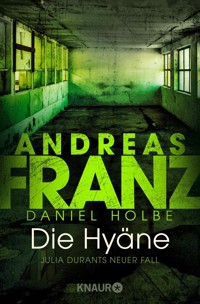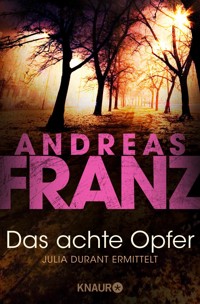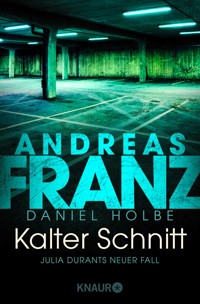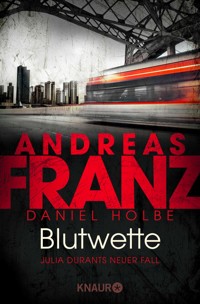Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter Brandt ermittelt
- Sprache: Deutsch
Als Oberstudienrat Schirner ermordet und grausam verstümmelt aufgefunden wird, reagiert seine Umgebung zunächst fassungslos: Der Lehrer war überall beliebt und führte eine glückliche Ehe. Hauptkommissar Peter Brandt beginnt gründlicher in Schirners beruflichem Umfeld zu recherchieren und entdeckt, dass an dem Gymnasium Dinge vorgingen, die offenbar nicht an die Öffentlichkeit dringen sollten. In diesem Roman begegnet dem Fan von Andreas Franz' Krimis ein neues Ermittlerduo: der unkonventionelle Hauptkommissar Peter Brandt und die coole Offenbacher Jung-Staatsanwältin Elvira Klein. Für Zündstoff sorgen ihre gegensätzlichen Charaktere - für Spannung die bewährte Hand des Erfolgsautors! Ein neues Ermittlerduo betritt die Bühne! Tod eines Lehrers von Andreas Franz: Spannung pur im eBook!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Franz
Tod eines Lehrers
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Epilog
Für alle Kinder.
Möge ihnen die Liebe und Zuwendung zuteil werden, die sie verdienen.
In ihren Händen liegt die Zukunft dieser Welt.
Und für alle Erwachsenen, auf dass sie die Kinder so behandeln, wie es ihnen gebührt, denn sie können sich nicht wehren.
Zerstört nicht das wertvollste Geschenk.
Rudolf Schirner hatte sich bereits seine Schuhe angezogen, wartete auf Wickerts obligatorisches Abschlusswort »Das Wetter« und sah sich als letzten Teil der Tagesthemen noch den Wetterbericht an, der auch für die nächsten Tage fast arktische, trockene Kälte mit viel Sonnenschein und sternenklare Nächte prognostizierte. Henry, sein Golden Retriever, lag neben dem Sessel, die Ohren gespitzt. Der Hund wusste, es war nur eine Frage von Minuten, bis sie ihr abendliches Ritual beginnen würden, er wartete nur noch auf die Schlussmelodie der Nachrichtensendung. Sie würden ziemlich genau eine Dreiviertelstunde laufen, hinüber zum Wald, und wie meist im Winter würden sie auch heute Nacht keinem Menschen mehr begegnen, denn in dieser Gegend ließ man mit Einbruch der Dunkelheit die Rollläden herunter, schloss die Haustüren ab und setzte sich vor den Fernseher oder las oder machte irgendetwas anderes, etwas, das man gerne in solchen Winternächten tat.
»Auf geht’s, mein Lieber.« Schirner gab Henry einen leichten Klaps auf den Rücken. »Dann wollen wir mal.« Er schaltete mit der Fernbedienung den Fernsehapparat aus und erhob sich. Die Tischlampe ließ er brennen. Henry wedelte aufgeregt mit dem Schwanz und blickte seinen Herrn erwartungsvoll an.
»Ist ja gut, wir gehen gleich. Aber erst zieh ich mir meinen Mantel und meinen Schal an, draußen ist es nämlich noch immer ziemlich kalt«, sagte Schirner liebevoll. Seine Frau Helga und sein Sohn Thomas schliefen längst, Carmen, die zwanzigjährige Tochter, studierte seit Oktober in Frankfurt, wo sie sich kurz vor Weihnachten gegen seinen Willen eine Wohnung genommen hatte und jetzt nur am Wochenende, an Feiertagen oder zu bestimmten Anlässen wie Geburtstagen nach Hause kam, obwohl sie gerade einmal eine gute halbe Stunde entfernt wohnte. Er hatte mit Engelszungen auf sie eingeredet, aber Carmen wollte sich nicht umstimmen lassen. Frankfurt, die Stadt des Lasters und der Verbrechen, so hatte er argumentiert, sei nichts für eine junge Frau, die praktisch auf dem Land groß geworden sei, denn als solches empfand er die geborgene Umgebung von Langen, wo er selbst schon seine Kindheit verbracht hatte und wo seine Wurzeln lagen. Doch alle Argumente hatten nichts geholfen, sie hatte dagegengehalten, dass es für alle besser sei, wenn sie in Ruhe studieren könne, wenn nicht der Krach lauter Musik aus Thomas’ Zimmer komme oder ihre Mutter frage, ob sie dies oder jenes erledigen könne.
Es war ein zeitaufwendiges Studium. Sie war im zweiten Semester, dreimal in der Woche hielt sie sich bis mindestens zwanzig Uhr in der Uni auf, manchmal sogar länger. Sie studierte Theologie, wozu auch die Fächer Latein, Altgriechisch und Hebräisch gehörten. Und Rudolf Schirner war, auch wenn er es nie zugeben würde, auf eine gewisse Weise stolz, eine Tochter zu haben, die sich nicht für einen dieser, wie er es nannte, profanen Studiengänge wie BWL oder Soziologie entschieden hatte, obgleich er es gerne gesehen hätte, wenn sie in seine Fußstapfen getreten wäre, um später als Lehrerin zu arbeiten. Doch ihr großes Ziel war es, eines Tages eine Gemeinde zu übernehmen und jeden Sonntag von der Kanzel zu predigen und sich um die großen und kleinen Sorgen und Nöte der Mitglieder zu kümmern. Sie schlug aus der Art, und er hatte keine Erklärung, warum es ausgerechnet Theologie sein musste, wo doch sonst keiner in der Familie mit Religion viel am Hut hatte. Aber Carmen war schon immer eine Einzelgängerin gewesen. Sie hatte bereits als Kind und Jugendliche die Bibel mehrfach geradezu verschlungen, war eifrig in die Kirche gegangen, hatte ihre Freizeit fast vollständig in den Dienst der Gemeindearbeit gestellt, und überhaupt schien Gott und die ihn umgebende mystische Aura, wie Rudolf Schirner es etwas abfällig bezeichnete, eine für ihn unerklärliche Faszination auf seine Tochter auszuüben. Jetzt lebte sie zusammen mit einer Kommilitonin in einer erstaunlich preiswerten, aber schmucken Zweizimmerwohnung in Uni-Nähe, telefonierte einmal täglich kurz mit ihrer Mutter, um ihr mitzuteilen, dass es ihr gut gehe, aber ansonsten sah und hörte man recht wenig von ihr.
Rudolf Schirner, fünfzig Jahre alt und einszweiundachtzig groß, dessen blondes, streng zurückgekämmtes Haar inzwischen licht geworden war, legte einen dicken Schal um seinen Hals, zog sich seinen Mantel über und leinte Henry an. Er liebte seinen Hund und die morgendlichen und nächtlichen Spaziergänge, während deren er sich entweder auf den Tag vorbereiten oder nach getaner Arbeit abschalten konnte.
Er zog leise die Tür hinter sich ins Schloss, nicht ohne vorher die Außenbeleuchtung angemacht zu haben, trat durch das Gartentor auf den Bürgersteig, ging vom Rotkehlchenweg hundert Meter geradeaus, bis er zur Hauptstraße kam, überquerte diese und bog nach weiteren fünfzig Metern rechts in den Wald ab, der linker Hand zum größten Teil zum Schloss Wolfsgarten gehörte und von einem scheinbar endlosen Zaun umgeben war. Die ersten Meter waren übersichtlich, doch nach gut hundertfünfzig Metern kamen die dicht an dicht stehenden Bäume, dazwischen über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entstandenes Unterholz und zwei kleinere, weniger gut begehbare Wege, die nach rechts abzweigten.
Die Temperatur war auf minus zwölf Grad gesunken, ein eisiger, böiger Wind, der aus allen Richtungen zu kommen schien, fegte übers Land, der Himmel war sternenklar, noch drei Tage bis Vollmond, der schon jetzt nur noch eine kaum erkennbare dunkle Kontur an der äußersten linken Seite aufwies. Alles war gefroren, der harte Boden knirschte leise unter seinen Schuhen. Er musste mehrfach kurz anhalten, damit Henry seine üblichen Markierungen machen konnte. Seit er hier wohnte, verging kein Abend, an dem er nicht mit dem Hund diese Strecke lief. Er tat dies mit ausgreifenden Schritten, seine Art, sich fit zu halten. Während der ersten Minuten ließ er den Tag Revue passieren und dachte auch an morgen, wenn er sechs Stunden am Stück unterrichten musste. Sein Beruf machte ihm Spaß, der Umgang mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an seiner Schule zum Glück noch so etwas wie Anstand und Respekt vor den Lehrern bewiesen. Seit fünfundzwanzig Jahren war er an der Schule, seit vierzehn Jahren Oberstudienrat, im fünften Jahr hintereinander Vertrauenslehrer, und vor drei Jahren wurde er zum stellvertretenden Direktor ernannt. Er unterrichtete Mathematik, Physik und Ethik, wobei sein Ethikkurs wesentlich stärker frequentiert war als der zeitgleich stattfindende Religionsunterricht seines Kollegen Baumann, der sich zwar redlich bemühte, es aber nicht schaffte, den beinahe erwachsenen Jugendlichen Gott und alles, was damit zusammenhing, wirklich nahe zu bringen. Für Schirner selbst war Gott nur eine Fiktion, etwas, das sich die Menschen im Laufe der Jahrtausende zusammengebastelt hatten, woran sie sich klammern konnten, das nicht greifbar war, weil es nicht aus Materie bestand, wovon sie sich aber erhofften, Es oder Er würde ihnen in Zeiten der größten Not beistehen. Schirner tat dies als Blödsinn ab, für ihn gab es keinen Gott, keinen Christus, zumindest nicht so, wie in der Bibel beschrieben und in späteren Zeiten glorifiziert. Er glaubte auch nicht an ein Jenseits, ein Leben nach dem Tod oder Wiedergeburt. Für ihn, einen überzeugten Existenzialisten und Atheisten, wurde man geboren, lebte und starb, um irgendwann zu Asche zu zerfallen. Seine Tochter Carmen dagegen war fest von der Existenz Gottes überzeugt, und er würde einen Teufel tun, sie davon abzubringen. Er hatte versucht ihr klar zu machen, dass es unmöglich ein Wesen geben könne, das zum einen im ganzen Universum und zum andern in jedem Einzelnen existierte. Das sei mathematisch und physikalisch schlicht unmöglich. Sein Versuch war fehlgeschlagen, und jetzt sollte sie ihren eigenen Weg gehen, und sicher würde sie eines Tages jene bittere Erfahrung machen, die ihr zeigte, dass sie nichts als einer Fata Morgana nachgelaufen war.
Er ging seit zehn Minuten mit leicht gesenktem Kopf in Gedanken versunken durch die mondhelle Nacht, Henry blieb zum x-ten Mal stehen, um das Bein zu heben, als Schirner eine dunkle Gestalt erblickte, die plötzlich aus dem zweiten Weg rechts um die Ecke kam. Schirner zog die Stirn in Falten und kniff die Augen zusammen – nur sehr selten traf er um diese Zeit noch einen andern Menschen an –, doch er hatte keine Angst, denn dies war eine sichere Gegend mit anständigen Bewohnern, und so gutmütig Henry auch war, so argwöhnisch verhielt er sich Fremden gegenüber. Die Gestalt kam näher, Schirner erkannte die Person, die leichte Anspannung wich, und ein Lächeln zeichnete sich auf seinem Gesicht ab.
»Hallo«, sagte er freundlich, »so spät noch unterwegs?«
»Ich konnte nicht schlafen. Noch ’ne Runde mit Henry drehen?«
»Wie jeden Abend. Ganz schön kalt, was?«
»Hm. Wenigstens ist es eine trockene Kälte, und damit verschwindet hoffentlich endlich mal das Ungeziefer. Ich muss jetzt aber los, mein Bett ruft. Schönen Abend noch«, sagte die ganz in Schwarz gekleidete Person, die von Henry, der an einem Baum schnüffelte, erst freudig begrüßt und jetzt nur noch nebenbei wahrgenommen wurde, ging weiter, blieb aber einen Moment später stehen, drehte sich um, kam noch einmal auf Schirner zu und sagte: »Ich hab was vergessen. Nur eine Frage …«
»Ja, was …«
Zu mehr kam Schirner nicht, er sah nicht den blitzschnell geführten Stoß kommen, die lange silberne Klinge, die ihn unvermittelt in den Bauch traf, immer und immer wieder. Er hatte die Augen weit aufgerissen, ein Stich nach dem andern drang in seinen Bauch und seine Brust. Ihm wurde schwindlig, er hatte das Gefühl, als würde er von allen Seiten attackiert, aber er nahm nur dieses eine Messer wahr. Alles um ihn herum verschwamm, er sank zu Boden, Blut rann aus seinem Mund, er bäumte sich noch dreimal auf, bis ein langes Zucken durch seinen Körper raste und auch dieses letzte Lebenszeichen aufhörte und Schirner mit gebrochenen Augen dalag.
Henry jaulte kurz auf und leckte dann über das tote Gesicht seines Herrn, bis ihm ein paarmal freundschaftlich auf die Schulter geklopft und er weggeführt wurde. »Komm, wir rennen ein bisschen, damit uns warm wird. Es ist wirklich schweinekalt.«
Peter Brandt, Hauptkommissar bei der Mordkommission Offenbach, zuständig für den Bereich Südosthessen, der von Bad Orb, Schlüchtern über Seligenstadt bis hinunter nach Langen reichte, wurde vom Telefon geweckt. Er blickte mit verschlafenen Augen zur Uhr, stieß einen derben Fluch aus, nahm den Hörer vom Apparat auf seinem Nachtschrank und meldete sich mit einem mürrischen und knappen »Ja?«.
»Hier Krüger, KDD. Schwing dich aus den Federn, Alter, es gibt Arbeit.«
»So früh? Was zum Teufel …«
»Ein Toter in Langen, auf einem Waldweg in der Nähe vom Schloss Wolfsgarten. Wurde vor einer guten halben Stunde gefunden. Soll ziemlich übel aussehen. Schau ihn dir an. Ein Streifenwagen steht an der Straße, damit du’s nicht verfehlst.«
»Wer ist vor Ort?«
»Im Moment nur Kollegen aus Langen. Ich hab denen schon gesagt, dass du in spätestens einer halben Stunde dort bist.«
»Bist du wahnsinnig?! Wie soll ich das in einer halben Stunde schaffen? Meinst du vielleicht, ich warte nur drauf, dass mitten in der Nacht jemand umgebracht wird? Ich bin in einer Stunde dort, richte denen das aus. Und die sollen nichts anrühren.«
»Okay, aber beeil dich.«
Krüger beendete einfach das Gespräch, Brandt brummte ein leises »Arschloch«, legte den Hörer zurück und setzte sich auf. Im Flur brannte bereits Licht. Er ging nur mit einem T-Shirt und einer Boxershorts bekleidet zum Badezimmer, doch die Tür war abgeschlossen. Brandt war einssiebzig groß oder klein, wie immer man es betrachtete, leicht untersetzt und doch muskulös, hatte volles dunkles, von vielen grauen Strähnen durchzogenes Haar und ein kantiges, leicht gebräuntes Gesicht mit einem markant hervorstehenden Kinn.
»Wer ist da drin?«, fragte er.
»Ich.«
»Sarah, bitte, lass mich ausnahmsweise zuerst rein.«
»Ich muss mich für die Schule fertig machen!«
»He, liebes Töchterchen, ich muss in fünf Minuten los, ein dringender Fall. Also mach schon auf.«
Sie öffnete die Tür und stand im Nachthemd vor ihm und sah ihn mit gekräuselter Stirn an, ein Zeichen ihrer Ungehaltenheit. Sarah war vierzehn und lebte seit der Scheidung von seiner Frau vor einem Jahr zusammen mit ihrer zwölfjährigen Schwester Michelle bei ihm, weil die Mädchen das so gewollt hatten. Ihre Mutter hatte zwar alle Hebel in Bewegung gesetzt, sie bei sich behalten zu können, doch als die Familienrichterin erfuhr, dass sie vorhatte, mit ihrem neuen Lover, einem stinkreichen Kunsthändler, eventuell nach Spanien zu ziehen und die Mädchen in ein Internat abzuschieben, wurde der Antrag auf alleiniges Sorgerecht abgeschmettert und dem Wunsch von Sarah und Michelle entsprochen, bei ihm zu wohnen. Als Brandt herausbekam, dass seine Frau nach dem schmutzigen Scheidungskrieg ihm die Töchter aus reiner Bosheit entziehen wollte, wurde er zum ersten Mal in seinem Leben richtig wütend. Niemals hätte er zugelassen, dass Sarah und Michelle in ein Internat abgegeben wurden, wo er sie maximal einmal im Monat für ein Wochenende hätte sehen können. Ein Internat war für ihn ein elitäres Gefängnis, in das reiche Leute ihre verwöhnten Kinder schickten.
Seine Ex hatte zwar Berufung eingelegt, indem sie die Begründung vorbrachte, er sei gar nicht in der Lage, gut für die Mädchen zu sorgen, da sein Beruf als Polizist mit den ungeregelten Arbeitszeiten das nicht zulasse, aber er führte als Gegenargument an, dass seine Eltern in der Buchhügelallee, die nur fünf Minuten zu Fuß von seiner Wohnung in der Elisabethenstraße entfernt war, wohnten und noch sehr rüstig waren und sich um Sarah und Michelle kümmern würden, wenn er einmal nicht zur Verfügung stand. Und das taten sie auch. Die Mädchen schliefen hin und wieder bei den Großeltern, meist jedoch in den eigenen Betten, weil Peter Brandt es fast immer schaffte, rechtzeitig zu Hause zu sein. Nach der Schule gingen die beiden in der Regel zu ihren Großeltern – außer wenn Brandt dienstfrei hatte –, aßen dort zu Mittag, machten ihre Hausaufgaben, trafen sich mit Freundinnen und wurden abends von ihrem Vater abgeholt. Sie führten ein relativ ruhiges Leben, jedenfalls ruhiger als zu den Zeiten, als ihre Mutter noch zur Familie gehörte, und sosehr Brandt die Trennung anfangs geschmerzt hatte, so wohler und befreiter fühlte er sich von Monat zu Monat.
»Wo musst du denn jetzt schon hin?«, fragte sie mürrisch. »Beeil dich bloß, ich verpass sonst meinen Bus.«
»Guten Morgen, liebste Sarah. Es gibt da einen Toten in Langen. Ich bin in fünf Minuten wieder draußen, und dann kannst du dich weiter deiner Schönheit widmen.« Er grinste, gab ihr einen Kuss auf die Stirn, drängte sich an ihr vorbei, erledigte seine Morgentoilette, wusch sich die Hände und das Gesicht, rasieren würde er sich erst am Abend. »Kannst du mir bitte zwei Toasts reinstecken?«
»Hm.«
Michelle kam verschlafen aus ihrem Zimmer, murmelte ein »Guten Morgen« und begab sich schnurstracks zum Gästeklo. Michelle hatte langes blondes Haar und war ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, was kein Nachteil war, ganz im Gegenteil, doch glücklicherweise zeigte sie bis jetzt nicht deren Allüren. Sarah hingegen war ein eher südländischer Typ und sah seiner Mutter sehr ähnlich, einer Italienerin, die allerdings schon seit fast fünfzig Jahren in Deutschland lebte. Während Michelle ein ruhiges und sanftes Wesen hatte, war Sarah manchmal recht zickig und aufbrausend, aber ihr Beleidigtsein oder ihre Wut hielt meist nur wenige Minuten. Es reichte schon, sie in den Arm zu nehmen und ihr ein paar nette Worte zuzuflüstern, um ihre schlechte Laune zu vertreiben.
Peter Brandt liebte seine Töchter über alles. Sie waren seit der Scheidung sein Lebensinhalt geworden, und er tat alles, um ihnen ein guter Vater zu sein. Auch wenn sein Beruf ihm häufig zu wenig Zeit für sie ließ, widmete er die wenige Zeit ganz und gar ihnen. Sie gingen ins Kino, ließen sich Pizza kommen, unterhielten sich über die Schule, und manchmal machten sie auch einfach nur Blödsinn.
Er brauchte keine fünf Minuten im Bad. Als er herauskam, sagte Sarah: »Wird es heute spät?«
Brandt schüttelte den Kopf und meinte: »Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin bestimmt nicht später als sechs wieder zu Hause. Und falls doch, sag ich Bescheid. Hast du mir die Toasts gemacht?«
»Klar doch, liebster Papa«, antwortete sie grinsend und verschwand wieder im Bad. »Was ist eigentlich mit der Daunenjacke?«, rief sie aus dem Bad.
»Welche Daunenjacke?«
Die Tür ging erneut auf, und Sarah steckte den Kopf heraus. »Ich hab dir doch schon am Wochenende gezeigt, dass meine im Arsch ist …«
»Sarah, bitte, nicht diese Ausdrücke«, sagte er mahnend. »Ja, ich kann mich vage erinnern. Wann wollen wir die kaufen?«
»Ich kann auch allein los, ich weiß ja, welche ich will.«
»Aha. Und welche?«
»Helly Hansen. Tragen fast alle in meiner Klasse.«
»Was heißt, fast alle? Zwei, drei?«
»O Mann, krieg ich die jetzt oder nicht?«
»Wie viel?«
»Hundertfünfzig«, antwortete sie leise.
»Hundertfünfzig Euro! Weißt du eigentlich, wie viel Geld das ist? Es gibt doch sicher auch Daunenjacken, die genauso warm sind, aber nicht mal die Hälfte kosten.«
»Die hält aber länger und sieht absolut geil aus. Bitte, bitte, bitte.«
Brandt atmete einmal tief durch. »Okay, ausnahmsweise. Aber ich hab jetzt kein Geld hier. Du kannst sie dir morgen kaufen.«
»Danke«, sagte sie strahlend und machte die Tür wieder zu. Und von drinnen: »Du bist und bleibst eben der beste Papa der Welt.«
Ja, ja, dachte er grinsend, solange die Kohle stimmt, ist man immer der beste Papa der Welt.
Sie hatte die Toasts bereits mit Schinken belegt, und das Glas Orangensaft stand neben dem Teller. Er aß im Stehen und gab, bevor er das Haus verließ, Michelle noch einen Kuss. Sarah war noch im Bad.
»Krieg ich auch so ’ne Jacke?«, fragte sie wie nebenbei und sah ihn an, wie eine Tochter ihren Vater eben ansah, wenn sie unbedingt etwas wollte. »In meiner Klasse haben auch die meisten ’ne Helly Hansen.«
»Ihr macht mich arm, wisst ihr das?«, seufzte er auf. »Irgendwann werden wir in einem Kellerloch hausen, ohne Strom, ohne Wasser, die Ratten werden an unsern Füßen nagen, und das alles nur, weil wir kein Geld mehr haben …«
»Sarah kriegt eine.«
»Okay, ausnahmsweise. Außerdem muss man ja bei der Kälte was Anständiges zum Anziehen haben. Ihr geht morgen zusammen los, und wehe, ihr kommt nicht mit einer Helly Hansen zurück oder wie immer das heißt. Und jetzt tschüs.«
Draußen schlug ihm der schon seit Tagen eisige böige Wind entgegen. Er war froh, unter die fellgefütterte Lederjacke noch einen Pullover angezogen zu haben. Um sechs Uhr dreiundfünfzig stieg er in seinen neuen Alfa 147 und raste los.
Helga Schirner wachte wie jeden Morgen pünktlich um halb sieben auf, streckte sich, öffnete als Erstes das Fenster, atmete genau fünfmal tief ein und aus und schloss es wieder. Sie ging ins Bad, setzte die Badekappe auf und stellte sich unter die Dusche. Dann trocknete sie sich ab, zog frische Unterwäsche an und den Morgenmantel darüber. Sie hatte wie immer tief und fest geschlafen und fühlte sich nun ausgeruht und bereit für den Tag. Sie begab sich ins Erdgeschoss, sah die Tischlampe im Wohnzimmer brennen, schüttelte den Kopf und schaltete sie aus. »Was für eine Stromverschwendung«, schimpfte sie leise und ging in die Küche, um das Frühstück für ihren Mann und ihren Sohn Thomas zu bereiten. Sie deckte den Tisch, holte Toast, Grahambrot, Butter, Marmelade und Honig aus dem Schrank, gab sechs gehäufte Löffel Kaffee und eine winzige Prise Salz in den Filter und stellte die Kaffeemaschine an. Dann machte sie das Radio an, und während sie leise einen Schlager aus den siebziger Jahren mitsang, hörte sie Geräusche aus dem ersten Stock und wie die Badezimmertür abgeschlossen wurde.
Um zehn nach sieben kam Thomas die Treppe heruntergetrampelt, wie er das immer zu tun pflegte, murmelte ein verschlafenes »Morgen« und setzte sich an den Tisch.
»Warum musst du eigentlich immer so trampeln? Kannst du nicht wie ein gesitteter Mensch gehen?«, sagte sie mit vorwurfsvoller Stimme.
Thomas Schirner, vierzehn Jahre alt, sah seine Mutter nicht einmal an und erwiderte auch nichts. Es war das typische morgendliche Ritual, sie moserte und er schwieg.
»Hat dein Vater heute später Schule?«, fragte Helga Schirner.
»Woher soll ich das denn wissen?«
»Er scheint lange wach gewesen zu sein, hat mal wieder das Licht im Wohnzimmer brennen lassen. Na ja, dann muss er heute wohl erst später los. Du hast sieben Stunden?«
»Wenn nichts ausfällt.«
»Schläft Henry wieder bei deinem Vater?«
»Mama, warum fragst du mich das?«, sagte Thomas genervt. »Schau doch selbst nach.«
»Mein kleiner Morgenmuffel. Schlecht geschlafen, was? Du solltest eben in Zukunft früher zu Bett gehen, dann bist du morgens auch schneller wach.«
»Mama, bitte …«
»Ist ja schon gut. Was willst du mit in die Schule haben?«
»Weiß nicht. Mach mir einfach wie immer zwei Brote und eine Banane.«
Um kurz vor halb acht verließ Thomas das Haus. Helga Schirner ging bis zur Treppe, warf einen Blick nach oben und überlegte, ob sie nach ihrem Mann sehen sollte. Sie schüttelte den Kopf und dachte: Er ist für sein Leben selbst verantwortlich, und wenn er zu spät kommt, dann hat er eben Pech gehabt. Sie räumte das benutzte Geschirr in die Spülmaschine, aß eine Scheibe Grahambrot mit Butter und Schnittlauch und trank dazu eine Tasse Kaffee mit wenig Milch und ohne Zucker. Um fünf nach acht klingelte es an der Tür. Sie runzelte die Stirn und fragte sich, wer das um diese frühe Stunde sein konnte. Als sie durch den Spion schaute, sah sie einen unbekannten Mann. Sie legte die Sicherungskette vor und machte die Tür einen Spaltbreit auf.
Es begann allmählich hell zu werden, Schaulustige hatten sich zum Glück noch nicht eingefunden. Am Tatort waren zwei Streifenwagen und vier Schutzpolizisten sowie fünf Beamte von der Spurensicherung, ein Notarzt und der Fotograf. Und Dieter Greulich, ein Kollege von der Mordkommission, Anfang dreißig und von der Sorte, die einem den ganzen Tag vermiesen können. Brandt wunderte sich, ihn hier zu sehen, und fragte sich, von wem er wohl die Information über den Mord erhalten hatte. Brandt kam mit jedem im Kommissariat gut aus, nur Greulich, dessen Name offenbar Programm war, war für ihn ein rotes Tuch. Obwohl erst seit einem Jahr bei der Kripo, wusste er alles besser und versuchte sich bei den Kollegen und vor allem bei der seit Januar in Offenbach tätigen Staatsanwältin Elvira Klein einzuschleimen, offensichtlich besessen von dem Gedanken, es so schnell wie möglich zum Hauptkommissar und leitenden Ermittler zu bringen. Greulich war das genaue Gegenteil von Brandt, ein Heißsporn, jähzornig, hinterhältig und bisweilen brutal, weshalb ihn Bernhard Spitzer, der Kommissariatsleiter, bereits einmal verwarnt hatte, nachdem er einen Verdächtigen während des Verhörs geschlagen hatte. Brandt versuchte die Anwesenheit von Greulich zu ignorieren, was natürlich nicht gelang, aber er würde sich seine ohnehin nur mittelmäßige Laune nicht noch mehr verderben lassen. Er wies sich wortlos gegenüber einem uniformierten Beamten aus, ging unter der Absperrung durch und auf den Toten zu. Er warf einen kurzen Blick auf ihn und fragte einen der Beamten: »Wer hat ihn gefunden?«
»Ein Jogger. Sitzt im Streifenwagen. Ihr Kollege war schon bei ihm.«
»Mein Gott, wer joggt denn bei dieser Saukälte so früh am Morgen? Was soll’s, wie heißt der gute Mann?«
»Wer, der Tote oder der …«
»Der Tote natürlich.«
»Rudolf Schirner. Wohnt gleich dort drüben in der Siedlung im Rotkehlchenweg.«
»Und woher wissen Sie das? Haben Sie ihn doch angerührt?«
»Nein, hab ich nicht, seine Brieftasche liegt neben ihm.«
»Wurde irgendwas am Tatort oder an der Leiche verändert?«
»Nein. Ich hatte selbstverständlich Handschuhe an, als ich die Brieftasche angefasst habe. Ich habe sonst wirklich nichts angerührt«, beteuerte den Angesprochene.
»Also kein Raubmord«, murmelte Brandt und fuhr sich mit einer Hand übers unrasierte Kinn.
»Das kann ich nicht sagen. In seiner Brieftasche war nur sein Ausweis, aber kein Geld, keine Kreditkarten und so weiter. Und ein Portemonnaie hatte er auch nicht. Könnte schon sein, dass man ihn ausgeraubt hat …«
»Und warum hat man ihm den Ausweis gelassen?«
»Vielleicht wollte uns der Täter helfen, damit wir ihn gleich identifizieren können«, erwiderte der Beamte lakonisch und mit dieser Prise Ironie, die Brandt gefiel. Er musste unwillkürlich grinsen.
»Wurden die Angehörigen schon verständigt?«
»Nein, wir wollten auf Sie warten. Außerdem wissen wir ja nicht mal, ob er überhaupt welche hat.«
»So wie der angezogen ist, hat er welche. Der hat eine Frau, die ihm die Hemden bügelt, den Anzug in die Reinigung bringt und die Schuhe putzt.«
»Und woher wollen Sie das wissen?«, fragte der Beamte erstaunt.
»Berufserfahrung. Alleinstehende schauen anders aus«, bemerkte Brandt trocken.
Greulich stellte sich neben Brandt und sagte: »Sieht ganz nach einem Ritualmord aus.«
»Aha. Und wie kommen Sie darauf?«
»Die vielen Einstiche, der abgeschnittene Pimmel. Das ist für mich ganz eindeutig ein Ritual, das der Täter vollzogen hat.«
»Und was glauben Sie, wer dahinter steckt? Satanisten, Teufelsanbeter, Hexen?«, fragte Brandt eher ironisch, was Greulich jedoch nicht zu bemerken schien.
»Wir müssen es rausfinden.«
»Schön, dann machen Sie sich schon mal an der Arbeit. Fahren Sie ins Präsidium, und ziehen Sie sich alle Vorgänge raus, die mit Ritualdelikten im Rhein-Main-Gebiet der letzten fünf, nein, besser zehn Jahre zu tun haben. Dazu suchen Sie sämtliche einschlägig vorbestraften Satanisten, Okkultisten … Sie wissen schon, Sie sind ja ein Fachmann.« Und als Greulich nicht gleich ging: »Ist noch was? Wir wollen den Fall doch so schnell wie möglich lösen. Und kein Wort an die Presse.«
»Bin schon unterwegs.«
»Moment noch. Was hat eigentlich der Jogger gesagt?«
»Nicht viel. Er dreht hier jeden Morgen ab Viertel vor sechs seine Runden. Ist übrigens ein Spieler von der Eintracht.«
»Auch das noch«, entfuhr es Brandt. »Haben Sie seine Personalien aufgenommen?«
»Natürlich. Hier«, antwortete Greulich und reichte Brandt einen Zettel.
»Bender. Der Junge ist viel zu schade für die Eintracht. Perlen vor die Säue geworfen.«
Greulich erwiderte nichts darauf, setzte sich in seinen Wagen und brauste davon, Brandt schaute ihm nach, bis er das Aufleuchten der Bremslichter an der Kreuzung sah, froh, ihn los zu sein. Er beugte sich über den Toten. Das Gesicht war von der Kälte blau angelaufen, die Gelenke starr, die Augen weit aufgerissen, das Entsetzen noch deutlich zu erkennen. Seine Hose war offen und blutdurchtränkt, seine Genitalien abgeschnitten. Brandt warf nur einen kurzen Blick darauf, winkte den Arzt zu sich heran und fragte: »Wie lange ist er schon tot?«
»Das ist bei der Kälte schwer zu sagen. Das müssen schon Ihre Gerichtsmediziner rausfinden. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier soll.«
»Wenigstens ungefähr.«
»Irgendwann heute Nacht. Der Typ ist zu ’nem Eisblock gefroren, wir hatten letzte Nacht so um die minus fünfzehn Grad.«
»Also gut«, sagte Brandt und bedeutete dem Fotografen und einem Beamten der Spurensicherung, näher zu treten, »mach deine Fotos und dann überlass der Spurensicherung das Feld. Ich erwarte bis heute Abend die ersten Resultate. Und ich werde mich jetzt mal mit dem Eintrachtler unterhalten und danach Frau Schirner einen Besuch abstatten. Und veranlasst, dass der Tote zur Sievers gebracht wird.«
Der junge Mann saß im Streifenwagen und sah Brandt an.
»Hallo, Herr Bender«, sagte Brandt. »Sie haben also den Toten entdeckt. Wann genau war das?«
»Ich hab nicht auf die Uhr geguckt, aber so gegen sechs.«
»Laufen Sie wirklich jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe hier rum?«
»Jeden Morgen. Ich muss mich fit halten, war lange verletzt. Und die Eintracht braucht mich wieder«, sagte er nicht ohne Stolz.
Hoffentlich schafft ihr den Aufstieg nicht, dachte Brandt, sprach es aber nicht aus. »Haben Sie ihn angerührt oder irgendwas verändert?«
»Scheiße, nein! Ich hab zum Glück mein Handy dabeigehabt und gleich die Polizei gerufen.«
»Und Sie sind auch sonst niemandem begegnet?«
»Nein, ich war ganz allein.«
»Okay, meine Kollegen nehmen Ihre Aussage noch zu Protokoll, dann können Sie gehen. Und viel Glück für den Rest der Saison. Ich glaube aber eher, dass Mainz es packt«, konnte sich Brandt doch nicht verkneifen zu sagen. »Ach ja, noch was – die Presse wird Ihnen Fragen stellen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie keine Details schildern. Sie wissen ja, wie diese Heinis sind.«
»Kein Wort. Und wir steigen doch auf.«
Brandt grinste Bender an, stieg wieder aus, ließ sich von einem der Schutzpolizisten erklären, wie er am schnellsten in den Rotkehlchenweg kam, und machte sich auf den Weg. Um fünf nach acht klingelte er an der Tür des Einfamilienhauses. Auf einem kitschigen Schild stand »Herzlich willkommen«.
Brandt hörte, wie von innen die Sicherungskette vorgelegt und die Tür einen Spaltbreit geöffnet wurde. Er hielt seinen Ausweis hoch und sagte: »Mein Name ist Brandt, Kripo Offenbach. Dürfte ich bitte kurz reinkommen?«
»Kriminalpolizei? Kann ich bitte noch einmal Ihren Ausweis sehen?«
Brandt hielt ihn erneut hoch, Helga Schirner warf einen langen Blick darauf, entriegelte die Kette und machte die Tür auf.
»Was wollen Sie von mir? Hat mein Sohn etwas angestellt, oder ist etwas mit meiner Tochter?«, fragte sie mit diesem speziellen Ausdruck in den Augen, den Brandt schon von einigen anderen Angehörigen kannte, denen er eine Todesnachricht überbringen musste. Ein Ausdruck, der aus Angst und einer bösen Ahnung bestand.
»Nein«, antwortete Brandt und trat in die warme Wohnung ein. »Können wir uns setzen?«
»Bitte, hier im Wohnzimmer«, sagte Helga Schirner, ging vor Brandt in das mit antiken Möbeln ausgestattete Zimmer und bat ihn, Platz zu nehmen.
»Frau Schirner, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann tot ist.« Er beobachtete die Reaktion der Frau, die bis eben gestanden hatte, sich jetzt aber langsam hinsetzte und Brandt ungläubig anstarrte, ein Blick, der Bände sprach.
»Was sagen Sie da? Mein Mann ist tot? Das kann nicht sein, er ist doch oben und schläft noch.«
»Sind Sie da sicher?«
Helga Schirner schluckte schwer und schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie kaum hörbar, »bin ich nicht. Ich habe mich schon gewundert, dass er nicht zum Frühstück runtergekommen ist, aber ich dachte, er hätte vielleicht später Schule.«
»Ihr Mann ist Lehrer?«
»Ja. Wo ist mein Mann jetzt?«
»Auf dem Weg in die Rechtsmedizin. Sind Sie in der Lage, mir ein paar Fragen zu beantworten?«
Helga Schirner nickte. Sie saß aufrecht da, die Beine eng aneinander gelegt, die Hände gefaltet. Ihre Mundwinkel zuckten, Tränen liefen ihr übers Gesicht.
»Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend. Ich gehe jeden Abend um zehn zu Bett, er sieht sich immer noch die Tagesthemen an und dreht danach mit dem Hund die übliche Runde.«
»Und als Sie heute früh aufgestanden sind, ist Ihnen da nicht aufgefallen, dass seine Seite leer ist?«
Sie sah Brandt an, als hätte sie die Frage nicht richtig verstanden, bevor sie antwortete: »Wir haben schon seit einigen Jahren getrennte Schlafzimmer. Ich brauche meinen Schlaf, und er geht nie vor Mitternacht ins Bett. Das hat mich gestört und … Wie ist er gestorben?«
»Er wurde umgebracht.«
»Umgebracht? Mein Gott! Wie wurde er …?«
»Wie es aussieht, wurde er erstochen. Sie sagen, dass er mit dem Hund draußen war. Ich habe aber keinen Hund gesehen.«
»Henry, ein Golden Retriever. Er hätte niemals zugelassen, dass meinem Mann etwas angetan wird.«
»Ist Henry ein friedlicher Hund?«
»Er ist nicht bösartig, doch Fremden gegenüber ist er erst mal distanziert und beobachtet sie. Aber er hat noch nie zugebissen.«
»Dann ist er also doch ein friedlicher Hund.«
»Ja.«
»Hatte Ihr Mann Feinde?«
»Nicht dass ich wüsste. Mein Gott, was soll jetzt bloß werden? Wie soll ich das nur den Kindern erklären? Rudolf ist tot? Ich hab doch für ihn noch den Frühstückstisch gedeckt«, sagte sie und brach unvermittelt in Tränen aus. »Und ich habe immer gedacht, warum nimmt er diesen finsteren Weg. Tagsüber ist es dort ja ganz schön, aber nachts würde ich nie … Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Wie soll das bloß weitergehen?«
»Brauchen Sie einen Arzt?«, fragte Brandt behutsam.
»Ich weiß nicht. Rudolf war doch so ein gutmütiger Mann. Er war bei allen beliebt und hat geholfen, wo er nur konnte. Ich begreife das alles nicht. Warum er? Warum ausgerechnet er? Er hat doch keiner Fliege was zuleide getan, war immer freundlich und hat keinem etwas Böses gewollt. Sie können fragen, wen Sie wollen, Sie werden immer die gleiche Antwort bekommen. Er war doch nur ein Lehrer. Wir haben keine Reichtümer und auch mit keinem unserer Nachbarn Streit gehabt …«
»In welcher Schule hat Ihr Mann unterrichtet?«
»Im Georg-Büchner-Gymnasium, in der Oberstufe. Ich halt das nicht aus, ich glaube, ich drehe durch. Ich muss in der Schule anrufen und Bescheid geben, dass mein Mann heute nicht kommt«, sagte sie mit verwirrtem Blick, sprang auf und wollte bereits zum Telefonhörer greifen, doch Brandts Stimme hielt sie zurück.
»Nein, nein, das brauchen Sie nicht, das übernehmen wir schon. Haben Sie einen Hausarzt?«
»Ja, Dr. Müller«, sagte sie unter Tränen.
»Ich würde es für gut halten, wenn er herkommt und Ihnen etwas zur Beruhigung gibt. Haben Sie seine Nummer griffbereit?«
»Auf dem Telefontisch das braune Register«, sagte sie mit tonloser Stimme.
Brandt suchte die Nummer heraus und rief in der Praxis an. Er ließ sich mit dem Arzt verbinden und bat ihn, so schnell wie möglich vorbeizukommen.
»Er wird gleich hier sein. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch eine Frage stellen. Hat sich Ihr Mann in letzter Zeit auffällig verhalten oder war er anders als sonst?«
Helga Schirner schüttelte den Kopf. »Nein, das hätte ich gemerkt.«
»Und es gab auch keine besonderen Vorfälle wie anonyme Anrufe oder sonstige Drohungen?«
»Nein, wenn ich es doch sage. Es war alles wie immer. Ich kann das alles nicht begreifen.«
»Hat Ihr Mann immer seine Brieftasche und sein Portemonnaie bei sich gehabt, wenn er das Haus verließ?«
»Ja, ich denke schon.«
»Hatte er Kreditkarten oder größere Mengen Bargeld bei sich?«
»Er hatte nur eine EC-Karte und eine Eurocard. Und Bargeld selten mehr als fünfzig oder sechzig Euro.«
Dr. Müller kam nur zehn Minuten nach dem Anruf. Brandt schilderte ihm in kurzen Worten, was vorgefallen war, der Arzt, der die Schirners offenbar schon lange kannte, sprach mit Helga Schirner, die aber seine Worte kaum noch wahrzunehmen schien. Er zog eine Spritze mit einem Beruhigungsmittel auf und injizierte die Flüssigkeit in die Armvene, was sie sich widerstandslos gefallen ließ. Er wartete noch fünf Minuten, bis das Mittel wirkte und Helga Schirner die Augen zufielen und sie gleichmäßig atmete.
»Was haben Sie ihr gegeben?«, fragte Brandt.
»Das Übliche in solchen Fällen, zehn Milligramm Valium. Das wird aber nicht lange vorhalten. Am besten wäre es, sie hätte jemanden, der sich um sie kümmert.«
»Kennen Sie denn jemanden?«
»Sie hat einen vierzehnjährigen Sohn und eine Tochter, Carmen, die in Frankfurt studiert und wohnt. Ich nehme an, dass die Nummer im persönlichen Telefonbuch steht.«
»Danke, ich werde versuchen sie zu erreichen.«
Dr. Müller packte seine Tasche zusammen und fuhr zurück in die Praxis. Peter Brandt fand die Nummer von Carmen Schirner in dem kleinen Telefonbuch. Ein Blick auf die Uhr, zehn vor neun. Vielleicht habe ich Glück und erwische sie noch zu Hause, dachte er, ansonsten probiere ich es auf ihrem Handy.
Er war erleichtert, als sie schon nach dem zweiten Klingeln abnahm. Er schilderte ihr kurz, was geschehen war, und sie versprach, sich sofort auf den Weg zu machen. Brandt blieb noch ein paar Minuten bei Helga Schirner, die die Augen wieder halb geöffnet hatte und ihn wie in Trance ansah. Er hatte in den vergangenen zwanzig Jahren schon etliche Todesnachrichten überbringen müssen, aber es war jedes Mal wieder anders, jedes Mal wieder neu, doch immer unangenehm.
Er zog leise die Tür hinter sich zu und begab sich noch einmal zum Tatort, wo die Spurensicherung eifrig bei der Arbeit war.
»Und, wie schaut’s aus?«, fragte Brandt.
»Also wenn du so was wie Sohlenabdrücke erwartest, bei dem knüppelharten Boden keine Chance. Ich glaub, das hier ist alles umsonst.«
»Und Schirner ist in der Rechtsmedizin?«
»Ist vorhin abgeholt worden.«
»Ich zieh Leine. Und friert euch nicht den Arsch ab.«
»Scherzkeks.«
Peter Brandt fuhr ins Präsidium, wo er bereits von seinem Chef und besten Freund Bernhard Spitzer erwartet wurde. Sie waren vor gut fünfundzwanzig Jahren zusammen zur Polizei gekommen, hatten auf demselben Revier Dienst geschoben, hatten gleichzeitig die Polizeischule besucht. Der Unterschied war nur, dass Spitzer sich im Büro am wohlsten fühlte, während Brandt es nur widerwillig betrat.
Und?«, wurde er von Spitzer empfangen, der hinter seinem Schreibtisch saß, eine dampfende Tasse Kaffee vor sich.
»Ich brauch jetzt auch erst mal einen Kaffee«, sagte Brandt, holte seine Tasse, schenkte sich ein und setzte sich Spitzer gegenüber.
»Wieso hast du Greulich hergeschickt, damit der alle Akten durchwühlt, die mit Satanisten und so ’nem Kram zu tun haben?«, fragte Spitzer grinsend, da er die Antwort schon kannte.
»Weil er was zu tun braucht. Ritualmord! Das war kein Ritualmord, Schirner wurde kaltblütig abgestochen.« Er nippte an seinem heißen Kaffee und wärmte sich an der Tasse die Hände.
»Und warum kann es deiner Meinung nach kein Ritualmord sein?«
»Weil der Täter eben auf bestimmte Rituale verzichtet hat. Der hat ihn nur kastriert, die Teile aber nicht mitgenommen.« Er zuckte mit den Schultern und fuhr sich übers Kinn. »Ich habe es in meiner Laufbahn zweimal mit Ritualmorden zu tun gehabt, und da sahen die Opfer ganz anders aus. Außerdem lassen Ritualmörder, wie gesagt, meistens die Teile nicht beim Opfer, sondern nehmen sie entweder als Souvenir mit oder essen sie. Ist auch egal. Der Typ ist Lehrer, das heißt, er war Lehrer, und ich denke, wir sollten uns zunächst mal in der Schule umhorchen. Seine Frau beschreibt ihn als überaus beliebt, freundlich und so weiter. Aber für meine Begriffe steckt mehr dahinter als nur ein simpler Mord, auch wenn Raubmord nicht ganz ausgeschlossen werden kann, weil in seiner Brieftasche nur sein Personalausweis war und auch sein Portemonnaie fehlt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Mord geplant war. Dafür spricht auch, dass der Hund verschwunden ist.«
»Welcher Hund?«
»Schirner ist jeden Abend nach den Tagesthemen noch eine Runde mit ihm gelaufen. Und wie seine Frau sagt, hat er dabei immer denselben Weg genommen. Es könnte also sein, dass jemand auf ihn gewartet hat. Jemand, der genau wusste, dass Schirner um eine bestimmte Uhrzeit dort vorbeikommen würde. Aber angeblich hatte er keine Feinde und hat sich in letzter Zeit auch nicht auffällig verhalten. Ich hab seine Frau alles gefragt, was ich in dem Moment fragen konnte. Dazu eben die Sache mit dem Hund. Offensichtlich ist er verschwunden. Ich nehme fast an, der Täter hat ihn mitgenommen, sonst wäre er wohl nach Hause gelaufen. Aber da er Fremden gegenüber angeblich misstrauisch ist, muss es jemand sein, den er kennt und der ihm vertraut ist. Oder er wurde ebenfalls getötet und woanders abgelegt. Was soll’s, das Puzzle werden wir auch noch zusammensetzen.« Er hielt inne und sagte nach einem Moment des Nachdenkens: »Wenn ich in die Schule fahr, will ich mit Nicole zusammenarbeiten. Als ich Greulich heute Morgen gesehen habe, ist mir schon wieder die Galle hochgekommen.«
»Du kannst Nicole haben. Hast du schon eine Vermutung, wo du ansetzen könntest?«
»He, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich bin kein Hellseher und auch kein Prophet. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen ein Motiv finden, denn irgendwer muss Schirner auf den Tod gehasst haben. Im wahrsten Sinn des Wortes.«
Brandt griff zum Telefon und tippte die Nummer der Rechtsmedizin in Frankfurt ein, wohin alle ungeklärten Todesfälle aus dem Zuständigkeitsbereich der Offenbacher Kripo gebracht wurden. Dr. Andrea Sievers meldete sich, eine gerade mal zweiunddreißigjährige Pathologin, die Brandt schon von dem Tag vor gut drei Jahren an leiden mochte, als sie vom Chef als die neue Mitarbeiterin vorgestellt worden war, vielleicht, weil sie den gleichen morbiden Humor hatten, vielleicht aber auch, weil sie anders war als die Frauen, die er kannte, ohne dass er dieses Anders hätte definieren können. »Peter hier, hi, ich wollte nur mal fragen, ob du schon den Eisblock auf den Tisch gekriegt hast.«
»Aber sicher doch, der Eisblock taut grade auf. Was willst du denn wissen?«
»Zum Beispiel, wie oft zugestochen und was für eine Klinge benutzt wurde.«
»Willst du Vermutungen oder Ergebnisse haben?«, fragte Andrea Sievers. »Wir haben’s gerade mal geschafft, ihm die Klamotten auszuziehen, und jetzt fangen wir ganz langsam an zu zählen. Aber du kannst ja rüberkommen und mithelfen.«
»Bin schon unterwegs.« Er legte auf und sagte zu Spitzer: »Ich mach mich ab in die Pathologie und nehm Nicole gleich mit. Danach schauen wir uns mal in der Schule des werten Herrn Schirner um.«
Peter Brandt ging in das Büro nebenan, wo Nicole Eberl am Computer saß. Sie blickte auf und sagte: »Guten Morgen. Du siehst müde aus. Schlecht geschlafen?«
»Haha. Wie würdest du dich wohl fühlen, wenn du mitten im schönsten Traum aus dem Bett geklingelt wirst? Du kannst deinen PC übrigens ausmachen, wir fahren in die Rechtsmedizin und anschließend in die Schule.«
»Schule?«
»Schirner war Lehrer. Seine Frau kann sich so gar nicht vorstellen, wer ihn umgebracht haben könnte. Sie hat das ganze Programm vom tollen Ehemann runtergespult. Aber sie haben in getrennten Betten geschlafen, und bei so was klingeln bei mir gleich alle Glocken. Wenn sich zwei Menschen lieben, dann schläft man auch in einem Bett. Klingt vielleicht altmodisch, aber so bin ich nun mal.«
»Ich kenne einige Ehepaare, die getrennt schlafen und sich trotzdem blendend verstehen.«
»Und fremd bumsen.«
»Alter Zyniker.«
Nicole Eberl, achtunddreißig Jahre alt, verheiratet, ein Kind, fuhr den PC runter, kam hinter ihrem Schreibtisch hervor und zog sich ihre Daunenjacke über. Sie war etwas kleiner als Brandt, hatte kurzes dunkelblondes Haar und freundliche blaue Augen. Sie war sehr schlank, fast androgyn, keine Schönheit, aber beileibe nicht unansehnlich, die meisten würden sagen, markant. Ihre Gesichtszüge waren eher herb, die Hände ähnelten Männerhänden. Das Wichtigste für Brandt aber war, sie gehörte zu den liebenswürdigsten Menschen, die er jemals kennen gelernt hatte. Ihr Mann war Architekt, der von zu Hause aus arbeitete und mit dem sich Brandt ebenfalls gut verstand. In ihrer Freizeit verfasste sie Kurzgeschichten und Kinderbücher, von denen drei bereits veröffentlicht wurden, für das letzte hatte sie sogar einen Preis erhalten, und sie konnte fast so gut kochen wie Brandts Mutter. Ihre Ehe war kinderlos geblieben, weil ihr Mann zeugungsunfähig war, aber vor zehn Jahren hatten sie ein Mädchen aus Indien adoptiert, das sich prachtvoll entwickelte und irgendwann eine richtige Schönheit sein würde. Das Mädchen war mittlerweile dreizehn und schon jetzt ein echter Hingucker, weil sie älter und reifer wirkte als die meisten andern in ihrem Alter. Älter und reifer als Sarah, die eher wie eine Zwölfjährige aussah.
»Ich bin fertig«, sagte sie, warf einen letzten Blick zurück, um sich zu vergewissern, dass auch alles an seinem Platz war. Sie war die personifizierte Ordnungsliebe und hielt im Gegensatz zu Brandt ihren Schreibtisch stets aufgeräumt. Seit über zehn Jahren arbeiteten sie zusammen. Mittlerweile hatte sie es zur Oberkommissarin gebracht, und spätestens mit vierzig würde sie zur Hauptkommissarin befördert werden. Sie hatte eine sanfte, gutmütige Art und war im Kommissariat der ruhende Pol. Selbst in den hektischsten Situationen behielt sie den Überblick und schaffte es, auch mit den miesesten Zeitgenossen zurechtzukommen, indem sie immer freundlich war und jeden gleich behandelte. Selbst Greulich hatte gegen ihren Charme keine Chance. Für Brandt war sie genau das Gegenteil von diesem Schleimer und Kriecher, dessen Mobbingaktivitäten er aufmerksam verfolgte. Noch hielten sich diese in Grenzen, aber dennoch würde er ihm bei Gelegenheit eine Lektion erteilen.
»Was hast du denn mit Greulich vor?«, fragte sie auf dem Weg zum Auto. »Der ist ja wie wild am Recherchieren.«
»Ich will ihn einfach nur aus dem Weg haben. Er ist überzeugt, dass es ein Ritualmord ist, und diese Überzeugung kann ich dem armen Jungen doch unmöglich zerstören. Ich hab ihm lediglich gesagt, er soll alles, was mit Satanisten, Hexen und so weiter zu tun hat, raussuchen und sich nach auffällig gewordenen Personen umsehen. Damit ist er erst mal beschäftigt. Er soll die Akten der letzten zehn Jahre bearbeiten.«
»Er ist schon ein Typ, der es einem schwer macht, ihn gern zu haben.«
»Den Kerl werde ich in meinem ganzen Leben nicht gern haben. Dieses Arschloch geht mir einfach nur tierisch auf den Senkel. Ich begreife gar nicht, wieso Bernie ihn überhaupt noch in unserer Abteilung arbeiten lässt.«
»Wie oft soll ich dir das noch sagen, der Junge hat Rückendeckung von ganz oben. Und ich wette mit dir, die Klein weiß längst über den Fall Bescheid, zumindest hat unser lieber junger Kollege vorhin schon telefoniert, vorher aber seine Tür zugemacht. Ich hab zwar nur ein paar Wortfetzen mitbekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es die Klein war.«
»Dieser kleine stinkende Bastard!«, fluchte Brandt. »Seit der in unserer Abteilung ist, läuft nichts mehr so rund wie früher. Ich fühl mich ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich wohl. Manchmal würde ich am liebsten den ganzen Kram hinschmeißen.«
»Jetzt mach’s aber mal halblang! Du wirst dich doch von so einem wie ihm nicht unterkriegen lassen. Wenn nicht anders, drehen wir das so, dass er irgendwann freiwillig geht.«
»Das schaffen wir nie. Bernie müsste sich was einfallen lassen …«
»Aber solange sich unser junger Kollege nichts Gravierendes zuschulden kommen lässt, so lange sind Bernie die Hände gebunden.«
»Aber ich garantiere dir, wenn der noch einmal hinter meinem Rücken etwas veranstaltet, knall ich ihm eins vor die Birne, und dann ist es mir scheißegal, ob die werte Frau Staatsanwältin mir was reinwürgt. Die Staatsanwaltschaft zu informieren ist die Aufgabe von Bernie oder mir. Irgendwann krall ich ihn mir wirklich, und dann gnade ihm Gott.«
»Ausgerechnet du«, sagte sie mit einem Lachen, das weder spöttisch noch verletzend war, weshalb er ihr auch nicht böse sein konnte, und setzte sich auf den Beifahrersitz. »Er ist jung und unerfahren …«
»Nee, nee, das zieht bei mir nicht. Der ist gerade mal dreißig, war vier Jahre beim Bund und meint die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Merkst du eigentlich gar nicht, was der vorhat?«
»Was denn?«, fragte sie mit Unschuldsmiene.
»Der will uns alle gegeneinander ausspielen, so was lernt man beim Bund. Und jetzt ist Schluss mit dem Thema, sonst gerate ich noch mehr in Rage.«
Auf der Fahrt in die Rechtsmedizin unterhielten sie sich über Brandts Töchter Sarah und Michelle, über die Katze, die sich Michelle so sehnlichst wünschte, und über die schulischen Leistungen der Mädchen.
Nicole Eberl kannte die ganze Ehegeschichte von Brandt, sie hatte mitbekommen, wie er seine Frau kennen gelernt und schon nach zwei Monaten geheiratet hatte, doch die Ehe stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Seine Frau war eine rast- und ruhelose Person, die das wenige Geld mit vollen Händen ausgegeben und sich ein ums andere Mal darüber beschwert hatte, dass Brandt nicht mehr unternahm, um auf der Karriereleiter weiter nach oben zu klettern, obwohl sie genau wusste, dass es nur sehr wenige Stufen bei der Polizei gab. Über A 12 kamen die wenigsten hinaus, manche schafften es auch bis A 13, aber selbst mit dieser Gehaltsklasse waren keine Reichtümer anzuhäufen. Doch Brandt war zufrieden mit seinem Leben und hatte geglaubt, mit der Geburt von Sarah und zwei Jahre später von Michelle würde sich alles zum Guten wenden, aber genau das Gegenteil war eingetreten. Sechs Jahre lang kriselte es in der Ehe, bis sie vor zweieinhalb Jahren eines Tages einfach weg war. Sie hatte ihre Sachen gepackt, die Mädchen zusammen mit ihrem Geliebten, den sie schon seit mehr als zwei Jahren hatte und von dem Peter Brandt nicht den Hauch einer Ahnung gehabt hatte, von der Schule abgeholt und war erst einmal untergetaucht. Und das war der Moment gewesen, als Brandt zu kämpfen begann. Und jetzt, nachdem alles gerichtlich geregelt war, war er glücklich, vor allem, wenn er sah, wie gut sich Sarah und Michelle entwickelten. Nicole Eberl mochte Brandt und seine ruhige, manchmal brummige Art.
»Sarah hat mich gefragt, ob sie eine Helly noch was Jacke bekommt.«
»Helly Hansen«, sagte Eberl und deutete auf den Schriftzug auf ihrer Jacke. »Bei dem Wetter geradezu ideal. Und?«
»Ist das eigentlich bei allen Mädchen so, dass sie irgendwann nur noch auf die Marke gucken?«
»Bei den meisten. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Mit dem Alter steigen die Ansprüche. Und Sarah ist immerhin vierzehn.«
»Als ich vierzehn war …«
»Ja, ja, als du vierzehn warst, da hast du die Klamotten von deinem Bruder aufgetragen …«
»Ich hab keinen Bruder.«
»Du darfst das nicht vergleichen. Wir sind beide eine andere Generation. Heutzutage zählen eben Markenklamotten.«
»Hundertfünfzig Euro für eine Jacke, die in einem Jahr schon wieder out ist! Und Michelle will natürlich auch eine.«
»Frag doch deine Ex, ob sie die Jacken spendiert, Geld genug hat sie doch.«
»Das wäre so ziemlich das Letzte, was ich tun würde. Nee, nee, die bekommen ihre Jacken von mir. Ich wollte nur mal deine Meinung dazu hören. Sind die wirklich so warm?«
»Sind ganz okay, gibt aber auch preiswertere, die genauso warm halten. Kauf sie ihnen, und du hast erst mal Ruhe, und vor allem hast du die beiden glücklich gemacht.«
»Ich hab’s ihnen ja schon versprochen.«
Brandt fand eine Parklücke in der Paul-Ehrlich-Straße. Sie betraten das alte Gemäuer des Instituts für Rechtsmedizin. Schon auf der Treppe ins Untergeschoss strömte ihnen der typische Geruch von Verwesung und aufgeschnittenen Leichen entgegen, ein Geruch, der sich in sämtlichen Ritzen des alten Gebäudes festgesetzt hatte. Brandt und Eberl zogen sich grüne Kittel und Latexhandschuhe an und begegneten kurz darauf Prof. Bock, der ihnen sagte, wo seine Kollegin Andrea Sievers zu finden sei.
»Hi, da sind wir«, begrüßte Brandt die junge Ärztin, die sich einige Notizen machte, aber sofort den Block und den Stift beiseite legte. Sie war nur knapp über einssechzig, zierlich, hatte, so viel man unter dem weit geschnittenen grünen Anzug erkennen konnte (Brandt hatte sie noch nie anders gesehen), eine ansehnliche Figur und ein hübsches, ebenmäßiges Gesicht mit Augen, die immer dann aufblitzten, wenn sie Brandt sah. Sie hatte bis zu den Schultern reichendes hellbraunes Haar, das hinten zu einem Zopf gebunden war, und fein geschwungene Lippen, doch das Schönste an ihr war ihr Lachen, bei dem sich niedliche Grübchen neben den Mundwinkeln bildeten.
»Auch hi. Seine Farbe verändert sich allmählich. Wenn der sich jetzt im Spiegel sehen könnte«, sagte sie mit jenem makabren Humor, der anscheinend allen Pathologen in die Wiege gelegt war, und zündete sich eine Zigarette an.
»Doch ansonsten ist er ganz gut in Schuss, oder?«, meinte Nicole Eberl.
»Kann ich erst beurteilen, wenn ich ihn aufgemacht habe. Aber das abgeschnittene Stück Männlichkeit, das ihr da mitgeschickt habt … Ich hab schon Besseres zu Gesicht bekommen. Letztens hatte ich einen hier, mein lieber Scholli, da wären neunundneunzig Prozent aller Männer vor Neid erblasst und die meisten Frauen … Na ja, ihr seid einen Tick zu spät, wir sind mit dem Zählen schon fertig.«
»Und, wie viele habt ihr gezählt?«
»Dreiundachtzig.«
»Aber hallo, da muss einer ja einen ganz schönen Brass auf den lieben Herrn gehabt haben. Bist du sicher, dass ihr euch nicht verzählt habt? Ich sehe doch auf den ersten Blick, dass …«
»Kannst gleich aufhören«, wurde er von Andrea Sievers unterbrochen. »Vorne sind’s neununddreißig, hinten vierundvierzig.«
Brandt zog die Stirn in Falten. »Der hat auch von hinten was abgekriegt?«
»Von vorne und von hinten.«
»Moment, das würde ja heißen, dass wir es mit zwei Tätern zu tun haben.«
»Kann, muss aber nicht. Wir hatten hier schon mal so einen Fall, wo eine Frau ihren Mann regelrecht massakriert hat, während er schlief. Im Todeskampf hat er sich gedreht, und da hat sie von hinten weitergemacht. Sie hat so lange auf ihn eingestochen, bis ihr die Puste ausging. Aber vielleicht kriegen wir anhand der Einstichkanäle mehr raus. Wenn zum Beispiel einer der Täter sehr groß und der andere kleiner war, dann verlaufen die Kanäle bei dem Größeren von oben nach unten oder ziemlich grade, beim Kleineren aber von unten nach oben, da Schirner ja selbst über einsachtzig ist. Er wurde auf dem Rücken liegend gefunden, da ist es natürlich auch möglich, dass die ersten vierundvierzig Stiche von hinten geführt wurden, dann hat man ihn umgedreht und noch mal von vorne eins draufgesetzt. Übrigens waren über sechzig der Stiche tödlich. Der Typ ist ziemlich ausgeblutet. Auch möglich, dass von vorne und hinten …«
»Sonst noch irgendwas?«
»Noch nicht. Wir schnippeln ihn jetzt auf. Ihr könnt ja hier bleiben und das Ergebnis gleich mitnehmen«, sagte sie grinsend, weil sie wusste, wie sehr Brandt sich davor ekelte, und drückte die ausgerauchte Zigarette in einem kleinen Aschenbecher aus. Brandt hatte sich schon vor Jahren das Rauchen abgewöhnt, aber in dieser Umgebung empfand er jeden Geruch, der nicht von den Leichen kam, als Balsam für seine Nase.
»Nee, danke«, sagte Brandt und schüttelte den Kopf. »Schände du weiter deine Leichen, wir haben noch was anderes zu tun. Wir sehen uns.«
»Kann ich dich mal kurz unter vier Augen sprechen? Nur ganz kurz.«
»Klar.«
Andrea Sievers ging mit Brandt in einen Nebenraum und sagte leise und mit einem beinahe unwiderstehlichen Augenaufschlag: »Wann löst du eigentlich dein Versprechen endlich ein? Ich meine, wann gehen wir essen? Ich dachte so an Freitag, danach kommt ein langes Wochenende. Und du hast doch bestimmt auch keine Bereitschaft, oder?«
»Doch, ich hab bis Freitag Bereitschaft. Aber ich ruf dich heute noch an, ob’s klappt. Bis dann und ciao.«
»Du rufst ja doch nicht an, Feigling.«
»Okay, okay, am Freitag. Und du darfst sogar das Lokal bestimmen.«
»Lokal«, sagte sie abfällig. »Restaurant, wenn schon, denn schon. So richtig schön mit Wein und guter Musik. Ich kenne da einen hervorragenden Laden in Sachsenhausen.«
»In Offenbach kann man auch gut essen«, entgegnete Brandt grinsend.
»Aber das, was ich meine, liegt nicht weit von meiner Wohnung entfernt«, sagte sie mit neckischem Augenaufschlag. »Überleg’s dir, aber nicht zu lange.«
»Rufst du mich heute Nachmittag an und sagst mir, ob wir’s mit zwei Tätern zu tun haben?«
»Natürlich. Und ich freu mich auf Freitag.«
Brandt und Eberl hängten die grünen Kittel an den Haken. Mit einem Augenzwinkern sagte sie: »Läuft da etwa was zwischen dir und Andrea?«
»Blödsinn, das ist nur …«
»Mein Gott, die steht total auf dich, merkst du das gar nicht? Und sie sieht auch noch gut aus. Und sie ist dreizehn Jahre jünger als du. Und …«
»Willst du mir jetzt ihre ganzen Vorzüge aufzählen? Ich habe zwei Töchter und …«
»Und was? Sie weiß das, aber es macht ihr offensichtlich nichts aus. Du bist jetzt seit über einem Jahr geschieden, du brauchst keinen Trauerflor mehr zu tragen. Ich als Frau sehe jedenfalls, dass du da eine echte Chance hast. Lass sie dir nicht entgehen.«
»Du hast ja Recht. Aber trotzdem, ich weiß ja nicht, wie Sarah und Michelle darauf reagieren würden.«
»Die wollten doch unbedingt zu dir. Trauern sie ihrer Mutter arg hinterher?«
»Nicht sehr.«
»Also, was hindert dich dran, es wenigstens zu versuchen? Außerdem passt ihr beide äußerlich echt gut zusammen, und das meine ich ernst. Und ihr habt eins gemeinsam – ihr seid beide geschieden. Gib dir endlich einen Ruck. Ein Mann wie du sollte nicht die ganze Zeit allein sein.«
»Mal sehen«, brummte er.
»Oder stehst du etwa mehr auf unsere schöne Staatsanwältin?«
»Die Klein? Aber sonst geht’s dir noch danke?! Die soll mir bloß gestohlen bleiben. Erst kommt sie aus Frankfurt und verpestet uns die Luft, und dann mischt sie sich auch noch permanent in laufende Ermittlungen ein. Die und Greulich würde ich am liebsten auf den Mond schießen, ohne Rückfahrkarte. Möchte wetten, dass wir noch heute was von ihr hören. Wie kommen Sie mit Ihren Ermittlungen voran? Bitte, machen Sie ein bisschen mehr Druck, sonst muss ich die Kollegen vom LKA hinzuziehen«, äffte er sie nach und fügte hinzu: »Warum nicht gleich das BKA oder Europol oder das FBI!«
»Reg dich wieder ab. Die Klein ist auch nur ein Mensch …«
»Und was für einer! Die hat mehr Haare auf den Zähnen als ein Gorilla am ganzen Körper. Und jetzt Schluss damit, ich muss mich auf den Fall konzentrieren.«
Georg-Büchner-Gymnasium. Peter Brandt und Nicole Eberl begaben sich ins Sekretariat, wiesen sich aus und baten darum, den Direktor sprechen zu dürfen. Die Sekretärin sagte, er unterrichte gerade, weil einige Lehrer krankheitsbedingt ausgefallen seien, doch Brandt bestand darauf, dass er aus der Klasse geholt wurde. Die kleine pummelige Frau sah Brandt für einen Moment unsicher an und fragte: »Ist irgendetwas passiert?«
»Das würden wir gerne mit Herrn Drescher persönlich besprechen. Wenn Sie ihn jetzt bitte holen wollen.«
Sie warteten fünf Minuten, bis sie mit einem etwa fünfzigjährigen, sehr jugendlich wirkenden Mann zurückkam, der offensichtlich wenig Verständnis zeigte, seinen Unterricht unterbrechen zu müssen. Er trug einen grauen Anzug, darunter ein blaues Hemd und eine ebenfalls blau karierte Krawatte. Brandt wunderte sich, hatte er doch seit der Einschulung seiner Töchter die jeweiligen Lehrer immer nur in Jeans oder Cordhosen und Pullis oder Flanellhemden angetroffen.
»Drescher«, stellte er sich vor und reichte erst Eberl, dann Brandt die Hand. »Was kann ich für Sie tun?«
»Wir würden uns gerne ungestört mit Ihnen unterhalten. Am besten in Ihrem Büro.«
»Wenn Sie mir bitte folgen wollen, es ist gleich hier vorne.« Er instruierte seine Sekretärin, in den nächsten Minuten nicht gestört zu werden, und machte die Tür hinter sich zu. Er bat die Beamten, Platz zu nehmen, er selbst setzte sich hinter seinen Schreibtisch.
»Herr Drescher, wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass einer Ihrer Lehrer, Herr Schirner, heute Nacht einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.«
»Bitte was? Schirner?« Drescher sah Brandt mit diesem ungläubigen Wollen-Sie-mich-auf-den-Arm-nehmen-Blick an, während er sich nach vorn beugte, die Hände gefaltet. »Was ist passiert?«
»Das wissen wir selbst noch nicht genau. Er wurde heute Morgen unweit seiner Wohnung gefunden.«
»Das darf doch nicht wahr sein! Ausgerechnet Schirner, einer unserer besten und beliebtesten Lehrer. Deswegen ist er also heute nicht zum Unterricht erschienen. Ich habe mich schon gewundert, denn das ist so überhaupt nicht seine Art, einfach unentschuldigt fernzubleiben. Er ist die Zuverlässigkeit in Person. Seit fast fünfundzwanzig Jahren ist er hier an der Schule, und er war seit drei Jahren mein Stellvertreter. Sein Tod ist ein herber Schlag für die ganze Schule. Er wird nur schwer, ich wage sogar zu behaupten, gar nicht zu ersetzen sein. Herr Schirner war noch ein Lehrer vom alten Schlag, für den sein Beruf gleichzeitig Berufung war. Er genoss sowohl bei den Kollegen als auch bei den Schülern große Beliebtheit, weshalb er auch seit fünf Jahren Vertrauenslehrer ist.« Er lehnte sich zurück, holte tief Luft und fuhr fort: »Diese Nachricht muss ich wirklich erst einmal verkraften. Da denkt man immer, so etwas könnte hier nicht passieren, und dann …«
»Bei aller Beliebtheit, gab es eventuell auch Personen, die ihm nicht so wohl gesonnen waren?«, fragte Brandt.
Drescher schüttelte den Kopf. »Nein, da fällt mir beim besten Willen keiner ein. Wissen Sie, Schirner ist der dienstälteste Lehrer an dieser Schule. Viele kommen, viele gehen. Ich selbst bin auch erst seit sechs Jahren hier, und ich kann nur Positives über ihn berichten. Er wird uns allen sehr fehlen.«
»Dennoch müssen wir den gesamten Lehrkörper befragen und auch die Schüler, die er zuletzt unterrichtet hat. Von seiner Frau wissen wir, dass er Mathematik, Physik und Ethik unterrichtet hat. Ist das korrekt?«
»Ja. Das mag zwar eine seltsame Kombination sein, aber es war ihm wichtig, den Heranwachsenden ethische und moralische Werte zu vermitteln, die in unserer heutigen Welt anscheinend kaum noch zählen. Als er letzten Herbst seinen Fünfzigsten feierte, haben ihm die Schüler einen riesigen Fresskorb und eine Schallplatte geschenkt, nach der er schon seit Jahren vergeblich gesucht hatte. Daran können Sie in etwa ermessen, welchen Stellenwert er bei den Schülern eingenommen hat. Er war nicht nur ein Lehrer, er war ein Vater und ein Menschenfreund.«
»Und doch muss es jemanden geben, der ihn gehasst hat. Manche Menschen tragen viele Mäntel und kennen sich in der Garderobe gut aus«, bemerkte Brandt trocken.
»Ich verstehe nicht, was Sie meinen«, sagte Drescher mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Unwichtig. Ihnen fällt also von den Schülern oder Lehrern keiner ein, der mit Schirner nicht so gut zurechtkam? Oder anders ausgedrückt – es muss doch auch Schüler oder ehemalige Schüler geben, die ihn nicht mochten.«
»Ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen, denn Herr Schirner war durch die Bank weg beliebt, auch wenn Ihnen das vielleicht nicht passt. Aber natürlich gibt es auch hin und wieder Schüler, die sich ungerecht behandelt fühlen, wir Lehrer sind schließlich auch nur Menschen, aber deshalb begeht man nicht gleich einen Mord.«
»Zu allen Zeiten haben Menschen schon aus scheinbar nichtigen Gründen einen Mord oder sogar mehrere begangen. Und was Schulen angeht, ich brauche da nur an Erfurt zu erinnern.«
»Ich bitte Sie«, entrüstete sich Drescher, »Erfurt war eine ganz andere Geschichte, mit einem völlig anderen Hintergrund.«
»Schau mer mal. Wir würden gerne so bald wie möglich mit unserer Befragung beginnen. Wann ist die nächste Pause?«