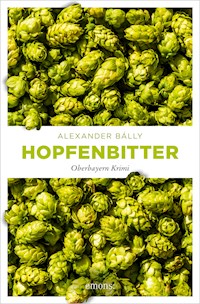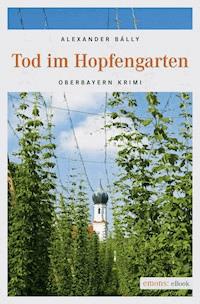
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Oberbayern Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein deftiger Kriminalroman – urbayerisch und liebenswert komisch. Unweit vom idyllischen Wolnzach wird eine skelettierte Leiche gefunden. Der ganze Marktflecken rätselt: Ist es der junge Peter Gerstecker? Denn der wird seit Monaten vermisst. Nur Hobbydetektiv Wimmer, Metzgermeister im Ruhestand, rätselt ausnahmsweise nicht mit. Stattdessen untersucht er Kunstdiebstähle in der Holledau. Doch dann soll er die Unschuld des Bruders des Vermissten beweisen. Gut, dass seine Enkelin Anna Sommerferien hat und mit auf Mördersuche gehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Bálly, Jahrgang 1964, wohnt mit seiner Familie in der Holledau zwischen Ingolstadt und München. Als echter Papiertiger arbeitete er seit seiner Schulzeit in Buchhandlungen und Verlagen. Nun schreibt er selbst, vor allem Krimis, Weihnachts- und Kurzgeschichten. Der erste Band seiner Holledau-Krimireihe mit Metzgermeisterdetektiv Wimmer und seiner pfiffigen Enkelin Anna erschien 2014.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Christian Bäck
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-9604-1298-4
Oberbayern Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Björn und Jens,treue Wimmer-Fans, die diesen Fallnicht mehr lesen können
Samstag
Geburtstagsüberraschungen
Norbert Wenzel war sehr zufrieden, als er mit seinem Schwiegervater im Ilmtal auf der Staatsstraße 2232 nordwärts in Richtung Geisenfeld fuhr. Die Überraschung zu seinem runden Geburtstag hatte den alten Herrn neben ihm sehr gefreut, was bei den Geschenken der letzten Jahre durchaus nicht jedes Mal der Fall gewesen war. Es war nicht einfach, ein passendes Präsent für den »Eddi-Opa« auszusuchen. Was er brauchte oder mochte, besaß er schon, anderes wies er meist zurück, gelegentlich sogar recht barsch. Dieses Mal aber hatte Norbert das Richtige gefunden, und sogar das Wetter spielte an diesem ersten Sonntag im August mit.
Ein Stück hinter Königswiesen bogen sie von der Straße nach links ab und fuhren vorbei an üppig grünen Hopfenranken, die sich schon seit Wochen in ihren sieben Meter hohen Stangengärten bis ganz nach oben wanden. Der Weg führte vorbei an einem stattlichen Einödhof und danach einen Schotterweg entlang. Hinter einem kleinen Waldstück lag ihr Ziel: der Segelflugplatz Holledau, das Zuhause des Pfaffenhofener Luftsportvereins. Der Flugplatz bestand genau genommen nur aus einem kleinen Hangar mit angebautem Vereinsheim, einem Windsack und einem Dutzend rot-weißer Markierungen auf einer kurz gemähten Wiese. Immerhin standen schon zwei erste Segelflugzeuge am Anfang der Graspiste und warteten, ein wenig geneigt, eine der schlanken Schwingen am Boden abgelegt. Noch war es zu früh, um den Flugbetrieb aufzunehmen. Zwar wehte ein leichter Wind und es schien die Sonne, doch die Thermik, die vom erwärmten Boden aufsteigenden Lüfte, die die Piloten zum Fliegen brauchten, war noch nicht kräftig genug. Es ging noch sehr gemütlich zu.
»Und mit so einem Flieger derf i fliegen? I hab doch gar koan Führerschein für so a Ding.«
»Geh weida, Opa, der da links is doch a Zweisitzer. In dem wird dich a Pilot mit nach oben nehmen.«
»Und dann kann i mei Elternhaus von oben sehn? Und unser Haus aa?«
»Des ham s’ mir g’sagt. Vielleicht siehst sogar die Mama, wie s’ mit der Petra auf der Terrasse den Tisch deckt.«
Ein paar Minuten später wurden sie freundlich von einem Vereinsmitglied begrüßt, das sich als Erwin Rosner und Vereinsvorstand vorstellte. »Ein wenig Zeit brauchen wir noch. Aber nicht mehr allzu lange.«
»Wie wird eigentlich gestartet?«, fragte der Jubilar. »Die Flieger ham ja keinen Propeller oder so was.«
»Das sind Segelflugzeuge, die brauchen keinen Motor. Wir fliegen wie ein Bussard oder ein Storch und nutzen die Aufwinde. Nur beim Start müssen wir die Flieger nach oben schleppen. Da, schauen S’! Da kommt schon der Matthias. Er hat heute Windendienst. Ohne die Winde müssten wir am Boden bleiben.«
Der Luftsportler deutete auf einen uralten Lastwagen in einem frischen gelben Lackkleid, auf dem hinter der Fahrerkabine ein unpassend moderner Sicherheitskäfig zwischen zwei großen Seiltrommeln montiert war. Ein roter Traktor, noch älter als der Lkw, folgte ihm.
»Die Winde fährt bis zum Ende der Startbahn und wird dort verankert. Mit dem Schlepper ziehen wir das Stahlseil bis hier heraus, zum Startplatz. Dann zieht das Seil den Flieger wie einen Drachen nach oben, und wir können fliegen, wohin wir wollen. Soweit es die Thermik zulässt – und der reglementierte Luftraum. Wie so ein Start funktioniert, das werden S’ gleich sehen. Unsere Schüler drehen erst ein paar Platzrunden, damit wir wissen, wie gut die Luft schon trägt. Möchten S’ vielleicht a Limo? Oder a Bier? Sie dürfen ja.«
Mit je einer Flasche Bier in der Hand verfolgten Wenzel und sein Schwiegervater, wie ein zweiter Oldtimer-Traktor ein weiteres Segelflugzeug zum Startplatz zog. Auch dieses war schnittig-elegant und aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ein Kleintransporter folgte. Er war wie die Traktoren mehr als ein halbes Jahrhundert alt und zu einem einfachen Feuerwehr-und-Ambulanz-Fahrzeug umgerüstet.
Offenbar waren hier ausschließlich die Flugzeuge modern, doch auch wenn die Fahrzeuge sehr betagt waren, waren sie alle liebevoll gepflegt und funkelten in der Sonne.
»Des g’fällt mir«, stellte das Geburtstagskind fest. »Oldtimer für den Boden und a modernes Zeugl für d’ Luft.«
Mit Hilfe der willig zupackenden Gäste wurde zuletzt ein kleiner Pkw-Anhänger mit einem Schreibpult neben den Startplatz geschoben, daran ein Feldtelefon angestöpselt und ein Sonnenschirm aufgespannt.
»Jetzt geht’s gleich los«, erklärte Rosner und nahm auf dem Anhänger Platz. »Das ist sozusagen unser Tower. Von hier aus sind wir per Funk mit unseren Piloten verbunden und über das Telefon mit dem Windenführer.«
Ein junger Mann hatte schon in einem der einsitzigen Flieger Platz genommen und schloss gerade die Plexiglashaube. Ein Vereinskollege assistierte beim Start, indem er unter dem Piloten das Stahlseil am Segelflugzeug einhängte. Dann ging er an das Ende des auf dem Boden liegenden Flügels und hob ihn in die Waagerechte. Der Helfer reckte den freien Arm, und das Seil straffte sich ganz langsam. Der Arm des Helfers zeigte dies an und wies nun zum Horizont. Das Flugzeug ruckte sanft und begann zu rollen. Mit dem Arm parallel zum Boden lief der Helfer nebenher. Nach fünf oder sechs Schritten konnte er nicht mehr mithalten, doch die Flügel hatten inzwischen längst so viel Wind unter sich, dass seine Hilfestellung nicht mehr nötig war. Sein Arm fiel seitlich am Körper hinunter, und das Flugzeug wurde rasch schneller. Steil stieg die Maschine auf und hing wie ein Drachen an dem Seil, das surrend und pfeifend die Luft zerteilte, während der weiße Flieger immer weiter nach oben entschwand.
Eine knappe Minute später fiel das Seil vom Haken, und der Segelflieger neigte sich in eine Linkskurve. Von einem kleinen Fallschirm gebremst und von der Winde eingeholt, fiel der Rest des langen Seils zu Boden, und der kleinere der Traktoren fuhr los, um es zu holen.
Das Flugzeug war inzwischen ein Stück geradeaus geflogen und hatte eine weitere Linkskurve gedreht. Es flog in einiger Entfernung parallel zur Graspiste zurück, noch ein Stück weiter nach Süden, um in zwei letzten Linkskurven zum Platz zurückzukehren. Zischender Fahrtwind begleitete den Flieger, wie er – nun stetig an Höhe verlierend – sich näherte und kurz nach dem Beginn der Graspiste aufsetzte. Rumpelnd rollte er aus und senkte erst, als er zum Stehen kam, einen seiner Flügel sanft zu Boden.
Noch zwei solcher Platzrunden beobachteten »Eddi-Opa« und sein Schwiegersohn, dann kam ein blonder junger Mann auf sie zu und stellte sich als Felix Bittner vor. »Ich bin Ihr Pilot für den Rundflug. Allmählich trägt die Luft. Sehen Sie dort!« Er deutete auf einen Greifvogel, der ein Stückchen weiter seine Kreise zog. »Wenn die Bussarde Thermik haben, dann haben wir sie auch.«
Der Pilot führte das Geburtstagskind zu dem doppelsitzigen Flugzeug und komplimentierte den Jubilar auf den hinteren Sitzplatz.
»Oje, is das tief. Da hock i ja fast am Boden!«, jammerte dieser.
»Wie in der Badewanne«, bestätigte Bittner heiter und schnallte an seinem Passagier sorgsam Fallschirm und Sicherheitsgurte fest.
»Und jetzt?«, wollte der wissen, während der Pilot sich vor ihm niederließ und sich ebenfalls anschnallte. »Muss i was tun?« Er war ein wenig aufgeregt, fühlte sich aber festgezurrt und hilflos. Inzwischen bezweifelte er, ob ein solcher Rundflug eine gute Idee gewesen war. Doch zum Fürchten war keine Zeit. Bittner meldete den Flug an, die Haube wurde geschlossen, und schon hob ein Helfer den abgelegten Flügel an.
»Sie müssen gar nichts tun. Nur genießen. Auch wenn es jetzt gleich a bisserl schnell wird und sich anfühlt wie in der Achterbahn, brauchen Sie keine Angst haben. Des gehört so.«
Schon senkte sich der Arm des Helfers, und das Flugzeug begann sachte loszurollen, wurde schneller und dann … Es fühlte sich an, als hätte ein Pferd sie getreten, so rasant nahmen sie nun Tempo auf. Die Beschleunigung drückte dem alten Herrn merklich auf den Magen. Der Alte blickte zur Seite und sah, dass die Landschaft plötzlich um fast neunzig Grad gekippt war. Schrilles Pfeifen erklang, als das Kabel durch die Luft sägte. Das alles hätte »Eddi-Opa« mannhaft und stumm ertragen, doch der Anblick der Flügel jagte ihm solche Angst ein, dass er aufschrie. Sollten sich die Schwingen derart durchbiegen, dass ihre Enden fast schon nach oben wiesen? Wann würden sie brechen?
Langsam kehrte die Landschaft wieder in die Horizontale zurück, und dann, mit einem letzten »Plong!«, rutschte das Seil am Gipfelpunkt vom Haken. Der weiße Flieger machte noch einen letzten Hüpfer, dann wurde es ruhiger. Auch die Flügel wiesen endlich – wie der Passagier es für richtig hielt – zum Horizont. Zweimal knackte es laut, als der Pilot zur Sicherheit manuell den Ausklinkmechanismus betätigte, danach herrschte plötzlich Stille.
»Das war der Start«, sagte Bittner. »Wir haben nun eine Höhe von etwa dreihundert Metern. Jetzt suchen wir uns einen Aufwind, um noch höher zu steigen, und der Ausflug kann beginnen.«
Sanft senkte sich die linke Tragfläche, der Flieger beschrieb eine weite Kurve und flog nun geradeaus nach Westen.
»Haben Sie es gespürt?«, fragte Bittner nach einer kleinen Weile. »Da haben wir ja unseren Aufwind. Am deutlichsten merkt man es mit dem Hosenboden, wenn man Aufwinde kreuzt. So wie gerade eben«, erklärte er und lenkte das Segelflugzeug in eine steile Kurve. Sie begannen zu kreisen, unter sich ein frisch abgeerntetes Getreidefeld. Langsam, aber stetig drehte sich der Zeiger des Höhenmessers im Uhrzeigersinn – sie stiegen. Der Jubilar hatte inzwischen etwas Vertrauen in das Fluggerät gewonnen und betrachtete mit Genuss und Neugier die Landschaft seiner Heimat.
Mit zunehmender Höhe änderte sich deren wohlvertrauter Anblick. Von hier oben, sie hatten inzwischen vierhundert Meter Höhe erreicht, wirkte sie weniger kleinteilig. Die Hügel, die am Boden noch steil aussahen und Radfahrer zum Schnaufen brachten, verwandelten sich aus dieser neuen Perspektive in sanfte Wellen. Die Wälder und Hopfengärten, die dort unten als grüne Wände den Blick in die weite Landschaft verstellten, waren von oben betrachtet die Landschaft selbst. Die freie Übersicht aus der Höhe zeigte nun auch die größeren Strukturen. Im Osten und Süden erkannte »Eddi-Opa«, so weit das Auge reichte, das bucklige Hopfenland. Im Westen war der Untergrund weniger gewellt, und feine Schraffuren markierten den Beginn des Spargellandes. Im Norden wurde es flach. Dort lag das Donaumoos. Sie erkannten sogar die rot-weißen Kamine der Raffinerie bei Ingolstadt, schon jenseits des breiten Flusses.
Auf etwa achthundert Meter Höhe beendete Bittner das Kreisen, und der Streckenflug begann. Sie glitten kilometerlang nach Süden, wobei sie ein paar hundert Meter ihrer Höhe verloren. Über einer großen Kiesgrube schraubten sie sich wieder hinauf, und es ging erneut über Land. Im Wechsel aus Kreisen und Geradeausflug erreichten sie Tegernbach, wo sie »Eddi-Opas« Geburtshaus überflogen, einen großen Bauernhof in der Ortsmitte. Als Nächstes wollten sie Wolnzach ansteuern, wo das Wohnhaus des Jubilars stand. Doch das Wetter spielte nicht mit. Der Wind war inzwischen auf Südwest gesprungen und brachte feuchte Luftmassen mit sich. Die Aufwinde waren nun schwerer zu finden und schwächer.
Der Rückweg war mühsam. Bittner war alle Orte angeflogen, über denen man üblicherweise Thermik fand, doch sie hatten kaum Höhengewinn gebracht. Auf den Strecken, die sie zwischen den Aufwinden dahingeglitten waren, hatten sie einen Großteil ihrer Höhe eingebüßt. Inzwischen waren sie nur noch vierhundert Meter über den Hopfenstangen, und noch waren sie ein gutes Stück vom Flugplatz entfernt. Der Pilot musste eine Entscheidung treffen.
»Ich fürchte, wir werden es nicht mehr ganz bis nach Hause schaffen«, erklärte er.
»Was soll des heißen? Stürz ma jetzt ab?«
»Nein«, lachte der junge Mann. »Wir müssen uns nur, solange wir noch hoch genug sind, ein schönes Fleckerl zum Landen suchen. Außenlandung, so nennt man das.«
Der Alte war nicht vollständig beruhigt und beobachtete mit Argwohn, wie sie langsam immer tiefer sanken.
»Wir haben Südwestwind, aber in Bodennähe kann das ganz anders sein. Sehen Sie dort unten die Kühe? Weil nahe dem Boden der Wind von Süden kommt, stehen alle mit dem Hintern in diese Richtung. Und nebendran ist eine nette Wiese.«
Dem Jubilar schien es, als würden sie schon bedenklich tief fliegen, aber Bittner wirkte völlig gelassen. Ihm gefiel, was er sah: Er konnte die Wiese von Norden her über ein Getreidefeld hinweg ansteuern und sicher gegen den Wind landen. Die Landezone war lang und frei von Oberleitungen. Hopfen gab es zwar, aber der wuchs seitlich oder dahinter. Der Landeplatz selbst sah weder sumpfig noch allzu uneben aus und war frei von Weidezäunen. Auch Maulwurfshügel konnte er nicht erkennen.
Sie flogen noch ein gutes Stück geradeaus, über den Kirchturm von Lohwinden, dann legte sich das Flugzeug nach links in die Kurve, um schließlich, als die Tragflächen zur Wiese zeigten, noch einmal nach links zu schwenken. Vor und unter ihnen lag das Getreidefeld und dahinter ihre provisorische Landebahn.
Bisher war der Flug, vom Start einmal abgesehen, recht leise gewesen. Ein stetiges Zischen des Fahrtwindes hatte den schnittigen Flieger eingehüllt und war rasch zu einer vertrauten Konstante geworden. Jetzt aber zog Bittner an einem Hebel neben den Sitzen, und aus den Flügeln schossen Störklappen nach oben. Plötzlich wurde es laut um sie herum, und der Flieger schien sehr rasch nach unten zu sacken. Immer näher kam die Wiese. Dann verschwanden die Klappen in den Tragflächen, und der Gleitflug fühlte und hörte sich wieder vertraut an.
Sanft schwebten sie auf die Wiese zu. Tiefer und immer tiefer. Und noch tiefer. Der Alte hörte, wie Grashalme die Unterseite des Rumpfes streiften, und gleich darauf rumpelten sie auf dem großen Rad des Fahrwerks über den Boden. Sie wurden langsamer und kamen schließlich ganz zum Stehen. Anmutig senkte sich der rechte Flügel auf das Gras. Sie waren sicher gelandet.
Sowie der Jubilar abgeschnallt war und wieder festen Boden unter sich spürte, ereilte ihn der Ruf der Natur. Der Flug hatte mehr als zwei Stunden gedauert, und das Bier drängte nach draußen. Er blickte sich um. Ein Fleck, dort, wo der Hopfen hinter der Wiese wuchs, schien ihm ein geeigneter Ort, um sich zu erleichtern. Er ging hinüber und nestelte schon an seiner Hose, als er bemerkte, dass ihn ein Totenschädel angrinste.
»Jessas!«, entfuhr es ihm, und er sah genauer hin. Im Kraut unter den Büschen erkannte er einen skelettierten Brustkorb und weitere Überreste einer menschlichen Leiche. »G’sund schaut der fei ned aus!«
Unverrichteter Dinge knöpfte er die Hose wieder zu und eilte zu Bittner zurück, der gerade mit dem Handy die Abholung der Gestrandeten organisierte. Der Alte nahm ihm kurzerhand das Telefon ab, beendete das Gespräch und wählte den Notruf.
»Ja, hallo! Grüß Gott. I hab a Leich g’funden. Am Rand von einer Wiese, a bisserl westlich von Lohwinden.«
…
»Ja, freilich. I bleib da.«
…
»Mein Name? I bin der Rummetshofer Eduard.«
Es war zwölf Uhr einundfünfzig.
Auf der Wiese
Eine Stunde später hatte sich die improvisierte Landebahn in einen recht belebten Ort verwandelt. Zunächst waren drei Streifenwagen eingetroffen, und Beamte der Polizeiinspektion Geisenfeld hatten ohne viel Federlesens die komplette Wiese, den Fundort der Leiche und den Flieger mit rot-weißem Polizei-Flatterband abgesperrt. Etwas später waren mehrere Fahrzeuge gekommen und hatten Beamte der Mordkommission und des kriminaltechnischen Dauerdienstes des Polizeipräsidiums Ingolstadt ausgespuckt. Zu diesem Zeitpunkt war schon etwa ein Dutzend Kinder mit Fahrrädern vor Ort. Sie verfolgten von der Straße aus als Zaungäste die ungewöhnlichen Vorgänge. Nach einer weiteren Viertelstunde fuhren noch drei Autos auf die Wiese: ein vw-Bus der Polizei, der als mobiles Büro dienen sollte, ein grüner Volkswagen mit Norbert Wenzel, der seinen Schwiegervater abholen wollte, und der braune Volvo von Erwin Rosner mit einem langen, schmalen Anhänger. Hatten die Luftsportler erst die Tragflächen und das Leitwerk des Fliegers demontiert, würde dieser komplett in dem schlanken Gehäuse verschwinden. Einstweilen mussten aber sowohl Norbert Wenzel als auch Erwin Rosner ihr Anliegen aufschieben.
Felix Bittner saß in einem Streifenwagen und wurde dort befragt. Eduard Rummetshofer, der als Leichenfinder etwas mehr als der Pilot zu erzählen hatte, hockte indessen an einem Klapptisch im Polizeibus und wartete auf den Kommissar vom Dienst.
Das war an diesem Wochenende der Erste Kriminalhauptkommissar Karl Konrad. Er hatte unter Kollegen einen ausgezeichneten Ruf als erfahrener und geduldiger Ermittler mit einem Händchen für knifflige Fälle. Mit seiner freundlich-leutseligen Art erweckte er bei Zeugen und Verdächtigen gleichermaßen Vertrauen. Dabei half es, dass er seine Sprache ganz natürlich der seines Gegenübers anpasste. Zugezogene bemerkten kaum einen Dialekt, Einheimische hörten unverfälschte Heimatklänge. Auch hatte er schon mehrfach recht verzwickte Verbrechen gelöst, weil er sich nicht allein und ausschließlich auf angeblich eindeutige Spuren und stringente Indizienketten verließ. Er war sich stets bewusst, dass die Praxis manchmal komplexer und komplizierter war als gradlinige Theorien. So verfolgte er gelegentlich Spuren, die seine Kollegen eher als unbedeutend oder irrelevante Zufallsereignisse abhakten und ausschlossen. Als Vorgesetzter ermutigte er auch jüngere Kollegen, sich nicht nur auf kühle und klare Logik zu verlassen, sondern auch auf ihren Instinkt zu hören. Zwar führte das Bauchgefühl sehr oft auf einen der vielen Irrwege der Ermittlungen, doch hatten er und sein Team so schon wichtige Informationen gefunden, die Licht in verworrene Fälle gebracht hatten.
Inzwischen ging Konrad allmählich auf das Pensionsalter zu.
»Grüß Gott, Herr Konrad.«
Konrads dichte Augenbrauen rückten zusammen und bildeten für einen Augenblick ein V, dann erkannte er sein Gegenüber. »Ja, hallo! Herr Rummetshofer, nicht wahr? Haben Sie mal wieder was für uns entdeckt?«
»Mei … was soll ich sagen? I find die Leichen ja nur. I such mir des ned aus.«
In den letzten zwei Jahren hatte es in Wolnzach und Umgebung drei größere Verbrechen gegeben, und jedes Mal war es Eduard Rummetshofer gewesen, der mindestens eine der Leichen gemeldet hatte. Bei zweien dieser Fälle hatte Karl Konrad die Ermittlungen geleitet.
»Und wie kommt es, dass Sie jetzt schon zum vierten Mal einen Toten für uns haben?«
»Reiner Zufall, Herr Konrad, wirklich. Reiner Zufall!«, beteuerte er und erzählte von dem Rundflug, der Außenlandung und dem Druck auf der Blase. »Ich war fei immer noch ned beim Bieseln«, schloss er seinen Bericht. »Wenn’s nix mehr gibt, was i hier helfen kann, dann … Also, meine Adress, die ham S’ ja. I fänd’s nett, wenn i jetzt dann heimdürft. Meine Frau und die Tochter, die warten schon auf mich und aa a Käskuchen. Weil heut mein Geburtstag ist.«
Konrad gratulierte, überflog seine Notizen auf dem Klemmbrett und reichte Rummetshofer dann die Kladde, um ihn seine Aussage unterzeichnen zu lassen. Dann endlich durfte das Geburtstagskind zu seiner Feier gehen.
Die Spurensicherungsfachleute hatten sich inzwischen einen Überblick verschafft. Karl Konrad stieg aus und hielt nach dem obersten Spurensicherer, Maximilian Thalmayr, Ausschau. Er fand ihn am Flatterband, wo er gerade Felix Bittner und Erwin Rosner erklärte, dass erst der komplette Fundort gesichert werden musste, bevor sie den Flieger bewegen, demontieren und dann verladen durften.
Konrad bestätigte nickend Thalmayrs Aussage und nahm ihn dann beiseite. »Wie sieht’s denn aus?«
»Schaun S’ halt selbst! Hier ham wir das Flugzeug und die Spuren der Landung. Dann die Fußspuren, die zu dem Hopfengarten führen. Und weiter hinten, da am Rand in den Brennnesseln, liegt der Leichnam.«
»Ich war schon kurz drüben. Ein Körper, stark verwest und teilweise skelettiert, aber sicher nichts für die Archäologen. Den können wir leider nicht dem Landesdenkmalschutz unterschieben. Zu frisch. Der gehört wohl uns. Könnt ihr den sichern?«
»Können wir. Aber der arme Mensch liegt schon so lang da umanander, da können wir auch noch auf die Fachleute aus der Gerichtsmedizin warten.«
»Haben Sie von denen schon wen erreicht?«
»Dr. Fröhlich ist startklar, er will aber seine Doktorandin mitbringen. Die war wohl auf einem Ausflugsdampfer auf dem Ammersee. Beide sollten in etwa zwei Stunden da sein.«
»Was muss am Flieger gemacht werden?«
»Nicht allzu viel. Der Pilot ist ja nur rein zufällig auf der Wiese gelandet. Wir müssen die Spuren der Landung und die Lage zur Leiche genau vermessen und alles auf der Tatortskizze eintragen. Auch wenn diese Details wahrscheinlich gar ned wichtig sind, hätt ich es gern ordentlich festgehalten. Wenn wir das alles sauber aufgenommen haben, können die«, mit einer knappen Kopfbewegung deutete er auf Bittner und Rosner, »von mir aus ihren Flieger zurückhaben.«
Thalmayr wurde seinem Ruf als sorgfältiger und geduldiger Spurensicherer gerecht. So dauerten die Erfassung und die Dokumentation der Spuren der Landung fast zwei Stunden, aber das Ergebnis würde auch der kritischsten Überprüfung standhalten. Bevor die Beamten das Segelflugzeug freigaben, lasen sie noch die gesicherten GPS-Daten des Fluges aus, um mit ihnen die Aussagen der beiden Insassen zu ihrer Flugroute zu überprüfen.
Endlich durften die Luftsportler sich wieder ihrem Flieger nähern. Sie stellten den Anhänger vor das Flugzeug und klappten ihn auf. Dann packten sie mit einem Polizisten als Helfer die Schwingen jeweils an ihren Enden. Felix Bittner entfernte hinter dem Pilotensitz zwei massive Bolzen, bevor sie erst die eine Tragfläche und dann die andere aus dem Rumpf zogen und ins Gras legten. In wenigen Minuten waren die Schwingen und das demontierte Leitwerk eingeladen und in ihren Halterungen festgezurrt. Zuletzt schoben sie den Rumpf Heck voran hinein. Alles in allem hatte die Aktion keine Viertelstunde gedauert.
Während die Kollegen in den weißen Papieroveralls die Spuren aufnahmen, sprach Konrad kurz mit dem Besitzer der Wiese, dem Landwirt Georg Gumpart, der aber nichts Hilfreiches beizutragen hatte. Als er sie zuletzt gemäht hatte und auch bei anderen Gelegenheiten, zu denen er vor Ort gewesen war, war ihm nie etwas Merkwürdiges aufgefallen.
Als gegen sechzehn Uhr dreißig die Rechtsmediziner Dr. Fröhlich und Sabine Adam-Büchner eintrafen, waren sie sehr befremdet über das Straßentheater, das sich inzwischen jenseits des Flatterbandes abspielte. Zu den neugierigen Lausbuben und einigen -mädchen hatten sich immer mehr Radfahrer und Spaziergänger gesellt. Auch etliche Anwohner aus dem nahen Lohwinden wollten wissen, was es hier zu sehen gab. Am Flatterband entlang stand ein halbes Dutzend Zaungäste in lebhafte Gespräche vertieft. Zwei Senioren hatten es sich sogar auf den Sitzbrettern ihrer Rollatoren bequem gemacht. Und in all dem Durcheinander wuselte auch noch ein junger Lokalreporter umher, schoss Fotos aus jeder sinnvoll erscheinenden Perspektive und befragte die Zaungäste.
»Kann man das Areal nicht weiträumiger absperren?«, fragte Adam-Büchner.
»Na ja, wir könnten natürlich die ganze Straße dichtmachen«, räumte Konrad ein. »Aber dann öffnet bestimmt einer der Bauern eine der Weiden da drüben für die Zuschauer – womöglich sogar gegen Eintritt. Hab ich alles schon erlebt. Von den Wiesen dort hätte das Publikum sogar einen noch besseren Überblick. Das will ich vermeiden. Von hier aus kann man eh nichts Wichtiges erkennen. Das Spannendste war bis jetzt der Segelflieger. Die Leich liegt ganz dahinten, gleich vor dem Hopfen. Von der sieht das Publikum nichts. Nicht mal mit einem Feldstecher. Auch nicht, wenn Sie nachher dort arbeiten.«
»Dann schauen wir mal«, meinte Dr. Fröhlich heiter. Er bat ein paar Streifenpolizisten, seine Untersuchungs- und Materialkoffer zum Fundort zu tragen, und nahm zwei Einwegoveralls aus dem Kofferraum seines Wagens.
Konrad überlegte noch, wo sich Frau Adam-Büchner, die nur ein Sommerkleidchen trug, umkleiden könnte, als die schon kurz entschlossen ihre Arme aus den Ärmeln zog, sie unter dem Kleid nach unten streckte und in die Hosenbeine des Anzugs stieg, um anschließend schnell ganz in ihn hineinzuschlüpfen. Als sie ihr Sommerfähnchen über den Kopf zog, war sie bereit.
Dr. Fröhlich brauchte etwas länger. Mit Mundschutz, Schutzbrille, blauen Handschuhen und Gazefüßlingen vervollständigte er ihre Arbeitskleidung.
Die Leiche lag fast drei Meter von der Wiese entfernt in einem Streifen fast hüfthohen Grases und Unkrauts, im Schatten des Hopfengartens, der hinter einem Graben aufragte. Der Fundort wurde zunächst fotografiert, bevor Dr. Fröhlich vorsichtig die größten Brennnesseln und das hohe Wiesenschaumkraut entfernte, um einen besseren Blick zu erhalten.
Schließlich klemmte er ein mehrseitiges Formular auf ein Schreibbrett und begann, den Totenschein auszufüllen. »Gibt es zu dem Leichnam Ausweispapiere?«, fragte er.
Thalmayr verneinte, und Dr. Fröhlich kreuzte »Identität: unbekannt« an.
»Reanimationsmaßnahmen wurden nicht vorgenommen, nehme ich an?« Er machte zwei weitere Kreuze auf dem Formblatt. »Sicheres Todeszeichen: fortgeschrittene Fäulnis«. Und: »Todesursache: unbekannt«. Auf einem Beiblatt beschrieb er knapp das Szenario: »Schädel ohne Verbindung zum Rest, etwa fünfzig Zentimeter vom Körper entfernt. Gesichtshaut und -muskulatur fehlen. Ebenso der Unterkiefer.« Er bückte sich und hob den Schädel vorsichtig auf. »Am Hinterkopf Haar- und Gewebereste.«
Die Doktorandin Adam-Büchner hielt ihm einen Pappkarton hin, um das Fundstück sicher zu verpacken.
»Können Sie uns schon etwas über das Geschlecht sagen?«, wollte Konrad wissen.
Der Mundschutz bewegte sich leicht, als Dr. Fröhlich lächelte. »Festlegen werde ich mich jetzt sicher nicht. Aber es scheint mir ein Mann gewesen zu sein. Frau Adam-Büchner?«
Die beiden Rechtsmediziner tauschten Karton und Schädel.
»Ein eher hoher als breiter Schädel«, kommentierte die junge Frau, was sie sah. »Die Augenwülste sind zwar nicht sehr stark ausgeprägt, aber deutlich. Mal sehen …« Sie zupfte an den Hautresten des Hinterkopfes. »Da! Das Hinterhauptbein reicht nicht sehr weit hoch.« Sanft strich sie über die Kuppel des Schädels. »Das Scheitelbein trifft hier aufs Stirnbein. Zwischen diesen Punkten weist der Schädel ein eher gewölbtes Profil auf. Ja, vermutlich ein Mann. Sicher werden wir das aber erst wissen, wenn wir uns das Becken angesehen haben. Das machen wir wohl besser im Institut. – Aber Moment! Da ist ja ein Loch! Hier oben, seitlich. Ein Ausschussloch, nach den Bruchmarken zu urteilen. Sehen Sie, wie von innen weggesprengt.« Sie deutete auf den Hinterkopf. »Aber wo ist die Kugel eingetreten?«
Wieder wechselten Schädel und Karton die Hände, und Dr. Fröhlich wendete nun den Schädel hin und her.
»Ah, hier!« Seine Augen strahlten, und er hob einen bräunlichen Hautfetzen an der rechten Schläfe, an der eine dünnen Haarsträhne hing.
Als sie den Schädel verpackt und den Karton beschriftet hatten, korrigierte Dr. Fröhlich den Totenschein, kreuzte »Anhaltspunkte für nicht natürlichen Tod« an und unterschrieb die Anordnung für eine Obduktion.
Frau Adam-Büchner kniete sich indessen neben die Stelle, wo der Schädel gelegen hatte, und untersuchte den Boden. Mit einer Pinzette griff sie eine rotbräunliche Kapsel, einer winzigen Kidneybohne nicht unähnlich, aber runder. »Eine Puppenhülle, vermutlich von einer Calliphora. Schmeißfliegen.«
Das Fundstück wurde in ein Plastikröhrchen gesteckt und beschriftet. Es folgten noch vierzehn weitere Puppenhüllen. Dann nahm sie mit einem dünnen Palettenmesser von der Oberfläche des Bodens eine Probe und weitere in zwei, fünf und zehn Zentimeter Tiefe. »Hier werden wir wohl nicht viel finden«, erklärte sie schließlich. »Die besseren Ergebnisse wird sicher die Erde unter dem Körper liefern.«
»Was suchen Sie denn im Erdreich?«, fragte Konrad.
»Rückstände der Verwesung. Höchst nützlich. Wenn Bakterien einen Körper zersetzen, wird es meist recht feucht. Weil unterschiedliche Bakterien in den verschiedenen Phasen der Dekompostierung aktiv werden, ändert sich auch die Zusammensetzung des Fluids, das ins Erdreich sickert.«
»Aha. Ich verstehe«, sagte Konrad, doch sein Gesichtsausdruck verriet, dass er den Nutzen solcher Proben noch nicht erfasst hatte.
»Diese Stoffe werden im Erdreich von wiederum anderen Mikroorganismen abgebaut«, fuhr Adam-Büchner fort. »Die Reihenfolge dieses Abbaus ist bekannt und auch seine Geschwindigkeit in Relation zur Witterung. Das bedeutet, wir können so dank der Arbeit von Arpad Vass an der Universität in Knoxville mit etwas Glück das postmortale Intervall bestimmen. Zumindest vage.«
»Sollte uns das gelingen, dann sicher auch deshalb, weil unsere Frau Adam-Büchner die Arbeit der Amerikaner an unser Klima anpasst.« Dr. Fröhlich war sichtlich stolz auf seine Doktorandin. »Die Rechenmodelle aus Tennessee sind nämlich nicht so einfach auf Bayern zu übertragen.«
Sie untersuchten den restlichen Körper und stellten Fraßspuren von größeren Tieren fest.
»Ich würde auf Füchse tippen oder auf einen Dachs«, meinte Dr. Fröhlich. »Die sind vermutlich auch für die Dislozierung des Schädels verantwortlich.«
Die Leiche lag auf dem Rücken. Das leere Gestell der Rippen war schon weitgehend vom Gewebe befreit. An einem der aufragenden Knochen hing noch ein letzter Fetzen eines ehemals weißen T-Shirts.
»Muss eine ganze Weile da liegen. Das Madenfest ist schon vorüber.« Sabine Adam-Büchners blau behandschuhter Finger wies auf eine formlose Masse, die sich am Boden der Karkasse gesammelt hatte. »Kaum mehr Aktivität. Bäh.«
Also gibt es etwas, was selbst leichenverzehrende Insekten eklig finden, schoss es Konrad durch den Kopf. »Sehen Sie Puppen?«, wollte er wissen.
»Kaum. Die finden wir aber sicher unter dem Körper.«
Die Beine und das Becken der Leiche steckten im mürben Wrack einer Bluejeans.
»Der linke Unterschenkel fehlt offenbar komplett, genauso wie der rechte Fuß. Der wurde am Sprunggelenk … abgenagt oder abgerissen, wie es aussieht.« Dr. Fröhlich stellte dies mit heiterer Gelassenheit fest. »Vermutlich von unseren kleinen pelzigen Freunden. Genau werde ich das erst wissen, wenn ich die Knochen näher untersucht habe.«
Auch die linke Hand des Leichnams wies Fraßspuren auf. Die rechte lag unter dem Körper. Dr. Fröhlich blickte auf. »Wie ist Ihre Meinung, Frau Kollegin? Würden Sie den Körper umdrehen?«
Einen Moment lang dachte die Doktorandin nach. »Nicht hier. Er scheint nicht mehr sehr stabil zu sein. Besser, wir nehmen ihn mit und untersuchen ihn im Institut.«
»Das sehe ich genauso.« Dr. Fröhlich nickte.
Vier Spurensicherer rollten neben dem Körper einen schwarzen Leichensack aus, und gemeinsam gelang es ihnen, den Leichnam einzutüten.
Während Frau Adam-Büchner und Dr. Fröhlich damit beschäftigt waren, Hunderte von Puppenhüllen zu sichern, veranlasste Konrad einige andere Notwendigkeiten. Zuerst ließ er einen Bestatter kommen, um die sterblichen Überreste ins rechtsmedizinische Institut nach München zu transportieren, dann bestellte er für den nächsten Tag eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei. Sie sollte die Gegend intensiv nach den vermissten Körperteilen durchstöbern. Auch Metallsuchgeräte sollten die Kollegen mitbringen. Zuletzt veranlasste er die Bewachung des Fundortes während der Nacht. Die Polizeiinspektion Geisenfeld würde einen Streifenwagen abstellen. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme bestand die Gefahr, dass die immer noch zahlreich herumstehenden Zuschauer eine nächtliche Nachlese halten würden.
Es war einundzwanzig Uhr dreiundzwanzig, als Konrad, Thalmayr und die beiden Rechtsmediziner als Letzte die Wiese verließen. Sabine Adam-Büchner hatte mehr als genug Bodenproben für weitere Untersuchungen sowie ein schönes Sortiment von Puppenhüllen leichenverzehrender Insekten im Gepäck.
»Ein paar Tage wird es schon dauern, bis wir vernünftige Ergebnisse haben«, erklärte Dr. Fröhlich, als er in sein Auto stieg. »Eine Autopsie an einem frischen Körper ist sehr viel einfacher.«
Thalmayr lud seine Koffer in den silbernen Kombi der Spurensicherung, während Konrad sich bei den Kollegen aus Geisenfeld verabschiedete. Dann fuhren beide gemeinsam davon. Die Nacht verschlang das letzte Licht der Dämmerung. Mit der Dunkelheit senkte sich wieder Ruhe auf die zertrampelte Wiese, auf der ein anonymer Toter eine einstweilen noch unbekannte Anzahl einsamer Wochen gelegen hatte. Nur der Lichtstrahl der Taschenlampe des Streifenbeamten tastete von Zeit zu Zeit durch die Finsternis.
Sonntag
Ruhestandsprogramm
Etwa fünf Kilometer östlich und dreizehn Stunden später saß man in der Wohnung über der Metzgerei Wimmer in Wolnzach noch am Frühstückstisch. Der Sonntagmorgen hatte langsam und sehr gemütlich begonnen, doch nun war das Frühstück weitgehend beendet. Sebastian Kirner, der vor mehr als zwei Jahren die Metzgerei von seinem Schwiegervater Ludwig Wimmer übernommen hatte, blätterte noch einmal bedächtig in der Wochenendausgabe der Lokalzeitung, während Wimmer, nun Metzgermeister im Ruhestand, sich auf der Eckbank streckte und den warmen Lufthauch genoss, der durch das offene Fenster hereinwehte. Sebastians Frau Karola schaffte in der Küche Ordnung und belud die Spülmaschine mit Geschirr, das Anna, ihre Tochter, ihr reichte. Das Mädchen war nun knapp fünfzehn und im letzten Jahr noch ein Stückchen gewachsen. Vor allem optisch hatte sie sich gestreckt. Ihr Babyspeck war aufgezehrt, stattdessen hatten sich Hüfte und Brust sanft gerundet. Sie war inzwischen ein resches Dirndl und kein Kind mehr.
Als Küche und Esszimmer aufgeräumt waren, lehnte sich Karola an den Türstock und nahm ihre Tochter in den Arm. »Ihr denkts mir fei an heute Abend. Mir wollen grillen. Spareribs und feine Angussteaks. Kommts also ja nicht zu spät! Es wär schad um das gute Essen. Was habt ihr denn heute so vor?«
Anna wollte erst ein wenig lesen und später am Nachmittag Eis essen gehen.
»Mit dem Thomas?«
Seit zwei Wochen hatte Anna ihren ersten Freund. Ihre Mutter wusste nach wie vor nicht, ob ihr das gefiel. Eigentlich war an Thomas nichts auszusetzen. Er war ein netter Bub, ein halbes Jahr älter als Anna, hatte Manieren und war kein »Spinner«. Grundsätzlich hielt sie aber nichts davon, dass Anna anfing, sich mit jungen Herren abzugeben, egal wie anständig sie auch sein mochten.
»Dass ihr zwei mir aber in der Eisdiele ned anfangts rumzupoussieren! Mir san G’schäftsleut. So was fällt fei auf uns zurück, und ich möcht ned, dass die Leut sagen, wir wärn a …«
»Jetzt lass halt das Kind amal in Frieden!«, unterbrach Sebastian seine Frau, bevor ihr etwas Uncharmantes entglitt. »Die Anna ist schon richtig geraten. Die macht nix Verkehrtes.«
»Und wo sollt das Madl denn dann bitte rumpoussieren? Wo wär’s dir denn lieber?«, mischte sich nun auch Wimmer ein. »Etwa hinter unserem Gartenschuppen? So wie du damals mit dem Ralf?«
»Welchem Ralf?«, fragten Sebastian und Anna unisono.
»Davon weißt du? Also …« Karola lief rot an, dann verschränkte sie die Arme vor der Brust. »Des war lange vor deiner Zeit, Basti, und außerdem – des is a Privatsach!«
»Genau! Und was ich mit dem Thomas mach und wo, das ist genauso privat!«, rief Anna und grinste frech. Mit so viel Flankendeckung konnte sie ihre Mutter auflaufen lassen. Diesmal zumindest. »Und was hast du vor, Mama?«
»Der Papa und ich, wir besuchen die Katharina. Die kleine Sophie ist jetzt ja schon fast drei Monate alt, und als Patentante sollt ich mich schon mal wieder sehen lassen.«
»Machts des ruhig«, sagte Wimmer. »Ich werd vielleicht a bisserl mit der Maschin fahren oder in den Biergarten gehen. Mal schauen.«
Die freie Zeit sinnvoll zu nutzen war für den Vierundsechzigjährigen ein gewisses Problem, seit er seinen Betrieb an Sebastian übergeben hatte. In der Metzgerei weiter mitzuarbeiten war für ihn nicht in Frage gekommen. Er war fest davon überzeugt, dass es nur einen Chef geben konnte. Würde er immer noch jeden Tag im Geschäft sein, würde er es seinem Schwiegersohn nur schwerer machen, in die neue Position hineinzuwachsen. Die erste Zeit nach der Übergabe hatte er es vergeblich mit verschiedenen Hobbys versucht, von Musik über Angeln bis hin zum Modellbau. Nichts hatte ihn begeistern können – bis auf eines: private Ermittlungen als Detektiv. Drei Mal schon hatte er mit Anna zusammen in Mordfällen in und um Wolnzach als Hobbydetektiv mit ermittelt. Sogar mit beachtlichem Erfolg! Bei ihren Nachforschungen hatten die beiden die entscheidenden Zusammenhänge stets vor der Polizei erkannt. Ein Geheimnis ihres Erfolges lag darin, dass sie weit besser als die Polizei in der lokalen Gerüchteküche bewandert waren. Sowohl Enkelin als auch Opa verstanden es, Leute unauffällig auszuhorchen, und ihre ausgefallenen Ideen der Informationsbeschaffung taten ein Übriges.
Zum Glück für die kleine Marktgemeinde und zu Wimmers Unglück waren Mordfälle und Verbrechen eher rar gesät. So konnte der alte Metzger diesen Zeitvertreib kaum dauerhaft betreiben. Seit mehr als einem Jahr hatten er und Anna nichts mehr zu ermitteln gehabt.
Um nicht vor Langeweile einzugehen, hatte Wimmer sich selbst eine Art Beschäftigungsprogramm verordnet und seine Woche mit regelmäßigen Tätigkeiten gefüllt. Keine davon war ihm ein inneres Bedürfnis, doch alle waren sie weit besser als das Fernsehprogramm oder das Ausfüllen von Kreuzworträtseln.
Montags und donnerstags lieferte er Fleisch und Wurstwaren an die Gastronomiekunden der Metzgerei. In dieser untergeordneten Tätigkeit wagte er es inzwischen, sich am Familienbetrieb zu beteiligen.
Dienstags und freitags nahm er sich mindestens eineinhalb Stunden Zeit für das Hochbeet, das Sebastian eigentlich Karola geschenkt hatte. Seit Wimmer es regelmäßig pflegte, konnte sie immer wieder Salat, Rettiche und Kräuter ernten.
Mittwochs besuchte er in vierzehntäglichem Wechsel die Seniorenspielnachmittage, die Frau Fechter im Gemeindezentrum veranstaltete, und das Amtsgericht in Pfaffenhofen, wo er als Zuschauer öffentliche Verhandlungen verfolgte.
Einmal in der Woche, den Termin hatte er nicht festgelegt, zwang er sich, in der Wolnzacher Bücherei vorbeizuschauen und sich ein Buch auszuleihen. So hatte er neben manchem anderen Autor Steinbeck entdeckt, den er inzwischen sehr schätzte, Dürrenmatt, den er für unbequem hielt, Montaigne, der ihm zu geschwätzig war, und Machiavelli, dessen utilitaristischen Ansatz er als moralischer Charakter ablehnte.
Im Dezember war ihm ein Buch von einem gewissen Herrn Pirsig in die Hände gefallen: »Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten«. Der Titel war vielversprechend gewesen, doch der Inhalt hatte ihn eher gelangweilt. Immerhin hatte das Werk eine alberne Idee in ihm geweckt, die sich in den folgenden Wintermonaten zu einem regelrechten Wunsch ausgewachsen hatte.
Er wollte wieder ein Motorrad besitzen. Als junger Mann, kurz nach der Lehre, hatte er sich von seinen Ersparnissen seine erste Maschine gekauft. Dabei hatte er es anders gemacht als so viele seiner Spezeln in den frühen Siebzigern. Die hatten sich die billigeren kleinen Zweitakter zugelegt, leichte Flitzer, 125er oder 250er, die ihre Kraft vor allem der hohen Drehzahl verdankten und deshalb mit monströsem Wespengesumm über die Straßen kreischten. Wimmer hatte tiefer in die Tasche gegriffen und eine gebrauchte BMW erstanden, einen schweren und soliden Feuerstuhl mit knapp fünfhundert Kubikzentimeter Hubraum, umgeben von einem Boxermotor. Der war zwar auch teurer im Unterhalt als die Maschinen seiner Freunde, aber dafür konnte er damit bequem auch große Touren machen – und ohne dass ein Tinnitus drohte. Anna-Maria, seine Freundin und spätere Frau, hatte damals ein Internat in Regensburg besucht und auf Wunsch ihrer Eltern im Anschluss eine zweijährige Ausbildung zur Laborantin gemacht – ebenfalls in Regensburg. Wimmer hatte immer vermutet, dass das deren Versuch gewesen war, die Liebenden auseinanderzubringen. Nur dank seines Motorrades hatte Wimmer seine Anna-Maria jede Woche ein- oder zweimal besuchen können.
Im vergangenen Winter hatte Wimmer immer öfter an sein altes Motorrad zurückgedacht. Im März war dann in einer Anzeige fast dasselbe Modell zum Verkauf angeboten worden – in Ingolstadt, nur einen Katzensprung entfernt: eine BMW R 50 S, die leicht überarbeitete und ein paar Jahre jüngere Sportversion seiner ersten Maschine. Mit Andreas, einem Bekannten aus dem örtlichen Motorradverein, besichtigte er den Oldtimer. Das Motorrad war alt, gepflegt, nicht »verbastelt«, wie Andreas befand, also weitgehend im Originalzustand. Auch technisch gab es wenig auszusetzen: Nirgendwo trat Öl aus, der Motor lief sauber, und der Tank war außen wie innen rostfrei. Andreas fand an keiner Stelle Spiel, wo keines sein sollte, und nickte zufrieden. Nur die Batterie und ein paar Kleinigkeiten bemängelte der Fachmann. Die Probefahrt war für Wimmer wie ein Kopfsprung in seine Jugend gewesen, ein wunderbares Déjà-vu. Nur wenige Minuten hatten Wimmer endgültig überzeugt. So war er stolzer Eigentümer der Maschine geworden.
Seine Tochter verstand zwar immer noch nicht, wieso er den Gegenwert eines neuwertigen Kleinwagens für ein altes Motorrad ausgegeben hatte, doch alles, was ihn vom Detektivspielen ablenkte, war ihr recht. Sein »Krimifimmel«, wie sie sich ausdrückte, war ihr von Anfang an ein Ärgernis gewesen. Sie fand seine Leidenschaft unpassend. Zunächst hatte sie Angst gehabt, dass ihr Vater sich und damit auch sie selbst der Lächerlichkeit preisgeben würde. Später war diese Angst einer größeren gewichen. Auch wenn Wimmer sich um Sicherheit bemüht hatte, waren seine Verbrecherjagden nicht immer ohne Risiko vonstattengegangen. Einmal waren er und Anna sogar in Lebensgefahr geraten.
Seit April war die »Maschin«, wie das Motorrad in der Familie genannt wurde, als Oldtimer zugelassen, und Wimmer nutzte sie bei gutem Wetter zu einsamen Ausflugsfahrten. Auch heute lud der blaue Himmel dazu ein, eine Ausfahrt zu machen.
Doch zunächst widmete sich Wimmer seiner aktuellen Büchereibeute, einem verrückten Büchlein namens »Flächenland«, das er sehr mochte. Er fand es ebenso absurd wie gelungen.
Gegen zwei Uhr verließ er schließlich das Haus in Ledermontur und schwang sich auf sein altes Motorrad.
Vor der Eisdiele sah er Anna mit Thomas. Sie hielten Händchen, doch ein unartiges Poussieren konnte er nicht erkennen. Bald ließ er Wolnzach hinter sich. Seine Fahrt hatte kein konkretes Ziel. Als er nach eineinhalb schönen Stunden auf sommerlichen Landstraßen genügend Fliegen auf seiner Motorradbrille gesammelt hatte, war er im Ilmtal bei Reichertshausen angelangt und strebte wieder nach Hause. Er wählte die schönere Strecke über schmale Nebenstraßen und kam so ohne Vorsatz auf Lohwinden zu. Was war denn das? Wimmer stutzte, nahm das Gas weg und ließ die Maschin ausrollen.
Am Straßenrand parkten mehrere Polizeibusse. Einige der dazugehörigen jungen Beamten konnte er weit hinten im Gelände gerade noch erkennen. Sie durchstöberten in langen Reihen mit dünnen Stöcken die Büsche und den benachbarten Hopfengarten. Einige ihrer Kollegen waren sehr viel näher und gingen mit tellerartigen Geräten methodisch über eine Wiese. Waren das Metallsonden? Und dort drüben, am hinteren Rand der Wiese, stand Karl Konrad. Wimmer kannte den Kommissar. Seine Frau und Konrads Roswitha waren Schulfreundinnen gewesen. Die Männer hatten sich bei verschiedenen Klassentreffen kennen- und schätzen gelernt. Nach dem Tod von Anna-Maria hatte Wimmers Detektivspielerei die lose Freundschaft wiederbelebt, auch wenn Konrad und vor allem seine Kollegen seine Aktivitäten als Hobbyermittler sehr kritisch sahen.
Konrad stand zu weit entfernt, um ihn anzusprechen, und die Wiese war mit Absperrband eingezäunt. So fuhr Wimmer weiter, nahm sich aber vor, den Kommissar bald einmal anzurufen. Kurz entschlossen revidierte er sein Vorhaben, gleich direkt nach Hause zu fahren. Stattdessen folgte er einem Impuls und bog in Lohwinden nicht Richtung Wolnzach ab, sondern fuhr noch ein Stück weiter und auf den gepflasterten Vorplatz eines großen Bauernhofs.
Wimmer hatte Glück. Helmuth und Lisa Renner saßen ums Eck im Schatten eines Apfelbaums an ihrem Gartentisch.
»Ja Ludwig!« Renner stand auf. »Was führt dich hierher?«
Vor ein paar Jahren hatte Wimmer bei Renner das eine oder andere Jungrind gekauft.
»Ich bin grad unterwegs g’wesen und hab g’dacht, schaust amal vorbei und sagst ›Grüß Gott‹.«
Ein paar Minuten später stand ein Bier vor Wimmer, und man war am Ratschen, wie man in Bayern frohes und ungezwungenes Plaudern nennt. Nach zehn Minuten waren die Themen Wetter und verfehlte Agrarsubventionen abgejammert, und ein Themenwechsel bot sich an. Wimmer überlegte schon, wie er möglichst unauffällig seine Neugier stillen konnte, als Lisa Renner das Gespräch von sich aus in die richtige Richtung lenkte.
»Sag amal, bist du von der Bundesstraß gekommen? San die Polizisten endlich fertig?«
»Na ja … ich hab an Haufen Polizeibusse stehen sehen, und auf einer Wiesen haben s’ anscheinend was g’sucht. Wird denn wer vermisst?«
»Naa, vermisst wird niemand, im Gegenteil. Hast des noch ned mit’kriegt? Die ham a Leich g’funden.«
»Wer ist es?«
Es war Helmuth Renner, der antwortete: »Das weiß bisher niemand, glaub ich. Aber«, er senkte die Stimme, »der Gumpart Schorsch hat g’meint, der muss da wohl scho a Weile g’legen ham. Dem g’hört doch die Wiese gleich daneben, wo s’ den Toten g’funden ham, und so, wie die Polizei g’fragt hat, hat er g’meint, kann der kaum frisch g’wesen sein.«
Wimmer nickte und trank bedächtig einen Schluck. Er vermied es so, etwas zu sagen, was seine Gesprächspartner hindern könnte, etwas von sich aus zu erzählen.
»Vielleicht ist es ja was Historisches«, meinte Lisa Renner. »In Pfaffenhofen ham s’ doch am Rathaus vor einiger Zeit so Skeletter aus’m Mittelalter g’funden. Oder es war so a Keltenkrieger. Die Kelten war’n hier ja eh überall.«
Wimmer brummte ein ermutigendes »Hmmm …«.
»Könnt aa a Deserteur g’wesen sein«, warf der Bauer ein.
»Ach geh, Helmuth!«
»Wieso denn nicht, Lieserl? Aa wenn ma ned gern drüber red, früher hat’s hier in der Gegend doch a paar ganz finstre Nazis ’geben. Solche, die nie recht ham aufgeben wollen. Und wie alles dann den Bach runter’gangen ist, wie der Hitler sich derschossen hat und die Amerikaner aa immer näher g’kommen san …« Der Mann lief Gefahr, den Faden zu verlieren, und setzte erneut an: »Damals ham jedenfalls ganz viele Soldaten ihr G’wehr wegg’schmissen. War ja aa vernünftig. Aber wehe, einer von dene Nazis hat die erwischt. Die ham s’ dann ruckzuck hing’richt. Ohne Prozess, ohne Priester oder Totengräber. A Graben oder a flache Gruben – und ›Peng!‹.«
»Also, Helmuth! Wo du so an Schmarrn nur immer herhast.«
Wimmer sagte nichts. Auch er wusste, dass solche Erschießungen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges vorgekommen waren, hier im Hopfenland wie auch anderswo. Doch bevor er weiter über Helmuth Renners Nazi-Theorie nachdenken konnte, wollte dessen Frau wissen, wie es Karola ging, und schon war das Thema erneut gewechselt. Nach einer knappen halben Stunde lehnte Wimmer das zweite Bier ab und verabschiedete sich. Er kam gerade noch rechtzeitig zum Familiengrillabend nach Hause.
Montag
Soko Wiesengraben
Kurz nach acht Uhr bestieg Karl Konrad in Geimersheim seinen Wagen, fuhr aus der Garage seiner Doppelhaushälfte und machte sich auf den Weg zum neun Kilometer entfernten Präsidium.
An den Einfallstraßen Ingolstadts passierte er Übersichtstafeln zur Orientierung, die auch den ehemaligen Verlauf der Stadtmauer zeigten. Beinahe kreisförmig hatte sie die Altstadt nördlich der Donau eingefasst. Im turbulenten letzten Jahrhundert war der historische Ortskern mit seinem mittelalterlichen Charme weitgehend verschont geblieben. Als zu Zeiten Napoleons die Stadt zu einer Landesfestung ausgebaut worden war, waren rings um die Altstadt zahlreiche Kasernen, Forts, Basteien, Festungs- und Batteriebauten errichtet worden, die noch immer an vielen Stellen mit ihren roten Ziegeln und dem weißen Kalkstein das Bild der Stadt prägten.
Die Gebäude der ehemaligen Friedenskasernen, zwei lang gestreckte, mehrgeschossige Bauten aus hellrotem Mauerwerk, wuchtig und doch schön gegliedert, standen unmittelbar nördlich der Altstadt am Busbahnhof. Das westliche der Häuser diente als Polizeipräsidium Oberbayern Nord.
Hier ging Karl Konrad gegen halb zehn Uhr vormittags durch die langen Flure zum kleinen Konferenzzimmer. Er kam etwas zu spät zur Besprechung, die für den skelettierten Leichnam angesetzt worden war. Frau Dr. Beate Müller würde als Staatsanwältin die Ermittlungen formal leiten. Sie war gut in ihrem Fach und auch recht umgänglich, solange man ihr ordentlich zuarbeitete. Sie verlangte solide Ergebnisse, die vor Gericht Bestand hatten. Lieferte man ihr Material, das ein Verteidiger vor Gericht genüsslich zerpflücken konnte, ließ sie das dumm aussehen. Solche Situationen verabscheute sie. Verantwortliche Ermittler lernten sie dann von ihrer garstigen Seite kennen. Doch dies war schon länger nicht mehr vorgekommen.
Anwesend waren Thalmayr und sein Kollege Linner von der Spurensicherung sowie – auf Konrads Wunsch – Kommissar Lukas Stimpfle.
Konrad nahm Platz und entschuldigte sich für sein Zuspätkommen. »Mein Drucker hat g’sponnen. Aber das hier hab ich unbedingt noch mitbringen wollen.« Er deutete auf ein dünnes Bündel Papier in seiner Hand, dann berichtete er vom Leichenfund und fasste die bisherigen Ergebnisse zusammen. Es waren nur wenige. »Man muss wohl von einem Mord ausgehen. Wir konnten einen Kopfdurchschuss feststellen, haben aber keine Waffe gefunden.«
»Herr Thalmayr? Herr Linner?« Dr. Müller wandte sich den Spurensicherern zu.
Thalmayr räusperte sich und meinte dann: »Im Moment ist der Tote in München. Wenn es sich denn nur um einen Toten handelt. Es könnten theoretisch auch ein Kopf ohne Körper und ein Körper ohne Kopf sein. Das ist aber eher unwahrscheinlich.«
»Malen Sie bitte nicht den Teufel an die Wand!«, rief Dr. Müller. »Das fehlte uns gerade noch. Der Fall wird auch ohne solche Komplikationen schwer genug. Wie lange hat der Tote auf der Wiese gelegen?«
Thalmayr seufzte. »Ich will den Docs in München nicht vorgreifen. Aber nur so als grobe Schätzung: a paar Wochen. Mindestens drei oder vier, vermutlich eher mehr. Dazu wird uns das rechtsmedizinische Institut Genaueres sagen können. Im Moment haben wir nicht allzu viel Spurenmaterial. Die Münchner werden den Toten selbst untersuchen und was er dabeig’habt hat. Später, wenn wir die Effekten des Toten haben, werden wir uns die natürlich auch ganz genau anschauen. Im Augenblick haben wir aber kaum mehr als die Tatortskizze und die spurentechnische Untersuchung des Fliegers. Aber der wird kaum in einer Verbindung zum Toten stehen. Also haben wir uns dort nicht allzu sehr verkünstelt. So weit waren wir schon am Samstag. Ist gestern, als ich freig’habt hab, noch was herausgekommen?«
»Die Bereitschaftspolizei hat zwar die Umgebung nach den fehlenden Gliedmaßen abgesucht, aber gefunden haben die Jungs leider fast nix«, antwortete Konrad. »Nur eine Schuhsohle und ein paar abgenagte Knochen, die zu einer Hand gehören könnten. Die Metalldetektoren, die wir benutzt haben, haben leider auch nichts Hilfreiches zutage befördert.«
»Die Wiese ist ned g’mäht gewesen«, wandte Thalmayr ein.
»Ihr habts a hohes Gras mit Metalldetektoren abg’sucht? A Wies’n, auf der zig Leut zwei Tage lang herumgetrampelt sind? Der Schmarrn war grad umsonst«, maulte Linner ungehalten. »So kommt bei der Suche fei nix G’scheites raus. Des müssts machen, wenn das Gras kurz ist. Aber ob man dann mehr findet, ist natürlich aa ned sicher. Insgesamt ham mir also an Toten, a Skizze und sonst nix. Schöner Kaas.«
Alle lächelten. Linner war ein hervorragender Fachmann für Spurensicherung und liebte seine Arbeit. Auch wenn er in einem fort grantelte und lamentierte, so fühlte er sich von Schwierigkeiten doch stets herausgefordert. Sein zur Schau getragener Missmut gehörte einfach zu ihm wie das Brummen zu einem laufenden Motor. Es mochte nicht so aussehen, dennoch war Linner dabei, sich für den Fall zu begeistern, und alle am Tisch wussten das.
»Was machen wir also?«, wollte Dr. Müller wissen. »Das ist eigentlich eine Sache für eine Sonderermittlungsgruppe.«
Niemand widersprach.
»Herr Konrad? Wollen Sie vielleicht …?«
»Naa. Lassen Sie mich bitte da raus. Ich steck bis über beide Ohren in den Kirchendiebstählen drin. Sie wissen, die Geschichte, die mir der Herr Hacker aufs Auge gedrückt hat. Der Fall wird immer größer.«
Vor vier Monaten, in der Mordkommission war es ausnahmsweise etwas ruhiger gewesen, hatte Staatsanwalt Hacker Konrad gebeten, Ermittlungen zu ein paar Kunstdiebstählen anzustellen. Mehrfach war in Kapellen und kleinere Dorfkirchen eingebrochen worden, Heiligenfiguren, bei denen es sich stets um schöne, solide Volks- beziehungsweise Handwerkskunst handelte, waren entwendet worden. Herausragende Kunstwerke, die in der Literatur dokumentiert waren und man leicht wiedererkennen könnte, waren nicht darunter. Es gab kaum Spuren, aber ein gewisses Muster. Alles deutete auf eine immer wieder zuschlagende Diebesbande hin, die leider für die Ermittler nur wenige Anhaltspunkte hinterließ. Weil der Fall verzwickt war, hatte Staatsanwalt Hacker Karl Konrad gebeten, sich der inzwischen fünf Einbrüche in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt anzunehmen.
Eine scheinbar überschaubare Aufgabe. Konrad nahm seine Ermittlungen auf, ging dabei auch einigen anderen Kunstdiebstählen nach, und plötzlich gehörten auch der unaufgeklärte Raub eines Feldkruzifixus im Landkreis Pfaffenhofen und ein weiterer Diebstahl aus einer Kapelle bei Erding zu dieser Serie. Je mehr Konrad nachforschte, umso mehr Diebstähle fand er plötzlich, und umso größer wurde sein Aktionsradius. Binnen fünf Wochen hatte sich die einst übersichtliche Ermittlung zu fast hundert Einzelfällen in einem Zeitraum von mehr als vier Jahren ausgewachsen. Das Gebiet seiner Untersuchungen erstreckte sich im Osten bis kurz hinter Deggendorf ins Niederbayrische und im Norden bis Cham. Der westlichste Diebstahl hatte sich in einer Kapelle bei Memmingen im Allgäu zugetragen, im Süden operierten die Gauner im gesamten Voralpenland zwischen Füssen und dem östlichen Chiemgau. Sehr viele Fälle, sehr viele Ermittler in den verschiedenen Dienststellen, aber immer noch kaum Spuren.
Konrad hatte es immerhin geschafft, dass alle zuständigen Kollegen nicht nur am selben Strang zogen, sondern nun auch in dieselbe Richtung. Sein Engagement hatte allerdings zu etwas geführt, was er nie im Sinn gehabt hatte: Er war nun die zentrale Koordinationsstelle und leitete die Gesamtermittlung, zu der immer noch jeden Monat ein oder zwei Fälle dazukamen.
»Ich bin heut nur dabei, weil ich der Kommissar vom Dienst war«, sagte er nun. »Aber der Herr Stimpfle …«
Kriminalhauptkommissar Lukas Stimpfle war sechsunddreißig Jahre alt, ein Import aus Stuttgart und seit mehr als zwei Jahren ein fähiger Ermittler im Team. Zwar hatte er immer noch gewisse Schwierigkeiten in seiner neuen Heimat, sowohl mit dem Verständnis der Sprache als auch mit dem großzügigeren Naturell, doch gerade seine schwäbische Art, alles genau zu nehmen und sich hartnäckig in Sachen zu verbeißen, hatte sich schon wiederholt als wertvoll erwiesen. In der Vergangenheit hatte er sich als Assistent von Konrad bewährt und vor einem Jahr recht erfolgreich eine eigene Soko in einem Mordfall geleitet.
Eine Minute später war der Schwabe somit zum Leiter der Soko Wiesengraben befördert.
»Wen wollen Sie dabeihaben?«, fragte Dr. Müller.
»Im Moment nur Frau Daschner, wenn des möglich isch.«