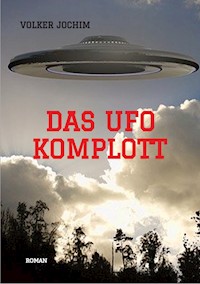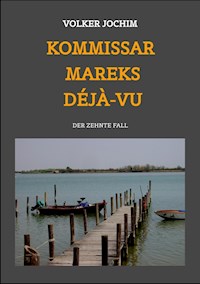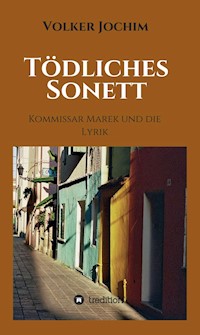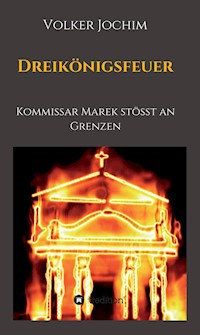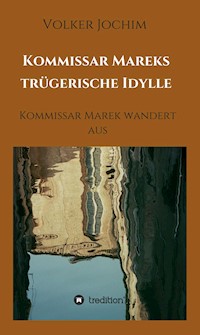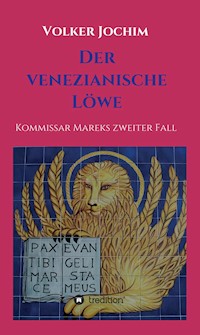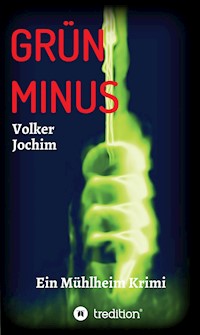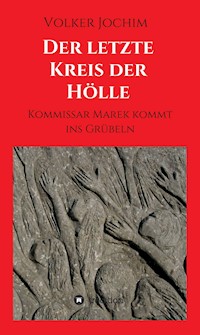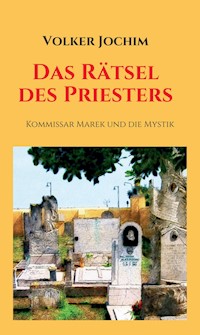2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Privatdetektiv Henry Pieroth erhält den Auftrag den Mörder eines Mädchens zu finden. Er ahnt nicht, dass dieser Mord erst der Anfang einer Serie von äußerst bizarren und grausamen Morden ist, welche die sonst so friedliche Kleinstadt Mühlheim am Main in Angst und Schrecken versetzt und bei der eine spätmittelalterliche Dichtung eine große und tragende Rolle spielt. Ein äußerst spannender Mühlheim Krimi um einen besonders perfiden Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Jochim
Tod im Kreis
Ein Mühlheim Krimi
Kriminalroman
© 2016 Volker JochimUmschlag, Illustration: tredition,Volker Jochim (Foto)
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-5327-1
Hardcover
978-3-7345-2080-8
e-Book
978-3-7345-2081-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1
Henry A. Pieroth hatte alles, von was die meisten seiner Zeitgenossen nur träumen konnten. Er war mit fünfunddreißig Jahren im besten Alter, sah, zumindest aus Sicht der Damenwelt, sehr gut aus, obwohl er nicht mehr gerade die sportlichste Figur besaß, hatte sein Abitur mit Auszeichnung bestanden, seine Promotion in forensischer Psychologie mit summa cum laude abgeschlossen und er war sehr reich. Das A in seinem Namen steht für Anton, den Vornamen seines Großvaters väterlicherseits, aber es war bei Todesstrafe verboten ihn mit diesem Namen anzusprechen. Einen Makel gab es dennoch, zumindest in den Augen derer, die ihn besser kannten – er war stinkfaul. Sein Abitur und seinen Studienabschluss verdankte er seiner überdurchschnittlichen Intelligenz und nicht etwa seinem Lerneifer. Was andere sich durch Fleiß hart erarbeiten mussten, sog er, bildlich gesprochen, einfach auf und speicherte es unauslöschlich ab. Seine finanzielle Unabhängigkeit war ebenfalls nicht der Verdienst harter Arbeit, sondern ein geerbtes Vermögen. Als vor zwölf Jahren seine Eltern auf dem Rückweg von einem Geschäftsessen in Mailand mit ihrer Privatmaschine über den Alpen abstürzten, hinterließen sie ihrem einzigen Sohn nicht nur die Mehrheitsanteile einer international vernetzten Beteiligungsgesellschaft, sondern auch ein mehr als beträchtliches Vermögen. Die nächsten zwei Jahre, bis zum Abschluss seines Studiums, lebte Henry Pieroth zusammen mit fünf Hausangestellten im Anwesen seiner Eltern, einem verstaubten, alten Kasten, wie er es nannte. Nach seiner Promotion verkaufte er das Haus, fand die Angestellten großzügig ab und baute sich im Mühlheimer Franzosenviertel ein Haus nach seinen Vorstellungen, in dem es ihm an nichts fehlte. Die Firma übergab er in die Hände eines vertrauenswürdigen Treuhänders und führte fortan das Leben eines Privatiers. Er verbracht seine Zeit mit schlafen, essen und lesen. Was er zum Leben benötigte, ließ er sich anliefern, da er es hasste, das Haus zu verlassen. Am liebsten las er Kriminalromane und Berichte über große, oder ungeklärte Kriminalfälle, die er gewissenhaft aus Zeitungen und dem Internet sammelte und archivierte.
Als es eines Tages an seiner Türe läutete und er missmutig auf den Überwachungsmonitor sah, stand statt eines Lieferanten Frank Sommer, sein bester und auch einziger Freund aus der Abiturklasse, vor Tür. Menschen wie Henry hatten eigentlich keine Freunde, umso erstaunlicher war es, dass diese Freundschaft nicht nur die gemeinsame Schulzeit überdauerte, sondern bis heute anhielt.
Da sie sich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatten, unterhielten sie sich über die alten Zeiten und wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen war. Das hieß, Frank Sommer redete und Henry hörte zu. Reden gehörte eben auch zu den Dingen, die er nicht besonders mochte. Zum Schluss vertraute Frank, der sein Informatikstudium mehr schlecht als recht abgeschlossen hatte, seinem Freund an, dass man ihn vor ein paar Wochen entlassen hatte und er auf Jobsuche sei.
„Und was treibst du so, altes Haus?“
Henry kratzte sich sein unrasiertes Kinn.
„Ich beschäftige mich mit dem perfekten Verbrechen.“
„Wie das denn?“, fragte Sommer erstaunt. „Arbeitest du für die Polizei?“
„Nein, im Gegenteil, ich beschäftige mich mit deren Unfähigkeit. Ich sammle Berichte über interessante, ungeklärte Fälle und erstelle meine persönlichen Fallstudien. Sehr oft komme ich dann zu einem völlig anderen Lösungsansatz.“
„Aha, und sonst?“
„Wie und sonst? Das ist anstrengend genug. So ein Fall entzieht mir die ganze Energie. Danach muss ich mich ausruhen.“
„Aber du spielst das Ganze doch nur hypothetisch durch“, warf Sommer ein.
„Es gibt Menschen, die arbeiten mit ihren Händen. Wenn die nach Hause kommen, sind sie erledigt. Ich arbeite mit meinem Kopf und das strengt genauso an, nur eben anders.“
Frank Sommer sah seinen Freund einen Moment lang verständnislos an, aber eigentlich war er ja schon immer so. Plötzlich hatte er eine Idee.
„Wie wäre es, wenn du daraus einen Beruf machen würdest?“
Henry sah aus, als hätte ihn der Blitz getroffen. Er hatte das Gefühl, dass die Unterhaltung eine unangenehme Wendung nahm. Alleine das Wort Beruf ließ ihn erschaudern. Das klang nach Arbeit und das war nicht sein Ding.
„Einen Beruf? Ich habe mit mir und den Fällen genug zu tun. Ich bin völlig ausgelastet. Was für einen Beruf meinst du überhaupt?“
„Na, Privatdetektiv. Du könntest eine Detektei aufmachen. Dann hätten deine Anstrengungen auch einen Sinn.“
Henry ließ das Gehörte einen Moment sacken. Ein privater Ermittler – dann könnte er seine Obsession offen ausleben. Gerade wollte er sich schon mit dem Gedanken anfreunden, als ihm etwas anderes durch den Kopf ging.
„Wenn das bekannt würde, kämen die Leute und wollen von mir, dass ich ihre entlaufenen Köter suche, oder ihre Ehefrauen im Bett ihres Nachbarn fotografiere. Nein danke! Auf dieses Niveau lasse ich mich nicht herab.“
„Musst du ja auch nicht. Du bist finanziell unabhängig und kannst dir die Fälle aussuchen, die du bearbeiten willst. Am besten stellst du dir eine Sekretärin ein, die dir die unliebsame Kundschaft fern hält.“
„Gott bewahre! Eine fremde Person in meinem Haus. Niemals!“
„Dein Büro muss ja nicht hier im Haus sein. Du mietest dir ein schickes Büro…“
Weiter kam er nicht.
„Kommt überhaupt nicht infrage! Ich werde meine vier Wände nicht verlassen!“
Henry A. Pieroth lehnte sich zurück und starrte eine Weile an die Decke. Dann beugte er sich nach vorne und grinste seinen Freund an.
„Ich mache es, aber nur unter folgenden Bedingungen: Das Büro ist in diesem Haus, du wirst mein Assistent und du ziehst hier ein.“
„Ich…?“, fragte Sommer perplex.
„Ja, du. Du suchst doch eh einen neuen Job. Hier hast du einen. Was sagst du?“
„Ich weiß nicht…“
„Ich zahle dir das Doppelte von dem, was du in deiner blöden Firma verdient hast. Das Haus ist außerdem groß genug. Du bekommst deine eigene Wohnung.“
Da konnte Frank Sommer nicht mehr ablehnen.
***
Ein paar Tage später war eine ganze Armada von Handwerkern dabei das Souterrain in eine separate Wohnung umzufunktionieren, in der es an nichts fehlte, und zwei der großen Räume im Erdgeschoss in Büros zu verwandeln. Zuletzt hielt der Lieferwagen eines bekannten Antiquitätenhändlers vor der Tür und brachte einen riesigen Schreibtisch aus edlem Holz und einen monströsen, aber sehr bequemen Ledersessel. Auf die Frage seines Freundes, was er denn mit diesem alten Schreibtisch in seinem modernen Büro wolle, entgegnete Henry, dass Humphrey Bogart in einem dieser amerikanischen Detektivfilme auch solch einen Schreibtisch gehabt habe. Daher war er der Meinung, dass ein Detektiv so etwas braucht. Nur der passende Stuhl dazu wäre ihm zu unbequem gewesen, deshalb hätte er sich diesen Sessel gekauft.
Frank hatte seinen Freund überredet mit nach draußen zu kommen. Nur bis zur Einfahrt des Grundstücks. Hier wischte er mit dem Ärmel des Sakkos über die große, glänzende Messingtafel, die neben dem Briefkasten und der Gegensprechanlage mit der Kamera angebracht war.
Henry A. Pieroth Private Ermittlungen Termin nur nach Vereinbarung
stand in großen Lettern darauf zu lesen, während, fast wie in einem kitschigen Film, die untergehende Sonne ihre letzten Strahlen über die leicht gekräuselte Wasserfläche des Mains schickte.
2
Fast einen Monat gab es nun schon die Detektei Pieroth, ohne dass sie bislang einen einzigen Auftrag angenommen, oder gar erledigt hätte. Frank Sommer war mittlerweile nicht nur Assistent, sondern auch Sekretär und Laufbursche für Henry Pieroth. Ein richtiges Faktotum. Ihm selbst machte das nichts aus, so war er beschäftigt und bezahlt wurde es ja auch noch über alle Maßen gut. Seinen Arbeitgeber sah er nur höchst selten.
Es war ja nicht so, dass es keine Anfragen gegeben hätte, doch Sommer hatte sie bislang alle abgelehnt da er wusste, dass Pieroth an diese Art von Aufträgen auch nicht eine Sekunde seiner Zeit verschwendet hätte. Doch an diesem Nachmittag sollte sich alles ändern…
***
„Guten Tag…“
Es hatte geläutet und Sommer hatte die Türe geöffnet. Vor ihm stand ein älterer Mann, der etwas eingeschüchtert wirkte.
„…mein Name ist Scholak, Ernst Scholak. Sind Sie Herr Pieroth?“
Sommer beobachtete wie der Mann verlegen seine karierte Mütze in den Händen drehte.
„Nein, ich bin sein Sekretär. Sommer, Frank Sommer, aber kommen Sie doch bitte erst einmal herein.“
Er führte den Mann in sein Büro und bat ihn Platz zu nehmen.
„Was können wir für Sie tun?“, fragte er den Mann, der sich Ernst Scholak nannte und mit großen Augen das teure Interieur des Büros betrachtete. Dabei kamen ihm Zweifel, ob dieser Mann überhaupt das Honorar bezahlen konnte, das sein Freund verlangte. Dazu kamen noch horrende Tagesspesen.
„Also, es ist so…“, begann der Mann und drehte weiter nervös seine Mütze in den Händen.
Nach den ersten Sätzen unterbrach ihn Sommer. Er hatte das Gefühl, dass dies ein Fall ist, der seinen Freund durchaus interessieren könnte.
„Einen kleinen Moment bitte. Ich bin gleich wieder für Sie da“, entschuldigte er sich und ging zu Henrys Büro.
Der hatte die Füße auf der Schreibtischplatte und las Zeitung. Neben ihm stapelten sich dutzende anderer Ausgaben auf dem Boden und auf dem Schreibtisch lagen Bücher und Zeitungsausschnitte in einem wilden Durcheinander.
„Ich glaube, das solltest du dir anhören. Wird dich bestimmt interessieren.“
„Was ist es denn diesmal?“, fragte er gelangweilt. „Wieder eine verschwundene Ehefrau?“
„Nein. Es geht um einen Mord und die Polizei tappt wohl im Dunkeln.“
Henry Pieroth nahm die Füße vom Tisch, ließ die Zeitung fallen und richtete sich auf.
„Ein interessanter Mord?“
„Das zu beurteilen überlasse ich dir. Ich bringe den Mann gleich rüber. Er heißt Ernst Scholak und wohnt hier in Mühlheim. Nur glaube ich nicht, dass er dein Honorar bezahlen kann.“
„Bring ihn her“, wischte er die letzte Bemerkung seines Freundes beiseite.
***
„Guten Tag Herr Pieroth“, sagte der Mann, als er von Frank Sommer durch die Bürotür geschoben wurde.
„Kommen Sie doch herein und nehmen Sie Platz, Herr Scholak. Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht einen Kaffee?“
„Nein, vielen Dank.“
Sommer hatte sich mit seinem Notizblock an einem Tisch in der Ecke niedergelassen.
„Dann erzählen Sie mal“, forderte Pieroth den Mann auf „und legen Sie die Mütze bitte hin, das macht mich nervös.“
„Wie unsensibel Henry doch ist“, dachte sein Freund bei sich.
„Vor genau drei Wochen“, begann Scholak, „vor genau drei Wochen hat man meine Tochter tot aufgefunden. Ermordet, wie mir die Polizei mitteilte. In der Rechtsmedizin durfte ich nur ihr Gesicht von weitem sehen. Sonst hat man mir bisher nichts gesagt. Ich möchte, dass Sie herausfinden, was passiert ist und wer mein Kind getötet hat.“
Tränen rannen über die Wangen des Mannes, die er verschämt mit dem Handrücken wegwischte.
„Die Polizei hat Ihnen nichts gesagt?“
„Nein, gar nichts. Das ist es ja. Da ist bestimmt etwas faul. Deshalb möchte ich Sie ja engagieren.“
Pieroth lehnte sich zurück, hatte die gefalteten Hände unter sein Kinn geschoben und starrte an die Decke.
Sommer, der alles notiert hatte, dachte zuerst einmal an das Wirtschaftliche.
„Sie kennen unser Honorar? Fünfhundert Euro pro Tag plus zweihundertfünfzig Euro Spesen. Ebenfalls pro Tag. Sollten die Ermittlungen den Radius von fünfzig Kilometern überschreiten, verdoppelt sich der Spesensatz. Auslandsreisen werden separat abgerechnet.“
Scholak wurde bleich.
„Das kann ich nicht bezahlen. Soviel habe ich nicht. Ich könnte höchstens mein Häuschen beleihen.“
„Nein! Das werden Sie nicht tun.“
Pieroth hatte sich wieder seinem möglichen Klienten zugewandt.
„Ich werde mir die Fakten ansehen. Wenn ich dann noch Interesse an dem Fall habe, werde ich ihn übernehmen. Wegen des Honorars machen Sie sich keine Gedanken. Zwei Dinge muss ich noch wissen: Wo wurde Ihre Tochter gefunden und Ihre Adresse.“
„Meine Tochter wurde neben der Willy-Brandt-Halle gefunden und wir wohnen in der Trachstraße. Hier ist meine Karte.“
„Wir melden uns spätestens in zwei Tagen. Auf Wiedersehen, Herr Scholak.“
Pieroth verabschiedete seinen Besuch. Er betrachtete die Visitenkarte. Ernst Scholak, Handelsvertreter, der konnte sich sein Honorar bestimmt nicht leisten.
„Frank!“, hörte Sommer seinen Freund rufen, als er den Mann zur Tür gebracht hatte, und ging zurück ins Büro.
„Sag mal, was war das denn? Ich meine mit dem Honorar? Du hattest es doch so festgelegt.“
„Du hast doch gehört, dass der Mann nichts hat und ich will nicht, dass er Stuhl und Bett verpfändet um etwas über das Schicksal seiner Tochter zu erfahren. Außerdem reizt mich dieser Fall.“