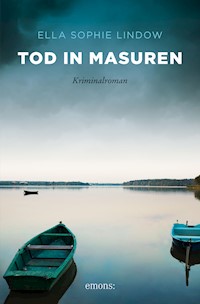
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Ein tiefgründiger Kriminalroman mit liebevollem Blick auf Polens malerische Ferienregion. Morgendliches Schwimmen, Gärtnern im Gemüsebeet und abendliches Grillen mit ihren Gästen auf dem Hof – Maries Ferienidylle in Masuren scheint perfekt. Bis zu dem Tag, an dem in dem Wäldchen auf ihrem Grundstück eine Leiche gefunden wird und ihre Welt ins Wanken gerät. Als sie auf einmal selbst unter Mordverdacht steht, beschließt Marie, auf eigene Faust zu ermitteln, und taucht dabei in die polnische Nachkriegsgeschichte ein. Ihre Neugier und ihr Gespür für historische Zusammenhänge bringen sie der Lösung nahe – und in tödliche Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[1] Der östliche Teil Polens und seine Nachbarländer
[2] Masurische Seenplatte
Ella Sophie Lindow ist ein Pseudonym. Die Autorin arbeitet als Hochschullehrerin an einer mitteldeutschen Universität. Seit über zwanzig Jahren verbringt sie ihre Sommermonate in Masuren. »Tod in Masuren« ist ihr erster Kriminalroman.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/ysuel
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Karte [1]: © shutterstock/Bardocz Peter (bearbeitet)
Karte [2]: © OpenStreetMap-Mitwirkende (bearbeitet)
Lektorat: Dr.Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-056-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
EINS
In Mrągowo ging sie vom Gas. Jetzt begann die letzte kurvige Strecke, die Marie in den vergangenen zwanzig Jahren immer wieder gefahren war, häufig mit dem Gefühl freudiger Erwartung, manchmal aber auch mit Bangigkeit, weil sie nie genau wusste, wie sie ihr Grundstück und ihr Haus nach der Abwesenheit im Winter wohl vorfinden würde. Und immer wieder erinnerte sie die Fahrt daran, wie sie vor mehr als zwanzig Jahren bei schrecklichem Regen und heftigem Gewittersturm, damals noch mit ihrem viel zu früh verstorbenen Mann, dieses letzte Stück der langen Strecke aus Deutschland, von Mrągowo nach Giżycko, zurückgelegt hatte, um den kleinen Hof zu erwerben, den sie beide im Sommer zuvor entdeckt hatten. Es war schon dunkel geworden, hatte in Strömen gegossen, sie hatten viel Gegenverkehr von breiten durch die Pfützen spritzenden und die Kurven schneidenden Lastern aus Litauen und Lettland gehabt, und vor ihnen waren kleine Polski Fiats dahingetuckert, eine fürchterliche Fahrt. Sie hatten sich gefragt, auf welches Wahnsinnsunternehmen sie sich hier einließen: einen alten teilweise verfallenen Vierseithof in Masuren, der zum Verkauf stand, zu erwerben, ohne ein Wort Polnisch zu sprechen, einfach nur, weil das Gehöft so traumhaft lag, umgeben von den leichten Hügeln der Endmoränenlandschaft mit Blick auf einen der zahlreichen Seen. Das hatte sie von Anfang an verzaubert.
Aber auf dieser denkwürdigen Fahrt zum Kaufvertrag war Marie fast geneigt gewesen, das scheußliche Wetter als schlechtes Omen zu nehmen und alles rückgängig zu machen, umzukehren und die Plastiktüte mit dem Geld, das beim Notar der Verkäuferin übergeben werden sollte, wieder mit nach Deutschland zu nehmen, doch dann hatte ihr Mann ihr gut zugeredet und sie bewogen, die Geschichte, die sie so enthusiastisch begonnen hatte, nun auch zu Ende zu bringen. Er war bei Maries Idee, den kleinen Hof zu erwerben, skeptisch gewesen, hatte Bedenken geäußert, sich dann aber von ihrer Begeisterung anstecken lassen und versprochen, seinerseits seinen Beitrag zu dem ganzen Unternehmen zu leisten, indem er Polnisch lernen würde.
Angesichts von Maries Zögern erwies er sich nun als Stütze. »Überleg doch einmal, was uns denn schon passieren kann; im Zweifelsfall müssen wir die ganze Geschichte wieder aufgeben, aber jetzt sollten wir sie erst einmal durchziehen«, hatte er gesagt, und sie hatten nicht kehrtgemacht, sondern waren weitergefahren, vorbei an der alten Ordensburg in Ryn, die inzwischen renoviert war und mit ihren Ritterbanketten große Reisegesellschaften anzog, weiter durch kleine Dörfer mit Storchennestern am Straßenrand, bis sie schließlich die Ausläufer von Giżycko erreichten, wo am Tag darauf der Kauftermin des alten Bauernhofs stattfinden sollte. Der Plan war, der früheren Besitzerin, einer alten Dame, solange sie lebte, Wohnrecht auf dem Hof zu gewähren und aus einem der verfallenen Stallgebäude ein Sommerhaus bauen zu lassen.
Es war alles nicht ganz einfach gewesen, aber letztlich war aus alten auf dem Grundstück herumliegenden Bruchsteinen ein wunderschönes Haus entstanden, und Marie und ihr Mann hatten dort – als Hochschullehrerin und -lehrer mit dem Privileg ausgestattet, in der vorlesungsfreien Zeit überall arbeiten zu können – viele glückliche Sommer verbracht, und für Marie war es nach wie vor ein wunderbarer Rückzugsort zum Auftanken.
Das alles ging ihr durch den Kopf, als sie jetzt die Strecke fuhr, um ihre Sommermonate wie gewohnt in Masuren zu verbringen. Sie war den Weg oft gefahren und kannte alle Kurven. Es gab nach wie vor viel Verkehr, aber er hatte sich geändert wie so vieles in Polen: Die langsamen Polski Fiats waren größeren, schnellen westeuropäischen Autos gewichen; Panjewagen gab es nicht mehr auf den Straßen, allenfalls noch in Museen, und viele der kleinen Ortschaften hatten Umgehungsstraßen erhalten. Die Fußballeuropameisterschaft, vor allem aber die EU-Mittel hatten den Straßenbau vorangetrieben; Autobahnen waren gebaut, große Verbindungsstraßen frisch asphaltiert, Schlaglöcher repariert worden; über weite Strecken war das Autofahren in Polen auf den großen Verkehrswegen inzwischen deutlich angenehmer als in Deutschland, lediglich die Sorge vor manchen zu abenteuerlichen Überholmanövern neigenden Fahrern war geblieben.
Der Weg von Berlin hatte dank der besseren Straßenverhältnisse nur neun Stunden gedauert, und so stand die Sonne noch am Horizont, als Marie in die kleine Straße mit Kopfsteinpflaster einbog. Sie wurde nach einer Kurve zu einem Sandweg, der durch Felder und Wiesen und vorbei an einem kleinen Wäldchen führte und schließlich in die etwas verwunschene, von Birken und Weiden gesäumte Zufahrt zu ihrem Hof mündete.
Zu ihrer Vorfreude auf eine schöne Sommerzeit kam dieses Mal eine große Erleichterung: Es war im vergangenen Monat endgültig gelungen, die lästigen Grundstücksquerelen, die es in ländlichen Gebieten immer wieder gibt, zu klären; in einem Tausch hatte sie ihren Hügel mit dem Blick auf den See ein Stück vergrößern können und dafür das Ackerland mit dem kleinen Teich und dem dahinterliegenden Wald an einen benachbarten Bauern abgetreten. Es war ein schwieriger Prozess gewesen, vor allem weil der Geodät, der vor zwanzig Jahren das Grundstück vermessen hatte, es nicht nur als zu groß, sondern auch noch mit falschen Koordinaten eingetragen hatte. Aber das war nun alles überstanden, und Marie hoffte, dass dieser Sommer nicht, wie der vorige, von unerwünschten Auseinandersetzungen überschattet sein würde.
Schon vom Sandweg aus konnte sie den großen alten Ahorn und die hochgewachsene Doppellärche auf dem Dach der Piwnica, des Erdkellers, sehen – sie war als Setzling immer wieder vom Rehbock verbissen worden und dann mit großer Widerstandskraft zu einem Doppelstamm geworden –, dazu das Storchennest auf dem Elektromast. Drei Junge waren es diesmal, hatte ihr Tomek, der nette Nachbar, der sich um das Anwesen kümmerte, am Telefon berichtet; er hatte auf Maries Bitte hin auch schon Tische und Bänke für den Innenhof und die Terrasse aus der Scheune geholt und aufgestellt.
So sah der kleine Vierseithof sehr einladend aus, als Marie ankam: Die Stockrosen blühten mit aller Pracht und in allen Farben vor dem Haus und dem gegenüberliegenden Stallgebäude, dazwischen hatten sich roter Mohn, duftender Lavendel und blauer Salbei breitgemacht, und die Abendsonne tauchte das Ganze in ein mildes Licht. Es war das Masurenbild, das Marie so liebte, das ihr immer Herz und Sinne öffnete. Sie blieb eine Weile im Innenhof stehen, ging dann zum Haus und begann, die nötigsten Sachen aus dem Auto zu holen und sich für den Sommer, in dem ein Buch zu Biografien entstehen sollte, einzurichten.
Morgen würde sie als Erstes ihre polnischen Freunde besuchen, allen voran Staszek, den emeritierten Juraprofessor aus Warschau. Er hatte sich nach dem Tod seiner Frau und wohl auch nach Streitigkeiten mit der ersten PiS-Regierung der Gebrüder Kaczyński in den Jahren 2006 und 2007 frühzeitig aus seinem Amt zurückgezogen, hatte seine Wohnung in Warschau vermietet und lebte nunmehr ganzjährig in seinem Blockhaus im Wald, ging jagen und angeln und hatte gelegentlich Jagdgesellschaften zu Gast. Von Zeit zu Zeit schrieb er Gutachten zur Nachhaltigkeit für die Partia Zieloni, die polnischen »Grünen«, deren Ziele zum Naturschutz er unterstützte, deren westlich angehauchte liberale Ideen er sich aber, wie Marie argwöhnte, eher nicht zu eigen gemacht hatte.
Seit zwei Jahren war er mit Małgorzata zusammen, einer versierten und erfolgreichen Anwältin aus Olsztyn, die Marie bei den Auseinandersetzungen um die Ländereien sehr geholfen und es auch geschafft hatte, die falschen Angaben des seit einiger Zeit nicht mehr auffindbaren Geodäten zu revidieren. Die Wochenenden verbrachte Małgorzata meistens bei Staszek, und Marie schätzte sie nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten als Anwältin, sondern auch wegen ihrer Fröhlichkeit und ihrer Unternehmungslust. Zudem sprach sie, wie auch Staszek, vorzüglich Deutsch.
Staszek hatten Marie und ihr Mann schon auf ihrer ersten Masurenreise kennengelernt. Der Kontakt war über die Universitäten zustande gekommen; es ging, wie Marie sich vage erinnerte, um einen Vergleich polnischen und deutschen Rechts in historischer Perspektive, über den die beiden Männer diskutieren wollten. Staszek war, wie üblich im Sommer, gemeinsam mit seiner Frau in seinem Blockhaus, und sie hatten Marie und ihren Mann sogleich zum Essen eingeladen. Die beiden hatten jene polnische Herzlichkeit und Gastfreundschaft praktiziert, die Marie von jeher so an dem Land fasziniert hatten und die ihr das Gefühl gaben, sich dort zu Hause fühlen zu können. Sie hatten sich auf Anhieb alle gut miteinander verstanden.
Staszek war es dann auch gewesen, der ihnen zum Kauf des alten Vierseithofs zugeredet hatte, und er hatte ihnen geholfen, einige Hindernisse bei dessen Erwerb zu überwinden. Seitdem verband sie eine gute, verlässliche Freundschaft. Marie hatte ihm ihr Kommen angekündigt, zwar nicht auf den Tag genau, aber sie ging davon aus, dass er zu Hause sein würde. Voller Vorfreude auf ihre beginnende Sommerzeit in Masuren lief sie auf den Hügel und warf einen Blick auf die rot im See untergehende Sonne, um dann in ihr Haus zu gehen und sich schlafen zu legen.
Noch bevor der Wecker klingelte, wurde sie am nächsten Morgen von den ersten Sonnenstrahlen und dem Geklapper der Störche geweckt. Schnell stand sie auf und ging zu dem kleinen Gemüsegarten, den Tomeks Mutter ihr Jahr für Jahr liebevoll anlegte, um sich dort ein paar frische Möhren für das Frühstück zu holen. Aber vor dem Frühstück würde sie zu dem verschwiegenen kleinen See in der Nähe von Staszeks Haus fahren, um ein paar hundert Meter zu schwimmen und den See an seiner schmalsten Stelle einmal zu überqueren.
Es war herrliches Wetter. Marie stellte ihr Auto in einiger Entfernung vom See ab und ging durch den Wald, nicht ohne sich hin und wieder ein paar von den köstlichen Waldhimbeeren, die den schmalen Pfad säumten, in den Mund zu stecken. Hinter einer letzten Wegbiegung sah sie den See, silbern durch die Bäume glitzernd, vor sich liegen. Die Sonne stand inzwischen höher und beleuchtete schon den im Schatten der großen Bäume liegenden kleinen Steg, den Staszek gebaut hatte. Er hatte eine Schneise in das Schilf geschlagen, damit man einen guten Einstieg hatte, vor allem aber hatte er in diesem Jahr, wie er Marie am Telefon erzählt hatte, eine zusätzliche Stufe – extra für sie – gebaut, weil der Wasserstand gesunken war; die Biber hatten mal wieder ihr Werk getan und einen Zufluss zu dem See verstopft.
Marie warf ihr Kleid über die Stange am Steg – auch ein Bauwerk von Staszek – und nutzte die hilfreiche Stufe, um in das samtige, etwas grünlich blühende Wasser einzutauchen. Die Bäume an der gegenüberliegenden Uferseite spiegelten sich im Wasser, verschwanden aber wie ein Vexierbild, als Marie ihnen entgegenschwamm. Es herrschte eine himmlische Ruhe, nur ein paar Kraniche waren zu hören, und in der Ferne klopfte ein Specht. Ab und zu kreiste ein Fischadler am Himmel, und am anderen Ufer blinkte das weiße Gefieder von zwei Schwänen auf, die langsam ihre Bahnen zogen.
Um den See, der sehr tief und fischreich war, rankte sich eine Fülle von Geschichten: Eine kleine Insel sollte angeblich schon von den Römern bewohnt gewesen sein, und im Winter beim Eisfischen sollte einmal ein Hecht aus dem von den Anglern geschlagenen Loch gekommen sein und sogleich eine Katze, die sich aufs Eis getraut hatte, in die Tiefe gezogen haben. Was auch immer daran das übliche Anglerlatein war, wenn von Zeit zu Zeit an der glatten Oberfläche ein nach Luft schnappender Fisch auftauchte, schien er aus den Tiefen von Loch Ness zu kommen. Marie genoss das erfrischende Schwimmen in der morgendlichen Stille, abseits des ganzen Trubels, der sich inzwischen in Giżycko mit seinen vielen Sommergästen ausgebreitet hatte. Hier fand sie das, was sie an Masuren faszinierte: eine geradezu bukolisch anmutende Naturkulisse, die selbst in hektischen Zeiten so friedlich und unberührt wirkte, als stehe hier noch alles miteinander im Einklang.
Bevor sie sich auf den Rückweg machte, lief sie kurz bei Staszek vorbei. Er war nicht zu sehen, und auch kein Hundebellen war zu hören; vermutlich war er schon im Wald oder hatte früh am Morgen etwas in Giżycko zu erledigen. Schade, dass er nicht zu Hause war, aber den genauen Termin ihrer Ankunft hatte sie ihm ja auch nicht genannt. Etwas enttäuscht, aber erfrischt vom Schwimmen fuhr sie zurück und setzte sich mit einem Kaffee an den Tisch im Innenhof, um den weiteren Tag zu planen.
Als Erstes stand die übliche Einkaufsfahrt nach Giżycko an, mit einem Besuch auf dem kleinen Markt, auf dem Bauern aus der Umgebung Gemüse und Früchte und eifrige Pilzsammlerinnen Pfifferlinge und manchmal sogar Steinpilze anboten. Auch die kleinen Waldheidelbeeren gab es; sie lagen in großen Eimern, aus denen die Marktleute mit einem Literglas die gewünschte Menge abmaßen, und waren ungleich aromatischer als die dicken auf Plantagen geernteten Früchte, die, in Plastikschälchen verpackt, das Angebot der Supermärkte bereicherten. Zum Glück hatte sich der kleine Markt trotz der westlichen Discounter, die sich auch in Giżycko breitmachten, erhalten können, auch wenn die alten Marktfrauen, die in den älteren Reiseführern abgebildet waren, inzwischen nicht mehr da waren und der vordere Teil des Marktes mit ziemlichem Ramsch gefüllt war.
Marie parkte ihr Auto in der Nähe der Gemüsestände und kaufte kleine Frühkartoffeln, ein Glas Rapshonig zum Auffüllen ihrer Honigbestände, frische goldgelbe Pfifferlinge und ein Pfund Heidelbeeren, dazu einen Korb voll schwarzer Johannisbeeren, die sie zu Marmelade verarbeiten würde; ihr eigener Strauch war inzwischen vom Wein an der Hauswand überwuchert worden und trug kaum noch Beeren. Außerdem entdeckte sie neben den Gemüseständen zwei Frauen, die Stauden aus ihren Gärten verkauften: weißen duftenden Phlox, Rudbeckia, den leuchtenden Sonnenhut mit seinen gelbbraunen Strahlen und selbst gezogene Geranien. Das wäre eine farbenfrohe Ergänzung des Beets vor ihrem Haus. Marie deckte sich großzügig ein und ging mit zwei Körben voller Obst und Gemüse und mit Blumen beladen zum Auto zurück, um sich durch die vielen Umleitungen, die das Straßenbild Giżyckos zurzeit bestimmten, auf den Heimweg zu machen.
Auf dem Nachhauseweg schaute sie bei Tomeks Mutter Halina vorbei, einer großen, starken Frau mit gutmütigen blauen Augen, die mit Hilfe ihres Sohnes und seit Kurzem auch einer Schwiegertochter ihren kleinen Hof mit ein paar Rindern und Hühnern, vielen Gemüsebeeten und einem bunten Blumengarten in Ordnung hielt und die sich – obwohl die gegenseitige Verständigung nur mangelhaft war, weil Marie immer noch nicht richtig Polnisch konnte – durch Herzlichkeit und Großzügigkeit Marie gegenüber auszeichnete. Bis vor ein paar Jahren hatte sie auch einige Milchkühe gehabt, und Marie hatte abends die frisch gemolkene, manchmal noch lauwarme Milch holen können, die sie ein paar Tage stehen ließ, um sie dann mit großer Begeisterung als Dickmilch mit Zucker und Schwarzbrot oder Früchten zu essen. Damals hatte Halina auch noch gebuttert und Käse gemacht. Dann aber war ihr das zu viel geworden, ihr Rücken spielte nicht mehr mit, und Marie konnte sich glücklich schätzen, dass sie ihr trotz ihrer Gebrechen jedes Jahr den kleinen Gemüsegarten neben dem Gästehaus anlegte.
Jetzt saßen sie auf den rot bezogenen Plastikhockern in der Küche, und kaum hatte Marie ihre kleinen Mitbringsel aus Deutschland auf den Tisch gestellt, da fand sie auch schon eine Tasse Tee und ein paar Kekse vor sich, und bevor sie sich verabschiedete, lagen ein Karton mit frischen Eiern und dicke duftende Tomaten aus dem Gewächshaus für sie bereit. Reich beschenkt machte sie sich auf den Rückweg. Dina, die Hündin, ein liebenswerter Mix aus Dorfhunden – Marie hatte sie schon als Welpen kennengelernt –, die sich über Maries Leckerli freute und gar nicht genug gestreichelt werden konnte, jaulte hinter ihr her, und Halina winkte ihr freundlich nach.
Maries Ankunft auf ihrem Vierseithof sprach sich schnell in der Gegend herum. Es gab eine feste Gruppe von Masurenfreunden, die Jahr für Jahr ihre Sommer dort verbrachten – arbeitend oder einfach nur den Sommer genießend: Ulla und Jan mit ihrem Sommerwohnsitz auf einer Halbinsel, Beate, die Journalistin aus Berlin, die sich seit Jahren für den Erhalt von Schloss Sztynort einsetzte; ferner Edelbert, der Musiker, der seine Wurzeln in Ostpreußen hatte und immer im evangelischen Pfarrhaus logierte, Mikołaj, der Maler aus Warschau, der auf der Suche nach masurischen Motiven schon eine Reihe von Aquarellen von Maries Vierseithof gemalt und mit großem Erfolg ausgestellt hatte, und nicht zuletzt Urs, der Ethnologe, der sich abseits im Borkenwald eine einsam liegende Hütte aus Lehm und Stroh gebaut hatte. Dazu gesellten sich zeitweise noch Ismene und Robert, die aus Schwaben nach Polen ausgewandert waren und in der Nähe von Giżycko unter ökologisch-anthroposophischem Vorzeichen eine Farm betrieben und Skudden züchteten, eine alte, sehr genügsame ostpreußische Hausschafrasse. Auch Anna, die am Gymnasium in Giżycko Deutsch unterrichtete, kam oft vorbei, und wenn er nichts anderes vorhatte, beehrte Staszek die kleine polnisch-deutsche Gruppe, die sich im Sommer immer wieder auf dem Hügel bei Marie einfand. Später würden auch noch Freunde aus Deutschland kommen, die dann bei Marie im Haus und in ihrem Gästehaus wohnen würden.
Die Gelegenheit, sich mit den alten Masurenfreunden zu treffen, fand sich schnell. Marie hatte gerade ihren Einkauf verstaut, ihren Koffer endgültig ausgeräumt und den Laptop angeschlossen, da rief Ulla an. Sie hatte von ihrem Nachbarn zwei riesengroße frisch geangelte Barsche geschenkt bekommen, die sie und Jan nicht allein bewältigen konnten. Sie wollten sie gerne mit anderen gemeinsam essen. Das kam Marie gerade recht und verhieß einen guten Einstand in Masuren. Sie rief einige Freunde an, und alle sagten freudig zu, gegen Abend vorbeizukommen.
Es dauerte nicht lange, da waren Ulla und Jan da, mit zwei glitzernden Barschen in einer großen Schüssel und einem Sack voller frisch geernteter kleiner Kartoffeln. Marie und Ulla nahmen die Fische aus, schrubbten die Kartoffeln, halbierten sie, mischten sie mit Öl, Salz und Knoblauch und füllten sie in eine Kasserolle, die sie in den Ofen stellten. Inzwischen hatten sich auch Edelbert aus dem Pfarrhaus und Beate aus Sztynort eingefunden. Sie hatte außer ihrer großen weißen polnischen Hirtenhündin Mona noch einen weiteren Gast, einen polnischen Kunsthistoriker, mitgebracht, und die Vorbereitungen konnten beginnen.
Während die Männer einen Tisch und eine Bank auf den Hügel trugen und Holz aus der Scheune holten, um zu späterer Stunde ein Feuer machen zu können, mixte Marie einen Aperitif aus selbst gemachtem Holunderblütensirup, frisch gesprudeltem Wasser und einem kleinen Schuss trockenen Pfälzer Rieslings, den sie aus Deutschland mitgebracht hatte. Ulla bereitete einen Salat aus den dicken Tomaten aus Halinas Treibhaus zu, und Marie suchte ihre Gartenbeete nach Kräutern ab, die den Winter überstanden hatten und nicht völlig von anderen Pflanzen verdrängt worden waren. In dem Steinbeet vor ihrem Haus entdeckte sie zwischen den Stockrosen und neben dem großen Salbeibusch Minze und Majoran, auf dem von Halina angelegten Gemüsebeet fanden sich Dill, Zwiebeln und Möhrenkraut. Marie gab ein paar Minzblättchen in den Aperitif, tat den Rest in den Tomatensalat und stopfte alles andere, ergänzt durch Zitronenscheiben und ein paar Knoblauchzehen, großzügig in die Fische, die dann, mit Öl begossen, in einem Fischbräter zu den Kartoffeln in den Ofen wanderten.
Es war ein wunderbarer Abend. Sie saßen gemeinsam auf dem Hügel, blickten auf den See und tranken den spritzigen Riesling; Fisch und Kartoffeln schmeckten vorzüglich, der Salat gab dem Ganzen eine frische Sommernote. Und als Nachtisch spendierte Marie die gerade erworbenen Waldheidelbeeren, nach Belieben mit Zucker, Milch oder Joghurt. Die brütende Hitze des Tages hatte sich gelegt, sogar ein leichter Wind war aufgekommen. Am Zaun, der Maries Grundstück auf dem Hügel begrenzte, näherten sich ein paar junge braune Bullchen und betrachteten neugierig die Gesellschaft, die sich inzwischen um das Feuer scharte, das in der aus Steinen gebauten Feuerstelle loderte. Die Sonne versank erneut wie ein roter Feuerball im See, und der Mond stieg weiß-silbrig zwischen den Bäumen hinter den Häusern auf. Auf einer Postkarte würde man dieses Idyll für kitschig halten; hier aber war es eine unwirklich anmutende Wirklichkeit, ein gutes Omen für schöne Spätsommertage mit masurischer Gelassenheit und voll der Leichtigkeit des Sommers.
Auch am nächsten Morgen war Marie früh wach. Der Himmel war strahlend blau, und es würde wieder ein heißer Tag werden, aber die nächtliche Abkühlung hatte schon glitzernde Tautropfen auf Blätter und Grashalme gelegt, sodass Maries morgendlicher Weg zum Gemüsebeet durch feuchtes Gras ging. Auf der benachbarten Weide stolzierte ein Storch – noch waren sie alle da, aber bald würden die Jungstörche Masuren verlassen –, und in der Ferne schrien Kraniche. Es herrschte die wunderbare Ruhe des Morgens, nur die Luft surrte leicht.
Marie beschloss, die Morgenstunde vor dem Schwimmen zum Schreiben zu nutzen, aber dann erschien Edelbert, der Musiker. Er hatte am Abend zuvor gehört, dass Marie morgens früh zum Schwimmen an den kleinen See fahren wollte, und war in aller Frühe mit dem Fahrrad aus Giżycko gekommen, um sich anzuschließen. Auf dem Weg habe er, so erzählte er, zwei Polizeistreifen gesehen. Marie dachte sich nichts dabei; gerade in den Sommermonaten stand die Polizei häufig – mehr oder weniger gut getarnt – in Hofeinfahrten, um die Geschwindigkeitssünder zur Kasse zu bitten. Wie erfolgreich sie damit war, wusste Marie nicht, denn bei aller Berechtigung, die Raser zu stoppen, funktionierte in Polen auf dem Land meistens noch eine Art Gemeinsinn, der sich gegen die Obrigkeit richtete: In der Regel warnten die entgegenkommenden Fahrer per Lichthupe vor den Kontrollen, auch Marie hatte auf diese Weise schon Glück gehabt.
Edelbert stieg in Maries Auto, und sie fuhren gemeinsam los. Den Wagen ließen sie wie gewohnt in einiger Entfernung am Wegrand stehen und gingen die letzten Meter zu Fuß zum See. Von Staszek, der sich auch häufig mit seinem Hund zum morgendlichen Schwimmen einfand, war wieder nichts zu sehen. Marie beschloss, ihn auf jeden Fall im Lauf des Tages anzurufen, das hätte sie gestern schon tun sollen. Nach dem Schwimmen kam Edelbert mit zum Frühstück; er liebte den kleinen Vierseithof von Marie, fand sich dort immer wieder ein, wenn er in seinen Ferien im Pfarrhaus war, machte sich gelegentlich durchaus auch nützlich, indem er die kleinen frühen Augustäpfel aufsuchte, die Marie zu einem köstlichen Apfelkuchen verarbeitete, die Dachrinne säuberte und die abgestorbenen Zweige aus den alten Obstbäumen schnitt, oder aber er saß einfach nur auf dem Hügel in dem schiefen Korbstuhl, den Marie schon längst verbrannt hätte, wenn er nicht interveniert hätte, und las Hölderlin-Gedichte.
Hungrig vom Schwimmen und noch dazu mit einem Frühstücksgast beehrt, beschloss Marie, ihr in der Regel etwas frugales Frühstück aus Paprika, Möhren, Tomaten und Joghurt um Brot, Eier und Süßes zu erweitern. Sie drückte Edelbert ein Tablett mit dem blau-weißen Bunzlauer Geschirr in die Hand, damit er den Tisch in der Morgensonne decken konnte, kochte zwei von den frischen Eiern von Halinas Hühnern, holte den cremigen Rapshonig, den sie gerade erworben hatte, und öffnete ein Glas von dem Holunder-Apfel-Gelee, das sie im letzten Herbst gekocht hatte. Das Brot hatte sie noch aus Berlin mitgebracht: Walchenbrot mit Walnüssen und Zuckersirup, das sie immer bei SoLuna am Südstern kaufte und das sich zum Glück eine Zeit lang frisch hielt. In den nächsten Tagen würde sie dann Anna um ihr Rezept zum Brotbacken und um etwas Sauerteig bitten müssen.
Das behagliche Frühstück in der Morgensonne wurde von einigen ungewohnten Maschinengeräuschen begleitet. Das war kein Mähdrescher, offensichtlich auch kein einfacher Trecker, sondern eher ein Bagger, und zwischen den Maschinengeräuschen hallten Rufe aus der Ferne herüber. Auf Maries ehemaligem Grundstück, in Nähe des kleinen Teichs, schien sich etwas zu ereignen, was weder Marie noch Edelbert deuten konnten.
Vermutlich waren es Erdarbeiten, denn der Bauer, dem Marie das Land abgetreten hatte, wollte den Teich, der in den letzten Jahren, wohl als Folge der trockenen Sommer, schon weitgehend verlandet war, ganz ausbaggern und trockenlegen, um ihn mit in seine Weidefläche zu integrieren. Das war sicher eine vernünftige Idee, auf jeden Fall besser als Maries anfängliche Pläne, den Teich als Landschaftselement in die Gestaltung ihres Anwesens einzubeziehen, eine malerische kleine Brücke zu bauen, die das dahinterliegende Wäldchen erreichbar machte, und nach Möglichkeit auch noch ein paar Karpfen einzusetzen. Dazu war es nie gekommen; der Aufwand und die permanente Pflege waren während der kurzen Sommerzeit, in der Marie in der Regel da war, einfach nicht zu leisten.
Außerdem fehlte ein Wasserzufluss für den Teich, und so war der Wasserspiegel gesunken und der Teich schlammig geworden; die Natur hatte sich ihr Recht genommen. An den Rändern wuchsen Schilf, Brennnesseln und Disteln, in der Mitte auch ein paar braune Lampenputzer, die aber wegen des ganzen Gestrüpps kaum zu erreichen waren. Es war ein kleiner Biotop, der da entstanden war, und abends konnte man manchmal die Unken hören, die sich dort offensichtlich wohlfühlten und den Störchen eine gelungene Mahlzeit boten.
Ohne den Geräuschen eine besondere Aufmerksamkeit beizumessen, ließen sich Edelbert und Marie das Frühstück schmecken, und Marie war bereit, ihren masurischen Sommertagesrhythmus zu beginnen – lesen, schreiben, wenn nötig einkaufen, ein bisschen Polnisch lernen und den Abend planen.
Doch diese Unbeschwertheit wurde jäh unterbrochen. Einer der silbrig lackierten, mit blauen und gelben Aufklebern versehenen Polizeiwagen kam ihre Zufahrt entlang. Marie wunderte sich, Polizei? Das rief bei ihr, wie wohl bei vielen Menschen, ein unangenehmes Gefühl hervor. Zwar war sie sich keiner Schuld bewusst, es sei denn, sie war – vielleicht doch, ohne gewarnt zu werden? – irgendwo zu schnell gefahren, aber dennoch … Oder gab es etwa doch noch Probleme mit dem Grundstückstausch?
Froh darüber, dass Edelbert anwesend war, kramte sie vorsorglich in Gedanken ein paar polnische Brocken zusammen, die möglicherweise für ein Gespräch hilfreich sein könnten.
Der Wagen mit zwei Polizisten hatte inzwischen im Innenhof gehalten, und die beiden waren ausgestiegen. Den einen kannte Marie – es war Piotr, ein stattlicher Mann von ungefähr Mitte vierzig, mit seiner Größe von fast zwei Metern, seinen schwarzen Haaren und seinen lustigen braunen Augen, die so gar nicht zu einer Polizeiuniform passten, nicht zu verkennen. Er war schon einmal vor ein paar Jahren wegen eines Einbruchs auf Maries Grundstück da gewesen – nichts Aufregendes, ein dorfbekannter Alki hatte Wein aus der Piwnica geklaut und sich dabei erwischen lassen, und da das nicht das Einzige war, was er auf dem Kerbholz hatte, war es der Polizei nur recht gewesen, dass sie ihn damals überführen konnte.
Marie war froh, Piotr zu sehen, er sprach aufgrund eines mehrjährigen NATO-Einsatzes recht gut Englisch, was die Verständigung sehr erleichtern würde. Und seitdem er sich unterhalb ihres Hügels ein Haus gebaut hatte, zählte er in gewisser Weise sogar zu den Nachbarn, und sie winkten sich immer freundlich zu, wenn sie sich begegneten. Der andere war ein kleinerer, etwas dicklicher Mann, vielleicht Mitte dreißig, mit rötlichen Haaren und einem Dreitagebart. Auch er kam Marie bekannt vor; er war es gewesen, so meinte sie sich zu erinnern, der sie im letzten Jahr auf dem Weg nach Giżycko, als sie nur geringfügig zu schnell gefahren war, geblitzt und dann sofort zur Kasse gebeten hatte.
Die beiden kamen auf Marie und Edelbert zu und grüßten freundlich. Marie sagte aus Höflichkeit ein paar polnische Worte, bevor sie mit Piotr ins Englische überging, und stellte Edelbert vor, den sie sogleich daran hindern musste, den beiden mit seinem Schulrussisch entgegenzutreten; er vergaß allzu leicht, dass die russische Sprache trotz mancher Ähnlichkeiten mit der polnischen in Polen nicht gut gelitten war, auch nicht als Verständigungsmittel. Alle nahmen Platz, und Marie bot Kaffee und Tee an.
Nach den üblichen einleitenden Floskeln über das Wetter und die Hitze und der Frage, ob es wohl am Nachmittag ein Gewitter geben werde oder nicht, kam Piotr zur Sache. »Ich habe gehört, du hast das Stück Land mit dem Teich hinter deiner Scheune verkauft?«
Marie stutzte. Also doch die Grundstückssache? Sie nickte.
»Und weshalb hast du es verkauft?«
Marie überlegte kurz. Was sollte sie antworten? Von den langen problematischen Landquerelen berichten? Und außerdem: Was ging das die Polizei an? Wäre es nicht der nette Piotr gewesen, der sie fragte, hätte sie sich vermutlich hinter dem »Nichtverstehen« aufgrund sprachlicher Probleme versteckt, so aber entschloss sie sich zu einer Antwort. »Ich wollte es einfach los sein, weil ich es nicht recht nutzen konnte und sich außerdem die Gelegenheit ergab, es gegen ein Stück vom Hügel einzutauschen.«
Damit, so nahm sie an, würde Piotr sich zufriedengeben, er bohrte jedoch weiter. »Aber den kleinen Teich hattest du doch, wenn ich mich recht erinnere, beim Kauf vor einigen Jahren unbedingt haben wollen?«
»Das stimmt, aber er war in letzter Zeit so zugewachsen, dass ich keine Chance mehr sah, ihn richtig zu pflegen«, antwortete Marie wahrheitsgemäß.
»Wann bist du denn das letzte Mal unten am Teich gewesen?«
Marie dachte nach. Sie ging selten zum Teich hinunter; die Weide hinter der Scheune wurde nicht mehr für Rinder genutzt und, weil für einen großen Mähbalken eine Zufahrt fehlte, auch nur selten gemäht, das Gras wuchs hoch, und dazwischen samten sich Büsche, Ahorntriebe und Disteln aus. Vor einigen Jahren war sie mit einem ihrer Gäste, der unbedingt ihr ganzes Grundstück hatte umrunden wollen, dort gewesen, der Gast war am Teich über eine Baumwurzel gestolpert und hingefallen und mit seiner hellen Jeans im Morast gelandet. Zum Glück hatte er sich nichts Ernstes getan, aber er war nur noch mit Mühen weitergekommen. Danach hatte Marie von solchen Begehungen abgeraten.
Als sie dann vor zwei Jahren ihren Geburtstag hier in Masuren mit vielen deutschen und polnischen Gästen gefeiert hatte und sie hinter der Scheune ein Wildschwein gebraten hatten, hatte Tomek mit einem Kreiselmäher, wie er auch an Straßenböschungen eingesetzt wurde, die Weide in Ordnung gebracht, aber das war mit großem Aufwand verbunden gewesen. Danach war sie nicht mehr gemäht worden, und Marie fand kein großes Vergnügen daran, auf dem Gang zum Teich zwischen hohem Gras, Disteln und Brennnesseln zu versacken und wegen der Unebenheiten des Geländes hin und wieder umzuknicken. So hatte sie dieses Stück ihres Grundstücks in der Tat lange Zeit nicht betreten, sondern nur aus der Ferne betrachtet.
»Ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal dort war«, nahm sie das Gespräch wieder auf, »auf jeden Fall aber vor zwei Jahren, als wir alles für mein Geburtstagsfest vorbereitet haben. Da hatte ich überlegt, ob man den Teich irgendwie in das ganze Arrangement einbeziehen könnte, doch dazu war schon alles zu verwildert. Vielleicht erinnerst du dich ja an das Fest, du warst doch, wie alle Nachbarn, auch eingeladen. Nur – warum fragst du?«
Marie schwankte zwischen Neugier und Irritation, sie wurde aus dem Gespräch nicht klug. Der zweite Polizist, der bisher nur zugehört hatte, wandte sich leise an Piotr. Marie konnte nicht richtig verstehen, was er sagte, aber den Wortfetzen nach, die sie erkannte, hatte der Hinweis auf das Fest sein Interesse gefunden, und offensichtlich forderte er Piotr auf, hier weiter nachzuhaken. Piotr schien einverstanden, und die beiden nickten einander kurz zu.
Edelbert hatte die Gesprächspause genutzt, um seinerseits sein Wissen bezüglich der Grundstücksangelegenheiten kundzutun, und ergänzte, an Marie, aber auch an Piotr gewandt: »Na ja, eigentlich wolltest du das Ganze ja auch los sein, weil du sowieso dein Wäldchen hinter dem Teich nicht mehr erreichen konntest, nachdem der Geodät den Zugang an seinen Neffen verschachert hatte.«
Marie war es nicht recht, dass Edelbert in dieser Situation auf ihre länger zurückliegende Kontroverse mit dem Geodäten anspielte, sie enthielt sich besser eines weitergehenden Kommentars. Aber Piotr und sein Kollege hatten Edelberts Hinweis sowieso nicht wahrgenommen, sie blieben bei dem Fest.
»Welche deiner Gäste sind denn bei deinem Fest zu dem Teich heruntergelaufen?«
»Vermutlich einige, wir hatten ja die Weide vorher gemäht und mit einbezogen. Genau weiß ich natürlich nicht, wer wann wo war, als Gastgeberin musste ich mich schließlich um alles kümmern. Vielleicht fällt dir ja selbst etwas dazu ein!« Marie wurde allmählich ungeduldig.
»Ich war leider nur kurz da, weil ich Dienst hatte, aber du weißt doch sicher noch, wen du eingeladen hattest?«
»Natürlich, nur sag mir jetzt endlich, was das Ganze hier soll; ich kann mir kaum vorstellen, dass du gekommen bist, um mit mir über den Grundstücksverkauf und meine zwei Jahre zurückliegende Geburtstagsfeier zu reden!«
Piotr zögerte kurz und warf seinem Kollegen einen Blick zu. Dann fand er sich zu einer Antwort bereit. »Okay, du musst es ja doch erfahren; es ist leider kein schöner Anlass, weshalb wir hier sind: Wir wurden heute Morgen von der Firma gerufen, die den Teich ausbaggern soll. Sie haben eine Leiche gefunden!«
Marie war wie vom Donner gerührt, die friedliche warme Sommeridylle des Hofes erschien ihr plötzlich wie ein Trugbild. Ein Frösteln durchschauerte sie. »Oh mein Gott, wie fürchterlich!«
Auch Edelbert war entsetzt. »Wisst ihr, wer es ist?«
»Nein, das wissen wir noch nicht, nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, geschweige denn, ob es ein Unfall oder ein Verbrechen war. Die Leiche hat mit Sicherheit auch schon länger dort gelegen, wie lange, können wir noch nicht sagen, das müssen die Rechtsmediziner, die sich die Fundstelle genau ansehen werden, entscheiden. Das Einzige, was feststeht, ist, dass der Teich in deinem Besitz war, als sich dort etwas abgespielt hat, was wir jetzt aufklären müssen, und deshalb sind wir hier!«
Schlagartig wurde Marie klar, dass ihr als Eigentümerin eine gewisse Verantwortung für das zugeschoben wurde, was sich unten am Teich ereignet hatte.
»Hast du eigentlich damals bei deinem Fest einen deiner Gäste über längere Zeit vermisst, und kannst du mir auf jeden Fall eine Gästeliste mit Adressen zukommen lassen?«
Die Frage nach ihren Gästen schien Marie nun doch reichlich abartig, und sie überlegte, wie sie dieses Gespräch beenden könnte. »Ich schlage vor, dass ihr erst einmal eure Arbeit macht, ehe ich hier etwas über meine Gäste sage.«
Das klang vielleicht schroffer als beabsichtigt, setzte aber, wie gewünscht, der Unterhaltung ein vorläufiges Ende.
Piotr und sein Kollege verabschiedeten sich, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Marie sich weiter zur Verfügung halten und vorsichtshalber schon einmal die Gästeliste erstellen solle.
Als die beiden weggefahren waren, beredete sie das Ganze mit Edelbert, aber außer ihrer gegenseitigen Bekundung des Erschreckens half das auch nicht weiter, und Edelbert machte sich auf den Heimweg; er wollte, bevor die Mittagshitze zu brütend wurde, mit dem Fahrrad wieder in Giżycko sein, außerdem war ihm die Nähe eines solchen Schauplatzes offenkundig unbehaglich.
Aber auch Maries heitere Ferienstimmung war dahin. Das Land mit seinen sanften Hügeln, das ihr am Morgen so friedlich erschienen war, bekam plötzlich etwas tiefgründig Unheimliches. Zwar war ihr klar, dass es in Masuren keineswegs immer friedlich zugegangen war, im Gegenteil. Zu oft war das Land Kriegsschauplatz gewesen. Viele blutige Schlachten hatten hier stattgefunden, und die Erinnerung daran war gegenwärtig, ja wurde sogar bewusst gepflegt und auch erfolgreich vermarktet.
So wurde der heldenhafte Sieg der Polen in der Schlacht bei Tannenberg (Stębark) und Grünwalde (Grunwald) von 1410, in der es dem polnischen König Władysław II. Jagiełło gelungen war, den Deutschen Orden unter Hochmeister Ulrich von Jungingen vernichtend zu schlagen, jedes Jahr aufs Neue mit einer bombastischen Inszenierung der Kämpfe auf dem Schlachtfeld bei Stębark und Grunwald nachgestellt. Es war eine Inszenierung, die an die große Vergangenheit der polnischen Nation erinnern und das nationale Bewusstsein heben sollte. Auch gab es kaum eine Stadt, die nicht einen Plac Grunwaldzki hatte, und vor zahlreichen Ordensburgen und in den Touristenzentren waren Verkaufsstände mit Ordensfahnen und Bannern, Wappen und Speeren der Kreuzritter und des polnisch-litauischen Heeres, dazu Videoclips mit dem Verlauf der Schlachten.
Mit der Gegenwart hatte all das nicht mehr viel zu tun, es befriedigte eher ein historisches und pittoreskes Interesse am ausgehenden Mittelalter, als dass es eine Rolle für das kollektive Gedächtnis spielte. Anders dagegen die Beton-Überreste der brutal-monströsen Bauwerke der Nazis, der Wolfsschanze oder – nur ein paar Kilometer von Maries Haus entfernt – des Himmler-Bunkers, der sogenannten Schwarzschanze; sie waren sehr viel näher und verwiesen direkt auf die furchtbaren Schrecken des Zweiten Weltkriegs und seine Folgen. Das hatten die Älteren noch miterlebt, entweder selbst oder als Familienschicksal, und es betraf sowohl die Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden oder geblieben waren, als auch die Polen, die – ihrerseits vertrieben – hierher umgesiedelt worden waren. Und auch die kleinen Dorffriedhöfe, auf den Hinweisschildern häufig als »cmentarz ewangelicki«, als evangelischer Friedhof, apostrophiert, die, versteckt an einem der Seen oder im Wald gelegen, die Gräber von Gefallenen beider Weltkriege bargen, waren sehr nahe liegende Zeugnisse der vielen Schlachten in Masuren.
Das Leid und die Gräuel, die dieser Landstrich schon gesehen hatte, lösten bei vielen Menschen Betroffenheit und Nachdenklichkeit aus. Auch Marie empfand das so, obwohl sie sich von der landschaftlichen Idylle immer wieder einfangen ließ. Aber an diesem Morgen verfing die idyllische Landschaft nicht mehr. Hier, auf ihrem Grundstück, vielleicht sogar zu einer Zeit, in der sie hier ihren Sommer verbracht hatte, hatte sich etwas abgespielt, das in erschreckender Weise in die alltägliche Routine hereinbrach. Marie schauderte erneut. Sie beschloss, sich dringend mit Staszek zu treffen. Sie brauchte jemanden, der die hiesigen Verhältnisse kannte und etwas über polnische Ermittlungsarbeit wusste, jemanden, mit dem sie reden und der ihr raten konnte, was jetzt zu tun war. Als sie ihn anrief, war er zu ihrer Überraschung gleich am Apparat.
Sie setzte zu ihrem Bericht an, aber bevor sie beginnen konnte, unterbrach er sie. »Ich wollte dich auch gerade anrufen, ich habe gehört, was geschehen ist und dass die Polizei bei dir war; ich komme vorbei und bin in zehn Minuten da.«
Marie war erleichtert. Staszek war ihr in den letzten zwanzig Jahren in allen schwierigen Situationen ein Halt gewesen. Nicht nur seine juristische Expertise, sondern auch seine feste Zuversicht, dass sich für Schwierigkeiten, die Menschen einander machten, in der Regel ein Ausweg finden ließ, stimmten Marie ihm gegenüber vertrauensvoll.
Schon nach kurzer Zeit bog er mit seinem uralten Polo, den er vor allem für die Fahrten durch sein Revier nutzte, auf den Hof ein, stieg, von Jasper, seinem hirschroten Schweißhund, gefolgt, aus und kam auf Marie zu.
»Schön, dass du wieder da bist!«, begrüßte er sie freudig. »Ich hatte dich noch gar nicht erwartet.«
Jasper sprang, wohl wissend, dass er das nicht durfte, an Marie hoch und ließ sich von ihr ausgiebig hinter seinen schwarzen samtweichen Ohren streicheln. Aber das Wiedersehen war nicht so unbeschwert wie sonst, sondern wurde überlagert von den Ereignissen des Morgens.
Marie holte einen Kaffee für Staszek, und sie setzten sich in die Sonne. »Woher weißt du schon, was geschehen ist, und was sagst du dazu?« Sie war bemüht, sich ihre Unruhe nicht zu sehr anmerken zu lassen, aber ihre Fragen klangen hektisch.
»Nun warte erst mal ab; ich werde dir alles, was ich weiß, der Reihe nach berichten.« Staszek trank von dem frisch aufgebrühten Kaffee, dann begann er mit seinem Bericht. »Heute Morgen konnte ich nicht zum Schwimmen kommen«, sagte er, »ich hatte einen Termin auf dem Grundbuchamt in Węgorzewo.«
Marie wusste seit einiger Zeit, dass Staszek mit seinem Grundstück und dessen Eintragung ebensolche Schwierigkeiten hatte, wie sie sie gehabt hatte. Der lange Jahre in der Woiwodschaft tätige Geodät war mit seinen Landvermessungen nicht immer korrekt gewesen; es wurde auch gemunkelt, seine »Großzügigkeit« beim Messen habe sich proportional zu seinem Wodkagenuss entwickelt. Auf jeden Fall hatte sich eine Reihe von Unregelmäßigkeiten herausgestellt. Im Zuge dessen war im Kreis eine großflächige Untersuchung aller Grundstückskäufe und -verkäufe der letzten zwanzig Jahre eingeleitet worden.
Für heute Morgen, so berichtete Staszek, war nun mit ihm ein Termin in der Grundbuchabteilung des Amtsgerichts in Węgorzewo anberaumt worden, weil sein Grundstück, wie auch andere, nicht mit dem Eintrag übereinstimmte. Bei der Klärung der Situation war ihm sein juristisches Wissen zwar von Nutzen, allein der Umgang mit der Verwaltung war angesichts der bürokratischen Strukturen selbst für einen Juraprofessor nicht einfach. Letztlich wurden die Änderungen der Eintragung aber akzeptiert, und Staszek hatte sich zufrieden auf den Rückweg gemacht.
Kurz vor der Abbiegung in seinen Waldweg war ihm die Polizeistreife mit Piotr und dessen rothaarigem Kollegen entgegengekommen und hatte ihn an den Rand gewinkt. Bei der dünnen Besiedlung des Landes konnten Piotr und Staszek als Nachbarn im weiteren Sinne gelten, und Staszek genoss aufgrund seines einfachen Lebens in der Natur und seiner weitreichenden Kenntnisse auf vielen Gebieten eine gewisse Autorität bei den Leuten im Dorf, auch bei Piotr. Für ihn war Staszek zudem eine Art besonderer Vertrauensperson, hatte er ihn doch bei seiner polizeilichen Arbeit schon mehrfach unterstützt, einfach dadurch, dass er die richtigen Fragen stellte. So war es ihm ein Anliegen, Staszek von dem Leichenfund auf Maries ehemaligem Grundstück in Kenntnis zu setzen, und dabei machte er auch aus seiner Vermutung, dass es sich wohl um ein Gewaltverbrechen handele, kein Hehl.
Staszek war entsetzt: ein Mord hier in der Gegend! Und bei aller Bestürzung waren seine Gedanken sogleich auch zu Marie gegangen, auf deren Grundstück das Ganze passiert war. Ihm war klar, dass das für sie ein furchtbarer Schock sein musste. Er hielt sie zwar eigentlich für eine starke Frau, aber in manchen Krisensituationen reagierte sie doch sehr emotional. Und auch er selbst war ja erschüttert. Zwar hatte er, der unter verschiedenen politischen Regimen in Polen gelebt hatte, mehr von der Gewaltbereitschaft der Menschen und ihren Tragödien mitbekommen als Marie, die im vergleichsweise friedlichen Westdeutschland der Nachkriegszeit aufgewachsen war, trotzdem schreckte ihn diese Nachricht.
Und so diente denn sein ausführlicher Bericht über die gelungene Verhandlung auf dem Grundstücksamt auch dazu, der Situation erst einmal ein wenig Spannung zu nehmen, wobei er nicht nur an Marie, sondern auch an sich selbst dachte. Aber dann waren sie beim Thema. Staszek hatte von den Polizisten nicht wesentlich mehr gehört als das, was Marie schon wusste; einzig Piotrs Vermutung, dass es sich wohl um ein Gewaltverbrechen gehandelt habe, ging darüber hinaus. Er beschloss jedoch, dieses Wissen vorerst für sich zu behalten, Marie würde es früh genug erfahren.
Marie dagegen konnte berichten, wie die beiden Polizisten immer wieder nach ihrem Fest und ihren Gästen gefragt hatten. Sie hätten auf sie den Eindruck gemacht, als machten sie sie oder ihre Gäste verantwortlich für das, was passiert sei. An dieser Stelle wurde bei aller Betroffenheit auch Maries Empörung deutlich.
»Ich weiß nicht, was diese Fragen sollten, und dann auch noch eine Gästeliste von mir zu verlangen, das ist doch reichlich überzogen! Muss ich darauf überhaupt eingehen?«
Staszek fand das Verlangen in der derzeitigen Situation auch etwas unverhältnismäßig, er würde das mit Małgorzata, die als Strafverteidigerin häufig mit solchen Dingen zu tun hatte, besprechen müssen. Zunächst wiegelte er jedoch ab.
»Du warst die Besitzerin des Teichs, und sie müssen versuchen, herauszubekommen, was passiert ist, und werden auch allen anderen, die in der Umgebung wohnen, Fragen stellen. Aber bisher wissen wir nichts Genaues, lass uns erst einmal abwarten, was in der Rechtsmedizin rauskommt. Die Leiche ist ja nach Olsztyn gebracht worden, und morgen sind wir vermutlich klüger. Vielleicht erfahren wir dann schon den ungefähren Todeszeitpunkt und die Identität des Toten.«
Marie nickte, auch ihr war wohl im Grunde klar, dass weder Aufregung noch Empörung weiterhalfen.
»Und wenn du Sorgen hast, heute Nacht allein auf deinem Hof zu übernachten«, fuhr Staszek fort, »kann ich dir Jasper hierlassen, oder du kommst zu mir. Jetzt solltest du aber versuchen, an deine Arbeit zu gehen, das Grübeln nützt nichts. Wolltest du nicht ein Buch über Biografien schreiben? Das ist doch das Beste, was du jetzt tun kannst.«
Marie kannte Argumente dieser Art aus den Gesprächen mit ihrem Mann und schätzte sie nur sehr bedingt. Sie hatte sie immer als ausgesprochen männlich empfunden, als Ablenkungsmanöver, die eine zu große Emotionalität oder eine nahende Auseinandersetzung verhindern sollten. Trotzdem musste sie zugeben, dass es nicht ganz falsch war, ihrer Arbeit nachzugehen, und letztlich verfehlte die Mischung aus rationalen Argumenten und Staszeks warmem, beruhigendem Tonfall ihre Wirkung nicht.
Sie verständigten sich auf ein gemeinsames Abendessen, bei dem sie sich, sollte es Neuigkeiten geben, noch einmal austauschen könnten, und Staszek fuhr zurück.
Am Nachmittag tauchte Piotr erneut am Teich auf, diesmal begleitet von einem Spezialisten der Spurensicherung. Sie vermaßen und fotografierten die Stelle des Leichenfunds noch einmal von allen Seiten, vermutlich um festzustellen, wie weit die Leiche im Wasser und wie weit sie im Schlamm gelegen hatte. Sauerstoff würde ihre Verwesung beschleunigt haben, Moor und Schlamm könnten dagegen erhaltend gewirkt haben. Bei der endgültigen Berechnung müssten zudem die Veränderungen des Teichs, dessen Wasserspiegel in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gesunken war, berücksichtigt werden, eine sicher sehr komplexe Aufgabe.
Marie, die auf dem Hügel saß, blickte immer wieder auf die nicht weit entfernt liegende Fundstelle; sie konnte sich weder entspannen und die Sonne genießen noch sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Normalerweise griff sie in einer solchen Situation gerne zu einem Krimi, aber das würde aktuell, wo sie den Krimi vor der Haustür hatte, kaum helfen. So stieg sie schließlich in ihr Auto und fuhr nach Giżycko, um am Hafen in der Tawerna »Siwa Czapla«, dem kleinen Restaurant zum Fischreiher, einen Milchkaffee zu trinken.
Die Tawerna mit dem dunklen Holzgiebel war in deutscher Zeit einmal die Jugendherberge gewesen, und sie atmete nach wie vor etwas vom Charme der Jugendbewegung des vergangenen Jahrhunderts, aber vor allem ihre Lage trug dazu bei, dass sie zu Maries bevorzugten Lokalen gehörte. Das »Siwa Czapla« lag direkt am Giżycko-Kanal, der den Löwentinsee, den Niegocin, und die Ausläufer des Mauersees, des Mamry, miteinander verband und direkt durch Giżycko führte. Alle Schiffe, die von einem in den anderen See fahren wollten, mussten ihn durchqueren und dabei unter der alten Drehbrücke hindurchfahren, die, unweit der Tawerna, mitten in Giżycko über den Kanal ging. Sie war für größere Schiffe zu niedrig und wurde deshalb von jeher mehrmals am Tag zu festen Zeiten geöffnet, damit auch die höheren Schiffe den Kanal passieren konnten. Die Autofahrer mussten dann vor der Brücke warten oder einen anderen Weg nehmen. Bevor sie geöffnet wurde, stauten sich viele Schiffe im Kanal, direkt neben der Terrasse des »Siwa Capla«: elegante Segelboote mit fröhlichen jungen Menschen, umgebaute Transportkähne, aber auch große Dampfer der Weißen Flotte, die die Touristen zu einer Fahrt über die große Seenplatte eingeladen hatten.
Der Platz am Kanal hatte etwas Beruhigendes und half Marie, die Aufregungen des Tages hintanzustellen. Dazu stieg ihr aus der Küche der Tawerna der Duft von Placki ziemniaczane in die Nase, kross gebackenen Kartoffelpuffern, die mit Lachs, Sahne, Apfelmus oder auch nur mit Zucker serviert wurden. Aber obwohl sie hungrig war, beschloss sie, es bei einem Milchkaffee zu belassen und lieber später noch in der »Bar Omega« vorbeizufahren, um eine Chłodnik, eine kalte Rote-Bete-Suppe mit Buttermilch, Ei und Kräutern, mit nach Haus zu nehmen.
Ihre Ruhe währte nicht lange. Rolf kam vorbei, ein entfernter Bekannter, ein Deutscher, der eine Polin geheiratet hatte und in Giżycko seinen vorgezogenen Ruhestand verbrachte. Mit seiner deutschen Rente konnte er hier weitaus besser leben, als es ihm jemals in Deutschland möglich gewesen wäre, und sich vieles leisten.
Er steuerte schnurstracks auf Marie zu. »Ich habe gehört, was auf deinem Grundstück passiert ist, und das wohl schon vor ein paar Jahren. Sag mal, davon hast du wirklich gar nichts mitgekriegt?«
Marie war sauer. Gerade war sie dabei, etwas zur Ruhe zu kommen, da kam ein Unbeteiligter mit neugierigen Fragen und dummen Bemerkungen.
»Ich muss leider gehen«, brach sie die Unterhaltung ab, bevor sie richtig begonnen hatte, und machte sich auf den Weg.
Jetzt blieb ihr wirklich nur noch die »Bar Omega« an der Ulica Warszawska. Deren Gemütlichkeitsfaktor war zwischen Mensa und Bahnhofshalle anzusiedeln, und für das Essen musste man anstehen, aber es gab polnische Spezialitäten, und die waren vorzüglich. Marie entschied sich, angesichts des warmen Sommertages zwei Portionen Chłodnik mitzunehmen, dazu ein paar Pierogi ruskie, Piroggen mit Kartoffeln und Quark. Dann rief sie Staszek an und lud ihn zu einem Abendessen ein. Das widersprach zwar allen ihren Kochstandards, aber heute lief einfach alles anders.
Staszek hatte großes Verständnis dafür, dass sie das Essen aus der »Bar Omega« mitgebracht hatte. Er hatte inzwischen mit Małgorzata gesprochen und ihr erzählt, dass die Polizei sich aus Maries Sicht so verhielt, als sei sie die Hauptverdächtige, und das, obwohl bisher nicht einmal klar war, was geschehen war. Małgorzata riet, Ruhe zu bewahren und erst einmal weitere Einzelheiten abzuwarten, schließlich sei es Aufgabe der Polizei, kritische Fragen zu stellen. Marie solle sich aber bei allzu kritischem Nachhaken mit ihr beraten, möglicherweise auch nur in ihrer Gegenwart etwas sagen. Unabhängig davon war sie aber, ebenso wie Staszek, überzeugt, dass sich die Dinge bald aufklären würden.
Am Abend saßen Marie und Staszek auf der Terrasse hinter dem Haus. Sie ließen den Tag, der so anders als erwartet verlaufen war, beim Essen noch einmal Revue passieren. Allmählich wurde es dämmrig, und als die Mücken kamen, war es Zeit für sie, ins Haus zu gehen. Sie tranken noch einen Schluck von dem Pinot Noir, den Marie aus Deutschland mitgebracht hatte, und Staszek verabschiedete sich; er wollte, wie häufig bei beginnender Dunkelheit, in den Wald gehen, wo in seinem Revier eine Elchkuh mit ihrem Jungen stand. Marie dagegen wollte nichts mehr als ins Bett gehen und schlafen.
ZWEI
Konstanty, der junge polnische Arzt aus Sejny in Podlachien, der nordöstlichsten Woiwodschaft Polens an der Grenze zu Litauen und Belarus, hatte Dienst in der forensischen Medizin in Olsztyn, als am späten Vormittag der Wagen mit der Leiche aus Masuren eintraf. Er hatte in Bydgoszcz studiert und ein Auslandsjahr in Münster verbracht, wo er seinen Schwerpunkt auf die forensische Medizin gelegt hatte. Dabei war er nicht ganz unbeeinflusst geblieben von dem Münsteraner »Tatort« mit dem Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne. Sonntagabends hatte er in Münster häufig mit seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen im »Alter Ego« in der Altstadt gesessen, um den »Tatort« zu sehen, und mit dem gehörigen Lokalpatriotismus waren sie mit Begeisterung dem schrägen Humor der Ermittler Boerne und Thiel gefolgt. Für Konstanty war das zugleich eine gute Übung gewesen, sein Deutsch zu verbessern.
Während jedoch seine Deutschkenntnisse nach Beendigung des Auslandsjahrs bald wieder versiegt waren – die internationale wissenschaftliche Kommunikation lief auf Englisch –, hatte sich seine Begeisterung für die Rechtsmedizin erhalten, und er war diesen Weg auch in Polen weitergegangen. Erst kürzlich hatte er gemeinsam mit den Münsteraner Kollegen einen Aufsatz zu einem Verfahren publiziert, das die gängige Altersbestimmung einer unbekannten Person – auch bei fortgeschrittener Veränderung des Leichnams – aus der Wurzellänge der Schneidezähne sowie dem Zustand der Schädelnähte noch präzisiert hatte. Mit diesem Verfahren zur Altersbestimmung hatte er im letzten Jahr schon in einem Fall zur Klärung der Identität einer unbekannten Person beitragen können, und seitdem war er ein gefragter Partner der Kripo in Olsztyn und des forensischen Labors und Forschungsinstituts der Polizei, des Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
In Olsztyn hatte sich Konstanty beworben, weil er Freude an der quirligen Stadt mit ihrer Burg und der Altstadt und den vielen Seen in der unmittelbaren Umgebung hatte. In Münster hatte er auf dem Aasee segeln gelernt, in Masuren wollte er dieses Hobby fortführen. Die Medical School mit ihrer forensischen Abteilung war als Teil der Universität in Kortowo, im Süden Olsztyns, angesiedelt, nicht weit vom Jezioro Kortowskie, dem Kortau-See. Konstanty hatte sich darauf gefreut, hier seine Arbeit mit seinen Segelaktivitäten verbinden zu können.
Etwas geschmälert wurde seine Begeisterung jedoch, als er das Gebäude sah, in dessen Untergeschoss er seinen Obduktionsbereich und sein Labor haben würde: ein altes rotes Backsteingebäude aus deutscher Zeit und aus dem vorletzten Jahrhundert. Es hatte einstmals als Heil- und Pflegeanstalt der Provinz Ostpreußen gedient und galt am Anfang des 20. Jahrhunderts sogar als eine der modernsten Psychiatrien in Deutschland, wurde dann aber in den vierziger Jahren in das Euthanasieprogramm der Nazis einbezogen: Zwangssterilisationen und Aussortierungen für den Transport in Vernichtungslager wurden hier vorgenommen.
Konstanty, der in Nordostpolen aufgewachsen war, einer Gegend, in der es vor dem Zweiten Weltkrieg noch »jüdische Schtetl« gab, von denen er seine Großmutter hatte erzählen hören, war sehr sensibel für diese Vergangenheit, und zeitweilig, wenn ihm allzu schlimm aussehende Leichen auf den Seziertisch kamen, glaubte er, noch immer etwas von dem Naziterror zu spüren, der in diesen Gebäuden vor gar nicht allzu langer Zeit zu Hause gewesen war. Wie an so vielen Stätten Polens überlagerten sich auch hier eine aufblühende Stadt und eine belastete und belastende Vergangenheit aus deutscher Zeit.
Ohne sich heute jedoch in solchen Gedanken zu verlieren, widmete er sich angesichts des eingetroffenen Leichnams zügig seiner Arbeit, neben der Bestimmung der DNA





























