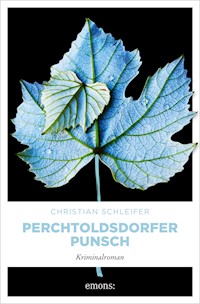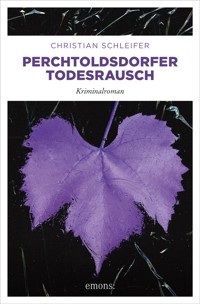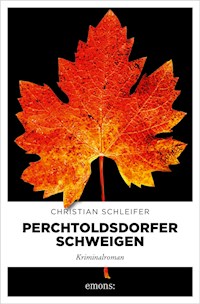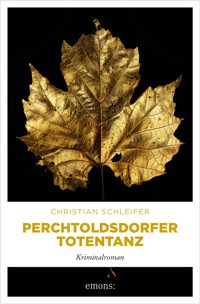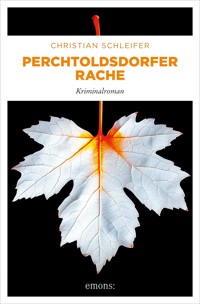Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Charlotte Nöher
- Sprache: Deutsch
Wein & Crime in Niederösterreich Der Heurigenort Perchtoldsdorf steht unter Schock: Bei den berühmten Sommerspielen wird ein Schauspieler auf offener Bühne getötet. Die ehemalige Polizistin Charlotte Nöhrer, die als Neu-Winzerin eigentlich versuchen wollte, dem Publikum ihren Frizzante nahezubringen, stolpert in die Ermittlungen. Schnell entspinnt sich ein Gewirr aus Liebe, Eifersucht und Erpressung. Dabei hat Charlotte mit dem elterlichen Weinbaubetrieb, den sie gegen alle Widerstände ins 21. Jahrhundert katapultieren will, alle Hände voll zu tun!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Schleifer, Jahrgang 1974, ist gebürtiger Perchtoldsdorfer, gefangen im Leben eines Wieners. Nach der Matura studierte er Anglistik und Germanistik. Diese Ausbildung nutzte er (total naheliegend), um zwanzig Jahre lang als Sportjournalist bei österreichischen Tageszeitungen zu arbeiten. 2015 beschloss er, sich mehr Zeit für seine Frau, die Zwillinge und das Krimischreiben zu nehmen. Wenn er nicht gerade am nächsten Krimi arbeitet, hilft er bei der Organisation von Tennisturnieren und anderen Sport-Events, außerdem ist er als Dosenfutteröffner für die Familienkatzen Felice und Chewie tätig.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Alle Shakespeare-Zitate stammen aus der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: iStockphoto.com/Photoartbox
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Uta Rupprecht
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-639-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die
Semmelblond Script Agency, Dresden.
TITANIA:Mein Oberon, was für Gesicht’ ich sah!Mir schien, ein Esel hielt mein Herz gefangen.
OBERON:Da liegt dein Freund.
TITANIA:Wie ist dies alles zugegangen?Oh, wie mir nun vor dieser Larve graut!
OBERON:Ein Weilchen still! – Puck, nimm den Kopf da weg.Titania, du lass Musik beginnen. Und binde stärkeralle Fünf Sinne als durch gemeinen Schlaf.
TITANIA:Musik her! Schlafbeschwörende Musik!
William Shakespeare,»Ein Sommernachtstraum«
Prolog
Ein Wald nahe Athen.
(Oberon und Titania)
»Komm nur, komm nur, holde Titania!«
»Zu gerne nur folge ich deinem Rufe, mein Oberon.«
Oberon nimmt Titania theatralisch in die Arme.
Ein Vollmond erleuchtet die Bühne der Perchtoldsdorfer Sommerfestspiele. Es ist eine heiße Frühsommernacht Ende Juni, die Nacht vor der Premiere von William Shakespeares »Ein Sommernachtstraum«. |Der Rest des Ensembles hat sich schon längst nach Hause beziehungsweise in verschiedene Hotels der Umgebung getrollt. Oberon und Titania nützen die spektakulär gestaltete und um diese Uhrzeit gottverlassene Bühne für eine persönliche Generalprobe. Was proben sie? Das können Sie sich denken. Nicht umsonst haben die beiden gewartet, bis die anderen die Sommerbühne verlassen hatten. Was die beiden gleich aufführen werden, war von Shakespeare garantiert nicht für die Bühne gedacht …
Wir sollten den Turteltauben ihre Fleißarbeit nachsehen. Zu groß ist das Lampenfieber vor der Premiere, und zu sehr gehen sie beide in ihren Rollen auf. Zu groß ist vor allem die Versuchung, ihre Affäre nicht nur heimlich in einem Hotelbett oder auf einem Autorücksitz auszuleben, sondern auch einmal in aller Öffentlichkeit, auf der ganz großen Bühne.
»Wollen wir das Bett des Herzogs mit unserem Segen weihen?«, fragt Oberon.
»Auf dass ihm und seiner Herzogin gesegneter Nachwuchs in ihrer Hochzeitsnacht entspränge?«, fragt Titania. Sie zieht Oberon zu sich. Näher und näher. Sein Atem lässt die feinen Härchen in ihrem Ohr habachtstehen.
So geschwollen die Sprache auch ist, das Liebesgeflüster der beiden klingt ganz und gar nicht fein. Aber das ist bei Shakespeare selbst auch so.
Das Bett des Herzogs befindet sich am linken Rand der weitläufigen Bühne, die sich quer über den Hof der historischen Perchtoldsdorfer Burgruine erstreckt. Wie es sich für opulentes Sommertheater gehört, kann hier von Bescheidenheit keine Rede sein. Ganz im Gegenteil! Es wird geprotzt, die Kostüme sind aufwendig, die Kulissen sowieso. Neben dem Herzogspalast mitsamt Bett schließt die Andeutung eines Dorfes an, den größten Teil der Bühne nimmt jedoch der Wald ein, in dem sich Shakespeares »Sommernachtstraum« überwiegend abspielt. Gut ein Dutzend alter Bäume haben ihr Leben lassen müssen, um nun auf der Bühne als Waldkulisse zu dienen – andeutungsweise, da die Bäume komplett entlaubt wurden, um dem Publikum einen besseren Blick zu gewähren. Sie sind so zurechtgestutzt worden, dass die akrobatisch ausgebildeten Schauspieler, allen voran Puck, während des Schauspiels wie Artisten durch die Bäume toben können.
»Wohl, wohl. Hauptsache, dir entspringt kein Nachwuchs.«
Titania kichert. Sie ist eine noch blutjunge Schauspielerin, gerade mal zwanzig Jahre alt. Anders Oberon: sehr angesehen in der Theaterwelt, ein Grandseigneur der Branche und verheiratet. Natürlich nicht mit Titania, aber das dürfte wohl klar sein.
Die Turmuhr, keine hundert Meter entfernt und mit dem dazugehörigen Wehrturm das Wahrzeichen von Perchtoldsdorf, schlägt Mitternacht. Zugleich schlägt es auch bei Titania ein.
Die Turmuhr weckt noch jemand anderen. Wenn Oberon und Titania geglaubt haben, allein zu sein, so haben sie sich getäuscht. Und zwar gewaltig. In der alten Rüstkammer, die während der Sommerspiele als Garderobe für die Schauspieler dient, wird ein Mensch von dem Geläute aus einem kurzen Schläfchen gerissen. Auch in seinen Träumen ist es alles andere als jugendfrei zugegangen. Konzentriert an einer Rolle arbeitend, war er im Zwielicht sanft in Morpheus’ Arme gesunken. Er fährt erschrocken hoch, reibt sich verschlafen die Augen und klappt das Skript zusammen. Genug für heute, morgen ist auch noch ein Tag.
In diesem Moment vernimmt die Person zwei Stimmen aus dem Burghof. Wer ist das? Das Ensemble ist doch längst nach Hause gegangen? Vorsichtig erhebt sie sich, bemüht, nur ja kein Geräusch zu machen. Eigentlich unnötig, denn die beiden da draußen hätten in ihrer Ekstase nicht einmal ein am Boden zerschellendes Glas gehört. Sie schleicht durch die Rüstkammer, auf das Tor zum Burghof zu. Eine unangenehme Vorahnung erfasst sie.
Draußen kichert Titania wieder wie ein Schulmädchen, dazwischen stößt sie immer wieder spitze Schreie aus. Die Gefahr, gehört oder ertappt zu werden, besteht nicht; praktischerweise sind die wenigen Lokale, die sich um diese Uhrzeit noch über Besuch freuen, weit genug entfernt. Westlich des Burghofs schließt der Begrischpark an, der sich leicht bergauf in Richtung Wienerwald und Föhrenberge zieht. Östlich schmiegt sich die Pfarrkirche an die Burg. Beides sind nicht unbedingt Orte, die um diese Uhrzeit noch ausgiebig frequentiert werden.
Mit einer fahrigen Handbewegung streicht sich Titania eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Mein Liebster, lass uns an einer anderen Stelle weitermachen. Mich dünkt, wir haben die erste Runde beendet und das Bett des Herzogs ausreichend gesegnet.«
Sie fasst Oberon am Arm und schleift ihn quer über die Bühne zur Waldkulisse. Dort gibt es ebenfalls ein Bett, nämlich jenes, in dem die mit Liebestropfen verzauberte Titania neben dem eselsköpfigen Zettel erwacht und diesen vernascht. In der gänzlich privaten Generalprobe der beiden Waldgeister wird Titania diesmal aber ihren schönen Oberon vernaschen. Die beiden sinken auf das mit Laub und Stroh ausgelegte Bett, das während der Vorstellung mit Hilfe von vier Seilen in luftige Höhen gezogen werden kann. Titania und Oberon verzichten allerdings auf Luftakrobatik und belassen das Bett auf sicherem und festem Untergrund.
Der oder die Dritte im Bunde bleibt am anderen Ende der Bühne stehen. Wut kocht hoch. Es ist also keine Täuschung. Die Hoffnung ist ohnehin nur klein gewesen, aber was hat der Mensch schon, wenn nicht immer einen letzten Funken Hoffnung? Dieser Funke schmilzt nun wie eine Schneeflocke in der Frühlingssonne.
»So heiß, es ist so heiß, mein Liebster. Ach, hätte ich doch nur ein Eis«, haucht Titania mit unschuldigem Blick. Ganz so, als hätte sie Einblick in das Gefühlsleben des heimlichen Beobachters. Oberon haucht ihr ins Ohr: »Eis habe ich nicht, meine Holde, aber etwas anderes …« Wieder kichert die junge Titania.
Ihr Keuchen hallt von den jahrhundertealten Mauern der ehemaligen Herzogsburg wider. Die Lust auf Eis ist plötzlich verflogen. Höher und höher, schriller und schriller werden ihre Schreie.
Bis sich mit einem Mal eine weitere Stimme einmischt.
»Du!«, tönt es durch den Burghof.
Unfreiwilliger Coitus interruptus. Wutschnaubend stürmt eine schattenhafte Gestalt auf die Bühne. Schritte und Atem sind schwer, nur die Augen funkeln.
»Hab ich dir nicht alles gegeben?«, schreit sie. Die Stimme überschlägt sich, bricht ab mit einem lauten Quieken. »Hab ich dir nicht alles gegeben?«, schreit die Gestalt nochmals, voller Verzweiflung.
Verschämt bedeckt Titania mit den Armen ihre Brüste, ein rotes Blatt (allerdings nicht so rot wie ihre Wangen) fällt ihr aus dem Haar.
Oberon stützt sich ungerührt im Sitzen mit den Armen auf, lässt die Beine gespreizt, grinst die Gestalt spöttisch an. Dann zieht er seine Titania in eine gleichermaßen beschützende wie besitzergreifende Umarmung und sagt nur: »Geh scheißen!«
Da kann sich auch die völlig verschreckte Titania ein dämliches Kichern nicht mehr verkneifen.
»Und dann beginnen die Morde« – das wäre jetzt eigentlich der klassische Abschlusssatz für diesen Prolog. Ich will den geneigten Leser aber nicht anlügen. Die Morde beginnen nämlich erst knapp vierundzwanzig Stunden später.
1. Aufzug
1
Am Anfang war das Wort. Und bekanntlich gibt ein Wort ja das andere. In der Liebe wie im Streit, in der Politik wie in der Kunst. Das trifft folgerichtig auch auf ein Theaterstück zu: ohne Worte kein Dialog, ohne Dialoge kein Stück. Schon gar nicht vom alten William Shakespeare. In seinen Tragödien gibt nicht nur ein Wort das andere, sondern auch gerne mal ein Mord den anderen. Und noch einer. Und noch einer. Bis am Ende alle tot sind. Gemeuchelt, vergiftet, erstochen oder in den Freitod gegangen. Da war der alte Shakespeare nicht sehr zimperlich.
Bei seinen Komödien ist das nicht so. Also, das mit den Morden, das mit den Worten natürlich schon.
Dass im »Sommernachtstraum« der Oberon mitten im zweiten Akt sein frühzeitiges Ende findet, steht daher auch in keinem Skript (auch in keinem Folio oder Quarto). Ist aber genau so passiert. Auf der Bühne der Perchtoldsdorfer Sommerfestspiele. Vor etwa fünfhundert Zuschauern. Live, in Farbe und nativem 3-D. Und mittendrin natürlich die Charlotte Nöhrer.
Aber fangen wir besser von vorne an.
Die Charlotte war bei der Premiere der Perchtoldsdorfer Version von Shakespeares »Sommernachtstraum« aus beruflichen Gründen dabei. Nach ihrem Abenteuer in Schladming (das ist eine Geschichte für ein anderes Mal) hatte sie ihren Worten Taten folgen lassen. Sie hatte ihren Job als Security in einer Shoppingmall aufgegeben, sich mit den Eltern ausgesöhnt und war in den familiären Weinbetrieb eingestiegen. Ihre Zeit als Polizistin war da schon gut zwei Jahre her.
Der Einstieg in den Weinbetrieb als Juniorchefin hatte zwar dem lang gehegten Wunsch des Herrn Papa entsprochen, war aber dennoch nicht ganz friktionsfrei abgelaufen. Die Charlotte war stur, der Herr Papa war stur, und beide hatten diametral entgegengesetzte Vorstellungen, wie ein Weinbau- und Heurigenbetrieb heutzutage zu führen war. Die Charlotte hatte sich vorerst durchgesetzt, was fürs Erste als Information reichen sollte.
Wichtig ist jetzt nur, dass die Charlotte – nicht zuletzt dank ihres in der Folge von Schladming kurzfristig österreichweiten Bekanntheitsgrades – die exklusive Schankkonzession für die Festspiele an Land hatte ziehen können. Das war per se nicht das Wahnsinnsgeschäft (obwohl sich damit schon ganz gut verdienen ließ), aber es steigerte den Bekanntheitsgrad vom Weinbau Nöhrer. Zu den Festspielen kamen ja auch viele Wiener, Niederösterreicher und Burgenländer – ab und zu wurde auch eine Busladung aus einem weiter entfernten Bundesland oder sogar aus dem benachbarten Ausland vor den Burgtoren ausgeladen –, und die mussten allesamt den Nöhrer-Wein konsumieren, wenn sie nicht verdursten wollten. »Mussten« wäre der Charlotte natürlich nie über die Lippen gekommen, »durften« wäre ihre Wortwahl gewesen.
Für die Ausschank hatte die Charlotte eine Holzhütte, ähnlich jenen auf den Weihnachtsmärkten, im Burghof aufbauen lassen. Unübersehbar waren dort Fotos vom Weingut und vom Heurigenlokal angebracht. Zusätzlich gab es Infoflyer und, eh klar, die Untersetzer für die Gläser waren mit dem Firmenlogo und der dazugehörigen Adresse gebrandet. Alles zwar ein bisschen aufdringlich, aber der Herr Papa hatte die PR-Arbeit in den letzten Jahren doch etwas schleifen lassen. Die Charlotte fand, dass sie jetzt wieder mehr Gas geben mussten, wenn sie mit den anderen »jungen« Heurigen in Perchtoldsdorf mithalten wollten. Tradition war ja schön und gut, aber sie ernährte nun mal keine Familie.
Die Hütte der Charlotte befand sich unmittelbar neben der Einfahrt zum Burghof. Ein paar Meter daneben hatte der lokale Fleischhauer seinen Verkaufsstand, an dem Leberkässemmeln, Schnitzelsemmeln, Grillhühner und Ähnliches angeboten wurden. Durchaus rustikal, aber es war nun mal ein Sommer- und nicht das Burgtheater. Auf der anderen Seite der Einfahrt war die Abendkassa. Wenn keine Sommerspiele stattfanden, war der Burghof ein öffentlicher Parkplatz. Dort, wo das restliche Jahr über Dutzende Autos abgestellt waren, stand nun eine große Stahlrohrtribüne, die Platz für knapp fünfhundert Zuschauer bot. Dahinter nahm die Bühne beinahe die gesamte Breite des Burghofs ein und schmiegte sich fast direkt an die Mauer der alten Herzogsburg. Nur ein schmaler Grünstreifen hatte als Fluchtweg nicht verbaut werden dürfen. Links und rechts wurde der Burghof von weiteren Mauern eingerahmt, die so kunstvoll restauriert worden waren, dass sie immer noch einen verfallenen Eindruck machten.
Wenn die Charlotte an ihrem Verkaufsstand beschäftigt war, konnte sie aufgrund des dazwischen befindlichen Tribünenmonsters nichts von der Bühne sehen. Hören – ja, sehen – nein. Und gerade am Premierenabend wollte die Charlotte ihren Stand nicht allein lassen. Sie hatte zwar für diesen Abend zwei Kellnerinnen des Heurigen als Hilfen eingeteilt, aber natürlich waren die Abläufe noch nicht eingespielt. Zudem waren zur Premiere jede Menge Promis geladen (wenige der A-Klasse, einige der B- und viele der C-Klasse), und da witterte die Charlotte die Chance, ein wenig Werbung für ihren Wein zu machen.
In dieser Hinsicht war sie nicht enttäuscht worden. Vom Fernsehen, sowohl öffentlich als auch privat, waren etliche Gesellschaftsreporter angetanzt, von den Printmedien ebenfalls. Und weil der sattsam bekannte und überall anwesende Braumeister sich mit einer jungen Dame aus seinem »Haustierzoo« das für ihn ungewohnt hochkulturelle Ereignis vor Beginn an ihrem Stand erträglich trinken wollte, waren auch schnell die Kameras da. Die Charlotte grinste zufrieden, am nächsten Abend würde der Name ihres Weinbaubetriebs groß und gut sichtbar zur Primetime auf allen Kanälen zu sehen sein. Was für eine Werbung: Österreichs größter Bierbrauer genießt Nöhrer-Wein.
Fast noch größer war aber die Genugtuung bei dem Gedanken, wie Herbert Zaitler, der Vorsitzende des örtlichen Weinbauvereins, schäumen würde, wenn er sie und ihre Holzhütte im Fernsehen sah. Dem Zaitler war die Charlotte nicht zuletzt aufgrund ihrer Elefant-im-Porzellanladen-Attitüde ein schmerzhafter Dorn im Auge. Bislang hatte er noch bei jedem Modernisierungsversuch der Charlotte versucht, sein Veto einzulegen – soweit ihm das als Weinbauverbandsobmann möglich war. Sprich: Er konnte nicht allzu viel tun, denn in den Betrieb des Weinguts Nöhrer durfte er sich nicht einmischen. Aber durchgehend Stress machen und sich beschweren, das konnte er so richtig gut.
Der Zaitler war durch und durch in der Vergangenheit verwurzelt. Ihm wäre es wahrscheinlich sogar am liebsten gewesen, wenn die Heurigen nach wie vor nur ein kaltes Buffet anbieten würden, was inzwischen natürlich völlig undenkbar war. Bei seinem eigenen Heurigenbetrieb hatte er gegenüber seiner Familie auch nur zähneknirschend nachgegeben, nachdem die Gäste ausgeblieben waren.
Der erste große Ansturm war inzwischen vorbei, die zweite Hälfte des Stücks voll im Gange. Die Flora, Charlottes kleine Schwester, und die Andrea, Charlottes Freundin und Liebhaberin, durften sich vom hintersten Rang aus das Stück ansehen (bei Freikarten für Mitarbeiter und deren Verwandte war man nicht so großzügig). Die Charlotte räumte mit einer der Kellnerinnen gerade Weinnachschub ein. Nach Ende der Vorstellung würde es an ihrem Stand hoffentlich nochmals so richtig rundgehen.
Mit einem Ohr hatte die Charlotte mitbekommen, dass sich die Handwerkertruppe rund um Zettel für die Proben ihres Stücks anlässlich der Hochzeit des Herzogs von Athen bereits im Wald versammelt hatte. Just da erschien unerwartet Kundschaft an ihrem Stand.
Den Kopf halb unter der Theke und Flaschen einschlichtend fragte sie: »Was darf ich Ihnen anbieten?«
»Ich weiß nicht so genau«, sagte der junge Mann auf der anderen Seite der Theke unsicher. Zwar war es selbst für einen Abend im späten Juni ungewöhnlich warm, aber er war relativ leicht angezogen, eigentlich gab es keinen Grund, zu schwitzen. Was er aber tat.
Die Charlotte sah sich den Burschen – er konnte noch keine achtzehn sein – etwas genauer an. Er war vielleicht eins achtzig groß und extrem schlank, um nicht zu sagen dürr. Halblange schwarze Haare mit spitzem Ansatz auf der Stirn, bleiches Gesicht. Nasenring, Lippenringe, Ohrring, auf seinem Handrücken konnte die Charlotte den Anfang oder das Ende einer schwarzen Tätowierung erkennen, die sich unter das schwarze Hemd schlängelte. Dazu schwarze Jeans und abgetragene Doc Martens, wobei sich die Charlotte wunderte, dass man die heutzutage überhaupt noch trug. Alles in allem machte er auf sie den Eindruck eines klassischen Emos, der sich alle Mühe gegeben hatte, sein Outfit dem gesellschaftlichen Anlass entsprechend zu gestalten. Bei uns hieß das damals noch Grufti, dachte die Charlotte und schüttelte innerlich den Kopf.
»Wie wär’s mit einem Schüttelwein? Der ist spritzig und erfrischend«, schlug die Charlotte vor. Nervös zupfte der Junge mit den Fingern an seinem Lippenpiercing, den Mund halb offen. Dabei fiel der Charlotte auf, dass er auch ein Zungenpiercing hatte.
»Was ist das? Ich möchte nichts zu Starkes.«
»Keine Sorge. Schnaps oder Ähnliches bieten wir nicht an. Unser Schüttelwein ist eine Spezialabfüllung für die Festspiele, ein Rosé-Frizzante. Schüttelwein ist ein Wortspiel auf Shakespeare. Schüttelbier, Schüttelwein und so, verstehen Sie?«
Die Charlotte erntete einen verständnislosen Blick. Gut, vielleicht hatte sie es mit der Namensgebung doch etwas übertrieben. Der Junge vor ihr war nicht der Erste, der das Wortspiel nicht zu würdigen wusste, an diesem Abend hatte sie den Schüttelwein schon unzählige Male erklären müssen.
Sie setzte nach: »Sekt, Frizzante und so weiter verbindet man ja mit Schütteln, wegen der Siegerehrungen im Sport und so. Und ›Shakespeare‹, das klingt wie Bier, aber wir machen ja Wein und nicht Bier, also deshalb Schüttelwein.« Aber es war sinnlos, der Witz war nicht mehr zu retten.
In Gedanken machte sich die Charlotte eine Notiz, dass sie den Schüttelwein so bald wie möglich umbenennen sollten. Das aktuelle Lot musste aber noch mit diesem Namen leben. Die Etiketten waren ja längst auf die Flaschen geklebt.
»Ist gut, ich nehme einen«, entschied sich der Junge schließlich doch.
Die Charlotte gab sich seufzend geschlagen und sagte: »Schmeckt besser, als er heißt.«
Sie nahm die langhalsige Flasche und goss den Schüttelwein in eine Sektflöte – am Premierenabend waren die wegen der Promis noch aus Glas. Später bei den regulären Vorstellungen wurde dann in Plastikeinweggläsern ausgeschenkt. Im Licht der untergehenden Sonne schimmerte der Frizzante lachsrosa, und am Glas bildete sich eine dünne Kondensschicht.
Der Junge schob mit leicht zittrigen Fingern einen Fünf-Euro-Schein über die Theke, die Charlotte konterte mit einer Ein-Euro-Münze. »Da ist übrigens ein Euro Einsatz auf dem Glas«, sagte sie und sah ihm nachdenklich nach, als er sich wegdrehte.
Er entfernte sich einige Meter von ihrem Stand, ging jedoch nicht zur Tribüne. Hat er keine Karte?, fragte sich die Charlotte insgeheim.
Der Junge starrte einfach nur in den Nachthimmel, zwischendurch blickte er immer wieder auf die Uhr.
Eigenartiger Typ, dachte die Charlotte.
Und dann brach die Hölle los.
2
»Charly, Charly!«, schrie die Flora hysterisch. Sie hatte sich über den oberen Rand der Stahltribüne gebeugt und winkte ihrer großen Schwester hektisch zu. Aber nicht nur die Flora war hysterisch – das gesamte versammelte Promi-Publikum war mit einem Mal in heller Aufregung. Die Charlotte ließ alles liegen und stehen und stürmte zur Bühne. Am Fuß des Tribünenaufgangs wurde sie von der Andrea erwartet, die sich nicht lange mit Rufen aufgehalten hatte.
»Was ist los?«, fragte die Charlotte schnaufend. Die Andrea zeigte wortlos zur Bühne. Dort drängte sich das komplette Ensemble um eine Person. Sie lag am Boden und rührte sich nicht. Sanitäter waren auch schon oben und versuchten, sich einen Weg durch die Schauspieler zu bahnen. Die Charlotte nahm die Andrea an der Hand und zog sie weiter nach vorne. Über die Lautsprecher kam derweil die Ansage, dass die Zuschauer bitte auf ihren Plätzen sitzen bleiben sollten. Es bestehe kein Grund zur Panik. Nach kurzem Rundblick war sich die Charlotte sicher, dass keine Gefahr bestand, die versammelte Prominenz könnte demnächst in Panik ausbrechen. Eher herrschte das Gegenteil – Sensationsgier und Schaulustigkeit. Viele hatten ihre Handys gezückt und fotografierten die Szene. Die Gesellschaftsreporter standen mit den Kamerateams direkt vor der Bühne im schmalen Fotograben und hielten alles in Bild und Ton fest. An Zeugen und Fotobeweisen würde es jedenfalls nicht mangeln, auch wenn zwei Polizisten versuchten, die Meute mit Händen und Füßen von der Bühne wegzudrängen. Vom Marktplatz, der eine Art übergroßen Vorplatz für Wehrturm, Kirche und Burg bildete, hörte man bereits die Sirene eines heranrasenden Rettungswagens.
Die Charlotte und die Andrea hatten sich über einen schmalen Grünstreifen am Rand der Burgmauer an der Tribüne vorbeigeschummelt und standen nun am rechten Bühnenrand, genau dort, wo die letzten Bäume des angedeuteten Waldes am Boden fixiert waren. Ebendort hatte es den Oberon anscheinend erwischt, so viel konnte die Charlotte durch das Menschengewirr erkennen. Die Sanitäter bemühten sich, dem Schauspieler mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage wieder Leben einzuhauchen, aber noch bevor der Notarztwagen in den Burghof einbog, hatten sie ihre Bemühungen bereits wieder eingestellt. Die übrigen Schauspieler standen in einem Halbkreis um den regungslosen Oberon, allen voran der geschockte Darsteller des Puck. Hinter ihm bedeckte die Titania ihren vor Schreck weit aufgerissenen Mund mit einer Hand.
»Halt, ich kann dich da nicht rauflassen!« Ein Polizist stellte sich der Charlotte und ihrer Freundin in den Weg. Sie sah ihn an und lachte lauthals los. Als einige der Schauspieler sich empört zu ihr umdrehten, verstummte sie sofort. Noch unpassender hätte man sich nun wirklich nicht benehmen können.
»Aber geh, Leo, das meinst du doch nicht ernst. Was willst du mit deiner Cousine denn machen? Mich in Handschellen abführen? Also komm, lass uns durch.« Der Polizist schnaufte einmal tief durch, erkannte seine hoffnungslose Lage und ließ die Cousine passieren. »Danke, hast eine Flasche vom Schüttelwein gut bei mir«, raunte die Charlotte im Vorbeigehen.
Der Leo verdrehte die Augen. Auch er hatte sich den Schüttelwein-Witz erklären lassen müssen (mehrmals sogar, was den Witz nicht besser machte). Er musste aber gestehen, dass der Frizzante viel besser schmeckte, als der Name vermuten ließ. Den ablenkenden Gedanken wischte er schnell beiseite und machte sich wieder an die Arbeit. Was umgehend der Society-Reporter des dramatisch überdimensionierten Boulevardblattes »Heimatland« zu spüren bekam.
»Aber gehen S’, Herr Inspektor, Sie haben die Dame vor mir ja auch durchgelassen.«
»Erstens: Inspektor gibt’s keinen.« (Eine glatte Lüge, der Leo war ja sogar Chefinspektor. Aber er hatte den alten Kottan-Witz schon so lang einmal anbringen wollen.) »Zweitens: Das ist praktisch eine Kollegin. Und drittens: Was du willst, ist mir aber so was von wurscht. Du kommst da nicht durch. Und jetzt zack, zack, zack, nach hinten mit dir.«
»Weil sonst was passiert?«, wollte der schmierige Typ wissen. Seine Augen waren blutunterlaufen (was nicht nur vom ständigen Starren auf einen Bildschirm kam), die halblangen, fettigen Haare nach hinten gegelt.
»Weil es sonst poscht!«, drohte der Leo und richtete sich zu seinen vollen ein Meter neunzig auf.
»Polizeigewalt! Geht’s noch? Hilft mir denn keiner?«, schrie der Reporter aufgebracht.
»Gusch!«, sagte ein weiterer Reporter. »Schleich dich!«, ein anderer. Weder der Society-Reporter noch sein Arbeitgeber waren in der Branche sonderlich beliebt. Hätte der Leo ihm tatsächlich eine aufgelegt, gäbe es wohl keinen, der das vor Gericht bezeugen würde. Damit war die Diskussion beendet.
Angefressen versuchte der Reporter, am Leo vorbei ein paar Blicke auf die Bühne zu erhaschen, mehr ging beim besten Willen nicht. Sein Fotograf streckte die Kamera blind in die Höhe und hoffte auf einen Schnappschuss für die Titelseite der morgigen Ausgabe.
Die Charlotte hatte es inzwischen geschafft, bis zur Leiche vorzudringen. Die Schauspieler kannten sie von den Proben. Keiner von ihnen hatte sich in den letzten Wochen nicht wenigstens einmal mit ihren Weinen aus dem Leben geschossen. Also ließ man sie gewähren. Sie gehörte ja praktisch zur Truppe. So eine Art Ehrenmitglied.
Vor ihr lag der leblose Körper von Norbert Obermayer, dem Darsteller des Oberon. Ganz offensichtlich war da nichts mehr zu machen. Der Brustkorb bewegte sich keinen Millimeter, die Augen starrten ins Leere, die Lippen waren bereits violett, und kleine Speichelbläschen liefen aus den Mundwinkeln.
»Lassts mich durch. Verdammt noch mal, lassts mich durch!«, ertönte es nun vom Bühnenabgang. Eine gewaltige Gestalt wälzte sich auf die Bühne, Valentin Lobinger, Regisseur und Intendant der Festspiele. Schnaufend schleppte er seine komplett in schwarzes Tuch gehüllten hundertfünfzig Kilo zum Schauplatz des Geschehens. Ehrfürchtig machten die Schauspieler der lebenden Legende Platz.
Auch wenn man es ihm heute nicht mehr ansah: Der Lobinger war vor Jahren mal eine ganz große Nummer in der internationalen Theaterszene gewesen. Er hatte es sogar geschafft, in London Shakespeare zu spielen. Irgendwann jedoch hatte es in seinem Leben einen Knacks gegeben, von dem er sich nicht mehr erholt hatte. Die Sommerfestspiele in Perchtoldsdorf waren vielleicht seine letzte Chance, nochmals die Kurve zu kratzen.
Der Lobinger fiel vor der Leiche des Obermayer auf die Knie. Seine mächtige Brust hob und senkte sich in schnellem Takt – ob vor Anstrengung oder Aufregung, hätte weder die Charlotte noch sonst einer sagen können. Fast schon zärtlich strich der Lobinger seinem Oberon über die Wange, dann schloss er ihm vorsichtig die Augenlider.
Ganz großes Theater. Beinahe hätte die Charlotte eine Träne verdrückt. Aber die Charlotte hatte ihn in den letzten Wochen auch schon ganz anders erlebt und wusste, er konnte ein ganz gewaltiger Arsch sein. Schließlich erhob sich der Lobinger, gestützt von ein paar Schauspielern.
»Was ist passiert?«, fragte die Charlotte jetzt endlich in die Runde. Eine halb nackte Gestalt trat vor und räusperte sich. Es war Willi Hofer, der Darsteller des Puck. Sein Kostüm bestand lediglich aus einer wolligen braunen Hose. Dazu barfuß, nackte Brust – man konnte seinen gut durchtrainierten Oberkörper sehen. Und den brauchte er auch, denn der Lobinger verlangte seinem Puck einiges an Akrobatik ab. Wie ein Alpen-Tarzan musste er sich von Baum zu Baum schwingen, Salti schlagen und noch andere waghalsige Kunststücke vollbringen.
»Wir waren gerade bei der Stiefmütterchen-Szene. In unserer Version ist das Original etwas abgeändert. Der Nobsi«, dabei zeigte der Willi auf die Leiche, »erzählt bei uns nicht nur von der Blume, die er in größerer Menge für seinen Liebeszauber braucht, sondern zeigt mir auch eine. Die letzte, die er noch hat. Ich habe die Blume angepustet, und kurz darauf hat der Nobsi zu würgen und zu keuchen angefangen. Dann ist er hingefallen, und das war’s dann auch schon.« Der Willi hielt die Plastikblume noch immer in der Hand.
Sanft löste die Charlotte das Requisit aus seiner panischen Umklammerung und hielt es vorsichtig am Stängel fest.
»Leo!«, rief sie über ihre Schulter hinweg. Ihr Cousin drehte sich sofort um und sah sie fragend an. Sie winkte ihn zu sich und flüsterte ihm ins Ohr: »Vergiss mal kurz die Pressefritzen. Hier!« Sie drückte dem verdutzten Leo die Plastikblume in die Hand. Dann sagte sie leise: »Vorsicht, Beweisstück!«, zwinkerte ihm zu und wandte sich wieder zu den Schauspielern um. Der Leo zog einen kleinen Plastikbeutel aus seinem Multifunktionsgürtel und ließ das Blümchen darin verschwinden.
Mittlerweile hatte sich der Notarzt einen Weg durch die Menge gebahnt, doch auch er konnte nur mehr den Tod von Norbert Obermayer feststellen. Als sich der Arzt erhob, sperrte die Spurensicherung endlich den Tatort ab und drängte Schauspieler, Presse und Schaulustige zurück. Das Blitzlichtgewitter aus dem Publikum ebbte jedoch noch immer nicht ab, denn Obermayer war während der normalen Spielzeiten ein gefeierter Star am Wiener Burgtheater. Ein Blick auf Twitter oder Facebook hätte gezeigt, dass die Begriffe #Obermayertot, #Oberonermordet und #PTownFestspiele gerade überdurchschnittlich trendeten.
Über die Lautsprecher kam die Durchsage, dass die Vorstellung für diesen Abend beendet sei. Es tue den Veranstaltern unendlich leid, aber wegen einer »Unpässlichkeit« von Norbert Obermayer könne man das Theaterstück leider nicht zu Ende führen. Die Zuschauer wurden gebeten, ihre Plätze geordnet zu räumen. Wer für seine Karte regulär bezahlt habe, bekomme das Geld an der Abendkassa zurück. Das waren am Ende gerade mal hundert Leute. Der Rest waren die üblichen Premieren-Schnorrer mit geschenkten VIP-Karten.
»Lass uns zum Stand zurückgehen«, sagte die Charlotte zur Andrea. Sie wusste, dass sie hier nichts mehr ausrichten konnte. Die Leiche war ausreichend abfotografiert und untersucht worden und konnte nun für den Abtransport fertig gemacht werden. Die Polizei sperrte den Tatort weitläufiger ab, und der Lobinger stand, nun wieder verhältnismäßig gefasst, der Presse Rede und Antwort. »Vielleicht lässt sich ja am Stand noch ein Geschäft machen. Dann war der Abend wenigstens nicht ganz für die Fisch’.«
An der Hütte wurden sie bereits von der Flora erwartet. Sie hatte sich in Abwesenheit ihrer Schwester hinter die Theke gestellt und schenkte fleißig aus.
Die Aufregung machte die Promigäste offenbar durstig. »Geh, bring noch zwei oder drei Kartons vom Schüttelwein«, sagte die Flora zu ihrer verdutzten Schwester. »Der geht weg wie warme Semmeln.«
Die Flora entpuppte sich einmal mehr als wesentlich reifer, als ihre fünfzehn Jahre vermuten ließen. Während die Charlotte wie so oft ihre neugierige Nase in Sachen gesteckt hatte, die sie eigentlich gar nichts angingen, hatte sich die kleine Schwester ungefragt zur Chefin am Weinstand aufgeschwungen. Und es funktionierte. Freundlich, aber bestimmt wies die Flora die wesentlich älteren Kellnerinnen an, und die taten umgehend wie ihnen geheißen. Genauso wie die Charlotte. Mit der Andrea im Schlepptau schlurfte sie zu ihrem kleinen Lieferwagen, holte eine Transportrodel und mehrere Kartons vom Schüttelwein aus dem Laderaum und lieferte ihrer Schwester wie gewünscht den Alkohol.
»Jetzt ist’s dann aber auch gut«, schnaubte sie ihr Schwesterherz schließlich an, »du kannst mich wieder ranlassen.«
»No way. Ich bleibe und helfe dir. Ich kenne dieses Glitzern in deinen Augen. Du bist sowieso nicht bei der Sache.« Die Charlotte seufzte und musste zugeben, dass die Flora durchaus recht hatte. Sie bekam das Bild des toten Obermayer einfach nicht aus dem Kopf. Nicht weil der Anblick so grausig gewesen wäre – als ehemalige Polizistin war die Charlotte einiges gewohnt, man hätte auch sagen können, dass sie einen echten Saumagen hatte –, sondern weil das alles so überraschend gekommen war. Andererseits, welcher Mord, und davon ging sie aus, kam schon nicht überraschend?
Perchtoldsdorf war ja nicht unbedingt die Riesenmetropole, wo es täglich Gewaltverbrechen gab. Der Ort grenzte unmittelbar an die Hauptstadt Wien an und galt als Nobelvorort. Quasi das Weiße im Speck des sogenannten Speckgürtels im Süden der Hauptstadt. Viele teure Villen, vor allem in Richtung Heide und Wienerwald, dazu ein paar Cottage-Viertel, wahllos über den ganzen Ort verteilt. Alles gutbürgerlich, aber doch auch ein wenig ländlich, wofür allein schon die Dutzende Heurigenbetriebe im Ort sorgten.
Die Charlotte hatte mehr als einmal die Vermutung angestellt, dass es in Perchtoldsdorf die höchste Pro-Kopf-Heurigendichte in ganz Österreich geben musste. Jeden Tag hatten im Schnitt sicher acht bis zehn verschiedene Heurigenbetriebe geöffnet, und das bei einer Einwohnerzahl von gerade mal fünfzehntausend inklusive Zweitwohnungsbesitzern. Damit war Perchtoldsdorf, abgesehen von der Bezirkshauptstadt Mödling, der größte Ort im Speckgürtel, der sich wie eine Perlenkette nach Süden erstreckte. Eine Ortschaft reihte sich an die andere: Perchtoldsdorf – Brunn am Gebirge (das namensgebende »Gebirge« wird bis heute gesucht) – Maria Enzersdorf – Mödling. Trotz seiner Größe war Perchtoldsdorf aber keine Stadt, sondern eine Marktgemeinde. Allerdings eine der größten Österreichs, was nicht verwunderte. Das diesem Ort eigentlich zustehende Stadtrecht wurde von der örtlichen Politik mit dem Verweis auf die Tradition seit Jahrzehnten abgelehnt. Tatsächlich hatte die Weigerung eher mit den höheren Förderungen für Marktgemeinden zu tun, aber das hätte offiziell natürlich niemand zugegeben.
Obwohl der Bezirk Mödling mehr oder weniger eine einzige große Stadtfläche bildete, waren die Bewohner der einzelnen Gemeinden doch wahnsinnig stolz auf ihre jeweilige Eigenständigkeit. Das erinnerte ein bisschen an die EU, wo auch alle irgendwie zusammengehörten, sich aber in falsch verstandenem und oft geschürtem Nationalstolz hinter den eigenen Grenzen verschanzten. Immerhin konnte man sich im Bezirk auf gemeinsame »Feinde« verständigen und war sich auch einig, dass die Zivilisation an der südlichen und westlichen Stadtgrenze von Mödling endete.
Kinder, die jenseits davon aufwuchsen, aber in die Schulen von Mödling, Perchtoldsdorf und so weiter pendelten, hatten es dort nicht wirklich leicht. Einen Spezialfall bildete dabei der sogenannte Tirolerhof zwischen Perchtoldsdorf und Gießhübl, der höchstgelegenen Ortschaft im Bezirk – eine Perchtoldsdorfer Exklave, die aus ein paar Dutzend Einfamilienhäusern bestand und außerhalb des eigentlichen Ortsgebiets lag. Von dort kamen im Spätherbst immer die ersten Autos mit einer dicken Schneedecke in die Zivilisation herunter. Dann wussten die Schulkinder, dass Weihnachten vor der Tür stand.
Die Gemeinde Perchtoldsdorf tat alles Menschenmögliche, um diese Abgrenzung zum Tirolerhof schon im jungen Alter in den Köpfen der Kinder zu verankern. So bildeten die Kinder vom Tirolerhof bereits in der Volksschule und auch später im Gymnasium eigene Klassen. Klar, total förderlich für die Integration. Mit Schaudern erinnerte sich die Charlotte noch an die Kämpfe, die zu ihrer eigenen Schulzeit zwischen den einzelnen Klassen ausgefochten worden waren.
Wie gesagt, die einzelnen Ortschaften grenzten sich, obwohl vollständig miteinander verwachsen, gerne voneinander ab. Doch es gab natürlich noch einen größeren gemeinsamen »Feind«, und der hieß Wien. Egal, dass statistisch nachgewiesen achtzig Prozent der Bewohner des Speckgürtels tagtäglich nach Wien zur Arbeit pendelten, wollte man mit der Bundeshauptstadt doch bitte schön so wenig wie möglich zu tun haben. In Perchtoldsdorf hörte man auch gerne den Spruch, dass Wien sowieso nur der nächstgrößere Vorort von Perchtoldsdorf sei. Gut, das konnte man sehen, wie man wollte. Tatsache war aber auch, dass viele Promis in den letzten zwei, drei Jahrzehnten aus der großen Stadt nach Perchtoldsdorf übersiedelt waren. Einfach, weil das Leben hier nahezu perfekt war und alle Vorteile von Stadt und Land vereinte. Mit dem Auto oder den Öffis war man in fünfundzwanzig Minuten in der Wiener Innenstadt (falls man nicht gerade in den täglichen Megastau auf der Südosttangente geriet), auf der anderen Seite war es nur ein Katzensprung, wenn man sich im Wienerwald erholen wollte. Villenviertel und viel Grün dominierten den Ort, und die Schulen im Raum Mödling hatten einen hervorragenden Ruf. Mit der Shopping City Süd – kurz SCS genannt – befand sich eine der größten europäischen Shoppingmalls gleich ums Eck, und verkehrstechnisch lag man genau an der Gabelung von Süd- und Westautobahn. Hätte der liebe Gott einen perfekten Platz zum Leben geschaffen, Perchtoldsdorf wäre dabei herausgekommen. Meinten jedenfalls die älteren Perchtoldsdorfer.
Wenn man die Jugend befragte, bekam man etwas anderes zu hören, egal, ob in Perchtoldsdorf, Brunn, Maria Enzersdorf oder Mödling. Dabei waren Brunn und Maria Enzersdorf sowieso die totalen Wüsten, was jugendliches Entertainment anging. In Mödling hatte es zu Charlottes Jugendzeiten immerhin noch fünf, sechs Lokale zum Ausgehen gegeben. Trotzdem war auch damals schon das »M« am Mödlinger Ortsschild gerne mal übersprüht worden, sodass nur mehr »Ödling« übrig blieb. Schon damals waren Feuerzeuge mit dem Aufdruck einer Ratte, die aus einem Kanaldeckel lugte, und der Aufschrift »Mödling – nicht einmal ein Kanaldeckel hat offen« der große Renner gewesen. In Perchtoldsdorf war die Lage für Jugendliche auch nicht besser: Unzählige Heurige, aber nur zwei Lokale, in denen »normale« Musik gespielt wurde. Und diese zwei Lokale grenzten sich strikt voneinander ab. In dem einen war früher die Bumm-Bumm-Disco-Fraktion mit Golf GTI zu Hause gewesen, im anderen die »Alternativen«. Letzteres, die »Motte«, gab es auch heute noch, es war besonders ab Mitternacht für einen jetzt-aber-wirklich-allerletzten Absacker beliebt. Das eigentlich winzige Bumm-Bumm-Discolokal war inzwischen in eine ausgezeichnete Cocktailbar verwandelt worden. Wollte man heutzutage als Jugendlicher am Wochenende richtig ausgehen, musste man schon nach Wien, denn hier draußen gab es für die Jugendlichen nichts mehr zu holen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Aus Sicht der Eltern war der Bezirk Mödling richtig toll, um dort Kinder aufzuziehen. Nur die Jugendlichen selbst sahen das ein bisschen anders. Aber was weiß die Jugend schon vom Leben?
Was die Kriminalitätsrate anging, so war der Bezirk klarerweise ein beliebtes Ziel für Einbrecher, Morde gab es aber so gut wie nie. Und genau deshalb war die Charlotte so in Gedanken versunken. Sie hatte sich mit der Andrea, einer Zigarette und einem Glas ihres hochgelobten und doof benamsten Schüttelweins hinter die Holzhütte verzogen, strich sich gedankenverloren eine kastanienrote Locke aus der Stirn und ließ sich die Geschehnisse nochmals durch den Kopf gehen. Irgendwie erinnerte sie das alles sehr unangenehm an die Morde in Schladming vor einem halben Jahr. Auch da war sie wie die Jungfrau zum Kind an ein paar Tote geraten. Gut, diesmal wusste sie, dass der Fall bei ihrem Cousin und seinen Kollegen in halbwegs kompetenten Händen lag. Einerseits. Andererseits hatten die hiesigen Polizisten halt aus den oben erwähnten Gründen mit Morden eher wenig Erfahrung. Was solche Fälle anging, da besaß sie dank ihrer Zeit als Polizistin in Wien schon einen ganz anderen Erfahrungsschatz.
»Willst du dich wieder einmischen?«, fragte die Andrea, der das Glitzern in Charlottes Augen gar nicht gefiel. Zwar hatten sich die beiden damals unter solchen Umständen kennengelernt, aber die Sache in Schladming war wirklich brandgefährlich gewesen. Nachdem alles gut ausgegangen war, hatten sich bei der Andrea die Erinnerungen an die teils lebensgefährlichen Ermittlungen rasend schnell verflüchtigt. Jetzt kamen sie wieder zurück.
Die Charlotte sah ihrer Freundin tief in die Augen. »Nein, diesmal nicht. Das soll die Polizei erledigen. Ich habe mit meinem Heurigen genug zu tun.«
Dafür gab es umgehend einen Kuss von der Andrea. Die Charlotte vergrub ihre Hände in den blonden Haaren ihrer Liebhaberin und drückte sie noch fester an sich.
3
Es war bereits nach Mitternacht, als die Charlotte sich unter Mithilfe der Andrea und der Flora endlich daranmachte, den Stand für die Nacht zu schließen. Die Promis hatten ihr die Hütte fast leer gesoffen, deshalb hatte die Charlotte natürlich so was von überhaupt keine Probleme damit, dass sie weitaus länger als geplant offen halten musste.
Für ihren Betrieb hatte sich der Abend als Glücksfall entpuppt, besser hätte es nicht laufen können – so tragisch die Sache mit dem Toten auch war. Aber man hatte dabei die ganze Dekadenz der heimischen Prominenz zu sehen bekommen, niemand war lange geschockt gewesen. Stattdessen hatten die Leute getratscht, sich in Mutmaßungen ergangen und gehofft, dass ihre Wortspende zur Tragödie am nächsten Tag im Fernsehen oder wenigstens in einer Zeitung zu sehen oder zu lesen sein würde.
Nach und nach hatten die Promis sich dann doch endlich verzogen, der Braumeister mit seiner beinahe noch jugendlichen Begleiterin als einer der Letzten. Er war halt ein richtiges Faktotum. Und irgendwie mochte ihn die Charlotte.
Man musste das schon respektieren: So ungelenk, patschert und naiv er im Fernsehen auch rüberkommen mochte, er hatte es im Leben doch zu etwas gebracht. Aus eigener Kraft. Nicht so wie in New York der orangehäutige Baumeister mit der Ententolle, der vom Geld seines Vaters profitiert hatte. Vielleicht musste man sich, wenn man es schaffen wollte, einfach so penetrant wie er ins Licht der Öffentlichkeit drängen.
Für sie wäre das nichts gewesen. Die Interviewtour durch die diversen Fernsehsender nach dem gelösten Fall in Schladming war zwar nett gewesen, aber die Charlotte war am Ende froh, als in ihrem Leben endlich wieder Ruhe herrschte.
Mitten im geschäftigen Aufräumen und Saubermachen wurden sie unterbrochen: »Haben Sie noch was für mich?« Die Charlotte hatte gerade einen neuen Karton Schüttelwein unter der Theke verstaut und lugte kurz hoch, wer da noch was wollte. War ja eigentlich offensichtlich, dass der Laden für diesen Abend geschlossen hatte.
Auf der anderen Seite der Theke stand eine Frau Ende vierzig, die langen kastanienroten Haare – eine Farbe ähnlich wie die von der Charlotte – zu einem Dutt hochgesteckt. Elegantes Abendkleid mit einem leichten Seidenmantel darüber und einem Seidenschal, unter dem eine Perlenkette hervorlugte.
Die Charlotte erschrak. »Sind Sie nicht …?«
»Ja, die bin ich. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie noch etwas Alkohol für mich hätten. Ich brauch das jetzt wirklich. Ich bin gerade eine Stunde lang von der Polizei einvernommen worden.«
»Aber klar doch, Frau Obermayer!« Die Charlotte schenkte der frischgebackenen Witwe ein Glas ein – randvoll. »Geht aufs Haus.«
»Danke.«
Eigenartig, dachte die Charlotte. Die Frau hatte zwar einen Hauch von dunklen Ringen unter den Augen, die Augen selbst waren aber weder rot noch geschwollen, wie man es von einer Frau, deren Mann gerade in aller Öffentlichkeit ermordet worden war, erwartet hätte. Die Obermayer lehnte sich schwer gegen die Theke und nahm einen kleinen Schluck, dann ließ sie den Schüttelwein ein wenig im Mund kreisen, bevor sie schluckte. »Exzellent«, sagte sie, »was ist das?«
»Das ist mein sogenannter Schüttelwein. Ein Rosé-Frizzante, Spezialabfüllung für die Festspiele.«
»Schüttelwein!«, lachte die Obermayer. »Nicht schlecht. Passt zu einem Shakespeare-Stück.« Schnappatmung, vergrößerte Pupillen, Herzrasen bei der Charlotte – die Neo-Witwe war doch glatt die Erste, die das Wortspiel ganz ohne Erklärung verstanden und zu würdigen gewusst hatte! Es hatte nicht einmal eine Minute gedauert, und die Charlotte hatte die Obermayer schon ins Herz geschlossen.
»Renate. Freut mich«, sagte die Witwe, nachdem sie das Glas in zwei, drei langen Zügen geleert hatte.
»Charlotte Nöhrer. Keine deutsche Charlotte, also das ›e‹ ist stumm. Mehr so die französische Aussprache.« Sie reichte der Obermayer über die Theke hinweg die Hand. »Muss ein furchtbarer Abend für Sie gewesen sein.«
»Wie man’s nimmt«, antwortete die Obermayer gefasst, was die Charlotte doch etwas überraschte.
»Aber Ihr Mann …«, stammelte sie.
Die Obermayer machte eine wegwerfende Handbewegung. »Erstens: bitte nur Renate, kein Sie oder Ihr. Und zweitens: Ja, natürlich ist das schlimm mit dem Norbert, aber unsere Ehe war ja schon lange nicht mal mehr das Papier wert, auf dem unser Ehevertrag stand.«
Das Wort Ehevertrag machte die Charlotte hellhörig. Und in Kombination mit der gelassenen Haltung der Witwe klingelten bei ihr sofort die Alarmglocken. Das sah ihr die Obermayer offenbar an, denn sie bestellte gleich noch ein zweites Glas vom Schüttelwein, bevor sie fortfuhr: »Ja, ja, ich weiß. Das wirft jetzt natürlich kein gutes Licht auf mich. Aber du kannst mir glauben, dass ich mit dem Tod meines Mannes nichts zu tun habe. Ich hab ja auch nichts davon. Von uns beiden war immer ich es, die das Geld hatte. Der Norbert hat gut von mir gelebt – aber nie so, dass es mir wehgetan hätte. Selbst unsere Wohnung in der Innenstadt gehört mir. Außer ein paar Schulden gibt es beim Norbert nicht viel zu erben. Er war immer schon ein Lebemann, seine Gagen hat er gleich verblasen. Und seine Gspusis waren in der Erhaltung sicher auch nicht günstig.«
So viel Offenheit war der Charlotte ein bisschen zu viel. Stotternd und mit fragendem Unterton sagte sie: »Trotzdem, mein Beileid?« Die Obermayer zwinkerte ihr zu. »Danke. Es ist ja nicht so, dass ich mir seinen Tod gewünscht hätte. Auf der anderen Seite geht mir nicht großartig was ab. Wie gesagt, er hatte seine Affären, ich hatte meine. Wir hatten uns schon lange darauf geeinigt, dass jeder sein eigenes Leben führt.«
»Nicht böse sein«, sagte die Charlotte, »aber wieso seid ihr dann überhaupt noch zusammengeblieben? Ich meine, wäre es nicht einfacher gewesen, sich gleich scheiden zu lassen?«
Die Obermayer senkte den Blick und schien die Kohlensäureperlen in ihrem Schüttelwein zu zählen. »Nicht wirklich. Lange Zeit lief es zwischen uns beiden ja gut. Wir wollten sogar Kinder, aber das hat einfach nicht funktioniert. Irgendwann haben wir dann alle möglichen Tests gemacht, und dabei kam heraus, dass er unfruchtbar war. Wenn’s nicht so traurig wäre, wäre es ja schon wieder lustig. Weißt du, wie so etwas überprüft wird?«
Die Charlotte schüttelte den Kopf, war aber ganz aufmerksam. Darüber hatte sie sich noch nie Gedanken gemacht. Ganz tief im Unterbewusstsein war sie sich aber nicht sicher, ob sie just in dieser Situation darüber aufgeklärt werden wollte. Doch die Renate fuhr unerbittlich fort.
»Die ersten Tests werden beim Urologen gemacht. Da bekommt der Mann einen Plastikbecher in die Hand gedrückt, darf sich in ein mehr oder weniger geschmackvolles Zimmer zurückziehen und sich dann einmal wundern. Fernseher, DVD-Player, Pornohefte – alles da. Hauptsache, er kann sich einen abwedeln und sein weißes Gold in den Plastikbecher spritzen. Dann wird gleich eine Probe unter dem Mikroskop begutachtet. Da sieht man sofort, ob die Spermien schnell oder langsam sind. Und an dieser Hürde ist der Norbert schon gescheitert. Der große Frauenheld hatte einfach zu langsames Sperma. Oder anders ausgedrückt: Die sind verreckt, bevor sie auch nur in die Nähe eines zu befruchtenden Eis kommen konnten.«
Die Charlotte musste wieder schlucken. »Eh!«, meinte sie schließlich in Ermangelung einer intelligenteren Antwort. So viel Offenheit von einer mehr oder weniger Unbekannten war zwar nett, aber für ihren Geschmack doch zu viel Information für ein erstes Beschnuppern. Um von ihrer Verlegenheit abzulenken, schenkte sie sich auch ein Glas ein und stieß mit der Obermayer an. »Auf Rennsperma!«, prostete sie und wollte sich im selben Moment gleich wieder auf die Zunge beißen. Aber die Witwe lachte nur und leerte auch das zweite Glas in Windeseile. Die Charlotte schenkte ihr ungefragt ein drittes ein.
»Ja, Rennsperma. Das wär’s gewesen. Wie auch immer. Nach der Diagnose war der Norbert unter Schock. Und dann hat er angefangen, sich seine Männlichkeit zu beweisen.«
»Indem er mit anderen Frauen vögelte«, sagte die Charlotte und nickte.
»Genau. Aufgrund seiner Unfruchtbarkeit hatte er ja auch nicht zu befürchten, dass er irgendeiner seiner Tussis unabsichtlich ein Kind anhängt.« Die Obermayer senkte wieder den Blick. »Ich habe ihn damals – das ist jetzt schon über fünfzehn Jahre her – noch sehr geliebt und wollte diese für uns beide schwere Zeit mit ihm gemeinsam verbringen. Ihm zur Seite stehen. Aber er hat mich mehr und mehr aus seinem Leben ausgeschlossen. Nur bei offiziellen Anlässen sind wir nach wie vor gemeinsam aufgetreten. Wir wollten da beide keine große Geschichte daraus machen, ich hatte wohl auch Schiss vor einer Trennung. Ich leite ja eine Künstler- und Eventagentur, und der Norbert war immer eines meiner besten Pferde im Stall. Als wir uns kennenlernten, war ich schon recht bekannt, der Norbert aber noch ein Niemand. Ich habe ihn groß gemacht, und im Gegenzug wurde meine Agentur durch ihn noch bekannter. Wir hatten bei einer Trennung also beide etwas zu verlieren. Das Seelische war irgendwann gar nicht mehr so schlimm, und es war ja nicht so, dass wir daheim nicht miteinander geredet hätten. Außerdem habe ich genug Freundinnen, mit denen ich mich austauschen kann. Aber das Körperliche ging mir mit der Zeit schon ab.«
»Also hast du dir auch eine Affäre zugelegt.«
»Nein, keine Affäre!«, erwiderte die Obermayer empört. »Toyboys.« Sie kicherte. »Das reichte mir. Weißt du, wie viele junge Möchtegernschauspieler jede Woche bei mir aufkreuzen und von mir vertreten werden wollen? Und die machen dafür nahezu alles. Und schweigen, weil sie Angst um ihre mögliche Karriere haben. In dieser Hinsicht war ich also auch versorgt. Und, zugegeben, ebenfalls skrupellos.«
»MeToo, nur in der anderen Richtung.«
»Ja, genau«, antwortete die Renate, offensichtlich ohne einen Anflug von schlechtem Gewissen. »Ich wäre wohl bis ans Lebensende mit dem Norbert zusammengeblieben.«
»Bist du ja auch. Irgendwie eben«, warf die Charlotte ein. Und hätte sich am liebsten gleich wieder selbst geohrfeigt. Das offene Geständnis der Obermayer, dass sie ihre Position nutzte, um Jungfleisch ins Bett zu bekommen, gab ihr ein wenig zu denken.
Die Obermayer fuhr ungerührt fort: »Es war halt auch eine Art von Gemütlichkeit und Vertrautheit. Wir hätten nächstes Jahr unseren fünfundzwanzigsten Hochzeitstag gefeiert. Niemals hätte ich den Nobsi umgebracht.«
Die Charlotte nickte. Sie hatte an diesem Abend noch mit vielem gerechnet, aber nicht mit einer Lebensbeichte von der Obermayer.
»Und das hast du alles auch der Polizei erzählt?«, hakte die Charlotte nach.
Endlich schimmerte die Andeutung einer Träne im linken Auge der Obermayer. Die Charlotte schob ihr wie beiläufig eine Serviette über die Theke, welche die Obermayer dankbar annahm. Krokodilsträne oder echte Trauer? Die Obermayer wischte sich über die Augen und nickte. »Klar. Ich habe doch nichts zu verheimlichen. Und ich habe genug Krimis gesehen, in denen sich Unschuldige durch Herumdrucksen und Lügen selbst ein Bein stellen. Das wollte ich vermeiden. Auch wenn es niemanden etwas angeht, wie der Norbert und ich gelebt haben, früher oder später hätte es die Polizei ja doch herausgefunden. Also habe ich gleich reinen Tisch gemacht und von unseren Affären erzählt. Auch die Geschichte mit dem unerfüllten Kinderwunsch habe ich nicht ausgelassen.«