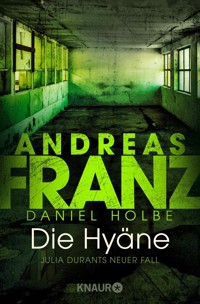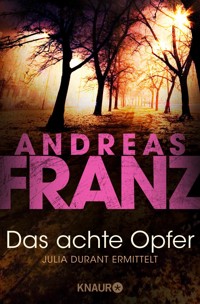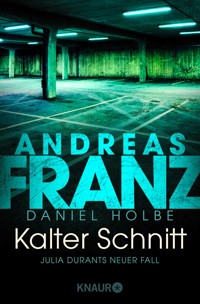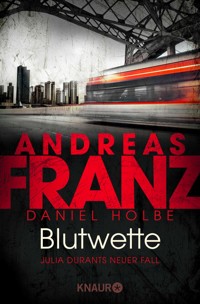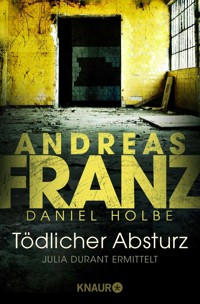
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Frankfurt, Neujahr 2011: Während man überall noch im Silvesterrausch ist, passiert, unbemerkt von allen, ein grausamer Mord: Eine junge Frau wird verprügelt, vergewaltigt, erdrosselt und schließlich in einem Müllcontainer unweit des Bankenviertels entsorgt. Erste Spuren werden sichergestellt, sogar DNA gefunden, die Ermittlungen führen hinauf in die Chefetagen einer renommierten Bank. Der Verdächtige ist stur, verweigert die Aussage und verbirgt sich hinter einer Armada von Anwälten. Schuldig? Da passiert ein zweiter Mord … Eine neue Herausforderung für Julia Durant und ihr Team!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andreas Franz / Daniel Holbe
Tödlicher Absturz
Ein neuer Fall für Julia Durant
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Frankfurt, Neujahr 2011: Während man überall noch im Silvesterrausch ist, passiert, unbemerkt von allen, ein grausamer Mord: Eine junge Frau wird verprügelt, vergewaltigt, erdrosselt und schließlich in einem Müllcontainer unweit des Bankenviertels entsorgt. Erste Spuren werden sichergestellt, sogar DNA gefunden, die Ermittlungen führen hinauf in die Chefetagen einer renommierten Bank. Der Verdächtige ist stur, verweigert die Aussage und verbirgt sich hinter einer Armada von Anwälten. Schuldig?
Da passiert ein zweiter Mord …
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
Freitag
Freitag, 31. Dezember 2010, 22.50 Uhr
Sonntag
Sonntag, 2. Januar 2011, 10.50 Uhr
Sonntag, 12.15 Uhr
Sonntag, 14.50 Uhr
Sonntag, 15.20 Uhr
Sonntag, 15.30 Uhr
Sonntag, 16.45 Uhr
Montag
Montag, 3. Januar 2011, 8.40 Uhr
Montag, 9.10 Uhr
Montag, 10.05 Uhr
Montag, 10.35 Uhr
Montag, 10.30 Uhr
Montag, 12.35 Uhr
Montag, 13.35 Uhr
Montag, 15.25 Uhr
Montag, 17.10 Uhr
Montag, 18.35 Uhr
Montag, 19.50 Uhr
Dienstag
Dienstag, 4. Januar 2011, 6.55 Uhr
Dienstag, 8.20 Uhr
Dienstag, 8.35 Uhr
Dienstag, 9.25 Uhr
Dienstag, 11.15 Uhr
Dienstag, 12.30 Uhr
Dienstag, 13.10 Uhr
Dienstag, 14.05 Uhr
Dienstag, 14.50 Uhr
Dienstag, 15.45 Uhr
Dienstag, 18.10 Uhr
Dienstag, 17.55 Uhr
Dienstag, 18.25 Uhr
Mittwoch
Mittwoch, 5. Januar 2011, 0.40 Uhr
Mittwoch, 8.35 Uhr
Mittwoch, 9.30 Uhr
Mittwoch, 10.25 Uhr
Mittwoch, 15.40 Uhr
Mittwoch, 19.30 Uhr
Mittwoch, 19.20 Uhr
Mittwoch, 19.58 Uhr
Donnerstag
Donnerstag, 6. Januar 2011, 9.15 Uhr
Donnerstag, 11.48 Uhr
Donnerstag, 15.40 Uhr
Donnerstag, 16.25 Uhr
Donnerstag, 17.55 Uhr
Donnerstag, 19.10 Uhr
Donnerstag, 18.45 Uhr
Donnerstag, 20.20 Uhr
Freitag
Freitag, 7. Januar 2011, 8.10 Uhr
Freitag, 10.07 Uhr
Freitag, 11.45 Uhr
Freitag, 13.10 Uhr
Freitag, 16.50 Uhr
Freitag, 17.12 Uhr
Samstag
Samstag, 8. Januar 2011, 9.10 Uhr
Samstag, 15.05 Uhr
Samstag, 16.50 Uhr
Montag
Montag, 10. Januar 2011, 8.55 Uhr
Epilog
Lumpen ergeben Papier
Papier ergibt Geld
Geld ergibt Banken
Banken geben Darlehen
Darlehen ergeben Bettler
Bettler ergeben Lumpen
Lumpensammlerweisheit
aus dem 18. Jahrhundert
Prolog
Eine Hundskälte da draußen«, kommentierte der Taxifahrer den eisigen Luftzug, der die muffige Luft im Wageninneren durchströmte. Zu seiner Verwunderung war der Fahrgast hinten eingestiegen, obwohl er die Beifahrertür bereits entriegelt und einen Spalt aufgestoßen hatte. Nach Mitternacht stellte kaum einer der Kollegen seinen Wagen irgendwo ab, ohne sich darin einzuschließen. Man konnte nie wissen – nicht in Frankfurt, nicht zu dieser Zeit.
»Allerdings«, brummte es von hinten, dann, etwas freundlicher, »na ja, es muss ja auch nicht das ganze Jahr über mild sein. Zum Museumsufer bitte, ich sage Ihnen dann drüben, wohin dort genau.«
Der cremefarbene Mercedes war zwei Jahre alt und sehr gepflegt. Er roch dezent nach Rauch und ein wenig nach Abgasen, so wie Taxis eben riechen, in denen Fahrer stundenlang herumsitzen und die verschiedensten Fahrgäste durch die Gegend chauffieren. Alkohol, Kotze, Kneipendunst und auch mal eine benutzte Heroinspritze – das waren nur einige der Spuren, denen man als Taxifahrer in dieser Stadt ausgesetzt war, und die abwaschbaren, regelmäßig imprägnierten Ledersitze waren daher ein Segen. Nicht auszudenken, wenn ein volltrunkener Gast seine Blase nicht mehr unter Kontrolle halten konnte und sich in gepolsterte Stoffsitze entleerte …
»Komme ich für fünf achtundachtzig denn überhaupt rüber zum anderen Mainufer?«, unterbrach die Stimme aus dem Fond den Gedankengang des Fahrers. Er zuckte zusammen und warf einen Blick auf die rote Digitalanzeige des Taxameters. »Na, rüber bestimmt«, überlegte er laut, »und sogar ein Stückchen weiter. Aber allzu weit reicht es wohl nicht, wegen der Nachtpauschale und so … Sie können mit EC-Karte zahlen, und mein Lesegerät akzeptiert auch die gängigen Kreditkarten.«
»Hätte ich Plastikgeld dabei, würde ich wohl nicht nach fünf achtundachtzig fragen«, erwiderte die Stimme mürrisch.
Der Fahrer zuckte mit den Schultern. Dann eben nicht. Er setzte den Blinker, nahm den Fuß etwas vom Gaspedal und ordnete sich auf die Rechtsabbiegespur ein.
»Ein Vorschlag«, setzte er erneut an. »Ich stelle mich an den Affentorplatz, da stehen die Chancen am besten, dass ich nicht zu lange warten muss. Wird dann zwar übers Limit gehen, aber das wäre okay für mich.«
»Hmm. Aber wir fahren über die Bubis-Brücke.«
»Jetzt sowieso, wir sind ja schon gleich dort.«
»Können Sie bitte ganz langsam rüberfahren?«
Der Taxifahrer runzelte die Stirn und warf einen prüfenden Blick in den Innenspiegel. Hinter dem Mercedes fuhr kein Fahrzeug, die Straßen waren ohnehin relativ leer.
»Solange keiner kommt, meinetwegen.«
Über dem Main schien ein leichter Dunst zu liegen, ansonsten war die Luft kristallklar, und die Lichter der rechts in den Blick kommenden Skyline strahlten in die Nacht. Ein Seufzen ertönte von hinten, zumindest kam es dem Fahrer so vor, und mit einem weiteren Blick in den zweiten Innenspiegel musterte er seinen Fahrgast. Er trug einen schwarzen Mantel, nicht zugeknöpft, darunter war ein weißes Hemd zu erkennen, keine Krawatte, aber ein dunkler Schal lag locker um den Hals. Handschuhe trug der Mann nicht, und eine Tasche hatte er auch nicht bei sich. Vielleicht einer dieser Workaholics, die weder Tageszeiten noch Feiertage kennen. Nur eben mal kurz ins Büro, und ehe man sich’s versieht, sind zwei Tage um, und man hat weder gegessen noch geschlafen, bestenfalls mal einen kurzen Augenblick, und dann steht man irgendwann nachts ohne Portemonnaie am Römer und friert sich den Hintern ab.
Ein weiteres Seufzen, eher ein schweres Atmen, das Taxi hatte gerade die Hälfte der Brücke überquert.
»Würden Sie kurz anhalten?«
»Nein, bedaure. Nicht mitten auf der Brücke.«
»Dann fahren Sie doch am Ende mal rechts ran.«
»Hören Sie, die Uhr läuft auch, wenn ich stehe«, mahnte der Fahrer. »Außerdem kommt hinter uns ein Auto, ich kann hier nicht weiter den Verkehr blockieren.«
»Schon gut, lassen Sie mich einfach am Ende raus.« Die Stimme klang wieder versöhnlich, und der Fahrer änderte daraufhin seine Meinung.
»Okay, meinetwegen fahre ich Sie auch noch mal hin und her, wenn Sie mögen. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute unterwegs ein wenig Sightseeing geboten haben möchten. Aber danach fahre ich mit Ihnen direkt zum Affentorplatz, und Sie gehen endlich nach Hause. Sie werden ja wohl mal einen Tag ohne Ihr Büro auskommen.«
»Ich wohne nicht am Affentorplatz. Biegen Sie einfach rechts ab und fahren Sie den Main entlang. Möglichst langsam, wenn der Verkehr es zulässt. Ich steige dann aus, sobald der Fahrpreis erreicht ist.«
Der Fahrer seufzte und lenkte den Wagen nach rechts. Die Skyline war nun auch für ihn gut zu sehen, der gelbe Schein des Hochhauses der Commerzbank, die angestrahlte rot-weiße Antenne des Maintowers sowie unzählige Glasfenster, hinter denen zum Teil Licht brannte oder die fremdes Licht reflektierten.
»Der Kunde ist König«, brummte er, »und wir haben ja immerhin die Zeit des Gebens, nicht wahr?«
»Davon merkt man in meinem Job nicht viel«, erwiderte der Fahrgast kopfschüttelnd. »Bei uns gibt es nur dreihundertfünfundsechzig Tage des Nehmens, na ja, und alle vier Jahre sogar noch einen Tag mehr.«
»Banker?«
»Anlageberater.«
»Hm«, nickte der Fahrer, »knapp daneben. Aber stimmt, ein Banker arbeitet wohl auch nicht mehr um diese Zeit.«
»Kommt drauf an«, war die knappe Antwort, dann schwiegen die beiden wieder. Schließlich setzte der Fahrer den Blinker rechts und steuerte den Wagen so weit wie möglich an den rechten Fahrbahnrand, hielt aber noch nicht an.
»Okay, wir müssten nun langsam zum Ende kommen. Ich würde mich, um ehrlich zu sein, doch lieber an den Hauptbahnhof stellen.«
»Schon gut, wie steht das Taxameter?«
»Sechs fünfzehn. Aber egal. Ich habe ja gesagt, Sie können ein Stück länger mitkommen.« Der Fahrer lächelte und drehte den Kopf nach hinten.
»Also fünf achtundachtzig bitte.«
Sein Fahrgast nestelte in den Taschen seines Mantels herum und brachte eine zerknitterte Fünfeuronote zum Vorschein, außerdem ein paar goldene und kupferfarbene Münzen.
»Fünf, fünf zwanzig, vierzig …« Die Zählschritte wurden immer kleiner, bis es nur noch Centstücke waren, die der Mann abzählte. Die Ärmel seines Mantels waren abgewetzt, das fiel dem Taxifahrer erst jetzt auf, das Hemd war zerknittert, und auch der Schal wirkte abgetragen. Das kantige Gesicht mit den dunklen Augenbrauen und den tiefen Stirnfalten war unrasiert.
»Siebenundachtzig, Mist, einer ist mir wohl runtergefallen.«
»Macht doch nichts, der findet sich schon. Und wenn nicht, bleibt’s ein Glückspfennig. Oder Glückscent meinetwegen. Ist doch eine schöne Tradition.«
»Wie Sie meinen«, erwiderte der Gast mit einem schmalen Lächeln, doch die Augen blieben trüb. Er machte eine Faust um das Geld und streckte sie dem Taxifahrer entgegen. »Hier, bitte. Und danke fürs Mitnehmen.«
»Gerne. Und sehen Sie zu, dass Sie ins Warme kommen!«
Der Fahrgast verharrte einen Augenblick, nachdem er die schwere Tür des Mercedes schwungvoll ins Schloss geschlagen hatte. Fröstelnd schlug er seinen Kragen hoch und verschränkte die Arme. Ein kalter Windstoß fuhr ihm durch die Haare, während er den Blick über die Querstraße und dann die Untermainbrücke entlangwandern ließ, an deren gegenüberliegendem Ende die eleganten Hotels und Geschäftshäuser lagen. Trotz der späten Uhrzeit, es war bereits Viertel nach drei, überquerten immer wieder Fahrzeuge den Main. Mit einem Schulterzucken setzte er sich in Bewegung, warf noch einen raschen Blick zurück, um sich zu vergewissern, ob das Taxi nicht bald verschwinden wollte. Doch der Fahrer schien es nicht allzu eilig zu haben.
Er zählte die Schritte, bei dreißig hörte er auf und hob den Blick vom Asphalt des breiten Fußgängerstreifens nach oben. Selbst im Dunkel der Nacht – oder vielleicht sogar gerade dann – wirkten die fernen Fassaden gleichermaßen majestätisch wie beängstigend. Er versuchte, anhand der winzigen Fenster die Etagen zu zählen, wurde aber immer wieder durch die Lichtreflexe irritiert. Irgendwo dort oben jedenfalls war es gewesen, sein Büro. Geräumig, elegant, ein dunkler Schreibtisch im Kolonialstil, eine ebenso dunkle und mächtige Bücherwand, überall dazwischen teure Mitbringsel von verschiedenen Reisen: auf dem Boden der handgefertigte Teppich aus dem Nahen Osten, im Regal vor den Aktenordnern eine Schatulle aus Elfenbein, neben dem Tisch ein Lampenschirm aus Schlangenhaut und, ganz besonders apart, ein Haigebiss über der Tür. Er hatte aufgehört zu zählen, wie viele Kunden er damit vergrault hatte und wie viele Kommentare er lachend darüber im Kreis seiner Partner zum Besten gegeben hatte.
Doch all das war nicht mehr wichtig, das Büro gehörte nun einem anderen, das Gebiss war wer weiß wo – vielleicht hing es ja sogar noch.
Es war wie im Mittelalter: In den erhabenen Burgen verschanzte sich die Elite gegen den Pöbel und blickte voller Verachtung auf ihn hinab. Das Glück lag bei dem, der sich auf der richtigen Seite befand, und hier unten, nachts, in winterlicher Kälte, war definitiv die falsche.
Mit klammen Fingern tastete er das metallene Geländer ab, passierte einen der Betonaufsätze, aus deren Oberseite Straßenlaternen ragten. Knapp acht Meter, so wusste er, betrug die Durchfahrtshöhe in der Brückenmitte, dort, wo der weiteste Abstand zwischen zwei Laternen war. Von hinten näherte sich ein Auto, es war das Taxi, der Fahrer nickte ihm flüchtig zu. Er blieb stehen und folgte dem Wagen mit seinen Blicken. Zwei weitere Autos bogen auf die Brücke ein, beschleunigten und brausten an ihm vorüber, ohne ihn zu beachten. Wenn die Hochhäuser Burgen waren, so bildeten die protzigen Karossen wohl die Schlachtrösser. Doch all das hatte nun keine Bedeutung mehr. Er prüfte, ob sich irgendwo ein Fußgänger, ein Fahrradfahrer oder ein weiteres Auto näherte. Nichts. Nun sollte er keine Zeit verlieren, das wusste er, das hatte er bereits gewusst, als er ins Taxi gestiegen war. Etwas zittrig kletterte er über das Geländer, verlagerte sein Gewicht auf die Absätze seiner Schuhe und versuchte dabei, so nah wie möglich an der Reling zu stehen. Seine Finger klammerten sich schmerzhaft um das kalte Metall, die Arme hatte er links und rechts von sich gestreckt.
Ein letztes Mal ließ er den Blick in Richtung Skyline wandern, dann, wie in Zeitlupe, schloss er die Augen, nahm einen tiefen Atemzug durch die Nase und löste die Finger.
Freitag
Freitag, 31. Dezember 2010, 22.50 Uhr
Karl von Eisner goss sich ein Glas Champagner ein und beobachtete die kleinen Gasbläschen, die sich wie Perlenschnüre an der Innenwand des Glases nach oben schlängelten. »Du auch?«, fragte er knapp und nickte dem Mädchen zu, deren Kopf auf seiner dunkel behaarten Brust ruhte und deren Augen gedankenverloren ins Leere zu blicken schienen.
»Nein danke. Für mich nicht.«
»Schade drum«, seufzte Karl. Er nippte kurz an seinem Glas. »Das ist eine ganz andere Liga als dieser Discountmüll. Was meinst du, wie viel so eine Flasche kostet?«
»Weiß nicht«, klang es leise, und das Mädchen zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Fünfzig vielleicht? Ich habe keine Ahnung.«
»Pah, fünfzig … Für einen guten Bollinger musst du schon ein wenig mehr hinblättern. Probier’s noch mal.«
»Hundert?«
»Fast richtig. Da siehst du mal, was mir unsere kleinen Treffen wert sind.«
»Aber ich trinke doch fast nie etwas«, gab das Mädchen zurück.
»Du weißt eben nicht, was gut ist. Aber das ist dein Problem.« Er sah auf die Uhr, verdammt, schon so spät.
»Dann schlage ich vor, du widmest dich wieder dem, von dem du immer kostest, wenn du hier bist«, fügte er lasziv hinzu und hob die Decke an, die ihre Körper unterhalb der Hüfte bedeckte.
Lara verachtete seine Überheblichkeit, auch wenn Karl von Eisner alles in allem kein unangenehmer Kunde war. Er sah gut aus für einen Mann jenseits der fünfzig, war trainiert, hatte nicht zu viel schlaffes Fettgewebe an Bauch und Hüfte – angeblich hielt er sich durch regelmäßiges Joggen in Form. Sie hätte es also weitaus schlechter treffen können. Seine Augen allerdings waren unheimlich, sie waren von einer beängstigenden Kälte und zeigten selbst beim Sex kaum eine Gefühlsregung außer Gier. Selbst diese brach jedoch nur kurz vor dem Höhepunkt durch, bevor der Direktor, wie sie ihn manchmal nennen musste, sich krampfend in sie ergoss. Seine dunkelbraunen Haare waren zweifelsohne gefärbt, und zwar inklusive der kräftigen Augenbrauen. Alles in allem also war er kein Kunde der üblichen Natur, korpulente, verklemmte Muttersöhnchen oder diskrete Familienväter auf Abwegen, die bereits nach dem Akt um Verständnis buhlten. Der Direktor hingegen hatte Macht und Geld, und er machte daraus auch keinen Hehl. Ja, Lara hätte es schlechter treffen können als mit diesem attraktiven Kunden, dessen sexuelle Vorlieben nicht pervers waren und dessen Portemonnaie recht locker saß. Der Direktor war Laras Ticket in die Zukunft, ein paar Monate noch, dann würde sie eine Abendschule besuchen und sich noch vor ihrem dreiundzwanzigsten Geburtstag an einer Universität einschreiben.
Die Treffen, auch damit hatte sich das Mädchen arrangiert, kamen meist recht kurzfristig, so auch heute. Sie trafen sich in einem kleinen Appartement am Rand von Oberrad. Wenn der Direktor kam, musste Lara ihn bereits erwarten, was nicht weiter schwer war, denn sie wohnte kaum zwei Kilometer entfernt in der Nähe der Binding Brauerei und war mit dem Fahrrad binnen weniger Minuten vor Ort. Ein eigenes Auto besaß Lara nicht, Taxifahren sollte sie nicht, zu indiskret, und auf öffentliche Verkehrsmittel zu warten hatte sie keine Lust.
Der erste Akt dauerte in der Regel nur wenige Minuten, Stressabbau, ein schneller Schuss, keuchend und schwitzend arbeitete er sich in Missionarsstellung an ihr ab, rollte danach zur Seite. Lara musste ihm dann das obligatorische Gummi herunterziehen und danach an seiner Brust liegen, während sein Herzschlag sich nach und nach beruhigte und die schnelle Atmung langsamer wurde. Danach folgte der Small Talk, jene Überheblichkeiten, die Lara zunehmend verabscheute, weil es meist darauf hinauslief, dass der Direktor ihren kleinen, geilen Körper erwähnte und dass nicht jeder im Leben sein Köpfchen einsetzen müsse, vor allem, wenn der Rest unterhalb nur gut genug beschaffen sei. Diese Phase, manchmal zehn Minuten, manchmal eine halbe Stunde, ließ Lara über sich ergehen, während sie darauf wartete, dass seine Potenz sich regenerierte für den zweiten, deutlich längeren und abwechslungsreicheren Akt.
Heute jedoch schien Karl von Eisner unter besonderem Stress zu stehen, denn obwohl Lara genau wusste, wo sie Hände, Lippen und Zunge an seinem Geschlechtsteil einzusetzen hatte, regte sich nichts.
»Verdammt, Kleine, was machst du?«, grollte er. »Ich muss los, die Gala, und ich will dich vorher noch einmal spüren.«
Doch es tat sich nichts. Der Schwellkörper pulsierte zwar sanft, wurde aber nicht hart. Nach einer weiteren Minute, Lara setzte nun das Zungenpiercing ein, und spätestens jetzt sollte ihr Bemühen doch Effekt zeigen, stieß der Direktor wütend ihren Kopf zurück und sprang auf.
»So, jetzt reicht’s mir, glaub ja nicht, dass du nachlässig werden kannst, wo ich dir so viel Geld in den Arsch geblasen habe!« In seinen Augen erkannte das verschüchterte Mädchen plötzlich eine neue, ihr bis dato unbekannte Gefühlsregung. Wut. Entstanden durch verletzten Stolz, nur so konnte Lara sich diese Reaktion erklären, denn es war das erste Mal, dass ihn seine Manneskraft im Stich gelassen hatte.
»Komm, wir versuchen es einfach noch mal«, säuselte sie, »auf die paar Minuten kommt es doch sicher nicht an.«
Der Handrücken traf sie völlig unerwartet und so hart, dass ihr Kopf zur Seite flog. Lara schnappte unwillkürlich nach Luft, wusste nicht, wie ihr geschah, vernahm nur, wie der Direktor ins Bad stampfte und dabei etwas murmelte wie: »Mit dir bin ich fertig.«
Wimmernd rollte sie sich auf der Matratze zusammen, heiß pochte ihre Wange. Im Bad wurde die Duschkabine geöffnet und Wasser aufgedreht, dessen monotones Prasseln alle anderen Geräusche überdeckte. Wie viele Minuten sie in zusammengerollter Fötalstellung verbracht hatte, hätte Lara nicht zu sagen vermocht. Der Schmerz auf ihrer Wange ließ langsam nach, doch vielleicht hatte sie sich auch nur daran gewöhnt. Sie fiel in einen dösenden Zustand, vernahm weder die leisen Schritte noch den Schatten, der sich ihr näherte.
Das Letzte, was Lara spürte, war ein dumpfer Schlag auf den Hinterkopf. Von dem Feuerwerk, den Kanonenschlägen, Tausenden jubelnden Menschen und der ausgelassenen Atmosphäre im Dunst der Schwarzpulverwolken, die von der Kälte zwischen den Häuserschluchten der Stadt gefangen gehalten wurden, bekam Lara nichts mehr mit. Für sie begann das neue Jahr, auf dessen Beginn wie in jeder Neujahrsnacht die Hoffnung von Millionen Menschen lag, mit der Hoffnungslosigkeit und Endgültigkeit des Todes.
Nur einige hundert Meter entfernt entkorkte Karl von Eisner eine halbe Stunde später eine weitere Champagnerflasche. Lachshäppchen, tablettweise Bruschetta und natürlich Kaviar auf Wachteleiern – das war seine Welt. Es gab in Frankfurt nicht wenige Menschen, die ihre Seele verkauft hätten, um an diesem Galadiner teilnehmen zu dürfen. Doch diese Welt ist nicht für alle gedacht, dachte der Direktor zufrieden, als er lachend mit seinen Geschäftspartnern, seiner eleganten Frau und einigen befreundeten Kollegen aufs neue Jahr anstieß.
Sonntag
Sonntag, 2. Januar 2011, 10.50 Uhr
Julia Durant gähnte noch einmal herzhaft und nahm anschließend das unerbittlich läutende Telefon aus der Ladestation. Ein kurzer Blick aufs Display verriet ihr, dass es sich um die Nummer von Kommissariatsleiter Berger handelte. Stirnrunzelnd warf sie einen Blick auf die Uhr. Kein gutes Omen, dachte sie noch, dann vernahm sie bereits die Stimme ihres Chefs: »Guten Morgen, Frau Durant, und frohes neues Jahr.«
»Danke ebenso. Vermutlich wird es nicht mehr lange so froh bleiben.«
»Ich störe Sie auch nur ungern, aber mit Ermittlern sieht es hier gerade nicht besonders üppig aus, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und ab morgen früh sind Sie doch ohnehin wieder im Dienst.«
»Passt schon«, seufzte Julia, »ich bin nur noch nicht richtig angekommen. Aber schießen Sie mal los, umso schneller bin ich wieder drinnen im Alltag.«
»Unbekannte Tote, noch ein ganz junges Ding«, erläuterte Berger knapp, »abgelegt in einem Müllcontainer in der Taunusanlage. Bankenviertel, Sie wissen schon, irgendwo im Hinterhof eines dieser Hochhäuser, wo außer der Putzkolonne kaum jemand hinkommt.« Er gab die genaue Adresse durch und ergänzte dann: »Ich schicke Ihnen Hellmer und irgendjemanden von der Rechtsmedizin, das ganze Programm eben, glauben Sie mir, es ist niemand begeistert, das neue Jahr ausgerechnet so zu beginnen.«
Julia notierte sich Straße und Hausnummer und verabschiedete sich mit den Worten: »In Ordnung, ich bin unterwegs. Geben Sie mir eine Viertelstunde.«
»Schon gut, kein Grund, einen neuen Rekord aufzustellen«, kommentierte Berger mit einem leicht ironischen Unterton. »Hellmer hat gesagt, er braucht eine halbe Stunde, wie gut, dass ich ihn als Erstes angerufen habe. Übrigens, Frau Durant, eine Sache noch«, fügte er hinzu und klang schon wieder ernst und geschäftig.
»Ja?«
»Wir haben zwar Sonntagvormittag, und angesichts der Kälte dürfte sich auch das Laufpublikum eher in Grenzen halten. Aber seien Sie bitte diskret, achten Sie darauf, dass die Kollegen den Tatort vernünftig abriegeln, Sie wissen ja, im Bankenviertel wittert jeder Amateur sofort eine riesige Geschichte.«
»Schon klar«, wehrte Julia ab, »als ob ich den Streifenbeamten ihren Job erklären müsste!«
»Darum geht es nicht. Seien Sie einfach nur vorsichtig. Sie wissen doch, wir haben Kommunalwahlen, da kann ich hier keinen Finger krumm machen, ohne mich irgendwo dafür rechtfertigen zu müssen.«
»Ist ja gut«, lenkte Julia ein. »Ich achte darauf, dass nichts nach außen dringt, und werde den Fall Ihnen zuliebe schnellstmöglich lösen.«
»Ja, genau, ich sehe schon, Sie verstehen mich.«
Kunststück, dachte Julia. Immerhin habe ich lange genug auf Ihrem Platz gesessen.
Es lag kaum ein halbes Jahr zurück, dass Julia Durant für mehrere Wochen kommissarisch seine Funktion hatte übernehmen müssen; ein Bandscheibenvorfall hatte Berger für viele Wochen handlungsunfähig gemacht. Der Innendienst hatte Julia wenig geschmeckt: ständiges Rechtfertigen vor den verschiedensten Abteilungen, die sich um Finanzen und öffentliches Ansehen weitaus mehr zu sorgen schienen als um die Schicksale von Gewaltopfern, die einer schnellen Verurteilung mehr zugeneigt schienen als einer lückenlosen Aufklärung. Glücklicherweise hatte Berger sich schließlich erholt und im September endlich wieder das Ruder übernommen. Denn für Julia Durant gab es nur einen Job, der sie erfüllte: die leitende Ermittlung eines Falles.
Rasch eilte sie vor den Badezimmerspiegel und bürstete das schulterlange, kastanienbraune Haar, welches sich dankenswerterweise nicht allzu widerspenstig zeigte. Mit zusammengekniffenen Augen musterte sie ihr Spiegelbild, doch es gefiel ihr nicht, was sie dort sah. Julia Durant war Jahrgang 1963, ein Novemberkind, das zweieinhalb Wochen vor der Ermordung Kennedys zur Welt gekommen war. Ein Ereignis, welches lange zurück lag, zu viele Jahrzehnte, ja, mittlerweile sogar in einem vergangenen Jahrhundert. »Du brauchst dringend eine Maske«, murmelte sie verdrossen, denn während die gut proportionierte Kommissarin noch eine recht straffe Figur aufweisen konnte, breiteten sich um die Augen unübersehbare Fältchen aus. Seufzend wandte sie sich vom Spiegel ab, schlüpfte aus ihrem Morgenmantel und fröstelte. Der Wetterbericht hatte von minus zehn Grad gesprochen, in der Innenstadt sicher etwas milder, aber dennoch ein eisiger Tag. Selbst in der angenehmen Wärme ihrer Wohnung meinte die Kommissarin bereits den kalten Wind auf den Wangen zu spüren.
Julia Durant hatte die Weihnachtsfeiertage in München verbracht, bei ihrem Vater, der in ihrem Heimatdorf unweit der bayerischen Landeshauptstadt als Pastor tätig gewesen war. Seit einigen Jahren befand er sich im Ruhestand, was den beinahe Achtzigjährigen jedoch nicht daran hinderte, vertretungshalber in den umliegenden Gemeinden einzuspringen, wenn Not am Mann war. Julia missfiel dies zunehmend, sie sorgte sich um ihren Vater, der bei weitem nicht mehr so fit war wie noch vor ein paar Jahren.
»Julia, du musst das verstehen«, entgegnete er nur jedes Mal, wenn sie das Thema ansprach. »Ich habe den Großteil meines Lebens im Dienst an der Gemeinde verbracht, und so werde ich es auch einmal beenden. Ich kenne die meisten Menschen hier seit ihrer Taufe, habe viele von ihnen getraut und auch einige beerdigt. Julia, das ist für mich kein lästiger Job, das ist mehr wie eine große Familie. Lass mich das machen, dadurch fühle ich mich lebendiger, als wenn ich zu Hause in meinem Sessel hocke.«
Julias Mutter war vor vielen Jahren an Krebs gestorben, und immer öfter plagten sie Gewissenbisse, dass sie ihren Vater wegen ihres Hunderte Kilometer entfernten Jobs nur so selten sah.
Doch es war nicht Pastor Durant alleine, den die Kommissarin in München besucht hatte. Silvester hatte sie mit Kommissar Claus Hochgräbe und einigen Kollegen von der Münchner Mordkommission gefeiert. Der Kontakt war vor einigen Monaten während des Mason-Falls zustande gekommen, und Hochgräbe hatte Julia irgendwann nach München eingeladen. Er war ein sympathischer Mann, ein paar Jahre älter als sie, durchaus attraktiv, kinderlos und außerdem verwitwet.
»Eine gute Partie!«, so hatte Hellmer ihn, als Julia ihm den Münchner Kollegen zum ersten Mal beschrieben hatte, lapidar bezeichnet. »Angel dir den nur mal, egal, ob hinterher was draus wird oder nicht.« Julia Durant hatte daraufhin nur müde gelächelt. Die Zeiten, in denen sie sich auf die Suche nach kurzlebigen Abenteuern begeben hatte, waren vorbei. Diese Julia Durant gab es nicht mehr.
Erst gestern war sie nach Frankfurt zurückgekehrt. In Bayern war es noch um einiges kälter gewesen, sie war also gut vorbereitet, kramte die Thermowäsche aus dem noch nicht ausgepackten Koffer und zog eine Jeans und einen hellgrauen Wollpullover darüber. Dunkelgrauer Mantel, schwarzer Fleeceschal, schwarze Lederhandschuhe, alles dabei – prüfte sie im Hinausgehen. Die Pudelmütze lag offenbar noch im Auto.
Gleichzeitig mit Hellmer traf die Kommissarin zehn Minuten später an der angegebenen Adresse ein. Die Taunusanlage war ein Teil des Frankfurter Grüngürtels und wand sich vom Opernplatz zwischen den Hochhäusern der Banken hindurch in Richtung Main. Sie durchschnitt das protzige Finanzviertel und trennte die Sündenmeile und den Hauptbahnhof im Westen von den eleganten Boutiquen und Hotels, die östlich angesiedelt waren. Selbst im Winter strahlte die vier Hektar große Parkanlage eine gewisse Anmut aus, sicher nicht so elegant wie der Holzhausenpark, aber überall standen Statuen und Skulpturen, und wenn man den Blick nicht abschweifen ließ, konnte man die protzigen Paläste der Hochfinanz und die unweit liegenden Sexclubs für einen Moment vergessen.
»Guten Morgen, meine Liebe«, begrüßte ihr langjähriger Partner sie mit polternder Stimme und zog Julia sogleich in eine kurze, heftige Umarmung. »Frohes Neues!«
»Dir auch«, ächzte sie und klopfte ihm auf die Schulterblätter. »Würde es dir etwas ausmachen …«
Hellmer ließ locker, und Julia schüttelte prustend den Kopf. »Ein paar Sekunden länger, und mir wäre der Sauerstoff ausgegangen.« Ihr Atem kondensierte sofort zu kleinen Wolken.
»Wollen wir?«, fragte Hellmer mit einem Nicken in Richtung des vor ihnen liegenden Wolkenkratzers. Julias Blick wanderte nach oben, es waren schätzungsweise dreißig, vierzig Etagen, vielleicht sogar noch mehr. Sie rechnete kurz. Hundertfünfzig Meter?
»Okay, dann los«, nickte sie. »Bleibt uns ja nichts übrig.«
Die Zufahrt zum Hinterhof des verwinkelten Betonkomplexes ging mit einem leichten Gefälle und in einer Rechtskurve nach unten, gerade so weit, dass man die oben liegende Straße und den Gehweg nicht mehr sehen konnte. Ein vier Meter breites Schiebetor mit grauen, glanzlosen Metallstreben, von denen jede einzelne so dick war wie ein Unterarm, war zu zwei Dritteln geöffnet. Im Innenhof befanden sich unter einem Vordach zwei Doppeltüren mit Gitterglas, durch das von innen her Licht schien. Vermutlich handelte es sich um die Zulieferungszone der Kantine, außerdem verriet ein schäbiger, gut gefüllter Standaschenbecher, dass sich das Personal hierher, abseits der eleganten Bereiche des Hauses, zum Rauchen verzog. Ein typischer Wirtschaftshof, schloss Julia Durant, eben jener Bereich, wo sich all die Dinge abspielen, von denen man in den oberen Etagen, dort, wo die Fassade elegant mit Glas verkleidet ist, nichts wahrnimmt.
Seitlich, an einer nackten Betonwand, befanden sich drei metallene Rollcontainer, die Deckel waren bis zum Anschlag nach hinten geschoben. Zwei Uniformierte sicherten die Zufahrt, doch es gab kaum Schaulustige. Da der Innenhof abseits der Blicke lag, waren Bergers Befürchtungen wohl übertrieben gewesen.
»Ah, die Kommissare«, begrüßte Platzeck von der Spurensicherung Durant und Hellmer. Er und sein Kollege waren gerade im Begriff, sich die Schutzkleidung anzulegen, kein dankbarer Job, denn sie mussten zumindest für einige Zeit ohne wärmende Handschuhe und Mantel arbeiten.
»Arschkalt mal wieder«, ergänzte er, bevor Julia die Begrüßung erwidern konnte, »ich hoffe, die Rechtsmedizin kommt bald. Wobei es in diesem Fall ein echter Witz ist, denn die da«, er deutete mit dem Daumen über die Schulter hinter sich, »erklärt einem auch jeder Nichtmediziner ohne großes Tamtam für tot.«
»Lass mal sehen«, forderte die Kommissarin.
»Aber bloß nichts anfassen«, gab Platzeck zurück.
»Ist ja nicht unser erster Tatort«, brummte Hellmer und trat an ihm vorbei neben Julia an den Container.
»Jetzt verstehe ich«, sagte sie leise.
Die junge Frau war bleich, lag mit dem Gesicht nach oben, seltsam verrenkt auf blauen Säcken, Stofffetzen, allem möglichen Verpackungsmaterial und einigen Scherben. Weiße und gelbe Styroporchips umgaben ihren Kopf, in den Augenbrauen und an den Wimpern der geschlossenen Augen hatte sich millimeterdicker Reif gebildet. Die Lippen waren matt und bläulich, der Gesichtsausdruck wirkte unendlich traurig. Aber gab es überhaupt Tote mit einem frohen Gesicht? Julia zwang sich zur Konzentration und ließ den Blick weiterwandern. War das ein blauer Fleck unter dem Kinn? Und seitlich, am Hals, befand sich dort ein Würgemal, oder handelte es sich am Ende um einen gewöhnlichen Knutschfleck? Das Mädchen war kaum über zwanzig, die Arme waren dünn, nicht magersüchtig, aber eben sehr zierlich, der Rock war den Außentemperaturen ebenso wenig angemessen wie das Oberteil. Von einer Jacke, Mütze oder Schal war nichts zu sehen, das Einzige, was einigermaßen angemessen erschien, waren die kniehohen Lederstiefel.
»Was meinst du?«, vernahm die Kommissarin Hellmers Stimme.
»Ich weiß nicht recht. Möchte sie nur ungern als Prostituierte abtun, wenn sie keine ist. Die Kleidung ist aufreizend, aber nicht billig, und sie scheint ja schon länger als eine Nacht hier zu liegen. Könnte also auch ein Silvesteroutfit sein. Fakt ist, dass ihr jemand Gewalt angetan hat, ob sexuell, das werden wir noch sehen, aber sie ist mit Sicherheit nicht von alleine in den Container gekrabbelt und erfroren, dafür liegt sie viel zu unnatürlich. So betrunken kann man gar nicht sein, dass man sich derart verdreht auf den linken Unterarm legt und dann auch noch den Kopf so weit nach hinten streckt.«
»Wow, dafür, dass du offiziell erst morgen wieder im Dienst bist, rattert dein hübsches Köpfchen ja schon wieder auf Hochtouren«, lächelte Frank Hellmer anerkennend. »Warst wohl nicht ausgelastet bei deiner neuen Flamme, wie?«
»Ach, halt die Klappe«, winkte Julia ab. »Sag mal lieber was Konstruktives, denn im Gegensatz zu mir bist du heute ganz regulär im Dienst.«
»Ist ja schon gut, dann gebe ich mal meinen Senf dazu. Also vorbehaltlich der Einschätzung von der Rechtsmedizin stimme ich dir in zwei Punkten zu. Erstens, dass jemand das Mädchen dort abgelegt haben muss, und zweitens, dass sie zu diesem Zeitpunkt mindestens bewusstlos war. So viel scheint sicher zu sein, niemand legt sich freiwillig so hin und bleibt dann auch so liegen. Daraus ergeben sich wiederum zwei Möglichkeiten, nämlich einmal, dass jemand sie getötet und hier entsorgt hat, oder aber, dass jemand sie gefunden und hier abgelegt hat.«
»Je eher ihr mich meine Arbeit machen lasst, umso eher könnt ihr eure Hypothesen prüfen«, erklang es aus dem Hintergrund, und die beiden Kommissare fuhren herum. Andrea Sievers, die attraktive Rechtsmedizinerin, war eingetroffen und stellte ihren Lederkoffer neben sich.
»Hey, Andrea«, lächelte Julia, »das ist mal wieder ein toller Start in ein neues Jahr, oder?«
»Na, wenigstens begegnen wir uns mal wieder«, gab diese zurück. »So ist das eben in unserem Job. Grüß dich, Frank, na, gut reingekommen?«
»Passt schon, danke.«
»Dann lasst mich mal sehen, was wir hier haben. Ich sehe zu, dass ihr bald ein paar Fakten bekommt. Ihr könnt mir glauben, dass ich mir hier keine Minute länger als nötig den Hintern abfriere. Aber ich sag’s gleich: Das meiste wird sich erst nach einer Untersuchung im Labor ergeben. Organisiert euch also am besten erst mal einen Kaffee und lasst die Spusi und mich hier unser Ding machen.«
»Gibt es denn schon jemanden, den wir konkret befragen können?«, erkundigte sich Julia Durant bei den Beamten, die am Tor der Zufahrt standen. Zwei junge Männer, beide deutlich unter dreißig, der eine gertenschlank, der andere eine eher stattliche Erscheinung.
»Nein, zumindest noch nicht«, gab der Schlanke zurück. »Gemeldet wurde der Leichenfund per Telefon, wir waren nur um die Ecke, also gleich vor Ort. Angerufen hat einer der Hausmeister, kann auch einer aus der Putzkolonne gewesen sein, da sind wir nicht so ganz durchgestiegen. Er wirkte alkoholisiert, stammelte wirres Zeugs, und die Sanitäter mussten erst mal seinen Kreislauf checken. Wir haben ihn dort drüben mit zwei Kollegen vom 13. Revier ins Café gesetzt.« Der Beamte deutete in Richtung einer Häuserzeile auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
»Der Personalraum der Bank liegt nämlich direkt hinter den Containern, und da wollte er partout nicht rein«, ergänzte der andere. »Kann ich verstehen, na, und es hätte Platzeck auch mit Sicherheit nicht gefallen.«
»Allerdings«, lächelte Julia, »danke. Wir übernehmen das dann mal, geben Sie uns aber bitte Bescheid, sobald sich im Hof etwas tut.«
»Gar keine schlechte Idee bei dieser Hundskälte, wie?«, fragte Hellmer, nachdem sie die Straße überquert hatten und sich dem Café näherten.
»Als hätte Andrea es geahnt. Ich möchte auch gerade nicht mit ihr tauschen, wenn ich ehrlich bin.«
»Nein, wirklich nicht. Wir können nachher ja eine Runde Kaffee für sie und die Jungs mitnehmen. Aber erst mal die Pflicht, ich bin gespannt, was das für ein Typ ist.«
»Werden wir gleich sehen.« Julia öffnete die golden umrahmte Glastür des Cafés.
»Mein Name ist Julia Durant von der Mordkommission, und das ist mein Kollege Frank Hellmer«, begrüßte die Kommissarin die beiden Beamten und den Mann, der ihnen gegenübersaß. Er dürfte etwa Ende vierzig sein, schätzte Julia, sein Gesicht war faltig, und alles an ihm wirkte irgendwie verbraucht. Nur die dunklen Augen waren noch lebendig und aufmerksam, selbst in ihrem derzeitigen Zustand. Dunkle Ränder umgaben sie, und die Pupillen hatten einen gläsernen Glanz, dennoch schienen sie alles zu erfassen, was um sie herum geschah. Durch das ungekämmte, nach hinten liegende Haar zogen sich jede Menge grauer Strähnen, und die Hände, die auf dem Tisch neben einer großen Cappuccinotasse ruhten, glichen riesigen Pranken mit zahlreichen kleinen Narben und dunklen Rändern unter den Fingernägeln. Die Hände eines Mannes, der für sein Geld kräftig anpacken muss, schloss die Kommissarin.
»Morgen«, brummte der Mann unwirsch und ließ seinen Blick langsam über sie wandern, was ihr etwas unangenehm war.
»Danke Ihnen, wir übernehmen das dann mal hier«, nickte Frank Hellmer derweil zu den beiden Beamten. »Wir kontaktieren Sie später. Oder haben Sie bereits etwas protokolliert?«
»Nein, so weit sind wir noch nicht gekommen.«
»Gut, danke.«
Hellmer und Durant nahmen auf den beiden Stühlen Platz, und mit einem Blick verständigten sie sich darauf, dass Julia das Gespräch moderieren würde.
»Ich möchte Ihnen zunächst danken, dass Sie die Polizei verständigt haben«, begann sie freundlich, »denn das ist ja heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich.«
»Hatte doch Dienst heute, und der Rundgang führt mich zwangsläufig dort vorbei«, entgegnete ihr Gegenüber und drehte die Tasse hin und her. »Das weiß hier auch jeder, also wären Sie ohnehin ganz schnell auf meinen Namen gekommen. Ich wäre ja schön blöd gewesen, wenn ich da nicht selbst angerufen hätte.«
»Okay, da haben Sie natürlich recht, dann war es aber zumindest eine konsequente Reaktion«, lächelte Julia. Früher oder später würde sie ihn schon knacken.
»Wie auch immer. Ich habe den Kollegen längst gesagt, dass ich nichts weiter weiß. Was wollen Sie also noch?«
»Nun, wir brauchen eine lückenlose Geschichte, wissen Sie, wir müssen die sogenannten W-Fragen beantworten. Wann, warum, wo und so weiter. Fangen wir doch damit an, wer Sie sind, ich kenne ja noch nicht einmal Ihren Namen.«
»Hubert Brack.«
»Danke, Herr Brack. Jetzt kann ich Sie wenigstens vernünftig anreden. Möchten Sie übrigens noch einen Kaffee? Wir haben da draußen ganz schön gebibbert, ich brauche jetzt jedenfalls ganz dringend etwas Warmes.« Sie wandte sich zu Frank Hellmer. »Würdest du mal jemanden herwinken?«
»Einen mit Schuss, wenn’s schon auf Sie geht«, brummte Brack und klang dabei zumindest ein klein wenig verbindlicher.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte Julia. »Wir sehen zu, dass wir mit den Fragen durchkommen, und danach können Sie sich gerne einen Grog, einen Lumumba oder sonst was auf unseren Deckel bestellen. Aber vorher müssen wir das Geschäftliche regeln.«
»Meinetwegen.«
»Okay, woher sind Sie denn heute Morgen gekommen?«
»Von zu Hause.«
»Und wo ist das?«
Er gab die Adresse durch, und Julia notierte sie. »Sagt mir gar nichts.«
»Sachsenhausen«, erklärte Brack, und Julia überlegte kurz. Sie hatte jahrelang in Sachsenhausen gewohnt, doch natürlich kannte sie bei weitem nicht alle Ecken. Er schien ihre Gedanken zu erahnen und ergänzte: »Ziemlich weit unten, so die Ecke vom Südfriedhof.«
»Aha«, erwiderte Julia knapp und nickte. »Wie sind Sie hergekommen?«
»Mit dem Bus. Notgedrungen.«
»Wieso notgedrungen?«
»Kostet ein Schweinegeld! Aber ein Auto hab ich nicht, und das Fahrrad ist leider platt. Und Laufen ist bei dieser Kälte ja auch nicht.«
»Haben Sie denn kein Jobticket oder eine Monatskarte?«
»Woher denn? Nur weil ich in der Bank arbeite, habe ich noch lange keinen Geldscheißer zu Hause.«
»Hmm. Ist wohl auch nicht so wichtig«, brummte Julia. »Den Zeitpunkt Ihres Anrufs bekomme ich ja von der Leitstelle noch durchgegeben. Verraten Sie uns aber bitte, wie lange Sie sich schon vorher auf dem Gelände oder im Gebäude aufgehalten haben.«
»Gar nicht. Ich bin gekommen, wollte ein leeres Päckchen Kippen in den Müll werfen und dann reingehen. Da hab ich sie dann auch schon gesehen.«
»Stand der Müllcontainer offen?«
»Nur so einen Spalt, wie immer. Gerade so weit, dass es nicht reinregnet oder momentan wohl eher reinschneit. Weit genug eben, dass ich ihn nicht jedes Mal aufschieben muss.«
»Und dann?«
»Dann hab ich mir gedacht, das ist doch ein Arm, was soll denn das, und hab den Deckel aufgeschoben, und da hab ich sie liegen sehen. Erst mal bin ich für einen Moment wie angewurzelt dagestanden, ich meine, man findet ja nicht jeden Tag eine Tote – und dann auch noch so ein hübsches Ding. Irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich müsste auch in die anderen beiden Tonnen sehen, habe also die Deckel aufgerissen bis zum Anschlag und inständig gehofft, dass da nicht noch eine liegt.« Er keuchte, und auf seiner Stirn bildeten sich Schweißperlen. Die Bedienung stellte mit einem höflichen Lächeln drei breite, dampfende Cappuccinotassen auf den Tisch und eilte wieder davon.
Brack fuhr sich mit dem Ärmel seines rotkarierten Flanellhemds über die Stirn. »Gott sei Dank waren da nicht noch mehr, und ich habe mich dann natürlich umgesehen, man weiß ja nie, ob einem nicht jemand auflauert oder so. Da schießen einem plötzlich völlig wirre Sachen durch den Kopf, das sind so Gedanken und Bilder, die rasen vorbei, ohne dass man sie zu Ende denkt, na, das macht wohl das Fernsehen. Ich habe es jedenfalls nicht länger ausgehalten da unten im Hof, bin hoch auf die Straße und habe die 112 gewählt.« Er tastete auf die linke Brust, vermutlich verbarg sich dort in der Tasche sein Handy. »Der Notruf geht ja tatsächlich ohne Guthaben, ich hab nämlich keines drauf. Sonst hätte ich wohl gar nicht gleich anrufen können, denn Telefonzellen findet man ja kaum noch hier, und allein ins Gebäude wäre ich mit Sicherheit nicht gegangen. Na, und wenn die mir bei Ihnen in der Leitstelle nicht gesagt hätten, dass sofort jemand käme und dass ich mich nicht wegbewegen soll, wäre ich wohl einfach losgerannt, wahrscheinlich den ganzen Weg bis nach Hause.«
Neue Schweißperlen hatten sich auf seiner Stirn gebildet. Der Schreck schien noch immer tief zu sitzen.
»Kann ich gut verstehen.« Julia nickte. »So was braucht kein Mensch. Und das Opfer ist Ihnen nicht bekannt?«
»Nein. Ist wohl auch nicht so ganz meine Liga, wie? Weder vom Alter noch vom Aussehen.«
»Ach, wir haben schon die tollsten Konstellationen erlebt«, warf Hellmer ein. »Aber sagen Sie, ist es eigentlich üblich, dass Sie sonntags arbeiten? Ich meine, sonntags früh um zehn ist doch sicher in keinem der Büros jemand da, oder? Schon gar nicht nach Neujahr.«
Brack kratzte sich am Kinn, wo, wie überall im Gesicht, graue Stoppeln auf der grobporigen Haut wucherten. »Da oben im Glaspalast sicher nicht, aber es gehört nun mal auch zu den Pflichten der elegantesten Bauten, dass die Zugangswege schnee- und eisfrei sind. Das ist vertraglich klar geregelt, und vom Facility Management«, diese beiden Worte setzte er mit Fingern in Anführungszeichen, »wird erwartet, dass bei Frost täglich zweimal gestreut wird. Die wollen keine Klagen an den Hals bekommen, und was meinen Sie, an wem es letzten Endes hängenbleiben würde, wenn trotzdem was passiert?«
»Klingt einleuchtend«, nickte Durant. »Und Sie sind demnach der Verantwortliche?«
»Im Schadensfall schon«, knurrte Brack. »Nur die Bezahlung für diese ach so tolle Verantwortung, die kommt bei mir nicht an. Das heimst die Zeitarbeitsfirma ein. Sie glauben doch nicht, dass auch nur einer der Betonbunker hier einen richtigen Hausmeister hat, so jemanden, der den Job von der Pike auf gelernt hat, der betonieren kann oder Stromkabel und Wasserleitungen anschließen und nicht bereits für das Wechseln einer Glühbirne eine Firma kommen lassen muss.«
»So jemanden wie Sie?«
»Ach, vergessen Sie’s«, winkte Brack ab. »Es ist, wie’s ist. Halb so viel Bürokratie und ein, zwei Kollegen, die es draufhaben – und wir wären weitaus effizienter als ein Dutzend Eurojobber. Aber letzten Endes bin ich ja selbst einer«, seufzte er schwermütig. »Die Zeiten, in denen es so etwas wie eine gute Seele in jedem größeren Gebäude gab, einen, der jeden Winkel kennt und weiß, wie es tickt, diese Zeiten sind wohl ein für alle Mal vorbei.«
»Geben Sie mir doch bitte noch die Daten Ihres Arbeitgebers, und Ihre Telefonnummer würde ich mir auch gerne notieren«, sagte Julia. »Dann wäre es das auch schon fürs Erste. Falls wir noch weitere Fragen an Sie haben, können wir Sie dann immer noch kontaktieren.«
»Wüsste nicht, was ich noch dazu sagen könnte.« Brack zuckte mit den Schultern und erhob sich.
»Doch keinen Kaffee mehr mit Schuss?«, lächelte Julia mit einem Zwinkern und erhob sich ebenfalls.
»Nein, jetzt will ich nur noch heim in meine Bude. Außerdem streut sich die Straße nicht von alleine.«
»Darauf müssen Sie heute verzichten«, sagte Julia, »wir können Sie derzeit nicht in den Hof lassen.«
»Solange Sie das auf Ihre Kappe nehmen«, erwiderte Brack gleichgültig.
»Machen wir. Sagen Sie, nur noch eine Frage«, Julia hob den Zeigefinger, und Brack verharrte. »Kann irgendjemand bezeugen, was Sie uns eben berichtet haben? Ankunftszeit, das Verlassen Ihrer Wohnung, irgendetwas davon?«
»Bedaure. Da gibt’s niemanden.«
»Okay. Danke trotzdem.«
Als Brack gegangen war und Hellmer die Kellnerin bezahlt hatte, ergriff Julia das Wort: »Und, was hältst du von ihm?«
»Ganz ehrlich? Das ist ’ne arme Sau, der sich den Rest des Tages mit einer Flasche Doppelkorn vertreiben wird und es noch eine ganze Weile zutiefst bereuen wird, heute aufgestanden zu sein. Das ist zumindest mein erster Eindruck – was sagst denn du dazu?«
»Na, ganz so drastisch hätte ich es wohl nicht ausgedrückt, aber prinzipiell sehe ich das ähnlich. Er hat eine sympathische Art, irgendwie, jedenfalls ist er ja doch noch aufgetaut und wirkte aufrichtig. Schade nur, dass niemand seine Geschichte bestätigen kann. Wir müssen also alles selbst prüfen. Warten wir Andreas Ergebnisse ab, dann haben wir zumindest einen konkreten Zeitraum, den wir auf ein Alibi abklopfen können.«
Andrea Sievers kam ihnen bereits entgegen, als sie das Tor erreichten.
»Ich hoffe, ihr hattet es schön gemütlich, während wir uns für euch abgerackert haben«, rügte sie die beiden mit einem Augenzwinkern, stellte ihren Koffer ab und hauchte sich warme Atemluft in die ausgehöhlten Handflächen. »Na, wenigstens habt ihr an mich gedacht«, lächelte sie versöhnlich, als Hellmer ihr die Tragevorrichtung mit vier Pappbechern entgegenstreckte. »Danke dir.«
»Kannst du uns denn schon etwas sagen?«, erkundigte sich Julia.
»Bedaure, viel ist es noch nicht. Ich habe vorerst nur die typischen Stellen in Augenschein genommen, also geschaut, ob es Würgemale am Hals gibt, und mal unters Röckchen gelugt, ob sich dort Hämatome finden, die auf einen sexuellen Übergriff hindeuten.«
»Und?«, bohrte Julia ungeduldig nach.
»Würgemale negativ, aber eine Vergewaltigung würde ich nicht ausschließen. Eindeutig ist, dass sie einen ordentlichen Hieb auf den Hinterkopf bekommen hat. Ob sie daran gestorben ist, bleibt noch zu klären, denn sie kann natürlich auch nur bewusstlos gewesen sein, und die Kälte in dem Müllcontainer erledigte den Rest. Tests auf Drogen, Alkohol und Co. kann ich erst vornehmen, wenn ich sie aufgetaut habe, und auch alle anderen Untersuchungen müssen bis dahin warten. Ich möchte da nicht mit dem Eispickel rangehen, obwohl, das wäre mal etwas erfrischend anderes, wenn ich drüber nachdenke.«
»Andrea!«, schalt Julia sie. »Du immer mit deinem grauenvollen Humor. Den kann ich gerade überhaupt nicht vertragen.«
»Tja, das ist eben der Preis, wenn man einen Job hat, bei dem man zu den inneren Werten eines Menschen nur selten ohne Knochensäge gelangt. Das hat tatsächlich schon etwas … Pathologisches.«
Sonntag, 12.15 Uhr
So, prima, ein halber Tag vorbei und keine Ahnung, was der Rest einem bringen wird«, stöhnte Hellmer, als die beiden an seinem BMW standen.
»Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auf die Identifizierung des Mädchens zu warten«, antwortete Julia, »Um Bracks Firma werden wir uns wohl erst morgen kümmern können. Was ist denn mit irgendeinem Verantwortlichen aus der Bank?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Hellmer kopfschüttelnd. »Wen ruft man bei so etwas an? Ich werde mich da am besten mal dahinterklemmen, muss ja ohnehin ins Büro.«
»Da komm ich mit. Ist allemal besser, als zu Hause herumzusitzen und sowieso die ganze Zeit drüber nachzudenken.«
»Sicher?«
»Klar. Nimmst du mich mit? Ich lasse mein Auto hier stehen. Dann kann ich nachher ein Stück laufen, um es abzuholen. Nötig hätte ich es ja, nach all den Kalorienbomben der Feiertage. Aber im Moment steht mir der Sinn nur nach Wärme.«
»Gerne.« Sie stiegen ein, und Hellmer startete den Wagen. »Ich fühle meine Ohren sowieso kaum mehr, sind sie überhaupt noch dran?«
Der BMW fädelte sich in den noch immer dünnen Verkehr, und aus dem Gebläse kam bald angenehm warme Luft.
»Du bist aber auch nicht gerade passend ausgestattet für so einen Tag«, gab Julia nach einem prüfenden Blick zurück. »Schau mal mich an, ich bin nicht zu eitel dafür, mir die Pudelmütze bis zum Hals runterzuziehen. Mit Claus habe ich sogar …«, sie räusperte sich schnell, »… also, was ich sagen wollte, in München bin ich sogar mit Ohrenschützern rumgelaufen. Und überhaupt«, fügte sie eilig hinzu und stieß ihren Kollegen in die Seite, »meinst du nicht, so langsam fällt es auf mit deiner Strategie? Ich meine, du kommst aus Okriftel gefahren, meinetwegen, aber du würdest ja selbst, wenn du hier im Revier übernachten würdest, angeben, dass du eine halbe Stunde brauchst. Und dann stehst du vor allen anderen auf der Matte.«
»Tja, besser so, als über der Zeit zu liegen, oder?«, grinste Hellmer. »Man darf völlig abgehetzt zu einem Treffpunkt kommen, keine Frage, aber ist man dann zu spät, wird man schief angesehen, ist man aber früher als erwartet, hat man sofort einen Bonus.«
»Oh Mann.« Julia rollte die Augen.
»Aber wo wir gerade dabei sind. Deine Strategie ist auch nicht übel«, begann Hellmer mit einem Unterton, der Julia ganz und gar nicht behagte.
»Wieso?«, entgegnete sie und tat unwissend.
»Du weißt genau, was ich meine. Einfach mal so schnell das Thema München anschneiden und dann wieder drüber weggehen, als wäre nichts gewesen. Aber nicht mit mir, da hast du dich mal schön verplappert, meine Liebe, und das werden wir jetzt auch brav auslöffeln!«
»Ach, Frank. Das ist doch Blödsinn.« Julia runzelte die Augenbrauen. »Hör mal, ich habe das vorhin nicht mit Absicht getan, ehrlich. Ich bin nur noch überhaupt nicht richtig hier angekommen, und ja, ich hatte ein paar wunderschöne Tage in München, und die meiste Zeit davon habe ich mit Paps verbracht. Zu Hause liegen noch die Koffer auf dem Bett, nicht ausgepackt, na, und dann kommt dieser Anruf.« Sie zuckte mit den Schultern und suchte den Blickkontakt zu ihrem Kollegen. »Wenn es nach mir ginge, hätte es mit dem Job ruhig ein wenig langsamer losgehen können. Kannst du das nicht verstehen?«
Frank legte die Hand auf Julias Schulter. »Na klar, und wie ich das kann. Schau, ich habe meine Familie zwar ständig um mich, aber gerade nach der Weihnachtszeit fällt es auch mir besonders schwer, wenn der Alltag kommt.«
Er machte eine kurze Pause und fragte dann: »Aber mal abgesehen davon scheint es dir wirklich gutzugehen. Oder irre ich mich?«
»Ja, Frank«, nickte Julia nach einigen Sekunden, in denen ihr Blick sich in weite Ferne verlor. Ein sanftes Lächeln zog über ihr Gesicht, als sie weitersprach: »Ich glaube, so gut wie jetzt ging es mir schon lange nicht mehr.«
»Das freut mich«, gab Hellmer lächelnd zurück und tätschelte ihr die Schulter, bevor er die Hand zurück ans Steuer nahm. »Halt es fest, solange es geht.«
»Na, wir werden sehen, wie lange der Alltag das zulässt«, seufzte Julia, ließ es aber nicht schwermütig klingen. Dann rieb sie sich die Hände und fügte geschäftig hinzu: »Na gut, bevor wir gleich nach oben gehen, klär mich doch mal bitte auf, was sonst noch so anliegt.«
»Nichts Außergewöhnliches, wenn ich das so sagen darf«, erwiderte Hellmer und überlegte kurz. »Zwei, nein drei erfrorene Obdachlose, das war fast unmittelbar nach deiner Abreise, und einer kam nach den Feiertagen dazu.«
»Schrecklich.«
»Ja, jedes Jahr derselbe Mist. Aber es interessiert einfach niemanden, und dann, im Rest vom Jahr, erfriert ja auch keiner mehr. Und wenn der nächste Frost kommt, tut jeder so, als wäre es das erste Mal, dass so etwas passiert. So ist das halt.« Er schüttelte resigniert den Kopf. »Dann hatten wir einen goldenen Schuss direkt an Heiligabend, ein neunzehnjähriger Stricher, das war nicht gerade feierlich. Insgesamt also nichts, was uns direkt betrifft, aber alles, was einen echt betroffen machen kann.«
»Allerdings«, pflichtete Julia bei. »Besonders dieser Junge. Wie kann man nur so abstürzen?«
»Ist jedes Mal ein Jammer«, seufzte Hellmer. »Aber was will man machen? Zwischen den Jahren ist für die meisten Menschen die schlimmste Zeit. Wenn einen dann die Einsamkeit übermannt, oder eine Depression, kommt man auf die dümmsten Gedanken. Entweder rastet man aus – und wir können heilfroh sein, dass es dieses Jahr wenigstens kein blutiges Familiendrama gegeben hat –, oder aber man macht einfach Schluss.«
»Eines so schlecht wie das andere«, kommentierte Julia bitter. »Sonst noch was?«
»Wie gesagt, keine großen neuen Fälle, die uns betreffen, nicht bis heute Morgen jedenfalls.«
Sie hatten das Präsidium erreicht, und Julia stieß die Beifahrertür auf. »Okay, dann gehen wir’s mal an.«
Sonntag, 14.50 Uhr
Bald, nur noch etwas Geduld, mahnte Arthur Drechsler sich zur Ruhe. Er drehte den Regler der Gasheizung hinunter, im Inneren des Wohnwagens war es angenehm warm. Die dicke Isolierung, die er den Sommer über nach und nach eingearbeitet hatte, zahlte sich aus. Auch die Aussparungen der Fenster waren mit zehn Zentimeter dicken Schaumplatten abgedichtet, das schuf ein wenig Privatsphäre, denn es ging schließlich keinen etwas an, was im Inneren geschah. Er legte den Kopf in den Nacken und sah in Richtung Oberlicht. Die Dämmerung würde nicht mehr lange auf sich warten lassen, es war einer dieser kurzen, eisigen Wintertage, spätestens in zwei Stunden würde es dunkel sein. Außerdem war in zwei Tagen Neumond, die finsterste Zeit dieses Winters, genau passend zur Stimmung, in der er sich befand.
Arthur schob einen der beiden Schuhkartons, die vor ihm auf dem Klapptisch der Essecke standen, zur Seite und griff nach dem anderen. Behutsam hob er den Deckel an, dabei hinterließen seine Finger Spuren in der dicken Staubschicht. Im Inneren der Box befanden sich Postkarten, Papierschnipsel, ein paar Fotografien und ein ganzer Stapel gefalteter Dokumente, meist Fotokopien. Zielstrebig blätterte er einen Stapel Fotos durch, dabei fiel sein Blick auf eine Urlaubsaufnahme, und er hielt kurz inne. Er zwang sich, die düsteren Erinnerungen zu verjagen, schob die Fotos beiseite, und schon wenige Sekunden später hielt er ein Sparbuch in den Händen. Das stoffähnliche Material und der Zustand des Covers ließen darauf schließen, dass es sich um ein recht altes Sparbuch handeln musste. Arthur schlug es auf und suchte den ersten Eintrag. 14. Februar 1959, ja, es war in der Tat ein sehr altes Dokument. Aber nach wie vor gültig, lächelte er grimmig und blätterte einige Seiten um, bis er den letzten Eintrag erreichte. Zufrieden schloss er das Buch und legte es zurück in die Kiste, die er gemeinsam mit dem anderen Schuhkarton wieder auf dem Hängeschrank verstaute.
Erneut warf Arthur einen Blick auf seine Uhr. Nur zehn Minuten waren vergangen, kein Grund zur Eile also. Er überlegte kurz, ob er den Ofen auf kleinster Stufe weiterbrennen lassen sollte, entschied sich aber dagegen. Keine Risiken, so lautete eine seiner Devisen. Er schlief nicht einmal bei eingeschaltetem Ofen, dabei war das Heizsystem seines Wohnwagens idiotensicher: Die Zuluft wurde durch eine separate Bodenöffnung angesaugt, außerdem gab es überall Bodenschlitze, meist hinter den Möbeln verborgen. Das Gleiche oben, wo die Abluft durch eine runde Öffnung, den sogenannten Pilz, entweichen konnte. Und auch hier gab es Schlitze oberhalb der Wandschränke. Diejenigen, welche hinaus auf die offene Grünfläche zeigten und von aufmerksamen Passanten gesehen werden konnten, hatte Arthur verschlossen. Ein wild wuchernder Holunderbusch und ein Haselnussstrauch bedeckten zwar eine große Fläche der Außenwand, trotzdem konnte man den Wohnwagen noch gut erkennen. Die Eingangstür lag auf der Rückseite und war nur über einen schmalen Fußpfad um den Wagen herum zu erreichen. Man konnte also nicht ohne weiteres feststellen, ob sich jemand im Inneren befand, kein Rauch, kein Licht – so sollte es sein. Den Nachbarn, so wusste Arthur, war es zwar ein Dorn im Auge, wie er das Grundstück hergerichtet hatte, doch das störte ihn herzlich wenig. Er pflegte die Grünanlage gerade ausreichend gemäß den Statuten der Grünflächenordnung. Der bescheuerte Verein von Kleingärtnern würde ihm nicht ans Bein pinkeln können, sosehr es sie auch wurmte. Spießer, Möchtegerngärtner, die sich auf ihrer achtzig Quadratmeter großen Parzelle ein Stück heile Welt schaffen wollten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ein altes Lehrerehepaar, dessen Tomatenstauden und Himbeerranken wie mit Lineal und Wasserwaage gemessen wuchsen. Nicht ohne Grund hatte Arthur auf der gesamten Länge seines Zauns Efeu und Liguster wuchern lassen.
Er knackste mit den Knöcheln seiner Finger und ging zum Kleiderschrank. Etwas Dunkles sollte es sein, am besten schwarz, passend zur Nacht und passend zu dem, was er vorhatte.
Sonntag, 15.20 Uhr
Stefan Löbler runzelte die Augenbrauen, dabei zogen sich vier breite Falten über seine Stirn. Wer zum Teufel läutete sonntagnachmittags unangemeldet an der Tür? Eigentlich müsste man in einem gehobenen Viertel wie diesem davon ausgehen dürfen, nicht unangemeldet gestört zu werden, dachte er missmutig, als er über den Marmorboden in die Eingangshalle schlurfte. Die exklusiven Villenviertel und Wohnanlagen der Reichen in den USA kamen ihm in den Sinn, Satellitensiedlungen in den ruhigen Randbezirken mittelgroßer Städte, abgetrennt durch Zaunanlagen und mit einem eigenen 24-Stunden-Wachservice. Beneidenswert, seufzte er in Gedanken, als er das Terminal der Schließanlage erreichte, denn dort gibt es sicher keine Hausierer wie hierzulande. Doch das Display zeigte etwas ganz anderes, und verwundert öffnete Löbler die Tür.
»Guten Tag, Herr Löbler«, sagte ein schlanker Uniformierter förmlich und nickte. Einen Schritt hinter ihm stand eine Polizeibeamtin, ebenfalls ausstaffiert mit Uniform, Mütze und Waffe im Holster.
»Tag«, entgegnete der Hausherr knapp. »Wird das jetzt etwa zur Gewohnheit?«
»Sie meinen, weil unsere Kollegen unlängst, am zweiten Weihnachtsfeiertag, schon einmal bei Ihnen waren?«, kam sogleich die Gegenfrage, und bevor er etwas sagen konnte, fuhr der Uniformierte fort: »Herr Löbler, dann können Sie sich vielleicht auch den Grund unseres Besuchs denken?«
»Genauso wenig wie damals.«
»Gut. Ich frage anders: Ist Ihre Frau zu Hause?«
»Nathalie? Na klar, sie wollte sich gerade ein Bad einlassen, möchten Sie vielleicht nachsehen?« Löbler klang ironisch und gab sich keinerlei Mühe, freundlich zu sein.
»Meine Kollegin, wenn Sie gestatten.« Der Polizist nickte seiner Partnerin zu. Dann wandte er sich wieder an den Hausherrn: »Wir beide bleiben derweil hier unten, und vielleicht möchten Sie mir erklären, warum wir erneut zu Ihnen gerufen wurden.«
Es klang nicht wie eine Frage, und auch der Beamte wirkte nicht, als wollte er freundlich oder zumindest höflich sein. Offenbar gefiel ihm diese Art des Einsatzes ebenso wenig.
»Hören Sie«, setzte Stefan Löbler an, »ich kann Ihnen nichts weiter sagen, als dass Sie mal wieder völlig umsonst bei mir auf der Matte stehen. Was war es an Weihnachten? Ruhestörung? Jemand fühlte sich belästigt?«
»Ja und nein. Jemand war in Sorge, Herr Löbler, das ist etwas anderes. In Sorge, dass Sie und Ihre Frau sich an die Gurgel gehen, dass jemand, insbesondere Ihre Frau, verletzt werden könnte.«
»So ein Humbug!«, entfuhr es Löbler, doch der Beamte zeigte sich unbeeindruckt.
»Wenn Sie das so sehen, bitte. Aber wir werden uns auch heute persönlich davon überzeugen, dass es Ihrer Frau gutgeht, denn uns erreichte dieselbe Meldung – und zwar mit Nachdruck. Was auch immer in Ihren vier Wänden geschieht, Herr Löbler, Sie sollten sich Gedanken darüber machen. Wenn schon Nachbarn die Polizei rufen, will das etwas bedeuten, stimmen Sie mir da zu?«
»Einen Scheiß stimme ich zu«, knurrte Löbler und trottete nach innen, wo er sich auf seine breite weiße Ledercouch fallen ließ. Oben hörte er sanfte Stimmen, konnte aber nicht verstehen, worüber dort gesprochen wurde. Der Polizist folgte ihm.
»Sie sagen also, es hätte heute Nachmittag hier im Haus keine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Ihrer Frau gegeben, in deren Verlauf Porzellan oder etwas in dieser Art zu Bruch gegangen ist?«
»So lautete die Meldung?«, hakte Löbler verächtlich nach. »Dann sollte Ihr Informant sich mal die Ohren untersuchen lassen, oder Sie sind im falschen Haus gelandet. Probieren Sie es doch im Nachbarort, da gibt’s ’ne Sozialbausiedlung, da finden Sie sicher jemanden, dem Sie helfen können.«
»Kein Grund, unverschämt zu werden.« Der Beamte sah ihn tadelnd an, blickte dann aber ans obere Ende der Treppe, wo eine attraktive Rothaarige, eingehüllt in einen Bademantel, neben seiner Kollegin stand. Diese schüttelte mit aufeinandergepressten Lippen und einem Schulterzucken den Kopf und kam die Stufen herunter.
»Sehen Sie«, grinste Löbler überheblich, »wieder nix. Hören Sie«, fuhr er mit gedämpfter Stimme fort, »sehen Sie sich meine Frau doch mal an, hm? Ich bin vierundvierzig, auf wie alt schätzen Sie sie? Kaum drei Jahre jünger, ob Sie’s glauben oder nicht, dabei würde sie locker für fünfundzwanzig durchgehen. Und sie ist knallhart im Geschäft, das ist ein weiterer Punkt, den man ihr nicht ansieht. Bei uns kann es, und da will ich Ihnen überhaupt nichts vormachen, durchaus heiß hergehen. Aber wenn sie schreit«, er grinste breit, »na, Sie können sich’s wohl denken, dann nur in Ekstase.«
»Danke, das interessiert uns nicht«, wehrte der Beamte ab und schloss zu seiner Kollegin auf, die bereits an der Haustür stand. »Doch Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass wir ein Auge auf Sie haben werden. Wir sind dazu verpflichtet, denn irgendjemandem haben Ihre Aktivitäten offensichtlich Grund zur Besorgnis bereitet.«
»Purer Neid, sonst nichts«, spottete Löbler und kam ebenfalls zur Tür. »Rufen Sie doch vorher an, wenn Sie das nächste Mal kommen. Sie könnten vielleicht Pizza mitbringen oder so, dann ist der Weg wenigstens nicht umsonst. Denn glauben Sie mir: Meiner Nathalie, der geht es prächtig hier, da können Sie Gift drauf nehmen, und wenn Sie mal wieder diesen Neidhammel in der Leitung haben, schicken Sie ihn doch mal rüber. Vielleicht geht ihm ja vom Zusehen einer ab, und er gibt endlich Ruhe.«
Mit Schwung warf er die Tür ins Schloss, dann stapfte er die Treppe nach oben in Richtung Badezimmer. Stefan Löbler war stinksauer, und es gab nur eine Sache, die ihn nun entspannen konnte.
Sonntag, 15.30 Uhr
Etwa zur gleichen Zeit schaltete Julia Durant im Präsidium ihren PC aus. Sie hatte E-Mails abgerufen, einige davon in knappen Sätzen beantwortet und zwei Telefonate geführt, nun gesellte sie sich wieder an Frank Hellmers Seite, der ebenfalls an seinem Monitor saß.
»Das ist eine ganz schön illustre Gesellschaft in den oberen Etagen unseres Tatorts«, sagte er und deutete auf eine Liste mit Firmennamen. Julia überflog einige Zeilen mit zusammengekniffenen Augen. Anlageberater, Steueranwälte, ein paar Zweigstellen namhafter internationaler Unternehmen und jede Menge Vertretungen kleiner und größerer Banken.
»Wow, das stinkt ja förmlich nach Geld.«
»Geld stinkt nicht«, warf Hellmer ein, »aber ich weiß schon, was du mir sagen willst. Ich wette darauf, von diesen Damen und Herren hat nicht ein Einziger jemals seinen Fuß in den Hinterhof gesetzt. Wahrscheinlich glauben die, dass deren Fünf-Gänge-Menüs von alleine wachsen und auf den Tisch geflogen kommen.«
»Ja, der Verdacht liegt nahe«, murmelte Julia. »Meinst du denn, das Opfer könnte dort gearbeitet haben?«
»Wenn wir einen Namen hätten, wäre es kein Ding, das herauszufinden. Aber so bleibt uns leider nur die Fahndung nach einer unbekannten Toten, inklusive Veröffentlichung im Internet. Parallel dazu müssen wir wohl oder übel mit einem Foto der Kleinen Klinken putzen gehen. Das wird Berger zwar überhaupt nicht schmecken, aber diskreter geht es nun mal nicht.«
»Es sei denn, unsere Metzger entlocken der Kleinen eine Identität. Wenn sie allerdings tatsächlich bei irgendeiner der Firmen tätig war, dürften wohl kaum Fingerabdrücke oder DNA in irgendeiner Datenbank ruhen.«
Julia seufzte. Das Warten auf Ergebnisse anderer Abteilungen gehörte nicht gerade zu ihren Stärken. Da klingelte Hellmers Telefon.
»Hallo?«