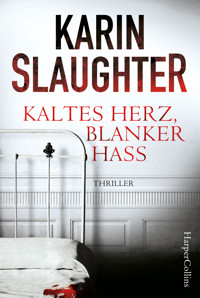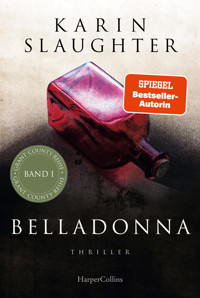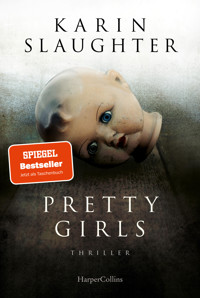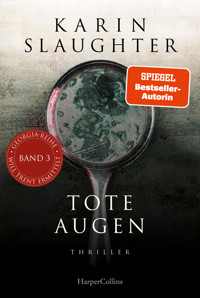
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georgia-Serie
- Sprache: Deutsch
Atlanta, Georgia: In der Notaufnahme des größten Krankenhauses der Stadt behandelt Dr. Sara Linton die sozial Schwachen und wagt einen Neuanfang nach der großen Tragödie, die ihr Leben in Grant County zerstört hat. Doch dann wird sie in eine Polizeiermittlung um eine Reihe grausamer Morde und Folterungen verwickelt – und sie trifft auf Will Trent und Faith Mitchell vom Georgia Bureau of Investigation. Die Ereignisse wecken lange verblasste Erinnerungen in ihr, an die sie nie wieder denken wollte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
In Sara Lintons neuem Zuhause Atlanta passieren brutale Morde an jungen Frauen, und die ehemalige Rechtsmedizinerin kann nicht tatenlos zusehen. Als sie eine gefolterte Frau in der Notaufnahme behandeln muss, schaltet sie sich in die Ermittlungen von Will Trent und Faith Mitchell vom Georgia Bureau of Investigation ein. Obwohl Will schnell den Ort findet, an dem die Opfer gequält wurden, verschwindet kurz darauf eine weitere Frau. Der Mörder ist noch auf freiem Fuß, und Sara, Will und Faith läuft die Zeit läuft davon …
Zur Autorin:
Karin Slaughter ist eine der weltweit berühmtesten Autorinnen und Schöpferin von über 20 New York Times-Bestseller-Romanen. Dazu zählen »Cop Town«, der für den Edgar Allan Poe Award nominiert war, sowie die Thriller »Die gute Tochter« und »Pretty Girls«. Ihre Bücher erscheinen in 120 Ländern und haben sich über 40 Millionen Mal verkauft. Ihr internationaler Bestseller »Ein Teil von ihr« ist 2022 als Serie mit Toni Collette auf Platz 1 bei Netflix eingestiegen. Eine Adaption ihrer Bestseller-Serie um den Ermittler Will Trent läuft derzeit erfolgreich auf Disney+, weitere filmische Projekte werden entwickelt. Slaughter setzt sich als Gründerin der Non-Profit-Organisation »Save the Libraries« für den Erhalt und die Förderung von Bibliotheken ein. Die Autorin stammt aus Georgia und lebt in Atlanta. Mehr Informationen zur Autorin gibt es unter www.karinslaughter.com
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel Undone Delacorte Press, An imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.
© 2009 by Karin Slaughter
Ungekürzte Ausgabe im HarperCollins Taschenbuch
by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2011 für die deutschsprachige Ausgabe by Blanvalet Verlag München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Die Rechte an der Nutzung der deutschen Übersetzung von Klaus Berr liegen beim Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Covergestaltung von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung von Magdalena Wasiczek / Trevillion Images
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749907915
www.harpercollins.de
WIDMUNG
An meine Leser … Vielen Dank für Ihr Vertrauen in mich.
PROLOG
Am heutigen Tag waren sie genau vierzig Jahre verheiratet, und Judith hatte noch immer das Gefühl, sie wisse nicht alles über ihren Ehemann. Seit vierzig Jahren kochte sie Henry das Essen, seit vierzig Jahren bügelte sie seine Hemden, seit vierzig Jahren schlief sie in seinem Bett, und er war ihr noch immer ein Rätsel. Vielleicht war das der Grund, warum sie das alles für ihn tat, ohne sich kaum je einmal zu beklagen. Es sprach schon sehr für einen Mann, wenn er einen nach vierzig Jahren noch immer interessierte.
Judith kurbelte das Autofenster herunter, um die kühle Frühlingsluft hereinzulassen. Das Zentrum von Atlanta war nur dreißig Minuten entfernt, aber hier draußen in Conyers fand man noch immer weite Flächen unerschlossenen Landes und sogar ein paar kleine Farmen. Es war eine stille Gegend, und Atlanta war gerade so weit entfernt, dass sie den Frieden genießen konnte. Dennoch seufzte Judith, als am fernen Horizont die Wolkenkratzer Atlantas auftauchten, und dachte, Zuhause.
Sie überraschte der Gedanke, dass Atlanta jetzt der Ort war, den sie als Zuhause betrachtete. Bis vor Kurzem war ihr Leben noch ein vorstädtisches, fast sogar ein ländliches gewesen. Weite, offene Flächen waren ihr lieber gewesen als die betonierten Bürgersteige der Großstadt, auch wenn sie zugeben musste, dass es nett war, so zentral zu leben, dass man zum Laden an der Ecke oder in ein kleines Café einfach zu Fuß gehen konnte, wenn man Lust dazu hatte.
Tage vergingen, ohne dass sie überhaupt in ein Auto steigen musste – ein Leben, wie sie es sich vor zehn Jahren noch nicht einmal erträumt hätte. Sie merkte, dass Henry es ähnlich empfand. Mit entschlossen hochgezogenen Schultern steuerte er den Buick über die schmale Landstraße. Nach Jahrzehnten des Fahrens über so ziemlich jeden Highway und jede Interstate des Landes kannte er instinktiv jede Nebenstraße, jeden Schleichweg und jede Abkürzung.
Judith vertraute darauf, dass er sie sicher nach Hause brachte. Sie lehnte sich zurück, schaute zum Fenster hinaus und kniff dabei leicht die Augen zusammen, sodass die Bäume am Straßenrand unscharf wurden und wirkten wie dichter Wald. Mindestens ein Mal pro Woche fuhr sie nach Conyers, und jedes Mal hatte sie das Gefühl, etwas Neues zu sehen – ein kleines Haus, das ihr nie aufgefallen war, eine Brücke, über die sie schon geholpert war, die sie jedoch noch nie beachtet hatte. Das Leben war so. Man merkte gar nicht, was an einem vorbeizog, bis man ein wenig langsamer fuhr, um genauer hinzuschauen.
Sie kamen eben von einer kleinen Jubiläumsfeier zu ihren Ehren, die ihr Sohn organisiert hatte. Na ja, wahrscheinlich eher Toms Frau, die sein Leben organisierte wie Chefsekretärin, Haushälterin, Babysitterin, Köchin und – wahrscheinlich – Konkubine in einer Person. Tom war eine freudige Überraschung gewesen, seine Geburt ein Ereignis, das die Ärzte für unmöglich gehalten hatten. Kaum hatte Judith ihn zum ersten Mal gesehen, liebte sie jeden Teil von ihm, betrachtete ihn als Geschenk, das sie mit jeder Faser ihres Körpers umsorgen würde. Sie hatte alles für ihn getan, und jetzt, da Tom Mitte dreißig war, schien er immer noch sehr viel Fürsorge zu brauchen. Vielleicht war Judith eine zu konventionelle Ehefrau, eine zu unterwürfige Mutter gewesen, sodass ihr Sohn zu einem Mann herangewachsen war, der eine Frau wollte – und brauchte –, die alles für ihn tat.
Für Henry hatte Judith sich mit Sicherheit nicht zur Sklavin gemacht. Sie hatten 1969 geheiratet, zu einer Zeit, da Frauen tatsächlich andere Interessen haben konnten, als den besten Braten zu machen und die beste Methode herauszufinden, Flecken aus einem Teppich zu entfernen. Von Anfang an war Judith entschlossen gewesen, ihr Leben so interessant wie möglich zu gestalten. In Toms Schule hatte sie bei Veranstaltungen und Ausflügen die Aufsicht geführt. Sie hatte als Freiwillige im Obdachlosenheim des Orts gearbeitet und mitgeholfen, in der Nachbarschaft eine Recyclinggruppe zu organisieren. Als Tom dann älter wurde, hatte sie die Buchhaltung für eine örtliche Firma erledigt und in einer Sportgruppe der Kirche für Marathonläufe trainiert. Dieser aktive Lebensstil stand in deutlichem Kontrast zu dem ihrer Mutter, einer Frau, die am Ende ihres Lebens so verwüstet war von Geburt und Erziehung von neun Kindern, so ausgelaugt von den körperlichen Anstrengungen, die einer Farmersfrau abverlangt wurden, dass sie oft zu depressiv war, um überhaupt sprechen zu können.
Allerdings, das musste Judith sich eingestehen, war sie in diesen frühen Jahren selbst eine in gewisser Weise typische Frau gewesen. Es war zwar peinlich, das zuzugeben, aber Judith war aufs College gegangen, nur um einen Ehemann zu finden. Sie war in der Nähe von Scranton, Pennsylvania, aufgewachsen, einem so winzigen Dorf, dass es nicht einmal auf der Landkarte verzeichnet war. Die einzig verfügbaren Männer dort waren Farmer, und die waren an Judith kaum interessiert. Judith konnte es ihnen nicht verdenken. Der Spiegel log nicht. Sie war ein bisschen zu mollig, die Zähne standen ein bisschen zu weit vor, sie war ein bisschen zu viel von allem anderen, um zu den Mädchen zu gehören, die man in Scranton zur Ehefrau nahm. Und da war dann noch ihr Vater, ein strenger Zuchtmeister, den sich kein vernünftiger Mann als Schwiegervater wünschen würde, und auf jeden Fall nicht im Gegenzug für ein birnenförmiges Mädchen mit vorstehenden Zähnen, das kein Talent für die Farmarbeit hatte.
Tatsächlich war Judith immer die Ausnahme in der Familie gewesen, diejenige, die nicht recht dazupasste. Sie las zu viel. Sie hasste die Farmarbeit. Auch als junges Mädchen hatte sie sich nicht zu Tieren hingezogen gefühlt und wollte nicht verantwortlich sein für ihre Pflege und Fütterung. Keines von ihren Geschwistern war auf eine weiterführende Schule geschickt worden. Es gab zwei Brüder, die in der neunten Klasse die Schule verlassen hatten, und eine ältere Schwester, die ziemlich schnell geheiratet und sieben Monate später ihr erstes Kind geboren hatte. Wobei keiner sich die Mühe gemacht hatte, genauer nachzurechnen. Ihre Mutter, eine Meisterin der Verdrängung, hatte bis zu ihrem Tod behauptet, ihr Enkel sei schon als Kleinkind grobknochig gewesen. Zum Glück hatte Judiths Vater die Vorzeichen gesehen, was seine mittlere Tochter anging. Für sie würde es keine Vernunftehe mit einem der Jungs vom Dorf geben, nicht zuletzt deswegen, weil keiner von ihnen sie als vernünftige Partnerin betrachtete. Das Bibelcollege, entschied er, war nicht nur Judiths letzte, sondern ihre einzige Chance.
Mit sechs Jahren war Judith von einem Kieselstein am Auge getroffen worden, als sie hinter dem Traktor herrannte. Von diesem Augenblick an hatte sie immer eine Brille getragen. Wegen der Brille nahmen die Leute an, sie sei ein Kopfmensch, wobei das genaue Gegenteil der Fall war. Ja, sie las sehr gerne, doch ihre Vorliebe war eher der Groschenroman als die hohe Literatur. So war es überraschend – nein, eher schockierend –, dass an Judiths erstem Tag im College der Dozent ihr zuzwinkerte.
Erst hatte sie gedacht, er hätte etwas im Auge, doch Henry Coldfields Absichten wurden unmissverständlich, als er sie nach der Stunde beiseitenahm und sie fragte, ob sie mit ihm in den Drugstore gehen und eine Limonade trinken wolle. Das Zwinkern war offensichtlich Anfang und Ende seines Draufgängertums. Henry war ein sehr schüchterner Mensch; was merkwürdig war, wenn man bedachte, dass er später der Spitzenverkäufer eines Spirituosengroßhandels wurde – eine Arbeit, die er auch drei Jahre nach seiner Pensionierung noch verachtete.
Judith nahm an, Henry konnte sich deshalb so gut anpassen, weil er Sohn eines Colonels der Army gewesen war, sodass sie sehr oft umziehen mussten und nie mehr als ein paar Jahre an einem Ort blieben. Es gab keine leidenschaftliche Liebe auf den ersten Blick – die kam erst später. Anfangs hatte Judith Henry einfach nur attraktiv gefunden, weil er sie attraktiv fand. Das war etwas ganz Neues für die Birne aus Scranton, aber Judith hatte sich schon immer ans entgegengesetzte Extrem der Marx’schen Philosophie gehalten – die von Groucho, nicht von Karl: Sie war mehr als bereit, jedem Klub beizutreten, der sie als Mitglied aufnehmen wollte.
Henry war ein Klub für sich selbst. Er war weder attraktiv noch hässlich, weder vorlaut noch schweigsam. Die Haare trug er ordentlich gescheitelt, sein Akzent war flach, und so war durchschnittlich das Wort, das ihn am besten beschrieb und das Judith in einem späteren Brief an ihre Schwester auch verwendete. Rosas Antwort lautete in etwa so: »Na ja, ich schätze, das ist das Beste, was du dir erhoffen kannst.« Zu Rosas Verteidigung muss man sagen, dass sie zu der Zeit mit ihrem dritten Kind schwanger war, während ihr zweites noch in den Windeln steckte, dennoch hatte Judith ihrer Schwester diese Kränkung nie verziehen – eine Kränkung, die ihr nicht gegen sie, sondern gegen Henry gerichtet erschien. Wenn Rosa nicht erkannte, was für ein besonderer Mensch Henry war, dann nur, weil Judith sich nicht gut ausdrücken konnte; Henry war viel zu vielschichtig für schlichte Wörter auf einem Blatt Papier.
Vielleicht war es für alle am besten so. Rosas sarkastische Bemerkung hatte Judith einen Grund gegeben, mit ihrer Familie zu brechen und sich diesem zwinkernd introvertierten, sprunghaften Fremden in die Arme zu werfen.
Henrys draufgängerische Schüchternheit war nur die erste von vielen Widersprüchlichkeiten, die Judith im Lauf der Jahre an ihrem Mann aufgefallen waren. Er hatte entsetzliche Höhenangst, hatte aber bereits als Teenager seinen Flugschein gemacht. Er verkaufte Alkohol, trank aber selbst nie. Er war ein häuslicher Mensch, verbrachte aber den größten Teil seines Erwachsenenlebens mit Reisen zuerst durch den Nordwesten, dann den Mittleren Westen, denn diverse Beförderungen führten ihn ebenso durchs ganze Land, wie die Army es getan hatte, als Henry noch ein Kind war. Sein Leben, so schien es, war dadurch definiert, dass er sich zwang, Dinge zu tun, die er nicht tun wollte. Und doch sagte er Judith oft, dass das Zusammensein mit ihr das Einzige sei, was er wirklich genieße.
Vierzig Jahre und so viele Überraschungen.
Zu ihrem großen Bedauern hatte Judith starke Zweifel, dass ihr Sohn für seine Lebensgefährtin ähnliche Überraschungen bereithalten würde. Als Tom heranwuchs, war Henry drei von vier Wochen unterwegs, und sein Vatersein kam in plötzlichen Ausbrüchen, die nicht unbedingt seine mitfühlende Seite betonten. Tom wurde folglich alles, was sein Vater ihm in diesen prägenden Jahren gezeigt hatte: streng, unbeugsam, getrieben.
Dazu kam allerdings noch etwas anderes: Judith wusste nicht, ob es damit zu tun hatte, dass Henry seine Arbeit als Pflicht seiner Familie gegenüber und nicht als seine Leidenschaft betrachtete, oder weil er es hasste, so viel von zu Hause weg zu sein, aber es sah so aus, als liege jeder Kommunikation, die er mit seinem Sohn hatte, eine latente Spannung zugrunde: Mach nicht dieselben Fehler, die ich gemacht habe. Verrate nicht deine Überzeugungen, nur um Essen auf den Tisch zu bringen. Der einzige positive Rat, den er seinem Sohn je gab, war, er solle eine gute Frau heiraten. Wenn er nur konkreter geworden wäre. Wenn er nur nicht so hart gewesen wäre.
Woran lag es, dass Väter mit ihren Söhnen immer so streng waren? Judith vermutete, sie wollten, dass ihre Söhne in Bereichen Erfolg hatten, wo es ihnen nicht gelungen war. Damals, am Anfang ihrer Schwangerschaft, hatte sich bei dem Gedanken an eine Tochter eine schnelle Wärme in Judiths Körper ausgebreitet, gefolgt von einer sengenden Kälte. Ein junges Mädchen wie Judith, draußen in der Welt, voller Trotz gegen ihre Mutter, voller Trotz gegen die Welt. Dadurch verstand sie Henrys Wunsch, dass Tom besser werden sollte und alles bekam, was er wollte, und noch mehr.
Im Beruf hatte Tom mit Sicherheit Erfolg, seine graue Maus von einer Frau war allerdings eine Enttäuschung. Sooft Judith ihrer Schwiegertochter gegenüberstand, drängte es sie, der Frau zu sagen, sie solle aufstehen, den Mund aufmachen und, um Gottes willen, Rückgrat zeigen. Eine der freiwilligen Helferinnen in der Kirche hatte letzte Woche gesagt, dass Männer immer ihre Mütter heirateten. Judith hatte der Frau nicht widersprochen, aber sie würde jedem raten, nur ja keine Vergleiche zwischen sich und der Frau ihres Sohns anzustellen. Abgesehen von der Sehnsucht nach ihren Enkeln, konnte Judith sich gut vorstellen, ihre Schwiegertochter nie mehr zu sehen und dennoch glücklich zu sein.
Die Enkel waren schließlich der einzige Grund, warum sie nach Atlanta gezogen waren. Sie und Henry hatten ihr Rentnerleben in Arizona völlig hinter sich gelassen und waren fast zweitausend Meilen hierher in diese heiße Stadt mit ihren Smogwarnungen und Bandenmorden gezogen, nur um in der Nähe der verzogensten und undankbarsten kleinen Wesen auf dieser Seite der Appalachen zu sein.
Judith warf einen flüchtigen Blick zu Henry hinüber, der beim Fahren aufs Lenkrad trommelte und unmelodisch summte. Über ihre Enkel sprachen sie nur voller Begeisterung, vielleicht weil sie, wenn sie ehrlich wären, zugeben müssten, dass sie sie nicht besonders mochten – und wo wären sie dann? Sie hatten ihr Leben völlig umgekrempelt für zwei kleine Kinder, die eine glutenfreie Diät, streng reglementierte Schlafperioden und straff durchorganisierte Spielzeiten einhielten, aber nur mit »gleichgesinnten Kindern, die dieselben Ziele hatten«.
Soweit Judith das beurteilen konnte, hatten ihre Enkel nur ein einziges Ziel: immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie stellte sich vor, dass man nicht niesen konnte, ohne ein gleich gesinntes, egozentrisches Kind zu finden. In den Augen ihrer Schwiegertochter war das jedoch eine fast unlösbare Aufgabe. War das nicht der ganze Zweck der Jugend, egozentrisch zu sein? Und war es nicht Aufgabe der Eltern, einem das auszutreiben? Auf jeden Fall war es allen Beteiligten klar, dass es nicht Aufgabe der Großeltern war.
Als der kleine Mark seinen nicht pasteurisierten Saft auf Henrys Hose geschüttet und Lilly so viele von den Hershey’s Kisses gegessen hatte, die sie in Judiths Handtasche gefunden hatte, dass sie Judith an eine Obdachlose erinnerte, die im letzten Monat im Heim so mit Methamphetaminen vollgepumpt war, dass sie sich in die Hose gemacht hatte, da hatten Henry und Judith nur gelächelt – sogar gekichert –, als wären das wunderbare kleine Angewohnheiten, die die Kinder in Kürze ablegen würden.
Doch das passierte eben nicht, und jetzt, da sie sieben und neun Jahre alt waren, verlor Judith allmählich den Glauben daran, dass sich ihre Enkel eines Tages zu höflichen und liebevollen jungen Erwachsenen entwickeln würden, die nicht den ständigen Drang verspürten, Erwachsenengespräche zu unterbrechen und durchs Haus zu rennen und so laut zu schreien, dass noch zwei Countys entfernt die Tiere anfingen zu jaulen.
Judiths einziger Trost war, dass Tom jeden Sonntag mit ihnen in die Kirche ging. Sie wollte natürlich, dass ihre Enkel das Leben in Christus kennenlernten, aber wichtiger war ihr noch, dass sie die Lektionen lernten, die man ihnen in der Sonntagsschule beibrachte. Du sollst Mutter und Vater ehren. Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Glaube nur ja nicht, du könntest dein Leben wegwerfen, die Schule abbrechen und zu Oma und Opa ziehen.
»Hey!«, rief Henry, als ein entgegenkommendes Auto auf der Gegenfahrbahn so dicht an ihnen vorbeifuhr, dass der Buick richtiggehend schwankte. »Kinder«, murmelte er und packte das Lenkrad fester.
Je näher Henry seinem Siebzigsten kam, umso mehr schien er sich in der Rolle des mürrischen, alten Mannes zu gefallen. Manchmal war das liebenswert. Zu anderen Zeiten fragte sich Judith, wie lange es noch dauern würde, bis er anfing, die Faust zu schütteln und alle Übel dieser Welt den »Kindern« in die Schuhe zu schieben. Das Alter dieser Kinder schien irgendwo im Bereich zwischen vier und vierzig zu liegen, und seine Verärgerung steigerte sich exponentiell, wenn er sie bei etwas ertappte, das er früher selbst getan hatte, jetzt aber nicht mehr genießen konnte. Judith graute vor dem Tag, da man ihm seinen Flugschein abnehmen würde, und dieser Tag würde eher früher als später kommen, da sein letzter Routinecheck beim Kardiologen einige Unregelmäßigkeiten ergeben hatte. Das war einer der Gründe, warum sie beschlossen hatten, den Ruhestand in Arizona zu verbringen, denn dort gab es keinen Schnee zu schaufeln und keinen Rasen zu mähen.
Sie sagte: »Sieht nach Regen aus.«
Henry hob den Kopf, um nach den Wolken zu schauen.
»Wird ein guter Abend, um mit meinem Buch anzufangen.«
Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Henry hatte ihr zum Hochzeitstag einen dicken historischen Liebesroman geschenkt. Judith hatte ihm eine neue Kühltasche geschenkt, die er auf den Golfplatz mitnehmen konnte.
Mit halb zusammengekniffenen Augen starrte sie auf die Straße vor ihnen und beschloss, sich demnächst wieder einmal ihre Augen untersuchen zu lassen. Sie selbst war auch nicht mehr weit von den siebzig entfernt, und ihre Sehkraft schien mit jedem Jahr schlechter zu werden. Die Dämmerung war für sie eine besonders schlechte Zeit, und Objekte in größerer Entfernung sah sie nur noch verschwommen. Deshalb blinzelte sie mehrmals, bevor sie wirklich sicher war, was sie da sah, und sie öffnete erst den Mund, um Henry zu warnen, als das Tier direkt vor ihnen war.
»Jude!«, schrie Henry, und sein rechter Arm legte sich quer über ihre Brust, während er das Lenkrad nach links riss, um dem armen Ding auszuweichen. Völlig unpassenderweise dachte Judith daran, wie recht die Filme doch hatten. Alles verlangsamte sich, die Zeit kroch dahin, sodass jede Sekunde wie eine Ewigkeit wirkte. Sie spürte Henrys starken Arm gegen ihre Brust schlagen, den Sicherheitsgurt in ihre Hüfte schneiden. Ihr Kopf schnellte zur Seite und krachte gegen die Tür, als das Auto ausscherte. Die Windschutzscheibe splitterte, als das Tier gegen das Glas prallte, dann auf das Autodach und schließlich auf den Kofferraumdeckel knallte. Erst als das Auto, nach einer Drehung um hundertachtzig Grad, schwankend zum Stehen kam, erreichten die Geräusche Judiths Ohr: das Krachen und doppelte Knallen, überlagert von einem schrillen Kreischen, das, wie sie jetzt erkannte, aus ihrem eigenen Mund kam. Anscheinend hatte sie einen Schock, denn Henry musste mehrmals »Judith! Judith!« schreien, bevor sie aufhörte zu kreischen.
Henrys Hand umklammerte fest ihren Arm, was ihr einen Schmerz bis in die Schulter hinaufschickte. Sie strich ihm über den Handrücken und sagte: »Ich bin in Ordnung. Bin in Ordnung.« Die Brille saß ihr schief auf der Nase, sie sah nicht mehr scharf. Sie hielt sich die Finger an die rechte Kopfseite und spürte eine klebrige Feuchtigkeit. Als sie die Hand wegzog, sah sie Blut.
»War vermutlich ein Reh oder …« Henry presste sich die Hand auf den Mund und ließ den Satz unvollendet. Er wirkte ruhig bis auf das verräterische Auf und Ab seines Brustkorbs, als er versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Der Aufprall hatte den Airbag aktiviert, ein feines weißes Pulver bedeckte sein Gesicht.
Ihr stockte der Atem, als sie nach vorn schaute. Blut war auf die Windschutzscheibe gespritzt wie ein plötzlicher, heftiger Regen.
Henry stieß die Tür auf, stieg aber nicht aus. Judith nahm die Brille ab, um sich über die Augen zu wischen. Beide Gläser waren kaputt, der untere Teil der Bifokallinse rechts fehlte. Sie sah, dass die Brille zitterte, und merkte, dass das Zittern von ihren Händen kam. Henry stieg aus, und sie zwang sich, die Brille wieder aufzusetzen und ihm zu folgen.
Das Geschöpf lag auf der Straße, die Beine bewegten sich. Judith schmerzte der Kopf, dort, wo sie ihn sich an der Tür angeschlagen hatte. Blut war ihr in die Augen gelaufen. Das war die einzige Erklärung, die sie hatte für die Tatsache, dass das Tier – mit Sicherheit ein Reh – allem Anschein nach die wohlgeformten weißen Beine einer Frau hatte.
»O Gott«, flüsterte Henry. »Es ist – Judith – es ist …«
Hinter sich hörte Judith ein Auto. Reifen quietschten auf dem Asphalt. Türen gingen auf und wurden zugeknallt. Zwei Männer kamen auf der Straße zu ihnen, einer lief sofort weiter zu dem Tier.
Er schrie »Ruf die 9-1-1!« und kniete sich neben den Körper. Judith machte ein paar Schritte darauf zu, dann noch ein paar. Die Beine bewegten sich wieder – die perfekten Beine einer Frau. Sie war völlig nackt. Blutergüsse schwärzten die Innenseiten ihrer Schenkel – sehr dunkle Ergüsse. Alte Ergüsse. Ihre Beine waren mit getrocknetem Blut verkrustet. Ein burgunderfarbener Film schien ihren Torso zu bedecken, eine klaffende Wunde in der Seite zeigte weißen Knochen. Die Augen waren geschwollen, die Lippen schrundig und aufgeplatzt. Blut verklebte die dunklen Haare der Frau und breitete sich um ihren Kopf aus wie ein Heiligenschein.
Judith ging noch näher hin, sie konnte nicht anders – plötzlich war sie Voyeur, nachdem sie ihr Leben lang höflich weggeschaut hatte. Glas knirschte unter ihren Sohlen, und die Frau riss in Panik die Augen auf. Sie starrte an Judith vorbei, ihr Blick hatte eine dumpfe Leblosigkeit. Ebenso plötzlich schlossen sich ihre Lider wieder, aber Judith konnte den Schauer nicht unterdrücken, der durch ihren Körper fuhr.
»O Gott«, murmelte Henry fast so, als wäre es ein Gebet. Als Judith sich umdrehte, sah sie, dass ihr Mann sich die Hand auf die Brust drückte. Seine Knöchel waren weiß. Er starrte die Frau an und sah aus, als müsste er sich gleich übergeben. »Wie konnte das passieren?«, flüsterte er, und Entsetzen verzerrte sein Gesicht. »Wie, in Gottes Namen, konnte das passieren?«
ERSTERTAG
1. KAPITEL
Sara Linton lehnte sich in ihrem Sessel zurück und murmelte ein leises »Ja, Mama« in ihr Handy. Kurz fragte sie sich, ob je wieder eine Zeit kommen würde, da sich das wieder normal anfühlte, es sie, wie früher, glücklich machte, mit ihrer Mutter zu telefonieren, und ihr nicht das Gefühl gab, es würde ihr ein Teil des Herzens aus der Brust gerissen.
»Baby«, flötete Cathy, »du schaust auf dich selber, und das ist das Einzige, was Daddy und ich wissen wollen.«
Sara spürte Tränen in ihren Augen brennen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie im Ärztezimmer des Grady Hospital geweint hätte, aber sie hatte keine Lust mehr zu weinen, eigentlich hatte sie keine Lust mehr, irgendetwas zu empfinden. War das denn nicht der Grund, warum sie ihre Familie, ihr Leben, das ländliche Georgia verlassen hatte und nach Atlanta gezogen war – damit sie nicht mehr dauernd daran erinnert wurde, was zuvor gewesen war?
»Versprich mir, dass du wenigstens versuchst, nächste Woche in die Kirche zu gehen.«
Sara murmelte etwas, das man als Versprechen interpretieren konnte. Ihre Mutter war nicht blöd, und sie wussten beide, es war höchst unwahrscheinlich, dass Sara an diesem Ostersonntag in einer Kirchenbank sitzen würde, aber Cathy bedrängte sie auch nicht.
Sara schaute den Stapel Krankenblätter auf dem Tisch an. Sie war am Ende ihrer Schicht und musste noch ihre Berichte diktieren.
»Mama, tut mir leid, aber ich muss jetzt Schluss machen.«
Cathy entlockte ihr noch das Versprechen eines Anrufs nächste Woche und legte dann auf. Sara hielt ihr Handy noch für ein paar Minuten in der Hand und starrte die abgegriffenen Ziffern an. Ihr Daumen suchte die Sieben und die Fünf, sie wählte die vertraute Nummer, schickte den Anruf aber nicht ab. Dann steckte sie das Handy in die Tasche und spürte dabei den Brief.
Der Brief. Sie betrachtete ihn als eigenständige Wesenheit.
Normalerweise sah Sara ihre Post nach der Arbeit durch, damit sie sie nicht mit sich herumschleppen musste, aber eines Morgens hatte sie sich die Post angeschaut, bevor sie aus dem Haus ging. Kalter Schweiß war ihr ausgebrochen, als sie den Absender erkannte. Sie hatte sich den ungeöffneten Umschlag in die Tasche ihres Arztmantels gesteckt, weil sie dachte, sie würde ihn in der Mittagspause lesen. Doch die Pause ging vorüber, der Brief blieb ungeöffnet, fuhr mit ihr zurück nach Hause und am nächsten Morgen wieder in die Arbeit. Monate vergingen, und der Brief begleitete Sara überallhin, manchmal in ihrem Mantel, manchmal in ihrer Handtasche, zum Supermarkt oder zu anderen Erledigungen. Er wurde zu einem Talisman, und oft steckte sie die Hand in die Tasche und berührte ihn, nur um sich daran zu erinnern, dass er noch da war.
Im Lauf der Zeit war der verschlossene Umschlag eselsohrig geworden, und der Poststempel des Grant County verblasste. Mit jedem Tag, der verging, wurde es für Sara schwieriger, ihn zu öffnen und zu erfahren, was die Frau, die ihren Mann umgebracht hatte, zu sagen hatte.
»Dr. Linton?« Mary Schroder, eine der Krankenschwestern, klopfte an die Tür. Sie benutzte die vertrauten Kürzel der Notaufnahme. »Wir haben eine OBE-Frau, dreiunddreißig, schwach und fadenförmig.« Sara schaute auf das Krankenblatt, dann auf ihre Uhr. Eine dreiunddreißigjährige Frau, die bei Einlieferung ohnmächtig war, stellte ein Rätsel dar, dessen Lösung einige Zeit dauern würde. Es war fast sieben Uhr. Saras Schicht war in zehn Minuten zu Ende. »Kann Krakauer sie übernehmen?«
»Krakauer hat sie bereits übernommen«, entgegnete Mary. »Er hat ein komplettes Stoffwechselprofil angeordnet und ist dann mit der neuen Tussi Kaffee trinken gegangen.« Die Sache bereitete ihr offensichtlich Kopfzerbrechen, denn sie fügte hinzu: »Die Patientin ist Polizistin.«
Mary war mit einem Polizisten verheiratet, was kaum schockierte, wenn man sich überlegte, dass sie seit fast zwanzig Jahren in der Notaufnahme des Grady Hospital arbeitete. Doch auch ohne diesen Hintergrund verstand es sich in jedem Krankenhaus der Welt von selbst, dass Polizisten und andere Gesetzeshüter die beste und schnellste Behandlung bekamen. Nur Otto Krakauer war das offensichtlich nicht bewusst.
Sara ließ sich erweichen. »Wie lange war sie ohnmächtig?«
»Sie sagt, ungefähr eine Minute.« Mary schüttelte den Kopf, denn Patienten waren, wenn es um ihre Gesundheit ging, selten die Aufrichtigsten. »Sie sieht nicht gut aus.«
Dieser letzte Satz war es, der Sara aus ihrem Sessel trieb. Grady war das einzige Unfallzentrum in der Region und auch eines der wenigen noch verbliebenen öffentlichen Krankenhäuser in Georgia. Die Schwestern und Pfleger im Grady sahen fast täglich Opfer von Autounfällen und Schießereien, Drogen-Überdosen und von so ziemlich jedem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie hatten ein geübtes Auge für die Entdeckung von ernsthaften Problemen. Und natürlich kamen Polizisten normalerweise nicht freiwillig in ein Krankenhaus, außer es ging um Leben und Tod.
Sara überflog das Krankenblatt der Frau, als sie durch die Notfallabteilung ging. Otto hatte nicht mehr getan, als die medizinische Vorgeschichte aufzunehmen und die üblichen Bluttests anzuordnen, und die Informationen ließen Sara keine offensichtliche Diagnose erkennen. Faith Mitchell war eine ansonsten gesunde dreiunddreißigjährige Frau ohne Vorerkrankungen und ohne frische Verletzungen. Die Ergebnisse des großen Blutbilds würden ihr hoffentlich einen genaueren Hinweis darauf geben, was eigentlich los war.
Sara murmelte eine Entschuldigung, als sie gegen eine Krankentrage im Gang stieß. Wie gewöhnlich quollen die Zimmer über, und die Patienten drängten sich in den Gängen, einige in Betten, andere in Rollstühlen, und alle sahen elender aus, als sie es bei ihrer Ankunft vermutlich getan hatten. Die meisten von ihnen waren wahrscheinlich direkt nach der Arbeit hierhergekommen, weil sie es sich nicht leisten konnten, den Lohn eines ganzen Tages zu verlieren. Sie sahen Saras weißen Arztkittel und riefen nach ihr, aber sie ignorierte sie, während sie das Krankenblatt durchging.
Mary sagte: »Ich komme gleich nach. Sie ist da drin«, bevor sie sich von einer älteren Frau auf einer Pritsche wegziehen ließ.
Sara klopfte an die offene Tür von Untersuchungszimmer 3. Privatsphäre – das war noch ein Luxus, den man Polizisten zukommen ließ. Eine zierliche blonde Frau saß auf der Bettkante, sie war voll angezogen und offensichtlich ziemlich verärgert. Mary war gut in ihrer Arbeit, aber auch ein Blinder hätte sehen können, dass es Faith Mitchell nicht gut ging. Sie war so bleich wie das Laken auf dem Bett; und auch aus einer gewissen Entfernung sah ihre Haut schweißfeucht aus.
Ihr Ehemann, der nervös im Zimmer auf und ab ging, schien auch nicht gerade hilfreich zu sein. Er war ein attraktiver Mann, deutlich über eins achtzig groß, mit kurz geschnittenen, sandblonden Haaren. Eine gezackte Narbe zog sich über eine Wange, vermutlich von einem Unfall in der Kindheit, bei dem er mit seinem Gesicht über den Asphalt unter seinem Fahrrad oder über die festgetretene Erde vor einer Homebase geschlittert war. Er war schlank und drahtig, wahrscheinlich ein Läufer, und sein dreiteiliger Anzug zeigte die breite Brust und die kräftigen Schultern eines Mannes, der viel Zeit im Fitnessstudio verbrachte.
Er blieb stehen, und sein Blick wanderte von Sara zu seiner Frau und wieder zurück. »Wo ist der andere Arzt?«
»Er wurde zu einem anderen Notfall gerufen.« Sie ging zum Waschbecken, wusch sich die Hände und sagte dabei: »Ich bin Dr. Linton. Können Sie mich kurz ins Bild setzen? Was ist passiert?«
»Sie ist ohnmächtig geworden«, sagte der Mann und drehte nervös den Ehering an seinem Finger. Er schien zu merken, dass er ein bisschen hektisch klang, und mäßigte seinen Ton. »Sie ist zuvor noch nie ohnmächtig geworden.«
Sara drückte die Finger an Faiths Handgelenk und maß ihren Puls. »Wie fühlen Sie sich jetzt?«
Sie schaute den Mann an. »Wütend.«
Sara lächelte, leuchtete mit ihrer Stablampe in Faiths Augen, untersuchte ihren Hals und führte all die üblichen körperlichen Untersuchungen durch, ohne irgendetwas Beunruhigendes zu finden. Sie stimmte mit Krakauers ursprünglicher Einschätzung überein: Faith war vermutlich ein wenig dehydriert. Ihr Herz klang allerdings gut, und es sah nicht so aus, als hätte sie einen Anfall erlitten. »Haben Sie sich bei dem Sturz den Kopf angeschlagen?«
Sie wollte eben antworten, doch der Mann ging dazwischen. »Es passierte auf dem Parkplatz. Ihr Kopf knallte auf den Beton.«
Sara fragte die Frau: »Sonst irgendwelche Probleme?«
Faith antwortete: »Nur ab und zu mal Kopfschmerzen.« Sie schien etwas zurückzuhalten, auch als sie gestand: »Ich habe heute noch fast nichts gegessen. Mir war heute Morgen entsetzlich übel. Und gestern Morgen ebenfalls.«
Sara öffnete eine der Schubladen auf der Suche nach einem Hämmerchen, um ihre Reflexe zu testen, doch sie fand keinen. »Haben Sie in letzter Zeit Gewichtsverlust oder -zunahme festgestellt?«
Faith sagte: »Nein«, während der Mann »Ja« sagte.
Der Mann sah zerknirscht aus, als er in Faiths Richtung hinzufügte: »Also ich finde, es sieht gut aus.«
Faith atmete tief durch. Sara betrachtete den Mann nun noch einmal und dachte sich, dass er wahrscheinlich Steuerberater oder Anwalt war. Er hatte sich seiner Frau zugewandt, und Sara bemerkte eine zweite, feinere Narbe auf seiner Oberlippe – offensichtlich kein chirurgischer Schnitt. Die Haut war schief zusammengenäht worden, sodass die Narbe, die zwischen Nase und Lippe verlief, nicht ganz gerade war. Wahrscheinlich hatte er im College geboxt, oder vielleicht war er einmal zu oft auf den Kopf geschlagen worden, weil ihm offensichtlich nicht klar war, dass man aus seinem Loch nur herauskam, wenn man aufhörte zu graben. »Faith, ich finde, das zusätzliche Gewicht sieht wirklich toll aus. Sogar noch ein bisschen mehr könnte nicht scha…«
Sie brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen.
»Nun gut.« Sara klappte die Krankenakte auf und schrieb einige Anordnungen hinein. »Wir müssen Ihren Schädel röntgen, und ich möchte auch gern noch ein paar weitere Tests durchführen. Keine Angst, wir können die Blutprobe von vorher benutzen, im Augenblick haben Sie also keine weitere Nadel zu befürchten.« Sie notierte sich etwas und hakte einige Kästchen ab, bevor sie Faith wieder ansah. »Ich verspreche Ihnen, wir machen das so schnell wie möglich, aber wie Sie sehen, haben wir heute ein ziemlich volles Haus. Beim Röntgen gibt’s einen Rückstau von mindestens einer Stunde. Ich werde tun, was ich kann, um das schnell durchzuziehen, aber vielleicht sollten Sie sich für die Wartezeit ein Buch oder ein Magazin besorgen.«
Faith antwortete nicht, aber irgendetwas in ihrem Verhalten änderte sich. Sie schaute den Mann an und dann wieder Sara. »Muss ich das da unterschreiben?« Sie deutete auf die Krankenakte.
Es gab nichts zu unterschreiben, aber Sara gab ihr die Akte trotzdem. Faith schrieb etwas ganz unten auf die Seite und gab ihr die Akte zurück. Sara las die Wörter: Ich bin schwanger.
Sara nickte, als sie die Röntgenanordnung ankreuzte. Offensichtlich hatte Faith es ihrem Ehemann noch nicht gesagt, aber Sara hatte jetzt eine Reihe anderer Fragen an sie, und die konnte sie nicht stellen, ohne diese Neuigkeit preiszugeben. »Wann wurde bei Ihnen zum letzten Mal ein Abstrich gemacht?«
Faith schien zu verstehen. »Letztes Jahr.«
»Dann erledigen wir das doch gleich, solange Sie hier sind«, sagte Sara zu dem Mann. »Sie können draußen warten.«
»Oh.« Er wirkte überrascht, obwohl er nickte. »Na gut.« Zu der Frau sagte er: »Ich bin im Wartezimmer, falls noch was ist.«
»Okay.« Faith sah ihm nach, und ihre Schultern entspannten sich sichtbar, als die Tür hinter ihm zuging. Sie fragte Sara: »Was dagegen, wenn ich mich hinlege?«
»Natürlich nicht.« Sara half ihr, es sich auf dem Bett bequem zu machen, und dachte, dass Faith jünger aussah als ihre dreiunddreißig Jahre. Sie hatte dennoch die typische Haltung eines Polizisten, diese unmissverständliche, leicht aggressive Straffheit der Schultern. Dieser Anwaltstyp schien nicht so recht zu ihr zu passen, aber Sara hatte schon merkwürdigere Paare gesehen.
Sie fragte die Frau: »Wie weit sind Sie?«
»Ungefähr in der neunten Woche.«
Sara notierte sich das, während sie fragte: »Ist das nur eine Vermutung, oder waren Sie bei einem Arzt?«
»Ich habe einen dieser frei verkäuflichen Tests gemacht.« Sie korrigierte sich. »Um genau zu sein, ich habe drei dieser Tests gemacht. Ich bin nie überfällig.«
Sara fügte einen Schwangerschaftstest zu den Anordnungen hinzu. »Was ist mit dieser Gewichtszunahme?«
»Zehn Pfund«, gab Faith zu. »Seit ich das herausgefunden habe, schiebe ich ein bisschen Panik beim Essen.«
Saras Erfahrung nach bedeuteten zehn Pfund normalerweise fünfzehn. »Haben Sie noch andere Kinder?«
»Eins – Jeremy – achtzehn.«
Sara schrieb auch das in die Akte und murmelte: »Sie Glückspilz. Mitten im schrecklichen zweiten Jahr.«
»Eher unterwegs in die schrecklichen Zwanziger. Mein Sohn ist achtzehn Jahre alt.«
Sara schaute Faith erstaunt an und blätterte in Faiths Anamnese.
»Ich erspare Ihnen das Rechnen«, bot Faith an. »Ich wurde schwanger, als ich vierzehn war. Jeremy bekam ich mit fünfzehn.«
Es gab nicht mehr viel, was Sara überraschte, aber Faith Mitchell hatte es geschafft. »Gab es bei Ihrer ersten Schwangerschaft irgendwelche Komplikationen?«
»Außer zur bevorzugten Beute der Sensationspresse zu werden?« Sie schüttelte den Kopf. »Absolut keine Probleme.«
»Okay«, erwiderte Sara, legte die Akte weg und schenkte Faith nun ihre volle Aufmerksamkeit. »Reden wir darüber, was heute passiert ist.«
»Ich ging zum Auto, und mir war ein bisschen schwindelig, und als Nächstes weiß ich nur noch, dass Will mich hierherfuhr.«
»Schwindelig, als würde sich alles drehen, oder wie bei einer Benommenheit?«
Sie dachte kurz über die Frage nach, bevor sie antwortete: »Benommen.«
»Irgendwelche Lichtblitze oder einen komischen Geschmack im Mund?«
»Nein.«
»Will ist Ihr Ehemann?«
Sie lachte schallend. »O Gott, nein.« Sie erstickte fast an einem ungläubigen Lachen. »Will ist mein Partner – Will Trent.«
»Ist Detective Trent hier, damit ich mit ihm reden kann?«
»Special Agent. Sie haben es eben getan. Er ist gerade gegangen.«
Sara hatte den Eindruck, irgendetwas nicht mitzubekommen. »Der Mann, der eben hier drin war, ist Polizist?«
Sie lachte. »Es ist der Anzug. Sie sind nicht die Erste, die ihn für einen Bestattungsunternehmer hält.«
»Ich dachte, er ist Anwalt«, gab Sara zu und dachte, dass sie in ihrem Leben noch nie einen Mann getroffen hatte, der weniger wie ein Polizeibeamter aussah als dieser Mann.
»Das muss ich ihm sagen, dass Sie ihn für einen Anwalt gehalten haben. Es wird ihn freuen, dass Sie ihn als gebildeten Mann einschätzten.«
Erst jetzt fiel Sara auf, dass die Frau keinen Ehering trug. »Und der Vater ist …«
»Mal da und dann wieder nicht.« Faith schien diese Information nicht peinlich zu sein, Sara nahm allerdings an, dass einer Frau, die bereits mit fünfzehn Jahren ein Kind bekommen hatte, nicht mehr viel peinlich sein konnte. »Es wäre mir lieber, wenn Will nichts davon erfährt«, sagte Faith. »Er ist sehr …« Sie brach mitten im Satz ab, schloss die Augen, presste die Lippen zusammen. Auf ihrer Stirn stand ein Schweißfilm.
Sara drückte noch einmal die Finger auf Faiths Handgelenk. »Was ist los?«
Faith biss die Zähne fest zusammen und sagte nichts.
Sara war oft genug angespuckt worden, um die Zeichen zu erkennen. Sie ging zum Waschbecken, befeuchtete ein Papiertuch und sagte zu Faith: »Atmen Sie tief ein und langsam wieder aus.«
Mit zitternden Lippen tat Faith es.
»Waren Sie in letzter Zeit gereizt?«
Trotz ihres Zustands versuchte es Faith mit Unbeschwertheit. »Mehr als sonst?«
Sie legte sich die Hand auf den Bauch und wirkte plötzlich nervös. »Ja. Nervös. Verärgert.« Sie schluckte. »Ich habe so ein Summen im Kopf, als hätte ich Bienen im Hirn.«
Sara drückte der Frau das kalte Papiertuch auf die Stirn. »Übelkeit?«
»Morgens«, brachte Faith gerade so heraus. »Ich dachte, das ist die typische morgendliche Übelkeit, aber …«
»Was ist mit den Kopfschmerzen?«
»Die sind ziemlich schlimm, kommen meistens am Nachmittag.«
»Waren Sie ungewöhnlich durstig? Urinieren Sie viel?«
»Ja. Nein. Ich weiß es nicht.« Sie schaffte es, die Augen aufzumachen, und fragte: »Und was ist es, eine Grippe oder ein Hirntumor oder was?«
Sara setzte sich auf die Bettkante und nahm die Hand der Frau.
»O Gott, ist es so schlimm?« Bevor Sara etwas erwidern konnte, sagte sie: »Ärzte und Polizisten setzen sich nur dann hin, wenn es schlechte Nachrichten gibt.«
Sara wunderte sich, dass ihr diese Erkenntnis hatte entgehen können. Sie hatte geglaubt, dass sie in den Jahren mit Jeffrey Tolliver alle seine Tricks durchschaut hatte, aber den hatte sie offensichtlich übersehen. Zu Faith sagte sie: »Ich war fünfzehn Jahre mit einem Polizisten verheiratet. Mir ist es nie aufgefallen, aber Sie haben recht – mein Mann setzte sich immer hin, wenn er schlechte Nachrichten hatte.«
»Ich bin seit fünfzehn Jahren Polizistin«, erwiderte Faith. »Hatte er Sie betrogen, oder wurde er zum Alkoholiker?«
Sara hatte einen Kloß im Hals. »Er wurde vor dreieinhalb Jahren getötet.«
»O nein«, keuchte Faith und presste sich die Hand auf die Brust. »Das tut mir sehr leid.«
»Ist schon okay«, erwiderte Sara und fragte sich, warum sie der Frau ein so persönliches Detail überhaupt mitgeteilt hatte. Ihr Leben in den letzten Jahren war darauf ausgerichtet, nicht über Jeffrey zu reden, und jetzt plauderte sie mit einer Fremden darüber. Sie versuchte, die Spannung zu lösen, indem sie hinzufügte: »Sie haben recht. Er hat mich auch betrogen.« Zumindest hatte er das getan, als Sara ihn zum ersten Mal geheiratet hatte.
»Das tut mir wirklich leid«, wiederholte Faith. »War er im Dienst?«
Sara wollte darauf nicht antworten. Ihr war übel, und sie fühlte sich überwältigt, wahrscheinlich ganz ähnlich, wie Faith sich gefühlt hatte, bevor sie auf dem Parkplatz ohnmächtig wurde.
Faith spürte das. »Sie müssen nicht darüber …«
»Danke.«
»Ich hoffe, man hat den Mistkerl geschnappt.«
Sara steckte die Hand in die Tasche, ihre Finger schlossen sich um die Kante des Briefs. Das war die Frage, auf die alle eine Antwort wollten: Haben sie ihn geschnappt? Hat man den Mistkerl verhaftet, der Ihren Ehemann umbrachte? Als wäre das von Bedeutung. Als würde die Verurteilung von Jeffreys Mörder den Schmerz über seinen Tod in irgendeiner Weise lindern.
Zum Glück kam Mary ins Zimmer. »’tschuldigung«, sagte die Krankenschwester. »Da war eine alte Dame, deren Kinder sie einfach hier abgesetzt haben. Ich musste den Sozialdienst anrufen.« Sie gab Sara ein Blatt Papier. »Das Stoffwechselprofil ist da.«
Sara runzelte die Stirn, als sie die Daten ablas. »Haben Sie Ihr Messgerät dabei?«
Mary griff in ihre Tasche und gab ihr das Blutzucker-Messgerät.
Sara tupfte ein wenig Alkohol auf Faiths Finger. Das komplette Stoffwechselprofil war unglaublich genau, aber das Grady war ein großes Krankenhaus, und es konnte schon mal vorkommen, dass im Labor Proben vertauscht wurden. »Wann hatten Sie Ihre letzte Mahlzeit?«, fragte sie Faith.
»Wir waren den ganzen Tag im Gericht.« Sara zischte: »Scheiße«, als die Lanzette ihr in den Finger stach. »So gegen Mittag aß ich ein paar Bissen eines Krapfens, den Will aus dem Automaten geholt hatte.«
Sara versuchte es noch einmal. »Die letzte richtige Mahlzeit.«
»Gegen acht Uhr gestern Abend.«
Aus Faiths schuldbewusstem Gesichtsausdruck schloss Sara, dass das Essen wahrscheinlich aus einer Tüte von einem Straßenverkauf gekommen war. »Tranken Sie heute Morgen Kaffee?«
»Vielleicht eine halbe Tasse. Der Geruch war mir ein bisschen zu viel.«
»Sahne und Zucker?«
»Schwarz. Normalerweise esse ich ein gutes Frühstück – Joghurt, Obst. Gleich nach meiner Joggingrunde.« Nach kurzem Zögern fragte Faith: »Ist mit meinem Blutzucker etwas nicht in Ordnung?«
»Werden wir gleich sehen«, antwortete Sara und drückte ein paar Tropfen Blut auf den Teststreifen. Mary hob eine Augenbraue, wie um Sara zu fragen, ob sie auf das Ergebnis wetten wollte. Sara schüttelte den Kopf: keine Wette. Mary blieb beharrlich und signalisierte mit den Fingern die Ziffernfolge 1-5-0.
»Ich dachte, der Test kommt erst später«, sagte Faith, die ein wenig verunsichert klang. »Nachdem man zuerst diese Zuckerlösung getrunken hat.«
»Hatten Sie je Probleme mit Ihrem Blutzucker? Gibt es eine familiäre Vorbelastung?«
»Nein. Keine.«
Das Messgerät piepste, und die Ziffer 152 erschien auf dem Monitor.
Mary pfiff leise, beeindruckt von der Präzision ihrer Vermutung. Sara hatte die Frau einmal gefragt, warum sie nicht Medizin studierte, nur um als Antwort zu erhalten, die Schwestern seien diejenigen, die wirklich Medizin praktizierten.
Sara sagte zu Faith: »Sie haben Diabetes.«
Faiths Mund bewegte sich, bevor sie ein schwaches »Was« herausbrachte.
»Ich vermute, dass Sie schon eine ganze Weile an Prädiabetes litten. Ihre Cholesterin- und Triglyceridwerte sind extrem erhöht, Ihr Blutdruck ist ein wenig hoch. Die Schwangerschaft und die schnelle Gewichtszunahme – zehn Pfund in neun Wochen ist eine ganze Menge – und zusätzlich Ihre schlechten Essensgewohnheiten, das alles hat die Krankheit dann ausbrechen lassen.«
»Meine erste Schwangerschaft war völlig normal.«
»Sie sind jetzt älter.« Sara gab ihr ein Gazetuch, das sie auf den Finger pressen sollte, um die Blutung zu stoppen. »Ich will, dass Sie gleich morgen früh zu Ihrem Hausarzt gehen. Wir müssen sichergehen, dass da nicht noch was anderes dahintersteckt. Unterdessen müssen Sie Ihren Blutzucker unter Kontrolle halten. Wenn Sie es nicht tun, ist eine Ohnmacht auf dem Parkplatz das kleinste Problem, mit dem Sie sich herumschlagen müssen.«
»Vielleicht ist es nur – ich habe nicht vernünftig gegessen, und …«
Sara ließ sie ihre Ausflüchte nicht beenden. »Alles über eins vierzig ist eine eindeutige Diagnose auf Diabetes. Und Ihr Wert ist seit der ersten Blutabnahme noch leicht gestiegen.«
Faith brauchte eine Weile, um das zu verdauen. »Wird es bleiben?«
Diese Frage konnte nur ein Endokrinologe beantworten. »Sie müssen mit Ihrem Arzt reden und ihn weitere Tests machen lassen«, riet ihr Sara, obwohl sie ihrer fachmännischen Einschätzung nach sagen würde, dass Faith in einer prekären Situation war. Wenn diese Schwangerschaft nicht wäre, würde sie sich als Diabetikerin im Vollstadium darstellen.
Sara schaute auf die Uhr. »Ich würde Sie ja über Nacht zur Beobachtung hierbehalten, aber bis wir Sie offiziell aufgenommen und ein Zimmer für Sie gefunden haben, ist die Praxis Ihres Hausarztes sicher schon geöffnet, und irgendwas sagt mir, dass Sie sowieso nicht hierbleiben würden.« Sie hatte genug Zeit mit Polizeibeamten verbracht, um zu wissen, dass Faith sich aus dem Staub machen würde, sobald sie die Chance dazu bekam.
Sie fuhr fort: »Sie müssen mir versprechen, dass Sie gleich morgen in der Früh Ihren Hausarzt anrufen – und ich meine, gleich als Allererstes. Wir haben hier im Haus eine Krankenschwester, die auch Diabetesberaterin ist, und sie wird Ihnen beibringen, wie Sie selber Ihr Blut testen können und wie und wann Sie sich spritzen müssen, aber Sie müssen diese Sache sofort in Angriff nehmen.«
»Ich muss mir selbst Spritzen verpassen?« Faiths Stimme klang schrill vor Bestürzung.
»Orale Medikamente sind bei Schwangeren nicht angezeigt. Deshalb müssen Sie ja auch mit Ihrem Arzt sprechen. Bei dieser Sache läuft vieles über Ausprobieren. Ihr Gewicht und Ihr Hormonhaushalt werden sich im Verlauf Ihrer Schwangerschaft verändern. Für die nächsten acht Monate wird Ihr Arzt Ihr bester Freund sein.«
Faith wirkte verlegen. »Ich habe keinen Hausarzt.«
Sara nahm einen Rezeptblock zur Hand und schrieb ihr den Namen einer Ärztin auf, mit der sie vor Jahren ihre Assistenzzeit gemacht hatte. »Delia Wallace arbeitet im Emory. Sie ist Spezialistin sowohl für Gynäkologie wie für Endokrinologie. Ich rufe sie noch heute an, damit ihr Büro Sie unterbringen kann.«
Faith schien noch immer nicht so recht überzeugt. »Wie kann ich so was so plötzlich bekommen? Ich weiß, ich habe Gewicht zugelegt, aber ich bin nicht fett.«
»Sie müssen nicht fett sein«, entgegnete Sara, »Sie sind jetzt älter. Das Baby beeinflusst Ihre Hormone, Ihre Fähigkeit, Insulin zu produzieren. Sie ernähren sich nicht gut. Das alles zusammen hat die Krankheit zum Ausbruch kommen lassen.«
»Will ist schuld«, murmelte Faith. »Er isst wie ein Zwölfjähriger. Donuts, Pizza, Hamburger. Er kann in keine Tankstelle gehen, ohne Nachos und einen Hotdog zu kaufen.«
Sara setzte sich wieder auf die Bettkante. »Faith, das ist nicht das Ende der Welt. Sie sind in einer guten Verfassung. Sie haben eine großartige Versicherung. Sie schaffen das.«
»Was, wenn ich …« Sie wurde blass und löste den Blickkontakt mit Sara. »Was, wenn ich nicht schwanger wäre?«
»Wir reden hier nicht von Schwangerschaftsdiabetes. Das ist ein Diabetes im Vollstadium vom Typ zwei. Ein Abbruch würde das Problem nicht einfach verschwinden lassen«, antwortete Sara. »Sehen Sie, das ist etwas, das sich wahrscheinlich schon eine ganze Weile in Ihnen aufgebaut hat. Die Schwangerschaft hat es nur schneller ausbrechen lassen. Am Anfang macht diese Krankheit das Leben etwas komplizierter, aber nicht unmöglich.«
»Ich wollte nur …« Faith schien nicht in der Lage zu sein, einen Satz zu beenden.
Sara tätschelte ihr die Hand und stand auf. »Dr. Wallace ist eine ausgezeichnete Diagnostikerin. Und ich weiß sicher, dass sie die städtische Krankenversicherung akzeptiert.«
»Staatlich«, korrigierte sie Faith. »Ich bin beim GBI.«
Sara nahm an, dass das staatliche Versicherungssystem ähnlich war, aber sie wollte dieses Thema nicht vertiefen. Faith hatte offensichtlich Schwierigkeiten, die Nachricht zu verdauen, und Sara hatte sie ihr nicht gerade schonend beigebracht. Doch Geschehenes konnte man nicht mehr ungeschehen machen. Sara klopfte ihr auf den Arm. »Mary wird Ihnen eine Spritze geben. Sie werden sich gleich besser fühlen.« Sie wandte sich zum Gehen. »Ich meine das ernst, dass Sie Dr. Wallace anrufen sollten«, fügte sie noch mit Nachdruck hinzu. »Ich will, dass Sie gleich morgen früh bei ihr anrufen, und Sie müssen unbedingt mehr essen als nur Krapfen. Kohlenhydratarme, fettarme, regelmäßige, gesunde Mahlzeiten und Obst, okay?«
Faith nickte wortlos, und als Sara den Raum verließ, kam sie sich vor wie ein absoluter Schuft. Ihr Verhalten an der Bettkante hatte sich im Lauf der Jahre eindeutig verschlechtert, aber das hier stellte einen neuen Tiefpunkt dar. War sie denn nicht wegen der im Grady herrschenden Anonymität überhaupt in diese Klinik gekommen? Bis auf eine Handvoll obdachloser Männer und einiger Prostituierter sah sie kaum je einen Patienten mehr als ein Mal. Das war für Sara die Hauptattraktion gewesen – die absolute Distanziertheit. Sie war an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie keine engeren Beziehungen mit Menschen eingehen wollte. Jedes neue Krankenblatt war eine Gelegenheit, um wieder ganz von vorn anzufangen. Wenn Sara Glück hatte – und wenn Faith Mitchell auf sich achtete –, würden die beiden sich wahrscheinlich nie wiedersehen.
Anstatt ins Ärztezimmer zurückzugehen, um an ihren Krankenakten weiterzuarbeiten, ging Sara an der Schwesternstation vorbei und durch die Doppeltür in den überfüllten Wartebereich und befand sich schließlich draußen vor der Tür. Am Ausgang standen ein paar Atemtherapeuten und rauchten Zigaretten, Sara ging deshalb weiter zur Rückseite des Gebäudes. Das schlechte Gewissen wegen Faith Mitchell lastete auf ihr, und sie blätterte zu Delia Wallaces Nummer in ihrem Handyverzeichnis, bevor sie vergessen würde, ihr Versprechen zu erfüllen. Der Telefondienst nahm ihre Nachricht über Faith entgegen, und Sara fühlte sich etwas besser, als sie den Anruf beendete.
Vor zwei Monaten war ihr Delia Wallace zufällig über den Weg gelaufen, als die Frau hier einen ihrer wohlhabenden Patienten besuchte, der nach einem schlimmen Autounfall mit dem Hubschrauber ins Grady gebracht worden war. Delia und Sara waren die einzigen Frauen unter den besten fünf Prozent ihrer Abschlussklasse an der Emory University Medical School gewesen. Zu der Zeit war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass es für Ärztinnen nur zwei Spezialisierungsmöglichkeiten gab: Gynäkologie oder Pädiatrie. Delia hatte sich für Ersteres entschieden, Sara für Letzteres. Beide würden sie nächstes Jahr vierzig Jahre alt werden. Delia schien alles zu haben. Sara kam sich vor, als hätte sie nichts.
Die meisten Ärzte – Sara eingeschlossen – waren bis zu einem gewissen Grad arrogant, aber Delia war schon immer eine sehr eifrige Selbstdarstellerin gewesen. Als sie im Ärztezimmer Kaffee tranken, ließ Delia sich über die Höhepunkte ihres Lebens aus: zwei gut gehende Praxen, einen Aktienhändler als Ehemann, drei Überflieger-Kinder. Sie hatte Sara Bilder von ihnen allen gezeigt, von dieser ihrer perfekten Familie, die aussah wie direkt aus einer Ralph-Lauren-Werbung.
Sara hatte Delia nichts von ihrem Leben nach dem Studium erzählt, dass sie ins Grant County, in ihr Zuhause, zurückgekehrt war und sich um Kinder in ländlichen Gegenden kümmerte. Sie erzählte Delia nichts von Jeffrey oder warum sie nach Atlanta zurückgekehrt war oder warum sie im Grady arbeitete, obwohl sie doch eine eigene Praxis eröffnen und so etwas wie ein normales Leben führen könnte. Sara hatte einfach nur die Achseln gezuckt und gesagt: »Ich bin hier gelandet«, und Delia hatte sie enttäuscht und zugleich selbstgerecht angeschaut, beide Regungen wohl ausgelöst von der Tatsache, dass Sara in ihrer ganzen Zeit an der Emory University immer besser gewesen war als Delia.
Sara steckte die Hände in die Taschen und zog ihren dünnen Mantel gegen die Kälte zusammen. Den Brief spürte sie an ihrem Handrücken, als sie an der Laderampe vorbeiging. Heute Morgen hatte sie sich bereit erklärt, eine Zusatzschicht zu übernehmen, und hatte volle sechzehn Stunden durchgearbeitet, damit sie morgen den ganzen Tag freinehmen konnte. Die Erschöpfung traf sie nun so heftig wie die kühle Nachtluft, und sie stand mit den Fäusten in den Taschen einfach nur da und genoss die relativ saubere Luft in ihren Lungen. Durch den Abgasgestank und die Gerüche, die aus dem Müllcontainer kamen, roch sie eine Andeutung von Regen. Vielleicht konnte sie heute Nacht schlafen. Wenn es regnete, schlief sie immer besser.
Sie schaute hinunter auf die Autos auf der Interstate. Die Stoßzeit ging eben zu Ende – Männer und Frauen, die heimkehrten zu ihren Familien, zu ihrem Privatleben. Sara stand an der Grady Curve, wie dieses Stück genannt wurde, eine Biegung in der Autobahn, die Verkehrsreporter als Aussichtspunkt benutzten, wenn sie über Probleme auf der Hauptader in die Innenstadt berichteten. Alle Rücklichter leuchteten tiefrot, als ein Abschleppwagen einen liegen gebliebenen Geländewagen vom linken Bankett zog. Streifenwagen blockierten den Schauplatz, blaue Lichter blinkten und warfen ihr gespenstisches Licht in die Dunkelheit. Das erinnerte sie an den Abend, als Jeffrey gestorben war – zuerst die Horden von Polizisten, dann die staatlichen Beamten, und überall Männer in weißen Schutzanzügen und Stiefeln, die den Tatort durchkämmten.
»Sara?«
Sie drehte sich um. Mary stand in der offenen Tür und winkte sie ins Gebäude. »Schnell!«
Sara lief auf die Tür zu, und Mary rief ihr die wichtigsten Infos zu. »Unfall mit einem Fahrzeug und Fußgänger. Krakauer hat Fahrer und Beifahrer übernommen, bei Fahrer Verdacht auf Myokardinfarkt. Sie haben die Frau, die vom Auto angefahren wurde. Offene Frakturen an rechtem Arm und rechtem Bein, vor Ort ohne Bewusstsein. Verdacht auf sexuelle Misshandlung und Folter. Helfer vor Ort war zufällig Rettungssanitäter. Hat getan, was er konnte, sieht aber schlecht aus.«
Sara war sicher, dass sie das missverstanden hatte. »Sie wurde vergewaltigt und von einem Auto angefahren?«
Mary ging nicht näher darauf ein. Ihre Hand lag wie ein Schraubstock um Saras Arm, als sie den Gang hinunterliefen. Die Tür zum Notfall-Aufnahmezimmer stand offen. Sara sah die Rollbahre und drei Sanitäter, die die Patienten umringten. Ebenfalls im Raum stand Will Trent, der sich über die Frau beugte und versuchte, sie zu befragen.
»Können Sie mir Ihren Namen nennen?«, fragte er.
Sara blieb am Fuß der Bahre stehen, Marys Hand noch an ihrem Arm. Die Patientin lag auf der linken Seite in Embryonalhaltung. Bänder fixierten sie auf der Bahre, pneumatische Schienen stabilisierten Arm und Bein der rechten Seite. Sie war wach, ihre Zähne klapperten, sie murmelte etwas Unverständliches. Unter ihrem Kopf lag eine zusammengerollte Jacke, eine Halskrause stabilisierte den Nacken. Die rechte Seite ihres Gesichts war mit Dreck und Blut verklebt, Isolierband hing ihr von der Wange und klebte in ihren dunklen Haaren. Ihr Mund war offen, die Lippen zerschnitten und blutig. Das Tuch, mit dem die Sanitäter sie zugedeckt hatten, war heruntergezogen, und an der Seite ihrer Brust klaffte eine so tiefe Wunde, dass leuchtend gelbes Fettgewebe zu sehen war.
»Ma’am?«, fragte Will. »Sind Sie sich Ihres Zustands bewusst?«
»Gehen Sie weg«, befahl Sara und schob ihn resoluter zurück, als sie beabsichtigt hatte. Er stolperte, kämpfte ums Gleichgewicht. Sara war es egal. Sie hatte den kleinen Digitalrekorder in seiner Hand gesehen, und es gefiel ihr nicht, was er hier tat.
Sara zog ein Paar Gummihandschuhe an, als sie sich hinkniete und zu der Frau sagte: »Ich bin Dr. Linton. Sie sind im Grady Hospital. Wir kümmern uns um Sie.«
»Hilfe … Hilfe … Hilfe«, flehte die Frau, und ihr Körper zitterte so heftig, dass die Bahre klapperte. Ihre Augen starrten stumpf ins Leere. Sie war entsetzlich dünn, ihre Haut schuppig und trocken. »Hilfe.«
Sara strich ihr so sanft über die Haare, wie sie konnte. »Wir haben hier sehr viele Leute, und wir werden Ihnen helfen. Aber Sie müssen bei mir bleiben, okay?« Sara stand auf und legte der Frau leicht die Hand auf die Schulter, um sie wissen zu lassen, dass sie nicht allein war. Zwei weitere Pfleger standen in dem Zimmer und erwarteten Anordnungen. »Zustand?«
Sie hatte die Frage an die uniformierten Rettungssanitäter gerichtet, aber der Mann ihr gegenüber fing an zu reden und ratterte in hektischem Stakkato die Vitalfunktionen der Frau und die unterwegs erstellte Diagnose herunter. Er trug Straßenkleidung, die blutbeschmiert war. Wahrscheinlich derjenige, der vor Ort Erste Hilfe geleistet hatte. »Durchdringende Wunde zwischen der elften und der zwölften Rippe. Offene Frakturen rechter Arm und rechtes Bein. Stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf. Sie war bewusstlos, als wir ankamen, kam aber zu Bewusstsein, während ich an ihr arbeitete. Wir konnten sie nicht flach auf den Rücken legen«, erklärte er, und nun lag Panik in seiner Stimme. »Sie schrie die ganze Zeit. Wir mussten sie ins Fahrzeug bringen, deshalb schnallten wir sie einfach fest. Ich weiß nicht, was los ist mit … Ich weiß nicht, was …«
Er unterdrückte ein Schluchzen. Seine Angst war ansteckend. Die Luft war wie aufgeladen mit Adrenalin, verständlich beim Zustand des Opfers. Auch Sara spürte Panik in sich aufkeimen. Sie fühlte sich kaum in der Lage, die Schädigungen zu beurteilen, die dieser Körper erlitten hatte, die vielen Wunden, die offensichtlichen Folterspuren. Mehr als eine Person im Zimmer hatte Tränen in den Augen.
Sara bemühte sich, so ruhig wie möglich zu sprechen, die Hysterie auf ein beherrschbares Niveau zu senken. Sie entließ die Rettungssanitäter und den Helfer mit den Worten: »Vielen Dank, meine Herren. Sie haben alles getan, was Sie konnten, nur um sie hierherzubringen. Bitte verlassen Sie jetzt den Raum, damit wir Platz haben, um ihr zu helfen.« Zu Mary sagte sie: »Legen Sie eine Infusion und bereiten Sie für alle Fälle einen zentralen Zugang vor.« Einem der Pfleger sagte sie: »Besorgen Sie ein fahrbares Röntgengerät, benachrichtigen Sie die CT und rufen Sie den diensthabenden Chirurgen.« Und zum andern: »Blutgase, Tox Screen, CMO, Blutbild und Gerinnung.«
Behutsam drückte Sara der Frau das Stethoskop auf den Rücken und versuchte, sich nicht auf die Verbrennung und die kreuz und quer laufenden Schnitte im Fleisch zu konzentrieren. Sie horchte die Lunge der Frau ab und spürte dabei die scharfe Kante einer Rippe unter ihren Fingern. Die Atemgeräusche waren gleichmäßig, aber nicht so stark, wie Sara es gern gehabt hätte, wahrscheinlich wegen der extrem hohen Morphindosis, die man ihr im Krankenwagen gegeben hatte. Panik verwischte oft die Grenze zwischen Helfen und Behindern.
Sara kniete sich wieder hin. Die Augen der Frau waren noch immer offen, die Zähne klapperten. Sara sagte zu ihr: »Wenn Sie Atemprobleme haben, sagen Sie mir Bescheid, ich helfe Ihnen dann sofort. Okay? Können Sie das tun?« Es kam keine Antwort, aber Sara redete trotzdem weiter, kündigte jeden Schritt an, den sie tat, und warum sie ihn tat. »Ich untersuche Ihre Luftwege, um sicherzustellen, dass Sie weiteratmen können«, sagte sie und drückte ihr sanft den Unterkiefer nach unten. Die Zähne der Frau waren rötlich verfärbt, was auf Blut in ihrem Mund hindeutete, aber Sara nahm an, dass sie sich lediglich auf die Zunge gebissen hatte. Tiefe Kratzspuren bedeckten ihr Gesicht, als hätte jemand sie mit den Fingernägeln bearbeitet. Sara vermutete, dass man sie intubieren und in ein künstliches Koma versetzen musste. Deshalb war jetzt die letzte Gelegenheit für die Frau zu sprechen.
Das war der Grund, warum Will Trent nicht gehen wollte. Er hatte das Opfer nach seinem Zustand befragt, um den Rahmen für eine Erklärung am Sterbebett zu setzen. Das Opfer musste wissen, dass es im Sterben lag, damit seine letzten Worte vor Gericht als Aussage zugelassen wurden, die nicht nur Hörensagen war. Auch jetzt stand Trent da und lauschte aufmerksam jedem Wort, das gesprochen wurde. Er fungierte als Zeuge der Situation, für den Fall, dass er vor Gericht aussagen musste.
Sara fragte: »Ma’am? Können Sie mir Ihren Namen nennen?« Sara hielt inne, weil der Mund der Frau sich bewegte, aber es kamen keine Wörter heraus. »Nur den Vornamen, okay? Fangen wir mit etwas Einfachem an.«
»Ah … ah …«
»Anne?«
»Nah … nah …«
»Anna?«
Die Frau schloss die Augen und nickte leicht. Ihre Atmung war durch die Anstrengung noch flacher geworden.
Sara versuchte es weiter. »Wie wär’s mit einem Familiennamen?«
Die Frau antwortete nicht.
»Okay, Anna. Ist gut so. Bleiben Sie einfach bei mir.« Sara schaute zu Will Trent hinüber. Er nickte zum Dank. Sie wandte sich wieder der Patientin zu, kontrollierte ihre Pupillen und tastete den Schädel ab auf der Suche nach Brüchen. »Sie haben Blut in den Ohren, Anna. Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen.« Sara nahm eine feuchte Kompresse und wischte der Frau das Gesicht ab, um etwas von dem getrockneten Blut zu entfernen. »Ich weiß, dass Sie noch da sind, Anna. Bleiben Sie einfach bei mir.«
Behutsam fuhr Sara mit den Fingern über Hals und Schultern und spürte, dass das Schlüsselbein sich bewegte. Sie tastete weiter nach unten und vorsichtig die Schultern hinten und vorn ab und dann das Rückgrat. Die Frau war stark unterernährt, die Knochen zeichneten sich deutlich ab, man konnte förmlich das ganze Skelett sehen. Die Haut zeigte Risse, als hätte man Haken oder Stacheln ins Fleisch gesteckt und wieder herausgerissen. Oberflächliche Schnitte bedeckten den ganzen Körper, und der tiefe Einschnitt in der Brust roch bereits septisch; offensichtlich war sie seit Tagen in diesem Zustand.
Mary sagte: »Infusion liegt, Kochsalz läuft.«
Sara fragte Will Trent: »Sehen Sie das Ärzteverzeichnis dort neben dem Telefon?« Er nickte. »Piepsen Sie Phil Sanderson an. Sagen Sie ihm, wir brauchen ihn hier sofort.«
Er zögerte. »Ich suche ihn lieber selbst.«
Mary bemerkte: »Anpiepsen geht schneller. Nebenstelle 392.« Sie klebte eine Schleife des Infusionsschlauchs auf den Handrücken der Frau und fragte Sara: »Wollen Sie noch mehr Morphium an Bord?«