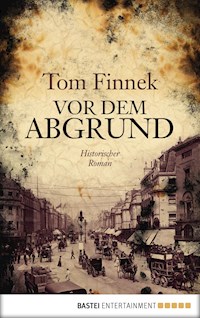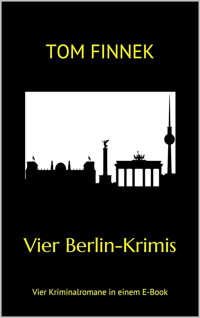4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Münsterland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der zweite Fall für den westfälischen Sturkopf Heinrich Tenbrink und seinen Partner Maik Bertram!
Auf einer Parkbank im Münsterland bricht ein Mann zusammen. An seiner Schläfe klafft eine blutige Wunde. Der Frau, die ihm helfen möchte, flüstert er die Worte "toter Bauer" zu - und stirbt.
Oberkommissar Maik Bertram vermutet zunächst, dass der Mann das Opfer eines tödlichen Liebes- oder Eifersuchtsdramas geworden ist. Aber was haben die letzten Worte des Toten zu bedeuten? Ohne die Hilfe Heinrich Tenbrinks, der sich von einem Schädelbasisbruch erholt und mit immer stärkeren Erinnerungslücken zu kämpfen hat, tritt er bald auf der Stelle. Also wendet er sich an seinen ehemaligen Partner und sofort meldet sich Tenbrinks untrügliches Bauchgefühl: Könnten die Worte des Sterbenden einen ganz anderen Sinn haben? Bertram und Tenbrink arbeiten wieder als Team und schon bald führen sie ihre Ermittlungen zu alten Familiengeheimnissen, einem weiteren rätselhaften Todesfall und zu einer ehemaligen Knochenmühle. Gleichzeitig kämpfen die Kommissare mit ihrer eigenen Vergangenheit und stoßen auf Dinge, die besser für immer unentdeckt geblieben wären ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitat
Erster Teil
Damals
1
2
Zweiter Teil
Heute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dritter Teil
Damals
1
2
Vierter Teil
Heute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fünfter Teil
Damals
1
2
Sechster Teil
Heute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Siebter Teil
Damals
1
2
Achter Teil
Heute
1
2
3
4
5
6
7
Neunter Teil
Damals
1
2
Zehnter Teil
Heute
1
2
3
4
5
6
Letzter Teil
Später
1
2
Hat es Ihnen gefallen?
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Der zweite Fall für den westfälischen Sturkopf Heinrich Tenbrink und seinen Partner Maik Bertram!
Auf einer Parkbank im Münsterland bricht ein Mann zusammen. An seiner Schläfe klafft eine blutige Wunde. Der Frau, die ihm helfen möchte, flüstert er die Worte »toter Bauer« zu – und stirbt.
Oberkommissar Maik Bertram vermutet zunächst, dass der Mann das Opfer eines tödlichen Liebes- oder Eifersuchtsdramas geworden ist. Aber was haben die letzten Worte des Toten zu bedeuten? Ohne die Hilfe Heinrich Tenbrinks, der sich von einem Schädelbasisbruch erholt und mit immer stärkeren Erinnerungslücken zu kämpfen hat, tritt Bertram bald auf der Stelle. Also wendet er sich an seinen ehemaligen Partner und sofort meldet sich Tenbrinks untrügerisches Bauchgefühl: Könnten die Worte des Sterbenden einen ganz anderen Sinn haben? Bertram und Tenbrink arbeiten wieder als Team und schon bald führen sie ihre Ermittlungen zu alten Familiengeheimnissen, einem weiteren rätselhaften Todesfall und zu einer ehemaligen Knochenmühle. Gleichzeitig kämpfen die Kommissare mit ihrer eigenen Vergangenheit und stoßen auf Dinge, die besser für immer unentdeckt geblieben wären …
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Über den Autor
Tom Finnek wurde 1965 im Münsterland geboren und arbeitet als Filmjournalist, Drehbuchlektor und Schriftsteller. Er ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und lebt mit seiner Familie in Berlin. Sowohl unter dem Pseudonym Tom Finnek als auch unter seinem richtigen Namen, Mani Beckmann, hat er bereits zahlreiche Krimis veröffentlicht. Zu seinen größten Erfolgen gehören neben der historischen Moor-Trilogie die London-Romane »Unter der Asche«, »Gegen alle Zeit« und »Vor dem Abgrund«.
TOM FINNEK
TOTENBAUER
Münsterland-Krimi
beTHRILLED
Originalausgabe
beTHRILLED in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2018/2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: schankz | Artem PEREBYINIS | Mimadeo
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-4788-3
be-thrilled.de
lesejury.de
»Lass ruh'n den Stein, er trifft dein eigen Haupt.«
Annette von Droste-Hülshoff, »Die Judenbuche«
Erster Teil
Damals
1
Was für ein Reinfall! Was für eine grandiose Zeitverschwendung! Dies war vermutlich der langweiligste und blödeste Urlaub seit der Erfindung der Sommerferien. Daniel hasste seine Eltern dafür, dass sie ihn überredet hatten, gemeinsam mit ihnen und den Große-Daltrups nach Kreta zu fliegen. Nun war er fast drei Wochen lang gezwungen gewesen, in einem schicken, aber verschnarchten Beach Resort am Sandstrand der Nordwestküste abzuhängen und sich zu Tode zu langweilen.
Eigentlich hatte er die Ferien zusammen mit seinen Schulfreunden in einem Jugendlager auf der Nordseeinsel Langeoog verbringen wollen, aber dummerweise hatte er die Anmeldefrist verpasst: Als er die Reise hatte buchen wollen, waren alle Plätze schon belegt gewesen. Anschließend hatte er noch andere Alternativen in Betracht gezogen. Statt mit den Eltern in Urlaub zu fahren, wäre er lieber auf eigene Faust nach London gefahren, wo gerade die Olympischen Spiele stattfanden, oder allein zu Hause geblieben, um die »sturmfreie Bude« auszukosten. Aber sein Vater hatte das strikt untersagt. London sei während Olympia ohnehin völlig ausgebucht, und die sturmfreie Bude komme erst recht nicht infrage. Dann könne er das Haus gleich selbst in Schutt und Asche legen, hatte er gemeint und ums Verrecken nicht mit sich reden lassen.
Schließlich hatte seine Mutter den Vorschlag gemacht, gemeinsam nach Griechenland zu fliegen: Immerhin seien es die letzten Sommerferien vor Daniels Abi - ein letzter Familienurlaub, bevor es ihn »in die weite Welt« hinausziehen würde. So spießig und altmodisch, wie Daniel immer behaupte, seien die Große-Daltrups gar nicht, hatte sein Vater hinzugefügt. Nur weil die Eltern manchmal Plattdeutsch redeten, heiße das nicht, dass sie Hinterwäldler seien. Außerdem sei ja auch Johnny mit von der Partie.
Johnny war der Sohn der Große-Daltrups. Er hieß eigentlich Johannes und war genauso alt wie Daniel. Sie waren Nachbarskinder, hatten aber außer diesem zufälligen Umstand und der gemeinsamen Grundschulzeit so gut wie keine Schnittmengen. Während Daniel aufs Gymnasium ging, hatte Johnny die Realschule besucht und war anschließend auf die Handelsschule gewechselt, um später einmal im Landmaschinenhandel des Vaters zu arbeiten und dieses Geschäft irgendwann zu übernehmen. Johnny war zwar ein Pedant und Langweiler, aber zumindest kein völliger Schwachkopf, auch wenn die Tatsache, dass er aus freien Stücken die Sommerferien mit seinen Eltern verbrachte, dieser Einschätzung fundamental widersprach. Für Daniel war es allerdings ein bis dato ungelöstes Rätsel, weshalb seine Eltern ihren Sommerurlaub ausgerechnet mit den Große-Daltrups verbringen wollten. Angeblich hatte sein Vater mit der Hilfe des Nachbarn irgendein lukratives Geschäft gemacht, das nun mit einem gemeinsamen Urlaub gefeiert werden sollte.
Johnny und seine Eltern waren jedoch nicht der Grund dafür, dass dieser Urlaub sich als ein Fiasko erwiesen hatte. Es war das verdammte Beach Resort … mehr noch, der gesamte verfluchte Urlaubsort, der Daniel auf die Nerven ging! Horrorpolis, wie er das Dorf insgeheim nannte, war ein einziger Albtraum. In der luxuriösen Hotelanlage, die für die Große-Daltrups eigentlich ein bisschen zu kostspielig war, wohnten nur wohlbetuchte Rentner und Scheintote, für die einst der «Tanztee« als größtmögliche Vergnügung erfunden worden war. Und das Kaff selbst - einst ein Fischerdorf, das inzwischen aber mit hässlichen Hotels, Tavernen und Apartmentblöcken zugepflastert war - hatte den Charme einer vorstädtischen Fußgängerzone und lag direkt an der vielbefahrenen Landstraße zwischen Rethymnon und Chania. Beton, Asphalt, Mauerwerk und Pflastersteine, so weit das Auge reichte. Vom ursprünglichen dörflichen Flair war nichts übrig geblieben.
Am schlimmsten aber waren die Leute, die hier Urlaub machten. Entweder waren es russische All-Inclusive-Idioten, die zwar viel Geld, aber keinen Benimm hatten und sich unentwegt wie Neandertaler aufführten, oder englische Proleten, die sich in ihren britisch geführten Pubs mit holländischem Bier betranken und grölend durch die Straßen oder über den Strand wankten. Am Wochenende gesellten sich noch die griechischen Großfamilien aus den umliegenden Städten dazu, die in Schwärmen die schönsten Plätze an der Küste besetzten und sie anschließend als Müllhalden zurückließen. Dass es in den Clubs und Bars regelmäßig zu Schlägereien und Randale kam, lag beinahe auf der Hand. Es war zum Kotzen!
Daniels schlechte Laune hatte aber auch damit zu tun, dass es in Horrorpolis einfach keine coolen oder interessanten Mädchen gab. Jedenfalls keine, die ihrerseits einen siebzehnjährigen deutschen Touristen toll fanden, der obendrein in Begleitung seiner Eltern war. Sowohl die Russen als auch die Engländer blieben grundsätzlich unter sich, bildeten regelrechte Wagenburgen um ihre Frauen und Mädchen, und die deutschen Zombies in den Rentner-Resorts hatten in den seltensten Fällen ihre hübschen Enkelinnen im Gepäck. An Backpacker-Touristinnen war schon gar nicht zu denken: Die waren allesamt an der felsigen Südküste Kretas unterwegs, wo der Pauschal- und All-Inclusive-Tourismus, allein schon wegen der beschwerlichen Anfahrt über die Berge, noch nicht so um sich gegriffen hatte. Kurzum, außer einem kurzen Flirt mit einer deutschen Kellnerin, die er am nächsten Tag in den Armen ihres griechischen Chefs wiedergesehen hatte, war Daniel ohne einen nennenswerten Kontakt zum anderen Geschlecht geblieben.
Und was die Sache noch schlimmer machte: Seitdem seine Freundin ihn vor vier Monaten wegen eines fünf Jahre älteren Jura-Studenten aus Münster verlassen hatte, lebte er wie ein verdammter Mönch, und eigentlich hatte er sich fest vorgenommen, in diesem Urlaub etwas daran zu ändern. Pustekuchen!
Doch bald würde dieser Albtraum enden, denn heute war ihr letzter Abend auf der Insel. Als es auf Mitternacht zuging, lungerten Johnny und er an der Strandpromenade herum, tranken Bier und beobachteten die Engländer, die mit bedröppelten Gesichtern und in volltrunkenem Zustand über das Pflaster torkelten. Die britische Fußballmannschaft war soeben beim Olympiaturnier sensationell im Viertelfinale gegen Südkorea ausgeschieden, und nun wehten über den Pubs, wo das Spiel natürlich in dröhnender Lautstärke übertragen worden war, die Union Jacks quasi auf Halbmast. Sehr zur Schadenfreude der Russen, deren Team sich allerdings erst gar nicht für Olympia qualifiziert hatte. Was sie nicht davon abhielt, die Engländer mit hämischen Gesängen zu verhöhnen. Vermutlich würde es heute Nacht wieder Randale geben.
»Lass uns zurückgehen«, sagte Johnny und warf seine leere Bierdose in einen bereits randvoll gefüllten Mülleimer. »Passiert doch eh nichts mehr.«
»Noch ein Bier im ›Happy Days‹? Ist doch unser letzter Abend.«
»Gibt sowieso nur wieder Stunk mit den Engländern. Außerdem geht unser Flug um acht. In ein paar Stunden müssen wir schon wieder aufstehen.«
»Wir können ja im Flugzeug schlafen«, meinte Daniel, zuckte dann aber mit den Schultern. »Wahrscheinlich hast du recht. Vielleicht kriegen wir noch was in der Hotelbar.«
»Die ist doch längst zu«, entgegnete Johnny und gähnte. »Strand oder Straße?«
»Hab heute keinen Bock, über die Felsen zu kraxeln.« Daniel deutete zur Straße. »Geht schneller.«
Das Beach Resort lag etwa anderthalb Kilometer vom Dorfkern entfernt, und auf dem Weg dorthin sprachen weder Daniel noch Johnny ein Wort. Dafür machten die Singzikaden einen Heidenlärm. Kein Mensch war auf der Straße unterwegs, und nur selten rauschte ein Wagen an ihnen vorbei. Es war ziemlich dunkel, weil das Gebiet zwischen Ortsrand und Hotelanlage kaum bebaut und deshalb nur spärlich beleuchtet war. Als sie etwa fünfhundert Meter vom Hotel entfernt waren, hörten sie auf einmal ein seltsames Würgen aus den Büschen neben der Straße. Es war sogar lauter als das Zirpen der Zikaden. Die beiden schauten sich überrascht an und blieben stehen.
»Was ist das?«, fragte Johnny.
»Da kotzt einer«, antwortete Daniel, dem solche Geräusche nicht unvertraut waren.
»Quatsch!«
Doch Daniel hatte recht, wie sich im nächsten Augenblick herausstellte.
Plötzlich torkelte vor ihnen ein vielleicht sechzehnjähriges Mädchen aus den Büschen, wischte sich mit dem Ärmel ihrer Sweatjacke über den Mund und spuckte auf den Boden. Die Kleine fuhr erschrocken zusammen, als sie aufblickte und die beiden Jungs vor sich stehen sah. »Fuck!«, rief sie, taumelte zurück ins Gebüsch und kippte hinter den Sträuchern um. Hart landete sie auf dem Rücken. Beim Versuch, sich wieder aufzurappeln, fiel sie zur Seite und blieb auf dem sandigen Boden liegen.
Die beiden Jungs gingen zu ihr hin.
»Ach, du Scheiße!«, rief Daniel und lachte erschrocken auf.
»Was ist denn mit der los?«
»Was soll sein? Die ist hackendicht.«
»Krass! Und was machen wir jetzt?«
»Wieso? Was sollen wir machen?«, antwortete Daniel grinsend. »Ausgekotzt hat sie sich ja schon. Die schläft jetzt ihren Rausch aus, und gut ist.«
»Wir können die doch nicht einfach so liegen lassen«, meinte Johnny, bückte sich über die reglose Gestalt und begann, die Taschen der Sweatjacke zu durchsuchen. »So nah an der Straße.«
»Solange sie nicht auf der Straße liegt …«, erwiderte Daniel achselzuckend. »Oder hast du 'ne bessere Idee?«
»Allerdings!« Johnny reichte Daniel einen Schlüssel, den er aus einer der Taschen gefischt hatte. Auf dem Schlüsselanhänger stand »Zeus 3«.
Die »Zeus Studios« waren eine Ansammlung einstöckiger Bungalows gleich neben dem Beach Resort. Diese heruntergewirtschafteten Unterkünfte der billigsten Touristenklasse wirkten seltsam deplatziert neben der noblen Hotelanlage: wie eine Leprasiedlung vor den Toren einer florierenden Stadt.
»Du willst die doch wohl nicht etwa bis dahin schleppen?«, fauchte Daniel und zeigte Johnny einen Vogel. »So betrunken, wie die ist, kriegt die ja keinen Fuß mehr vor den anderen.«
»Dann tragen wir sie eben«, antwortete Johnny ungerührt und fasste das Mädchen, das undeutlich vor sich hinbrabbelte, unter den Achseln. »Wir sind immerhin zu zweit, und die ist so spindeldürr, dass das kein Problem sein sollte.«
»Ich fasse es nicht«, knurrte Daniel, half Johnny aber dennoch, das Mädchen hochzuhieven und halbwegs in der Senkrechten zu halten. »Mann, wie die stinkt!«, maulte er. »Die hat sich selbst angekotzt.«
»Sie ist rückwärts in die eigene Kotze gefallen«, verbesserte Johnny ihn und deutete auf den Rücken des Mädchens, der mit Erbrochenem verschmiert war.
Jetzt war es Daniel, der »Fuck!« rief.
2
Mit vereinten Kräften und unter Ausstoß zahlreicher Flüche, die zunehmend unflätiger wurden, schafften sie es, das Mädchen bis zum Anfang der »Zeus Studios« zu schleppen. Die beiden mussten dann die Kleine tatsächlich an Armen und Beinen packen und sie die letzten Meter tragen, weil sie vollends das Bewusstsein verlor und keine eigenen Schritte mehr machen konnte. Schließlich hatten sie den Bungalow Nummer drei erreicht und setzten ihre Fracht vor der Tür ab. Ein Bewegungsmelder ließ eine blanke Glühbirne über der Tür aufleuchten. Daniel schaute an sich hinab und rümpfte die Nase. Er war völlig verschwitzt und stank nun ebenfalls nach Kotze.
»Lass uns gehen!«, sagte er schnaufend und stützte sich mit den Händen auf den Oberschenkeln ab. »Wenn die morgen aufwacht, wird sie die paar Schritte ins Bett auch allein kriechen können.«
»Wir bringen sie rein«, widersprach Johnny.
»Und wenn die nicht allein in dem Bungalow wohnt?«
»Das werden wir ja gleich sehen.« Johnny ging zur Tür, öffnete mit dem Schlüssel und rief: »Hallo? Kalispera! Ist da jemand? Anybody home?« Als niemand antwortete, drehte er sich zu Daniel um und sagte: »Siehste!«
Auf der Straße, die nur ein paar Meter von dem Bungalow entfernt war, hielt in diesem Augenblick ein Auto. Eine Fensterscheibe surrte, und eine Frau fragte aus dem unbeleuchteten Inneren: »Alles in Ordnung bei euch? Braucht ihr Hilfe?«
»Ja, alles in Ordnung«, antwortete Daniel und hob abwehrend die Hand. »Sie hat nur zu viel getrunken. Alles okay! Danke!«
»Verstehe!« Wieder surrte das Fenster, und das Auto verschwand in der Dunkelheit.
Ein wenig verblüfft fragte sich Daniel, ob sie so auffallend teutonisch aussahen, dass man sie in Griechenland automatisch auf Deutsch ansprach. Dann schaute er auf Johnnys Outfit – ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit der Nummer sieben und dem Namen »Schweinsteiger« auf dem Rücken – und lachte.
»Was ist so lustig?«, wollte Johnny wissen.
»Nichts«, antwortete Daniel und fasste das bewusstlose Mädchen an den Fußknöcheln. »Nimm du den Oberkörper! Und dann rein mit ihr.«
Sie schleppten das Mädchen in einen Vorraum und von dort ins angrenzende Zimmer. An der Wand stand ein Doppelbett, auf dem sich jedoch nur eine Garnitur Bettwäsche befand. Mit letzter Kraft brachten sie das Mädchen zur Bettkante, ließen den Oberkörper in die Kissen fallen und hievten die Beine hoch.
»Sollten wir nicht einen Arzt rufen?« Johnny schaltete die Lampe auf dem Nachttisch an. »Die ist ja bleich wie ein Gespenst.«
»Spinnst du?« Daniel tippte sich an die Stirn. »Nur weil sie betrunken ist? Die hat morgen bloß einen Kater und 'nen ordentlichen Filmriss. Davon stirbt man nicht.« Er schaute sich in dem Zimmer um und verzog angewidert das Gesicht. Der Raum war eine einzige Müllhalde; überall lagen leere Bierflaschen, Zigarettenkippen, Essensreste und Verpackungsabfall herum. Auch die Klamotten des Mädchens waren im ganzen Zimmer verstreut, obwohl es einen Kleiderschrank gab. Dessen Türen standen offen, darin gähnende Leere.
»Hier stinkt's!«, rief Johnny und öffnete die gläserne Verandatür auf der anderen Seite des Zimmers. »Kein Wunder, so wie's hier aussieht! Wie kann man nur so hausen? Scheint 'ne ziemliche Schlampe zu sein.« Er ging zum Rucksack, der auf dem Boden lag, nahm den Gepäckaufkleber in Augenschein und buchstabierte laut das Kürzel für den Abflughafen: »L.T.N.« Er wandte sich an Daniel und fragte: »Wofür steht denn das?«
»Luton. In der Nähe von London.«
»Engländerin«, sagte Johnny und lachte. »Das erklärt einiges.«
Zum ersten Mal, seitdem sie das Mädchen am Straßenrand aufgegabelt hatten, betrachtete Daniel es genauer. Eigentlich ganz niedlich, die Kleine! Blondierte, schulterlange Haare, ein Nasenpiercing, jede Menge Sommersprossen und wild wuchernde rötliche Augenbrauen. Allerdings war das Mädchen dürr wie ein Gerippe. Magersüchtig oder auf Drogen, tippte Daniel und zog ihr mit etwas Mühe die stinkende Sweatjacke aus. Darunter kam ein weißes Tanktop mit einem Union Jack auf der Brust zum Vorschein.
»Was machst du da?«, fragte Johnny und zog den bis zum Boden reichenden Vorhang vor die offene Verandatür.
»Willst du sie etwa in ihren verkotzten Klamotten liegen lassen?«, entgegnete Daniel und warf die Jacke neben das Bett. Ein seltsames Kribbeln fuhr ihm über den Rücken und den Nacken. Dann griff er nach dem Tanktop.
»He!« Johnny stellte sich auf die andere Seite des Bettes. »Was soll das? Die Unterwäsche ist doch gar nicht dreckig!«
Doch Daniel hatte dem Mädchen das Top bereits über Kopf und Arme gezogen und betrachtete die kleinen, etwa mandarinengroßen Brüste, deren Warzen seltsam blass und nach innen gewölbt waren. Daniel spürte, wie sich etwas in seiner Hose regte, und bevor er wusste, was er tat, griff er nach der rechten Brust des Mädchens und fuhr mit den Fingern über den weichen Nippel. Es fühlte sich gut an.
»Lass den Scheiß!« Johnny lief ums Bett herum. »Bist du bescheuert?!«
»Wieso? Was ist denn daran so schlimm?«, antwortete Daniel und lachte abfällig. »Davon merkt die doch gar nichts.« Er spürte, wie sein Herz raste und sich ein Kloß in seinem Hals bildete.
»Eben drum. Die ist ohnmächtig. Das ist doch pervers!«
»Reg dich ab!« Daniel räusperte sich und nahm zögerlich die Hand von der Brust. »Zieh ihr lieber die Schuhe aus!«
»D-die Schuhe?«, stammelte Johnny. »Ach so, die Schuhe. Meinetwegen.«
Während Johnny dem Mädchen die Chucks auszog, griff Daniel nach dem Bund der Leggings und schob die Hose nach unten.
»Verdammt!«, protestierte Johnny. »Hör auf mit dem Mist!«
»Die Hose stinkt auch nach Kotze«, behauptete Daniel. »Jetzt mach hier keinen Aufstand und zieh ihr die Scheiß-Leggings über die Füße!«
»Aber dann gehen wir.«
»Ja, doch!«, knurrte Daniel und berührte mit der Hand die Innenseite der nackten Oberschenkel des Mädchens. Langsam fuhren seine Finger in Richtung Slip, der beim Ausziehen der Leggings etwas nach unten gerutscht war. Über dem Bund waren einige rötliche Schamhaare zu sehen, und beim Gedanken daran, dass das Mädchen im Intimbereich nicht rasiert war, schoss ihm das Blut in den Kopf. Und nicht nur dahin. Sein Schwanz war steif wie eine Kanone. Auch weil seine Finger inzwischen den Slip berührten und langsam unter den Saum fuhren.
Im selben Augenblick traf ihn Johnnys Schlag an der Schulter, und er flog seitlich gegen den Kleiderschrank.
»Ich hab gesagt, du sollst mit dem Scheiß aufhören!«, schrie Johnny, warf die Leggings auf den Boden und zerrte an der Bettdecke, bis er das Mädchen halbwegs damit bedeckt hatte.
»Ist ja gut.« Daniel rieb sich den schmerzenden Oberarm. »Kein Grund, gleich auszuflippen. War doch nur Spaß!«
»Fand ich aber nicht witzig«, knurrte Johnny mit finsterer Miene. »Mach die Verandatür zu! Und dann hauen wir ab.«
»Aye, aye, Sir!« Daniel salutierte wie ein Soldat und setzte leise hinzu: »Spielverderber.« Dann verschwand er hinter dem Vorhang und zog die Verandatür zu. Allerdings lehnte er sie nur an, sodass sie von außen problemlos zu öffnen war.
Johnny wartete bereits an der Eingangstür auf ihn; in der Hand hielt er den Schlüssel des Bungalows. »Was soll ich damit machen?«
»Leg ihn da vorne auf den Tisch«, antwortete Daniel achselzuckend und deutete auf einen Beistelltisch im Vorraum.
Johnny nickte, deponierte den Schlüssel auf dem Tisch, schaute ein letztes Mal auf das Mädchen im Nebenraum und folgte Daniel dann nach draußen. Als sie die Tür ins Schloss gezogen hatten, flammte über dem Eingang die blanke Glühbirne auf, und Johnny rief: »Wir haben vergessen, die Nachttischlampe auszumachen.«
Ich werde sie nachher ausmachen, dachte Daniel und grinste.
»Was ist so lustig?«, fragte Johnny.
»Nichts«, erwiderte Daniel.
Lustig würde es erst später sein. Dafür würde er schon sorgen.
Zweiter Teil
Heute
1
Mona hätte ihn umbringen können.
Viel zu schnell und mit viel zu schwerem Atem hetzte sie durch den Altwicker Stadtpark und suchte ein Ventil für ihre Wut. Verdammtes Arschloch! Diesem Mistkerl war es schon wieder passiert! Sie wusste, dass sie bei dem Tempo bald Seitenstechen bekommen würde und dass dieser »Amoklauf« wenig mit orthopädisch sinnvollem Joggen zu tun hatte. Aber wenn sie nicht wie eine Irre durch den nebligen und menschenleeren Park rannte, würde sie vermutlich vor Wut und Ärger laut schreien. Oder wie ein kleines Kind heulen – was auch nicht besser wäre! Vor allem nicht an ihrem Hochzeitstag.
Sie hatte das kleine Waldstadion der Eintracht Altwick inzwischen zum dritten Mal umrundet und bog nun in Richtung Schützenplatz ab, der ebenfalls ringsum von Bäumen umstanden war und dessen Rasen unter dem immer dichter werdenden Bodennebel kaum zu erkennen war. Typisches Aprilwetter! Vor zwei Wochen war sie noch in kurzer Hose und T-Shirt durch den Park gejoggt, und jetzt war es so nasskalt wie im Herbst. Für den Abend waren Regenschauer und Windböen angekündigt; es begann bereits zu nieseln. Mona musste sich beeilen, wenn sie noch einigermaßen trocken nach Hause kommen wollte.
Der Gedanke an Zuhause ließ sie nun doch einen wütenden Schrei ausstoßen: »Mistkerl!« Wie konnte er bloß ihren Hochzeitstag vergessen? Zum zweiten Mal hintereinander! Am Morgen hatte sie noch gedacht, er erlaube sich einen Spaß mit ihr und spiele den abermals Vergesslichen, um sie dann am Abend mit einem funkelnden Geschenk, hübschen Blumen oder einer Einladung zum Essen zu überraschen. Doch als sie am späten Nachmittag von der Arbeit gekommen war, hatte ein Zettel auf dem Küchentisch gelegen: »Bin bei Jan. Warte nicht mit dem Essen auf mich. Kuss, Max.«
Jan hatte ein Sky-Abo, und es war Freitagabend. Vermutlich schauten sie Fußball, vermutlich beide in königsblauer Kluft und mit sauerländischem Sponsoren-Bier an den Lippen.
Mona hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten, und legte den Kopf in den Nacken, als sie an einer Parkbank anhielt, um durchzuschnaufen und ihre Muskeln zu dehnen. Die Seitenstiche waren längst da und ließen sie noch mehr verkrampfen. Sich aufzuregen brachte nichts, aber sie regte sich dennoch auf. Alles tat weh, und damit meinte sie nicht nur ihre Muskeln und ihr Zwerchfell. Wieder entfuhr ihr ein Wutschrei: »Scheißkerl!«
Als wäre das sein Stichwort gewesen, erschien in diesem Moment ein junger Mann auf der gegenüberliegenden Seite des Schützenplatzes. Er tauchte im wahrsten Sinn des Wortes wie ein Phantom aus dem Bodennebel auf: Zuerst erspähte sie nur undeutlich seinen Kopf, dann seinen Oberkörper und schließlich, als er den Platz etwa zur Hälfte überquert hatte, konnte sie ihn in Gänze sehen. Für einen kurzen Augenblick hatte sie gehofft, dass es Max wäre, der nach ihr suchte, um sich bei ihr für seinen dummen Witz zu entschuldigen. Doch der Mann hatte langes, lockiges Haar und war viel schlanker und größer als ihr bierbäuchiger und glatzköpfiger Max.
Irgendetwas stimmte nicht mit dem Kerl, aber es dauerte eine kleine Weile, bis Mona begriff, was es war. Der Mann schwankte oder torkelte, außerdem trug er trotz des nasskalten Wetters weder Mantel noch Jacke: Offenbar war er betrunken. Obwohl er in Schlangenlinien ging, den Blick zu Boden gerichtet hatte und überhaupt nicht auf den Weg zu achten schien, hielt er irgendwie Kurs auf die Parkbank, an der Mona ihre Dehnübungen machte. Sie hörte damit auf, und eine innere Stimme riet ihr, unverzüglich wegzugehen. Trotzdem blieb sie regungslos an Ort und Stelle und starrte wie gebannt zu dem Mann, der hörbar kicherte und sich über irgendetwas zu amüsieren schien. Es war unheimlich, auch weil weit und breit kein anderer Mensch zu sehen war. Nur sie und der Betrunkene.
Der Mann blieb schließlich direkt vor der Bank stehen, schien aber Mona überhaupt nicht wahrzunehmen. Dann setzte er sich plötzlich hin. Nein, er sackte auf die Bank, als hätte man bei einer Marionette die Fäden durchtrennt. Mona kam der Mann bekannt vor, doch ihr wollte nicht einfallen, wo sie ihn gesehen hatte.
Sie stand immer noch wie paralysiert neben der Bank. Nach ein paar Sekunden räusperte sie sich und fragte leise: »Hallo, alles in Ordnung?«
»Toter Bauer?«, hörte sie den Mann mit nuschelnder Stimme sagen. Als Nächstes lachte er laut auf. »So 'n Quatsch!« Dann hustete er plötzlich und verstummte.
Ein kalter Schauer lief Mona über den Rücken. Sie wandte sich ab und schloss den Reißverschluss ihrer Trainingsjacke, als sie plötzlich eine Berührung an ihrer Pobacke spürte. Ebenso erschrocken wie angewidert sprang sie zur Seite und rief: »He, lassen Sie das!«
Im selben Augenblick kippte der Mann, der sich mit der Schulter an Monas Hintern angelehnt hatte, seitlich von der Bank und landete bäuchlings auf dem Boden. Mona öffnete den Mund wie bei einem Aufschrei, doch zu ihrer eigenen Verwunderung kam kein Ton über ihre Lippen. Dafür klingelte in diesem Moment ihr Handy in der Jackentasche. Während sie sich zu dem Mann bückte, dessen Gesicht mit der Nase nach unten im feuchten Gras lag, zog sie das Handy heraus und nahm automatisch den Anruf entgegen, ohne auf dem Display nachzuschauen, wer sie sprechen wollte.
»Ja?«, sagte sie und drehte mit einer Hand den Kopf des Mannes vorsichtig zur Seite.
»Wo steckst du, Mona?« Es war Max.
»Was?« Irgendetwas stimmte mit den Haaren nicht. Sie waren verfilzt und klebten seitlich am Kopf, als wären sie dort mit etwas eingeschmiert worden.
»Wo steckst du? Wir warten alle auf dich.«
»Max?«, fragte sie verwirrt und starrte fassungslos auf ihre Hand, mit der sie den Mann berührt hatte. Ihre Finger waren blutverschmiert – ebenso wie die Haare, wie sie jetzt erst bemerkte. Als Nächstes fiel ihr die seltsame Delle an der Schläfe des Mannes auf. Nein, keine Delle – eine tiefe Wunde!
»Wer denn sonst?« Max lachte ungläubig. »Wo bist du? Wir sind alle hier und wollen mit dir anstoßen. Jan und Mareike. Anton und Lisa. Meine Eltern sind auch schon da. Wir wollen feiern.«
»Feiern?« Monas Hand begann zu zittern, und sie öffnete ein weiteres Mal den Mund zu einem Schrei, der nicht zu hören war.
»Unseren Hochzeitstag, Schatz! Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, ich hätte ihn schon wieder vergessen? Ich wollte dich nur ein bisschen foppen.«
»Foppen?«, wiederholte sie wie ein Papagei und dachte, was für ein seltsames Wort das war. Irgendwie unpassend. Sie sank auf die Knie und schüttelte den Kopf.
»Mona?«
Gleich hinter dem Schützenplatz, gegenüber vom Verkehrskreisel, befand sich die Altwicker Polizeiwache. Sie wollte aufstehen und hingehen, doch die Beine versagten ihr den Dienst.
»Mona? Alles in Ordnung?«
»Nein, nichts ist in Ordnung«, entgegnete sie und beendete das Telefonat. Jetzt wusste sie wieder, woher sie das Gesicht kannte. Aus dem Altenheim!
Sie wählte 110 und wartete auf das Freizeichen.
2
Heinrich Tenbrink hasste Besuche beim Arzt. Nicht nur, weil er während seiner Zeit im Krankenhaus und der anschließenden Reha zu viele Ärzte gesehen hatte und gezwungen gewesen war, zu viele Untersuchungen und Behandlungen über sich ergehen zu lassen. Sondern auch, weil er das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht nicht ertragen konnte. Im Angesicht eines Mediziners kam sich Tenbrink immer vor wie ein dummer Schüler oder unerfahrener Lehrling, der sich darauf verlassen musste, dass der Lehrer oder Meister das Richtige tat oder sagte, ohne irgendeine Möglichkeit der Kontrolle oder Korrektur zu haben. Ärzte waren wie Richter, die Urteile sprachen und Maßnahmen anordneten; doch anders als vor Gericht war Tenbrink nicht Experte genug, um diese einschätzen zu können. Und er hasste es, der Unterlegene oder Unwissende zu sein.
Ein halbes Jahr war inzwischen seit jenem »Vorfall« in Holland vergangen, der ihm einen Schädelbasisbruch und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma eingehandelt hatte. Noch immer litt er unter unregelmäßig auftretenden Kopfschmerzen, Schwindelanfällen und plötzlicher Übelkeit, die eine Rückkehr in den Polizeidienst zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich machten. Wenn er diese Rückkehr denn überhaupt wünschte. Doch es waren nicht die Folgen seiner Kopfverletzung, die ihn heute zur Neurologie der Uniklinik geführt hatten. Jedenfalls nicht nur. Denn die »Beschwerden«, wie Dr. Eichler sie verharmlosend nannte, hatten lange vor den Schlägen auf den Kopf angefangen. Das Problem bestand also darin, die zuvor schon vorhandenen Beschwerden von den Folgen der Verletzung zu unterscheiden, denn Bewusstseinsstörungen und Amnesie waren klassische Symptome eines Schädel-Hirn-Traumas. Tenbrink hätte gern geglaubt, dass seine Vergesslichkeit und die geistigen Aussetzer durch die Kopfverletzung bedingt waren, aber diese Selbsttäuschung funktionierte nicht. Tenbrink wusste es besser. Und deshalb hatte er auch all die Untersuchungen und Tests über sich ergehen lassen, deren Ergebnisse nun in schriftlicher Form vor ihm ausgebreitet auf dem Schreibtisch lagen.
»Womit sollen wir anfangen?«, fragte Dr. Eichler lächelnd und schaute auf den Wust von Papieren. Er schob seine Brille auf die Stirn und setzte die Lesebrille, die an einer Kette um seinen Hals hing, auf die Nase.
»Machen Sie's kurz und schmerzlos, Doktor«, antwortete Tenbrink und fragte sich, ob der Neurologe schon mal etwas von Gleitsichtbrillen gehört hatte. »Aber bitte so, dass ich es als Laie verstehe.«
»Ganz so kurz wird es nicht gehen.« Dr. Eichler griff sich ein Papier aus dem Stapel. »Schließlich haben wir eine ganze Reihe von Untersuchungen an Ihrem Kopf vorgenommen. Röntgen, MRT, CT und diverse Blutanalysen. Außerdem habe ich hier die Ergebnisse der neuropsychologischen Tests vorliegen. Vorab kann ich Ihnen mitteilen, dass es gleich mehrere gute Nachrichten für Sie gibt.«
»Außer der einen schlechten?«
»Darauf komme ich später zurück«, erwiderte der Arzt, schaute auf das Papier und räusperte sich. »Einen Tumor oder ein Geschwulst hatte ich ja bereits beim letzten Mal ausgeschlossen, das Gleiche gilt für ein Hirnödem oder Ähnliches, das physischen Druck auf ihr Gehirn ausüben könnte. Nichts davon ist auf den Bildern zu sehen. Auch die Schwellungen und Ergüsse infolge der erlittenen Fraktur sind vollständig zurückgegangen. Sie haben in der Tat einen strapazierfähigen Schädel und ein robustes Hirn, Herr Tenbrink.«
»Dickkopf«, sagte Tenbrink und nickte, als wäre er erleichtert.
»Kommen wir zur Möglichkeit einer Arteriosklerose«, fuhr Dr. Eichler fort und wühlte in den Unterlagen, bis er das gesuchte Papier gefunden hatte. »Anhand der MRT-Bilder können wir eine arteriosklerotische Enzephalopathie ebenfalls ausschließen. Eine vaskuläre Demenz liegt also nicht vor.«
»Was heißt das auf Deutsch?« Tenbrink rückte seine Brille zurecht, obwohl sie gar nicht verrutscht war.
»Die Adern in Ihrem Hirn sind nicht verstopft oder verhärtet, das Blut zirkuliert, Ihrem Alter entsprechend, ganz normal. Eine arterielle Unterversorgung mit Sauerstoff liegt nicht vor, auch einen unbehandelten Schlaganfall können wir ausschließen. Eine durch Durchblutungsstörungen hervorgerufene Demenz kommt daher als Ursache der Beschwerden nicht infrage.«
»Also kein Alzheimer?«
»Die Alzheimer-Krankheit ist nur eine Art der Demenz und hat mit der vaskulären Demenz nichts zu tun. Alzheimer und Demenz sind, wie Sie vielleicht wissen, nicht deckungsgleich.«
»Also doch Alzheimer?«, entfuhr es Tenbrink, der auf seinem Stuhl immer weiter nach vorne gerutscht war, sodass er nun auf der Kante saß und das Sitzmöbel zu kippeln anfing.
»Zum jetzigen Zeitpunkt deutet nichts darauf hin«, antwortete Dr. Eichler und hob abwehrend die Hände. »Eine Alzheimer-Diagnose ist nicht ganz einfach, weil die Krankheit schwer von anderen psychischen oder neurologischen Störungen abzugrenzen ist. Im Prinzip müsste man eine feingewebliche Untersuchung des Gehirns vornehmen, um Alzheimer sicher zu diagnostizieren.«
»Dann tun Sie das doch!«
»Dafür müssten Sie tot sein.«
»Oh!« Tenbrink wäre um ein Haar vom Stuhl runtergerutscht.
»Aber, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, dass Sie an Morbus Alzheimer erkrankt sind. Auch die neuropsychologischen Tests, die wir an Ihnen vorgenommen haben, legen einen solchen Befund nicht nahe. Nein, Alzheimer schließe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus.«
»Aber was ist es dann?« Tenbrink schob seinen Hintern zurück und schlug die Beine übereinander, um das Zittern der Knie zu unterdrücken. »Creutzfeldt-Jakob oder Multiple Sklerose oder Parkinson oder was?«
»Sie waren im Internet, richtig?« Dr. Eichler lachte und schüttelte den Kopf, sodass seine blonde Löwenmähne wie die Perücke eines Clowns hin und her schwappte. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen Wikipedia und all diese Medizin-Blogs meiden?« Nach einem weiteren Kopfschütteln setzte er schnaufend hinzu: »Parkinson!«
»Aber was fehlt mir denn? Ich bilde mir das doch nicht ein!«
»Rein körperlich fehlt Ihnen nichts; jedenfalls haben wir nichts gefunden, was die Symptome erklären würde. Da Sie sich die Gedächtnisstörungen aber erwiesenermaßen nicht einbilden, muss es einen anderen Grund für die zeitweilige Amnesie geben.«
Tenbrink tippte sich an die Stirn und fragte: »Werde ich bekloppt?«
»Unsinn!« Erneut lachte Dr. Eichler, doch es klang in Tenbrinks Ohren ein wenig gezwungen. »Allerdings ist nicht auszuschließen, dass es psychische Ursachen für Ihre Beschwerden gibt. Das kann Stress sein, ein heftiges Trauma oder übermäßige Belastung. So was in der Art.«
Ich werde bekloppt, dachte Tenbrink.
»Ich will ganz ehrlich sein«, fuhr der Arzt in ernstem Ton fort.
Tenbrink schluckte. Das hörte sich nicht gut an.
»Die Gedächtnislücken an sich machen mir wenig Kopfzerbrechen.« Dr. Eichler kicherte, als wäre das Wortspiel beabsichtigt gewesen. »Der Berliner Amnesietest hat in dieser Hinsicht keine signifikanten Auffälligkeiten ergeben. Die Ergebnisse liegen gerade noch im Toleranzbereich. Sie werden bald sechzig Jahre alt, da wird man eben vergesslich oder kann sich Sachen nicht mehr so gut merken. Allerdings finde ich die Kombination mit den Aussetzern, die Sie mir beschrieben haben, recht ungewöhnlich. Sie haben diese Situationen, glaube ich, ›Zeitlöcher‹ genannt.«
»Es ist so, als würde ich aus einem Traum aufwachen, nur dass ich überhaupt nicht geschlafen habe. Und alles, was vorher war, ist wie ausradiert.«
Dr. Eichler nickte. »Das erinnert mich an ein Phänomen, das die Psychologen ›Fugue‹ nennen.«
»Fuge?«, fragte Tenbrink. »Wie in der Musik oder wie beim Bau?«
»Nein, ›Fugue‹ wie Flucht. Menschen mit einer solchen Erkrankung erleben etwas ganz Ähnliches wie Sie: Auch sie finden sich plötzlich in einer Situation oder an einem Ort wieder, ohne zu wissen, was zuvor mit ihnen geschehen ist oder wie sie an diesen Ort gelangt sind. Manchmal haben die Betroffenen nicht einmal eine Ahnung, wer sie überhaupt sind.«
Tenbrink zuckte unwillkürlich zusammen. Auch das war ihm schon passiert. »Und was hat das zu bedeuten?«
Dr. Eichler räusperte sich. »Wissen Sie, was eine Dissoziation ist?«
»Nicht genau.« Tenbrink wusste, was eine dissoziative Identitätsstörung war, weil das bei einer polizeipsychologischen Fortbildung behandelt worden war. In dem Fallbeispiel war es um einen Mann mit multiplen Persönlichkeiten gegangen, der einen Mord begangen hatte, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil nur eine der Persönlichkeiten für die Tat verantwortlich war, während die anderen keine Ahnung davon hatten.
»Wenn wir mit bestimmten konfliktbeladenen Dingen nur schwer umgehen oder sie nicht wirklich verarbeiten können ...« - Dr. Eichler setzte die Brille fürs Lesen ab und ließ die für die Fernsicht von der Stirn herabgleiten -, »dann ist unser Hirn manchmal in der Lage oder sogar gezwungen, diese Dinge aus dem Bewusstsein abzuspalten. Das ist so eine Art Selbstschutz.«
Tenbrink nickte. Er kannte das vor allem von Fällen, in denen Kinder Opfer von Gewalt, oft durch nahe Verwandte, geworden waren. Um nicht zugrunde zu gehen und weiter in der Familie leben zu können, wurden die Taten verdrängt. Was nicht selten zu einem Teufelskreis wurde. Aber was hatte das mit ihm zu tun?
»Eine Form der Dissoziation ist die sogenannte dissoziative Amnesie«, fuhr Dr. Eichler fort. »Oft hervorgerufen durch ein psychisches Trauma und manchmal einhergehend mit solchen Fuguen, wie Sie sie beschrieben haben.«
»Ich habe die Erinnerungslücken und Aussetzer, weil ich unter einem Trauma leide?« Tenbrink schüttelte ungläubig den Kopf.
»Ich bin Neurologe und kein Psychologe«, entgegnete der Arzt schulterzuckend. »Aber es wäre zumindest eine denkbare Erklärung.«
»Ich erinnere mich an kein solches Trauma.«
Dr. Eichler zuckte erneut mit den Schultern. Das reichte als Antwort.
»Ich habe das Trauma vergessen, meinen Sie?«, schlussfolgerte Tenbrink verwirrt. »Und immer wenn mich etwas unbewusst an das Trauma erinnert, verdränge ich auch das?« Das klang doch sehr nach Küchenpsychologie, wie er fand.
»Wann haben die Beschwerden angefangen?«
»Keine Ahnung«, log Tenbrink und rieb sich die lädierte Schläfe, die stark zu pochen begonnen hatte.
»Ungefähr.«
»Vor ein paar Jahren.«
»Etwas genauer?«
Tenbrink zögerte die Antwort hinaus, obwohl sie bereits auf seiner Zunge lag. Die Kopfschmerzen breiteten sich von der Schläfe über den ganzen Schädel aus. Er brauchte ein Aspirin, nein: besser zwei. Dann sagte er: »Nach Karins Tod.«
»Wäre der Tod Ihrer Frau nicht eine mögliche Erklärung? Trauer kann ein enormer Stressfaktor sein. Der Verlust eines geliebten Menschen schmerzt manchmal wie eine körperliche Wunde. Oder sogar mehr.«
»Mag sein«, erwiderte Tenbrink und nahm die Brille ab, weil auf einmal die Nasenwurzel brannte, als wäre sie wund. »Aber Karins Tod war kein Trauma für mich, jedenfalls nicht im Sinne einer plötzlichen seelischen Erschütterung. Sie ist ja nicht völlig unerwartet gestorben. Karin hatte Gebärmutterkrebs, und uns blieben noch einige Monate, um uns auf ihr Lebensende vorzubereiten. Es war eine sehr schwere Zeit, vor ihrem Tod und danach, aber ...« Er wollte nicht sagen, dass ihr Tod auch eine Erlösung gewesen war, für Karin und für ihn. Deshalb beließ er es bei dem »aber« und einem tiefen Seufzer.
»Können Sie sich an den Tod Ihrer Frau erinnern?«
»Sie ist zu Hause gestorben«, antwortete Tenbrink und blinzelte. »Karin wollte nicht im Krankenhaus sterben, und darum haben wir sie zu Hause gepflegt.«
»Ist das eine Antwort auf meine Frage?«
Tenbrink verstand nicht, was der Arzt damit meinte, wurde nervös und wollte sich die Brille zurechtrücken. Doch sie befand sich nicht auf seiner Nase. Eine seltsame Panik befiel ihn.
»In Ihrer Hand«, sagte Dr. Eichler.
»Hm?«
»Ihre Brille.«
»Ach ja, wie dumm von mir.« Tenbrink setzte sie auf und kam sich wie ein Trottel vor. Wie einst in der Schule, als er an der Tafel gestanden und nicht gewusst hatte, wann genau der Dritte Punische Krieg gewesen war. Er hasste es, ahnungslos zu sein. Oder sich vor anderen zum Narren zu machen.
»Herr Tenbrink?«
»Ja?«
»Hören Sie mich?« Dr. Eichler sah nun wirklich besorgt aus.
»Entschuldigung, Doktor ...« Tenbrink lächelte verkrampft. »Was haben Sie gesagt?«
3
Der Auffindeort war weiträumig durch graue Stellwände und Sichtblenden abgesperrt, und weil es nach wie vor regnete, hatte man direkt über der Leiche einen Faltpavillon aufgestellt, um die erste Leichenschau vornehmen zu können. Aus seinem Gespräch mit der Zeugin wusste Maik Bertram, dass der Todesort aller Voraussicht nach nicht der Tatort war, und so begutachtete er den Platz vor der Parkbank nur flüchtig. Er grüßte Bremer, der neben dem Rechtsmediziner stand und ihm stirnrunzelnd über die Schulter schaute, mit einem flüchtigen Kopfnicken. Bertram konnte sich einfach nicht daran gewöhnen, dass Arno Bremer nun Erster Hauptkommissar und Leiter des Kriminalkommissariats 11 war. Es fühlte sich irgendwie falsch an.
»Guten Abend, Herr Bertram«, begrüßte ihn der junge Rechtsmediziner, der über die am Boden liegende und bereits entkleidete Leiche gebeugt war und aus den Augenwinkeln zu ihm herüberschielte. »Mistwetter, was?«
”'n Abend! Dr. Kemper, richtig?« Bertram lächelte, als der Mediziner bestätigend nickte. »Sie waren der Rechtsmediziner beim letzten ...«
»Die Frau am Galgen«, unterbrach ihn Dr. Kemper und nickte erneut. »Da fällt mir ein: Wie geht es eigentlich Herrn Tenbrink?«
»Besser, aber er befindet sich immer noch in der Reha«, antwortete Bertram und schaute zu Bremer, dessen Miene sich merklich verfinsterte. Wenn das denn überhaupt möglich war. Und nur um Bremer zu ärgern, setzte er hinzu: »Heinrich Tenbrink hat einen echten Dickschädel. Den kriegt keiner so schnell klein.«
»Dieser Mann hier hatte leider weniger Glück.« Dr. Kemper deutete auf die Leiche, deren Schädel an der linken Schläfenpartie merklich verformt war. »Dabei dürfte die Verletzung ganz ähnlich sein wie damals bei Hauptkommissar Tenbrink. Ein schwerer Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Keine scharfen Kanten und nichts Spitzes; sonst sähe die Wunde anders aus. Das ist allerdings bislang nur eine erste Vermutung. Genaueres nach der Obduktion.«
»Können Sie schon sagen, wann dem Mann der Schädel eingeschlagen wurde?«, wollte Bremer wissen und zupfte nervös an seinem Schnurrbart, den er seit Neuestem an den Enden gezwirbelt trug.
»Wieso bist du so sicher, dass hier ein Fremdverschulden vorliegt?«, fragte Bertram und wusste sogleich selbst die Antwort darauf. Bremer wollte, dass dem Mann der Schädel eingeschlagen worden war, denn dann hätte er sein erstes Tötungsdelikt als Leiter des KK11. Ohne seinen Vorgesetzten anzusehen, setzte er hinzu: »Der Mann könnte auch gestürzt sein.«
»Das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht auszuschließen«, erklärte Dr. Kemper, bevor Bremer etwas erwidern konnte. »Allerdings gibt es keine weiteren Verletzungen oder Hämatome am restlichen Körper, was bei einem Sturz eher untypisch ist. Und zur genauen Tatzeit kann ich leider noch nichts sagen. Die Wunde ist bereits verschorft und sicherlich nicht frisch, aber sie befindet sich noch in der Exsudationsphase.« Bevor einer der Kommissare fragen konnte, erklärte der Mediziner: »Früher nannte man das Entzündungsphase. Die kann jedoch bis zu drei Tage dauern.«
»Geht's etwas genauer?« Bremer kaschierte nicht einmal ansatzweise, dass er genervt war.
»Zwei Stunden, vielleicht vier.« Dr. Kemper zuckte bedauernd mit den Achseln. »Genauer geht's leider nicht. Der Regen hat die Wunde aufgeweicht. Sie werden sich gedulden müssen, bis wir den Schädel seziert haben, Herr Hauptkommissar.«
»Wieso ist der Mann nicht sofort nach dem Schlag oder Sturz gestorben?«, fragte Bertram und betrachtete eine Tätowierung auf dem Oberarm des Toten. Eine Art Tribal-Tattoo, das sich wie eine Girlande um einen Namen wand. Lisa, las Bertram im Stillen und setzte hinzu: »Wieso erst Stunden später?«
»Sehr wahrscheinlich eine Einblutung ins Gehirn.« Der Rechtsmediziner deutete auf die Schläfe des Mannes. »Deshalb ist, mit Blick auf die Schwere der Verletzung, auch relativ wenig Blut nach außen gedrungen und keine Schwellung zu sehen. So ein Epiduralhämatom drückt immer mehr aufs Gehirn: Die Folgen sind Übelkeit, Erbrechen, Wahrnehmungsstörungen und oft auch Bewusstlosigkeit. Wenn die Blutung nicht gestillt oder der Schädel nicht geöffnet wird, tritt irgendwann der Tod ein. Das hängt natürlich davon ab, wie stark die Blutung ist und ob eine Vene oder eine Arterie verletzt wurde.«
»Soll das heißen, dass der Mann wohlmöglich stundenlang mit der offenen Wunde am Kopf durch die Gegend gewankt ist?«, fragte Bremer.
»Womöglich«, murmelte Bertram, der dem Reflex nicht hatte widerstehen können, seinen Chef zu korrigieren. Er hasste falsches Deutsch.
»Was?«, entfuhr es Bremer.
»Nichts.« Bertram schaute zu Boden.
»Das ist durchaus denkbar«, antwortete schließlich Dr. Kemper, »aber nicht sehr wahrscheinlich. Vermutlich wurde der Mann direkt nach dem Schlag bewusstlos und war es auch die meiste Zeit danach.«
»Und dann ist er aufgewacht, um hierher zu kommen und zu sterben«, folgerte Bertram. »Wie weit kann man mit einer solchen Verletzung gehen? Oder war er sogar noch in der Lage, mit dem Auto zu fahren?«
Ein Achselzucken des Rechtsmediziners war die Antwort.
»Na, wunderbar!«, rief Bremer. »Wir wissen nicht, wann der Mann niedergeschlagen wurde, und wo das geschehen ist, wissen wir auch nicht.«
Ob das geschehen ist, wissen wir ebenfalls noch nicht, dachte Bertram, hielt diesmal aber seinen Mund und biss sich auf die Lippen.
»Und zu allem Überfluss haben wir keine Ahnung, wer der Ermordete ist, weil er nämlich weder Papiere noch ein Handy bei sich hatte.« Bremer deutete auf die Kleidung des Toten, die in einer durchsichtigen Asservatentasche auf der Parkbank lag.
»Der Mann heißt Peter Gausling«, sagte Bertram und kramte seinen Notizblock hervor. »Er arbeitete als Pfleger in einem Seniorenheim in Oldenhook.«
»Woher weißt du das?«
»Die Auffindezeugin, Mona Rensing, hat Gausling wiedererkannt. Ihre Großmutter lebte einige Zeit in dem Altenheim, und Gausling war einer ihrer Pfleger. Ich hab Bernd die Daten bereits nach Münster durchgegeben. Er kümmert sich darum, sobald er im Büro ist, und meldet sich dann.«
»Und warum erfahre ich erst jetzt davon? Ich möchte, dass man mich über solche Ermittlungsergebnisse umgehend auf dem Laufenden hält.«
»Ich sag's dir doch gerade«, antwortete Bertram und versuchte, nicht mit den Augen zu rollen. »Brauchst du mich hier noch?« Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern wandte sich ab und verließ den abgesperrten Bereich.
Arschloch!, dachte er und stieß beinahe mit Heide Feldkamp zusammen, obwohl die im leuchtend weißen Overall der Spurensicherung eigentlich nicht zu übersehen war. Heide war die Tatortspezialistin in ihrem Team und hatte gerade mit den Kollegen den Schützenplatz und den angrenzenden Fußballplatz nach Spuren abgesucht.
»Und?«, fragte Bertram.
»Nichts.« Heide nahm die Kapuze vom Kopf. »Keine Spur von einer Jacke oder einem Mantel. Und in der Dunkelheit werden wir auch keine Blutspuren finden.« Sie deutete auf die Scheinwerfer, die den weitläufigen Platz nur unzureichend erhellten. »Jedenfalls nicht mit diesen Funzeln.«
»Die Wunde war nicht frisch und das Blut bereits verkrustet. Hier werden wir auch bei Tageslicht keine Blutspuren finden.«
»Ist Arno inzwischen da?« Heide kratzte sich die Kopfhaut und setzte die Kapuze wieder auf.
»Und ob! Schlecht gelaunt wie immer.«
Während Heide die Augen verdrehte und den Faltpavillon betrat, folgte Bertram dem beleuchteten Pfad, den die Kollegen von der Spurensicherung auf beiden Seiten mit Flatterband abgesperrt hatten. Dies war der Weg über den Schützenplatz, den der Verstorbene laut Mona Rensing bis zur Parkbank gegangen war. Getaumelt, wie sie sich ausgedrückt hatte, und irgendetwas vor sich hin brabbelnd.
»Toter Bauer«, wiederholte er eine Äußerung des Toten, die ihm die Zeugin mitgeteilt hatte.
Bertram ging bis zum Ende des Schützenplatzes und durchquerte einen kleinen Hain, der den Platz von der angrenzenden Kreisstraße trennte. Rechts ging es zum Verkehrskreisel, an dem sich auch die Polizeiwache Altwick befand, und linker Hand führte die Straße in Richtung Holland. Nur einen Steinwurf entfernt stand das Ortsausgangsschild von Altwick, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite begann ein Neubaugebiet mit zahlreichen, beinahe identisch aussehenden Einfamilienhäusern aus rotem, braunem oder sandfarbenem Klinkerstein. Die meisten Häuser waren bereits fertiggestellt und bewohnt, aber am Rand der Siedlung befanden sich einige Bauten noch im Rohzustand. Hier waren die Häuser zum Teil noch ohne Dach, und zwei beleuchtete Baukräne ragten in den regnerischen Himmel. Dies war die sogenannte Baumsiedlung, deren Straßen allesamt nach irgendwelchen Bäumen oder Sträuchern benannt waren. Auch das wusste Bertram von Mona Rensing, die mit ihrem Mann Max im Ahornweg wohnte.
»Guten Abend, Herr Kriminaloberkommissar«, wurde Bertram von einem uniformierten Kollegen angesprochen, der mit einem weiteren Beamten den Zugang zum Gelände sicherte und sich nun zum Gruß an den Mützenschirm tippte.
»Kennen wir uns, Herr Polizeihauptkommissar?«, fragte Bertram, nachdem er die drei Sterne auf den Schulterklappen erblickt hatte.
»Ewerding«, antwortete der PHK mit seiner Bassstimme und deutete zur Polizeiwache. »Stellvertretender Dienststellenleiter. Wir sind uns vor ein paar Monaten begegnet. Ich habe Ihnen und Ihrem Chef unsere neue Wache gezeigt.«
»Ich erinnere mich.« Bertram nickte. »Und man hat Sie als stellvertretenden Dienststellenleiter zur Tatortsicherung verdonnert?«
»Ist ja sonst nicht viel los.« Ewerding zuckte mit den Achseln. »In Altwick gibt's nicht so oft einen Mord zu untersuchen.«
»Noch ist nicht gesagt, dass es sich um Mord handelt.«
Ewerding schaute etwas enttäuscht drein, und wieder gingen seine Schultern in die Höhe.
»Wohin führt diese Straße?«, wollte Bertram wissen.
»Holland«, antwortete Ewerding und rieb sich die beachtliche Bierwampe.
»Etwas genauer bitte.«
»Erst nach Oldenhook und dann durchs Hooker Venn bis zur B 70.«
»Wie weit ist es bis Oldenhook?«
»Drei, vier Kilometer«, antwortete Ewerding verwundert. »Wieso?«
»Kennen Sie das Altenheim dort?«
»Sicher.«
Bertram machte eine auffordernde Geste mit der Hand.
»War früher mal ein katholisches Krankenhaus«, setzte Ewerding hinzu und schnaufte, als hätte er Mühe beim Atmen. »Heute nennt es sich Senioren-Wohnpark und ist so exklusiv und teuer, dass es sich kein Normalsterblicher leisten kann. Pflegeheim, betreutes Wohnen, Senioren-WGs, Wellness, Sportplatz und Turnhalle, das ganze Programm. Wie ein Dorf im Dorf. Halb Oldenhook lebt von dem Altenheim. Und das nicht schlecht.«
»Danke, Herr Ewerding«, sagte Bertram und wandte sich ab.
»Gruß an den Chef!«, rief der PHK ihm nach.
Im selben Augenblick trat Bremer aus dem Wäldchen, schaute Ewerding überrascht an und fragte: »Kennen wir uns?«
»Wieso?«
»Weil Sie mich grüßen lassen.«
»Ich meinte den anderen Chef«, antwortete der Polizeihauptkommissar verwirrt. »Hauptkommissar Tenbrink, den Kommissariatsleiter.«
Bremer knurrte etwas Unverständliches und nicht sehr Freundliches in Ewerdings Richtung, zog seinen albernen Borsalino-Hut in die Stirn und wandte sich dann an Bertram: »Bernd hat angerufen und die Personalien des Toten durchgegeben. Peter Gausling, 24 Jahre alt, ledig. War zuletzt in Oldenhook gemeldet. Am Nonnenbusch 14.«
»Komische Adresse«, fand Bertram.
»Ich sagte ja, es war mal ein katholisches Krankenhaus«, erklärte Ewerding und kam ein paar Schritte näher. »Mit Nonnen als Krankenschwestern. Von dem einstigen Busch ist aber nicht viel übrig geblieben.«
»Was?«, fragte Bremer. »Wovon reden Sie?«
»Vom Altenheim. Am Nonnenbusch. So heißt das.«
»Gausling wohnte in einem Altenheim?«, rief Bremer verwundert.
»Das ist nicht bloß ein Altenheim«, entgegnete Ewerding und faltete die Hände vor der Brust. »Da gibt's betreutes Wohnen, Seniorenwohngemeinschaften, Wellnessangebote und jede Menge Sportanlagen.«
»Das ganze Programm«, fügte Bertram hinzu und ging zu seinem Wagen.
4
Bertram hatte schon viele Reaktionen auf den Erhalt einer Todesnachricht erlebt. Manche begannen zu weinen oder zu schluchzen, laut oder leise. Andere stammelten zusammenhangslos oder in Halbsätzen, zuckten wie unter Anfällen und konnten nicht begreifen, was so einfach auch nicht zu verstehen oder zu akzeptieren war. Wieder andere hörten gar nicht auf zu reden und eine ganze Batterie von Fragen zu stellen, die entweder nicht zu beantworten oder zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht relevant waren. Plapperten Banales oder Offenkundiges, nur um das Schweigen zu brechen. Und natürlich gab es die Desinteressierten, die den Tod eines Bekannten, Arbeitskollegen oder Verwandten mit einem Achselzucken oder einem verwunderten Kommentar quittierten. Selbst offene Schadenfreude oder nur leidlich verschleierte Genugtuung hatte Bertram bereits erlebt. Doch die Reaktion von Beate Lohmann, Leiterin des Senioren-Wohnparks »Am Nonnenbusch«, war für ihn ein Novum: Sie reagierte überhaupt nicht, weder durch Worte noch durch Gesten.
Bertram und Bremer hatten die Heimleiterin vor ihrem Arbeitszimmer im Hauptgebäude angetroffen, als sie gerade die Bürotür hinter sich abgeschlossen hatte und Feierabend machen wollte. Beate Lohmann lauschte Bremers knappen und recht vagen Ausführungen aufmerksam, aber ohne erkennbare Gefühlsregung, nickte lediglich ein oder zwei Mal, schaute dann zu Boden und verharrte anschließend bewegungs- und geräuschlos. Wie eine Statue.
Bremer und Bertram schauten sich an und warteten, doch nichts geschah. Sie war und blieb wie zur Salzsäule erstarrt, wirkte dabei aber nicht geschockt oder entsetzt, sondern schlichtweg leblos. Als hätte man ihr den Stecker gezogen.
»Frau Lohmann?«, sprach Bertram sie nach einer Weile an. »Alles in Ordnung?«
Keine Antwort. Keine Bewegung. Nur der starre Blick zu Boden.
»Hallo! Hören Sie mich?«, versuchte es Bremer und berührte sie am Oberarm.