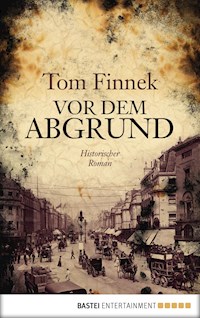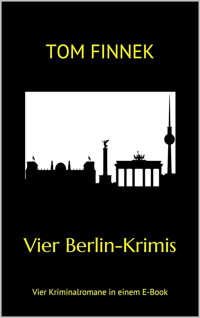4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Münsterland-Reihe
- Sprache: Deutsch
In einer kalten Rauhnacht, nahe der niederländischen Grenze: Ein alter Bauernkotten steht lichterloh in Flammen, und die Leiche des Bauern liegt mit eingeschlagenem Schädel vor dem Haus. Oberkommissar Maik Bertram und seine Kollegen können den vermeintlichen Mörder bald fassen: Schultewolter, der vor Jahren auch den inzwischen pensionierten Heinrich Tenbrink niedergeschlagen hat. Doch Zeugen haben gesehen, wie Schultewolter den Toten aus dem brennenden Haus gezerrt hat. Warum würde ein Mörder sein Opfer retten wollen?
Im vierten Fall der Münsterland-Krimis machen alte Bekannte und dunkle Geheimnisse während der Rauhnächte den Ermittlern Tenbrink und Bertram das Leben schwer.
LESER-STIMMEN ZUR REIHE:
"Die Hauptfiguren der Serie sind mir schnell ans Herz gewachsen und ich hoffe, dass es noch weitere Folgen in der Serie gibt. Und zwar bald, ich kann's kaum erwarten ..." (BrittDreier, Lesejury)
"Tom Finnek hat hier ein ungewöhnliches, sehr sympathisches Ermittlerpaar geschaffen, das durch die bildhafte Beschreibung sofort im Kopf des Lesers haften bleibt. Die beiden agieren glaubhaft und kommen authentisch rüber." (Ladybella911, Lesejury)
"Ein wunderbarer, mit dezentem Humor gespickter, spannender Regionalkrimi mit einem außergewöhnlichen Ermittlerduo, welches einem schnell ans Herz wächst." (Honigmond, Lesejury)
"Spannender Plot, interessante Figuren, tolle Atmosphäre" (_inga_, Lesejury)
Heinrich Tenbrink und Maik Bertram ermitteln bereits in:
- Galgenhügel
- Totenbauer
- Schuldacker
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
In dieser Reihe sind bereits erschienen
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitat
Prolog
Samstag
1
2
Erster Teil
Sonntag
1
2
3
4
5
6
7
8
Zweiter Teil
Montag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dritter Teil
Dienstag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vierter Teil
Mittwoch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fünfter Teil
Donnerstag
1
2
3
4
5
6
7
8
Epilog
Freitag
1
2
Hat es Ihnen gefallen?
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
In dieser Reihe sind bereits erschienen:
Galgenhügel
Totenbauer
Schuldacker
Über dieses Buch
In einer kalten Rauhnacht, nahe der niederländischen Grenze: Ein alter Bauernkotten steht lichterloh in Flammen, und die Leiche des Bauern liegt mit eingeschlagenem Schädel vor dem Haus. Oberkommissar Maik Bertram und seine Kollegen können den vermeintlichen Mörder bald fassen: Schultewolter, der vor Jahren auch den inzwischen pensionierten Heinrich Tenbrink niedergeschlagen hat. Doch Zeugen haben gesehen, wie Schultewolter den Toten aus dem brennenden Haus gezerrt hat. Warum würde ein Mörder sein Opfer retten wollen?
Über den Autor
Tom Finnek wurde 1965 im Münsterland geboren und arbeitet als Filmjournalist, Drehbuchlektor und Schriftsteller. Er ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und lebt mit seiner Familie in Berlin.
Tom Finnek
Rauchland
Ein Münsterland-Krimi
Originalausgabe
beTHRILLED in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2020/2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
Unter Verwendung von Motiven © von © shutterstock: Zastolskiy Victor | Maxim Petrichuk | Matt Gibson | Askobol | S.N.Ph | Henriette V.
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-9429-0
be-thrilled.de
lesejury.de
»Der Münsterländer ist überhaupt sehr abergläubisch,
sein Aberglaube aber so harmlos wie er selber.«
Annette von Droste-Hülshoff, »Bilder aus Westfalen«
Prolog
Samstag
1
Wenn nur diese verdammte Kälte nicht wäre! Petras Hände waren trotz der dicken Handschuhe eisig und schmerzten, und ihr Gesicht fühlte sich taub an. Sie spürte ihre Nasenspitze nicht mehr, egal wie sehr sie daran rieb.
»Da vorne müssen wir nach links.« Martin deutete vage geradeaus, als könnte er in der mondlosen Finsternis irgendetwas erkennen. »Dann kommen wir wieder zur Landstraße.«
»Weißt du das, oder glaubst du das?« Petra versuchte, das Gesicht ihres Mannes in der Dunkelheit zu erkennen. Um an seiner Miene abzulesen, ob er wenigstens eine ungefähre Ahnung hatte oder nur wichtigtuerisch daherredete. Wie so oft …
»Da vorne links«, wiederholte Martin, als wäre das eine Antwort auf ihre Frage. Er lallte merklich und ging schwankend vor ihr her. »Kannst ja hierbleiben, wenn du mir nicht glaubst.«
»Mir ist kalt!«
»Dann komm endlich, verdammt!«
»Kein Grund, gleich zu fluchen«, murmelte sie und trottete widerwillig hinter ihm her. Petra wusste nicht genau, wie lange sie nun schon durch das Engerloer Venn irrten, aber sie hatte nicht den Eindruck, dass sie sich dabei dem Dorf wesentlich genähert hatten. Kein Licht weit und breit, kein Haus, keine Straße – nichts. Nur sandige Feldwege, gefrorene Feuchtwiesen und düsterer Bruchwald. Weil der Himmel wolkenverhangen war, halfen nicht einmal die Sterne bei der Orientierung. Den Großen Wagen hätte sie vermutlich erkannt. Das war der mit dem Polarstern, oder?
So ein Mist! Wäre sie doch bloß zu Hause geblieben, wie sie es eigentlich vorgehabt hatte. Die ganzen dörflichen Rituale und das Nachbarschaftsgedöns waren ihr als gebürtiger Dortmunderin auch nach drei Jahren im Münsterland immer noch fremd, und sie hätte gern darauf verzichtet. Aber Martin hatte sie regelrecht beschworen, nicht schon wieder einen Rückzieher zu machen. So wie letztens beim Adventskegeln mit dem Stammtisch. Oder davor beim Klootball-Schmieten in einer der umliegenden Bauernschaften. Sonst würden sie irgendwann gar nicht mehr zu irgendwas eingeladen. Das könne sie doch auch nicht wollen. Also hatte Petra schließlich zugestimmt, mit den Nachbarn den traditionellen »Schneegang« zum Venn an der holländischen Grenze zu unternehmen. Eine gemeinschaftliche Wanderung durch die kalte Pampa. Mit Bier, Schnaps und Glühwein im Handkarren, dem sogenannten Käörken, das bei keinem Schneegang fehlen durfte. Wie jedes Jahr in der Nacht vor dem Dreikönigsfest. In der letzten der zwölf Rauchnächte, wie die alten Leute im Dorf sie nannten. Ein Ritual zum Ende der Weihnachtszeit.
»Wir hätten mit den Brandherms nach Hause gehen sollen«, sagte sie und versuchte, sich zu orientieren. Der schmale Feldweg gabelte sich vor ihnen; links glaubte sie in der Ferne ein Waldgebiet zu erkennen, rechts ging es über offenes Land. Sie hätte sich für rechts entschieden.
»Hätte, hätte, Fahrradkette«, knurrte Martin und torkelte nach links. »Jetzt müssen wir eben das Beste draus machen.«
»Es ist immer dasselbe mit dir«, murmelte Petra halblaut, zögerte kurz an der Weggabelung und folgte dann ihrem Mann. »Solange noch Bier oder Schnaps da ist, kannst du kein Ende finden. Immer noch einen und noch einen. Bis nur noch die Waldkötters mit ihrem blöden Käörken übrig sind, die gar nicht mehr in Engerloe wohnen und einen ganz anderen Heimweg haben. Warum sind die überhaupt noch beim Schneegang dabei, wenn sie gar keine Nachbarn mehr sind?«
»Es sind halt ehemalige Nachbarn.«
»Ehemalig! Entweder ist man Nachbar oder nicht«, fauchte sie und rieb sich mit den Handschuhen über die Wangenknochen, die sich inzwischen ebenfalls taub anfühlten. »Die Waldkötters wohnen doch jetzt in Holland. Haben die da keine Nachbarn?«
»Jetzt hör schon … auf zu maulen!«, antwortete Martin und kämpfte mit einem Schluckauf. »Kann doch keiner ahnen, dass der … Akku leer ist.«
»Kein Wunder bei der Kälte!«
»Jetzt bin ich's wieder … schuld«, sagte er und hielt sich die Nase zu, um den Schluckauf zu bekämpfen.
»Natürlich hast du Schuld. Wer denn sonst?«, rief sie und äffte Martin nach: »Wir haben ja Google Maps. Da ist jeder Feldweg eingezeichnet. Damit kommen wir ganz leicht nach Hause. Ein Kinderspiel!« Sie lachte abfällig und hätte weinen können. Auch wenn die Tränen auf ihren eisigen Wangen vermutlich sofort gefroren wären. »Wahrscheinlich hast du wieder die ganze Zeit irgendwelche blöden Spiele auf dem Handy gespielt, und wenn man das Ding dann mal wirklich braucht, ist der Akku leer. Typisch!«
»Wenn du dir endlich ein Smartphone zulegen würdest, könnten wir jetzt mit deinem Handy den Weg suchen!« Er schluckte mehrfach, dann machte er: »Hicks!«
»Ich hab ein Handy. Zum Telefonieren. Und wenn wir vorhin mit den Brandherms nach Hause gegangen wären, lägen wir jetzt längst im Bett. Auch ohne Internet und Google Maps.«
»Petra«, sagte Martin und legte seine Hand auf ihren Unterarm.
»Komm mir bloß nicht mit ›Petra‹!«, fauchte sie und schüttelte seine Hand ab. »Hier hat sich's ›ausgepetrat‹.«
»Petra«, wiederholte er und deutete zum Wald. »Guck doch! Da vorne ist … hicks … ein Licht. Im Busch.«
Tatsächlich! Irgendwo in dem Wald schimmerte es gelblich. Vielleicht ein erleuchtetes Fenster oder eine Hoflaterne. Auch wenn es Petra für unwahrscheinlich hielt, dass dort in der finsteren Einöde irgendjemand wohnte. Außerdem flackerte das Licht, und ihr schien es beinahe so, als würde es heller werden.
»Was ist das?«, fragte sie und blieb stehen.
»Ein Licht«, antwortete Martin und torkelte weiter auf dem Feldweg in Richtung Wald. »Hab ich doch gesagt.«
»Das seh ich auch!«, rief sie ihm nach. »Aber was ist das?«
»Ist doch egal«, lallte er und schluckte mehrmals. »Hauptsache … hell. Dann kann's nicht … verkehrt sein.«
Das fand Petra nicht, dennoch folgte sie ihrem Mann und starrte wie gebannt auf das flackernde Licht zwischen den Bäumen. Ein leises Geräusch war zu hören, wie ein Wispern oder Flüstern. Nein, ein Knistern! Und als ihr das klar wurde, erspähte sie auch die Rauchsäule, die aus dem Wald aufstieg.
»Es brennt!«, schrie sie und stieß Martin von hinten an.
»Quatsch!«, antwortete er. »Was soll denn da brennen?« Doch dann schien auch er die Rauchsäule zu sehen, und er rief: »Verdammt! Du hast recht!« Vor Schreck hatte er sogar seinen Schluckauf vergessen. Er wirkte auch gar nicht mehr so betrunken.
»Vielleicht brennt das Venn«, vermutete Petra.
»Im Wald?« Martin tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Da gibt's kein Venn. Außerdem qualmt der Torf nur. Wenn das Moor brennt, gibt's keine großen Flammen.«
Wie auf ein unhörbares Kommando hin liefen sie los in Richtung Feuer und hatten nur wenige Minuten später den Waldrand erreicht. Der Feldweg endete hier nicht, sondern führte als Hohlweg mitten durchs Gehölz zu einem kleinen Bauernhof oder Kotten, aus dessen geborstenen Fenstern die Flammen schlugen.
»Das muss der Schaddebuer sein!«, rief Martin und wandte sich zu Petra um, die sich die stechende linke Seite hielt.
»Was denn für ein Schaddebuer?«, keuchte sie. Den Namen hörte sie zum ersten Mal.
»Der alte Friedhelm Harking. Der wohnt hier ganz einsam an der Grenze. Wie so 'n Einsiedler. Mitten im Rauchland.«
»Was denn für ein Rauchland?«, fragte Petra. Auch den Namen hörte sie zum ersten Mal.
»Keine Ahnung. Heißt halt so.« Martin streckte seine Hand aus. »Gib mir dein Handy. Ich ruf die Feuerwehr.«
»Das kann ich auch selber«, antwortete Petra, reichte ihm aber dennoch das Handy. Sie war froh, zum Telefonieren nicht die Hände aus den Handschuhen nehmen zu müssen.
»Martin Witte hier, aus Engerloe«, sprach Martin nach kurzer Zeit ins Handy, während sie sich vorsichtig dem brennenden Kotten näherten. »Ich möchte ein Feuer melden. Ein Haus brennt. Es muss der alte Kotten von Friedhelm Harking sein.«
Petra spürte die Wärme des Feuers auf ihrem Gesicht. Es war angenehm und schrecklich zugleich. Wohlig und unheimlich. Dann fuhr sie plötzlich zusammen. Da vorne hatte sich was bewegt. Direkt vor dem Haus. Ein schwarzer Schatten. Doch jetzt war er weg. Sie wandte sich zu Martin um und wedelte aufgeregt mit den Händen.
»Die Adresse?«, brüllte Martin ins Handy und schüttelte unwirsch den Kopf in Petras Richtung. »Keine Ahnung. Im Engerloer Venn, direkt an der holländischen Grenze. In der Nähe von Haaksbergen. Hier gibt's keine Adresse.«
»Da ist jemand!« Petra zupfte an Martins Ärmel.
»Lass das!« Er starrte sie wütend an. »Nein, nicht Sie, ich rede mit meiner Frau. Was?! Das Feuer ist so laut. Nein, nicht in Haaksbergen! Auf der deutschen Seite der Grenze. Zwischen Engerloe und Haaksbergen. Die Gegend heißt Rauchland. Kommen Sie schnell!« Er legte auf, verdrehte die Augen und fragte: »Was?«
»Da ist jemand!«, wiederholte sie. Sie standen etwa fünfzehn Meter vom Haus entfernt, die Hitze und der Lärm waren beinahe unerträglich. Das hölzerne Schindeldach hatte inzwischen auch Feuer gefangen, und die Flammen schlugen nun überall aus dem kleinen Bauernkotten. Immer wieder gab es kleine Explosionen wie von Knallfröschen, und Funken sprühten wild und schossen wie winzige Raketen durch die Gegend.
»Wo ist jemand?«
»Vor dem Kotten. Aber jetzt ist er weg! Ich glaube, er ist ins Haus gerannt.«
»Quatsch!« Martin zeigte ihr abermals den Vogel. »Das Dach stürzt gleich ein. Warum sollte jemand da reinrennen? Dann wäre er ja lebensmüde.«
Im selben Augenblick wurde die Tür des Kottens von innen aufgestoßen, und eine riesige Gestalt erschien als schwarzer Schemen im vom Feuer hell erleuchteten Türrahmen.
Petra stieß einen spitzen Schrei aus, und Martin rief entsetzt: »O Gott!«
Die schwarze und seltsam unförmige Gestalt kam schwankend näher und sackte dann zu Boden. Erst jetzt erkannte Petra, dass es sich nicht um eine Person handelte, sondern dass dort zwei Menschen waren. Der eine, vermutlich ein Mann, hatte den anderen auf den Armen aus dem Haus getragen und beugte sich nun über ihn.
»Hallo!«, rief Petra gegen den Lärm des Feuers an. »Wer ist da?« Eine dämliche Frage, aber ihr fiel nichts Besseres ein. »Können wir helfen?!«
Der Mann, der sich über die am Boden liegende Person gebeugt hatte, richtete den Oberkörper auf. Er schien in ihre Richtung zu starren, doch Petra sah nur eine schwarze Silhouette vor dem lodernden Inferno. Der Mann trug einen Schlapphut und einen weiten Mantel, mehr war nicht von ihm zu erkennen.
»Was ist mit ihm?«, fragte Martin, deutete auf den am Boden Liegenden und ging einige Schritte auf die beiden Gestalten zu. »Lebt er noch?«
Als Antwort erhob sich der schwarze Mann schwerfällig, reckte abwehrend die Hände hoch und rief mit krächzender Stimme: »Gao wegg!« In der rechten Hand hielt er ein langes Messer. Es sah aus wie ein Brotmesser.
Dann fuhr der Mann plötzlich herum und rannte humpelnd davon. Und verschwand in der Dunkelheit.
2
Martin wusste selbst nicht, was in ihn gefahren war. Vielleicht war es der Alkohol, der ihn übermütig gemacht hatte, oder es lag daran, dass Petra aufgebracht rief: »Der Kerl läuft weg. Tu doch was, Martin!«
Also tat er was. Ohne weiter darüber nachzudenken, lief er dem humpelnden Mann mit dem Messer hinterher. Mitten in den Wald hinein. Vermutlich in Richtung holländische Grenze, die nicht weit vom Kotten des Schaddebuern entfernt war.
Das Feuer tauchte alles in ein unwirkliches, orangefarbenes Licht und warf lange Schatten, die vor seinen Augen zu tanzen schienen. Der schwarze Mann war nicht sehr schnell unterwegs, er zog das linke Bein nach und schien immer wieder Pausen machen zu müssen. Nach wenigen Minuten hatte Martin ihn am oberen Rand eines Hanges erreicht, der zu einem zugefrorenen Bach hinabführte. Er packte den Kerl hinten am Mantelkragen und befahl laut: »Bleiben Sie stehen!«
Wieder brüllte der Mann: »Gao wegg!«
»Stehen bleiben!«, schrie Martin und zerrte an dem Mantel des Mannes, um ihn daran zu hindern, in die vereiste Senke hinunterzulaufen.
»Godverdorri!«, fluchte der Mann und riss sich kurzerhand den Mantel vom Leib. Dabei erkannte Martin, dass er das Messer nicht mehr in den Händen hielt. Vermutlich hatte er es auf der Flucht durchs Unterholz verloren oder weggeworfen.
Als der Mann weiterrannte, folgte ihm Martin und rief auf Plattdeutsch: »Stao stille!«
Und tatsächlich blieb der Mann nach wenigen Schritten plötzlich stehen, bückte sich tief und rieb sich das linke Knie.
»Na also«, murmelte Martin und pustete kräftig durch. »Warum nicht gleich so?!«
Er sah die Ausholbewegung zu spät und bemerkte den heransausenden Ast erst, als er mit einem lauten Krachen an seinem Kopf landete. Zum Glück war der Ast morsch und zerbrach an seinem Schädel, doch Martin verlor das Gleichgewicht, taumelte nach hinten und fiel hin. Er kullerte den rutschigen Hang hinunter, bis er mit der Schläfe hart auf dem Eisbach aufschlug. Dann wurde es dunkel.
Als er wieder aufwachte, brauchte er eine Weile, um sich zu orientieren. Und um sich zu erinnern. Die schwarze Gestalt am Rand der Senke war verschwunden. Wahrscheinlich war der Kerl längst in Holland. Aber Martin stellte zufrieden fest, dass er immer noch den Mantel des Mannes in den Händen hielt. Besser als nichts.
»Martin!«, hörte er in diesem Moment Petras Stimme von oben. »Wo bist du? Martin!«
»Hier unten!«, antwortete er und rappelte sich auf. Sein Kopf schmerzte, und beim Aufstehen bemerkte er, dass er sich den rechten Knöchel verstaucht hatte.
»Was machst du da?« Petra stand inzwischen oben an der Kante des Hangs und hielt sich die Hand wie einen Schirm über die Augen, als könnte sie dadurch den zugefrorenen Bach besser überblicken.
Blöde Frage, dachte Martin, und begann, den Hang hinaufzuklettern. »Er ist mir entwischt«, sagte er frustriert.
»Warum bist du dem Kerl überhaupt hinterhergerannt?«, rief sie und streckte ihm die Hand entgegen. »Der hatte ein Messer dabei.«
»Du hast doch gesagt, ich soll was tun.« Er schlug ihre Hand aus und kletterte den letzten Meter ohne ihre Hilfe nach oben.
»Aber doch nicht so was!« Petra schüttelte den Kopf, als wäre er ein kleines Kind, das eine Dummheit begangen hatte. »Da hätte ja sonst was passieren können. Du könntest tot sein.«
»Ich hatte ihn schon am Kragen, aber er hat sich losgerissen«, antwortete Martin, als er neben Petra stand und sich die dreckige Hose abklopfte. Dann reckte er das erbeutete Kleidungsstück in die Höhe und setzte triumphierend hinzu: »Ich hab seinen Mantel!«
»Na, das ist ja super!«, sagte sie schnippisch und verschränkte die Arme vor der Brust. »Und jetzt hoffst du, dass er sich bei der Kälte zu Tode friert?«
»Das ist ein Beweismittel«, murmelte Martin unhörbar.
»Was?«
»Nichts!« Er deutete vage in Richtung Feuer, das selbst aus dieser Entfernung bedrohlich und beängstigend aussah. Der ganze Wald schien in Flammen zu stehen. »Was ist mit dem anderen?«
»Der ist tot, glaub ich«, antwortete sie und schüttelte sich, entweder vor Kälte oder vor Schrecken. »Jedenfalls hat er nicht mehr geatmet, und sein Gesicht war völlig verbrannt. Ich wollte ihn noch etwas weiter vom Haus wegziehen, aber er war zu schwer. Darum hab ich erst mal nach dir gesucht.«
Aus der Richtung des Kottens war plötzlich ein lautes Getöse zu hören, und die Flammen schlugen noch höher in den Himmel als zuvor. Vermutlich war gerade der Dachstuhl eingestürzt.
»Wo bleiben die bloß?«, fragte Petra, während die beiden langsam zurückgingen.
»Wer?« Martin versuchte, trotz des verstauchten Knöchels nicht zu humpeln. Um keine weiteren blöden Kommentare seiner Frau zu provozieren.
»Wer wohl? Die Feuerwehr!«
In diesem Moment war in der Ferne ein Martinshorn zu hören. Es waren mehrere Sirenen, wenn Martin es richtig wahrnahm. Die Feuerwehr hatte also den Kotten des Schaddebuern gefunden. Auch ohne Adresse.
Erster Teil
Sonntag
1
Heinrich Tenbrink war ein Frühaufsteher. War das immer schon gewesen. Auch früher, als Karin noch gelebt hatte. Und sogar im Urlaub oder nach langen Geburtstagsfeiern und sonstigen Festen war er stets mit den Hühnern aufgestanden. Sehr zum Verdruss seiner Frau. Morgens um sechs war für Tenbrink die Nacht zu Ende. Dass es inzwischen überhaupt keinen Grund mehr gab, so früh aufzustehen, änderte daran nichts. Seit Beginn des Jahres war er im vorzeitigen Ruhestand, und bereits im Dezember hatte er nicht mehr gearbeitet, weil er noch Resturlaub hatte und Überstunden abfeiern konnte. Doch an der Sechs-Uhr-Regel wollte er nicht rütteln. Es gab schließlich immer was zu tun. Zum Beispiel für Maik Bertram das Frühstück machen, obwohl der – wie einst Karin – ein ausgesprochener Langschläfer war und oft in letzter Sekunde und nur mit einem hastig geschlürften Kaffee im Magen zur Arbeit hetzte. Was Tenbrink nicht davon abhielt, jeden Morgen den Frühstückstisch zu decken. Mit Toast, Müsli und Orangensaft. Manchmal auch mit hart gekochtem Ei. Man konnte ja nie wissen.
Tenbrink und Bertram waren inzwischen wie ein altes Ehepaar. So kam es Tenbrink jedenfalls vor. Seit etwas über einem halben Jahr wohnten sie nun unter einem Dach, Bertram im ersten Stock, Tenbrink im Erdgeschoss, und sie hatten sich allerlei Routinen und Rituale zugelegt, um ihr Zusammen- oder Nebeneinanderwohnen zu vereinfachen und zu strukturieren. Es gab Tenbrinks Frühstücksroutine, Bertrams Quizshow-Fernsehabende, ihr gemeinsames Feierabendbier-Ritual in der Küche, das abwechselnde oder auch gemeinschaftliche Gassigehen mit Locke. Sie hatten sogar ein klar definiertes Prozedere beim Kochen: Bertram war für Pizza, Pasta und Salate zuständig, Tenbrink für Eintöpfe, rustikale Kartoffelgerichte und den Sonntagsbraten.
Tenbrink musste manchmal an diese alte amerikanische Filmkomödie denken, in der ein chaotischer Sportreporter und ein ordnungsfanatischer Hypochonder sich eine riesige Wohnung in New York teilten. Wie üblich konnte er sich weder an den Filmtitel noch an die Namen der Schauspieler erinnern. Im Präsidium wurden Tenbrink und Bertram wegen ihrer Männer-WG oft Sherlock Holmes und Dr. Watson genannt. Und das Haus in der Schöppinger Von-Galen-Straße hieß bei den Kollegen nur »Baker Street«.
Inzwischen waren sie jedoch allesamt Ex-Kollegen von Tenbrink. Denn er war seit knapp einer Woche Kriminalrat a. D.; er hatte sich auf eigenen Wunsch in den Vorruhestand versetzen lassen. Weil es Zeit gewesen war. Weil er an seine Grenzen gestoßen war, körperlich wie geistig. Auch wenn Bertram in den vergangenen Monaten vehement versucht hatte, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und von seinem Entschluss abzubringen. Bei einem Dickkopf wie Tenbrink natürlich vergeblich.
»Exit Light, Enter Night!«, kam es in diesem Moment aus dem Flur. An den lärmenden Klingelton von Bertrams Smartphone würde er sich nie gewöhnen. Manchmal wünschte er sich sogar die alberne Monty-Python-Melodie zurück, die ihm früher so auf den Geist gegangen war. Immer noch besser als dieses Hardrock-Gejaule. Locke schien das ähnlich zu sehen, er kläffte kurz, rannte in den Flur und hockte sich erwartungsvoll vors Sideboard, auf dem Bertrams Handy wegen des Vibrationsalarms zielstrebig in Richtung Abgrund wanderte.
»Arno Bremer«, las Tenbrink auf dem Display und nahm das Handy in die Hand, bevor es vom Sideboard fiel. Aus dem Obergeschoss war kein Geräusch zu hören, deshalb nahm Tenbrink das Gespräch entgegen. »Hallo, Arno«, sagte er, »hier ist Heinrich.«
»Wo steckt Maik?«, fragte Bremer. Erster Hauptkommissar. Tenbrinks Nachfolger. Inzwischen alleiniger Leiter des KK11.
»Der schläft noch.«
»Aha.« Es folgte eine Pause. »Woher weißt du das? Teilt ihr euch inzwischen auch das Schlafzimmer?«
»Was? Wie kommst du darauf?«
»War nur 'n Scherz.« Wieder eine Pause. »Sag Maik, er soll in die Pötte kommen. Wir haben einen Einsatz.«
»In die Pötte?« Tenbrink hasste es, wenn Bremer versuchte, wie Schimanski zu klingen. Es wirkte aufgesetzt und unecht. »Soll er nach Münster kommen?«
»Nein, nach Engerloe. Wir treffen uns in einer halben Stunde auf dem Kirchplatz.«
»Worum geht's denn?«, fragte Tenbrink.
»Kann ich nicht sagen – ist dienstlich«, antwortete Bremer. Dann knackte es in der Leitung.
»Arschloch!«, brummte Tenbrink.
»Das hab ich gehört«, sagte Bremer.
Tenbrink schluckte hart. »Ich dachte, du hättest aufgelegt.«
»Sag Maik Bescheid!«
»In die Pötte kommen, ich weiß«, antwortete Tenbrink und beendete das Telefonat. Dann wiederholte er laut: »Arschloch!«
»Gleichfalls.« Maik Bertram stand in Unterhose und T-Shirt am Fuß der Treppe und kratzte sich den Fünftagebart. »Ich wünsch dir auch einen schönen Morgen.«
»Das war Arno«, teilte Tenbrink ihm mit und hob die Hand zum Gruß. »Du sollst in einer halben Stunde in Engerloe sein.«
»Engerloe?« Bertram tätschelte Locke, der schwanzwedelnd zu ihm gerannt war und nun seine nackten Waden ableckte. »Muss mir das was sagen?«
»Ein Dorf an der holländischen Grenze. Zwischen Vreden und Haaksbergen. Mitten im Venn.« Tenbrink deutete mit der Hand zur Küche. »Frühstück ist fertig.«
»Du hast Frühstück gemacht?«, wunderte sich Bertram und kratzte sich den Hinterkopf. »Um diese Zeit?«
»Mach ich doch immer.«
»Heute ist Sonntag, Heinrich«, antwortete Bertram und grinste.
»Tatsächlich?« Daran hatte er überhaupt nicht gedacht. »Wie auch immer, jedenfalls ist der Tisch gedeckt.«
»Du hast ja gehört, was Arno gesagt hat. Für mehr als 'nen Kaffee wird's nicht reichen.« Bertram schüttelte sein Bein und rief: »Das kitzelt, Locke. Aus!«
»Ich kann dir das Frühstück auch einpacken, wenn du willst; ich hab Eier gekocht«, sagte Tenbrink und hatte plötzlich wieder diese alte Hollywood-Komödie vor Augen. »Sag mal, Maik, kennst du vielleicht eine amerikanische Komödie aus den Fünfzigern oder Sechzigern über eine Männer-WG in New York?«
»Wie kommst 'n jetzt darauf?«, antwortete Bertram, schob Locke weg und hob auffordernd den Zeigefinger, damit der Pudel sich setzte. Was der natürlich nicht tat. »Meinst du den Film mit Walter Matthau und Jack Lemmon?«
Genau! So hießen die Schauspieler! Tenbrink nickte.
»›Ein seltsames Paar‹«, sagte Bertram, hob erneut den Zeigefinger in Richtung Hund und verschwand dann schnell nach oben. Von dort rief er hinunter: »Es gab später auch eine Serie dazu. Die hieß ›Männerwirtschaft‹.«
»Männerwirtschaft«, wiederholte Tenbrink murmelnd und ging in die Küche, um den Kaffee für Bertram einzugießen. Mit wenig Milch und viel Zucker. Wie immer.
2
Das war vermutlich der seltsamste und entlegenste Tatort, den Bertram je zu Gesicht bekommen hatte. Das winzige Bauernhaus war nur noch eine schwarze, verkohlte Ruine, und das Gleiche galt für den angrenzenden Viehstall, in dem sich zum Glück keine Tiere befunden hatten. Sah man einmal von einigen bedauernswerten Hühnern ab. Auch von dem umstehenden Wäldchen war im Umkreis von zehn Metern kein Baum oder Strauch übrig geblieben. Nur schwarz verkohlte und an Gerippe erinnernde Stümpfe, die als klägliche Überreste aus dem rußbedeckten Boden ragten und in dem frühmorgendlichen Dämmerlicht noch unheimlicher und unwirklicher erschienen. An einigen Stellen hatten sich Pfützen aus Löschwasser gebildet, die inzwischen aber bereits zu schaumigem schwarzem Eis gefroren waren. Kein Wunder, bei der Saukälte.
Umgeben war der kleine Schwarzerlenwald von ebenfalls zugefrorenen Feuchtwiesen und unwirtlichem Moorland, dem Engerloer Venn, das nach Süden hin bis zur B 70 reichte und gen Norden bis zur holländischen Grenze. Und es erstreckte sich darüber hinaus, auch wenn das Venn in Twente vermutlich anders hieß.
»Wie kann man hier mitten in der Einöde leben?«, fragte Bertram und schüttelte verständnislos den Kopf. Das tat an den Ohren weh, weil er vergessen hatte, eine Mütze aufzusetzen.
»Die Frage sollte eigentlich lauten: Wie kann man hier sterben?«, erwiderte Heide Feldkamp, die bereits seit einer Stunde vor Ort war und gemeinsam mit den Leuten vom Erkennungsdienst die wenigen verbliebenen Spuren sicherte. Sie zwinkerte Bertram zur Begrüßung zu, zog die Kapuze ihres weißen Einwegoveralls nach hinten und setzte hinzu: »Denn so viel steht laut erstem Befund des Notarztes fest: Der Mann ist weder erstickt noch verbrannt.«
»Ich dachte, er wurde erstochen«, sagte Bremer, der etwas abseits stand und Angst zu haben schien, sich die schicken Schuhe und teuren Kleider zu versauen. »Die Kollegen vom Kriminaldauerdienst haben am Telefon gesagt, dass der Flüchtende ein Messer in der Hand hatte.«
»Das haben die beiden Zeugen ausgesagt«, bestätigte Heide und nickte. »Aber bei der ersten Leichenschau wurden keine entsprechenden Stichwunden an dem Verstorbenen gefunden. Allerdings waren die, sofern es welche gibt, wegen der Verbrennungen auch schwer zu finden, an einigen Stellen hatte sich die Kleidung regelrecht in die Haut gebrannt. Was der Arzt aber entdeckt hat, waren Spuren stumpfer Gewalteinwirkung am Kopf. Ob die Wunden prä- oder postmortal waren, ließ sich wegen der Brandverletzungen nicht ohne Weiteres feststellen. Wir werden die Ergebnisse der Rechtsmedizin abwarten müssen. Die Leiche ist bereits auf dem Weg nach Münster.«
»Wie heißen die Zeugen?«, fragte Bertram und schaute der kleinen Dampfwolke nach, die seinem Mund entströmt war. Er ärgerte sich, dass er Tenbrinks Care-Paket ausgeschlagen hatte. Unwahrscheinlich, dass hier in der Nähe irgendwo ein Frühstück zu ergattern war.
»Petra und Martin Witte. Ein Ehepaar aus Engerloe. Die Kollegen haben ihre Aussage aufgenommen und sie dann nach Hause geschickt. Die beiden sahen wohl ziemlich mitgenommen aus und waren völlig unterkühlt.«
»Was hatten die hier mitten in der Nacht zu suchen?«
»Sie haben sich auf dem Rückweg von irgendeiner Feier im Venn verlaufen. Ein Schneegang mit der Nachbarschaft. Bernd Hölscher überprüft das bereits.«
»Schneegang?«, wunderte sich Bertram und rieb sich mit den Handschuhen die schmerzenden Ohren. »Es hat doch gar nicht geschneit. Ist viel zu kalt für Schnee.«
»Das heißt nur so«, knurrte Bremer und klopfte sich den Dreck vom Ärmel seines Kamelhaarmantels. »Ist so 'ne Tradition im Münsterland.« Er wandte sich an Heide: »Wann haben die Zeugen die Feuerwehr gerufen?«
»Ziemlich genau um Mitternacht.«
Bremer nickte. »Was wissen wir über das Opfer?«
»Friedhelm Harking, laut Ausweis in seiner Brieftasche Jahrgang 1945. Er war früher Torfbauer und lebte hier ganz allein und wie ein Einsiedler im Venn. Auf Plattdeutsch hieß der Mann Schaddebuer, das sagt jedenfalls der Zeuge.«
»Familie?«, fragte Bremer.
»Angeblich hat oder hatte er einen Sohn in Münster. Bernd gibt uns die Adresse durch, sobald er fündig geworden ist.« Heide strich sich die blonden Haare hinter die Ohren, zog sich die Kapuze wieder über den Kopf, grinste in Bertrams Richtung und fragte: »Kalte Ohren?« Dabei fuhr sie ihm wie beiläufig mit den behandschuhten Fingern über den Hinterkopf.
»Nicht!«, murmelte er leise, schob ihre Hand weg und schaute wie ertappt zu Bremer, der aber immer noch damit beschäftigt war, irgendwelche Rußflecken von seinem Ärmel zu wischen.
»Gut geschlafen?«, flüsterte sie und hob neckisch die Augenbrauen. »Und schön geträumt?«
Bertram machte einen Schritt zur Seite und schwieg beredt. Ja, er hatte gut geschlafen. Sehr gut sogar. Wie immer, wenn er vorher Sex gehabt hatte. Und er war froh, dass er anschließend nicht in Heides Bett eingeschlafen war, sondern darauf bestanden hatte, nach Hause zu fahren. Als hätte er geahnt, dass sie am Morgen zu einem Einsatz gerufen würden.
»Konnten die Zeugen den anderen Mann beschreiben?«, fragte Bremer, schlug den Kragen seines Mantels hoch und korrigierte den Sitz seiner schwarzen Fellmütze, die er statt des üblichen Borsalino-Huts auf dem Kopf trug. »Größe, Alter, Haarfarbe?«
»Besser als das!« Heide lächelte schelmisch und ging zum Transporter des Erkennungsdienstes, der nur ein paar Meter entfernt geparkt war. Sie öffnete die Heckklappe, kramte in einem beschrifteten Karton, in dem sich die gesicherten Beweismittel befanden, und zog einen durchsichtigen Plastikbeutel heraus.
»Was ist das?«, fragte Bremer.
»Das haben wir in seinem Mantel gefunden.« Heide wedelte mit dem Beutel, in dem sich etwas Graues befand. »Martin Witte, einer der Zeugen, ist dem flüchtenden Mann mit dem Messer hinterhergerannt.«
»Er hat einen bewaffneten Mann verfolgt?«, wunderte sich Bertram. »Ganz schön mutig.«
»Eher betrunken, sagen die Kollegen vom KDD«, antwortete Heide und zuckte mit den Schultern. »Das Messer hat der Mann offenbar unterwegs weggeworfen. Wir suchen noch danach. Witte hat den Kerl zwar zu fassen bekommen, konnte ihn aber nicht überwältigen. Er wurde mit einem Ast geschlagen und fiel dann einen Hang hinunter.« Sie machte eine Kunstpause, lächelte geheimnisvoll und setzte dann hinzu: »Aber vorher hat er ihm den Mantel entrissen.«
»Und was ist das?«, wiederholte Bremer seine Frage und deutete auf den Asservatenbeutel.
»Ein Führerschein«, erwiderte Heide mit triumphalem Grinsen im Gesicht. »Der steckte in der Innentasche des Mantels. Wir wissen, wer der Mann ist.« Es war offensichtlich, dass sie dieses wesentliche Detail ganz bewusst bis zuletzt verschwiegen hatte. Kindische Effekthascherei, fand Bertram.
»Und warum erfahre ich das erst jetzt?«, schimpfte Bremer und zupfte verärgert an den Enden seines Schnauzbarts. »Warum sagst du das nicht gleich? Der Mann muss sofort zur Fahndung ausgeschrieben werden.«
»Ist doch längst passiert«, konterte Heide und schaute hilfesuchend zu Bertram, der jedoch mit den Schultern zuckte und ihr die Beweismitteltasche aus der Hand nahm. »Ich hab Bernd den Namen und alle Daten durchgegeben. Er kümmert sich darum. Wegen der Nähe zu Holland wird umgehend eine Grenzfahndung eingeleitet.«
»Das ist meine Aufgabe!«, schnauzte Bremer und stampfte wie ein kleines Kind auf dem Boden auf. »Noch bin ich hier der leitende Ermittler, verdammt!«
»Du warst nicht hier«, erwiderte Heide nun ebenfalls erbost. »Und es musste schnell gehen!«
Bertram hielt sich den Plastikbeutel nah vors Gesicht, um den darin befindlichen Gegenstand im diffusen Dämmerlicht besser erkennen zu können. Bei dem Führerschein handelte es sich um einen dieser uralten mausgrauen Lappen aus speckigem Papier, die in der BRD bis in die Achtzigerjahre ausgegeben wurden. Als gebürtiger DDR-Bürger kannte er diese alten »Fleppen« nur von Fotos und hatte noch nie einen in der Hand gehalten. Bertram las, was auf der Vorderseite stand, und hielt den Atem an.
»Du hättest mich anrufen müssen!«, fuhr Bremer in seinem beleidigten Tonfall fort. »Ich bin es schließlich auch, der sich gegenüber der Staatsanwaltschaft verantworten muss. Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder macht, was er will?!«
»Warum regst du dich so auf?«, antwortete Heide verstimmt und verschränkte die Arme vor der Brust. »Am Ende ist es ohnehin Bernd Hölscher, der die Fahndung rausgibt.«
»Die Fahndung läuft längst«, sagte Bertram und reichte Bremer den Beweismittelbeutel.
»Sag ich doch«, meinte Heide.
»Sie läuft seit über einem Jahr, und zwar über Europol«, antwortete Bertram und wandte sich an Bremer: »Lies mal, Arno!«
Bremer starrte erst zu Bertram, dann auf den Führerschein, und las laut: »Führerschein für Herrn Heinrich-Josef Schultewolter, geboren am 14. 07. 1941 in Ahlbeck, Kreis Altwick.« Er schüttelte den Kopf und schaute Bertram fragend an.
»Fällt dir gar nichts auf?«
»Wunderst du dich über den Kreis Altwick? Den gibt's schon seit den Siebzigern nicht mehr. Wegen der Gebietsreform. Das gehört jetzt alles zum Kreis Borken.«
»Nein«, antwortete Bertram und bemühte sich, nicht die Augen zu verdrehen. »Ich meine den Namen.«
»Heinrich-Josef Schultewolter?«, fragte Bremer.
»Verdammt!«, entfuhr es Heide. Bei ihr war der Groschen gefallen.
»Exakt!« Bertram nickte.
»Die Frau am Galgen!«, rief Heide.
Bremer schien noch immer nicht zu verstehen.
»Schultewolter ist der Mann, der damals Heinrich Tenbrink am Ahlbecker Galgenhügel den Schädel eingeschlagen hat«, erklärte Bertram. »Und der seitdem trotz Steckbrief und Europol-Fahndung spurlos verschwunden ist. Wie vom Erdboden verschluckt.«
»Das ist ja 'n Ding«, murmelte Bremer. »Den seltsamen Kauz hatte ich völlig vergessen.«
Der Satz hätte von Tenbrink stammen können, dachte Bertram und grinste. Auch wenn Tenbrink den alten Schultewolter bestimmt nicht vergessen hatte. Jeder Blick in den Spiegel weckte vermutlich die Erinnerung. Denn die Narbe an Tenbrinks Schläfe war immer noch deutlich zu sehen.
»Heide!«, rief in diesem Moment einer der Kollegen vom Erkennungsdienst und näherte sich ihnen mit einer großen, durchsichtigen Asservatentasche. »Wir haben das Messer gefunden! Nur ein paar Meter von der Stelle entfernt, wo der Zeuge in den Bach gefallen ist.«
»Blutspuren?«, fragte sie.
»Positiv!«, antwortete der Kollege vom ED und reichte ihr die Tasche. »Und jede Menge Fingerabdrücke.«
»Na also«, sagte Bremer und starrte säuerlich auf seine rußgeschwärzten Schuhe. »Jetzt brauchen wir nur noch diesen Schultewolter. Ohne Mantel ist der bei der Eiseskälte bestimmt nicht weit gekommen. Diesmal entwischt er uns nicht.«
»Die Wittes haben ausgesagt, dass er gehumpelt hat«, berichtete Heide und brachte den Führerschein und das Messer zum Transporter. »Vielleicht ist er verletzt. Könnte doch sein, dass es einen Kampf zwischen ihm und Harking gegeben hat.«
»Der kommt nicht weit«, wiederholte Bremer.
Er muss nicht weit kommen, wenn er sich im Venn auskennt, dachte Bertram, nickte aber stumm. Er wollte nicht auch noch als Miesepeter in Tenbrinks Fußstapfen treten.
3
»Was wollen Sie?« Die Stimme klang mürrisch und krächzend. Durch den Türspalt waren nur eine Nase und ein Paar Augen zu sehen. Und weiter unten ein Fuß im blauen Filzpantoffel.
»Wir sind von der Kriminalpolizei«, antwortete Bremer und hielt seinen Dienstausweis vor den Spalt. »Ich bin Erster Hauptkommissar Bremer, das ist Oberkommissar Bertram.« Er trat ganz nah an die Tür, obwohl Hermann Harking keinerlei Anstalten machte, sie zu öffnen.
»Das sagten Sie bereits an der Haustür. Worum geht's?«
»Das würden wir ungern im Treppenhaus besprechen«, erwiderte Bertram und nickte bedächtig. »Es geht um Ihren Vater.«
»Was ist mit ihm?«
»Können wir hereinkommen?«
»Was ist mit ihm?«, wiederholte Harking.
»Er ist tot«, knurrte Bremer.
Nase, Augen und Filzpantoffel verschwanden. Dann fiel die Tür unvermittelt ins Schloss.
Bertram und Bremer schauten sich überrascht an. Ebenso plötzlich wurde die Tür wieder geöffnet, und ein etwa fünfundvierzig Jahre alter Mann stand in einer Mischung aus Jogging- und Hausanzug vor ihnen: blauer Fleece-Pullover mit Stehkragen und Reißverschluss, karierte Flanell-Hose.
»Wie ist er gestorben?«, fragte Hermann Harking und hob sofort abwehrend die rechte Hand. »Nein, lassen Sie mich raten. Er ist betrunken mit seiner Brummfiets gegen einen Baum gefahren. Oder in seiner eiskalten Bruchbude erfroren.«
»Er wurde ermordet«, sagte Bremer und betrat den länglichen Wohnungsflur, von dem mehrere Türen abgingen.
»Vermutlich ermordet«, präzisierte Bertram und folgte ihm.
»Er wurde erschlagen«, sagte Bremer und setzte vorsorglich hinzu: »Nach jetzigem Kenntnisstand.«
Harking schüttelte verwirrt den Kopf und schien nicht recht zu begreifen, was ihm gerade mitgeteilt wurde. Er fuhr sich mit der Hand durch das strubbelige, an den Schläfen graue Haar, deutete mit der anderen Hand nach links, wo sich die Küche befand, und fragte: »Wollen Sie Kaffee? Ich hab mir vorhin welchen gemacht. Ist noch genug übrig.«
»Nein, danke«, antwortete Bremer und blieb direkt vor Harking stehen, sodass sich ihre Nasen beinahe berührten. »Der Tod Ihres Vaters scheint Sie nicht besonders mitzunehmen oder zu berühren.«
Bevor Harking darauf etwas erwidern konnte, sagte Bertram: »Ich hätte gern einen Kaffee. Mit Milch und Zucker. Sehr nett von Ihnen.« Er zwängte sich an den beiden vorbei, ging in die schmale und etwas vernachlässigt aussehende Küche und setzte sich an den Esstisch, auf dem sich benutztes Geschirr, verschiedene Zeitschriften und eine leere Pizza-Schachtel stapelten.
»Ja, sicher, kein Problem.« Harking ging zu einem leicht angegilbten Hängeschrank, holte zwei klobige Tassen heraus, stellte sie auf den Tisch und goss sich und Bertram Kaffee aus einer Thermoskanne ein. »Die Milch ist leider schlecht geworden. Geht auch Kaffeesahne?« Ohne auf eine Antwort zu warten, ging er zum Kühlschrank und holte die Sahne heraus. »Zucker steht auf dem Tisch, und Löffel sind in der obersten Schublade.« Er deutete zu einer Anrichte neben dem Fenster.
»Herr Harking?«, fragte Bremer, der an der Küchentür stehen geblieben war und seine Fellmütze knetete.
»Ja?« Hermann Harking wollte sich gerade an den Tisch setzen und schaute verwirrt zur Tür. »Ach so, ja. Natürlich. Warum mich der Tod meines Vaters nicht so mitnimmt?«
»Genau«, sagte Bremer.
»Für mich ist mein Vater bereits vor langer Zeit gestorben.« Harking setzte sich, nippte an seinem Kaffee, schaute nachdenklich aus dem Fenster und setzte hinzu: »Ich hatte seit Jahren keinerlei Kontakt zu ihm.«
»Warum?« Bertram rührte Zucker in seinen Kaffee. Die Kaffeesahne ließ er unangetastet. Die klumpigen Brocken auf der Oberfläche sahen nicht gerade verlockend aus.
»Was wissen Sie über meinen Vater?«, antwortete Harking mit einer Gegenfrage.
»Noch sehr wenig.« Bertram nahm einen Schluck und stellte erstaunt fest, wie gut der Kaffee schmeckte. Ein wenig nussig und sehr aromatisch. »Ihr Vater war Torfbauer, stimmt das?«
»Früher mal«, antwortete Harking und nickte. »Im Engerloer Venn wird schon lange kein Torf mehr abgebaut. Höchstens für den Eigenbedarf und manchmal auch für die paar Touristen, die sich dorthin verirren. Das ganze Bruchland soll renaturiert und irgendwann wieder zum Hochmoor werden.«
»Uns wurde gesagt, dass Ihr Vater wie ein Eremit in dem alten Bauernkotten an der Grenze lebte.«
»Wie ein Eremit?« Harking zuckte mit den Schultern. »Das sind ja normalerweise irgendwelche Heiligen oder frommen Leute. Und das war mein Vater bestimmt nicht. Ein kauziger Waldschrat – so würde ich ihn bezeichnen. Kein angenehmer Mensch und erst recht kein guter Vater.«
»Er ist tot«, bemerkte Bremer vorwurfsvoll.
»Und deshalb soll ich jetzt nur Gutes über ihn sagen?«
»Die Wahrheit wäre uns lieber«, entgegnete Bertram mit einem Seitenblick zu seinem Chef.
»Sie kennen bestimmt diesen alten Spruch«, sagte Harking. »Immer nur ›Ik, ik, ik‹ wie ein Buchfink und ›Mien, mien, mien‹ wie eine Goldammer. Genau so war er. Und wenn man nicht nach seiner Pfeife tanzte, dann wurde er zum Rumpelstilzchen.«
Nein, diesen Spruch kannte Bertram noch nicht. Tenbrink hätte sich bestimmt darüber gefreut. »Warum hatten Sie keinen Kontakt mehr zu Ihrem Vater?«, fragte er und nahm einen großen Schluck Kaffee. »Was ist geschehen?«
»Ihm hat meine Frau nicht gefallen. Darum hat er nicht mehr mit mir gesprochen. ›Met Patjacken küür ik nich‹, hat er erklärt, und daran hat er sich gehalten. Kein Wort mehr. Fast zwanzig Jahre lang.«
»Weil Ihre Frau eine Holländerin ist?«, hakte Bertram nach.
»War«, antwortete Harking. »Mieke ist seit zehn Jahren tot. Sie ist mit dem Fahrrad von einem abbiegenden Lkw überfahren worden.« Er deutete aus dem Fenster. »Nur ein paar Straßen weiter.«
»Das tut mir leid«, sagte Bertram.
»Mir auch.« Wieder ging sein Blick aus dem Fenster. Als wäre er in Gedanken ganz weit weg. »Aber dass sie aus Holland kam, war nicht der eigentliche Grund, warum Papa nichts mit uns zu tun haben wollte. Ihm hat nicht gepasst, dass Mieke nicht in der Kirche war und wir nur standesamtlich geheiratet haben. Für ihn haben wir eine wilde Ehe geführt, da wir ohne Segen der katholischen Kirche waren.«
Bertram bemerkte, dass Harking zum ersten Mal »Papa« und nicht »mein Vater« gesagt hatte, und fragte: »Ihr Vater war offensichtlich sehr religiös?«
»Ein Heuchler war er«, sagte Harking und deutete auf Bertrams Tasse. »Wollten Sie nicht Milch in Ihren Kaffee?«
»Wieso Heuchler?« Bertram schüttelte den Kopf und hielt die Hand über seine Tasse, als Harking nach der Kaffeesahne griff.
»Eigentlich war er ein gottloser Heide, wie er im Buche steht. Hat an Moorgeister und Gespenster und Wiedergänger geglaubt. Das ganze abergläubische Spöken-Zeug, an das die Leute früher geglaubt haben.« Harking lachte abfällig und knallte plötzlich die Kaffeesahne auf den Tisch. »Aber wehe, man hat was gegen die katholische Kirche oder den Papst gesagt, dann wurde er fuchsteufelswild. Dabei ist er selbst nur unregelmäßig in die Messe gegangen, weil er sich mal mit dem Pastor gestritten hat. Den hat er danach auch nicht mehr gegrüßt. Aber überall Kreuze, Marienbilder und neben jeder Tür ein Weihwasserbecken. Dass ich Mieke ohne Segen der Kirche geheiratet hab, hat er mir nie verziehen.« Er hielt inne und schüttelte plötzlich den Kopf. »Nein, er hat mir nicht verziehen, dass ich ohne seinen Segen geheiratet habe.«
»Und in all der Zeit haben Sie kein Wort mit ihm gesprochen?«, fragte Bremer überrascht, der immer noch an der Tür stand, als wollte er den Ausgang bewachen. »Auch nicht nach dem Tod Ihrer Frau? Nicht mal am Telefon?«
»Telefon?« Hermann Harking verschluckte sich an seinem Kaffee und schüttelte erneut den Kopf. »Sie wissen tatsächlich sehr wenig über meinen Vater! Ein Telefon wäre dem Schaddebuer niemals ins Haus gekommen. Von einem Handy ganz zu schweigen. Das war alles neumodisches Teufelszeug für ihn. Düüwelskraom! In seinem Kotten gibt's keinen Fernseher, keinen Computer und keine ordentliche Heizung. Nur den alten Ofen in der Stube; auf dem hat er auch gekocht. Das Haus ist auch nach wie vor nicht an die Kanalisation angeschlossen. ›Dat bruukt wi nich‹, hat er gemeint. Das Wasser kam bis zuletzt mithilfe einer Pumpe direkt aus dem Grundwasser. Ohne Genehmigung, versteht sich.«
»Woher wissen Sie das, wenn Sie seit Jahren nicht auf dem Hof waren?«, wunderte sich Bertram und leerte seine Tasse.
»Das weiß ich von Bernhard Denhöfde. Der hat seinen Hof ganz in der Nähe. Er war früher unser Noodnaober. Als es noch so was wie bäuerliche Notnachbarn gab. Ich ruf ihn manchmal an, um zu erfahren, wie's um Papa steht.« Er seufzte und biss sich auf die Unterlippe. »Das brauch ich dann jetzt wohl nicht mehr.«
»War das nicht sehr einsam da draußen im Venn?«, wollte Bertram wissen. »Ich meine, für Sie, als sie noch ein Kind waren.«
»Damals fand ich das ganz normal. Ich kannte es ja nicht anders. Außerdem gab's ja noch ein paar Kinder in der Nachbarschaft. Und die Denhöfdes hatten auch einen Fernseher. Und natürlich ein Telefon, falls es mal was Dringendes gab. Nur im Winter war's fürchterlich, weil's überall gezogen hat und eiskalt war. Ich hab dann immer mit Wollmütze, dicken Socken und Handschuhen geschlafen.« Er lächelte nachdenklich und setzte hinzu: »Heute würde sich vermutlich das Jugendamt einschalten.«
»Sie sind Lehrer, nicht wahr?«, fragte Bertram.
»Woher wissen Sie das?« Harking wunderte sich kurz und lachte dann. »Ich vergaß, Sie sind ja von der Polizei. Ja, ich unterrichte an einer Grundschule. Das hat meinem Vater auch nicht gepasst. Für ihn war das ein Frauenberuf. Fast so schlimm wie Erzieher oder Krankenpfleger. Oder Friseur.«
»Wollen Sie gar nicht wissen, wer Ihren Vater getötet hat?«, meldete sich Bremer von der Tür.
»Wissen Sie denn schon, wer es war?« Harking klang überrascht. »Haben Sie den Mörder gefasst?«
»Darüber können wir zum jetzigen Zeitpunkt …«, begann Bertram, doch Bremer unterbrach ihn: »Wo waren Sie gestern Abend, Herr Harking? Zwischen elf Uhr und Mitternacht.«
»Hier.« Harking deutete auf die leere Pizzaschachtel. »Mit einer Pizza vorm Fernseher. Im Ersten lief ein Krimi.«
»Allein?«
»Allein.« Er schaute Bremer fragend an. »Glauben Sie, dass ich meinen Vater getötet habe?«
Statt einer Antwort zuckte Bremer mit den Schultern, setzte seine Fellmütze auf und fragte: »Sagt Ihnen der Name Schultewolter etwas?«
»Heini Schultewolter?« Harking nickte verwirrt. »Was hat der denn damit zu tun?«
»Sie kennen ihn also?«
»Papa und er waren früher Freunde und Jagdgefährten. Jedenfalls so was in der Art. Schmuggler und Wilderer, so könnte man es auch bezeichnen. Ich kann mich noch erinnern, dass die oft nächtelang Skat gespielt und selbst gebrannten Schnaps getrunken haben. Zusammen mit Bernhard Denhöfde. Ist aber schon ewig her. Da hat Mama noch gelebt.«
»Wann ist Ihre Mutter gestorben?«, erkundigte sich Bertram.
”1999. Sie litt an einer nicht diagnostizierten Herzinsuffizienz.«
»Herzschwäche?«
Harking nickte. »Mama war damals kaum älter als ich heute. Nicht mal fünfzig.« Er atmete tief aus und stierte auf die Tischplatte. »Das war ein paar Jahre, bevor mein Vater das Land verkauft hat. Von dem Geld hat sie leider nie was gesehen. Nach ihrem Tod ist Papa immer kauziger und eigenbrötlerischer geworden. Unausstehlicher.«
»An wen hat Ihr Vater Land verkauft?«, wollte Bertram wissen.
»An den Bund oder die Gemeinde. So genau weiß ich das nicht. Es ging um die neue Zufahrt zur B 70 und eine direkte Verbindung nach Holland. Die neue Straße führte genau durch unser Land.« Er schnaufte abfällig und korrigierte sich: »Papas Land. Damals stand das alles noch nicht unter Naturschutz wie heute.«
»Haben Sie zu der Zeit noch bei Ihren Eltern gewohnt?«, fragte Bertram und übersah geflissentlich Bremers demonstrative Blicke auf die Armbanduhr.
»Gott bewahre!« Harking lachte gallig. »Damals hab ich schon in Münster studiert. Genauso wie Greta.«
»Greta?«, hakte Bertram nach. »Wer ist das?«
»Meine jüngere Schwester. Die wohnt inzwischen in Usedom.«
»Auf Usedom«, korrigierte Bertram ihn automatisch.
»Nein, in Usedom«, entgegnete Harking und lächelte. »Ich meine die Stadt Usedom auf der Insel Usedom. Greta hat es auch nicht mehr in Papas Nähe ausgehalten. Und weiter weg als Usedom geht's ja kaum. Jedenfalls nicht in Deutschland.«
»Was hat Ihre Schwester studiert?«, wollte Bertram wissen.
»BWL und Steuern an der Fachhochschule. Sie arbeitet inzwischen als Steuerberaterin, aber nur noch halbtags, wegen der Kinder.« Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht, als er hinzusetzte: »Ich muss sie anrufen und ihr sagen, was mit Papa passiert ist. Oder wollen Sie vorher mit ihr sprechen?«
»Vielleicht ist es besser, wenn sie es von Ihnen erfährt«, antwortete Bertram. »Aber wir werden auf jeden Fall mit ihr sprechen müssen.«
»Sicher. Ja. Klar.« Der Gedanke, seiner Schwester vom Tod des Vaters zu berichten, schien ihm arg zuzusetzen.
»Danke, Herr Harking«, sagte Bremer, gab Bertram mit einer Kopfbewegung das Zeichen zum Aufbruch und wandte sich zum Ausgang. »Wir geben Ihnen Bescheid, sobald die Leiche Ihres Vaters für die Beerdigung freigegeben wird. Die Obduktion kann aber wegen der Verbrennungen noch etwas dauern.«
»Verbrennungen?« Hermann Harking fuhr aus seinen Gedanken auf und schaute Bremer verwirrt an. »Wieso denn Verbrennungen? Haben Sie nicht gesagt, dass er erschlagen wurde?«
»Der Kotten ist niedergebrannt«, antwortete Bertram und erhob sich. »Aber daran ist Ihr Vater nicht gestorben.«
»Ich versteh nicht.« Harking schüttelte den Kopf. »Hat der Mörder das Feuer gelegt?«
»Möglicherweise, aber das wissen wir noch nicht.«
»Maik!«, rief Bremer und verließ die Küche.
»Danke für den Kaffee.« Bertram reichte Harking zum Abschied die Hand. »War sehr lecker.«
»Douwe Egberts«, erwiderte Hermann Harking und schaute aus dem Fenster. »Das war Miekes Lieblingskaffee.« Er lachte bitter und setzte hinzu: »Papa hat immer Patjackenkoffie dazu gesagt.«
4
»Das klingt ein bisschen nach ›Der Mann in den Bergen‹, findet ihr nicht?« Frank Stukenkemper schob sich die schwarze Hornbrille auf die Nasenwurzel und griente verschmitzt. »Ihr wisst schon, diese Serie aus den Siebzigern über den bärtigen Kerl, der in so 'ner Holzhütte in der Pampa lebt und mit wilden Tieren spricht.«
»Du meinst den heiligen Franz von Assisi«, antwortete Bertram schmunzelnd und schaute dabei zu Arno Bremer, der ihm direkt gegenüber saß und überhaupt nicht erfreut dreinschaute. Stukenkemper war noch zu Tenbrinks Zeiten und auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin vom Kriminalkommissariat 12 – Jugendkriminalität und Körperverletzung – zum KK11 gewechselt und erheiterte – oder nervte – seitdem die Kollegen des Kommissariats für Todes- und Sexualdelikte mit seinen flapsigen Sprüchen und absonderlichen Vergleichen. Vor allem alte Fernsehserien und musikalische Gassenhauer schienen es ihm angetan zu haben.
»Nein! Ich meine diese Serie über den amerikanischen Trapper!«, rief Stukenkemper, der offenbar nicht verstanden hatte, dass Bertram einen Scherz gemacht hatte. »Die mit dem schnulzigen Titelsong.« Und bevor ihn jemand daran hindern konnte, trällerte er los: »Maybe! There's a world where we don't have to run …«
»Frank, das reicht!«, unterbrach ihn Bremer und klatschte laut in die Hände. Wie ein Lehrer, der den Klassenclown in die Schranken weisen will. »Aber du hast natürlich recht. Friedhelm Harking hat tatsächlich wie ein Einsiedler im Venn gelebt. Allerdings glaube ich nicht, dass er mit den Tieren geredet hat.«
»Er hat ja nicht einmal mit seinem eigenen Sohn geredet«, ergänzte Bertram.
»Danke, Maik«, sagte Bremer und zog eine Flappe. »Können wir jetzt bitte ohne kluge Sprüche fortfahren? Dafür wäre ich euch sehr verbunden!«
»Der Vergleich mit dem Trapper stimmt auch in anderer Hinsicht nicht ganz«, meldete sich Bernd Hölscher zu Wort und streichelte Struppi, der es sich wie üblich auf seinem Schoß bequem gemacht hatte. Auch der Pudel war eine Erbschaft von Tenbrink. Oder eine Altlast, wenn man es mit Bremers Augen betrachtete: Tenbrinks Zweitpudel, der inzwischen von Bernd Hölscher adoptiert und mit einer klassischen Pudelfrisur versehen worden war. Vorne lang, hinten kurz.
»Wieso stimmt der Vergleich nicht?«, fragte Stukenkemper.
»Harkings Haus liegt nicht wirklich in der Pampa«, antwortete Hölscher. »Bis Engerloe sind es gerade mal vier Kilometer, und Haaksbergen auf der holländischen Seite ist sogar noch näher. Der Kotten war außerdem ans Stromnetz angeschlossen, und auch die Telefonleitung war bis zu seinem Haus verlegt. Friedhelm Harking hat nur beides kaum oder gar nicht benutzt.«
»Kommt letztlich aufs Gleiche raus«, fand Stukenkemper. »Keine Glotze, kein Internet, kein Telefon. Dafür Grundwasser aus dem eigenen Brunnen, vermutlich ein Plumpsklo mit Sickergrube neben der Hütte, und geheizt und gekocht hat er mit 'nem vorsintflutlichen Metallofen. Das ist doch nicht normal. Wir leben schließlich nicht mehr in der Steinzeit.«
»Ein kauziger Waldschrat«, sagte Bertram und schaute aus dem Fenster, an dem sich einige Eisblumen gebildet hatten. »So hat sein Sohn ihn genannt.«
»Unsere Arbeit wird dadurch jedenfalls nicht einfacher«, meinte Heide, die neben Bertram am Konferenztisch saß und wie zufällig mit ihrem Fuß seine Wade berührte. »Es gibt keine Telefongespräche, keine Handydaten und keine Internet-Browserverläufe, die man auswerten könnte. Mit neugierigen Nachbarn, die irgendwas gesehen oder gehört haben könnten, sieht's auch schlecht aus. Friedhelm Harking hat nicht einmal ein Auto gehabt, mit dem er in irgendwelche Radarfallen gefahren sein könnte. Nur ein museumsreifes Fahrrad mit Hilfsmotor. Eine Kreidler J 50, die stand hinterm Haus.«
»Brummfiets«, murmelte Bertram.
»Wie früher bei Sherlock Holmes und Dr. Watson«, sagte Reinhard Gehling, der Jüngste im Team, und schaute zu Bertram, senkte jedoch sofort den Blick und bekam einen roten Kopf.
Bertram war sich nicht sicher, ob das als Anspielung auf ihn und Tenbrink gemeint gewesen war.
»Zu allem Überfluss ist der gesamte Tatort verbrannt und verkohlt«, setzte Heide hinzu und fuhr mit dem Fuß an Bertrams Wade hoch. »Und damit sind fast alle Spuren vernichtet. Was das Feuer übrig gelassen hat, wurde durch das Löschwasser zerstört. Oder durch die Horden von Feuerwehrleuten, die am Tatort unterwegs waren. Keine verwertbaren Reifenspuren und bislang keine brauchbaren Fuß- oder Fingerabdrücke. Kriminaltechnisch ist das Ganze ein einziges Desaster.«
»Wir haben das Messer«, gab Bertram zu bedenken, rückte mit seinem Stuhl nach hinten, zog das Bein weg und schüttelte unmerklich den Kopf in Heides Richtung. »Mit dem Blut und den Fingerabdrücken. Besser als nichts.«
»Die Obduktion gestaltet sich wegen der Vielzahl an Brandwunden und äußeren Einwirkungen schwierig«, antwortete Arno Bremer und schaute in seine Unterlagen. »Aber Dr. Kemper hat keinerlei Stichwunden an der Leiche gefunden, und das Blut an dem Messer stammt definitiv nicht von Friedhelm Harking. Du hast recht, Maik, wir haben das Messer, aber es ist nicht die Tatwaffe.«
Bertram hasste es, wenn Bremer seine Sätze mit »Du hast recht« anfing und gerne die Namen der Angesprochenen anfügte. Das sollte vermutlich aufbauend und positiv klingen, wirkte aber immer etwas aufgesetzt. Wie aus einem Motivationslehrgang für polizeiliche Führungskräfte.
»Woran genau ist er denn gestorben?«, fragte Stukenkemper.
»Massive Gewalteinwirkung auf den Schädel«, antwortete Bremer. »Laut innerer Leichenschau ist er an den Kopfverletzungen gestorben.«
»Das Feuer war gegen Mitternacht«, sagte Stukenkemper. »Aber wann wurden ihm die Verletzungen zugefügt?«
»Kurz vorher, laut Dr. Kemper.« Wieder schaute Bremer in seine Unterlagen. »Eine halbe, höchstens eine Stunde vor dem Eintritt des Todes. Das lässt sich aus der Schwere und der Position der Verletzungen schließen.«
»Und die Tatwaffe?«, fragte Bertram.
»Im Haus wurde ein gusseiserner Schürhaken gefunden«, meldete sich Heide zu Wort. »Nicht in der Nähe des Ofens, sondern mitten in der Wohnstube, gleich neben dem Esstisch. Die Kollegen vom Erkennungsdienst sind noch dran. Fingerabdrücke waren allerdings nicht darauf, und was DNA-Spuren anbelangt, haben sie uns auch wenig Hoffnung gemacht. Feuer und Wasser, da bleibt nicht viel übrig.«
»Aber wir kennen doch den Mörder«, meinte Stukenkemper und kraulte seine buschigen Siebzigerjahre-Koteletten. »Heinrich-Josef Schultewolter war zur Tatzeit am Tatort. Er war verletzt, vermutlich nach einem Kampf mit dem Opfer, und er ist davongerannt, als die beiden Zeugen auftauchten. Viel klarer geht's nicht, oder?« Nach kurzem Zögern setzte er hinzu: »Und es wäre nicht das erste Mal, dass er jemandem den Schädel eingeschlagen hat.«
»Aber warum hat er den toten oder sterbenden Harking aus dem brennenden Haus getragen?«, fragte Gehling, während er gleichzeitig auf die Tischplatte starrte, als studierte er die Maserung des Holzes. »Sollte er das Feuer gelegt haben, um die Spuren der Tat zu vernichten, dann wäre es doch ziemlich dämlich, die Leiche aus dem Feuer zu holen.«
»Das ist ein sehr gutes Argument, Reinhard«, sagte Bremer.
Bertram verdrehte die Augen.
»Vielleicht war das Feuer nur ein Versehen«, vermutete Hölscher und tätschelte Struppis frisch gebürstete Krone. »Oder Harkings Tod war ein Versehen. Ein Unfall. Könnte doch sein, dass er seinen Freund nach der Tat retten wollte, weil er gar nicht beabsichtigt hatte, ihn zu töten.«
»Vielleicht stammt ja das Blut am Messer von Schultewolter«, mutmaßte Stukenkemper. »Harking sticht aus irgendeinem Grund auf Schultewolter ein, und der zieht ihm als Antwort den Schürhaken über die Birne.«
»Das erklärt aber weder das Feuer«, entgegnete Bertram, »noch die Tatsache, dass Schultewolter den Toten aus dem Haus getragen hat.«
»Spekulationen bringen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich weiter«, entgegnete Bremer und wandte sich an Heide Feldkamp. »Hat die Spurensicherung schon Hinweise auf die Brandursache gefunden?«