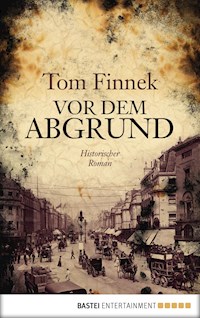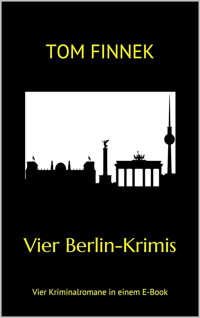4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Münsterland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein nebelverhangener Herbstmorgen, ein kleines Dorf im Münsterland und ein historischer Galgen - an dem eine bekannte Schauspielerin hängt. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Kommissar Tenbrink wird hellhörig, als er erfährt, dass die Schwester der Toten vor sechzehn Jahren an genau diesem Ort auf tragische Weise ums Leben kam. Ein bloßer Zufall? Tenbrink und sein junger Kollege Bertram glauben nicht an Zufälle. Irgendwo muss es eine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen geben. Während ihrer Ermittlungen graben sie tief in der Vergangenheit der Dorfbewohner - was nicht allen im Ort gefällt. Und um ein altes Geheimnis zu schützen, schreckt jemand auch vor weiteren Morden nicht zurück.
"Galgenhügel" ist der Auftakt der neuen Krimi-Reihe von Erfolgsautor Tom Finnek um das Ermittlerteam Tenbrink und Bertram: Westfälischer Dickschädel mit Erinnerungslücken trifft auf strafversetzten Magdeburger mit heikler Vergangenheit.
LESER-STIMMEN
"Die vielen Spuren, denen das Ermittler-Duo unter erhöhtem Zeitdruck nachgehen muss, verdichten sich zu einem fulminanten Showdown." (Venatrix, Lesejury)
"Ein wirklich gut gelungener Krimi der alle Krimifans begeistern wird. Ein absolutes Muss!" (Kessi76, Lesejury)
"Tom Finnek hat hier ein ungewöhnliches, sehr sympathisches Ermittlerpaar geschaffen, das durch die bildhafte Beschreibung sofort im Kopf des Lesers haften bleibt. Die beiden agieren glaubhaft und kommen authentisch rüber." (Ladybella911, Lesejury)
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelZitatPrologErster Teil1234567891011Zweiter Teil12345678910Dritter Teil12345678IntermezzoVierter Teil1234567Fünfter Teil1234567891011Sechster Teil12345678910EpilogÜber den AutorImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ein nebelverhangener Herbstmorgen, ein kleines Dorf im Münsterland und ein historischer Galgen – an dem eine bekannte Schauspielerin hängt. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Kommissar Tenbrink wird hellhörig, als er erfährt, dass die Schwester der Toten vor sechzehn Jahren an genau diesem Ort auf tragische Weise ums Leben kam. Ein bloßer Zufall? Tenbrink und sein junger Kollege Bertram glauben nicht an Zufälle. Irgendwo muss es eine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen geben. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, graben sie tief in der Vergangenheit der Dorfbewohner – was nicht jedem im Ort gefällt. Als ein weiterer Mensch stirbt, steht fest: Jemand will um jeden Preis verhindern, dass ein altes Geheimnis ans Licht kommt.
»Galgenhügel« ist der Auftakt der neuen Krimi-Reihe von Erfolgsautor Tom Finnek um das Ermittlerteam Tenbrink und Bertram: Westfälischer Dickschädel mit Erinnerungslücken trifft auf strafversetzten Magdeburger mit heikler Vergangenheit.
TOM FINNEK
GALGENHÜGEL
Münsterland-Krimi
»Ich bin ein Westfale, und zwar ein Stockwestfale,nämlich ein Münsterländer – Gott sei Dank!, füge ich hinzu.«
Annette von Droste-Hülshoff, »Bei uns zu Lande auf dem Lande«
Prolog
Warum konnte er nicht einfach den Mund halten? Verständnislos schaute Ellen ihren Mann an, der wild gestikulierend auf eine der verstört dreinschauenden Flugbegleiterinnen einredete, dabei lauthals fluchte und herumkrakeelte. Ellen betrachtete ihn wie einen völlig Fremden und kam sich plötzlich vollkommen einsam vor, als stürzte sie ganz allein mit diesem verdammten Flugzeug in Richtung Meeresoberfläche. Um sie herum weinten oder schluchzten die Leute, einige wenige beteten, ein junges Paar hielt sich über den Gang an den Händen, wieder andere tippten hektisch etwas in ihre Smartphones. Letzte Nachrichten für die Liebsten. Doch die meisten der Passagiere taten all das beinahe geräuschlos, wie gedämpft. Nur Michael brüllte herum und schnauzte die Stewardessen an, als wären sie irgendwelche Darstellerinnen in einem seiner Filme, die sich nicht an seine Regieanweisungen hielten. Ununterbrochen sprudelten Worte aus seinem Mund, dabei deutete er immer wieder auf seine Schwimmweste und die beiden Ventile, mit denen die Weste aufgeblasen wurde. Doch Ellen hörte gar nicht hin, sie schottete sich ab, gab keinen Ton von sich und versuchte, die letzten Augenblicke ihres Lebens ganz bei sich zu sein. Sie wollte sie nicht mit sinnloser Panik vergeuden. Sie wusste, dass sie in Kürze sterben würde, und versuchte, das Unvermeidliche zu akzeptieren. So schwer ihr das auch fiel. Was gab es jetzt noch zu sagen? Worte hatten jeden Sinn verloren. Vielleicht schwieg sie aber auch, weil die Angst ihr die Kehle zuschnürte. Wie in Schockstarre.
»Brace for impact!«, hatte der Flugkapitän über die Lautsprecher gesagt.
Gleich wäre alles vorbei! Da konnte der schlaksige Amerikaner in der Reihe vor ihnen behaupten, was er wollte. Angeblich hatte er schon einmal eine solche Notwasserung überlebt, damals in New York, auf dem Hudson River. Es komme lediglich darauf an, dass der Pilot das Flugzeug waagerecht in der Luft halte und die Boeing mit beiden Tragflächen gleichzeitig auf dem Wasser aufkomme, hatte er bereits kurz nach dem Ausfall der Triebwerke getönt. Dann bestünde eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie die Katastrophe unbeschadet überstanden.
Ellen wollte davon nichts hören. Das hier war nicht New York, unter ihnen befand sich nicht der Hudson River, sondern das Karibische Meer, und die Küste Venezuelas war noch etliche Flugminuten entfernt. Statt auf dem Flughafen von Caracas zu landen, würden sie mitten in der Nacht mit der Boeing 767 im Ozean versinken. Und da sie in der Business Class direkt hinter dem Cockpit saßen, würden sie vermutlich als Erste auf dem Wasser aufschlagen und sterben. Bevorzugt selbst im Tod. Der Gedanke daran ließ Ellen mehrmals schlucken, sie war kurz davor, sich zu übergeben. Nicht jetzt, schalt sie sich in Gedanken und musste unwillkürlich und völlig unangebracht lachen.
»Was ist so witzig?«, schimpfte Michael und stieß sie ärgerlich mit dem Ellbogen an. »Glaubst du, wir sind hier bei Verstehen Sie Spaß?«
Ellen schüttelte den Kopf und biss sich auf die Lippen. Plötzlich hörte sie neben sich ein lautes Zischen. Sie erschrak und stellte irritiert fest, dass das Geräusch aus Michaels Rettungsweste kam. Entgegen den Anweisungen des Kabinenpersonals hatte er an den Ventilen der Druckpatronen gezogen.
»Wir sollen die Westen doch erst außerhalb des Flugzeugs aufblasen«, sagte Ellen und merkte im selben Moment, wie dumm und hohl ihre Worte klangen. Wie sehr sie den eigenen düsteren Gedanken widersprachen. Es würde kein außerhalb des Flugzeugs geben. Jedenfalls würden sie es nicht mehr erleben.
»Und wenn ich nach dem Aufprall nicht mehr in der Lage bin, das Scheißding aufzublasen?«, fuhr Michael sie an. »Was dann? Soll ich etwa ertrinken, nur weil das die verdammten Vorschriften so verlangen?«
Wir werden alle sterben, wollte Ellen sagen, beließ es dann aber bei einem stummen Achselzucken. Reden nützte ohnehin nichts mehr. Jetzt galt es, sich auf das Ende gefasst zu machen. Wie bei einem Countdown. Ellen begab sich wieder in die gebückte Brace-Position, wie sie es so oft in den schlecht animierten Filmchen zu Beginn eines jeden Flugs gesehen hatte. Gurt festgezurrt, Becken nach hinten, Kopf runter, Hände auf die Knie.
»Brace, brace!«, rief eine Stewardess. »Heads down!« Damit verschwand sie nach vorne zu ihrem Klappsitz vor den Toiletten.
Wieder fluchte Michael. Mit aufgeblasener Rettungsweste war gar nicht daran zu denken, sich nach vorne zu beugen und den Kopf nach unten zu nehmen. Er musste aufrecht sitzen bleiben, wie in einem Stützkorsett. Was ihn aber nicht daran hinderte, weiterhin unentwegt auf Ellen einzureden. Nur sein Ton hatte sich mittlerweile geändert. Da die Stewardess außer Reichweite war, schrie er nicht mehr herum, sondern haderte gestenreich mit seinem Schicksal, beklagte sich bei Ellen, machte ihr Vorwürfe, weil sie die Reise unbedingt unternehmen wollte, und schien sowohl mit ihr als auch mit seinem eigenen Leben abrechnen zu wollen. Völlig ansatzlos sprang er dabei zwischen der Vergangenheit und dem, was seine Zukunft hätte bringen sollen, hin und her. Seine Worte wurden zunehmend selbstmitleidig. Was er selbst aber gar nicht zu bemerken schien.
Ellen schloss die Augen, hielt sich unmerklich die Ohren zu und dachte mit Bitterkeit daran, dass dieser Urlaub eigentlich ein Neuanfang hätte sein sollen. Oder vielmehr eine letzte Chance. Für ihre zur bloßen Routine verkommene Ehe, für ihr scheinbar aufregendes, aber völlig sinnentleertes Leben, für einfach alles. Drei Wochen Venezuela, von den eisigen Anden über das tropische Orinoco-Delta bis zu den Traumstränden der Karibik, während im heimischen Berlin das übliche triste Novemberwetter herrschte. Drei Wochen ohne den ganzen Fernsehrummel, ohne mühsame Drehs und langweilige Studioarbeit, ohne alberne PR-Auftritte und ermüdende Interview-Termine. Ohne das nichtige Leben in einer schillernden Blase. Drei Wochen zum Innehalten und Durchschnaufen.
»Alles auf Anfang!«, wie man beim Film sagen würde.
Ellen hatte gerade die erste Staffel einer humorigen Krimiserie mit dem Titel »Lustig bis in den Tod« abgedreht und mit Bedacht für den Rest des Jahres keine neuen Rollen angenommen. Und da auch Michael mit der Postproduktion seines neuesten Zweiteilers weitgehend fertig war, hatte sie die Reise gebucht, ohne ihn zu fragen. Natürlich war er außer sich gewesen und hatte behauptet, jetzt sei wirklich keine Zeit für Urlaub und er müsse sich unbedingt um die Finanzierung und Stoffentwicklung des nächsten Projekts kümmern. Doch das hatte Ellen nicht gelten lassen. Zu oft hatte sie diesen immer gleichen Sermon in den sechs Jahren ihrer Ehe gehört. Nie war Zeit für Urlaub, nie Zeit für irgendetwas, vor allem nicht für sich selbst. Und an Kinder war schon gar nicht zu denken. Stets gab es gute Gründe, äußere Zwänge oder nützliche Ausreden. Nicht jetzt, nicht hier, nicht so! Damit müsse nun Schluss sein, hatte sie gefordert und Michael die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder er begleite sie nach Südamerika oder sie werde ohne ihn fliegen. Und anschließend nicht zu ihm zurückkehren.
Anschließend! Ein großer Schwarm Vögel hatte dafür gesorgt, dass es dazu nicht kommen würde. Jedenfalls hatte der schlaksige Amerikaner vermutet, dass es Vögel gewesen waren. Wahrscheinlich Gänse. Wie damals in New York. Wenige Minuten nachdem die Maschine die Reiseflughöhe verlassen und zum Landeanflug auf Caracas angesetzt hatte, hatte es einen lauten Knall und ein kurzes Vibrieren gegeben. Ellen war aus dem Halbschlaf aufgeschreckt und hatte zunächst an ein Luftloch oder einen Blitzeinschlag geglaubt. Nichts Ernsthaftes jedenfalls. Bis sie aus dem Fenster geschaut und den Feuerschein auf der rechten Seite gesehen hatte. Da es draußen stockfinster war, konnte man die Flammen, die aus dem Triebwerk schlugen, auch im Bug des Flugzeugs erkennen. Ellen glaubte zu wissen, dass sich ein Flugzeug mit etwas Geschick auch mit nur einem Triebwerk steuern ließ, doch als sie bemerkte, dass die Passagiere auf der linken Seite ebenfalls wie gelähmt aus den Fenstern starrten und die beiden Triebwerke plötzlich jaulende Geräusche von sich gaben, ahnte Ellen, dass sie in ernsten Schwierigkeiten steckten. Nur wenige Augenblicke später zischte es laut und dumpf, die Flammen erloschen, erst rechts, dann links, und es war wieder dunkel hinter den Fenstern. Doch noch ehe so etwas wie Hoffnung oder gar Erleichterung aufkommen konnte, verstummten kurz nach dem Zischen auch die Motorengeräusche. Die Triebwerke waren ausgefallen. Auf beiden Seiten. Einzelne entsetzte Schreie betonten die unerträgliche Stille. Die Boeing 767 war zu einem gigantischen und völlig untauglichen Segelflugzeug geworden. Zu einem stromlinienförmigen Sarg aus Aluminium.
»Ellen, hörst du mir überhaupt zu?« Michael zerrte heftig an ihrer Schulter und riss sie aus ihren irrlichternden Gedanken.
»Natürlich«, log sie und nahm die Hände von den Ohren.
»Und was sagst du dazu?«
»Was soll ich sagen?« Sie war nicht in der Lage, ihn anzuschauen, und starrte weiterhin auf ihre Knie. »Nichts.«
»Nichts?«
»Wir werden sterben, Michael.« Das war alles, was dazu zu sagen war.
»Eben drum.« Seine Worte klangen gleichzeitig verständnislos und vorwurfsvoll. Als hätte sie ihn mit ihrem vermeintlichen Desinteresse tödlich beleidigt. »Willst du denn gar nicht wissen, was mit deiner Schwester geschehen ist?«
»Meine Schwester?« Ellen war völlig verwirrt und brauchte eine Weile, um zu begreifen, wovon Michael überhaupt sprach. Er war immer noch damit beschäftigt, mit seinem Leben abzurechnen, und inzwischen war er offenbar dazu übergegangen, eine Art Beichte abzulegen. Ballast abzuwerfen. Als könnte das, wie bei einem Heißluftballon, die Wucht des Aufschlags mindern.
Ellen konnte es kaum fassen. Sie stürzten gerade in den Tod, hatten nur noch wenige Augenblicke zu leben, und Michael hatte nichts Besseres zu tun, als ihr einen Seitensprung oder eine Affäre mit ihrer Schwester Anne zu gestehen! Sie schüttelte den Kopf. An seine zahlreichen Weibergeschichten hatte sie sich ohnehin gewöhnt, selbst wenn ihr die Vorstellung, dass er es auch mit Anne getrieben hatte, übel aufstieß.
»Ich will nichts von Anne hören! Behalt es für dich!«, rief Ellen abwehrend und erstarrte, weil sich in diesem Augenblick die Position des Flugzeugs änderte. Der Bug ging ruckartig in die Höhe. Wieder schrien die Leute, und aus den Lautsprechern schallte eine verzerrte Ansage in Dauerschleife: »Brace, brace!« Gleichzeitig fing der Rumpf an zu vibrieren. Er schlingerte hin und her wie in den Kurven einer Achterbahn. Alles zitterte und schwankte. Ellen dachte an die beschwichtigenden Worte des Amerikaners: Es komme lediglich darauf an, die Maschine waagerecht in der Luft zu halten. So viel dazu!
»Es geht nicht um Anne«, stieß Michael mühsam hervor und hielt sich krampfhaft an der Lehne seines Sessels fest. »Sondern um Eva. Um die Sache auf dem Galgenhügel.«
»Eva?« Ellen durchfuhr es wie ein Stromschlag. Es war wie ein Stich ins Herz. Die Sache auf dem Galgenhügel! Plötzlich hatte Michael ihre ganze Aufmerksamkeit. Und obwohl sie wusste, dass sie die Frage nicht stellen sollte und die Antwort nicht hören wollte, fragte sie: »Meinst du den Unfall?«
Erster Teil
1
Zelten im Münsterland! In den Herbstferien! Bastian hatte von Anfang an geahnt, dass es eine Schnapsidee war, doch Claudia hatte als unbeirrbarer Outdoor-Fan darauf bestanden. Schließlich gebe es kein schlechtes Wetter, hatte sie einen alten Kalauer bemüht, sondern lediglich unpassende Kleidung. Außerdem hätten sie es den Kindern versprochen. Die waren tatsächlich ganz wild auf das vermeintliche Abenteuer gewesen. Urlaub auf dem Land, inmitten von Venn und Moor, umgeben von Bruchwald, Wacholderheide und endlosen Maisfeldern. Und nun hatten sie die Bescherung! Die halbe Nacht hatte es wie aus Kübeln gegossen, und als sie am frühen Morgen durch das Prasseln des Regens und das Donnergrollen geweckt wurden, schwamm ihr Familienzelt auf einer riesigen Wasserlache. Der Boden des Innenzelts fühlte sich an wie ein Wasserbett, bei jedem Schritt machte es gurgelnde Geräusche, und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Nässe durch den Kunststoff drang und die Schlafkammer unter Wasser setzte. Das Vorzelt war bereits geflutet und roch nach Moder.
Doch statt nach einer Ferienwohnung Ausschau zu halten, wie Bastian es vorgeschlagen hatte, bewunderte Claudia den Nebel, der den gesamten Zeltplatz umhüllte und in dichten Schwaden über den klitschigen Boden waberte.
»Wie in einer Ballade von Droste-Hülshoff«, fand sie.
»Hm«, knurrte er missmutig und zitierte: »›Unter jedem Tritte ein Quellchen springt.‹«
»Ach was«, entgegnete Claudia. »Außerdem lässt der Regen bereits nach. Genau das richtige Wetter, um die alte Kolkmühle zu besuchen. Die ist nur sonntags für Besucher geöffnet, und anschließend können wir im ›Schulzenhof‹ brunchen. Das Essen dort soll sehr gut sein.«
»Und das Wasser?«, fragte er und deutete auf die bräunliche Lache.
»Das versickert doch«, behauptete Claudia. »Und heute Abend buddelst du einfach einen Graben ums Zelt.«
»Einen Wassergraben?«, fragte Nele aufgeregt und entblößte mit einem Lachen ihre frische Zahnlücke im Oberkiefer. »Wie beim Schloss in Altwick?«
»Dann musst du auch eine Zugbrücke bauen, Papa«, meinte Timo und grinste. »Sonst ist es kein Schloss.«
»Schlösser haben keine Zugbrücken«, sagte Nele altklug. »Das sind Burgen, du Doofi!«
»Selber doof!«, schnauzte Timo seine kleine Schwester an.
»Schluss jetzt!«, rief Claudia und entschied: »Wir fahren zur Mühle.«
Bastian zuckte resignierend mit den Schultern und hoffte, das späte Frühstück im »Schulzenhof« würde sie für all das Ungemach entschädigen.
Die Kolkmühle war eine uralte Wassermühle direkt an der Grenze zwischen dem Münsterland und der holländischen Twente. Eine niedliche kleine Mühle, der man ansah, dass sie in den Jahrhunderten seit ihrer Errichtung mehrmals umgebaut und renoviert worden war. Das etwas schiefe Dach war aus Eichenholz gezimmert und reichte beinahe bis zum Boden.
»Wie ein Hexenhaus«, fand Nele und klatschte begeistert in die Hände. »Fehlen nur Hänsel und Gretel.«
»Wer die Hexe ist, wissen wir jedenfalls«, sagte Timo abfällig.
Claudia stand vor einer Rundbogentür, die zum Untergeschoss der Mühle führte, und betrachtete ein in Sandstein gehauenes Wappen, das über der Tür ins Fachwerk eingelassen war. »Renovatum Anno 1721«, las sie und deutete auf zwei verschnörkelte Initialen. »C und A«, fuhr Claudia fort. »Wisst ihr, wofür das steht?«
»Klar«, sagte Bastian lächelnd, »da kauf ich immer meine Hemden.«
»Blödmann«, erwiderte Claudia, schaute in ihren Reiseführer und gab selbst die Antwort: »Clemens August. So hieß der damalige Bischof von Münster.«
»Interessant«, behauptete Bastian und schielte auf die Uhr.
Dass sie im Nieselregen vor der Mühle standen und sich nicht im trockenen Inneren die imposanten Mahlgänge und hölzernen Kammräder anschauten, lag daran, dass die Kolkmühle noch geschlossen war. Die Mühle wie auch die Schänke »Zum schwarzen Kolk« auf der gegenüberliegenden Seite des Mühlenwehrs öffneten erst um neun. Sie waren schlichtweg zu früh dran. Der gesamte Platz, der von einer riesigen Linde dominiert wurde, wirkte zu der frühen Morgenstunde wie verwunschen. Was durch den dichten Nebel noch verstärkt wurde. Nur ein alter, aber noch gut erhaltener Volvo stand auf dem Parkplatz, von dessem Besitzer aber war weit und breit nichts zu sehen.
»Mama, hast du vorhin nicht was von einem Galgenhügel erzählt?«, fragte Timo und rieb sich die vor Kälte geröteten Hände. »Der ist doch gar nicht weit weg, oder? Können wir da nicht hingehen?«
»Erst schauen wir uns die Mühle an. In zehn Minuten wird sie geöffnet«, sagte Claudia und schüttelte den Kopf. »Zum Galgen gehen wir später. Der liegt ohnehin auf halbem Weg zum ›Schulzenhof‹.«
»Kann ich nicht schon mal vorgehen?«, fragte Timo. »Nur mal kurz gucken. Ich bin auch sofort wieder zurück.« Da Claudia immer noch den Kopf schüttelte, wandte er sich mit flehendem Blick an seinen Vater. »Bitte, Papa! Kann ich?«
Bastian hob seufzend die Schultern und erntete einen missfälligen Blick seiner Frau sowie einen erfreuten seines Sohnes.
Timo deutete das Achselzucken als Erlaubnis und rief: »Danke, Papa!« Dann rannte er über das gemauerte Mühlenwehr zu einer schmalen Straße, die nach Nordosten hin einen Bogen um den oberen Mühlteich machte und sich anschließend durch Wald und Heide schlängelte. Wenige Sekunden später hatte der Nebel den Jungen verschluckt.
»Ich hatte Nein gesagt«, fauchte Claudia und sah Bastian vorwurfsvoll an.
»Es sind ja nur ein paar Meter«, sagte er und schaute zu Boden, als gäbe es in den Pfützen etwas Interessantes zu beobachten.
»Ist das ein echter Galgen?«, fragte Nele ängstlich. »Dann geh ich da nicht hin.«
»Nein, Süße«, lachte Claudia und streichelte ihr über den Kopf. »Den hat der Heimatverein von Ahlbeck hier für die Touristen aufgebaut. Das ist nur ein Denkmal. Früher stand an der Stelle mal ein richtiger Galgen, aber den gibt’s schon lange nicht mehr. Brauchst keine Angst zu haben.«
»Da kommt jemand.« Bastian deutete auf einen alten Mann, der neben der Schänke aus dem Nebel auftauchte und sich ihnen mit schwerfälligen Schritten näherte. Der Mann fuhr sich über den grau melierten Vollbart, rückte seinen breitkrempigen Filzhut zurecht und rief ihnen zu: »Morgen zusammen! Sie sind früh dran.«
»Die Sintflut hat uns geweckt«, antwortete Bastian und nickte zur Begrüßung.
»Mistwetter!«, knurrte der Mann, starrte zum Himmel und schlurfte zum Eingang der Schänke. »Einen Moment. Ich hol schnell die Schlüssel auf, dann können Sie in die Mühle.«
»Aufholen?«, wunderte sich Bastian leise.
»Lass doch!«, sagte Claudia und bedachte ihn mit einem tadelnden Blick. »Die reden hier halt anders. Das ist wahrscheinlich der holländische Einfluss.«
»Können die kein Deutsch?«, fragte Nele verdutzt.
»Ruhe jetzt!«, zischte Claudia.
»So!«, sagte der Graumelierte, als er mit einem riesigen, rostigen Bartschlüssel in der Hand aus der Schänke trat. »Dann wollen wir mal.«
»Nicht viel los hier«, meinte Bastian und deutete auf die etwas verwahrlost wirkende Schänke, die wenig mehr als ein umgebauter Bauernhof war. »Wundert mich eigentlich. Die Mühle ist doch sehr sehenswert und idyllisch gelegen.«
»Das wird alles anders werden, wenn die Schulzin hier das Sagen hat.«
»Die Schulzin?«, wunderte sich Claudia.
»Die Chefin vom ›Schulzenhof‹«, sagte der Alte und hob vielsagend die Augenbrauen. »Sie hat die Mühle und den Gasthof vor Kurzem gekauft, und bald beginnen die Umbauten. Wenn die nächstes Jahr damit fertig sind, wird’s hier ein großes Ausflugslokal mit Kutschfahrten, Konzerten und anderem Remmidemmi geben. Ist ’ne tüchtige Frau, die Schulzin.« Er öffnete mit dem Schlüssel eine kleine, mit Eisen beschlagene Pforte, durch die man vom Mühlenwehr aus das Erdgeschoss betreten konnte, und wies ins Mühleninnere. »Bisschen staubig hier«, sagte er, schaltete das Licht an und hustete. »Aber das wird alles anders werden, wenn die Schulzin …«
Weiter kam er nicht, denn in diesem Moment hörten sie Timo aufgeregt rufen: »Mama! Papa! Kommt schnell! Da hängt eine!«
Völlig außer Atem erreichte der Junge das Mühlenwehr, hielt sich die offenbar stechende Seite und wiederholte atemlos: »Da hängt eine!«
»Wo hängt was?«, fragte Bastian.
»Am Galgen«, keuchte Timo. »Eine Frau.«
»Das ist ein Denkmal, du Doofi«, erklärte Nele.
»Dann hängt die eben an einem Denkmal«, sagte Timo und zog eine Grimasse. »Tot ist sie aber auf jeden Fall. Sonst würde sie ja nicht am Strick hängen.«
»Hör auf, deiner Schwester Angst zu machen«, sagte Bastian, schaute aber unsicher zu Claudia.
»Das ist bestimmt nur eine Puppe«, knurrte der Alte. »Ist ja bald Halloween.«
»Die sieht aber ziemlich echt aus.« Timo klang zugleich fasziniert und erschrocken.
»Verdammte Blagen!«, zischte der Alte und fuhr sich über die rot geäderte Knollennase. »Nichts als dummes Zeug im Kopf. Im Sommer haben sie einen ollen Schweinskopf an den Galgen gehängt. Bei Bullenhitze. Was glauben Sie, wie das gestunken hat.« Plattdeutsch fluchend setzte er hinzu: »Godverdorrie!«
»Jetzt komm schon, Papa!«, flehte Timo und zog an Bastians Ärmel. »Wir müssen die Frau abschneiden! Sonst reißt noch irgendwann der Kopf ab.«
»Iiih«, kreischte Nele und fing an zu weinen.
»Timo!«, rief Claudia und nahm Nele in den Arm. »Was fällt dir ein?!«
»Ihr beiden bleibt hier«, sagte Bastian zu Claudia und Nele. Dann wandte er sich an den Alten: »Lassen Sie uns mal nachschauen.«
»Ich muss mich um den Gasthof kümmern«, maulte der, nickte dann aber zögerlich und schimpfte: »Dummes Zeug!« Damit stapfte er zu dem alten Volvo auf dem Parkplatz.
Bastian und Timo liefen in der Zwischenzeit übers Mühlenwehr und folgten dem asphaltierten Weg, bis sie nach etwa hundert Metern an einen Abzweig kamen. Rechter Hand führte die Straße nach Ahlbeck, und linker Hand schlängelte sich ein Sandweg in Richtung Holland. Hier befand sich ein kleiner Überrest der kargen Wacholderheide, die früher einmal den gesamten Bruchwald und die ausgedehnten Moorgebiete umgeben hatte.
»Gleich da vorne.« Timo deutete nach rechts, wo ein schmaler Trampelpfad zwischen Birken und Wacholderbüschen durchs dornige Gestrüpp führte. Eine mit schaurigen Bildern verzierte Schautafel am Wegesrand erklärte, was es mit dem Galgenhügel auf sich hatte und warum der Heimatverein des Dorfes es für nötig gehalten hatte, ihn an historischer Stelle wieder aufzubauen.
Inzwischen war auch der Volvo am Abzweig angekommen, und gemeinsam mit dem Alten gingen Bastian und Timo über den Trampelpfad, der vom Regen durchweicht war und in dessen Senken das Wasser stand. Nach etwa zwanzig Metern gelangten sie zu einer Lichtung, die von der Straße aus nicht zu sehen gewesen war. Dort befand sich ein kleiner, grasbewachsener Hügel, auf dessen Kuppe ein Holzgerüst auf einem ebenfalls hölzernen Podest stand. An dem Querbalken, der zwischen zwei mächtigen Eichenpfosten befestigt war, hing eine Frau am Strick. Keine Puppe. Kein Halloween-Spaß!
»Du gehst sofort zurück zur Mühle!«, befahl Bastian seinem Sohn.
»Die ist also doch echt!« Timo rührte sich nicht vom Fleck. Er schluckte und schüttelte den Kopf, als verstünde er erst jetzt, was das bedeutete. »Hat die sich umgebracht?«
»Timo, zur Mühle, sofort!«, wiederholte Bastian und wartete, bis der Junge gehorchte und hinter den Büschen verschwunden war. Dann wandte er sich an den Alten: »Haben Sie ein Messer oder eine Säge im Auto? Mir müssen den Strick durchschneiden.«
»Hab ich. Aber sollten wir nicht besser alles so lassen und die Polizei rufen?«
»Wir können sie doch nicht einfach so hängen lassen.«
»Ich dachte, das muss man sogar.«
»Und wenn sie noch lebt?«, fragte Bastian.
»Die ist tot«, sagte der Alte kopfschüttelnd, nahm den Filzhut vom Kopf und starrte unverwandt auf die Frau, der das dunkelblonde Haar klitschnass im Gesicht klebte. »Wie die Schwester.«
Bastian verstand nicht und schaute nun ebenfalls zu der Toten. Sie war jung, vielleicht Anfang oder Mitte dreißig. Und ausgesprochen hübsch, selbst als Leiche. Das Seltsame war jedoch, dass Bastian sie zu kennen glaubte. Irgendwo hatte er dieses Gesicht schon mal gesehen.
»Godverdorrie!«, schimpfte der Alte schließlich, setzte den Hut wieder auf und ging zu seinem Wagen, um ein Messer zu holen. »Wat föör ’ne Driete!«
Bastian starrte unverwandt und wie gebannt zum Galgen. Eine grauschwarze Nebelkrähe setzte sich in diesem Augenblick auf den Querbalken, legte den Kopf schräg und beäugte interessiert die tote Frau unter sich. Als der Aasfresser sich anschickte, der Toten auf die Schulter zu hüpfen, machte Bastian »Ksch!« und klatschte in die Hände, um den Vogel zu verscheuchen.
2
Heinrich Tenbrink schaute niemals fern, denn er besaß keinen Fernseher mehr. Seitdem Karin vor drei Jahren gestorben war, hatte der klobige Kasten ungenutzt auf der Kommode im Wohnzimmer gestanden und Staub angezogen. Deshalb hatte Tenbrink ihn im Sommer seiner Tochter Maria geschenkt, für die Laube im Schrebergarten. Karin hatte abends oft und gern vor der Kiste gesessen und irgendwelche Serien angeschaut, in denen zumeist Nonnen oder Ärzte die Hauptrollen spielten. Und den obligatorischen Tatort am Sonntag natürlich. Doch Tenbrink hatte noch nie etwas für erfundene Geschichten übriggehabt, weder im Fernsehen noch in Büchern. Die Realität reichte ihm allemal, er brauchte keine aufgebauschte Fiktion, und mit Krimis und Thrillern konnte man ihn ohnehin jagen. Berufskrankheit. Als Erster Hauptkommissar und Leiter des Kriminalkommissariats 11 konnte er nach Dienstschluss gern auf Verbrechen verzichten. Einmal hatte er, um Karin einen Gefallen zu tun, einen Münsteraner Tatort mit ihr angeschaut, und sie hatten es beide bitter bereut. Es war eine einzige Tortur gewesen. Für ihn, weil er nicht verstanden hatte, was an einer Mordermittlung ulkig sein sollte, und für sie, weil er ihr mit seinem ständigen Mosern den harmlosen Spaß verdorben hatte. Anschließend hatte Karin ihn nie wieder gefragt, ob er mit ihr einen Krimi schauen möchte. Und nach ihrem Tod wäre er nie auf die Idee gekommen, sich allein vor den Fernseher zu setzen. Es wäre ihm unpassend und beinahe pietätlos vorgekommen.
Doch obwohl er nie fernsah, geschweige denn ins Kino ging, kannte Tenbrink die Frau, die dort vor ihm auf dem grotesken Holzpodest lag und von einem jungen Gerichtsmediziner einer ersten Leichenschau unterzogen wurde. Schließlich las er Zeitung und hatte oft genug Bilder von ihr gesehen. Ellen Gerwing, die berühmteste Tochter des nur wenige Kilometer entfernt liegenden Dorfes Ahlbeck, gefeierte Schauspielerin und TV-Serienstar. Vermutlich als Nonne oder Ärztin. Auch wenn die Schlagzeilen, für die sie in den vergangenen Monaten gesorgt hatte, nur bedingt mit ihrer Schauspielerei zu tun gehabt hatten und eher einem ärztlichen Bulletin gleichgekommen waren.
»Morgen, Herr Hauptkommissar«, begrüßte ihn der junge Arzt, während er gleichzeitig den Strick am Hals der Frau lockerte. »Bei so einer berühmten Selbstmörderin wird der Chef auch am Sonntag aus dem Bett geklingelt, was?«, setzte er schmunzelnd hinzu und befingerte die Kehle der Toten.
Kennen wir uns?, hätte Tenbrink beinahe geantwortet, unterließ es aber, da die Frage angesichts der offensichtlichen Tatsache seltsam geklungen hätte. Allerdings hatte er keine Ahnung, wo er dem Arzt schon mal begegnet war.
Der Gerichtsmediziner schien Tenbrinks verwirrten Gesichtsausdruck zu bemerken, denn er grinste unmerklich. »Tobias Kemper. Wir sind uns letzte Woche im Institut begegnet. Ich bin der neue Assistent von Professor Holzhauser.« Der Arzt nickte und widmete sich wieder der Toten.
Tenbrink konnte sich nicht an diese Begegnung und seinen Besuch in der Rechtsmedizin erinnern. Er hätte schwören können, dass er seit Wochen nicht dort gewesen war. Tenbrink wandte sich von der Leiche ab, zog einen Notizblock aus der Manteltasche und notierte Kempers Namen und dessen Beziehung zum Direktor des Instituts für Rechtsmedizin. Darüber schrieb er die Buchstaben »UKM«. Für Universitätsklinikum Münster.
»Sind Sie sicher, dass es Selbstmord war?«, fragte Tenbrink, nachdem er den Block wieder verstaut hatte.
»Noch kann ich nichts Endgültiges sagen«, antwortete der Arzt schulterzuckend. »Todeszeitpunkt zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens. Allem Anschein nach Tod durch Strangulation und daraus folgender Unterbrechung der zerebralen Blutzufuhr. Das Genick ist jedenfalls nicht gebrochen. Alles Weitere werden wir später im Institut klären.« Er machte eine Pause und antwortete dann auf Tenbrinks eigentliche Frage mit einer Gegenfrage: »Wie viele Morde durch Erhängen hatten Sie in den letzten Jahren aufzuklären?«
Auch wieder wahr, dachte Tenbrink und nickte. Mord durch Strangulation war ihm schon untergekommen, allerdings noch nie an einem Galgen. Andererseits gingen Selbstmörder zum Erhängen meist in den Keller oder auf den Dachboden, um sich in aller Abgeschiedenheit das Leben zu nehmen. Nicht zu einem historischen Richtplatz, wo sie unweigerlich von Spaziergängern oder Touristen gefunden wurden.
Anstatt den Mediziner weiter von seiner Arbeit abzuhalten, schaute Tenbrink sich an diesem merkwürdigen Ort um, der ihm ebenso unwirtlich wie unwirklich erschien. Das hölzerne Galgengerüst, das wegen der Leichenschau ringsum mit Sichtblenden aus grauer Plane umstellt war, befand sich auf einem kaum mannshohen Hügel inmitten von Wald und Heide und wirkte auf Tenbrink wie ein makaberer oder aus der Zeit gefallener Scherz. Ein deplatzierter und zudem etwas klein geratener Kalvarienberg.
Der morgendliche Nebel hatte sich inzwischen gelichtet, und auch der Nieselregen hatte aufgehört, doch die Sonne hatte gegen die unverändert dichte Wolkendecke keine Chance. Die Feuchtigkeit hing nach wie vor in der Luft und ließ Tenbrinks Brille beschlagen. Die örtliche Schutzpolizei hatte den sogenannten Galgenhügel erst auf Anweisung der Kripo weiträumig mit Flatterband abgesperrt, und bei einem Blick auf den aufgeweichten und zerwühlten Boden rings um den Hügel erkannte Tenbrink, dass der Starkregen der vergangenen Nacht und die vielen Neugierigen, durch die er sich vorhin mühsam hatte drängeln müssen, kaum verwertbare Spuren am Auffindeort übrig gelassen hatten. Tenbrink wunderte sich immer wieder, wie schnell sich Nachrichten über Todesfälle und Polizei- oder Feuerwehreinsätze auf den Dörfern herumsprachen und Gaffer anlockten. Aber in Zeiten von Twitter und WhatsApp war das eigentlich nicht erstaunlich. Auch einige Vertreter der lokalen Presse waren bereits vor Ort. Die Überregionalen und die Leute vom Fernsehen würden nicht lange auf sich warten lassen.
Dass die Schaulustigen durch ihr Herumtrampeln Spuren vernichtet hatten, war zwar ärgerlich, aber in diesem Fall vermutlich nicht weiter wichtig. Bei einem derart offenkundigen Selbstmord waren sie auf die Ergebnisse der Spurensicherung nicht wirklich angewiesen. Die Kollegen in ihren Ganzkörperoveralls hatten dennoch schmale Trampelpfade für die Einsatzkräfte abgesteckt und suchten die übrige Gegend nach Hinweisen und Beweismitteln ab.
»Morgen, Heinrich«, hörte Tenbrink plötzlich eine krächzende Stimme hinter sich. Als er sich umdrehte, schaute er in das hübsche, aber verknautscht wirkende Gesicht von Maik Bertram.
»Morgen«, antwortete Tenbrink und grinste, als er die dunklen Ränder um die Augen des Oberkommissars sah. »Haben sie dich auch aus dem Bett geklingelt?«
»Ich bin sogar schon etwas länger hier als du.« Bertrams Stimme klang belegt. Er räusperte sich. »Ist halt ’ne prominente Leiche. Die Staatsanwaltschaft ist vermutlich in heller Aufregung und will auf Nummer sicher gehen. Deshalb schickt sie ihre besten Leute. Außerdem weiß die Oberstaatsanwältin, dass wir beide auf halbem Weg zur Grenze wohnen. Das ist schneller und einfacher, als jemanden aus Münster rüberzuschicken.« Er lächelte gequält, fuhr sich über den stets akkurat gestutzten Dreitagebart und deutete zur Leiche. »Du weißt, wer das ist?«
Tenbrink nickte, und im selben Augenblick hörten sie den Mediziner entgeistert rufen: »Du meine Güte!«
»Was ist?«, fragten Tenbrink und Bertram wie aus einem Mund.
Der Arzt hatte den klitschnassen Mantel der Toten geöffnet und untersuchte gerade den Körper der Frau auf Spuren von Gewaltanwendung oder sonstige Fremdeinwirkung. Er hatte den Pullover samt Hemd hochgeschoben und starrte auf den Bauch der Frau, der mit riesigen, zum Teil wulstigen und seltsam gezackten Narben übersät war. Kemper deutete auf die verwüstete Haut, die beinahe an ein Schlachtfeld erinnerte, und murmelte fassungslos: »Was ist denn da passiert? Ist die in einen Fleischwolf geraten?«
»Haben Sie nichts davon gehört?«, wunderte sich Tenbrink über Kempers Unwissenheit. »Stand wochenlang in allen Zeitungen.«
Der Mediziner schüttelte verwirrt den Kopf.
»Der Flugzeugabsturz vor knapp einem Jahr?«, kam ihm Bertram zu Hilfe. »In der Karibik? Venezuela, glaube ich. Die Bruchlandung auf dem Wasser.«
»Sie war an Bord?«, fragte Kemper.
»Und hat als eine von wenigen den Absturz überlebt«, bestätigte Tenbrink. »Die Narben stammen wahrscheinlich von den Verletzungen und den anschließenden Notoperationen. Ellen Gerwing war eine Zeit lang die prominenteste Krankenakte Deutschlands.«
Kemper schien sich nun zu erinnern. Er nickte und meinte: »Jedenfalls sind die Verletzungen allesamt älteren Datums und haben mit ihrem Tod nichts zu tun.«
»Sind Sie da sicher, Doktor?«, fragte Tenbrink und runzelte die Stirn. »Irgendeinen Grund wird sie schon gehabt haben, sich das Leben zu nehmen.«
Der Arzt schob den Unterkiefer vor. »Schon seltsam, oder? Sie überlebt einen Flugzeugabsturz, wird mehr schlecht als recht und vermutlich über Monate zusammengeflickt und bringt sich dann um? Klingt nicht logisch.«
»Selbstmorde haben nicht unbedingt etwas mit Logik zu tun«, meinte Tenbrink, blickte hinauf zum Galgen und stutzte beim Anblick des Querbalkens. »Wo ist eigentlich der Teil des Stricks, der am Galgen befestigt war?«, fragte er. »Hat man den abgeschnitten?«
Bertram schüttelte den Kopf und deutete auf das hintere Ende des Holzpodests. Dort lag der Rest des mehrere Meter langen Seils – das eine Ende durchtrennt, das andere Ende an einer Querstrebe verknotet. »Das Seil war nicht am Galgen befestigt, sondern führte darüber hinweg und wieder nach unten, wo es am Podest verknotet war.«
»Warum?«, wunderte sich Tenbrink.
»Vielleicht war sie zu klein, um den Querbalken zu erreichen«, vermutete Bertram. »Außerdem war’s mitten in der Nacht und vermutlich stockfinster.«
»Hm«, machte Tenbrink und deutete auf einen abgesägten Baumstumpf, der neben der Toten lag. »Sie befestigt das Seil hinten am Podest, wirft es über das Gerüst, stellt sich auf den Holzblock, legt sich die Schlinge um den Hals und …«
»Sieht so aus«, bestätigte Bertram und rieb sich den kahl geschorenen Schädel. »Erinnert ein bisschen an einen Flaschenzug.«
»Ist die Familie der Toten schon verständigt?«, fragte Tenbrink und schaute nachdenklich auf die Fahne, die sein Atem in der feuchten Luft bildete.
»Es gibt nur eine jüngere Schwester, Anne«, sagte Bertram und gähnte unwillentlich. »Das hat mir einer der Schupos berichtet. Zwei Kollegen der Borkener Kripo sind bereits zum ›Schulzenhof‹ unterwegs.«
»Das schnieke Wellness-Hotel?«, fragte Tenbrink. Vor einigen Jahren, kurz nach der Eröffnung des Hotels, hatte er dort mit Karin zu Abend gegessen. Hübsches Anwesen, exquisite Küche, aber zu kostspielig für seinen Geldbeutel.
»Anne Gerwing ist die Chefin dort«, antwortete Bertram. »War früher ein großer Bauernhof und wurde von den Eltern bewirtschaftet. Schulze Gerwing. Daher der Name des Hotels.«
»Bei euch im Osten heißt das Schultheiß, oder?«, fragte Tenbrink und grinste.
»Ich weiß, was ein Schulze ist«, knurrte Bertram säuerlich.
Tenbrink wusste nur zu gut, dass Maik Bertram es nicht leiden konnte, auf seine ostdeutsche Herkunft angesprochen zu werden, doch manchmal konnte er sich eine spitze Bemerkung nicht verkneifen. War ja nicht böse gemeint.
»Herr Hauptkommissar?«, wurde er aus seinen Gedanken gerissen.
»Was?«, fragte Tenbrink.
»Die Frau hat mehrere Suffusionen an beiden Unterarmen.« Der Arzt deutete auf die Innenseite des rechten Unterarms. »Leichte Hämatome, wie Fingerabdrücke, noch sehr frisch und ohne Verfärbung.«
»Anzeichen für Gewaltanwendung?«, fragte Tenbrink.
»So weit würde ich nicht gehen«, antwortete Kemper. »Vielleicht wurde sie etwas fester an den Armen gehalten. Dafür kann es verschiedene Erklärungen geben.« Er zuckte mit den Achseln und setzte hinzu: »Solche Hämatome können beispielsweise auch beim Sex entstehen.«
»Beim Sex?«, wunderte sich Tenbrink. »Wurde sie gefesselt?«
»Dann sähen die blauen Flecken ganz anders aus«, entfuhr es Bertram, schaute beinahe erschrocken drein und beeilte sich hinzuzufügen: »Ich meine … also … das glaube ich jedenfalls.«
Tenbrink und der Arzt sahen Bertram an. Der eine verwundert, der andere amüsiert. »Wie auch immer«, meinte der Arzt schließlich und erhob sich. »Mehr kann ich hier im Moment nicht tun. Ich lass die Tote nach Münster bringen. Die Obduktion wird dann genauere Ergebnisse bringen. Dann wissen wir auch, ob die Suffusionen prä- oder postmortal entstanden sind.«
»Danke, Doktor …« Tenbrink stockte.
»Kemper«, sagte der Arzt und lächelte nachsichtig.
»Kemper, ich weiß«, antwortete Tenbrink und fuhr sich mit den Fingern über die beschlagene Brille. »Wir sehen uns dann in Münster.«
Tenbrink und Bertram liefen den Hügel hinab, zwängten sich durch die Sichtblenden und wurden sofort von einem uniformierten Kollegen der Schutzpolizei angesprochen.
»Benötigen Sie die Zeugen noch?«, fragte der Polizeiobermeister.
»Zeugen der Tat?«, antwortete Tenbrink verwundert.
»Nein, ich meine die Leute, die die Leiche entdeckt haben.« Der Polizeiobermeister klang irritiert. »Sie sitzen drüben in der Mühlenschänke und warten. Werden langsam ungeduldig.«
»Haben Sie die Aussagen der Zeugen aufgenommen?«
»Jawohl.«
»Hat ein Polizeifotograf Bilder des Auffindeorts gemacht?«
»Jawohl«, wiederholte der Uniformierte, und Tenbrink befürchtete fast, dass der Mann gleich salutierte. »Gleich als Erstes, Herr Hauptkommissar, noch bevor die Kriminaltechniker vor Ort waren. Wir haben zwar keinen Polizeifotografen, aber unser Anwärter hat immer eine Kamera dabei und hat alles fotografiert. Da war die Tote aber bereits vom Galgen geschnitten. Leider.«
»Wenn Sie die Namen und Adressen der Zeugen notiert haben, können sie meinetwegen gehen. Sollte es noch weitere Fragen geben, können wir sie ja dann kontaktieren.«
»Einige der Zeugen sind nicht von hier«, sagte der Polizeiobermeister und fügte achselzuckend hinzu: »Touristen aus Hannover. Sie zelten in der Nähe.«
»Zelten?«, wunderte sich Tenbrink. »Im Oktober?«
»Im Münsterland?«, fügte Bertram kopfschüttelnd hinzu.
»Ja«, sagte der Polizeiobermeister und schmunzelte. »Fand ich auch komisch.«
3
»Jetzt lassen Sie mich doch durch!«, rief eine aufgebrachte Frauenstimme. »Ich will zu meiner Schwester!«
Tenbrink, der gerade mit Bertram das weitere Vorgehen besprechen wollte, fuhr herum und sah eine etwa dreißigjährige Frau mit leuchtend rotem Haar und wild funkelnden Augen, die vor dem Flatterband stand und von zwei uniformierten Polizisten mit viel Mühe daran gehindert wurde, zum Rettungswagen zu gelangen. Die Trage mit der zugedeckten Leiche wurde gerade von zwei Sanitätern ins Heck des Wagens geschoben.
»Das ist meine Schwester!«, rief die Frau und deutete auf die Trage. »Ich will sie sehen.« Im selben Augenblick hatte die schlanke, aber erstaunlich starke Frau den einen Kopf größeren Polizeimeister, der sich vor ihr aufgebaut hatte, zur Seite gestoßen und lief zum Wagen. Bevor die Rettungssanitäter sie daran hindern konnten, zog sie das Tuch von der Leiche und starrte auf die tote Frau. Ihre Hand strich der Toten über die bleiche Wange, und fast gleichzeitig stieß sie einen gellenden Schrei aus, der Tenbrink durch Mark und Bein ging. Die Tränen schossen ihr in die Augen, sie schnappte nach Luft und begann zu wanken.
Tenbrink hatte sich ihr von der Seite genähert und fasste sie unter den Arm, bevor sie zu Boden gehen konnte. »Frau Gerwing?«, fragte er.
Sie drehte sich wie in Zeitlupe um und schaute ihn verständnislos an. Sie öffnete den Mund, doch es kam kein Ton heraus. Dann hielt sie sich die Hand vor den Mund und schüttelte fassungslos den Kopf.
»Ich bin Hauptkommissar Tenbrink von der Kripo Münster«, sagte er und gab einem der Sanitäter ein Zeichen, die Leiche zuzudecken und in den Wagen zu schieben. »Es tut mir sehr leid wegen Ihrer Schwester. Mein herzliches Beileid.«
»Sie hat uns alle zum Narren gehalten.« Anne Gerwing atmete schwer und kämpfte mit den Tränen.
»Wie bitte?«
»Sie hat es die ganze Zeit vorgehabt«, wisperte sie und wischte sich mit dem Ärmel ihres Mantels über die laufende Nase. »Von Anfang an.«
»Hat sie das gesagt?«, fragte Bertram, der sich ebenfalls genähert hatte.
»Was?«, antwortete sie verwirrt und schaute Bertram verständnislos an. »Nein, im Gegenteil! Das ist es ja eben. Ihr ging’s gut, immer besser, alles im Lot. Das hat sie zumindest behauptet. Ellen war schon immer eine gute Schauspielerin. Nicht nur vor der Kamera.«
»Warum hat sie sich umgebracht?«, fragte Tenbrink und merkte, dass seine Frage allzu direkt und hart geklungen hatte.
»Fragen Sie das im Ernst?«, antwortete Anne Gerwing und kniff die Augenbrauen zusammen. Erst jetzt bemerkte Tenbrink die riesigen Sommersprossen in ihrem auffallend blassen Gesicht, und ihm fiel auf, wie unterschiedlich die beiden Schwestern aussahen. Die eine mit langen dunkelblonden Haaren, blauen Augen und sehr feinen und ebenmäßigen Gesichtszügen, die andere mit fuchsigem Kurzhaar, grünen Augen und einem energischen, fast harten Ausdruck im Gesicht. Doch beide auf ihre jeweilige Art durchaus bemerkenswert. Die eine auffallend schön, die andere interessant.
»Ihre Schwester hatte gerade erst einen Flugzeugabsturz überlebt«, hörte Tenbrink seinen Kollegen fragen und musste sich regelrecht zwingen, Anne Gerwing nicht länger ins Gesicht zu starren.
»Das Überleben war ja gerade Ellens Problem«, sagte sie und zuckte merklich zusammen, als die Hecktür des Rettungswagens mit einem lauten Knall geschlossen wurde. »Dass sie überlebt hat, hat Ellen nicht glücklich gemacht. Es hat sie in eine schwere Depression gestürzt.«
Bertram schluckte. »Der Mann Ihrer Schwester war ebenfalls an Bord der Maschine, nicht wahr? Und er hat den Absturz nicht überlebt.«
Anne Gerwing nickte nachdenklich. »Er saß neben ihr. Ellen hat den Aufprall auf dem Wasser wie durch ein Wunder überlebt und wurde gerettet, Michael nicht. Reiner Zufall. Oder Schicksal. Ganz wie Sie wollen. Ellen ist damit nicht klargekommen.«
Tenbrink hatte die Berichterstattung über den Flugzeugabsturz vor einem Jahr nur beiläufig verfolgt. Während des Landeanflugs war ein Vogelschwarm in die Turbinen geraten. Beim Versuch, ohne funktionierende Triebwerke auf dem Wasser zu landen, war die Maschine auseinandergebrochen und gesunken. Tenbrink erinnerte sich, dass unter den Opfern auch Ellen Gerwings Mann, ein erfolgreicher Produzent und Filmregisseur, gewesen war. Nur den Namen des Mannes hatte er vergessen. Tenbrink war sich sicher, dass er nicht Gerwing geheißen hatte. Michael … Verflixt! Verdammte Namen!
»Michael Hartmann stammte auch aus Ahlbeck, nicht wahr?«, fragte Bertram und bekam von Tenbrink ein dankbares Lächeln geschenkt, dessen Grund er natürlich nicht verstehen konnte.
Wieder nickte Anne Gerwing. »Der Kotten seiner Eltern ist nur einen Kilometer von unserem Hof entfernt. Ellen und Michael lebten aber schon seit vielen Jahren in Berlin«, setzte sie hinzu und seufzte. »Ellen war nur sehr selten in Ahlbeck.«
»Sie sagten gerade, Ihre Schwester sei mit dem Überleben des Absturzes nicht klargekommen.« Tenbrink führte Anne Gerwing hinter die Polizeiabsperrung, wo sie ungestörter reden konnten. »Was genau meinten Sie damit? Wie hat sich das ausgedrückt?«
»Posttraumatische Belastungsstörung, so lautete die Diagnose«, sagte Anne Gerwing und schaute dem Rettungswagen nach, der sich gerade einen Weg durch die Schaulustigen bahnte und auf die Straße zur Kolkmühle einbog. »Ellen litt seit dem Absturz unter Panikattacken und Angstzuständen. Vor allem in Fahrzeugen jeder Art. Es war ihr zum Beispiel nicht mehr möglich, irgendwo im Auto mitzufahren, wenn sie nicht selbst am Steuer saß. In Berlin ist sie einmal vor lauter Panik aus einem fahrenden Taxi gesprungen. Sie war deshalb auch in ärztlicher Behandlung und hat eine Therapie gemacht.«
»Hat sie Medikamente genommen?«, fragte Bertram.
Sie nickte und schüttelte gleich darauf den Kopf. »Die Therapeutin in Berlin hat ihr Psychopharmaka verschrieben, um die Angst zu lösen. Anafranil, ein Antidepressivum. Doch Ellen hat die Medikamente vor Kurzem abgesetzt. Ohne Absprache mit der Ärztin. Keine gute Idee. Das hab ich ihr auch gesagt, aber sie hat behauptet, sie bräuchte die Tabletten nicht mehr. Sie hatte Angst vor den Nebenwirkungen.« Anne Gerwing schlug den Kragen ihres Kamelhaarmantels hoch und setzte hinzu: »Ellen hätte nicht herkommen dürfen.«
»Wohnte sie bei Ihnen? In Ihrem Hotel?«
»Es ist … war auch Ellens Hotel«, antwortete sie achselzuckend. »Auf dem Papier jedenfalls. Wir haben den Hof gemeinsam von unseren Eltern geerbt, aber sie wollte nie etwas mit dem ›Schulzenhof‹ zu tun haben. War nicht ihr Ding. Sie war mit ihren Filmen ja auch ausreichend beschäftigt.« Wieder zuckte sie mit den Achseln. »Vor zwei Wochen stand sie dann plötzlich vor der Tür.«
»Weshalb ist sie nach Ahlbeck gekommen?«, wollte Tenbrink wissen und beeilte sich hinzuzusetzen: »Ich meine nicht …« Er deutete vage in Richtung Galgen.
»Wegen der Reha«, antwortete Anne Gerwing. »Das hat sie jedenfalls behauptet. Wir sind ein zertifiziertes Wellness-Hotel mit ausgezeichneter Fitness-Abteilung. Ellen hatte die postakute Rehabilitation in Berlin gerade hinter sich und konnte erst seit einigen Wochen wieder ohne Gehhilfe laufen. Sie wollte bei uns an ihrer Fitness arbeiten. Muskelaufbau, Konditionstraining und Narbenbehandlung.« Sie schüttelte heftig den Kopf, und mit einem Mal liefen ihr die Tränen über die Wangen. »Alles nur Vorwand. Sie war wegen des verdammten Galgenhügels hier.«
»Sie ist nur wegen dem Galgen nach Ahlbeck gekommen?«, wunderte sich Tenbrink. »Um sich daran zu erhängen?«
»Nein, nicht wegen des Galgens«, entgegnete sie unwirsch. »Obwohl ihr das verfluchte Ding vermutlich gut in den Kram gepasst hat. Sie war wegen des Hügels hier!«
»Wegen dem winzigen Hügelchen?«, fragte Tenbrink erstaunt.
»Damals war er noch nicht winzig.«
»Damals?«, hakte Bertram nach.
»Sie haben keine Ahnung, oder?« Anne Gerwing machte eine gequälte Miene. »Sie wissen nicht, was auf dem Hügel passiert ist? Als er noch ein richtiger Hügel war? Nein, natürlich nicht. Wie sollten Sie auch!«
Tenbrink hob auffordernd die Augenbrauen. »Erzählen Sie’s uns!«
»Nicht hier«, antwortete sie, wandte sich ab und schlüpfte unter dem Flatterband hindurch. Einen Pressefotografen, der ein Foto von ihr machen wollte, starrte sie derart wutentbrannt an, dass er zurückwich, als hätte sie ihm eine Ohrfeige gegeben. Sie stapfte davon, und als sie bereits einige Meter gegangen war, rief sie über ihre Schulter: »Nun kommen Sie schon!«
An ihrem Tonfall konnte Tenbrink erkennen, dass sie es gewohnt war, Befehle zu geben. Und dass die Befehle befolgt wurden.
4
Der »Schulzenhof« war nur einen Katzensprung vom Galgenhügel entfernt und lag auf einer kleinen Anhöhe, einer sogenannten Warft, inmitten des Bruchwalds. Das Anwesen erinnerte nur noch ungefähr an einen münsterländischen Bauernhof. Zwar handelte es sich bei dem zentralen Hotelgebäude, in dem auch das Restaurant untergebracht war, um ein klassisches Hallenhaus, wie es für Bauernhöfe in dieser Gegend typisch war, doch beim Umbau zum Hotel hatte das Haus alles »Hiesige« eingebüßt. Das fand Tenbrink jedenfalls. Die übliche Fassade aus rotem Backstein war einem hübsch anzuschauenden und weiß verputzten Fachwerk gewichen. Und statt mit schlichten Tonziegeln war das riesige, an einigen Stellen fast bis zum Boden reichende Dach mit Reet aus Schilfrohr gedeckt. Der »Schulzenhof« sah nun so aus, wie sich Touristen einen alten westfälischen Bauernhof vorstellten. Und das war vermutlich auch der Sinn und Zweck der Umgestaltung gewesen. Auf Tenbrink als gebürtigen Münsterländer wirkte das norddeutsch anmutende Gebäude allerdings seltsam deplatziert und unecht. Wie ein Museum. Dazu passten auch die frisch lackierte und auf Hochglanz polierte Egge und der vorsintflutliche Handpflug, die vor dem Haus zwischen den Blumenbeeten ausgestellt waren.
Das einzige auf dem Hof, das vermutlich noch so aussah wie vor der Renovierung, war die uralte Linde am Ende der kiesbedeckten Auffahrt, deren gelbbraunes Laub gerade von einem Gärtner im grünen Kittel zusammengeharkt wurde. Sämtliche Stallungen, Gesindehäuser, Remisen und Scheunen, die früher einmal zu dem Hof gehört haben mussten, waren verschwunden und hatten modernen Apartment-Bungalows und Sportanlagen Platz gemacht. Soweit Tenbrink sich erinnerte, konnte der »Schulzenhof« mit allem aufwarten, was man von einem Wellnesshotel der Premiumklasse erwarten durfte: Swimmingpool, Fitnessraum, Sauna, Dampfbad, Massagebereich, Tennisanlage und Gymnastikraum.
»Hier entlang!« Anne Gerwing trat durch das alte Tennentor, das inzwischen mit Panoramafenstern versehen war und den Blick auf eine rustikal eingerichtete Empfangslounge freigab. »Meine Wohnung und die Büros sind hinten im Flett.«
»Flett?«, fragte Bertram leise.
»So hieß früher der hintere Bereich im Bauernhaus, so eine Art Wohnküche«, übersetzte Tenbrink und folgte der Chefin des Hotels durch die Lounge. »Im Flett wohnte die Herrschaft. Die Knechte und Mägde schliefen meist bei den Tieren auf der Tenne oder in winzigen Gesindehäusern.«
»Was du alles weißt«, staunte Bertram und grinste.
»Ich komme schließlich von hier«, knurrte Tenbrink, um nicht erkennen zu geben, dass Bertrams Bemerkung ihm geschmeichelt hatte.
Sie betraten nun das Restaurant, in dem es ebenfalls von bäuerlichem Tand und hübsch drapierten altertümlichen Gerätschaften wimmelte. Nur die alten Bohlen an der Decke und die frei stehenden Stützpfeiler erinnerten noch daran, dass hier früher einmal die Tenne gewesen war, mit dem Dreschplatz in der Mitte und den Stallungen an den Seiten. In einer Ecke befand sich eine gemauerte Feuerstelle, die ebenso wie der riesige, an schweren Ketten aufgehängte Messingtopf nur noch dekorativen Zwecken diente. Direkt daneben führte eine hölzerne Treppe ins obere Stockwerk, wo sich vermutlich die Zimmer der Hotelgäste befanden.
Anne Gerwing wartete an einer Tür am gegenüberliegenden Ende des Speiseraumes, auf der ein Schild mit der Aufschrift »Privat« prangte. Sie öffnete die Tür mit einer Keycard und führte Tenbrink und Bertram einen Gang entlang zu einem kleinen Büro, das erstaunlich uneinheitlich eingerichtet war und fast gemütlich wirkte. Ein altes Sofa stand in der Ecke, davor ein niedriger, mit Magazinen und Büchern beladener Tisch. An der Wand befand sich ein Regal mit weiteren Büchern, einigen Aktenordnern und einer altmodischen Stereoanlage. Mit Schallplattenspieler und analogem Radio, wie Tenbrink erstaunt feststellte. Auch die zum Teil vergilbten Konzertplakate an den Wänden schienen aus einer fernen Zeit zu stammen. Jugenderinnerungen, vermutete er. Oder Erbstücke. Es war offensichtlich, dass dieser Raum nicht nur als Arbeitszimmer genutzt wurde. Ein Refugium, dachte Tenbrink unwillkürlich und überlegte, ob dieser Raum früher einmal ihr Jugendzimmer gewesen sein mochte.
»Möchten Sie Kaffee?«, fragte Anne Gerwing und warf ihren Mantel über einen hölzernen Lehnstuhl hinter dem altmodischen Schreibtisch, auf dem sich außer einem Laptop und einem schnurlosen Telefon nichts befand. »Oder lieber Tee?«
Tenbrink schüttelte den Kopf und setzte sich aufs Sofa.
Bertram sagte: »Kaffee, bitte. Komplett.«
Anne Gerwing stutzte kurz, nickte dann, setzte sich in den Lehnstuhl und griff nach dem Telefon. Sie orderte Kaffee mit Sahne und Zucker und nachdem sie aufgelegt hatte, fragte sie völlig unvermittelt: »Wissen Sie, was es mit dem Galgen auf sich hat?«
»Ein historischer Hinrichtungsplatz«, sagte Tenbrink, dem das Hinweisschild am Galgenhügel nicht entgangen war. »Vom hiesigen Heimatverein an originaler Stelle wiedererrichtet. Vermutlich als Touristenattraktion.«
»Man erkennt es heute nicht mehr«, antwortete Anne Gerwing und nickte nachdenklich. »Aber der Galgen stand früher an einem Verkehrsknotenpunkt. Im Mittelalter führte ein wichtiger Handelsweg direkt daran vorbei, außerdem befanden sich die Mühle und der Grenzübergang in unmittelbarer Nähe. Die Gehenkten sollten weithin sichtbar sein und abschreckende Wirkung haben. Darum stand der Galgen auch auf einem großen Hügel. Oder Bülten, wie man in Ahlbeck sagt.«
»Von dem heute nicht mehr viel übrig ist«, setzte Bertram hinzu.
Es klopfte an der Tür. Bertram bekam seinen Kaffee. Tenbrink zückte seinen Notizblock. Und nach einer kurzen Pause fuhr Anne Gerwing fort: »Meine Eltern haben den Hügel vor sechzehn Jahren abtragen lassen. Sie haben den ganzen Bülten dem Erdboden gleichgemacht. Als könnten sie dadurch irgendwas ungeschehen machen. Was natürlich nicht möglich ist.«
»Was ist dort passiert?«, fragte Tenbrink. »Was hat Ihre Schwester auf dem Hügel erlebt?«
»Unsere Schwester Eva ist dort tödlich verunglückt«, sagte Anne Gerwing, und wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen. Sie schien nach den richtigen Worten zu suchen, räusperte sich mehrmals und setzte schließlich hinzu: »Eva und Ellen waren Zwillinge. Eineiige Zwillinge. Unzertrennlich wie Hanni und Nanni. So hab ich sie immer genannt.« Sie lachte plötzlich und hörte ebenso abrupt wieder damit auf. »Eva ist auf dem Galgenbülten in Ellens Armen gestorben.«
»Vor sechzehn Jahren?«, fragte Tenbrink.
Anne Gerwing nickte. »Es war ein Unfall, ein saudämlicher und tragischer Unfall«, sagte sie und starrte wie gebannt auf ihre Hände, an denen Tenbrink vergeblich nach einem Ehering suchte. Sie trug überhaupt keinen Schmuck, weder an den Händen noch am Hals. »Es hatte in der Silvesternacht heftig geschneit, alles lag unter einer dicken Schneedecke, und wir Mädels wollten auf dem Bülten tütenrutschen.«
»Tütenrutschen?«, fragte Tenbrink.
»Kennen Sie das nicht?«, wunderte sie sich. »Rodeln ohne Schlitten. Nur mit einer Plastiktüte, damit der Hintern nicht nass wird.«
»Hatten Sie keine Schlitten?«, fragte Tenbrink irritiert.
»Doch, natürlich, aber darum geht’s ja gerade beim Tütenrutschen. Na ja, eigentlich ziemlich kindisch, das Ganze. Es war Evas Idee gewesen. Wie früher, hatte sie gemeint, als wir noch kleine Kinder waren. Nur wir drei, allein im frischen Schnee. Eine Schnapsidee, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir waren auf einer Silvesterparty auf einem Nachbarhof und bereits ziemlich betrunken. Und weil es in der Nacht so stark geschneit hatte, hat Eva vorgeschlagen, ganz früh am nächsten Morgen zum Bülten zu gehen. Das war früher unser Rodelberg gewesen.«
»Wie alt waren Sie damals?«, fragte Bertram.
»Eva und Ellen waren achtzehn, ich war sechzehn«, sagte sie, ohne den Blick von ihren Händen zu nehmen. »Wir waren eigentlich schon zu alt für solche Albernheiten, aber wir hatten es so abgemacht, und darum sind wir am nächsten Morgen zum Galgenhügel gestiefelt. Ich hatte überhaupt keine Lust darauf, schließlich waren wir noch völlig verkatert und hatten nur wenig geschlafen, aber die anderen ließen sich partout nicht davon abbringen. Es sei alles so schön verschneit und unberührt, fanden sie, und ich solle nicht immer so eine Spielverderberin und Nörgeltante sein.«
Tenbrink ahnte bereits, was auf dem Rodelberg passiert sein könnte, und er fragte: »Durch was ist Ihre Schwester durchgerutscht? Eine Baumwurzel?«
Anne Gerwing schaute überrascht auf und schüttelte dann den Kopf. »Es war eine Glasscherbe«, sagte sie und rieb sich die Augen, als wäre ihr etwas hineingeraten. »Unter dem knöcheltiefen Schnee steckte eine zerbrochene Bierflasche im Boden. Von oben nicht zu sehen.«
»Und davon kann man sterben?«, wunderte sich Bertram und stellte seine Kaffeetasse ab.
Tenbrink schaute seinen Kollegen vorwurfsvoll an.
»Eva ist mit dem Oberschenkel durch die Scherbe gerutscht und hat sich die Arterie direkt unterhalb des Schambeins aufgerissen«, erklärte Anne Gerwing. »Sie ist innerhalb weniger Minuten verblutet. Ellen ist bei ihr auf dem Bülten geblieben und hat versucht, das Bein abzubinden, und ich bin nach Hause gelaufen und hab den Notarzt gerufen. Als ich mit unserer Mutter wieder beim Galgenhügel ankam, war Eva bereits tot.« Sie atmete schwer und hatte sichtlich Mühe, weiterzusprechen, die folgenden Worte kamen nur stakkatohaft und in Halbsätzen über ihre Lippen. »Ich hab noch nie so viel Blut gesehen … überall … auch Ellen … alles rot vor Blut. Mitten im Schnee. Ellen hat immer noch auf sie eingeredet, dabei … Eva war längst gestorben … in Ellens Armen.«
Tenbrink nickte und rückte sich die Brille zurecht, obwohl sie gar nicht verrutscht war. Vor einigen Jahren hatten sie einen Mord im Mafiamilieu untersucht. Das Opfer, ein italienischer Restaurantbesitzer, war damals auf genau diese Weise von Mitgliedern der ’Ndrangheta ermordet, ja regelrecht hingerichtet worden. Ein Schnitt durch die Oberschenkelarterie war ebenso tödlich wie ein Schnitt durch die Kehle.
Anne Gerwing erhob sich, wandte ihnen den Rücken zu und schaute aus dem Fenster auf den Nutzgarten, der hinter dem Haus lag. Dabei fuhr sie wie in einem Selbstgespräch fort: »Eva hatte keine Chance gehabt und Ellen auch nicht. Selbst wenn ein Notarzt sofort vor Ort gewesen wäre, hätte er die Blutung vermutlich nicht stoppen können. Ellen konnte nichts machen. Gar nichts. Aber trotzdem hat sie sich anschließend die Schuld dafür gegeben.«
»Weil sie ihre Schwester nicht gerettet hat?«, fragte Tenbrink.
Anne Gerwing nickte. »Ellen ist nie darüber hinweggekommen. Wir alle haben sehr unter Evas Tod gelitten, nicht zuletzt unsere Eltern, deshalb haben sie auch den Hügel eingeebnet. Aber Ellen hat es völlig fertiggemacht. Sie fühlte sich wie amputiert, hat sie mal gesagt. Als wäre mit Eva auch ein Teil von ihr gestorben. Zwillinge. Sie hat ihren Tod nie verwunden. Bis heute nicht.« Plötzlich fuhr sie herum, schaute Tenbrink eindringlich an und setzte hinzu: »Verstehen Sie?«