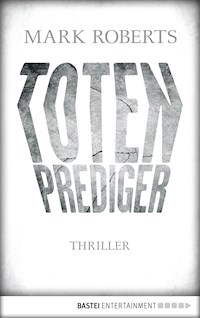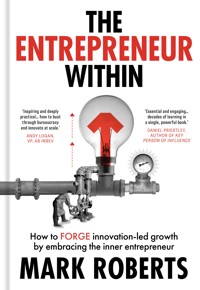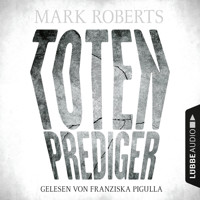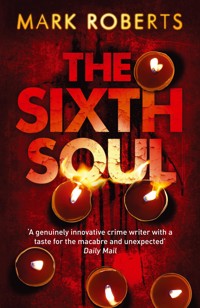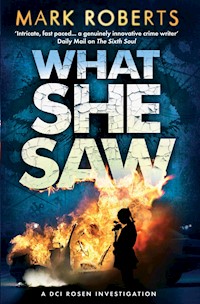9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eve Clay
- Sprache: Deutsch
Vor zehn Jahren hielt der Serienkiller Justin Truman Liverpool in Atem. Er folterte und ermordete Männer, die eines gemeinsam hatten: Sie waren polizeibekannte Pädophile. Truman wurde zwar gefasst, konnte aber bald fliehen und untertauchen. Bis heute existieren Websites, auf denen Fans ihn als Rächer der missbrauchten Kinder feiern. Als erneut Morde an Pädophilen begangen werden, muss sich DCI Eve Clay der Frage stellen, wer diesmal Selbstjustiz übt: Truman - oder etwa einer seiner Fans?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungProlog: 29. September 1984Erster Teil: Los Llorones – Weinende KinderErster Tag: Montag, 23. Oktober 201712345678910111213141516171819202122232425262728Zweiter Teil: Die Seelen heimkehrender KinderZweiter Tag: Dienstag, 24. Oktober 201729303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798Dritter Teil: TotentanzDritter Tag: Mittwoch, 25. Oktober 201799100101102103104105107108109110111112113114115116EpilogDanksagungÜber dieses Buch
Vor zehn Jahren hielt der Serienkiller Justin Truman Liverpool in Atem. Er folterte und ermordete Männer, die eines gemeinsam hatten: Sie waren polizeibekannte Pädophile. Truman wurde zwar gefasst, konnte aber bald fliehen und untertauchen. Bis heute existieren Websites, auf denen Fans ihn als Rächer der missbrauchten Kinder feiern. Als erneut Morde an Pädophilen begangen werden, muss sich DCI Eve Clay der Frage stellen, wer diesmal Selbstjustiz übt: Truman – oder etwa einer seiner Fans?
Über den Autor
Mark Roberts wurde in Liverpool geboren und arbeitete dort zwanzig Jahre als Lehrer, unter anderem an einer Förderschule. Er gewann den Manchester Evening News Theatre Award für das beste Stück des Jahres, außerdem wurden seine Kriminalromane international veröffentlicht. Mit Totenprediger beginnt Roberts eine neue Krimireihe um die Liverpooler Polizistin Eve Clay, die nicht nur grausame Morde, sondern auch ihre eigene Vergangenheit aufklären will. Weitere Informationen zum Autor finden Sie auf: www.markrobertscrimewriter.com
MARK ROBERTS
TOTENTAGE
THRILLER
Aus dem Englischen von Angela Koonen
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Mark Roberts
Titel der englischen Originalausgabe: »Day of the Dead«
Originalverlag: Head of Zeus
Published by Arrangement with Head of Zeus
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Titelillustration: © shutterstock Ensuper | arigato | Vectorcarrot
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7813-9
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Linda und Eleanor
Legt sie, die Sichel, sich auch um die Wangen,die rosigen – Lieb’ ist kein Narr der Zeit.Nicht können Stunden, Wochen sie belangen;der Jüngste Tag, er findet sie bereit.
SHAKESPEARE
Prolog
29. September 1984
»Bleib, wo du bist, Eve! Rühr dich nicht vom Fleck!«, befahl Mrs Tripp, die Leiterin des katholischen Kinderheims St. Michael. »Und wenn jemand in mein Büro kommt und mit dir reden will, sagst du kein Wort!«
Eve waren die Angst und der Schweißfilm im Gesicht der dicken Frau, die einen Augenblick später aus dem Büro eilte und die Tür hinter sich zuknallte, nicht entgangen. Still zählte Eve bis zehn und lauschte. Auf dem Flur war jedoch niemand zu hören.
Sie ging zum Aktenschrank, war in Gedanken schon bei dem dicken Schnellhefter, der an ihrem ersten Tag im St. Michael vor zwei Jahren auf Mrs Tripps Schreibtisch gelegen hatte und auf dem ihr Name stand: Evette Clay.
An der obersten Schublade stand »A-E«. Sie öffnete sie und ging die dünnen Mappen durch. Tom Adams, Jennifer Brady, Tonia Breen.
Der stark gewölbte Schnellhefter mit ihrem Namen kam ihr unter die Finger. Ihr Herz klopfte heftig, und der Mund war plötzlich ganz trocken, als sie ihn herausnahm. Sie wusste nicht, ob die Erinnerung ihr einen Streich spielte, aber es schien, als sei der Hefter jetzt dünner.
»Ja, da fehlt etwas, ganz eindeutig«, sagte sie zu sich. Sie klappte ihn auf und blätterte auf der Suche nach einem bestimmten Dokument mit der freien Hand durch die Unterlagen.
Wenn andere verloren gegangen sind, überlegte sie, warum dann nicht meine Geburtsurkunde?
Nach einem Drittel der Papiere stieß sie auf das rot-weiße Blatt. »Herr im Himmel«, flüsterte sie.
Im Flur wurden jetzt Stimmen und Schritte laut. Eve hörte Mrs Tripp reden und auf das Büro zukommen, zusammen mit einem Erwachsenen, der zwischen Mrs Tripps schnellen Sätzen nur zustimmend brummte.
Eve steckte den Hefter an seinen Platz zurück und schloss die Schublade. Ihr war speiübel, als sie zu der Stelle hastete, an der Mrs Tripp sie zurückgelassen hatte. Den Blick aus dem Fenster gerichtet, wo der Notarztwagen mit offenen Hecktüren neben einem Streifenwagen stand, faltete sie ihre Geburtsurkunde zusammen und schob sie in ihre Hosentasche.
Hinter ihr öffnete sich die Bürotür, während draußen die Sanitäter einen zwanzigjährigen Mann mit blonden Locken auf einer Trage zum Krankenwagen trugen. Er war bis zum Hals mit einer blauen Decke zugedeckt. Sein Gesicht war blutig.
»Eve, was tust du am Fenster?« Mrs Tripp klang verwirrt und panisch, überspielte das aber mit unechtem Mitgefühl.
»Genau, was Sie gesagt haben, Mrs Tripp. Ich habe mich nicht vom Fleck gerührt.« Sie blieb stehen und beobachtete weiter, was vor dem Haus passierte. »Wird Christopher Hawkins ins Krankenhaus gebracht?«, fragte sie, als die Trage mit dem Bewusstlosen im Notarztwagen verschwunden war.
»Eve, es ist unhöflich, mit einem Erwachsenen zu sprechen und ihm dabei den Rücken zuzukehren!«, tadelte Mrs Tripp.
Und es ist unhöflich, zu jemandes Rücken zu reden, egal wie alt er ist, dachte Eve.
Eine hochgewachsene Polizistin in blauer Uniform stand in der Tür. Eve blickte an Mrs Tripp vorbei in ihr Gesicht. Die Polizistin lächelte sie an und schloss die Tür. »Ich möchte mich ein bisschen mit dir unterhalten, Eve. Ich heiße Gwen Jones und bin Police Constable.«
»Von der Admiral Street?«, fragte Eve.
»So ist es. Das ist mein Revier.«
»Nur keine Angst«, sagte die Heimleiterin.
Eve ging auf die Polizistin zu und fragte sich, ob Mrs Tripp mit sich selbst redete.
»Ich habe keine Angst vor Ihnen.« Eve versuchte zu lächeln, spürte aber, dass es traurig ausfiel.
Die Polizistin bückte sich zu Eve hinab. Sie wirkte zwar sehr tough, strahlte aber zugleich eine Freundlichkeit aus, die das aufgewühlte Mädchen beruhigte. Ihr Blick huschte über Eves Gesichtszüge, als läse sie darin wie in einem Buch.
Dann schaute sie hinter sich. »Sie können jetzt gehen, Mrs Tripp.«
Eve war augenblicklich erleichtert.
Schweigen.
Die Polizistin richtete sich gerade auf und zeigte zur Tür. Mrs Tripp ging errötend hinaus und schloss die Tür mit einer Demut, die Eve an ihr noch nie gesehen hatte.
Jones schob Eve sanft in Richtung Schreibtisch und deutete auf den Stuhl davor. Als Eve sich setzte, freute sie sich, weil die Polizistin sich neben ihr auf Mrs Tripps Schreibtischkante niederließ.
»Wenn ich dich bitte, von Anfang an zu erzählen, Eve, dann meine ich durchaus Ereignisse, die nicht erst heute stattgefunden haben. Erzähl mir mit deinen eigenen Worten, was passiert ist, und lass dir Zeit. Wir haben so viel Zeit, wie du brauchst.«
»Wir dürfen keine Haustiere haben. Manche Kinder bei uns waren nicht nett zu Tieren. Wissen Sie, was ich meine?«
Jones nickte. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt Eve.
»Aber im Garten hinter dem Haus gibt es einen streunenden Kater, der da lebt. Er heißt Rufus. Ich darf es nicht, aber ich füttere ihn trotzdem. Rufus ist scheu, aber bei mir ist er ein bisschen zutraulicher, weil ich ihn gut behandle. Also …« Eve kamen die Tränen. Sie atmete tief durch und drängte sie damit zurück. »Vor drei Wochen ist Rufus verschwunden, er kam nicht mehr in den Garten. Einige Kinder meinten, er sei weitergezogen wegen der anderen Kater in der Nachbarschaft. Manche behaupteten, er sei überfahren worden. Ich war vernünftig. Ich habe mich damit abgefunden, dass er weg ist. Als ich im Botanischen Garten war und Chris …«
»Christopher Hawkins?«
»Ja. Er arbeitet hier. Er hat mich immer angeguckt, aber nie angesprochen, außer heute Morgen. Er sagte, er hätte Rufus hinten im Garten gesehen.«
»Wer war sonst noch im Botanischen Garten, Eve?«
»Alle. Alle Kinder. Alle Erwachsenen. Sogar Mrs Tripp.«
»Wieso das?«
»Weil wir Michaelis feiern. Chris sagte: ›Geh doch zurück zum Heim und sieh nach, ob Rufus da ist. Wenn jemand fragt, wo du bist, sag ich, ich hätte dich da drüben gesehen. Also keine Sorge.‹ Deshalb bin ich losgerannt, und als ich hier war, musste ich über die Mauer klettern, um in den Garten zu kommen. Ich habe überall gesucht, aber Rufus war nicht da. Da habe ich Chris plötzlich hinter mir gehört. ›Hast du Glück gehabt, Eve?‹, hat er gefragt. Er hat mich furchtbar erschreckt. Es war, als wäre er aus dem Nichts erschienen. ›Wie sind Sie hierhergekommen?‹, habe ich ihn gefragt. Er hat ganz freundlich gelächelt, guckte aber so komisch. ›Ich glaube, Rufus ist im Schuppen‹, meinte er. Und er gab mir den Schlüssel dazu und sagte: ›Geh nur, schließ auf, Eve.‹ Das habe ich getan. Drinnen war es stockdunkel. ›Er ist bestimmt da drinnen‹, meinte Chris. ›Geh doch rein und such ihn. Er braucht dich bestimmt noch. Geh nur, Eve.‹ Er schob mich ein bisschen, hier, zwischen den Schulterblättern, und ich ging schließlich. Er kam mit rein. Ich hörte die Tür knarren, als er sie zumachte, und es wurde noch dunkler. Dann sagte er: ›Du siehst aus, als müsstest du mal in den Arm genommen werden.‹ ›Nein, muss ich nicht‹, habe ich gesagt. Und: ›Rufus ist gar nicht hier.‹ ›Ja, aber wir beide‹, sagte er darauf. Und dabei hat er so laut geatmet. Es war schrecklich. Dann … ich kann mich nicht erinnern, was er noch gesagt oder getan hat, weil es in meinem Kopf ganz still wurde. Und schwarz. Dann … dann plötzlich wurde die Schuppentür aufgerissen, und ich kam zu mir und hörte jemanden schreien: ›Geh weg von ihr, du dreckiger Lustmolch!‹ Es war Jimmy. Jimmy Peace.«
»Jimmy Peace wohnt auch in eurem Heim, ja?«
Eve nickte stolz, und kurz hellte sich ihr Blick auf. »Er ist mein bester Freund auf der ganzen Welt. Er sagt, er wird immer auf mich aufpassen.«
»Das ist großartig, Eve.« Die Polizistin lächelte sie an. »Erzähl mir weiter von Chris.«
Eve wurde still. Ihr war, als fiele sie in ein tiefes Loch. »Chris wollte sich an ihm vorbeidrängen. Es ging alles ganz schnell, und plötzlich hatte Jimmy ihn draußen vor dem Schuppen im Schwitzkasten. Jimmy sah total wütend aus, aber als er mich anguckte, hat er gelächelt und total freundlich gesagt: ›Geh zurück zum Botanischen Garten. Du sollst keinen Ärger kriegen. Ich werde mich ein bisschen mit Chris unterhalten.‹ Der sagte: ›Ich schwöre bei Gott, Junge, beim Leben meiner Mutter, ich wollte ihr nur helfen, die Katze zu finden. Ich wollte ihr doch gar nichts tun.‹
Und mehr weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich in den Botanischen Garten zurückgelaufen bin und wie ich wieder hierherkam …«
»Eve!«, rief jemand von draußen.
Eve ging ans Fenster. »Jimmy?«
Jimmy, der größte, kräftigste fünfzehnjährige Junge der Welt, wurde von zwei dicken Polizisten rückwärts zum Streifenwagen gezerrt. Dabei blickte er zu Eve. »Ich lasse nicht zu, dass dir einer was tut. Eve!«, rief er, während er in das Auto verfrachtet wurde.
»Eve«, sagte PC Jones sanft hinter ihr und legte die Hände auf ihre Schultern. »Ich muss jetzt gehen. Ich werde ihnen sagen, was du mir erzählt hast. Das wird sich für Jimmy sehr günstig auswirken. Verstehst du?«
»Ja. Ich habe gemerkt, dass Chris etwas Schreckliches mit mir machen wird. Er ist mir zum Schuppen gefolgt. Jimmy hat das verhindert. Er hat mich gerettet.«
»Das ist wahr, Liebes. Da hast du vollkommen recht.«
Als PC Jones das Büro verließ, drehte sich Jimmy in dem Streifenwagen nach Eve um. Er wirkte bekümmert, und dann rief er ihr noch etwas zu. Sie konnte ihn zwar nicht hören, sah aber seinen zärtlichen Gesichtsausdruck dabei.
»Es tut mir leid, dass du meinetwegen in Schwierigkeiten steckst, Jimmy.«
Der Streifenwagen fuhr weg.
»Danke, Jimmy!«
Zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Beschützerin, Schwester Philomena, die sich bis zum sechsten Lebensjahr um sie gekümmert hatte, sagte sie das zu jemandem, und sie sagte es zu dem Jungen, der für sie wie ein großer Bruder war. »Ich liebe dich, Jimmy Peace.«
Sie versuchte, sich sein Gesicht vor Augen zu rufen, sich zu erinnern, wie er aussah, aber sobald er fort war, ließ ihr Gedächtnis sie im Stich.
Und nachdem der Streifenwagen weggefahren war, überkam sie eine traurige Gewissheit: Jimmy Peace würde nicht mehr ins St. Michael’s zurückkehren.
Erster Teil
Los Llorones – Weinende Kinder
Erster Tag
Montag,
23. Oktober 2017
1
18.30 Uhr
»Taten haben Folgen. Seine Sünden haben ihn eingeholt, und er starb wegen dem, was er mir angetan hat.«
Detective Chief Inspector Eve Clay hielt ihr Festnetztelefon ans Ohr gedrückt und hörte Samantha Wilsons bitteren Tonfall.
Sie betrachtete die Fotos der Leiche David Wilsons, die auf ihrem Schreibtisch in der Einsatzzentrale des Polizeireviers Trinity Road ausgebreitet lagen, und schauderte wieder genauso wie vor neun Tagen, als sie in das Schlafzimmer gegangen war und zum ersten Mal gesehen hatte, was der Mörder mit ihm gemacht hatte.
»Sind Sie noch dran, DCI Clay?«, fragte Samantha Wilson.
»Ja. Ich dachte nur gerade darüber nach, was Sie gesagt haben. Über Ihren Vater.«
»Er hat mich regelmäßig vergewaltigt, seit ich dreizehn war, und das zwei schreckliche Jahre lang.«
Clay verspürte aufsteigende Übelkeit.
Sie blickte auf ein Foto, das den Toten in Bauchlage auf dem Bett zeigte, mit dem Unterleib in einer Blutlache liegend. Er hatte sieben Brandblasen am Rücken, wo Räucherkegel zu Asche verglüht waren, und in die linke Schulter hatte der Mörder in eleganter Schreibschrift »Vindici« geritzt.
»Er wird heute Abend eingeäschert, Ms Wilson«, sagte Clay und wandte sich dem nächsten Foto zu. David Wilson in Rückenlage, anstelle der Genitalien eine klaffende Wunde, die Ursache der Blutlache.
»Gut!«
»Wollen Sie dem nach wie vor fernbleiben?«
Clay nahm die Keramikfigur in die Hand, die am Tatort gestanden hatte; ein Weinendes Kind vom mexikanischen Tag der Toten.
»Ja. Ich werde nicht hingehen.« Ihre Stimme stockte einmal kurz.
Sie drängt Tränen zurück, dachte Clay, während sie die Figur betrachtete, das Gesicht, die aufgemalten schwarzen Locken, das bis zu den nackten Knien reichende Unterhemd und das um den Hals gehängte Schildchen, auf dem »Samantha« stand.
»Falls Sie es sich anders überlegen, werde ich Detective Sergeant Stone anweisen, Sie zur Unterstützung zu begleiten.«
»Hmm.«
Anhand des Lauts spürte Clay, dass Samantha Wilson weich wurde, und winkte Stone zu sich. »Möchten Sie mit ihm sprechen?«
Samantha sagte ohne zu zögern Ja.
Stone war ein grauhaariger Vierziger mit beginnendem Buckel. Der Spitzname, den Clay ihm beim ersten Anblick gegeben, aber nie ausgesprochen hatte, kam ihr in den Sinn: der Geiermensch.
»Karl, ich habe Samantha Wilson am Telefon.« Clay hielt das Mikrofon zu. »Sie will noch immer nicht zur Einäscherung gehen.«
»Was soll ich tun?«
»Ich möchte, dass sie teilnimmt. Vielleicht fällt eine aufschlussreiche Bemerkung, wenn sie mit ihrer Mutter zusammentrifft.«
»Überlass das mir, Eve.«
Clay gab ihm das Gerät.
»Hallo, Samantha. Wie geht es Ihnen?«
Da die Fotos auf dem Schreibtisch sie an die Mordnacht erinnerten, ging Clay ans Fenster, nahm ihr iPhone und öffnete die Sprachmemos. »Neuer Eintrag 15.10.2017.«
Sie schaute über die Schulter zu Stone, der seiner Gesprächspartnerin konzentriert zuhörte, und dachte an den Moment, als sie vom Tatort in die Einsatzzentrale zurückkehrte und ihr Festnetzgerät zu klingeln anfing. Es hatte aufgehört, kaum dass sie danach griff.
Beim erneuten Klingeln kurz darauf hatte sie beim Abnehmen die Sprachmemofunktion eingeschaltet.
Jetzt suchte sie sich den Mitschnitt heraus und hörte ihn sich an.
»DCI Eve Clay.«
Auf dem Display hatte »Unbekannt« gestanden.
»Hallo, Eve.« Der männliche Anrufer klang, als freue er sich, mit ihr zu sprechen.
»Wer sind Sie?«
»Wer ich bin?« Jetzt klang er sehr amüsiert. »Ich weiß, wer Sie sind, Eve, und es ist schön, Sie zu kennen.«
»Ich verrate Ihnen, was ich bin. Ich bin todmüde und habe keine Zeit für Spielchen oder sinnloses Rätselraten, denn ich habe viele echte Probleme zu lösen. Also sagen Sie mir bitte, wer Sie sind, oder ich lege auf.«
Nach kurzem Schweigen erklärte der Anrufer: »Ich will Sie weder ärgern noch Ihre Zeit vergeuden, Eve. Ich werde Ihnen über einen Dritten ein Foto schicken. Das sollte Sie von einer Idee abbringen, die Ihnen gerade durch den Kopf geht. Würde Ihnen das gefallen?«
»Ja. Aber wer sind Sie?«
»Das werde ich Ihnen gleich verraten. Sitzen Sie gut? Ich bin Vindici.« Die Tonaufnahme gab seine Sprache fast mit dem Singsang eines Kinderreims wieder, und sie fühlte sich versucht, in Erinnerungen abzugleiten.
»Haben Sie David Wilson getötet?«
»Finden Sie mich …«
»Haben Sie David Wilson getötet?«
»… und all das wird aufhören.«
»Haben Sie David Wilson getötet?«
»Oder soll ich Sie finden?«
Danach hatte der Anrufer aufgelegt.
»Eve?« Sie hörte Detective Sergeant Bill Hendricks hinter sich und drehte sich um.
»Ich schwanke noch, Bill. Ich war erst überzeugt, dass das ein Telefonstreich war.«
»Tja, es war keiner, Eve. Der Stimmenvergleich hat das bewiesen.«
Sie erinnerte sich, wie sie eine Gänsehaut bekam, als bei den Aufnahmen der Londoner Verhöre Vindicis und des Telefonats mit ihr die Computergrafiken dasselbe Muster nachwiesen.
»Er ist wieder da, Eve. Ich bin mir sicher, dass Vindici unser Täter ist. Er hat Wilson ermordet. Das Timing seines Anrufs war mustergültig.«
»Ich verstehe das nicht, Bill.«
»Was verstehst du nicht? Der Modus Operandi ist fast derselbe wie bei den Morden, die er in London und Brighton vor elf, zwölf Jahren begangen hat.«
»Aber er ist seit fünf Jahren flüchtig. Wieso tritt er jetzt wieder in Erscheinung? Und warum hat er sein Territorium nach Liverpool verlegt?«
»Darüber werde ich mir den Kopf zerbrechen«, sagte Hendricks.
Sie schaute auf ihr iPhone, und dabei entspann sich ein Gedankengang. Ich bin ihm nie persönlich begegnet …
Die zweite Mordserie Justin Trumans alias Vindici hatte direkt vor ihrer Nase begonnen.
Sie schaute zum Fenster, sah in der Scheibe ihr Spiegelbild und fühlte sich seltsam beunruhigt.
… aber er tat so, als ob er mich kennt.
2
18.45 Uhr
Die befriedigendste Aufgabe, mit der sich Detective Constable Barney Cole seit der Nacht von Wilsons Ermordung zu befassen hatte, bestand darin, Justin Trumans Lebenslauf zu recherchieren. Nachdem er tagelang in den frühen Morgenstunden konzentriert daran gearbeitet hatte, war er nun fertig geworden. Aufgrund von Gesprächen mit Kollegen der Londoner Polizei, deren Ermittlungsakten und akribischem Durchforsten der Vindici-Fanseiten im Internet hatte er die Fakten zusammengetragen.
»Hey, Eve«, rief Cole. »Ich bin mit Trumans Vita fertig.«
Clay blickte auf und sah vier A4-Haufen unterschiedlicher Höhe auf Coles Schreibtisch liegen, von denen einer auffällig dünn war.
Als sie zu ihm ging, zeigte er auf den dünnen Stapel und erklärte: »Justin Trumans unbescholtene Jugendzeit.« Er klopfte auf die Akten daneben. »Fahndung der Metropolitan Police während seiner aktiven Zeit bis zur Verhaftung.«
Clay las den gelben Klebezettel an dem nächsthöheren Haufen. »Justin Truman, Verhöre bei der Met nach seiner Verhaftung bis zum Prozess«. Sie tippte auf den dicksten Stapel. »Und der?«
»Trumans Gerichtsverhandlung und Flucht aus dem Gewahrsam.«
Cole warf eine Vitamintablette in einen Plastikbecher und goss Mineralwasser hinein, sodass die Tablette sprudelnd darin aufging.
»Ich habe schwer geackert, um das zusammenzutragen.«
»Danke, Barney, du bist ein Arbeitstier, und ich weiß das wirklich zu schätzen.«
»Es gibt so viele Vindici-Fanseiten, das Internet wimmelt nur so davon.« Cole bewegte seine Laptop-Maus, und das zur Ikone gewordene Polizeifoto, das nach der Verhaftung in London gemacht worden war, füllte den Bildschirm. Über seinem Kopf stand »Vindici« und darunter »Tod den Pädos«. Er wies auf die Website und sagte: »Diese zum Beispiel.«
Clay betrachtete Vindicis Gesicht. Ein gut aussehender Mann mit braunen Augen, schwarzen Haaren und einer Stirntolle. Obwohl er für das Polizeifoto ein neutrales Gesicht machte, wirkte sein Blick glücklich.
»Diese Seite ist ganz typisch, aber eines lässt sie für uns besonders interessant erscheinen«, sagte Cole. »Dies ist eine der beiden Sites, die von Liverpool aus betrieben werden.«
»Wirklich?« Clays Miene hellte sich auf. »Wo denn?«
»Das versuche ich mit Poppy Waters zusammen herauszufinden. Schau her, Eve.«
Cole klickte im Menü auf »Methode«, und auf dem Bildschirm erschien eine Tischplatte, auf der einige Gegenstände präsentiert wurden.
Clay las, was darüber stand: Was ihr für eine Hinrichtung im Stil Vindicis benötigt.
Sie betrachtete ein gefährlich aussehendes Schnitzmesser und dachte: Kastration. Sie zählte sieben Räucherkegel. Zum Abbrennen. Und eine angespitzte Fahrradspeiche. Um das Gehirn zu zerstören. Und dabei gingen ihr die Tatortfotos nicht aus dem Kopf, die sie sich während des Telefonats mit Samantha Wilson angesehen hatte.
Das Bild wechselte und zeigte zwei menschliche Skelette, gekleidet als Braut und Bräutigam. Unterhalb der Füße erschienen die Worte »Mitte Oktober bis Anfang November« und wurden dann ersetzt durch »Zeitraum für das Fest anlässlich des Tags der Toten«.
»Was er am Tatort zurückgelassen hat, hat mit dem Día de los Muertos zu tun, der in Mexiko gefeiert wird.«
»Fragt sich nur, warum«, sagte Clay. »Warum ist das Fest für ihn so bedeutsam?«
»Ich enttäusche dich wirklich nicht gern, Eve, aber ich weiß es nicht. Fest steht, dass er zwischen Mitte Oktober 2005 und Anfang November 2006 zehn Männer ermordet hat. Er begeht seine Taten immer in dem Zeitrahmen, da die Mexikaner ihre Verstorbenen ehren. Die übrige Zeit tritt er nicht in Erscheinung.«
»Also nimmt er sich vierzehn Tage Zeit, um Pädophile hinzurichten«, schloss Clay.
»Bisher war jedes seiner Opfer wegen Kindesmissbrauchs verurteilt«, sagte Cole. »Er hat sie alle in ihren Häusern gefoltert und ermordet. Hat Räucherkegel auf ihnen abgebrannt, sie kastriert, ihnen dann eine Fahrradspeiche ins Gehirn getrieben. Seine Verhaftung war ein reiner Zufallstreffer. Vindici wurde von einem jungen Verkehrspolizisten angehalten, und der hat dabei den Weihrauch an ihm gerochen. Vindici kam da gerade von seinem zehnten und letzten Mord. Er hat sich der Verhaftung nicht widersetzt, ist vielmehr mitgegangen wie das Lamm zur Schlachtbank. Er hat nichts abgestritten, weigerte sich aber, die symbolischen Gegenstände am Tatort zu erklären, also die Räucherkegel und die Süßigkeiten.«
»Süßigkeiten?«
»Ja. Figuren, wie sie am Tag der Toten üblich sind. Also Totenschädel, Skelette und dergleichen aus Zucker. Makaber, aber süß.«
»Moment mal, Barney.« In Gedanken ging Clay die Räume des Wilson’schen Hauses durch. »Bei Wilson hat er keine Süßigkeiten hinterlassen. Und dieses Detail wurde während des Prozesses und in den Medien auch nicht erwähnt.«
»Vielleicht hat er seine Vorgehensweise geändert.«
»Vielleicht. Oder er ist diesmal nicht der Täter. Nein, ich habe mit ihm telefoniert. Es ist kein Trittbrettfahrer. Es ist Vindici.« Clay konnte selbst heraushören, dass sie skeptisch klang, und intuitiv wandte sie sich der Vindici-Fanseite wieder zu. »Verfolge weiter, was auf den Fanseiten passiert, Barney.«
»Es ist kompliziert, herauszufinden, wer eine Website aufgesetzt hat, aber wir arbeiten daran.«
»Was hat sich während des Prozesses abgespielt?«, fragte Clay.
»Der war ein Medienrummel. Truman wiederholte nur immerzu: Ich preise die Unschuldigen und betrauere ihren Tod. Nun, die Seelenklempner waren sich einig: Truman war hundertprozentig zurechnungsfähig. Nach einem schiefgegangenen Prozess – eine Jurorin gestand, sich in Truman verliebt zu haben – wurde er im zweiten Durchgang mit zehn Stimmen für schuldig befunden und bekam lebenslänglich aufgebrummt.«
»Weiter«, bat Clay.
»Während des Prozesses im Old Bailey wurde er von Industrie und Medien vermarktet«, fuhr Cole fort. »Sein Polizeifoto wurde auf T-Shirts, Poster und Kaffeetassen gedruckt und verkauft. Es ist noch immer ein höchst beliebter Bildschirmschoner und sogar Motiv eines Werks von Banksy in Camden Lock. Vindici ist für die Öffentlichkeit ein Held. Jedenfalls kommt er in einen Vorzeigeknast und wird ein mustergültiger Häftling; geliebt von den Wärtern und von den Mitgefangenen vergöttert, die ihn wegen der Art seiner Verbrechen mit Geschenken und Respekt überhäufen. Schließlich wird er nur noch schludrig bewacht, und im Januar 2012 verschanzt er sich mit einem Wärter namens Vincent Reagan in seiner Zelle. Er behält Reagan zwölf Stunden lang da, foltert ihn und informiert die Behörden, dass der Mann pädophil sei. Er war in der Hinsicht nur noch nicht aufgefallen, weshalb der Geiselunterhändler Truman erklärte, er habe den Falschen. Doch der sagte, sie sollten sich verziehen, er wisse genau Bescheid, und sie sollten Reagans Haus unter die Lupe nehmen.«
Cole machte eine dramatische Pause, bevor er weiter berichtete: »Reagan lebte bei seiner alten Mutter. Die übrigen Wärter hatten ihn immer für einen Einzelgänger gehalten. Wie sich herausstellte, war seine Bude mit kinderpornographischen Bildern tapeziert, und als man seinen Laptop durchsuchte, zeigte sich, dass er tatsächlich die Nummer eins eines großen Pädophilenrings war, der sich über fünf Kontinente erstreckte. Es gab dreiunddreißig Verhaftungen und Verurteilungen, inklusive sieben sich anschließender Suizide. Zahllose Verdächtige tauchten unter und verschwanden spurlos. Das war Vindicis Sternstunde. Er folterte und tötete Reagan, verbreitete Fotos im Internet mit einem Mobiltelefon, das er von Eddie Christian bekommen hatte, einem Gangsterboss aus Manchester. Diese Bilder verbreiteten sich weltweit. Nach zwölf Stunden schob er Reagan den angespitzten Stiel eines Löffels durchs Ohr ins Gehirn, und: Gute Nacht, Mr Reagan. Dann öffnete er seelenruhig seine Zellentür und streckte die Arme vor, damit man ihm Handschellen anlegen und ihn abführen konnte. Reagan wurde in mehreren Tüten aus der Zelle geschafft. Finger, Ohren und Nase jeweils gesondert. Und Vindici war zum globalen Superstar aufgestiegen.«
»Wie konnte er fliehen?«, fragte Clay.
»Er sollte verlegt werden aus dem Strangeway in die Einzelhaft ins Untergeschoss des Wakefield. Unterwegs geriet der Konvoi in einen mehrfachen Auffahrunfall. In dem daraus resultierenden Durcheinander konnte Truman entkommen und wurde nie wieder gesehen.«
»Gut gemacht, Barney. Das war sehr erhellend.«
»Also, dann begebe ich mich mal wieder auf die Fährte der Liverpooler Vindici-Fanseiten.«
Clay reagierte nicht mehr auf die Bemerkung, da sie gedanklich mit den zwei Webseiten beschäftigt war.
»Nur zu, Eve«, sagte Cole. »Ich kann in Ihrem Kopf die Rädchen schnurren hören.«
»Ich denke an den Dominoeffekt. Jede Wette: Wenn wir eine der Liverpooler Seiten lokalisieren, dann kurz darauf auch die andere, vielleicht sogar am selben Tag.«
»Wie stellst du dir das vor?«
»Sie betreiben sie in derselben Stadt aufgrund derselben Leidenschaft. Sie kennen sich persönlich. Sie halten einander den Rücken frei. Und sie könnten Licht in den Mordfall bringen.«
»Dann hoffe ich, du hast recht, Eve.«
Sie merkte, dass er ihre Vermutung nicht teilte, und fragte sich, ob sie einem Wunschdenken unterlag.
»Ich auch. Wir werden sehen«, sagte sie. »Zeig mir bitte noch mal Vindicis Polizeifoto.«
Sie schaute auf Coles Laptop und fühlte sich von Vindicis Augen angezogen. Ein frisch verhafteter Mann, der glücklich wirkte, obwohl ihm ein Leben hinter Gittern bevorstand.
»Wir werden sehen«, wiederholte sie. »Wir werden sehen.« Dann wandte sie sich ab. Gerade brachte Stone sein Telefongespräch mit Samantha Wilson zu Ende. Sie bemerkte an ihm die Körpersprache eines Mannes, der mit einem ihm nahestehenden Menschen spricht. Was er sagte, konnte sie nicht verstehen, aber er bekam dabei einen weichen Gesichtsausdruck.
Er legte auf und schaute lächelnd zu Clay. »Sie wird heute zum Springwood Krematorium gehen. Myrtle Chapel. Unter der Bedingung, dass ich sie begleite. Ich habe ihr gesagt, sie braucht jetzt menschliche Nähe.«
»Gut gemacht, du Charmeur!«, sagte Clay und fragte sich, was wohl zum Vorschein kommen würde, wenn Samantha Wilson und ihre Mutter aufeinanderprallten.
3
19.58 Uhr
Clay stand an der Tür des Springwood Krematoriums und beobachtete Samantha Wilson und deren Mutter, Sandra Wilson.
Der Mond kam hinter einer Wolke hervor, und das ätherische Licht ließ das vergiftete Verhältnis der beiden, ihre ablehnende Körpersprache, den Zorn der Tochter und den Schmerz der Mutter klar erkennen.
Zwei Leichenwagen, die langsam auf das Krematorium zufuhren, zogen Samanthas Aufmerksamkeit an, sodass sie sich noch ein wenig mehr von ihrer Mutter wegdrehte.
Taten haben Folgen! Clay wälzte den Ausspruch im Kopf, als sie Riley und Stone zunickte.
DS Gina Riley trat auf die Witwe zu. »Mrs Wilson?«
Stone näherte sich der Tochter. Die lächelte ihn an und hielt ihm die Wange hin. Als er ihr einen Kuss daraufhauchte, begegnete er Clays Blick.
»Während der Andacht würde ich gern neben Ihnen sitzen, Mrs Wilson«, sagte Riley. »Sofern Sie nichts dagegen haben?«
Clay sah auf die Uhr. Zwei Minuten vor acht.
Mrs Wilson schaute zu ihrer Tochter, die jetzt in ein leises Gespräch mit Stone vertieft war.
Der Kies knirschte unter den Reifen des vorfahrenden Leichenwagens. Die Sargträger, die mit dem zweiten Wagen kamen, stiegen aus und öffneten die Hecktüren, um den Sarg in die Kapelle zu tragen.
Der Bestatter, ein großer Mann, dem sich der Ernst seines Berufes in den Gesichtszügen verewigt hatte, näherte sich Clay.
»Danke, dass Sie der ungewöhnlichen Bitte entsprochen haben«, sagte sie. »Und dass Sie hinsichtlich der Arbeitszeit eine Ausnahme machen.«
Der Bestatter nickte. »Fünfundzwanzig Jahre bin ich in dieser Branche tätig. Nach meinem Ermessen ist das die …«, er suchte nach einem passenden Wort, »… heikelste Bestattung, die ich erlebt habe.«
Clay beobachtete Samantha, während sich die sechs Sargträger den Sarg auf die Schultern hoben. Sie sagte etwas, das nur Stone hören konnte.
»Das ist völlig verständlich, Sammy«, erwiderte er.
Samantha rückte schutzsuchend hinter Stone und spähte über seine Schulter zu der Leichenprozession.
Der Bestatter nahm seinen Platz vor dem schlichten Sarg ein, in dem David Wilsons verstümmelte Überreste lagen.
Als die Prozession auf die Kapelle zuging, fasste Mrs Wilson einmal still weinend an den Sarg. Riley ging neben ihr her.
»Wie ich sehe, glaubst du ihm noch immer«, stellte Samantha hinter ihrer Mutter fest. »Bis zum bitteren Ende hältst du an deiner Illusion fest, Mutter!«
Clays iPhone vibrierte in der Manteltasche.
»Tun Sie mir einen Gefallen«, flüsterte Stone an Samantha gewandt. »Ich werde für Sie da sein, aber halten Sie während der Andacht durch. Einverstanden?«
Samantha nickte.
Clays Handy schien bei jedem Summton stärker zu vibrieren, um ihre Aufmerksamkeit zu erzwingen. Sie schloss die Hand darum, als sie Samanthas Blick auffing. »Warum sind Sie doch noch hergekommen?«, fragte sie.
Die Antwort kam ohne Zögern. »Ich will den Sarg durch den Vorhang zum Ofen gleiten sehen. Tausend Grad Celsius. Ich brauche absolute Gewissheit, dass er weg ist.«
»Kommst du mit uns hinein, Eve?«, fragte Stone.
»In einer Minute«, antwortete sie, denn sie sah, dass Hendricks gerade eintraf.
Während der auf sie zukam, beobachtete sie Stone und Samantha von hinten. Die junge Frau hakte beide Hände in seinen rechten Ellbogen ein, bevor sie mit ihm die Kapelle betrat.
Clay zog das summende Handy aus der Tasche, sah, dass der Anruf von der Zentrale kam, und nahm ihn an, wobei sie Hendricks mit einer leichten Berührung am Arm aufhielt.
»Hier Clay. Was gibt’s?«
»Das ist gerade hereingekommen, DCI Clay. Ich spiele es Ihnen vor.«
Clay stellte auf Lautsprecher.
Man hörte im Hintergrund einen Fernseher laufen.
»Polizei. Von wo rufen Sie an?«, fragte eine Telefonistin.
Jemand weinte, entweder bei dem Anrufer oder in der an seinem Ende der Leitung laufenden Fernsehsendung. Das war nicht zu unterscheiden.
»Ich kann auf meinem Display sehen, dass Sie unter der Festnetznummer 4967370 anrufen.«
Eine Tür fiel zu, und die Geräusche aus dem Fernseher erstarben.
»Ich rufe von 699 Mather Avenue an.«
Eine höfliche androgyne Stimme ohne Akzent, urteilte Clay. Vermutlich irgendwo in den Dreißigern. Dem Sprecher war nicht anzuhören, ob er männlich oder weiblich war, aber es war definitiv nicht Vindicis Stimme.
»Was für ein Problem haben Sie?«
»Ein Mann wurde ermordet und seine Frau gefoltert. Sagen Sie Eve Clay, sie soll schnellstmöglich herkommen. 699 Mather Avenue.«
Damit war der aufgenommene Anruf zu Ende, und Clay eilte zu ihrem Wagen. Auf dem Weg rief sie Hendricks zu: »Bitte schicken Sie alle verfügbaren Kollegen hin. Sie sollen die Mather Avenue zwischen Allerton Road und Garston absperren, und auch die Seitenstraßen nicht vergessen. 699 Mather Avenue. Ruf Barney Cole an und frag ihn, wer die Bewohner sind; ein Mann und eine Frau angeblich.«
Sie stieg in ihren Wagen. »Und, Bill, wir treffen uns am Tatort. Der echte Vindici hat keine Frauen gefoltert. Unser Täter ist ein Nachahmer, oder?«
»Vielleicht hat er seinen Modus Operandi erneut geändert. Letztes Mal hat er keine Süßigkeiten hinterlassen, diesmal foltert er eine Frau. Wer weiß schon, wie sehr er sich im Lauf der Jahre verändert hat«, gab Hendricks zu bedenken.
»Seinen Modus Operandi hat er definitiv geändert. Früher war er allein, jetzt hat er anscheinend einen Komplizen.«
Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr Clay auf das Tor des Springwoood Krematoriums zu und wiederholte in Gedanken die unaufgeregten Worte des Anrufers.
Ermordet, gefoltert … sagen Sie Eve Clay … ermordet, gefoltert … sagen Sie Eve Clay … ermordet, gefoltert … sagen Sie Eve Clay …
Mit Herzklopfen beschleunigte sie auf der Springwood Avenue auf 130 km/h.
Ich bin Vindici. Finden Sie mich, und all das wird aufhören. Oder soll ich Sie finden?
»Du bist also wieder da, Vindici«, sagte Clay. »Aber wo? Und warum jetzt?«
4
20.03 Uhr
140 km/h war Clays Höchstgeschwindigkeit, als sie vom Krematorium zu der Adresse an der Mather Avenue raste, unweit der Merseyside Police Training Academy.
Als sie vor dem frei stehenden Haus an den Bürgersteig fuhr, sah sie zwei uniformierte Kollegen den Weg zur Haustür entlanggehen.
»Stopp!«, rief Clay und eilte auf das schmiedeeiserne Vorgartentor zu. »Der Mörder könnte noch im Haus sein!« Sie lief an ihnen vorbei, zückte ihren Dienstausweis und erkannte bei beiden stille Erleichterung. An der Haustür leuchtete sie mit der Taschenlampe die Kante ab und entdeckte keine Blutspuren. Sie rechnete trotzdem damit, dass im Haus eine grausame, wenn auch aufgeräumte Szene auf sie wartete, genau wie im Haus der Wilsons.
Clay drückte gegen die Tür, die jedoch geschlossen war. Hinter sich hörte sie Hendricks heraneilen. »Hast du den Rammbock dabei, Bill?« Er trat neben sie, und beim ersten Stoß des Rammbocks sprang die Tür auf.
Die Lampen im Flur brannten, und Clay spürte die Präsenz von Leben und Tod am selben Ort.
»Polizei!«, rief sie. »Melden Sie sich, wenn Sie mich hören können!«
Keine Antwort.
Sie horchte. Da weinte jemand, aber es klang nicht nach einer Frau, die extreme Schmerzen litt. Ein Kind, dachte Clay, und da lag etwas in dem Weinen, bei dem ihr schlecht wurde und das sie zugleich wütend machte.
Sie roch Weihrauch und sah Hendricks an. »Derselbe Geruch wie bei den Wilsons.«
»Derselbe Geruch, derselbe Täter«, sagte Hendricks. »Ich warte noch auf den Anruf von Cole, was er über die Bewohner herausgefunden hat.«
Im Flur stand ein kleiner Tisch mit einem Ablagefach, in dem zwei Branchenbücher lagen. Auf dem Tischchen ein Notizblock, ein Stift und eine von Staub eingerahmte freie Stelle, wo das Telefon gestanden hatte.
»Der Anrufer ist weg!« Clay trat auf die geschlossene Tür des vorderen Zimmers zu. »Und das Telefon, das er benutzt hat, muss er mitgenommen haben. Geh du nach oben, Bill, ich sehe mich hier unten um.«
Die Vorhänge des Zimmers an der Straße waren zugezogen, das Deckenlicht eingeschaltet, und alles schien an seinem Platz zu sein. Sie lauschte und konnte das Weinen aus dem Nebenzimmer und Hendricks’ Schritte in dem Raum über ihr hören.
Clay ging nach nebenan, und das Weinen, das sie dorthin zog, wurde lauter.
Sie blieb stehen und stellte sich die Szene aufgrund des gespeicherten Anrufs vor: Der Anrufer stand am Telefontisch, rief bei der Zentrale an, überquerte den Flur, um die Tür zu schließen und das Geräusch des Fernsehers …
Draußen wurden die Sirenen etlicher Einsatzfahrzeuge laut, die die breite Allee entlangkamen.
»Hier oben sind sämtliche Lampen eingeschaltet!«, rief Hendricks. »Die Türen zum Bad und zum Schlafzimmer stehen weit offen. Die zum hinteren Zimmer nicht. Die ist abgeschlossen!«
Clay hob den Arm und drückte mit den Knöcheln die Tür an der oberen Ecke auf.
Langsam schwang sie in den dunklen Raum. Die einzige Lichtquelle war der Fernseher an der Wand. Clay konnte nicht sehen, was auf dem Bildschirm passierte, aber von dort kam das klägliche Weinen.
Vor dem Fernseher saß eine nackte Frau gefesselt auf einem Stuhl.
Clay schaltete das Licht ein. »Bill! Bill! Ruf einen Krankenwagen! Sie ist noch am Leben!« Bei der plötzlichen Helligkeit fuhr die Frau erschrocken zusammen und gab unartikulierte Laute von sich, da sie mit einem Tuch geknebelt war.
Clay hörte Hendricks die Treppe heruntereilen und telefonieren. »Danke, Barney. Das hilft uns weiter!« Hinter ihr blieb er stehen. »Eve …«, sagte er leise. »Dies ist das Haus von Steven und Frances Jamieson. Barney hat sie in unserer Datenbank gefunden.« Sein Gesicht verriet bereits die ganze Geschichte.
»Und Steven Jamieson hat eine ähnliche Vorgeschichte wie David Wilson?«, fragte Clay leise.
»Ja.«
»Danke.« Sie holte tief Luft und trat in das Zimmer.
5
20.05 Uhr
Während Clay sich Frances Jamieson näherte, redete sie möglichst ruhig und hielt den Blick auf sie gerichtet. An der linken Schulter war Blut hinuntergelaufen, die sichtbare Seite ihres Gesichts war blutüberströmt. Der Knebel hatte einiges Blut aufgesaugt.
»Mrs Jamieson? Frances Jamieson? Keine Angst, Mrs Jamieson, bitte erschrecken Sie nicht.« Langsam näherte sie sich der Frau von schräg vorn. »Mein Name ist Eve Clay, ich bin Polizistin.«
Das mitleiderregende Weinen aus dem Fernseher ging ihr unter die Haut, aber sie widerstand dem Drang, sich danach umzudrehen, und konzentrierte sich auf die gefesselte Frau. Sie zeigte ihren Dienstausweis und betrachtete sie kurz von oben bis unten. Die Arme waren hinter dem Rücken gefesselt, die Füße mit dünner blauer Kordel an die Stuhlbeine gebunden. Clay schätzte die Frau auf Mitte fünfzig.
Es drehte ihr den Magen um, als sie die Augen sah, die weit aufgerissen wild hin und her blickten. Es sah aus, als hätte die Frau Blut geweint, und jetzt bemerkte Clay entsetzt, dass die Oberlider weggeschnitten waren.
Sie war froh, als sie Hendricks hereinkommen hörte.
»Die Sanitäter sind da«, sagte er.
»Hol sie bitte sofort. Sie sollen sich beeilen!«
Atemwege prüfen, dachte Clay und löste den Knoten des Knebels am Hinterkopf. »Öffnen Sie den Mund, Mrs Jamieson. Ich muss nachsehen …« Die Frau drehte den Kopf weg. Sie schien etwas im Mund zu haben, kniff aber die Lippen zusammen und atmete angestrengt durch die Nase.
Clay sah sich suchend nach dem Tatmesser um. Ein Teppichmesser, dachte sie. Aber wenn er sogar das von ihm benutzte Telefon mitgenommen hatte, dann erst recht das Werkzeug, mit dem er seine Opfer gequält hatte.
Clay schaute der Frau in die Augen und sah wilde Fassungslosigkeit. Sie fühlte sich erinnert an zwei Rettungsflöße auf stürmischer See. »Ihr Mann? Wissen Sie, wo er ist?«
Die Frau bewegte den Kopf nicht, schien sie nicht zu hören.
Clay bückte sich hinter ihr, um den Knoten an den Handfesseln zu untersuchen. Ein ordentlicher, fachmännischer Knoten. Das Weinen aus dem Fernseher war kaum auszuhalten, aber sie weigerte sich, hinzusehen, weil jede Sekunde zählte, wenn sie die traumatisierte Frau noch an Ort und Stelle zum Reden bringen wollte.
Clay machte mit dem Handy einige Fotos von der blutigen Schulter. Wie bei David Wilson hatte der Mörder den Namen Vindici in eleganter Schreibschrift in die Haut geritzt. Aber im Gegensatz zu Wilson war dieses Opfer dabei am Leben gewesen.
Clay blickte auf, als eine tough wirkende Brünette im grünen Sanitäteranzug mit Hendricks hereinkam.
Sie blieb abrupt stehen und schlug sich die Hand vor die Augen. »Herr im Himmel!«, sagte sie erschüttert. »Meine Güte!«
Zart besaitet?, wunderte sich Clay. Nach allem, was Sie schon gesehen haben müssen?
Beim Klang der neuen Frauenstimme erschrak Frances Jamieson heftig, und Clay sprach beruhigend auf sie ein. »Alles in Ordnung. Sie ist Sanitäterin und wird sich gleich um Sie kümmern. Und es ist noch ein Polizist bei uns.«
Hendricks Züge verdunkelten sich, als er die Fernbedienung vom Boden aufhob und den Fernseher ausschaltete. Nachdem das Weinen verstummt war, hörte man die misshandelte Frau immer tiefer einatmen.
Hendricks ging vor ihr in die Hocke. »Können Sie mich hören?«, fragte er sanft.
Sie nickte.
»Es ist vorbei.« Er winkte die Sanitäterin heran.
Die blickte Clay an und deutete auf die Hände der Frau. »Darf ich …?«
»Ja, bitte.« Clay holte zwei Asservatenbeutel aus der Tasche und ließ den Knebel in einen hineinfallen. »Einen Moment noch bitte«, sagte sie dann.
Den Blick auf die ordentlichen Schleifen des Knotens gerichtet, flüsterte sie zu Hendricks. »Vindici muss sich enorm verändert haben, wenn er so etwas jetzt einer Frau antut. Selbst wenn sie zu ihrem pädophilen Mann hält.«
»Aber wir können seine Beteiligung nicht ausschließen«, erwiderte Hendricks. »Der Anruf bei dir gleich nach dem Mord an Wilson, das war definitiv Truman. Wir können auch nicht ausschließen, dass er seine Vorgehensweise geändert hat. Oder dass er jetzt einen Komplizen hat.«
»Bei Wilsons Leiche lagen keine Süßigkeiten, und hier werden wir auch keine finden. Vindici war pedantisch – und dies war das Detail, das der Öffentlichkeit vorenthalten wurde.«
Clay wandte sich der Sanitäterin zu. »Jetzt binden Sie sie bitte los.«
Hendricks öffnete einen Asservatenbeutel, und als die Sanitäterin die Schnur hineinfallen ließ, sagte er: »He, was haben wir denn da?«
An der Schnur hing ein langes blondes Haar. Clay blickte auf Mrs Jamiesons kurze schwarze Haare und die braunen der Sanitäterin.
Als sie jemanden kommen hörte, drehte sie sich um. Ein kleiner drahtiger Sanitäter schob einen Rollstuhl ins Zimmer. Mit einem Nicken forderte Clay ihn auf, sich zu beeilen, und ging selbst vor Frances in die Hocke. Aus deren rechtem Mundwinkel lief dicker Schleim.
»Was haben Sie im Mund, Mrs Jamieson?«, fragte sie.
Die Angesprochene hob das Gesicht zur Decke. »Sehen Sie mich an«, sagte Clay. »Bill?« Mehr brauchte sie nicht zu sagen. Er drückte ihr einen Asservatenbeutel in die Hand. »Schauen Sie mich an, Frances.« Langsam senkte Mrs Jamieson den Kopf. »Frances, sobald Sie mich ansehen, werde ich Ihnen einen Asservatenbeutel an den Mund halten. Ich möchte, dass Sie es hineinspucken.«
Clay hielt den Beutel hin. Mrs Jamieson öffnete den Mund, etwas Weiches, Nasses fiel hinein, und einen Moment später noch einmal das Gleiche.
Clay richtete sich auf, und beim Blick in den Beutel drehte sich ihr der Magen um.
»Was ist es?«, fragte Hendricks.
Clay sprach die beiden Sanitäter an. »Egal, was Sie glauben, gesehen zu haben, Sie sprechen darüber mit niemandem. Das ist ein Detail, das wir den Medien verschweigen werden, um Leute, die sich bei uns als Täter ausgeben, zu prüfen.«
Während die Sanitäterin Mrs Jamiesons Füße losband, schob ihr Kollege den Rollstuhl in Position.
»Ordentliche Knoten an den Füßen?«, fragte Clay.
»Genau die gleichen wie an den Händen«, antwortete die Sanitäterin.
»Dann hat sich unser unbekannter Anrufer Zeit genommen.« Clay wandte sich an Hendricks. »Mr Jamieson wird oben hinter der verschlossenen Tür liegen. Bitte, öffne sie mir.«
6
20.09 Uhr
Als Hendricks das Zimmer verließ, legten die Sanitäter Mrs Jamieson eine Decke um und hoben sie auf die Beine.
»Wir werden Sie in den Rollstuhl setzen und in die nächste Notaufnahme bringen.«
Mrs Jamieson rollte die Augen und kniff die Lippen zusammen, während sie hinausgeschoben wurde.
Clay fing den Blick der Sanitäterin auf, schaute kurz auf deren Namensschild und sagte leise: »Einen Moment bitte, Cara. Ich werde eine Beamtin der Spurensicherung ins Royal schicken. Wir müssen untersuchen, ob der Täter an ihr Spuren hinterlassen hat.«
Sie rief Riley an, die nach zweimaligem Klingeln abnahm. Im Hintergrund hörte sie eine Frau weinen und nahm an, dass es Sandra Wilson war. »Gina, du musst zum Royal fahren. Geh in die Notaufnahme. Dort findest du eine Mrs Frances Jamieson vor.«
»Ist sie eine Pädophile?«
»Ihr Mann war einer. Sie wurde gefoltert. Sie muss den Mörder gesehen haben. Er hat mich angerufen, als du gerade in die Kapelle gingst.«
»Ich habe mich schon gefragt, wo du hin bist.«
»Der Mörder hat sich in der Zentrale gemeldet und uns die Adresse des Tatorts genannt.«
»Mann oder Frau?«
»Das war nicht zu unterscheiden. Die Stimme war verstellt. Der Anrufer klang aber nicht wie Vindici. Ich muss jetzt auflegen.«
Über ihrem Kopf knarrte eine lockere Bodendiele unter Hendricks’ Gewicht. Er blieb stehen.
»Cara?« Clay blickte sich um. Sie war mit der Sanitäterin allein.
»Ja?«
»Als Sie ins Zimmer kamen, Cara, haben Sie den Kopf vom Fernseher weggedreht und sich mit der Hand die Augen abgeschirmt. Was musste Mrs Jamieson sich die ganze Zeit ansehen?«
»Einen Mann, der ein Mädchen zum Sex zwang«, flüsterte die Sanitäterin. »Es war vielleicht sechs Jahre alt.«
»Danke«, sagte Clay. »Ich bedaure, dass Sie dem ausgesetzt waren.«
Die Sanitäterin schauderte. »Entsetzlich, einfach entsetzlich.«
Nachdem sie hinausgegangen war, traf der leitende Beamte der Spurensicherung ein, Detective Sergeant Terry Mason. Clay reichte ihm drei Asservatenbeutel. »Die Schnüre, mit denen Frances Jamieson gefesselt war, und das Tuch, mit dem sie geknebelt war.«
»Du lieber Himmel«, sagte er, als er auf den dritten Beutel blickte.
»Das sind vermutlich Wilsons Testikel. Sie steckten in Frances Jamiesons Mund. Terry, hast du eine Kollegin verfügbar?«
»Sergeant Cindy O’Brian.«
»Schick sie in die Notaufnahme des Royal. Sie muss eine Frances Jamieson untersuchen. Sag ihr, sie soll sich beeilen. Mrs Jamieson ist schon dorthin unterwegs. Danke.«
Aus dem oberen Stock hörte Clay einen lauten Knall, und kurz darauf roch man würzigen Rauch.
Während sie die Treppe hinauflief, roch es intensiver, und hinter der Tür, die Hendricks kurzerhand mit einem Tritt geöffnet hatte, drang der unverwechselbare Geruch von Blut hervor.
7
20.13 Uhr
Am Ende der Treppe atmete Clay die parfümierte Luft ein.
Derselbe Weihrauchgeruch wie bei Wilsons Leiche.
»Eve, ich bin hier!«, rief Hendricks von einem Schlafzimmer am Ende des Ganges.
Als sie seiner Stimme nachging, wurde der Geruch immer intensiver.
»Es erinnert sehr an das vorige Mal«, sagte er.
In der Tür angelangt, wurde ihr Blick vom Nachttisch angezogen, auf dem eine fabrikgefertigte, dreißig Zentimeter hohe Keramikfigur eines geschlechtsneutralen Kindes stand. Das nichtssagende Gesicht bekam nur durch die geschlossenen Augen und die langen aufgemalten Wimpern einen ernsten Ausdruck.
»Die gleiche Figur«, sagte Clay. »Fabricado en Puebla« war in die Standfläche geprägt. »Aus derselben Keramikfabrik in Mexiko.«
Die linke Hand zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger nach unten, die rechte Hand war zur Faust geballt zum Gesicht gehoben, die Knöchel dem Betrachter zugewandt, so als klopfte das Kind an eine Tür.
Angesichts der Position der Figur und der von Jamiesons Gesicht sagte Clay: »Dies war vermutlich das Letzte, das er vor seinem Tod gesehen hat.«
Um den Hals der Figur war ein weißes Schildchen gebunden, das auf den Rücken herabhing. Clay drehte das Papier um. »Sally«, las sie vor. Offenbar hieß Jamiesons Opfer so. Auf dem Zettel an der Figur bei Wilson hatte »Samantha« gestanden. Eine Visitenkarte ganz im Stil Vindicis.
Clay ging zum Fußende des Bettes und wandte ihre Aufmerksamkeit dem Toten zu. Er lag auf dem Bauch mit dem Gesicht zur Wand, Arme und Beine ein wenig zur Seite ausgestreckt und die Hände und Füße mit Seidenkrawatten an die Bettpfosten gebunden. Auf dem Rücken hatte er sieben kleine Aschehügel und darunter Brandwunden von den Räucherkegeln, die von der glühenden Spitze bis zur Basis langsam abgebrannt waren, genau wie bei Wilson.
Das Blut auf der Matratze war zwischen seinen Beinen herausgetropft.
Clay sah, wie Hendricks sich tief bückte, um das Gesicht des Toten genauer ansehen zu können, und die Brauen zusammenzog. Sie folgte seinem Blick.
»Er hat Blutergüsse an der Kehle und im Nacken«, stellte er fest. »Er wurde stranguliert, aber das wird nicht die Todesursache sein, wenn der Täter wie bei Wilson vorgegangen ist.«
»Das wird sich herausstellen, wenn wir ihn zu Dr. Lamb in den Obduktionssaal gebracht haben.«
Clay erkannte die Schritte Terry Masons, der die Treppe heraufkam, bevor er nach ihr rief. »Eve?«
»Wir sind hier, Terry!«, rief sie.
Als er in der Tür innehielt, hörte sie das schnelle Klicken seiner Kamera und betrachtete den Rücken des Toten genauer. Der große Blutfleck in Höhe des Steißbeins über der linken Gesäßbacke war teilweise getrocknet, und an der linken Schulter fand sich der blutige Schriftzug »Vindici«.
»Sieben Brandwunden wie bei Wilson. Warum?«, fragte Mason und trat näher. Clay erinnerte sich an etwas, das Vindici beim Prozess gesagt hatte. Die Staatsanwältin hatte ihn gefragt, warum er immer sieben Räucherhütchen auf dem Rücken seines Opfers abbrenne, und seine Antwort war von einer Zeitung als Schlagzeile genutzt worden: »Eines will ich von vornherein klarstellen: Ich erkläre nichts. Ich bin eine moderne Mary Poppins.«
Die Staatsanwältin nahm ihn damals zur Bedeutung der Zahl stundenlang ins Kreuzverhör, erfuhr dabei aber tatsächlich nichts.
Sieben Räucherkegel. Clay deutete auf die Keramikfigur. »Und wer ist Sally? Ein Name unter so vielen, aber er hat etwas zu sagen.«
Der Gestank von verbranntem Fleisch drang durch den vorherrschenden Blut- und Weihrauchgeruch.
Die Beine des Toten wiesen feine rote Striemen auf. Ihrer Ansicht nach war er mit einem sehr dünnen, scharfen Gegenstand geschlagen worden.
»Das ist neu, Terry.« Mason unterbrach das Fotografieren und trat neben sie. Sie deutete auf die Beine des Toten. »Wilson wurde nicht geschlagen.«
»Moment mal!« Hendricks klang, als wäre ihm gerade etwas eingefallen. »Mir fällt da was ein. Vindici, nein, Justin Truman – ich schlage vor, wir lassen die Boulevardzeitungssprache und nennen ihn bei seinem richtigen Namen. Truman hat jedes Opfer geschlagen, das seine Stellung oder Autorität in der Gesellschaft ausgenutzt hatte, um sich vor Strafverfolgung zu schützen oder um sich Kindern nähern zu können. Nach dem Motto: Du wirst sterben, aber ich werde dich erniedrigen, bevor ich dich kaltmache.«
»Du hast ein gutes Gedächtnis, Bill.«
»Ich habe es in meiner Doktorarbeit analysiert.«
Clay blickte auf die exponierte Gesichtshälfte des Toten und den von einem Schlag stammenden Bluterguss. Die Haut war violett und blau verfärbt, die Wange geschwollen, in der Ohrmuschel klebte getrocknetes Blut. Sie stellte sich das Ausmaß der Wut vor, das dem Mörder die Kraft verlieh, um Hiebe wie Mike Tyson zu versetzen.
»Justin Truman hat, soweit ich weiß, keine Verbindung zur Merseyside. Die Pädophilen, die er tötete, lebten alle im Großraum London. Bis auf den einen in Brighton.«
»Oh, er hat durchaus eine Verbindung zur Merseyside«, widersprach Hendricks.
»Welche?«
»Zu dir, Eve. Er hat dich persönlich angerufen. Du hattest eine herzliche, kurze und bedeutsame Unterhaltung mit ihm. Und wir wissen, dass er es tatsächlich war.« Sein Telefon klingelte. »Es ist Barney«, sagte er und verließ das Zimmer.
Während Mason den Toten weiter fotografierte, betrachtete Clay die sieben Brandwunden und Aschehügel auf dem Rücken.
Sieben, dachte sie. Was steckt hinter dieser Zahl? Eine befremdliche, sonderbare Übelkeit überkam sie, als der Geruch verbrannten Menschenfleischs ihr in die Nase stieg und sich als etwas Heißes, Wabbeliges im Magen niederzulassen schien.
»Hey, Eve.« Hendricks drehte sich um, offenbar begierig, mit ihr zu reden.
»Was hat Barney noch herausgefunden?«
Hendricks kam ans Fußende des Bettes, blickte kurz auf Jamieson und sah dann Clay an. »Mach dich auf etwas gefasst.«
8
20.18 Uhr
Sie lag in der Wanne im heißen Wasser, nur ihr Kopf schaute heraus. Bis zum Kinn war der Rest ihres Körpers unter einer dicken Schaumschicht verborgen, erzeugt mit dem lavendelduftenden Schaumbad aus der Viertelliterflasche von Avon.
Das Licht war ausgeschaltet, aber das Bad war erleuchtet von bernsteingelbem Schein, den die Straßenlampen vor dem Milchglasfenster hineinwarfen. Da sie allein im Haus war, war es still. Nur der Wind war zu hören, wie er an den Ästen der Bäume rüttelte und das tote Laub verwehte.
Sie schöpfte eine Handvoll Schaum und rieb ihn sich in die kurzen, nach Rauch riechenden Haare und die Kopfhaut und fühlte, wie ein immenser innerer Friede sie überkam.
Den Blick auf den Schaum gerichtet, massierte sie sich die Füße, die Zehen, die Waden, die Oberschenkel und das Gesäß und stellte sich dabei eine Meerjungfrau vor, die sich in einem warmen, grünlichen Meer treiben ließ. Sie sah, wie ihr schuppiger Schwanz in der Sonne glitzerte, die von einem wolkenlosen Himmel schien, und dass ihre Haare im Wasser schimmerten. Die Mähne reichte ihr bis zur Hüfte, wo der menschliche Körper in den Fischleib überging.
Die Meerjungfrau drehte sich im Wasser. Ihre Brüste waren klein und fest, die Brustwarzen korallenrot, die Taille schmal und die Arme lang und schlank.
Sie hielt das Bild fest, erregt von den sinnlichen Details.
In dem Halbdunkel konnte sie es nicht sehen, aber eine rötliche Verfärbung war von ihrer Haut auf den Schaum übergegangen und überzog die Seifenblasen wie ein Algenteppich.
»Ich wünschte, ich wäre eine Meerjungfrau«, sagte sie zu den Schatten, die ihren Wunsch in sich aufnahmen und mit Schweigen besiegelten. »Halb Frau, halb Fisch. Genau wie ich«, gestand sie der Dunkelheit. »Weder das eine noch das andere und doch beides, Fisch und Frau.«
Sie öffnete die Augen, um in das gelbbraune Halbdunkel zu starren. Nicht Dunkelheit, nicht Helligkeit. Weder das eine noch das andere, genau wie ich.
Sie tauchte unter den Schaum und stellte sich vor, sie hätte sich durch die Macht ihres Wunschdenkens in eine Meerjungfrau verwandelt. Tief unter der warmen Strömung schwebend blickte sie durch die grünen Wellen auf ihre Silhouette. Sie sah ihren dunklen Schwanz hin und her gleiten, ihre Arme anmutig tanzen und die Haare unter der zarten Liebkosung ihres Geliebten, des Ozeans, ausfächern.
Weder das eine noch das andere, dachte sie, genau wie ich.
9
20.18 Uhr
»Barney sagt, Steven Jamieson hat fünf Jahre einer neunjährigen Haftstrafe in Strangeways abgesessen. Er hat ein achtjähriges Mädchen missbraucht. Im Gefängnis wandte er sich Jesus zu, äußerte immer, was von ihm erwartet wurde, und nahm an allen Kursen teil. Das war nur die Spitze des Eisbergs, aber die South Yorkshire Police konnte ihm bis auf das Verbrechen an dem einen Mädchen nichts nachweisen. Jamieson hatte reichlich Geld und Beziehungen. Er hat die Leute entweder bestochen oder eingeschüchtert, damit sie schwiegen. Nach seiner Entlassung zog er nicht nach Sheffield zurück, sondern ging nach Merseyside, wo er niemanden kannte, sodass er hier unerkannt leben konnte. Er ist in Belle Vale als Sexualstraftäter registriert, aber seitdem bei polizeilichen Ermittlungen nicht mehr aufgefallen.«
Clay ballte die Fäuste, löste sie bewusst und steckte sie in die Jackentaschen. »Noch etwas, Bill?«
»Barney hat mit DCI Lesley Reid gesprochen, die seinerzeit die Ermittlung gegen Jamieson führte und ihn hinter Gitter gebracht hat.« Hendricks drehte sich zu Mason um. »Terry, du wirst entfernen müssen, was der Tote im Mund hat.«
»Was ist es?«, fragte Mason.
»Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht angefasst. Aber er hat etwas im Mund.«
»Augenblick, warte, noch nicht«, stoppte Clay ihn. Sie dachte an den Rat der Gerichtsmedizinerin, an die sie Wilsons Leiche übergeben hatte, für den Fall, dass es einen weiteren Toten gäbe. »Dr. Lamb möchte, dass die Leichen genauso abgeliefert werden, wie wir sie vorfinden. Wir werden es ihren Assistenten überlassen, Jamieson in den Leichensack zu packen und hinzubringen.«
»Noch etwas?«, frage Mason.
»Wenn du alle Beweismittel eingesammelt hast, bestell bitte einen Möbelwagen. Das Haus soll ausgeräumt werden, damit wir unter die Dielen gucken können.«
Sie ging hinaus und die Treppe hinunter zur Haustür. Sie wollte ihren Mann anrufen und um etwas bitten, war jedoch nicht bereit, das innerhalb dieses Hauses zu tun.
10
20.29 Uhr
Riley stand auf der Laderampe der Notaufnahme und hielt sich schaudernd den Mantelkragen zu, denn vom Mersey wehte ein kalter Wind herüber. In den fünf Minuten, die sie schon wartete, war nur ein Krankenwagen angekommen, und eine Nachfrage an der Anmeldung bestätigte ihr, dass Frances Jamieson noch unterwegs war.
Da kam ein Ambulanzwagen angeschossen, bog leicht abgebremst um die Ecke und hielt auf die Klinik zu. Die Sirene war abgeschaltet, aber das Blaulicht blinkte. Er stoppte mit dem Heck unmittelbar neben dem Eingang der Notaufnahme.
Als der Fahrer heraussprang und zum Heck rannte, hörte Riley Leute aus dem Gebäude kommen.
Der Fahrer öffnete die Hecktüren, und zwei Ärzte und drei Krankenschwestern liefen an ihr vorbei.
Riley näherte sich und musterte die brünette Sanitäterin, die hinten bei Frances Jamieson gesessen hatte, als sie auf die Uhr sah.
»Sie hat während der Fahrt das Bewusstsein verloren«, erklärte die Sanitäterin. »An der Kreuzung Mather und Booker Avenue.«
»Atmet sie noch?«, fragte ein junger Arzt.
»Ja.«
»Entschuldigen Sie«, sagte Riley. Ärzte, Schwestern und Sanitäter drehten sich nach ihr um, und der Ausdruck ihrer Gesichter ließ vermuten, dass sie sie für eine Schaulustige hielten.
Sie zeigte einem Arzt ihren Dienstausweis und fragte die Sanitäterin: »Ist ihr Zustand kritisch?«
»Sie wird nicht sterben, falls Sie das meinen!«
»Wenn sie zu sich kommt und Sie alle mit ihr fertig sind, muss ich mit ihr sprechen.« Riley wandte sich noch einmal an die Sanitäterin. »In der Zwischenzeit würde ich mich gern mit Ihnen unterhalten, wenn das möglich ist.«
»Sicher.« Die Sanitäterin nickte.
»Ich werde einen eigenen Raum brauchen, um mit Ihrer Kollegin zu sprechen«, sagte Riley in die Runde und blickte jeden Einzelnen an. »Könnten Sie das so schnell wie möglich einrichten?«
»Kommen Sie mit«, sagte die älteste der drei Krankenschwestern.
Die beiden Sanitäter manövrierten die Rolltrage mit Frances Jamieson aus dem Wagen, und Riley sagte: »Augenblick noch.«
Sie schaute in Jamiesons Gesicht und auf die kurzen dunklen Haare. Die drehte ihre lidlosen Augen zum Himmel und sah aus, als bestaunte sie die Sterne.
»Fertig?«, fragte der Sanitäter, der hinterm Steuer gesessen hatte.
»Danke«, antwortete Riley.
Eine heftige Windbö trug von irgendwoher Gesang und Gelächter heran.
»Kommen Sie mit mir«, sagte die Krankenschwester. »Ich bringe Sie zum Familienzimmer.«
11
20.35 Uhr
Im Familienzimmer des Royal Liverpool University Hospital saß Riley der braunhaarigen Sanitäterin gegenüber, die während der Fahrt bei Frances Jamieson gewesen war, und schaltete ihr iPhone auf Aufnahme.
»Haben Sie mit ihr gesprochen …«, Riley schaute auf das Namensschild, »… Cara?«
»Ich habe sie gefragt, ob sie ein Schmerzmittel möchte. Ich hatte auch ein Spray vorbereitet, um ihre Augen feucht zu halten, und erklärte ihr, dass man die Lider erneuern kann, indem man Haut vom Gaumen verpflanzt. Ich wollte sie damit ein wenig beruhigen.«
»Hat sie darauf etwas gesagt?«, fragte Riley.
Die Sanitäterin schüttelte den Kopf. »Ich machte das Spray bereit und rief Kevin zu, er solle losfahren. Zu dem Zeitpunkt lag sie auf der Rolltrage und hatte den Kopf weggedreht. Ich habe zwei und zwei zusammengezählt und begriff, dass sie entweder selbst pädophil ist oder mit einem Pädophilen verheiratet war und die Scheußlichkeiten toleriert hat. Als wir rechts abbogen in die Straße zur Innenstadt, habe ich sie gefragt, wer das getan hat. Sie gab einen Laut von sich wie ein Tier in der Falle und sagte nur: ›Es.‹ Aber voller Grauen.«
»Ihre Antwort war wirklich ›Es‹?«
»Ja, ganz eindeutig. Es.«
Die Sanitäterin atmete tief durch.
»Gut, lassen Sie sich einen Augenblick Zeit. Was passierte dann?«
»Nichts weiter.«
»Das ist alles? Sind Sie sicher?«
»Das ist alles.«
Riley drückte auf Stopp. »Danke, Cara. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, hier haben Sie meine Karte. Ich gehöre zum Revier an der Trinity Road. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie alles für sich behalten, was Sie heute Abend gesehen haben. Erzählen Sie es nicht einmal Ihren engsten Vertrauten.«
»Absolut nicht, Ehrenwort. Ich möchte niemanden mit solchen Dingen infizieren.« Die Sanitäterin schauderte. »Was sie in dem Fernseher ansehen musste … furchtbar …« Sie schloss die Augen, um die Erinnerung auszublenden.
Als sie sie wieder öffnete, fragte sie: »Steckt Justin Truman dahinter? Er soll auch an dem Mord an dem Pädo in Aigburth vorige Woche beteiligt gewesen sein, heißt es.«
»Das ist eine laufende Ermittlung«, erklärte Riley. »Ich darf dazu weder Details preisgeben noch öffentlich Vermutungen zur Person des Täters anstellen.«
»Oh, okay …«