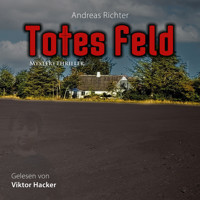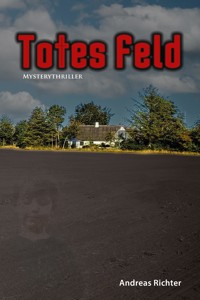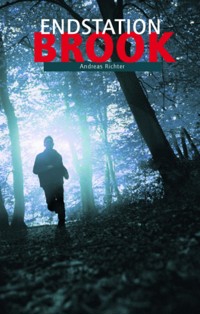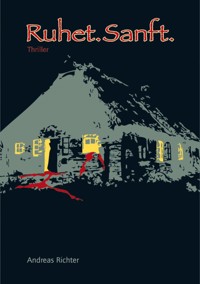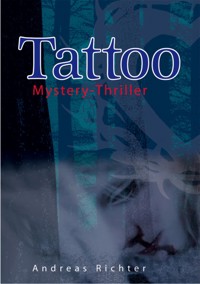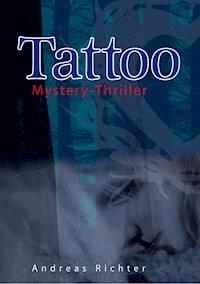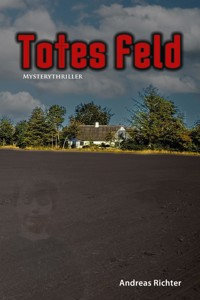
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mysterythriller aus Hamburg:
Oliver Bremser war als Marketing-Manager eine große Nummer, bevor der Alkohol seine Karriere und Ehe zerstörte. Am Stadtrand von Hamburg will er als Künstler und Maler ein neues Leben beginnen.
In der Nähe seine Ateliers entdeckt Oliver ein Feld, auf dem seit vielen Jahren nichts wächst. Er fragt sich, weshlb. Das tote Feld lässt Oliver nicht mehr los.
Bald darauf bemalt sich eine von Olivers Leinwänden nach und nach wie von selbst. Wie ist das möglich und was steckt dahinter?
Auf der Suche nach Antworten muss Oliver herausfinden, was es mit dem toten Feld auf sich hat - und welches Geheimnis er selbst tief in sich trägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Totes Feld
Auf einem Feldstück am Hamburger Stadtrand wächst seit hunderten Jahren nichts - das Feld ist tot. Und während ein kleiner Junge durch die Wälder irrt, bemalt sich eine Leinwand von Künstler Oliver wie von selbst. Welches Geheimnis verbindet das Feld, der Junge und Oliver miteinander?BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenImpressum
Totes Feld
Andreas Richter
Copyright © 2023 Andreas Richter.
Alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.
Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.
Umschlaggestaltung: Werbekontor Herrmann, Bargteheide.
Widmung
Totes Feld
Für Alexandra
Alle Personen, Orte und Begebenheiten dieser Geschichte könnten frei erfunden sein – doch wer weiß das schon mit Sicherheit.
Junge
Die Frau drückte dem Jungen einen Kuss auf die Stirn und fragte sich, wo bloß die Zeit geblieben war. Es schien erst gestern gewesen zu sein, dass er ihr nach der Geburt auf die Brust gelegt worden war und sie aus großen Augen fragend angeschaut hatte, doch tatsächlich war es bereits acht Jahre her. Sie sagte sich, dass sie ihm keine gute Mutter gewesen war. Zu selten hatte sie ihn in die Arme geschlossen, ihn zu selten gefragt, was ihn bedrückte, wenn er traurig geschaut hatte. Sie hätte vieles anders, besser machen müssen. Doch nun war es zu spät, sie konnte das Verpasste nicht nachholen und die begangenen Fehler nicht korrigieren. Nicht in diesem Leben. Alles, was ihr noch blieb, war zu versuchen, dass er lebend davonkam. Wenigstens er sollte nicht ihretwegen sterben. Wegen ihrer Schuld und Dummheit. Ihre Blindheit hatte alles zerstört.
Sie hob sein Kinn an und sah ihm tief in die Augen. Sie wusste, dass sie überzeugend wirken musste, dass es darauf ankam, ihm Mut zu machen, anstatt seine Angst weiter zu verstärken. Hier, inmitten des Durcheinanders von Verzweiflung, Zerstörung und Tod.
»Mein guter Junge«, sagte sie und lächelte angestrengt. »Du weißt doch noch, wo der Baum mit dem Versteck steht?«
»Die Buche«, sagte der Junge schluchzend. Mit Bäumen kannte er sich aus.
Sie nickte und wischte seine Tränen fort. »Nicht weinen, du bist doch schon groß. Du bist ein großer Junge, und jetzt wirst du noch größer. Dazu musst du bloß sein wie die Riesen in den Geschichten, die du vom Vater so gerne hörst.« Gehört hast, fügte sie in Gedanken an.
Der Junge sah zu Boden. »Es gibt keine Riesen«, sagte er trotzig.
»Selbstverständlich gibt es sie«, sagte sie mit gespielter Empörung. »Gerade erst habe ich einen mit eigenen Augen gesehen.«
»Wann?«
»Gestern.«
»Wirklich?«
»Ich schwöre es«, sagte sie und dachte, dass es jetzt nicht mehr darauf ankam, dass sie einmal mehr log und dafür nicht um Vergebung bitten würde. Es änderte nichts.
»Wie hat der Riese ausgesehen?«, fragte der Junge.
»Groß war er, und stark.«
»Sein Gesicht – wie schaute sein Gesicht aus?«
»Freundlich. Es war ein großer und starker Riese, ein freundlicher. So, und nun sag: Was sind Riesen noch, außer groß und stark?«
»Mutig«, sagte der Junge mit dünner Stimme.
»Richtig, und was noch?«
»Schnell.« Jetzt mit fester Stimme.
»Richtig, und was können Riesen? Sag, mein Junge, was können sie?«
»Alles«, rief er.
»Richtig«, sagte sie, klatschte in die Hände und hoffte, dass ihr Strahlen echt wirkte. »Sie können alles, die Riesen. Und weil du jetzt zum Riesen wirst, kannst auch du alles.«
Sie packte ihn an den Schultern, um seine Entschlossenheit zu stärken. »Lauf zu dem Versteck. Lauf durch das Getreide und lauf, so schnell du kannst. Bleib nicht stehen, egal wie schwer deine Beine sind. Schau dich nicht um, selbst dann nicht, wenn du überzeugt bist, du müsstest es tun. Wenn du die Buche erreichst, verkriechst du dich sofort im Versteck. Dort bleibst du heute und die zwei nächsten Tage und verhältst dich ruhig. Du sprichst nicht mit dir selbst, um dich zu beruhigen, und du singst nicht vor dich hin, um die Angst zu vertreiben. Heute und die nächsten zwei Tage lang gibst du keinen Laut von dir, sondern bist still wie ein Mensch im Grab. Kein Wort, egal was passiert und wie groß deine Furcht auch sein wird. Du verlässt das Versteck erst zwei Tage nach heute, hast du mich verstanden?«
»Ja, Mutter.« Der Junge zitterte am ganzen Körper.
»Du bist ein guter Junge«, sagte sie und küsste ihn auf sein Haar. In Gedanken flehte sie den Himmel an, den Jungen nicht für ihre Sünden zu bestrafen, sondern ihn sicher zum Versteck zu führen und ihm ein langes Leben zu geben.
»Mutter?« Die Augen des Jungen flehten.
Die Zeit war knapp, doch sie begriff seine Angst. Er durchlitt die Furcht seines Lebens, eine Angst, die jeder Mensch verspüren würde. Eine letzte Frage gestand sie ihm noch zu.
»Was ist?«
»Kommst du mich holen, morgen in zwei Tagen?«
Alles in ihr krampfte. Am liebsten hätte sie aufgeschrien vor Liebe und Schmerz, doch sie musste sich zusammenreißen.
»Aber selbstverständlich. Vielleicht aber sind die bösen Männer vor mir dort, doch dann bleibst du stumm und bewegungslos im Versteck. Falls ich dich nicht holen komme, machst du dich allein auf den Weg. Doch du kehrst nicht hierher zurück, auf keinen Fall kommst du zurück. Hast du verstanden? Du gehst in die andere Richtung, weiter fort von hier. Wo du auch hingehst, ich bin bei dir, auch wenn du mich nicht siehst. Hab keine Angst, ich lass‘ dich nicht allein. So, und nun lauf!« Die letzten Worte gefroren ihr fast im Hals.
Der Junge zwängte sich ins Freie. Kaum war er draußen, füllte er seine Lungen mit frischer Luft und blickte zum Getreidefeld. Die Maisstängel wogten und raschelten im sanften Wind. Das Feld war nicht weit entfernt, doch es kam dem Jungen vor, als läge es am anderen Ende der Welt. Wie sollte er es bis dahin schaffen? Bis er das Feld erreichen würde, hätte er keinen Schutz und wäre aus jeder Himmelsrichtung zu sehen. Die bösen Männer würden ihn erwischen.
Plötzlich hörte der Junge einen abgehackten Schrei. Der Vater. Es klang auf eine fremde Weise furchtbar. Die Blase des Jungen entleerte sich unkontrolliert. Was machten die bösen Männer mit dem Vater? Die Angst schien den Jungen zu zerreißen. Ihm war klar, dass er sofort loslaufen musste, doch er war wie gelähmt. Regungslos stand er da und die schrecklichen Geräusche um ihn herum füllten seine Ohren und brachten seinen Kopf zum Platzen.
Mit einem Mal schien es, als bekäme er einen Stoß in den Rücken. Die Mutter? Der Junge sah hinter sich, doch dort war niemand. Wenigstens gehorchte ihm sein Körper nun wieder. Der Junge rannte los. Während er lief, machte er sich so klein wie möglich, doch in seiner Fantasie wuchs er zum Riesen. Er wuchs und wuchs und schon bald überragte er die Bäume und betrachtete die Welt von oben. Seine Schritte wurden immer ausladender und wenn er die Füße aufsetzte, bebte die Erde.
Riesen waren schnell.
Schnell.
Riesen waren stark.
Stark.
Riesen konnten alles.
Alles.
Der Junge erreichte das Feld. Schützend hob er die Hände vor die Augen und verschwand im Mais. Er rannte weiter und hoffte inständig, in die richtige Richtung zu laufen. Immer wieder lief er in Stängel hinein und die kantigen Blätter zogen feine Schnitte in sein Gesicht. Die Kraft des Jungen schwand, doch er rannte und rannte, sah nicht, wohin und hatte kein Gefühl dafür, wie viel Strecke noch vor ihm lag. Er stolperte und schlug hin, rappelte sich auf und lief weiter, so schnell er konnte. Dann hatte er das Feld durchquert. Schnaubend blieb er stehen. Er schaute sich um und entdeckte die Buche zwischen all den anderen Bäumen. Sie stand nicht allzu weit entfernt. Der Junge war erleichtert. Ein kurzes Stück noch musste er laufen, dann hätte er es geschafft. Er sah, dass seine Handflächen aufgeschürft waren und die Knie bluteten, doch es tat nicht weh. Der Junge pustete durch, dann rannte er los.
Als er die Buche erreicht hatte, sank er zu Boden. Sein Herz schlug wie wild. Während er nach Luft rang, blickte er in den blauen Himmel, den vereinzelt Wolken als schmale Bänder zierten. Die Mutter hatte immer gesagt, dass oben im Himmel nur Gutes war, nichts Böses.
Die Mutter. Der Vater. Die Schwestern, die Großmutter. Wie ging es ihnen? Dem Jungen schossen die Tränen in die Augen. Nein, er durfte nicht weinen. Nicht jetzt. Jetzt musste er sich vor den bösen Männern verstecken. Bestimmt suchten sie ihn bereits.
Das Versteck war gut getarnt. Hätte der Junge von dem Versteck nichts gewusst, hätte er es wohl niemals entdeckt. Die Mutter hatte es ihm erst vor ein paar Wochen gezeigt. Er hatte sie gefragt, wozu das Versteck gut war und wer es angelegt hatte, doch sie hatte lediglich entgegnet, dass er niemandem davon erzählen dürfte.
Der Junge kroch ins Versteck hinein. Es war klein und eng. Ein erwachsener Mensch hätte niemals hineingepasst. Doch vielleicht war das Versteck auch nicht für Erwachsene gebaut worden, sondern für Kinder.
Vielleicht sogar eigens für ihn.
Oliver
Ich hatte das Haus im äußersten Nordosten Hamburgs gekauft, weil ein halber Neuanfang nicht ausreichte. Die Sache war nämlich, dass es nur ganz oder gar nicht ging. Wenn ich eine Zukunft haben wollte, musste ich mein bisheriges Leben aus mir rausschneiden wie ein fauliges Stück Fruchtfleisch aus einem Apfel. Was hinter mir lag, war vorbei und durfte nicht zurückkehren. Niemals.
Hamburg hatte mir schon immer gut gefallen. Ich mochte auch andere deutsche Städte, jedoch war die Stadt an der Elbe die erste Wahl gewesen, nachdem ich mich zum Neubeginn entschlossen hatte. Ich hatte mir einige Objekte in verschiedenen Stadtteilen angeschaut, doch bei jedem hatte irgendetwas nicht gepasst. Schließlich hatte ich dieses hier gefunden. Es war ein kleines romantisches Häuschen in einer kleinen Sackgasse inmitten der Walddörfer, dort, wo Naturschutzgebiete und Ländlichkeit am Rande der Großstadt für Idylle sorgten und die Uhren langsamer tickten. Die hier lebenden Menschen scherten sich wenig um anderer Leute Angelegenheiten und kümmerten sich um ihren eigenen Kram. Genau das Richtige für mich.
Mein Name ist Oliver Bremser, ich bin sechsundvierzig Jahre alt und trockener Alkoholiker. Ich habe drei Entzüge hinter mir und arbeite jeden Tag daran, dass kein vierter folgt. Seit zehn Monaten habe ich keinen Tropfen angerührt. Es geht mir hervorragend ohne Alkohol, doch ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich mir nicht doch gelegentlich gerne einen Drink genehmigen würde. Doch dazu darf es nicht kommen.
In meinem zurückgelassenen Leben wohnte ich in Wolfsburg und war beim größten Automobilhersteller der Welt angestellt. Auch meine Eltern hatten bis zuletzt dort gearbeitet, mein Vater in der Produktion und meine Mutter in Teilzeit in der Buchhaltung. Meine Eltern waren redliche und demütige Menschen, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden standen. Ich war ein Einzelkind und meine Eltern achteten sehr auf mich und legten viel Wert darauf, dass ich wohlerzogen und fleißig war. Ich denke gerne an meine Kindheit zurück. Ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir, neben meinen liebevoll ausgerichteten Geburtstagsfeiern, die dreiwöchigen Reisen während der Sommerferien. Jahr für Jahr fuhren wir mit unserem kleinen Campingwagen an den Gardasee. Dort traf ich die Spielkameraden vom vergangenen Jahr wieder und hatte eine wundervolle Zeit. Einmal jedoch reisten wir nach Jugoslawien, in den Teil des heutigen Kroatiens. Dort war es heiß, ich fand keine netten Kinder zum Spielen und das Essen schmeckte mir nicht. Also entschied ich, ununterbrochen schlechte Laune zu haben. Im darauffolgenden Jahr ging es wieder an den Gardasee.
Ich war das, was man einen anständigen Jungen nannte und bereitete meinen Eltern kaum Kummer. Ich war ein guter Schüler, trug in der Nachbarschaft das kostenlose Anzeigenblatt aus, spielte Handball und hatte keine Freunde von der Sorte, die als falscher Umgang bezeichnet wurden. Im Grunde war ich artig und auch ein wenig langweilig. Ich trank, rauchte und kiffte nicht, hörte keine laute Rockmusik und hatte meine erste Freundin mit sechzehn. Drei Monate lang knutschten wir bloß, weil ich einfach nicht den Mut hatte, meine Hand unter ihren Pulli zu schieben, bis es ihr zu blöd wurde und sie es für mich übernahm.
Kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag musste ich im regionalen Kreiswehrersatzamt zur Feststellung der körperlichen Eignung für den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr antanzen. Zu meiner Verwunderung erhielt ich den Tauglichkeitsgrad fünf und war somit ausgemustert. Ich war froh, nicht durch den Matsch robben oder Panzer putzen zu müssen. Anstatt Zeit zu verschwenden, konnte ich mit neunzehn Jahren und einem Einser-Abitur in der Tasche das Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing beginnen. Um meinen Eltern nicht zu sehr auf der Tasche zu liegen, bat ich meine Mutter, sich zu erkundigen, ob ich in der Marketingabteilung des Konzerns stundenweise als studentische Hilfskraft arbeiten könnte. Es klappte. Ich hatte Freude an den Aufgaben und den Projekten, an denen ich mitwirkte, und mein Fleiß und meine Verlässlichkeit kamen gut an. Ich zog das Studium im Schnelldurchlauf durch, und noch bevor ich den Abschluss in der Tasche hatte, wurde mir ein fester Job in der Marketingabteilung angeboten. Als mir das Gehalt genannt wurde, blieb mir fast die Luft weg. Mit gerade mal vierundzwanzig Jahren war mein Monatseinkommen höher als das meiner Eltern zusammen, trotz ihrer langen Konzernzugehörigkeit. Das fühlte sich zwar großartig, aber gleichzeitig auch falsch an. Ich sprach mit meinen Eltern darüber, doch sie lächelten meine Bedenken fort, sagten, das wäre vollkommen in Ordnung und sie seien stolz auf mich. Als müssten sie es mit Nachdruck beweisen, luden sie mich auf der Stelle zum Essen beim Chinesen um die Ecke ein. Es war rührend und ich weiß noch, dass ich das günstigste Gericht bestellte. Ich hätte keine besseren Eltern haben können.
Nur wenige Tage später endeten ihre Leben. Ein Geisterfahrer auf der A7 riss sie beim Suizid mit in den Tod. Das verdammte Arschloch krachte mit zweihundert Sachen frontal in den Wagen meiner Eltern. Einige Fahrzeuge hatten gerade noch ausweichen können, meine Eltern nicht. Sie und das Arschloch waren auf der Stelle tot. Im Wagenwrack des Arschlochs fand die Polizei einen Abschiedsbrief. Er schrieb, seine Frau hätte ihn für einen anderen Mann verlassen und die zwei kleinen Töchter mitgenommen, das Leben habe für ihn keinen Sinn mehr. Ich verstand es nicht. Das Arschloch hätte sich auf leise Weise selbst töten können, stattdessen hatte er sich für den lauten Abschied entschieden, der einen klaren Adressaten hatte: Seine Frau, die sich auf ewig mit Schuldgefühlen quälen sollte. Ich hatte die Ärmste nie getroffen, doch ich wünsche ihr bis heute, dass der selbstverliebte und perfide Plan des Arschlochs von Ehemann nicht aufgeht.
Der tragische Tod meiner Eltern entsetzte mich, ich war voller Wut und Traurigkeit. Mein Vorgesetzter legte mir nahe, mich für einige Zeit arbeitsunfähig schreiben zu lassen, doch das kam für mich nicht infrage. Stattdessen nahm ich den mir zustehenden Sonderurlaub und machte einige weitere Tage frei, um alles zu regeln. Dabei wusste ich kaum, wo ich anfangen sollte. Freunde, Bekannte und ferne Verwandte boten mir Unterstützung und Gespräche an, doch ich lehnte alles ab. Ich sah es als meine Aufgabe an, alles selbst und allein zu regeln, und ließ niemanden an mich ran, selbst meine damalige Freundin nicht. Ich bemerkte in all dem Stress und Schmerz nicht, wie überfordert ich war.
In jenen Tagen entdeckte ich den Alkohol als Bewältigungshelfer. Nüchtern ging es mir nicht gut. Trank ich, ließ sich alles besser ertragen und ich fühlte mich weniger gestresst. Also kippte ich bereits am Vormittag die ersten Biere. Nicht, dass ich vorher nicht gelegentlich Alkohol getrunken hatte, doch nie war ich angetrunken oder gar voll gewesen, und erst recht nicht hatte ich getrunken, um mich selbst zu manipulieren. Das war jetzt anders.
Ich nahm das Angebot des Vermieters, in dessen Wohnung meine Eltern und ich länger als zwanzig Jahre gewohnt hatten, an, den Mietvertrag zu unveränderten Konditionen zu übernehmen. Am selben Tag erfuhr ich, dass ich als Erbe die Leistungen aus den Lebensversicherungen meiner Eltern erhalten würde. Sie hatten einander zum Bezugsberechtigten bestimmt, doch da sie zeitgleich verstorben waren, ging das Geld an mich. Es war absurd: Meine Eltern waren auf albtraumhafte Weise getötet worden, und nur wenige Tage später verdankte ich ihnen eine günstige Wohnung und die Aussicht auf mehr als achtzig Riesen auf dem Konto. Das alles fühlte sich komplett falsch an, doch der Alkohol gaukelte mir vor, besser damit klarzukommen, sofern ich ihn bloß machen ließ. Also ließ ich ihn machen.
Nach der Beisetzung krempelte ich die Wohnung um und wenig später zog meine Freundin ein. Sie war ein großartiger Mensch und ich hatte sie wirklich gern. Doch seit dem Tod meiner Eltern bedeutete mir unsere Beziehung nicht mehr viel, allerdings dachte ich, das würde sich ändern, wenn erst einmal etwas Zeit ins Land gegangen und die Trauer verarbeitet wäre. Jedoch tat ich nichts zur Bewältigung. Ich führte keine entsprechenden Gespräche und vermied es, über das Geschehene nachzudenken. Wurde ich auf den Verlust angesprochen, bagatellisierte ich ihn und wechselte rasch das Thema.
Auf der Flucht vor mir selbst stürzte ich mich in die Arbeit, um der Welt und mir zu beweisen, dass ich besser denn je funktionierte. Mit einer konstanten Menge Alkohol im Blut schaltete ich die Traurigkeit aus und steckte meine enthemmte Energie in die Projekte, an denen ich arbeitete. Zu jener Zeit wurde alles, was ich im Job anfasste, zum Erfolg. Ich erntete viel Lob und kam auf den Geschmack. Es gefiel mir, gesehen zu werden und dass mein Name fiel, wenn die Dinge gut liefen. Ich wollte mehr davon und wusste, dass ich, um im Konzern weiter voranzukommen, nicht nur Leistung bringen, sondern auch mein Netzwerk erweitern und mögliche Förderer identifizieren musste. Dazu musste ich als eher distanzierter Mensch mit wiederkehrenden introvertierten Phasen über meinen Schatten springen und mich ein Stück weit neu erfinden. Auch hier log der Alkohol mir eine Lösung vor. Er versprach mir, dass ich dank seiner Hilfe lockerer und nahbarer werden würde. Das verdammte Zeug hielt das Versprechen, doch viel zu lange hatte es mir den Preis dafür verschwiegen. Im Job gab ich Vollgas, sah nur noch mich und schaute immer weniger nach links und rechts. Jeden Abend trank ich Alkohol und sorgte auf diese Weise dafür, so wenig wie möglich über mein Leben nachzudenken. An den Wochenenden schoss ich mich regelmäßig ab, und es machte mir nicht das Geringste aus, dabei allein und nicht in Gesellschaft zu sein. Immer wieder versuchte meine Freundin, mir die Augen zu öffnen, doch ich wollte nicht raus aus der Blindheit. Unsere Beziehung verlor ihren Wert. Nach einem Jahr hatte meine Freundin genug von mir und verließ mich. Es machte mir nicht viel aus.
Zwar war mir bewusst, dass ich zu viel trank, doch da ich es morgens fast immer gut aus dem Bett schaffte und mich sogar gelegentlich zum Laufen aufmachte, die Sauferei mir nicht anzusehen war und ich im Job funktionierte, sah ich keinen Grund, mein Verhalten zu ändern. Meine Lebensinhalte waren die Arbeit und das Trinken, und das eine schien mit dem anderen bestens zu funktionieren. Und da ich niemanden aus meinem näheren Arbeitsumfeld dicht an mich heranließ, fiel es niemandem auf, wie fremdgesteuert ich mittlerweile war. Fast wäre ich stolz auf meine schauspielerische Leistung gewesen, doch bisweilen meldete sich eine mahnende Stimme, die mir sagte, dass ich mich auf einem ungesicherten Pfad am Rande einer tiefen Schlucht befände. Zwar schenkte ich der Stimme nur wenig Gehör, doch sie gab nicht auf. Hätte es diese Stimme nicht gegeben, wäre ich möglicherweise viel früher tief gefallen.
Mit sechsundzwanzig Jahren wurde ich Senior Marketing Manager und erhielt eine üppige Gehaltsanpassung. Zu der Zeit war ich vergleichsweise gut beisammen, rührte auch mal den einen oder anderen Tag lang keinen Alkohol an und hatte mehrere aufeinanderfolgende Beziehungen, die mir jedoch nicht viel bedeuteten. Zweimal hintereinander nahm ich meinen Jahresurlaub an einem Stück und reiste mit dem Rucksack per Anhalter durch Nordamerika. Es waren wundervolle Reisen, bei denen ich mir selbst näher war als gewöhnlich und bis auf die eine oder andere Dose Bier nichts anrührte. Ich genoss die Wochen in vollen Zügen und hatte die beste Zeit meines Lebens. Weshalb konnte es nicht immer so unbeschwert und einfach sein?
Doch kaum hatte der Alltag mich zurück, verfiel ich in mein altes Muster. Da ich den gesamten Urlaub auf einen Schlag verbraucht hatte, fühlte ich mich nach drei, vier Monaten unter Hochdruck ausgebrannt und leer. Um durchzuhalten, griff ich wieder mehr zur Flasche. Niemand bekam davon etwas mit, und falls doch, erfuhr ich davon nichts. Solange ich meine Leistung brachte, spielte alles Weitere für die anderen keine Rolle. Hauptsache, ich lieferte.
Mit achtundzwanzig wurde ich Teamleiter und trug von einem Tag auf den anderen Personalverantwortungen für fünfzehn Leute. Das setzte mich gewaltig unter Druck, denn von nun an musste ich führen, und das musste ich erst einmal lernen. Mir war klar, dass zahlreiche Kollegen neidisch oder missgünstig auf mich schauten, denn für gewöhnlich verliefen Karrieren bei uns im Konzern langsamer. Die Erwartungen an mich wuchsen und ich war in ständiger Sorge, zu scheitern. Ob ich zu dem Zeitpunkt bereits Alkoholiker oder noch übermäßiger Gewohnheitstrinker war, weiß ich nicht. Jedenfalls verließ ich immer häufiger zur Mittagszeit das Konzerngelände, um irgendwo in der Nähe eine Kleinigkeit zu essen, vor allem aber, um einige Gläser Wein und auch mal den einen oder anderen Grappa zu trinken. Ich dachte mir nichts dabei, denn schließlich trank ich nicht, weil es mich danach verlangte, sondern weil ich es mir gönnte.
Zumindest redete ich mir das ein.
Junge
Der Junge lag im Versteck. Angestrengt spähte er durch den Spalt und rechnete damit, dass die bösen Männer auftauchen würden. Er hatte eine fürchterliche Angst. In dem Versteck war es so eng, dass der Junge sich kaum rühren konnte. Seine Arme und Beine waren taub und der Rücken schmerzte. Der Junge musste Wasser lassen, doch er durfte das Versteck nicht verlassen. Er hatte es der Mutter versprochen. Er musste das Pipimachen wegdrücken und warten, bis es dunkel wurde – wann auch immer es so weit war. Von hier aus konnte der Junge den Stand der Sonne nicht sehen und er hatte das Gefühl für die Tageszeit verloren.
Noch bevor die Dunkelheit hereinbrach, konnte der Junge den Drang nicht länger zurückhalten. Er urinierte unter sich weg und weinte leise. Wie gerne wäre er jetzt bei der Mutter und den anderen, doch er musste sich noch ein wenig gedulden. Aber nicht mehr lange. Denn bald würde die Mutter kommen und ihn holen, und dann wäre alles wieder gut. Es war ein schöner Gedanke.
Der Junge schloss die Augen. Er war erschöpft und traurig. Kurz darauf schlief er ein.