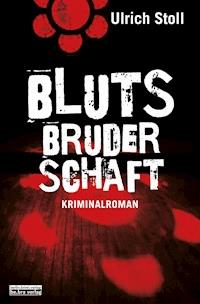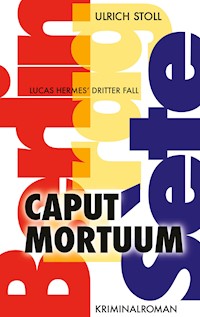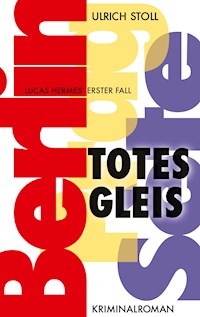
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lucas Hermes
- Sprache: Deutsch
West-Berlin im Sommer 1988. Der Fernsehreporter Lucas Hermes steht beruflich und privat vor dem Aus. Um wieder ins Geschäft zu kommen, braucht er dringend einen Knüller. Als innerhalb von wenigen Tagen drei Menschen bei Bombenanschlägen uns Leben kommen, beginnt er auf eigenen Faust zu recherchieren. Für Hermes steht bald fest, dass die Spuren ins rechtsextreme Milieu führen. Doch als mehrere Zeugen sterben und seine Mitstreiterin, die attraktive Zeitungsreporterin Anna Rademacher, entführt wird, zeigt sich, dass Hermes sich mit übermächtigen Kreisen angelegt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Die Presse muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun.«
Stewart Alsop
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Sonntag, 22. Mai 1988
Montag, 23. Mai 1988
Dienstag, 24. Mai 1988
Mittwoch, 25. Mai 1988
Mittwoch, 25. Mai 1988
Donnerstag, 26. Mai 1988
Freitag, 27. Mai 1988
Samstag, 28. Mai 1988
Montag, 30. Mai 1988
Dienstag, 31. Mai 1988
Dienstag, 31. Mai 1988, 23.30 Uhr
Donnerstag, 2. Juni 1988
Samstag, 4. Juni 1988
Donnerstag, 9. Juni 1988
Samstag, 11. Juni 1988
Montag. 13. Juni 1988
Dienstag, 14. Juni 1988
Donnerstag, 16. Juni 1988
Freitag, 17. Juni 1988
Montag, 20. Juni 1988
Dienstag, 22. Juni 1988
Mittwoch, 23. Juni 1988
Donnerstag, 24. Juni 1988
Freitag, 25. Juni 1988
Montag, 27. Juni 1988
Dienstag, 28. Juni 1988
Mittwoch, 29. Juni 1988
Donnerstag, 30. Juni 1988
Freitag, 1. Juli 1988
Samstag, 2. Juli 1988
Montag, 4. Juli 1988
Dienstag, 5. Juli 1988
Mittwoch, 6. Juli 1988
Freitag, 8. Juli 1988
Samstag, 9. Juli 1988
Sonntag, 10. Juli 1988
Montag, 11. Juli 1988
Donnerstag, 14. Juli 1988
Freitag, 15. Juli 1988
Samstag, 16. Juli 1988
Montag, 18. Juli 1988
Mittwoch, 20. Juli 1988
Donnerstag, 21. Juli 1988
Freitag, 22. Juli 1988
Samstag, 23 Juli 1988
Montag, 25. Juli 1988
Dienstag, 26. Juli 1988
Mittwoch, 27. Juli 1988
Donnerstag, 28. Juli 1988
Freitag, 29. Juli 1988
Montag, 1. August 1988
Dienstag, 2. August 1988
Mittwoch, 3. August 1988
Donnerstag, 4. August 1988
Donnerstag, 11. August 1988
Freitag, 12. August 1988
Sonntag. 14. August 1988
Montag, 15. August 1988
Dienstag, 16. August 1988
Mittwoch, 17. August 1988
Donnerstag, 18. August 1988
Freitag, 19. August 1988
Mittwoch, 24. August 1988
Donnerstag, 25. August 1988
Freitag, 26. August 1988
Prolog
Er horcht in den Tunnel hinein. Die Dampflok der Baureihe Null-Drei durchfährt die Kurve im Berg, die sich an die langgestrecke Stahlträgerbrücke anschließt. Eine gute Idee, das Modell im Maßstab HO in der schwarzen Reichsbahn-Lackierung mit den kräftigen Wagner-Windleitblechen zu wählen. Er legt das Gesicht schief, berührt mit der rechten Schläfe fast das Gleis, das leise summt. Es riecht nach Holzleim und Öl.
Im Dunkel des Tunnelausgangs leuchten die drei Stirnlampen auf. Er hat den Trafo auf langsame Fahrt gestellt. Dann kann man das Knarzen der Zahnräder besser hören, glaubt er – ein feines Schnurren der Zacken, die gut geölt ineinandergreifen. Die Fahrgestelle der Waggons klackern weich über die Schienenstöße. Er wird so lange wie möglich den Kopf unten halten, will staunen wie ein Kind, vor dem sich ein mechanisches Wunderwerk auftut.
Jetzt hebt er den Kopf vom Gleis, knapp vor der Lok, so als wolle er ihren Fahrtwind auf der Haut spüren. Das ist das Letzte, was jemand fühlt, der auf den Gleisen liegt, Hände und Füße schmerzhaft gefesselt, ein Taschentuch als Knebel im Mund, vollgesaugt mit Speichel, der jeden Schrei erstickt. Dann schneiden die schlanken Radkränze in die Haut, das Fleisch platzt auf, die Knochen splittern. Mit ruhiger Kraft trennen die Räder knirschend Füße und Kopf vom Rumpf, dem verzweifelt zuckenden Leib.
Die dünnen Pleuelstangen stoßen träge vor und zurück. Majestätisch schiebt sich die Schnellzuglokomotive dicht an seinem Gesicht vorbei, gefolgt von den blauen und roten Waggons der ersten und zweiten Klasse. Das Signal steht auf Grün, der D-Zug schnurrt sanft ohne Halt durch den Bahnhof.
Nur noch wenige Tage. Ruhig rückt der Uhrzeiger über der Werkbank vor.
Sonntag, 22. Mai 1988
Die U7 trieb eine Welle muffiger Luft vor sich her, als sie in den Bahnhof rollte und Dutzende mürrischer Berliner ausspuckte, deren Laune nicht einmal das Frühlingswetter heben konnte. Beim Einsteigen atmete Lucas Hermes durch den Mund ein, um den Geruch der ungewaschenen Leiber im engen Waggon nicht ertragen zu müssen. Seit seiner Kindheit ekelten ihn die Ausdünstungen seiner Mitmenschen. Gerüche, die ihn zwangen, sich wegzudrehen, wenn die Leute ihre schwitzigen Körper auf engstem Raum zusammendrängten oder ihm ihren schlechten Atem entgegenhauchten.
Sein Kontoauszug, den er eben aus dem Nadeldrucker gezogen hatte, war deprimierend. Neunzehn Mark dreiundfünfzig. Der Sender hatte noch immer nicht das Honorar für seinen Film über eine gefälschte Ausgabe des Neuen Deutschland, der Zeitung der DDR-Staatspartei, überwiesen. Zwei Monate war die Ausstrahlung in der Sendung »Im Visier« schon her. Ein ziemlich guter Bericht über die Hintergründe eines Pressecoups: Hamburger Journalisten hatten eine selbst hergestellte Version des SED-Blattes in die DDR geschmuggelt, in der suggeriert wurde, die DDR-Führung hätte endlich Gorbatschows Perestroika-Kurs übernommen und sei zu Reformen bereit. Lucas war bei Layoutarbeiten und Druck der gefälschten ND-Ausgabe mit der Kamera dabei gewesen und hatte verdeckt gedrehtes Material von der Verteilung des Blattes in Ost-Berlin in den Beitrag hineingeschnitten.
Wenn jetzt der Dauerauftrag für die Spedition abgebucht wurde, war er im Minus.
Vor gar nicht langer Zeit war Lucas Hermes noch mit dem Audi Coupé seiner Freundin Martina durch die Stadt gebraust. Standesgemäß. Der Starreporter fährt vor. Der gefürchtete Enthüller im gelben 2,3-Liter-Wagen mit den straffen Recaro-Sportsitzen, neben sich eine strahlend schöne Frau.
Wenn er damals vor dem Eingang zum Messegelände an der Masurenallee parkte, blickten selbst die fest angestellten Fernsehredakteure respektvoll zu ihm hinüber, die ihre Saabs und Porsches auch vor der Messe abstellten, wenn sie morgens zum Sender am Theodor-Heuss-Platz kamen.
Martina jammerte, sie habe sich beim Kauf verschätzt, der Kofferraum des Coupés sei zu klein für einen Kinderwagen. Lucas widersprach heftig, lobte ihre Entscheidung und pries die Beschleunigungswerte des Wagens.
»Eine kleine Spende«, murmelte der schmutzige Kerl, der jetzt dicht vor Lucas stand und ihm einen zerknitterten Pappbecher vor die Nase hielt. Lucas drehte den Kopf weg.
»Hältst dich wohl für was Besseres?« Der Ton des Bettlers wurde feindselig. Dem dürren Mann mit dem strähnig fettigen Haar baumelte ein alter Kassettenrekorder an einer Paketschnur um den Hals. Der Obdachlose verzog das Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen.
»Ja, dich meine ich.« Er spreizte den Zeigefinger vom Pappbecher ab und deutete auf Lucas. »Du fährst jetzt in dein schönes warmgepuptes Zuhause. Aber ich …« – er deutete in einer pathetischen Geste auf sein zerlumptes T-Shirt und zeigte seine schlechten Zähne – »… muss jede Nacht zusehen, wo ich einen Platz zum Schlafen finde.« Lucas stellte sich taub, starrte durch die Fensterscheibe ins Dunkel des Tunnels.
»Ich bin Sänger«, fuhr der Bettler in einem hellen Singsang fort. »Ich bin schon überall aufgetreten und die Leute haben mir zugejubelt. Alle lieben die Lieder von Zarah Leander, wenn ich sie singe. Dann weinen die Menschen!« Er schüttelte mit bitterer Miene den Kopf. »Aber keiner will für die Musik zahlen.«
Ein Mädchen mit roter Punkfrisur steckte wortlos eine Mark in den Pappbecher und ging weiter. Lucas war erlöst. Der Sänger drückte die Starttaste des Kassettenrekorders auf seiner Brust, wandte sich von ihm ab und holte tief Luft, während die ersten Takte aus dem Lautsprecher krächzten:
»Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn und dann werden tausend Märchen wahr!«
Zwei Lieder und zwei Stationen später stürzte Lucas am Mierendorffplatz aus der Bahn und lief die Lise-Meitner-Straße hoch. Da lag sein künftiges Quartier: ein dreistöckiger Flachbau an der Ecke zur Olbersstraße, grau und düster vor dem noch blauen Abendhimmel. 22 Uhr 30, eigentlich zu früh zum Schlafen. Die Begegnung mit dem Obdachlosen in der Bahn hatte Lucas eigentümlich berührt. Ausgerechnet in dem Moment, in dem er seinen Weg in die Obdachlosigkeit antrat, erschien ihm eine zerlumpte Figur, die zu sagen schien: Sieh mich an, ich bin wie du!
In dem mit Waschkieselplatten verblendeten Lagerhaus waren mehrere Firmen untergebracht, auch die Spedition, bei der er seine Wohnungseinrichtung eingelagert hatte. Die Spedition nahm fünfzig Mark pro Monat für die Lagerung – die billigste Möglichkeit, ohne Wohnung in Berlin zu überleben. Ein Hotel kam angesichts seiner Finanzlage nicht infrage. Seine Altbauwohnung hatte er nach drei Monaten Mietrückstand fluchtartig verlassen müssen. Der Vermieter behielt die Kaution ein und ließ ihn schließlich ziehen, allerdings unter der Bedingung, dass alle Möbel am Freitag bis 18 Uhr abgeholt würden.
Die Spedition hatte Lucas vor rund einer Woche entdeckt. Er war stundenlang vor dem grauen Zweckbau auf und ab gelaufen, um das Kommen und Gehen zu beobachten. Er wollte herausfinden, wie lange das Büro im Erdgeschoss des linken, flacheren Gebäudeteils besetzt war und wie der Pförtner auf seinem Kontrollgang Türen und Fenster verschloss. Der Mann saß meist in dem verglasten Eckraum neben der Tordurchfahrt, packte pünktlich um fünf seine Stullendose ein und schloss das Büro ab. Dann ging er zu dem mannshohen Zaun, der das gesamte Gelände umschloss, und verriegelte das Einfahrtstor von außen. Wer am Wochenende rein wollte, musste über das Tor klettern, das aus senkrechten Metallstäben und vier Querstreben bestand. Heikel waren die spitzen Enden, die nur mit höchster Vorsicht zu überwinden waren, wollte man nicht mit der Kleidung hängen bleiben. Zu dem Büro gab es keinen Zugang. Es war verriegelt, auch das schmale Rolltor, das direkt zur Kellertreppe führte. Doch neben der Pförtnerloge war in Bodenhöhe ein kleines Kellerfenster, das immer offen stand, um das gelagerte Gut zu belüften.
Lucas blickte besorgt nach oben. Im rechten, ein Stockwerk höheren Gebäudeteil brannte auch abends in der obersten Etage Licht, vermutlich eine Hausmeisterwohnung. Das Eingangstor war aber außerhalb der Sichtweite der Wohnungsfenster, die alle auf die Olbersstraße gingen. Nur von einer Loggia aus, die zur Lise-Meitner-Straße lag, hätte der Bewohner den Eindringling entdecken können. Lucas überwand das Tor fast lautlos und kauerte sich kurz hinter den Zaun, um zu beobachten, ob ein Schatten auf dem Balkon auftauchte. Nichts.
Jetzt, kurz vor elf, lag nächtliche Stille über dem Gelände. Eine grau getigerte Katze huschte maunzend über den Hof, als Lucas sich dem Gebäude näherte. Er zog seine Jeansjacke aus und packte sie sorgfältig in seinen Rucksack. Dann ließ er sich vorsichtig durch das Fenster in den Keller gleiten und griff nach draußen, um den Rucksack hineinzuziehen, in dem seine wichtigsten Utensilien verstaut waren: eine Plastikflasche mit Mineralwasser, eine Taschenlampe, eine Zange, ein Vorhängeschloss, Zahnbürste und Zahnpasta.
Der Verschlag Nummer 14, in dem er seine Möbel abgestellt hatte, war mit einem leichten Vorhängeschloss gesichert. Mit der Zange ließ es sich erstaunlich leicht knacken. Sein mitgebrachtes Schloss sah fast genauso aus. Das Risiko, dass der Austausch des Schlosses auffallen würde, schätzte er als gering ein. Waren die Verschläge einmal vermietet, kümmerte der Spediteur sich nicht weiter darum und würde nicht merken, dass Lucas jederzeit Zugang zu dem Abstellraum hatte.
Er drehte den Lichtschalter. Sein in Plastikfolie eingeschlagenes Bett stand zuunterst, darauf vier schwere Bücherkisten. Er räumte sie beiseite, um an die Matratze heranzukommen. Die lag glücklicherweise auf dem Lattenrost. Die Kiste, in der er den Schlafsack verstaut hatte, fand er erst nach langem Suchen. Lucas war völlig durchgeschwitzt, als er ihn endlich auf das Bett legen konnte. Er zog sich bis auf Unterwäsche und Strümpfe aus, löschte das Licht und tastete sich zurück zum Bett. Dann zwängte er sich in den Schlafsack.
Bei jeder Bewegung knisterte die Plastikfolie auf der Matratze. Zähne putzen? Lieber morgen früh und jetzt nur ein Schluck Wasser. Lucas stellte den Reisewecker auf 7 Uhr 15 und starrte an die Decke. Der Keller roch leicht muffig.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte er zum letzten Mal in seiner Dreizimmer-Altbauwohnung am Maybachufer geschlafen, in einem frisch gemachten Bett. Den Freitag verbrachte er bis zum Nachmittag antriebslos im Bett und verstaute erst am frühen Abend die bereits gepackten Kisten und Möbel widerwillig in Margarethes altem Ford Transit, den sie als Wohnmobil für ihre Irland-Reisen nutzte. Margarethe van Oyen, eine Kollegin aus der Redaktion, mit der er direkt nach seiner Trennung von Martina eine kurze Affäre gehabt hatte, brachte mit ihm die Sachen in die Spedition. Lucas log ihr etwas von Verzögerungen bei der Renovierung der neuen Wohnung vor und durfte die Nacht bei ihr auf dem Sofa verbringen. Seine vorsichtigen Annäherungsversuche kurz vor dem Schlafengehen wies sie lachend zurück. Am Samstag, nach einem ausgiebigen Frühstück mit Margarethe auf ihrem großzügigen Balkon, war er stundenlang ziellos durch die Stadt gelaufen und hatte sich von Café zu Kneipe gehangelt, bis er in den frühen Morgenstunden am Ufer des Landwehrkanals im Tiergarten ein paar Stunden Schlaf auf dem Rasen fand. Am Sonntagmorgen wachte er zerschlagen und fröstelnd auf. Ein leichter Nieselregen hatte ihn bis auf die Haut durchnässt. Er flüchtete in die Neue Nationalgalerie, lief von Saal zu Saal, immer gefolgt von den Museumswärtern, bis er sich auf einer flachen Lederbank ausstrecken konnte. Den müden Kopf in die Hand gestützt, betrachtete er halb liegend die stämmigen steingrauen Körper von Fernand Legers »Zwei Schwestern« mit ihren kreisrunden Brüsten, bis ihm der Kopf auf die Brust sackte. Ein Wärter rüttelte ihn wach – sein leises Schnarchen war bemerkt worden. Lucas floh aus dem Museum, verfolgt von den vorwurfsvollen Blicken der anderen Besucher. Die restlichen Stunden bis zum Abend irrte er wieder durch die Stadt. Erst spät, dachte er, wäre der unbemerkte Einbruch in die Spedition möglich.
Er war auf dem besten Weg, ein dreckiger Penner zu werden.
Lucas war überzeugt, in seinem Kellerloch nicht einschlafen zu können. Der Wecker tickte nervtötend laut.
Montag, 23. Mai 1988
Am Morgen hatte er ein pelziges Gefühl auf der Zunge und das tiefe Bedürfnis, sich die Zähne gründlich zu reinigen und unter die Dusche zu springen. Sein schönes Bad mit den kleinen blauen Glaskacheln und dem warmen Duschstrahl … das gab es nicht mehr. Er trank einen Schluck Wasser, behielt einen Rest Flüssigkeit im Mund und putzte sich mit zusammengepressten Lippen die Zähne. Die Mischung aus Wasser, Spucke und Zahnpasta ließ er angewidert in die Flasche zurücklaufen und schraubte sie zu. Er blickte sich in seinem Verlies um, in dem er die erste Nacht seiner obdachlosen Zeit verbracht hatte. Ein enges Geviert von schmutzig-weiß gestrichenen Backsteinwänden, eine aus groben Brettern gezimmerte Tür, die eine Handbreit kürzer als die Türöffnung war, damit Frischluft in das Kabuff gelangen konnte. An der Wand ein altmodischer schwarzer Drehlichtschalter und die dazugehörende Kellerleuchte mit einer 25-Watt-Birne, die ein schummerig-gelbliches Licht warf.
Er zog sich, auf dem Bett kauernd, nackt aus und packte die getragene Wäsche in eine Tüte, in der bereits das Hemd vom Vortag steckte. Die Plastiktüte, beschloss er, war ab sofort sein Schmutzwäschedepot.
In einem Umzugskarton fand er frische Kleidung: Unterhose und Strümpfe, ein dunkelrotes Polohemd und eine Jeans. Er nahm sich vor, in dem Frischwäschekarton Ordnung wie in einem Kleiderschrank zu halten. Ein Stapel Hemden und Polos, ein anderer mit T-Shirts und Unterhemden, ein dritter Wäscheturm mit Boxershorts und Hosen, sodass ein Viertel der Kartonfläche frei blieb für den Sockenhaufen. Lucas zog noch im Sitzen das Sommerjackett über, das er mit Martina im KaDeWe gekauft hatte. Schlammfarben, genau der beige-braune Ton, den Lucas in den Kaufhäusern und Herrenbekleidungsgeschäften an Ku’damm und Tauentzien tagelang gesucht hatte. Es war der letzte gemeinsame Einkauf mit Martina gewesen, vielleicht sogar das letzte Mal, dass sie gemeinsam etwas unternommen hatten. Martina wollte damals Klarheit, doch Lucas war nicht so weit, sich völlig auf sie einzulassen. Lief es nicht gut zwischen ihnen? Jeden Abend in einem anderen Restaurant, mit Freunden in der Kneipe, im Kino, im Theater, im Konzert. Sie gingen tanzen, wann es ihnen passte, manchmal bis zum Morgen. Dann schleppten sie sich, bevor die Läden an der Nürnberger Straße aufmachten, verschwitzt und glücklich aus dem Dschungel und liebten sich in ihrer Wohnung, wenn die anderen zur Arbeit mussten. Er sah sich nicht als Vater eines gemeinsamen Kindes. Martina war damals siebenunddreißig und ließ ihn spüren, dass ihre Uhr tickte. Aber er wollte sich nicht erpressen lassen, brauchte Zeit, um sich über seine Gefühle klar zu werden. Wie sollte das denn gehen? Er, der Reporter, der ständig auf Dreh oder auf Recherche unterwegs war, müsste wie die Familienväter unter seinen Kollegen nach jedem Arbeitstag nach Hause hetzen, um dort mit vorwurfsvollen Blicke empfangen zu werden. Martina, die kühle Blonde, die er immer so gern angeschaut hatte, erschien ihm bei den Gesprächen über den Kinderwunsch reizlos. Der Mund schmal und herrisch, die Sätze mit der gestreckten Hand zerteilend, ihr Blick kalt und fordernd.
Er redete sich heraus, wenn das Gespräch wieder einmal auf die anstehende Familiengründung kam. Oder er schwieg, wenn sie ein klares Bekenntnis zum Kind forderte, bis sie es nicht mehr aushielt und in einem Tobsuchtsanfall Gläser zerschmiss. Es war ihre Wohnung, also war es an ihm, zu gehen und sich eine Junggesellenbude zu suchen.
Erst ein Jahr später hatte er über Umwege erfahren, dass Martina damals schwanger gewesen war und das Kind kurz nach der Trennung verloren hatte. Darum hatte sie also nach dem Ende der Beziehung alle seine Kontaktversuche brüsk zurückgewiesen. Lucas hatte Martina nie wiedergesehen, auch nicht zufällig in der U-Bahn. Er traute sich seitdem nicht mehr in ihre Straße oder in die Restaurants und Cafés, in denen sie früher oft gemeinsam gesessen hatten. Nach und nach schlief der Kontakt zu ihren gemeinsamen Freunden und Bekannten ein. Lucas kämpfte um keine Freundschaft. Er akzeptierte den Rückzug der anderen als gerechte Strafe für sein Verhalten.
Lucas faltete das Jackett sorgfältig auf Din-A3-Größe, steckte es in eine Plastiktüte und schob sie aus dem Kellerfenster, danach folgte sein Rucksack. Vorsichtig stemmte er sich durch das Fenster in den Hof, klopfte Polohemd und Hose aus, schlüpfte erneut in die Jacke und steckte die Plastiktüte in den Rucksack. Dann machte er sich auf zur U-Bahn.
Im Bahnhof Zoo angekommen, musste er mehrfach Jugendlichen mit müden Augen ausweichen, die sich ihm in den Weg stellten, ihn anrempelten oder einfach nur die Hand ausstreckten. »Eine kleine Spende?«, fragte ein Mädchen mit so resignierter Stimme, als erwarte sie nicht einmal mehr, dass einer der Vorbeiströmenden stehen blieb und auf ihre Bitte einging. Lucas schätzte sie auf gerade einmal sechzehn Jahre. Die Junkies drückten sich Tag und Nacht an den schmutzig gelben Wänden des unterirdischen Ganges herum und schnorrten Passanten an. Lucas hatte die Szene vor einem halben Jahr kennengelernt, als er über Wochen im und um den Bahnhof Zoo recherchiert und gedreht hatte. Zehn Jahre nach dem berühmten Buch über die vierzehnjährige heroinabhängige Christiane F. sah die Szene am Zoo nur äußerlich besser aus. Jetzt waren Amphetamine neben Heroin zur wichtigsten Droge geworden. Speed war an der Jebensstraße weitaus günstiger als Heroin zu bekommen. Die Dealer reagierten auf die neue Billigdroge mit Lockangeboten und fixten die Kinder, die vor ihren Eltern weggelaufen waren und am Bahnhof hausten, mit winzigen Heroin-Probierpäckchen an, für die sie zwanzig Mark verlangten.
Er stieg die Treppe hoch in die Haupthalle und erreichte die Waschräume. Ein an den Armen wild tätowierter Bartträger, der sich nach einer langen Nacht im Freien wohl gerade gesäubert hatte, kam ihm im Unterhemd entgegen. Lucas leerte die Flasche mit dem Zahnputzwasser ins Waschbecken und spülte sie sorgfältig aus. Dann warf er eine Fünfzigpfennigmünze ein und betrat auf Zehenspitzen die Duschkabine. Er stellte sich vor, das sich hier nicht nur der Tätowierte, sondern auch Junkies, Penner und sonstige Reisende gewaschen hatten – Menschen, die garantiert Viren, Bakterien und Pilzsporen auf den fleckigen Kacheln verteilt hatten. Im Sieb lag ein Büschel schwarzer Haare. Endlich konnte er die frischen Sachen ausziehen, bevor sie seinen Nachtgeruch annahmen, und hängte sie über die Kabinenwand. Er stellte sich auf den Außenrist der Füße, um möglichst wenig Hautkontakt mit dem Boden der Dusche zu haben, und ließ das heiße Wasser minutenlang über seinen Körper rieseln. Er wusch sich die Haare, und wenige Minuten später, nach erneutem Zähneputzen, fühlte er sich so frisch wie an jedem Morgen. So frisch wie zu der Zeit, als er noch kein verdammter Obdachloser war.
Lucas blickte in den Spiegel. Der Dreitagebart stand ihm. Obwohl seine Haare von dunkelblond langsam ins Grau übergingen, gefiel ihm seine halblange Mähne, die seine leicht abstehenden Ohren verdeckte. Der Haarausfall hielt sich in Grenzen. Keine beginnende Hinterkopfglatze, die älteren Männern etwas Mönchisches verlieh, kein dramatischer Rückgang des Haaransatzes, vielleicht eine etwas höhere Stirn als noch vor fünf Jahren.
Den kleinen dunklen Fleck auf dem Nasenrücken hatte er zuerst übersehen. Jetzt, im erbarmungslosen Neon der Spiegelleuchte, war die Verfärbung deutlich zu erkennen. Eine harmlose Pigmentstörung, redete er sich ein. Eine gutartige Hautveränderung, die aber in einigen Jahren, wenn er sich an die dunkle Tönung der Stelle gewöhnt hatte, heimlich tief ins Fleisch wuchern würde. Wären Sie nur früher gekommen, Herr Hermes! Dann wäre der Krebs nicht metastasiert! Das sturzbetroffene Gesicht des Arztes: Nein, es gäbe kaum noch Hoffnung. Lucas kniff die Augen zusammen und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, als wollte er einen bösen Traum beiseitewischen. Den bräunlichen Fleck musste er im Auge behalten.
Die Falten, die sich um seine Augen herum ins Gesicht zu graben begannen, gaben ihm etwas Verlebtes. Lucas fand, dass ihn das eher interessanter machte. Sorge bereitete ihm, dass er seit kurzem eine gewisse Teigigkeit in den Hüften feststellte. Gewiss, andere in seinem Alter waren dick, hatten Bäuche, die eine feste kleine Halbkugel über dem Gürtel bildeten. Doch bei ihm war das Gewebe erschlafft, nicht nur im Bauchbereich, auch die Brustmuskulatur, die ihre Festigkeit verloren hatte und an den Achseln erste Falten warf. Er nahm sich vor, ein wenig zu trainieren. Vielleicht ein paar Liegestütze im Kellerkabuff nach dem Aufwachen.
Das Leben auf der Straße will gelernt sein, dachte Lucas. Nimm es als eine Rechercheübung – ganz unten, wie Egon Erwin Kisch auf seinen Touren durch Prags Obdachlosenheime. Ein Pappbecher Kaffee im Stehen und ein mit Putenbrust und welkem Salat belegtes Brötchen. Das Frühstück im Bahnhof Zoo war nicht billig. Das konnte er sich auf Dauer nicht leisten. Lucas nahm sich vor, in den nächsten Tagen auf alle Pressekonferenzen zu gehen, bei denen es etwas zu essen gab.
***
Der Knall war ohrenbetäubend. Wiebke Posselt sah ihren Kaffeebecher wie in Zeitlupe vom Tisch hochspringen. Die Tasse neigte sich, verharrte in der Luft. Eine schwarze Woge Kaffee stieg über den Becherrand, um dann dem hinunterstürzenden Becher Richtung Schreibtischplatte zu folgen. Als Wiebke Posselt sich kurz darauf auf dem Boden wiederfand, dröhnte es in ihren Ohren. Eine ungeheure Kraft musste sie mitsamt ihrem Bürostuhl umgeworfen haben. Sie versuchte, auf die Füße zu kommen, und merkte, dass bei jedem tastenden Schritt Glassplitter unter ihren Schuhen knirschten. Die Fensterscheiben waren bei dem Knall aus den Fassungen gesprungen. Die Bürotür ließ sich nur schwer öffnen, offenbar war der Rahmen verzogen. Erst jetzt vernahm sie Schreie wie in weiter Ferne.
Auch die Stühle vor ihrem Büro waren umgestürzt, die Wartenden verschwunden. Dort wo die Eingangstür zur Beratungsstelle gewesen war, befand sich nur noch ein zersplitterter Türrahmen. Die Stimmen kamen von unten, aus dem Erdgeschoss: Neben dem Klingeln in ihren Ohren vernahm sie leise wimmernde und schluchzende Frauen. Männer brüllten heiser und aufgeregt durcheinander. Sie tastete sich zum Treppengeländer vor und ging mit zitternden Knien langsam, Stufe für Stufe, hinunter.
Wiebke Posselt schrie auf. Auf dem Treppenabsatz lag ein blutgetränktes Stoffbündel. Sie taumelte weiter und entdeckte vor der Eingangstür von Hauswart Köppke einen blutigen Klumpen – ein grausam entstellter Kopf, in dem es keine Augen und kein Gesicht mehr gab. Die Stimmen kamen jetzt von draußen. Nur raus hier, dachte sie und stolperte vorwärts ins Freie, wo bereits ein gutes Dutzend Menschen auf dem Bürgersteig kauerten.
Dienstag, 24. Mai 1988
Lucas war spät dran. Dienstags fand die Redaktionskonferenz immer schon um 14 Uhr statt, nach der Schaltkonferenz und dem Mittagessen. Er umrundete eilig den Theodor-Heuss-Platz und lief auf das weiße, sechsstöckige Funkhaus zu. Neben dem markanten Block des Deutschlandhauses stand ein quadratisches Gebäude mit einem eckigen Turm, der von einem Stahlgerüst mit dem Senderlogo in Neonbuchstaben gekrönt war: Der Name RBS – Rundfunk im britischen Sektor – stammte aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Besatzungsmacht hatte das Gebäude gezielt zur Zentrale eines demokratischen – »staatsfernen«! – Rundfunksenders gemacht, aus dem die Nazis 1936 die ersten Live-Bilder von den Olympischen Spielen in die Fernsehstuben Berlins übertragen hatten.
Mit kurzem Gruß hastete er am Pförtnertresen vorbei und stieg in den Lift. Dass Lucas Hermes seit Monaten keinen Film mehr gemacht hatte, schien die Sicherheitsleute nicht zu stören. Sie behandelten ihn wie die anderen freien Mitarbeiter, die regelmäßig in die Redaktion kamen, um ihre Themenvorschläge abzuliefern oder in den Schneideraum zu gehen. In der Aufzugkabine überlegte er verzweifelt, welches Thema er in der Konferenz vorschlagen könnte. Die Zeitungen vom Wochenende hatte er in einem Café überflogen, doch den Spiegel und die Montagszeitungen hatte er noch nicht in die Hände bekommen, ganz zu schweigen von den Agenturmeldungen. Also musste er darauf hoffen, dass für die nächste oder übernächste Sendung noch ein Film fehlte und er gefragt würde, ob er den Beitrag kurzfristig übernehmen könnte.
Er machte kurz Halt im Fernschreiberraum, riss die letzten Meldungen aus dem Drucker und eilte in den Konferenzraum im obersten Stockwerk. Fast alle Stühle waren schon besetzt. Die fest angestellten Redakteure und die sogenannten Freien, die kein Gehalt bekamen, sondern pro abgeliefertem Film honoriert wurden, studierten ihre Notizen oder die vor ihnen ausgebreiteten Zeitungen. Lucas war stets etwas mulmig zumute, wenn er die Redaktion betrat. Nicht nur, weil er hier die größte Niederlage seines Berufslebens erlitten hatte. Das Gebäude hatte für ihn eine gespenstische Aura. Aus diesen Räumen hatte der »Sender Paul Nipkow« ab März 1935 täglich gesendet, um »das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen«. Lucas stellte sich schaudernd vor, wie die Ansagerin Ursula Patzschke-Beutel in einem der Räume, in denen er heute Beiträge schnitt, die »Volksgenossinnen und Volksgenossen« mit einem markigen »Heil Hitler!« begrüßt hatte. Das TV-Programm der Nazis zeigte allabendlich von 20 bis 22 Uhr Spielfilme, Reportagen, Unterhaltungssendungen und die berühmten Scherenschnittfilme von Lotte Reiniger. Der Kriegsausbruch verhinderte, dass das teure neue Medium zum totalen Propagandainstrument wurde. Bis zum Oktober 1944 strahlte der »Deutsche Fernseh-Rundfunk« Programme wie »Wir senden Frohsinn, wir spenden Freude« in der Auflösung von 441 Zeilen in die wenigen verbliebenen Post-Fernsehstuben der zerbombten Stadt aus.
Im Konferenzraum war die Luft schon jetzt zum Schneiden. Stövenhagens Angewohnheit, in den Sitzungen Zigarillos zu rauchen, verstanden die übrigen Raucher der Redaktion als Aufforderung, den Raum schon vor Erscheinen des Redaktionsleiters einzunebeln. Lucas öffnete ein Fenster und nahm am Ende des langen Konferenztisches Platz. Er sah die Meldungen durch – fast nur Ausland und nichts für die Sendung – und fischte sich dann die B.Z. vom Zeitungsstapel. Auch im Lokalteil fand er nichts wirklich Interessantes. Gottlob Freese saß am anderen Tischende, in der Nähe von Stövenhagens Platz, und hatte eine aufgeschlagene Akte vor sich. Er war offenbar bestens vorbereitet. Sein Gesicht war weich, fast jungenhaft. Die rosigen Wangen bildeten einen Kontrast zur blassen, hohen Stirn, von der das dünne blonde Haar zunehmend zurückwich.
Er sieht aus wie ein altes Kind, dachte Lucas. Und er könnte eine Abreibung gebrauchen.
Happiness is a warm gun. Bang Bang Shoot Shoot. Happiness is a warm gun, momma. Bang Bang Shoot Shoot. And when I feel my finger on your trigger I know nobody can do me no harm.
Lucas versuchte, den Beatles-Song aus dem Kopf zu bekommen. Freese, das Frettchen, hatte offenbar eine ausrecherchierte Geschichte vor sich auf dem Tisch. Vermutlich würde er gleich interne Papiere zu einem Skandal aus der Arbeitswelt präsentieren. Miese Arbeitgeber, schlechte Löhne, Umweltsauereien in Betrieben – auf jeden Fall etwas, das Lucas nicht sonderlich interessierte, aber bei Stövenhagen und der Chefin vom Dienst gut ankam.
Bang Bang. Er beugte sich wieder über die B.Z.: »Gasexplosion in Kreuzberg – ein Toter« titelte das Boulevardblatt, darunter das Foto eines Hauses, das ihm bekannt vorkam. Natürlich, die Redaktion der türkischen Zeitung Milliyet! Dort hatte er vor ein paar Wochen seinen Kollegen Altün getroffen, der ihm von illegalen islamischen Internaten in Berlin erzählt hatte. Eine verdammt gute Story, die er mal wieder nicht mit der nötigen Energie weiterrecherchiert hatte.
»Gestern gegen 16 Uhr 30 ereignete sich eine Explosion in einem Wohnhaus in der Oranienstraße«, begann der fett gedruckte erste Absatz des Artikels. »Möglicherweise war Gas aus einer Leitung ausgetreten. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr der Hauswart Edgar K. (59) getötet. Wie durch ein Wunder wurde sonst niemand verletzt. Die Polizei verhängte eine Nachrichtensperre und riegelte den Unglücksort ab.«
»Na Lucas, wann steigt die Einweihungsparty?« Margarethe van Oyen stand plötzlich in der Tür. Halblange blonde Locken umspielten ihr etwas rundes Gesicht. Ihm gefiel, dass sie in letzter Zeit üppiger geworden war und ihre Figur nach wie vor mit enganliegenden Kleidern betonte. Er lächelte sie hilflos an. »Nächste Woche kann ich einziehen, dann sehen wir mal.« Er hoffte, dass sie nicht weiterfragte und in den nächsten Wochen vergessen würde, ihn erneut auf die fällige Fete anzusprechen.
»Wo wohnst du denn bis dahin?«, rief sie fröhlich über den Tisch hinweg und setzte sich.
Bevor Lucas eine passende Antwort gefunden hatte, betrat Stövenhagen grußlos den Raum, gefolgt von der Chefin vom Dienst, Britta Hensel. Die Gespräche verstummten. Der Chef ließ seinen schweren Leib in den Bürostuhl am Kopfende des Tisches sacken, stellte eine türkisfarbene Schachtel auf den Tisch, klappte sie auf und schickte sich an, ein Zigarillo anzuzünden. Freese war schneller und zückte sein Feuerzeug. Stövenhagen fixierte die Flamme und strafte Freese mit Nichtbeachtung.
»Gut. Was haben wir?«, murmelte er mit freudlos verkniffenem Mund. Nur gute Freunde durften ihn Essjott nennen. Essjott Stövenhagen, der Schrecken der Mächtigen. Wenn er auf dem Bildschirm erschien, wurde sein vollständiger Name, Sven-Jörgen Stövenhagen, eingeblendet. Ein Mann Ende fünfzig, nicht dick, aber füllig, mit dichtem drahtigem Haar und einem ausdruckslosen Gesicht, das sich höchstens dann zu einer Maske der Verachtung verzog, wenn man Themenvorschläge an ihn herantrug oder ihm die Filmbeiträge zur Abnahme vorlegte. Entspannt oder gar lachend kannte ihn keiner hier, höchstens seine wenigen Kumpel aus der Skatrunde, RBS-Urgesteine wie er.
Stövenhagen blickte missmutig zu Britta Hensel hinüber, die vor sich die Blätter mit den Themen ausgebreitet hatte, die schon in Arbeit waren. Er mied den Augenkontakt mit seinen Mitarbeitern und verzichtete auf die üblichen Grußformeln. Nie sprach er seine Redakteure mit Namen an, vermied es, sich für Duzen oder Siezen zu entscheiden, indem er pauschalisierend Redakteure und Autoren mit »ihr« anredete. Dabei starrte er seinem Gegenüber aus kleinen grauen Augen stets auf die Schulter, statt ihm ins Gesicht zu blicken.
Britta Hensel, eine dunkelblonde schlanke Frau um die vierzig mit einem harten Zug um den Mund, war seit einem Jahr als Chefin vom Dienst für die Planung der Sendung »Im Visier« verantwortlich. Sie kam direkt vom Regionalfernsehen, hatte bei der Abendschau volontiert und moderiert und ließ sich nun gemeinsam mit Stövenhagen die Filme der Autoren vorführen. Die »Abnahme« war bei den freien Mitarbeitern gefürchtet, weil so gut wie jeder Beitrag nach Hensels und Stövenhagens Ansicht noch einmal umgeschnitten werden musste – für die Freien unbezahlte Mehrarbeit.
Britta Hensel referierte die Liste der Themen, an denen die Reporter zum Teil seit Wochen arbeiteten. Als sie zu der geplanten Reportage über die Autonomen am Potsdamer Platz kam, nickte sie einem fleischigen Mann im grauen Jackett zu, der scheinbar unbeteiligt mit halb geschlossenen Augen auf seine Unterlagen blickte.
»Wie weit sind wir mit der Besetzer-Geschichte?«, fragte Hensel.
Heiner C. Schmitt reagierte nicht sofort und blätterte betont ruhig in seinen Papieren. »Die Besetzer haben das Grundstück in Norbert-Kubat-Dreieck umbenannt«, brummte Schmitt nach einer Kunstpause in seine Unterlagen. Er hatte sich angewöhnt, die Worte zu dehnen, um seinen Vortrag durch Pausen interessanter zu machen. Die bubihaft in die Stirn gekämmten braunen Haare passten nicht zum überheblichen Gesichtsausdruck des Mannes, in dessen riesigem Schädel zu kleine Augen und ein breiter Strich von Mund saßen. »Kubat war ein Autonomer, der nach den Mai-Krawallen letztes Jahr festgenommen wurde und sich in der Haft erhängt hat«, referierte Schmitt. Die Runde hing an seinen Lippen. Schmitt führte aus, wie es im Zeltdorf am Potsdamer Platz aussah. Mehrere hundert Linke hatten sich dort verbarrikadiert, nachdem zwischen DDR und West-Berlin im März ein Gebietstausch vereinbart worden war. Die Besetzer hatten über Nacht Bauwagen auf das Gelände gekarrt, das nach wie vor zu Ost-Berlin gehörte, und sich ein Dorf aus Hütten, Zelten und Wagen gebaut. Die DDR-Grenzer sahen dem Treiben untätig zu. »Erst wenn das Grundstück am 1. Juli an West-Berlin fällt, ist mit der Erstürmung zu rechnen«, fuhr Schmitt fort. »Da sollten wir zwei Tage vorher dabei sein.«
Die Chefin vom Dienst nickte. »Also planen wir das als Reportage für Anfang Juli ein.«
Schmitt ließ sich in den Stuhl zurückfallen, faltete die Hände vor seiner Wampe und nickte knapp. Lucas beobachtete den schwammigen Mann, den sie im Sender ironisch »Profi-Checker« nannten. Schmitt verstand den Spitznamen allerdings als Kompliment. Er war nicht nur für sein hohes Selbstwertgefühl bekannt, sondern auch wegen seiner spezifischen Flirtmethoden berüchtigt. Auf Dienstreisen mit großem Drehteam, so ging der Flurfunk, hielt Schmitt stets im Hotelzimmer der hübschesten Praktikantin Besprechungen ab. Er nutzte die Situation, hieß es, um unbemerkt einige Tropfen seines Parfums auf dem Kopfkissen der Mitarbeiterin zu platzieren. Schmitt glaubte offenbar, dass das Mädchen ihm am nächsten Tag verfallen würde, wenn sein Duft über Nacht in ihr Unterbewusstsein gedrungen war. Über seine Erfolgsquote war nichts bekannt. Lucas stellte sich angewidert vor, wie der nackte Schmitt seinen aufgeschwemmten Körper auf eine zwanzig Jahre jüngere, schlanke Frau wälzte und dabei wie eine gestrandete Robbe japste.
»Im Visier« galt neben den Nachrichten als wichtigstes Schlachtschiff des Senders. Ein Magazin, das die Mächtigen zwar nicht fürchten, aber respektieren mussten. Die Sendung hatte in zwei Jahrzehnten viele Preise gewonnen und einige wichtige Enthüllungen gebracht, darunter auch Lucas Hermes’ Nordimex-Geschichte. Für die Story über den Hamburger Kaufmann und Konsul Hanns A. Schäfer, der dubiose Geschäfte mit der DDR machte und seine Einnahmen auf Konten in Liechtenstein und der Schweiz versteckte, hatte Lucas zunächst viel Anerkennung geerntet. Doch dann setzte Schäfer eine Maschinerie in Gang, die Lucas fast seine Existenz gekostet hätte, und diese Vernichtungskampagne nagte immer noch schwer an seinem Selbstbewusstsein. Selbst wenn er neue Indizien für die Verbrechen Schäfers in die Hände bekäme, würden der Sender und vor allem Stövenhagen sie aus Angst vor dem Geschäftsmann vermutlich nicht veröffentlichen. In der »Visier«-Redaktion war Lucas seit seiner Niederlage gerade noch geduldet. Seit Schäfer zurückgeschossen hatte, reagierten Stövenhagen und Hensel mit großem Misstrauen auf seine Themenvorschläge.
Jetzt war Gottlob Freese dran. Während er umständlich sein Thema vorstellte, grübelte Lucas über die Nachricht in der Boulevardzeitung. Eine Nachrichtensperre passte nicht zu einem Unglück. Also musste die Explosion einen kriminellen Hintergrund haben.
Freese berichtete von einer Reinigungsfirma, die erschreckend niedrige Löhne zahlte und die Ausschreibung für den Nachfolgeauftrag verlor, weil sie von einer anderen Firma unterboten wurde.
Stövenhagen grunzte unzufrieden. »Für wen putzt die Firma?«
»Das ist ja das Interessante«, antwortete Freese mit vor Eifer glühenden Wangen. »Die Firma putzt in den Museen in Dahlem. Also im Völkerkundemuseum.«
»Und die Museen haben jetzt eine Firma mit noch mieseren Löhnen genommen?« Stövenhagen fixierte Freeses Hemdkragen.
»Nicht nur das«, triumphierte der Jungredakteur. Sein ganzes Gesicht war inzwischen vor Aufregung gerötet. »Die billigere Firma, die den Zuschlag bekommen hat, hat genau die Putzkräfte eingestellt, die bei der Vorgängerfirma waren. Jetzt putzen sie wieder im Museum, werden aber noch schlechter bezahlt.«
»Klappt das für nächste Woche?«, wollte Britta Hensel wissen und blätterte in ihrem Themenplan.
Als Freeses Geschichte beschlossen war, hob Lucas die Hand. Hensel erteilte ihm mit einem kurzen Nicken das Wort.
»Ich würde mir gerne die Explosion in Kreuzberg näher ansehen«, begann Lucas zögernd.
»Ist das nicht eine reine Lokalgeschichte?«, quengelte Freese aus der anderen Ecke des Sitzungsraumes.
»Ich habe mit einer Quelle gesprochen.« Das war glatt gelogen. »Die Gasexplosion könnte vorgeschoben sein, um die Presse draußen zu halten. Ich habe Hinweise, dass es eine Bombe gewesen sein könnte. Vielleicht ein ausländerfeindlicher Anschlag.« Du pokerst hoch, sagte er zu sich selbst. Freese glotzte ihn erstaunt an und schwieg.
»Also, ich sehe die Geschichte noch nicht«, murmelte Stövenhagen und sah an Lucas vorbei. Seit der Nordimex-Sache behandelte er ihn wie Luft.
»Wir brauchen da eine Struktur«, belehrte ihn Britta Hensel. »Es ist nur dann eine Geschichte, wenn dahinter eine politische Gruppe steckt.« Sie sah Lucas streng an und linste dann Zustimmung heischend zu Stövenhagen hinüber.
»Haben wir irgendeinen Beweis für die These?«, fragte der und starrte auf das Blatt vor sich.
»Ich kann noch nichts über meine Quelle sagen«, log Lucas. »Es ist doch aber klar, dass ein Hauswart nicht an Gasleitungen rumfummelt. Das ist ein Fachmann, der bei Gasgeruch sofort den Klempner holen würde. In dem Haus hat die Zeitung Milliyet ein Büro, und die ist vielen ein Dorn im Auge – vor allem den Rechten.«
Stövenhagen grunzte zufrieden, klatschte mit der flachen Hand auf den Tisch und erhob sich. »Dann recherchiert das erst mal richtig.«
Britta Hensel notierte den Themenvorschlag auf ihrer Liste. Damit hatte Lucas zwar noch keine Aussicht auf ein Honorar, doch das Thema war immerhin als Recherche angenommen. Das ermöglichte ihm, im Sender zu telefonieren und das Archiv zu benutzen.
Beim Verlassen des Konferenzraumes versuchte Lucas, sich seinen Hass auf Stövenhagen nicht anmerken zu lassen, der dicht vor ihm lief. Nach der Nordimex-Enthüllung hatte das Münchner TV-Magazin »News« ein Überwachungsvideo veröffentlicht, das Lucas beim Diebstahl von Unterlagen in der Nordimex-Zentrale zeigte. Er hatte sich unter dem Vorwand, ein Interview mit dem Honorarkonsul über internationale Handelshemmnisse führen zu wollen, Zugang zur Firma verschafft. Während die Sekretärin in Schäfers Büro nachfragte, ob der Besucher auch wirklich angemeldet war, hielt er sich für einige Minuten allein im Zimmer auf. Nordimex zeigte ihn an, Lucas Hermes bestritt alles und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, die er selber begleichen musste. Auch wenn die so erbeuteten Unterlagen schließlich den Beweis für Schäfers illegale Geschäfte erbracht hatten, distanzierte sich die »Visier«-Redaktion von ihm.
Lucas blieb im Türrahmen stehen und betrachtete Stövenhagens Hinterkopf, der sich in Richtung Büro entfernte. Er dachte an den Kommentar des Redaktionsleiters zu der Nordimex-Enthüllung, in dem Stövenhagen die Recherchemethoden seines Reporters verurteilt hatte. Lucas kannte den Wortlaut noch immer fast auswendig.
»Auch Journalisten machen Fehler, und auch unsere Redaktion ist nicht gefeit gegen Irrtümer«, hatte der »Visier«-Chef doziert. »Unsere Methoden, Informationen zu gewinnen, dürfen niemals die Grenze zur Illegalität überschreiten. Wir entschuldigen uns für falsche Vorwürfe gegen Konsul Schäfer.«
Wenigstens hatte Britta Hensel Stövenhagen überzeugt, dass Lucas nach ein paar Monaten Pause wieder für die Redaktion arbeiten durfte. Seither fühlte er sich wie ein Aussätziger, um den die anderen einen weiten Bogen machten, wenn sie ihm auf den Fluren des Funkhauses begegneten. Die lange Untätigkeit hatte sein Konto rapide schrumpfen lassen. Und jetzt lebte er wie ein Hund in einem Lagerraum und musste bei denen um Aufträge betteln, die fast seine Existenz vernichtet hätten.
Lucas setzte sich im Freienzimmer in einen ausgeleierten Bürostuhl. Er musste telefonieren, zuallererst mit der Staatsanwaltschaft.
Eine Stunde später stand er vor dem Haus, das von der Explosion verwüstet worden war. Der Staatsanwalt hatte ihn am Telefon kalt abgewimmelt und auf den Pressesprecher verwiesen. Die Pressestelle kann jeder Trottel anrufen, dachte Lucas. Doch die Sekretärin des Leitenden Staatsanwaltes hatte sich an ihn erinnert und war ihm offenbar wohlgesonnen. Sie hatte ihm verklausuliert bestätigt, dass eine Bombe in Kreuzberg hochgegangen war und dass er mit seiner These eines Anschlags gegen Türken nicht unbedingt danebenlag.
Der Bürgersteig vor dem Haus in der Oranienstraße war mit einem weiß-roten Band abgesperrt. In der Tür stand ein Polizist und machte unmissverständlich klar, dass es keine Chance gab, hineinzugelangen. Die Treppenhauswände sahen verkohlt aus. Dort musste die Bombe hochgegangen sein. Die Fensterscheiben vom Erdgeschoss bis zum vierten Stock fehlten. Die Ladung war offenbar so groß gewesen, dass mehrere Stockwerke von der Explosion betroffen waren.
Lucas trat näher an die Absperrung heran, bis der Polizist sich in seine Richtung drehte und ihn feindselig anstarrte. Lucas kniff die Augen zusammen und studierte die Schilder an der Fassade. Unter der Redaktionstafel der Milliyet war ein weiteres Schild angebracht:
»Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge e.V. (4. Stock)«
Er notierte den genauen Namen der Beratungsstelle und die Telefonnummer. Ihm war klar, dass sich jetzt niemand unter der Nummer melden würde, doch im Vereinsregister könnte er die Verantwortlichen und ihre Privatadressen finden. Die Namen auf den kleinen Klingelschildern seitlich neben der Haustür konnte er aus der Distanz nicht entziffern.
Das Haus schien völlig unbelebt zu sein. Kein Bewohner war zu sehen, den er beim Betreten des Gebäudes in ein Gespräch hätte verwickeln können. Vermutlich waren alle Mieter wegen Einsturzgefahr evakuiert worden. Hier war im Moment nichts mehr herauszubekommen. Er ging zur Telefonzelle am Oranienplatz und wählte Klamms Nummer. Es war mal wieder an der Zeit, seine Kontakte zur Berliner Polizei aufzufrischen.
Kriminalhauptkommissar Ernst Klamm stimmte zu Lucas’ Erstaunen einem Treffen zu und klang erstaunlich jovial. Morgen am frühen Nachmittag, ja, das würde passen. Er komme zum altbewährten konspirativen Treffpunkt, scherzte er. Lucas legte auf und blieb einen Moment unschlüssig in der Telefonzelle stehen. Der Kommissar hielt ihn für einen gut verdienenden Journalisten, der es sich problemlos leisten konnte, einen Informanten zu Kaffee und Kuchen oder sogar zu einer warmen Mahlzeit einzuladen. Was, wenn Klamm auf die Idee käme, beim Treff auf seine Kosten einen Happen zu essen?
Lucas blickte gehetzt nach draußen. Niemand, der in die Telefonzelle wollte. Er sah auf die Uhr: kurz nach vier, die ideale Zeit für sein Vorhaben. Er klappte das in einer grauen Plastikverankerung befestigte Telefonbuch hoch und blätterte mit zitternden Fingern zum Buchstaben R vor. R klang irgendwie gut. Raupach, Reschke, Richter. Er hatte lange gezögert, diesen Schritt zu machen, doch jetzt sah er keine Chance mehr, anders zu Geld zu kommen.
Endlich ein Vorname, der passte: Hermine Richter, das schien eine ältere alleinstehende Frau zu sein. Lucas warf zwanzig Pfennig in den Metallschlitz und drehte die Wählscheibe. Es klingelte dreimal, viermal.
»Ja bitte?«
Lucas räusperte sich. »Weißt du, wer hier ist?« Er sprach mit heller, leicht kippender Stimme.
»Belästigen Sie mich nicht!« Die alte Dame hatte aufgelegt.
Mit zitternden Fingern und dem Gefühl leichter Übelkeit wühlte er sich zurück durch die dünnen Seiten des Telefonbuches.
Klöber, Kloos, Krawinkel (zu ungewöhnlich). Eleonore Krawczik, Bleibtreustraße 16. Lucas wählte und lauschte dem Klingeln.
»Krawczik?« »Hallo, ich bin’s!«, rief er mit gespielter Heiterkeit.
»Lukas?« Er zuckte zusammen. Unmöglich, dass sie ihn kannte.
»Ja, ich bin’s! Rate mal, wo ich stecke?«
»Bist du zurück aus Amerika? Das ist ja schön!«
»Ja«, hauchte er. Wie sollte er weitermachen? Ihm wurde immer flauer.
»Deine Mutter sagte, du kommst erst nächste Woche. Ist denn dort das Semester schon zu Ende?« Lukas war also Student. Er musste demnach der Enkel von Eleonore Krawczik sein oder der Großneffe.
»Alles fertig«, rief er in den Hörer. »Alle Prüfungen bestanden!«
»Dann weißt du ja, dass ich dir eine Belohnung versprochen habe. Wann kommst du?«
»Ich bin in Charlottenburg, kann hier aber nicht sofort weg. Kann ich einen Freund vorbeischicken?«
»Einen Freund? Dann sehe ich dich ja nicht!«
»Um die … Belohnung zu holen …« Lucas improvisierte. »Die könnte ich gerade gut gebrauchen, weißt du …« Er hatte sich eigentlich eine Geschichte über einen geplanten Autokauf zurechtgelegt. Ein Schnäppchen, für den seine Barschaft nicht ganz reichte. Jetzt musste er sich stattdessen auf die hoffentlich großzügige Belohnung von Oma Krawczik für das bestandene Semester ihres Enkels einlassen.
»Na gut, schick ihn vorbei« sagte die alte Dame mit hörbar enttäuschter Stimme. »Aber du musst auch kommen!«
»Gleich morgen!«, versprach er.
Das Haus in der Bleibtreustraße war ein eleganter, hell gestrichener Altbau, dessen Balkone mit girlandenartigem Stuck verziert waren. Lucas strich sich die Haare glatt und klingelte bei Krawczik im ersten Stock. Der Surrer ging. Die breite Treppe war mit einem weinroten Teppich beschlagen, der auf jeder Stufe von Messingstangen gehalten wurde. Frau Krawczik, eine elegante Achtzigjährige mit Perlenkette, stand bereits in der Tür.
»Müller«, verneigte sich Lucas noch auf der letzten Stufe. »Ich komme, um für Lukas das Geschenk abzuholen, wenn ich darf.« Er verzog das Gesicht zu einem höflichen Lächeln.
»Ich hoffe, Sie bringen es direkt zu Lukas!«
Sie hielt ein kleines Paket fest in beiden Händen. Das Geschenk schien wertvoll zu sein.
»Selbstverständlich«, sagte Lucas, sich abermals leicht verbeugend. »Sie können sich auf mich verlassen.«
Nach ein paar weiteren Höflichkeitsformeln verließ er gemessenen Schrittes das Haus, um auf der Straße sofort in Laufschritt zu verfallen, bis er an der Ecke Niebuhrstraße zum Stehen kam und hastig das Geschenkpapier aufriss.
Da Paket enthielt ein paar einfache Manschettenknöpfe und einen Umschlag, dem Lucas einen Zwanzigmarkschein entnahm. Sein Raubzug war ein Reinfall, die wohlhabende Frau Krawczik bestätigte das Gerücht, dass reiche Menschen zum Geiz neigten. Er brauchte erst einmal ein Bier.
Nach dem hastig geleerten Glas Schultheiss im Zwiebelfisch fiel ihm ein, dass es wohl besser wäre, ohne Alkoholfahne vor der Tür seines nächsten Opfers aufzutauchen. Er zahlte und steuerte den Kiosk am Savignyplatz an, um eine Packung Kaugummi zu erstehen. Die Furcht, von der rüstigen Frau Krawczik entdeckt zu werden, trieb ihn dann nach Norden, wo er in der Leibnizstraße erneut eine Telefonzelle ansteuerte.
Im Telefonbuch entdeckte er diesmal in der Zillestraße einen Namen, der aus dem frühen 20. Jahrhundert zu stammen schien: Käthe Burow. Das Telefon klingelte lange. Niemand war zu Hause. Lucas hängte ein, blätterte weit vor: Irmgard Schepenbeck, auch ganz in der Nähe. Am anderen Ende meldete sich eine zerbrechlich wirkende, leicht heisere Frauenstimme. Wieder ließ Lucas die alte Dame raten, wer wohl am Telefon sei.
»David, mein Lieblingsenkel, das ist ja eine Überraschung!«
Lucas trug Großmutter Irmgard seine finanziellen Nöte vor und bat um einen Zuschuss von ein paar hundert Mark zu einem Autokauf. Ein absolutes Schnäppchen, ein zehn Jahre alter Golf, tiptop in Schuss. Nein, leider könne er nicht selber vorbeikommen, der Papierkram, haha, er schicke aber einen absolut vertrauenswürdigen Freund, Thomas, vorbei, um das Geld zu holen. Die alte Dame akzeptierte zu seiner Verwunderung sofort.
»Dann schick den Thomas gleich mal her!«
Irmgard Schepenbeck wohnte im Erdgeschoss eines rußiggrauen Altbaus in der Krumme Straße nahe dem Karl-August-Platz. Als Lucas klingelte, öffnete sich ein Fenster. Die alte Dame hatte hinter der Gardine offenbar auf ihn gewartet.
»Sind Sie Thomas?«, fragte sie und lächelte ihn an. Lucas nickte und trat unter das Fenster. »Thomas und wie weiter?«
»Müller. Thomas Müller.«
»Und jetzt wollen Sie das Geld für meinen Enkel?«
»Wenn es keine Umstände macht …«
»Schämen Sie sich nicht, alte Leute zu beklauen?«, fragte Irmgard Schepenbeck mit kalter Stimme. Die Haustür öffnete sich, ein Polizist erschien.
Lucas rannte los. Er hetzte wie besinnungslos die Straße hoch, schlug einen Haken nach links in einen Innenhof, gelangte in die Sesenheimer, hinter sich die Rufe des Polizisten und Fetzen des Sprechfunkverkehrs. Irmgard Schepenbeck hatte ihn reingelegt. Er stürzte quer über die Straße, wieder in einen Hof, und sprang in einen offenen Müllcontainer voller blauer Plastiksäcke. Er schloss den Deckel über sich. Der Müll stank erbärmlich. Lucas glaubte, sein hechelnder Atem müsste ihn verraten, doch der Beamte blieb in der Hofeinfahrt stehen. Ein Krächzen des Sprechfunkgerätes, dann entfernten sich die Schritte.
Eine halbe Stunde lang wagte er sich nicht vom Fleck zu rühren, dann kroch er aus seinem Versteck und schleppte sich stinkend zum Bahnhof Zoo. Er duschte ausgiebig und zog die nach Müll riechende Kleidung nur widerwillig wieder an. Er musste bis zum Abend auf einer Bank am Mierendorffplatz ausharren, bis er in sein Kellerversteck in der Lise-Meitner-Straße zurückkehren konnte.
Mittwoch, 25. Mai 1988
Den nächsten Tag begann Lucas mit einer Brezel und einem Kaffee beim Stehbäcker an der Kaiserin-Augusta-Allee. In der Telefonzelle fiel seine Wahl diesmal auf Hedwig Günzel.
»Ja bitte?«
Lucas glaubte, sein Herz schlagen zu hören. »Rate mal, wer hier ist!« Wieder der eingeübte Spruch, diesmal mit sicherer Stimme und munterem Klang.
»Moritz, bist du das?«, fragte die alte Frau misstrauisch.
War Moritz der Enkel? »Ja, Oma, ich bin ganz in der Nähe.«
Stille. Die alte Dame schien zu überlegen. »Du klingst so merkwürdig.«
»Ich bin erkältet«, sagte er hastig. »Wie geht es dir?«
»Ach, du weißt ja, der Zucker und die Beine.«
»Du musst dich eben schonen, Oma.« Er kam langsam in Fahrt. Jetzt musste er zum Angriff übergehen. »Oma, ich habe eine kleine Bitte. Ich bin bei einem Gebrauchtwagenhändler und der hat einen fantastischen gebrauchten Golf …«
»Hast du nicht einen Wagen?«
Lucas kam ins Straucheln. »Nicht mehr«, log er. Er hatte noch keine Idee, was mit dem alten Wagen sein sollte. »Aber der Golf ist sehr günstig, nur dreitausend Mark.«
Es war still in der Leitung. Hatte er zu schnell das Geldthema angeschnitten? Lucas merkte, wie er zu schwitzen begann. »Das Dumme ist nur«, fuhr er fort und räusperte sich noch einmal, »ich habe nur tausend Mark dabei, das reicht denen nicht.« Er merkte, wie er wieder kühner wurde. Was hatte er schon zu verlieren?
»Und jetzt brauchst du Geld?«, fragte die alte Dame.
»Nicht die ganze Summe, ich muss nur sicherstellen, dass der Händler mir den Wagen reserviert. Ich brauche eine Anzahlung, nur für ein paar Stunden, bis ich das restliche Geld von zu Hause holen kann.«
»Und du bist in der Nähe?«
»Ich bin in Charlottenburg.«
»Dann komm doch vorbei und ich sehe mal, was ich da habe.«
»Das würdest du tun, Oma?« Lucas legte so etwas wie ein freudiges Glucksen in seine Stimme.
»Du bist doch mein einziger Enkel.«
Er musste jetzt ganz vorsichtig sein. »Wie viel hast du denn da?«
»Sicher nicht tausend, aber achthundert bestimmt.«
Achthundert Mark! Der Schweiß lief ihm den Hals hinunter. »Einen Moment«, sprach er in die Muschel, dann hielt er den Hörer weg. »Sind Tausendachthundert als Anzahlung in Ordnung?« Er wartete, als ob der Gebrauchtwagenhändler ihm gerade antwortete, und nahm den Hörer wieder an den Mund. »Super, es klappt. Und nachher machen wir eine Spritztour im neuen Golf, Oma!«
»Na, dann komm her, mein Junge!«
Lucas schluckte. »Ich muss hier den Vertrag machen. Ich kann dir nur einen Bekannten vorbeischicken, den Thomas. Ist das in Ordnung?«
»Den kenne ich nicht«, erwiderte Frau Günzel. Sie klang wieder kühler. »Ist der denn zuverlässig?«
»Ein seriöser Mann, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Ich schick ihn dir gleich vorbei.«
Als eine Viertelstunde später der Türöffner an der Leibnizstraße surrte, merkte Lucas, dass sein Hemd durchgeschwitzt war und seine Hände zitterten. Er fühlte sich elend und musste an den schmuddeligen Privatdetektiv Harry Angel aus dem Film »Angel Heart« denken. Ein heruntergekommener Fahnder auf dem Weg in die Hölle, der nicht weiß, dass er schon lange in den Händen des Teufels ist.
Frau Günzel wohnte im zweiten Stock. Das Treppenhaus des Fünfzigerjahrebaus roch frisch geputzt. Lucas klingelte. Hinter der Tür sah jemand durch den Spion.
»Ich bin es, Thomas, der Freund von Moritz«, rief Lucas. Ein Riegel klackte, die Tür öffnete sich einen Spalt und das freundliche Gesicht einer kleinen weißhaarigen Frau tauchte auf. Eine Sicherungskette spannte sich zwischen Tür und Rahmen.
»Ich kann Sie leider nicht hereinlassen, heutzutage weiß man ja nie!«
Die alte Dame mit der goldenen Metallbrille musste um die achtzig sein. Sie tat ihm fürchterlich leid. Lucas setzte ein schüchternes Lächeln auf. »Sie machen Ihrem Enkel eine große Freude. Nachher will er Sie mit dem neuen Wagen besuchen.«
»Wenn er mal nur seine Ausbildung ordentlich zu Ende bringt«, sagte Frau Günzel mit besorgter Stimme und reichte ihm einen Briefumschlag. »Ich habe ihn zugeklebt, damit nichts wegkommt.«
Lucas war zum Heulen zumute.
Mit langen Schritten hastete er von der Otto-Suhr-Allee zur U-Bahn am Ernst-Reuter-Platz, der früher »Knie« hieß. Das Rondell war eine karge Rasenfläche mit einem flachen Wasserbassin, die weiträumig von grauen Hochhäusern umstellt war. Das kantige Telefunkenhaus mit über zwanzig Stockwerken beherrschte den Platz und konkurrierte mit dem am Zoo gelegenen Europacenter um den Titel des höchsten Bürogebäudes im Westteil der geteilten Stadt. Immer wenn Lucas die aufgeräumten, neu bebauten Plätze überquerte oder an den klar gegliederten Häuserreihen des Berliner Aufbau-Programms der Fünfzigerjahre entlangging, kamen ihm düstere Gedanken. Er musste an die Erzählungen seiner Mutter und der Großeltern über die Flächenbombardements denken, an die Geschichten vom ungleichen Häuserkampf zwischen der Roten Armee und den schlecht bewaffneten Greisen des Volkssturms.
In diese Kriegshölle war er hineingeboren worden. Gezeugt im Januar 1943 während des Fronturlaubs des Soldaten Friedrich Hermes. Die Erinnerung an den Bombenkeller des Elternhauses in Charlottenburg, an die Nächte im Zoobunker unter dem Beben der wummernden Flak war wie ausgelöscht, so sehr er sich auch anstrengte. Alle Versuche, sich als Säugling und Kleinkind auf dem Schoß der Mutter im Schutzraum vorzustellen, blieben vergeblich. Die Erzählungen der Mutter über das Kriegsende in Berlin waren so lebendig, dass er sich das alles vorstellen konnte, doch es gelang ihm nie, die Bilder von brennenden Häusern und unter den Ruinen Verschütteten mit seinen eigenen Erinnerungen zu verknüpfen. Die Geschichten von der Endphase des Krieges in Berlin waren wie Erzählungen aus einem fernen Land. Und dennoch trug er eine diffuse Erinnerung an den Krieg in sich. Kein Bild, aber die Ahnung eines stechend scharfen Geruchs und ein Gefühl der Schwere, das vom Magen ausging.
Zum Glück hatte Ahmet Altün Zeit für ihn. An ein Betreten der Milliyet-Redaktion sei nicht zu denken, hatte der Redakteur Lucas am Telefon erklärt. Die Treppe sei einsturzgefährdet und der Abriss des Hauses drohe – schlecht für die Redaktion, die bislang für eine lächerliche Miete in dem baufälligen Gebäude in der Oranienstraße untergekommen war. Als Treffpunkt machten sie eine türkische Teestube in der Oranienstraße aus.
»Hast du eine Ahnung, ob ihr gemeint wart oder die Beratungsstelle?«
Altün trank seinen Tee und blickte zum Haus schräg gegenüber. Noch immer stand sich dort ein Polizist die Beine in den Bauch. Er zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder Lucas zu.
»Die Polizei hat uns völlig im Unklaren gelassen, nicht einmal die Bombe bestätigt. Die reden immer nur von einer Detonation.«
»Könnte denn jemand euch auf dem Kieker haben?«
»Schon möglich. Du weißt ja, vor neun Jahren wurde unser Chefredakteur Abdi Ipekci von Ali Agca ermordet. Also, wir haben schon mächtige Feinde.«
»Der Ali Agca?«
»Genau, der Papst-Attentäter. Erst hat der Scheißkerl Abdi Ipekci erschossen, dann verhalfen ihm die Militärs zur Flucht aus dem Knast, und dann konnte er in Ruhe das Attentat auf den Papst durchführen.«
»Du meinst, die Grauen Wölfe könnten hier in Berlin einen Anschlag auf euch verübt haben?«
»Kann sein, ist aber eigentlich nicht deren Handschrift. Die lieben es, martialische Attentate zu verüben, also Mann gegen Mann, mit der Knarre in der Hand. Die sehen sich als Soldaten und nicht als feige Attentäter.«
»Gab es denn schon Anschläge von Grauen Wölfen in Berlin?«
»Vor vier Jahren, ja. Da ist ein Mann einfach in eine Beratungsstelle für misshandelte Frauen gerannt und hat eine junge Frau erschossen und eine Jurastudentin lebensgefährlich verletzt.«
Galt der Anschlag also doch der Beratungsstelle? Lucas löcherte seinen Bekannten mit Detailfragen. Altün schilderte die Situation, beschrieb eindringlich den Knall und wie plötzlich die Wände gewackelt hatten. Wie bei einem Erdbeben, nur viel lauter sei es gewesen. Nein, ihm sei niemand aufgefallen, der um das Haus herumgeschlichen war.
»Drohbriefe gab es auch schon eine Weile nicht mehr.«
»Bekommt ihr die sonst öfter?«
»Immer wieder, besonders nach Artikeln über die Armenier oder Kurden.«
Sie vereinbarten, bald zu telefonieren. Bei der Zeugenvernehmung wollte Altün versuchen, möglichst viel über die Ermittlungen der Polizei in Erfahrung zu bringen, und Lucas Bericht erstatten. Er wusste, dass der Fernsehkollege unter dem Druck stand, mehr als einen reinen Hintergrundbericht über die Bombe bringen zu müssen. Natürlich würde er ihm als Interviewpartner zur Verfügung stehen.
***
Als die Dampflok das Entkoppelungsgleis erreicht, trennt er sie mit einem Knopfdruck vom D-Zug. Er lässt die Null-Drei vorziehen, schaltet die Weiche um, dreht den Trafoschalter nach links, bis das Relais surrend auf Rückwärtsfahrt umschaltet. Langsam rollt die Lok, den Tender voran, auf das Nebengleis. Das regelmäßige Brummen der Eisenbahn beruhigt ihn. Als der Hausmeister ihn im Treppenhaus überrascht hat, war er viel zu fahrig, hat sich das Paket einfach abnehmen lassen. Eine Schwäche, an der er noch arbeiten muss. Zum Glück hat alles doch noch geklappt. Er stellt sich die entsetzten Gesichter der schnauzbärtigen Männer und ihrer mit Kopftüchern und missfarbenen Gewändern verhüllten Weiber vor. Wie sagt man so schön: Den Überlebenden bot sich ein Bild des Grauens.
Er atmet ruhig durch, fährt sich mit der Hand über den Schädel und lächelt. Die Bombe hat funktioniert, auch der neue Sprengsatz, der fast fertig auf der Werkbank steht, wird funktionieren. Er muss vorsichtig bei jedem Handgriff sein. Behutsam befestigt er ein Kabel. Ein Schauder läuft durch seinen Körper, wenn er daran denkt, dass er einst in den Geschichtsbüchern stehen wird, neben den anderen Kriegern, die ihr Leben für die große Sache eingesetzt haben, für einen anderen, mächtigeren Staat.
Mittwoch, 25. Mai 1988
»Name und Adresse?« Der Grenzbeamte kniff die Augen zusammen und fixierte den aufgeklappten Reisepass in seinen Händen.
»Anna Rademacher, Goebelstraße 11«, sagte sie betont gelangweilt. Ihre Füße schmerzten. Eine blöde Idee, in hochhackigen Schuhen nach Ost-Berlin zu reisen. Eine geschlagene Stunde hatte sie in der Schlange vor dem Einreiseschalter am Bahnhof Friedrichstraße gewartet. Einzeln musste jeder Einreisende durch eine Tür in einen länglichen Container eintreten. Die Kabine war vollständig mit Holzimitat ausgekleidet und der Länge nach durch eine Wand mit einer Glasscheibe geteilt. Hinter dem Glas saß ein DDR-Grenzer, der die Pässe und Reisedokumente akribisch kontrollierte. Der junge Mann, dessen dunkelgrüne Uniform so gar nicht zu seiner Vokuhila-Frisur passte, hob den Kopf und blickte sie schweigend mit ausdruckslosem Gesicht an. »1000 Berlin 13«, fügte sie gedehnt hinzu.
»1000 Westberlin 13«, korrigierte der Beamte mit tonloser Stimme. Er starrte erneut in den Pass und verglich minutenlang ihr Foto, auf dem sie die Haare schwarz gefärbt hatte und eine struppig-punkige Strähnenfrisur trug, mit der jungen Frau mit langem, braunem Haar, die vor ihm stand. Er verglich die schwarz umrandeten Augen des Schwarz-Weiß- Bildes mit den strahlend grünen Augen der Frau vor ihm, die ihm, kaum geschminkt, viel freundlicher erschienen. Die meisten der Ringe, die sich auf dem Foto den ganzen Ohr- bogen hochzogen, waren verschwunden und durch ein großes Paar Kreolen ersetzt worden. Er blätterte auf die Seiten vor, auf denen die Visa fremder Länder eingestempelt waren. Dorthin würde der wohl auch gerne mal reisen, ging es Anna durch den Kopf.
Der Grenzer hielt den Pass unter den Tresen, wo er ihren Blicken entzogen war, sie hörte ein Surren wie von einem Fotokopierer, Stempelgeräusche und das Kratzen eines Kugelschreibers auf Papier. Dann zog er den zugeklappten Pass wieder hervor und legte ihn zusammen mit der gelblichen Ausreisekarte und dem Visum auf den Tresen. »Einen schönen Aufenthalt in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik!«
Sie nahm die Papiere mit kurzem Kopfnicken an sich. Als die Tür surrte, drückte sie sie auf und trat aus dem Kontrollgebäude hinaus in den östlichen Teil des Bahnhofs. An der Zollkontrolle wurde sie zu ihrem Erstaunen durchgewinkt und ging durch ein Labyrinth von Gängen auf den Ausgang zu.
An der Georgenstraße vor dem Bahnhof schlug ihr der Zweitaktmief der Trabis und Wartburgs entgegen. Die Luft lag wie graubrauner Nebel zwischen den Häusern. Sie ging ein paar Schritte, vorbei an einer altertümlichen Telefonzelle, und erreichte die Friedrichstraße. Den geschwungenen Schriftzug des Kabaretts Distel auf der gegenüberliegenden Seite sah sie wie durch einen Schleier. Anna Rademacher suchte ein Taxi. Am Stand neben dem Bahnhof war kein Wagen zu sehen. Sie blickte sich um und entdeckte auf der Weidendammer Brücke einen grauen Wolga mit beleuchtetem Taxischild, der langsam näherkam. Anna hob den Arm, doch der Fahrer reagierte nicht und fuhr einfach weiter, obwohl er keine Fahrgäste hatte.
West-Berlin war nur wenige Meter entfernt, doch hier klang und roch alles anders. Sie fühlte sich wie auf einer Zeitreise. Der Bahnhof war eine Schleuse, durch die sie in ein anderes Jahrzehnt gespült worden war. Das süßliche Aroma von Braunkohle, das Kreischen der verblichen gelblichen Straßenbahnen und das Nähmaschinenrattern der schwächlich motorisierten Autos waren fremd und doch irgendwie vertraut, erinnerten sie an die Klänge und Gerüche ihrer Kindheit und an die Besuche im Osten in den Sechzigerjahren.