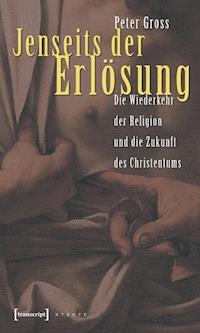Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Peter Gross legt einen neuen Text vor, in dem er in essayistischer Form über die Trauer, den Tod und das Weiterleben nach dem Verlust eines geliebten Menschen nachdenkt. Eine bewegende Meditation über die letzten Dinge, die gekonnt zwischen wissenschaftlicher Analyse und autobiografischen Elementen changiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Gross
Nachdenken über die letzten Dinge
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Henry Olden – shutterstock
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN (E-Book) 978-3-451-81216-3
ISBN (Print) 978-3-451-60031-9
Inhalt
Treibgut
Rodins Pose
Doppelwelt
Groll
Essplätze
Letzte Dinge
Conchita
Eiland
Quellen
Über den Autor
Treibgut
Wie macht man eine Hafeneinfahrt sicher? Indem man sie von Treibgut befreit. Treibgut werden Gegenstände genannt, die im Meer und in Binnengewässern aufgrund ihrer Beschaffenheit weder sinken noch sich zersetzen, sondern selbst bei heftig bewegter See und noch nach langer Zeit an der Oberfläche oder knapp unter ihr verbleiben. Vieles an Treibgut ist kleinteiliges Geschwemmsel und unerheblich. Oder komisch. Wie die zehntausend Plastikenten, die nach Auskunft des Lexikons vor bald dreißig Jahren von einem Frachter im Atlantik über Bord gingen und seither vergnügt auf den Weltmeeren schwimmen.
Treibgüter wie Wrackreste können für die Schifffahrt allerdings eine erhebliche Gefahr darstellen und werden deshalb an Brücken und Hafeneinfahrten mit einem Rechen gestoppt, wenn möglich entfernt oder anderweitig unschädlich gemacht. Die meisten Ausfälle bei der Vendée Globe, der gerade stattfindenden achten Auflage der Nonstop-Regatta der Einhandsegler um die Welt, kommen durch Kollision mit ungesichertem Treibgut zustande.
Existiert Treibgut nicht auch in unserem Bewusstsein? Sitzt Treibgut nicht auch in uns? Verborgene Altlasten? Die im Bewusstseinsstrom treiben und eine zwar latente, aber gleichwohl erhebliche Gefahr für unsere Seele darstellen? Traumata, wie sie die Psychologie nennt. Also schmerzliche Erinnerungen an Personen, Episoden und Ereignisse, die sich einfach nicht beseitigen lassen? Gewiss gibt es auch freundliches und erfreuendes Treibgut. Wiederkehrende Gedanken an frohe Tage. An bewegte Nächte. An Erfolge und Feiern. An die große Liebe. Leidvolle Augenblicke und schmerzliche Ereignisse sind aber, jedenfalls bei mir, in der Überzahl und gefahrdrohend.
Einer Mitteilung der russischen Ärztekammer zufolge hat ein gewisser Wladimir Barkow dreiundvierzig Jahre seines Lebens mit einem unsichtbaren Bruder in seiner Brust gelebt, ohne dass er es wusste. Er klagte nur zeitlebens über Atemnot beim Laufen. Nach dem Tod Barkows fanden die Ärzte bei der Autopsie den verkümmerten, schuppenartig verhornten Körper eines Zwillings von Vladimir, der sich im vorgeburtlichen Stadium in seine Brust eingenistet hatte und sich von Körpersekreten ernährte. Der tote Körper, mehr als drei Kilogramm schwer, den der Verstorbene über vierzig Jahre lang in sich trug, lastete auf Barkows Herz und Lunge und erdrosselte schließlich, trotz des nur mehr vegetativen Zustandes, seinen Wirt. Mit der Tötung seines Wirtes tötete er sich selber.
Tragen wir nicht alle solche unliebsamen Gefährten in uns? Schatten, die unsichtbar mit uns wandern? Die uns plagen, ohne dass wir den Grund kennen? Die in uns wohnen und Atemnot hervorrufen? Und uns zur Verzweiflung treiben? Gar umbringen? Treibgut, das niemals verschwindet und das wir einfach nicht loswerden? Und ist nicht der Groll ein solcher Geselle? Der immer wieder aufkommt und sich nicht unter Kontrolle bringen lässt?
Gäste kommen und gehen. Fremde kommen und bleiben. Der Groll ist ein sich festsetzender Fremder. Vielerlei Worte lassen sich für ihn finden: Zorn, Hass, Neid oder Bitternis sind begriffliche Versuche, dieses so selten benannte Gefühl einzufangen. Aber Groll ist weder Zorn noch Hass. Es handelt sich vielmehr um eine unwegsame, schlecht erschlossene und sorgfältig verdrängte Region des Daseins. Der biblische Zorn ist Gegenstand vieler Abhandlungen. Gott darf zornig sein. Ein mit Groll erfüllter Gott ist in Anbetracht seiner unendlichen Güte hingegen undenkbar, auch wenn seine Anhänger jene hassen dürfen, die ihn, ihren Herrn, hassen. So wenig sich Gott, der grandiose Unschuldige und Creator, schämt ob seiner Taten.
Ist von Groll die Rede, zieht sich Gott wohlweislich zurück, auch wenn der Mensch sein Geschöpf ist. Er kann zum Groll nichts sagen, denn er empfindet keinen Groll. Wie soll er auch, er ist allmächtig und allgütig. Er lässt die Menschlein in ihrem Groll allein. Aber er beobachtet sie. Er verfügt über eine riesenhafte Beobachtungsanlage. Gebietet über ein Heer von Spähern. Ein Panoptikum sondergleichen. Orwell kann zusammenpacken.
Eigentlich ist es etwas Schönes, wenn jemand zu einem schaut. Überhaupt schaut. Gott hat die Augen überall. Er führt Buch. Es lässt keine schlecht ausgeleuchteten Winkel zu. Gott betrachtet die Menschlein, wie er Abraham beobachtet hat, der auf sein Geheiß den einzigen Sohn Isaak töten sollte. Des Teufels Macht erwacht. The Devil in uns streckt seine Glieder und erhebt sich. Braun-schwärzlich die Hülle, die nun das Herz umfängt. Sterbenstraurig die Wege, die sich auftun, und schmählich die Gefühle, die sich in den Katakomben der Seele entfalten. Man schämt sich, diese offenzulegen. Der Gefühle gibt es viele. Einige verbergen sich im Dunkeln. Shakespeare, dessen vierhundertster Todestag wir gerade feiern, brachte, liest man, die tiefsten Regungen des Herzens auf die Bühne. Lodernder Hass. Strafender Zorn. Unendliche Liebe.
Gerade der Begriff Groll war ihm indes fremd. Das hat seinen einsehbaren Grund. Groll entzieht sich in einer gnädigen Weise einer Offenlegung. Während Trauer ermöglicht, sich gehen und die Tränen laufen zu lassen, und es ausgesuchte Anlässe wie Beerdigungen dafür gibt, will Groll verborgen bleiben. Denn es handelt sich um ein Kapitel, das neben Groll auch Rachegefühle, aufbrechenden Zorn, Wünsche nach Vergeltung und, nicht selten, Todeswünsche umfasst. Der Weg nach oben, gesäumt von Liebe und Trauer, der Weg nach unten, in die Katakomben des Gemüts, steinig und mit Verbitterung gepflastert. Ein Danaergeschenk, aber nicht in der Gestalt eines riesenhaften trojanischen Pferdes, sondern als gefahrdrohender, sich im Innenleben ausbreitender Infekt.
Soll man über diese Kehrseite des Schmerzes und der Trauer überhaupt sprechen? Wer seine Schlechtigkeit nach außen wendet, erringt keinen Ruhm, sondern Verachtung und Abscheu ob solcher Armseligkeit und gleichzeitiger Selbstbezichtigung. Eifersucht und Neid, diese Verwandten des Grolls, sind unsoziale Gefühle, sind peinlich und haben einen pathologischen Charakter. Sie gelten nämlich ausgerechnet jenen, die in Glück und Frieden leben, denen niemand weggestorben ist und denen es besser zu gehen scheint als einem selber. Das Wörtchen Groll ist übrigens zu schwach, um das Gemeinte zu beschreiben. Es handelt sich um Dunkles und Verheimlichtes. Seine Domestizierung ist weit fortgeschritten. Was einem in dieser Hinsicht widerfahren ist, wird unterdrückt.
Erfrischendes und Schönes findet sich nämlich wenig darunter. So gerne wir solches erinnern würden. Glück eignet sich schlecht als Treibgut. Glück ist ein Faserland, eingebettet in Sprüche. Glück entsteht im Unglück. Nähme das Glück kein Ende – es wäre kein Glück. Glück zerspringt wie eine Seifenblase. Glück ist sprunghaft. Glück ist flüchtig. Es fügt sich den Wünschen nicht. Kurz: Schönes verschwindet eher, während Bitteres bleibt. Darum enden so viele Menschenleben untröstlich. Darum wollen so viele Menschen vergessen. Darum ist Alzheimer für nicht wenige Menschen eine Therapie. Groll lässt sich auch nicht einfach negieren. Er ist die Auffangstation für böse Gedanken. Und hat noch einen anderen Sinn. Denn Groll treibt uns an. Das Abwesende ist wichtiger als das Anwesende. Die Suprematie des Verborgenen ist doch die Grundlage jeder Religion und jeder Psychotherapie. Wer glücklich und satt ist, bleibt im Glücksbad liegen.
In dieser Sichtweise erscheint die persönliche Geschichte wie auch die Weltgeschichte überhaupt als eine Geschichte des Grolls. Sie begleitet den Menschen und verfolgt ihn, wo immer er sich befindet. Lange Wanderungen liegen hinter uns. Kontinente haben sich geteilt, Meere sind entstanden. Die ersten Lebewesen erscheinen. Menschen wollen sich heimisch machen. Sie erleben den Mangel, grollen und versuchen mit endemischer Energie, die Kluft zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit zu schließen. Denn die Welt ist ein Tal der Tränen. Im krassen Unterschied zum häuslichen Fotoalbum oder den eigenhändig fertiggestellten digitalen Bildergalerien, in denen gemeinhin nur die Glücksmomente festgehalten sind. Und uns Seite für Seite fröhliche Menschen entgegenlachen, während die Dunkelkammern ihrer Existenz verborgen bleiben. »Hab Sonne im Herzen« – gerade trägt mir das Netz diese Mail zu. Die Sonne, wo lacht sie, pausbäckig wie auf Kinderzeichnungen? Wo erhellt sie die Dunkelkammer unserer Sorgen und Nöte, unserer Niedrigkeit?
Oder hat meine Erinnerung möglicherweise eine Schlagseite? Sind diese Einlassungen vielleicht Ausdruck einer ganz persönlichen Idiosynkrasie? Bin ich eine unzufriedene Natur? Ein Misanthrop? Egal, ich nehme die Arbeit auf. Ich will alles, was mir in diesem Tag durch den Kopf geht, aufschreiben und so vielleicht entsorgen. Aber es heißt aufgepasst! Manchmal wirft man etwas weg und vermisst es nachher schmerzlich. Denn schmerzliches seelisches Treibgut ist nicht nur eine Gefährdung des seelischen Haushalts. Sondern auch ein Treiber. Vielleicht ist die Welt insgesamt eine Anhäufung von Treibgut, das ein Weltenstrom angespült hat und das nun in Geschichtsbüchern, in Bildfolgen im Internet und in unseren Köpfen sein Dasein fristet?
Nach Köpfen gezählt nehmen die Speicher täglich um fast dreihunderttausend knöcherne Festplatten zu. Rechen für Treibholz. Ein kolossales, globales, weltumspannendes und täglich wachsendes Brockiland, ein riesiger Second-Hand-Laden. So könnte man die Situationsanalyse betiteln. Indem wir uns, Flüchtlinge auf schwankenden Schlauchbooten mitten im Meer, von Erlebniswellen und Gedankenschaumkronen fernzuhalten versuchen. Man wird winzig klein bei dieser Vorstellung. Sind wir, die Spezies Mensch, eventuell selbst Treibgut der Evolution: sieben Milliarden thalassische, dem Meer entronnene Existenzen, von denen der Großteil unerkannt sein Dasein fristet, während einige wenige, immer wiederkehrend, bleiben und ins Mausoleum der Geschichte wandern?
Was immer sich für eine Phänomenologie des Treibguts anbietet – Treibgut lässt sich nicht einfach hervorlocken und heben. Manchmal, wie hinsichtlich des Grolls, ist die Bergungsaktion schmerzhaft, manchmal will dieses wie der Zorn einfach ans Tageslicht, manchmal will es sich mit allen Mitteln verbergen, und manchmal sucht es, wie der Schmerz, unsere Nähe. Das Aufschreiben ist kein heiteres Unterfangen, wie Haruki Murakami (2016) es lobt. Ist Treibgut eventuell eine Ansammlung von letzten Dingen? Das zu behaupten wäre übertrieben und, angesichts der Bedeutung dieses Begriffes, ein zu großes Wort.
Denn unter letzten Dingen versteht man in biblischer Sicht Ereignisse, die am Ende der Zeit über die Welt in einer festgeschriebenen Reihenfolge hereinbrechen: ein metaphysischer Fahrplan. Mit der Rede von letzten Dingen hat die Theologie versucht, eine Ordnung in die sterbensschweren Tage und Nächte der Menschenkinder zu bringen: Tod und Auferstehung, Gericht, Himmel und Hölle. Eine riesengroße Erzählung gegenüber dem Geschwemmsel, das ich zu bieten habe. Die sieben Plagen, die apokalyptischen Reiter. Die Öffnung der Bücher. Der Richterspruch Gottes. Die pompösen, in der Offenbarung des Evangelisten Johannes genannten Ereignisse haben indes in der Moderne ihre Kraft verloren. Wie die Zweiweltenlehre des Christentums, der Glaube nämlich, dass es hinter oder über dieser Welt, in der wir leben, noch eine zweite, unser Dasein letztlich bestimmende transzendente Welt gebe.
Die christlichen Symbole sind nach zwei Jahrtausenden der Mission versunken. Sie tauchen manchmal, ohne Bezug auf das letzte Buch des Neuen Testamentes, unvermittelt im Bewusstsein auf, kurzzeitige weltliche Epiphanien, die dann erscheinen, wenn Welttheatervorhänge geschwind geöffnet und schnell wieder zugezogen werden. Die Christenwelt ist, wie es Karl Rahner, der katholische Theologe genannt hat, entapokalyptisiert. Die Vorhänge zur jenseitigen Überwelt bleiben geschlossen. Es zirkulieren die vorletzten Dinge. Die Symbolik der letzten Dinge ist aber weiterhin präsent. Die Wirklichkeit, in der wir leben, ist redivinisiert. Das Himmelreich ist auf die Erde herabgestürzt und dort zersprungen. Überall noch Bruchstücke. Kreuze, an denen der Heiland hängt.
An die Stelle weltendzeitlicher Vorsehung tritt eine Handvoll ganz persönlicher trivialer Befürchtungen und Ängste. Vorhang auf! Was macht meine Achillessehne, was mein fünffacher Rippenbruch, was machen Myriam und Lukas Jodokus, was Mara oder Nora oder Tristan, was macht Brigitta, was machen Helga, Elisabeth und Cécile? Glücksmomente und beseligende Ereignisse verschwinden im Nu, sobald man sie zu erinnern sucht. Während die plagenden Gedanken umso heftiger zurückkommen, je fester man sie verwünscht und verdrängt. Wie die Schlaflosigkeit. Unser Kopf ist ein überfließendes Reservoir, ein knöchernes Archiv, eine Aufzeichnungsmaschine. Sie verfügt über sieben Eingänge. Für sieben Plagen und sieben Freuden. Unser Schädel birgt nicht siebentausend ungelesene Mails, sondern sieben Millionen. Sie befinden sich, bahntechnisch gesprochen, im Wartesaal. Man betrachtet sinnierend, manchmal mit Erstaunen, manchmal mit Abscheu, was hängenbleibt. Und produziert eine Welt aus Treibgut. Eine Treibgutwelt über der Welt. Was bleibt? Was bleibt übrig?
Es wird Abend. Ich blicke auf einen wie in bengalisches Licht getauchten, von der Abendsonne blutrot angestrahlten Säntis. Ich denke an St. Peterszell und das blauschwarze Neckertal. Das ich gerade von der Wasserfluh herkommend durchfahren habe. Und an Nassen und Magdenau, wo ich die Liebe kennenlernte. An den blassen, jetzt in den entlaubten Bäumen und Sträuchern hell leuchtenden, lebensgroßen Heiland im Magdenauer Kastanienhain. Geheimnisvolle Landstriche. Verwunschene Orte. Den Theatersaal des Restaurants Rössli. Wo ich als Seminarist im dortigen Laientheater die Rolle eines Daimyos (Fürsten) von Nagasaki zu spielen hatte. Am Gürtel eine enorme Schwertscheide samt hölzernem Schwert. In der linken Hand eine unbeschriebene Schriftrolle aus Pergament. Die ich jetzt beschreibe.
Rodins Pose
Ich sitze auf einer Bank in unmittelbarer Nähe des Grabes meiner verstorbenen Frau auf dem Ostfriedhof und sehe zu, wie man auf meinen Wunsch hin das Grab – eigentlich muss ich sagen: unser Grab – mit einem schweren, vor Jahrzehnten in einem Baugeschäft erstandenen und viele Jahre auf dem Westbalkon unserer Wohnung stehenden Bronzeengel schmückt. Er wird mit seinem Gewicht von mehr als einem halben Zentner nur mit Mühe zu entwenden sein, wie das gemäß Zeitungsberichten in anderen Ländern, was antike Grabengel betrifft, immer wieder vorkommt. Dem Engel zu Füßen liegt ein bläulich-matter Sandsteinblock, auf dem der Name meiner Frau eingraviert ist, buchstäblich in Stein gemeißelt. Platz muss noch sein, im Grab und auf dem unteren Teil des Sandsteins. Für mich beziehungsweise meinen Namen, haben wir uns doch gegen eine Feuerbestattung und ein Gemeinschaftsgrab entschieden. Dann werde ich zuletzt auch da sein. Da unten.
Merkwürdig, dass ich, während ich mich über meine eigene Abwesenheit neige, sinnierend am Grab sitze und meinen Kopf mit der rechten Hand abstütze, August Rodins berühmte, in vielen Versionen bewunderte Skulptur »Der Denker« erinnere. Merkwürdig deshalb, weil dieser doch nackt ist, und von einer mir gar nicht eigenen durchtrainiert-athletischen Körperlichkeit. Am Zürcher Kunsthaus, das ich gelegentlich passiere, nimmt er sich, weit oben im sogenannten Höllentor sitzend, zwar weniger aus wie ein großer Philosoph oder Wissenschaftler, den er Kunsthistorikern zufolge darstellen soll, sondern eher wie ein geschlagener Athlet oder, man verzeihe mir diese Assoziation, wie ein vor einem Platzregen schutzsuchender Vogel. Mit seiner schwarzen Patina gar wie ein nach Brotkrumen auf dem Vorplatz spähender Rabe.
Dass ich Rodins Denker erinnere, liegt einfach daran, dass ich intuitiv seine so eingängige und überall als Sinnbild der Nachdenklichkeit verwandte denkerische Pose eingenommen habe. Denker oder Rabe, hin oder her – ganz tief hinunter möchte ich mein Ohr halten und nicht da oben sitzenbleiben. Und aufschauen zum Denker Rodins. Meine Leitfigur ist zwar eher die Darstellung der Schwermut, wie sie Albrecht Dürer in einem rätselhaften Holzschnitt als traurigen, in stilles Nachdenken versunkenen Engel dargestellt hat. Denn die irdische Welt ist, wie ich in diesem Moment und an diesem Ort schlagartig erkenne, eine von zwei Welten, der erlebten einerseits, einer geträumten oder phantasierten oder furchterregenden Über- oder Unterwelt wie in Rodins Höllentor andererseits. Kurz: einem Reich der Lebenden und einem Reich der Toten. Beide Welten sind unnachgiebig ineinander verschlungen, das steinerne Archiv, das der Friedhof ja darstellt, und die zirkulierenden Besucher, die früher oder später auch ins Archiv wandern, bilden eine Art Karussell, in dem die kreisenden Figuren, Episoden und Erinnerungen Mal für Mal an uns vorbeischweben. Media vita in morte sumus – mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Und todkrank noch träumen wir vom irdischen und, je näher der Tod rückt, überirdischen Leben. Die Doppelheit der Welt und die Suprematie der Überwelt erscheinen mir nicht absonderlich, sondern Treibgut aller Kulturen.
Und ich sitze hier und sinniere über ihren und meinen Zustand.
Ich kämpfe mit ganz unterschiedlichem Treibgut. Den eigenen Tod stirbt man, mit dem Tod der Liebsten muss man leben. Und lasse mich hierhin und dorthin treiben. Die Leiche ist die Präsenz der Abwesenheit. Virtuell ist sie da, nur virtuell. Sonst müsste man ja hinuntersteigen in die Gefilde der Toten. Hat nicht Dostojewski beim Anblick von Holbeins, aus dem 16. Jahrhundert stammenden und im Roman »Der Idiot« genauestens beschriebenen Gemälde »Der Leichnam Christi im Grabe« einen epileptischen Anfall bekommen, so dass seine Frau ihn wegzerren musste?
Gestern fielen mir beim Aufräumen Röntgenbilder von mir in die Hand. So siehst Du, der Du das liest, und so sehe ich einmal aus. Die Serie »Der Bestatter« im Schweizer Fernsehen bringt uns diesen Zustand näher. Vielleicht, wie Freunde meinen, wäre es leichter gewesen, U. stünde, wie das heute Mode ist, in einer Urne im Wohnzimmer oder auf dem Flur, jedenfalls zu Hause. Oder läge im Verbund mit anderen in einem Gemeinschaftsgrab, wie sie unterdessen auch Konjunktur zu haben scheinen und in der Tat ausnehmend apart und platzsparend gestaltet sind.
Ich glaube nicht, dass die Nähe meiner zu Staub gewordenen Frau in meiner häuslichen Umgebung tröstlicher gewesen wäre. Was einem bezüglich dieser Thematik nicht alles durch den Kopf schießt! Denn zuhause machen sich auch afrikanische Fetische und asiatische Skulpturen breit. Immer wieder hätte der Anblick mich vermutlich zutiefst beeinträchtigt und den Zeitfluss unterbrochen. Bei einem Grab auf dem Friedhof nimmt man sich einen Besuch vor, um über die Vergänglichkeit nachzudenken. Die Urne zuhause ist wie der Tod, immerzu da. Ein zeitgemäßes Memento mori. Immerzu über den Tod nachdenken möchte man ja auch wieder nicht.