
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
An Monster unter dem Bett glaubt der 15-jährige Jim schon lange nicht mehr. Er hat ganz andere Probleme und Träume, wie z. B. seinen Loserstatus an der Schule zu verlieren, in Mrs.Pinktons Matheunterricht möglichst nicht an die Tafel gerufen zu werden und endlich, endlich, endlich die Aufmerksamkeit von Claire Fontaine, dem schönsten und coolsten Mädchen der Schule, zu erregen. Das ändert sich jedoch, als eines Abends eine gewaltige, haarige Pranke mit Krallen, so lang wie ein Unterarm, unter Jims Bett hervorschießt und ihn an den Füßen packt. Vor lauter Schreck wird Jim ohnmächtig und wacht kurz darauf in einer feuchten, schimmeligen Höhle wieder auf – er ist im Reich der Trolle gelandet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Guillermo del Toro
Daniel Kraus
TROLLHUNTERS
Roman
Mit Illustrationen
von Sean Murray
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Felix Mayer
Das Buch
Ihr seid Futter. Das ist keine angenehme Vorstellung, doch es ist hilfreich, von diesen Dingen zu wissen. Es gibt nämlich Wesen auf dieser Welt, die nicht nur in ihren Höhlen kauern und warten. Diese Wesen haben ihre eigenen Jagdmethoden, ihre eigenen Feuerstellen und ihre eigenen Vorlieben …
Jim Sturgess lebt im sonnigen San Bernadino. Im Gegensatz zu seinem schrulligen Vater glaubt der Fünfzehnjährige schon lange nicht mehr an Monster unter dem Bett – Jim hat ganz andere Probleme. Seinen Loserstatus an der San Bernadino High loszuwerden, zum Beispiel. Oder in Mrs. Pinktons Matheunterricht nicht nach vorne an die Tafel gerufen zu werden. Oder endlich ein Date mit Claire Fontaine, dem schönsten und coolsten Mädchen der ganzen Welt, klarzumachen. Jims Einstellung zu Monstern ändert sich jedoch, als eines Abends zwei riesige, haarige Pranken mit gewaltigen Krallen unter eben diesem Bett hervorschießen und ihn an den Knöcheln packen. Vor lauter Schreck wird Jim ohnmächtig und wacht kurz darauf in einer feuchten, schimmeligen Höhle wieder auf. Er ist im Reich der Trolle gelandet, wo er einem uralten Geheimnis auf die Spur kommt. Dort, im Land der Monster und Ungeheuer, findet Jim unerwartet neue Freunde und vor allem seinen eigenen Heldenmut. Und genau den braucht er auch, um den Kampf gegen das Böse zu gewinnen und das Geheimnis der Trolle zu lösen …
Die Autoren
Guillermo del Toro wurde 1964 in Guadalajara, Mexiko, geboren, wo er auch die Filmschule besuchte. Heute zählt del Toro, der mit Werken wie Pans Labyrinth und Hellboy Filmgeschichte schrieb, zu den bekanntesten und erfolgreichsten Regisseuren der Welt. Zusammen mit dem Schriftsteller Daniel Kraus hat er mit Trollhunters nun sein erstes Jugendbuch geschrieben.
Daniel Kraus wurde 1975 in Midland, Michigan, geboren und ist in Iowa aufgewachsen. Er ist ein Experte für Monster jeglicher Art und wurde für seine Romane bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Parents Choice Award. Daniel Kraus lebt zusammen mit seiner Frau in Chicago.
Für meine Kinder und die Zeit der Hoffnungen und Träume.
Möge sie für uns alle ein wenig länger dauern.
Guillermo del Toro
Für Craig Ouellette
Daniel Kraus
Sie heißen mich Troll;
Mondlichter Nager,
Sturmböiger Riese,
Fluch des Regensaales,
Gefährte der Sibylle,
Nachtfahrender Magier,
Der den Laib des Himmels verschlingt.
Was anderes ist ein Troll?
Bragi Boddason der Ältere;
Dichter, 9. Jhd.
PROLOG
Die Milchkartonepidemie
Ihr seid Futter. Eure Muskeln, die ihr anspannt, um zu gehen, zu sprechen oder etwas hochzuheben? Nur Fleischklopse, garniert mit saftigen Sehnen. Eure Haut, die ihr so oft prüfend im Spiegel betrachtet habt? Ein Auflauf aus diesem leckeren Gewebe ist für Kenner eine Delikatesse. Und eure Knochen, die euch die Kraft verleihen, um im Leben euren Weg zu machen? Sie brechen zwischen knackenden Zähnen, wenn geifernde Mäuler ihr Mark schlürfen. Das alles ist keine angenehme Vorstellung, doch es ist hilfreich, von diesen Dingen zu wissen. Es gibt nämlich Wesen auf dieser Welt, die nicht nur in ihren Höhlen kauern und darauf warten, dass wir sie fangen und über dem Feuer braten. Diese Wesen haben ihre eigenen Jagdmethoden, ihre eigenen Feuerstellen und ihre ganz eigenen Vorlieben.
Jack Sturges und sein kleiner Bruder Jim wussten nichts von all dem, als sie in ihrer Heimatstadt San Bernardino auf ihren Fahrrädern einen ausgetrockneten Kanal entlangjagten. Es war der 21. September 1969, ein herrlicher Tag einer längst vergangenen Epoche. Im Osten floss das Licht der Abenddämmerung über den Gipfel des Mount Sloughnisse, aus den umliegenden Straßen war das Summen von Rasenmähern zu hören, der Chlorgeruch eines Swimmingpools lag in der Luft, und aus einem Hinterhof zog der rauchige Duft gegrillter Hamburger.
In der Tiefe des Kanals konnten die beiden Jungen, unbeobachtet vom Rest der Welt, ihre Schießereien austragen. An diesem Spätnachmittag kämpfte wie immer Victor Power (Jack) gegen Doctor X (Jim). Sie umkurvten Schutthaufen und feuerten mit ihren Strahlenkanonen aus Plastik, und dass Victor Power wie immer der Sieger blieb, lag diesmal ganz entschieden an seinem neuen Fahrrad, einem kirschroten Rad der Marke Sportcrest, an dem noch die Schleifen hingen. Jack hatte es erst heute zu seinem dreizehnten Geburtstag bekommen, aber er steuerte es, als hätte er nie ein anderes Rad besessen, sauste mörderische Uferstellen hinauf und pflügte durch Gestrüpp, manchmal sogar freihändig, um besser zielen zu können.
»Du kriegst mich nie!«, rief Victor Power.
»Und ob!«, keuchte Doctor X. »Ich werde … warte … jetzt warte doch, Jack!«
Jim – oder »Jimbo«, wie sein Bruder ihn nannte – schob seine Brille mit den dicken Gläsern, die gebrochen und mit einem Pflaster geklebt war, die schweißüberströmte Nase hinauf. Er war acht und für sein Alter eher klein. Sein ramponiertes gelbes Schwinn war viel schlichter als das Sportcrest und außerdem so groß, dass er Stützräder dafür brauchte. Dad hatte ihm versprochen, dass er bald hineinwachsen würde. Darauf wartete Jim noch immer. Bis es so weit war, musste er sich aufrichten, wenn er ordentlich Fahrt aufnehmen wollte, aber dann konnte er mit seiner Strahlenkanone nicht mehr richtig zielen. Doctor X war chancenlos.
Das Sportcrest schoss durch einen Müllhaufen. Kurz darauf folgte Jim mit quietschenden Stützrädern. Als er den zusammengequetschten Milchkarton sah, blieb er mit einer Drehung stehen. Auf der Seite des Kartons war das Gesicht eines lächelnden Mädchens aufgedruckt, darunter stand VERMISST. Jim schauderte. Auf diese Weise wurde bekannt gegeben, wenn wieder ein Kind vermisst wurde. Das passierte andauernd.
Ein Jahr zuvor war das erste Kind verschwunden, und in ganz San Bernardino waren Suchtrupps und Rettungsteams gebildet worden. Dann wurde ein zweites Kind vermisst. Dann noch eins. Eine Zeit lang suchte man noch gezielt nach jedem einzelnen, doch schon bald kam fast täglich eine neue Meldung, und irgendwann konnten die Erwachsenen nicht mehr. Die Resignation in den Gesichtern der völlig übernächtigten Eltern war das Schlimmste für Jim gewesen. Sie hatten sich der unbekannten Macht ergeben, die ihre Kinder raubte, und wenn sie am Frühstückstisch Milch in die Schüsseln ihrer Familien gossen, versuchten sie, nicht auf die Gesichter zu blicken, die auf den Milchkartons aufgedruckt waren und über denen stand:
WER HAT DIESES KIND GESEHEN?
Die letzte Zahl, die Jim gehört hatte, war 190. Dass so viele Kinder als vermisst galten, war eigentlich nicht zu glauben, aber die Veränderungen in der Stadt erlaubten keinen Zweifel: Um das Schulgelände war ein höherer Zaun errichtet worden, immer mehr Eltern überwachten die Spielplätze, und wenn Kinder nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen waren, griff sofort die Polizei ein. Normalerweise durften Jim und Jack so kurz vor Sonnenuntergang nicht mehr mit den Rädern unterwegs sein, aber heute, an Jacks Geburtstag, hatten ihre Eltern eine Ausnahme gemacht.
Als Erstes hatte Jack sein neues Rad aufgemöbelt, indem er sein Transistorradio mit einem Stück Draht an den rot glänzenden Lenker gebunden hatte. Dann hatte er es voll aufgedreht, und den ganzen Nachmittag hatten groovende Songs aus der Hitparade die beiden Brüder begleitet: Sugar, Sugar, Hot Fun in the Summertime, Proud Mary. Es mag seltsam klingen, aber diese Musik war der perfekte Soundtrack für die Lasersalven von Victor Power und Doctor X. Solange Jim nicht an die Milchkartons dachte, war dieser Nachmittag der beste in seinem Leben.
Aus dem Radio an Jacks Fahrrad erklang jetzt What’s Your Name? von Don and Juan, ein Liebeslied, das Jim nicht besonders mochte, dessen sehnsüchtiges Säuseln aber irgendwie zur Stimmung des vergehenden Tages passte. Die Sonne ging rasch unter, morgen fing die Schule wieder an, und der letzte Kilometer bis nach Hause war vielleicht das letzte Aufflackern des Sommers, bevor der Herbst und der Alltagstrott ihn wie die Flamme einer Kerze erstickten.
Jim blinzelte in die Sonne. Jack trat so heftig in die Pedale, dass die Vögel davonstoben und wahrscheinlich erst wieder landen würden, wenn sie ihr Winterquartier im Süden erreicht hätten. Er johlte vor Freude, während im Windschatten des Sportcrest Laub aufwirbelte. Gleich würde er unter der Holland Transit Bridge hindurchsausen, einem Klotz aus Stahl und Beton. Oben auf der Brücke fuhren ein paar Autos, und darunter breitete sich eine Dunkelheit aus, die so tief und schwarz war, dass einem die Augen wehtaten, wenn man hineinsah.
Jim musste ihn unbedingt einholen. Er wollte, dass sie gleichzeitig als Brüder nach Hause kamen, als Jack und Jim Sturges, und nicht als das immer gleiche Paar von Gewinner und Verlierer, als Victor Power und Doctor X. Er richtete sich auf und trat mit aller Macht in die Pedale. Die Stützräder protestierten – quietsch, quietsch, quietsch –, doch Jim holte alles aus seinen Beinen heraus. Er wünschte, sie wären kräftiger und länger.
Als er wieder aufsah, war Jack nicht mehr da.
Unter der Brücke lag, im Licht der untergehenden Sonne, nur das Sportcrest. Der Lenker war verbogen, und das Vorderrad drehte sich noch. Jim raste schon auf die Brücke zu, trat jetzt aber rückwärts und brachte sein Schwinn ein paar Schritte vor dem Dunkel unter der Brücke schlitternd zum Stehen. Keuchend stand er da, die Beine über dem Mittelrohr gespreizt, und hielt in der Finsternis Ausschau nach seinem Bruder.
»Jack?«
Das Vorderrad des Sportcrest drehte sich noch immer, als träte Jacks Geist weiter in die Pedale.
»Komm schon, Jack. Sei nicht so blöd. So schnell kriege ich keine Angst.«
Die einzige Antwort kam von Don and Juan. Ihr Harmoniegesang hallte von den Wänden wider und wurde zu einer gruseligen Wehklage:
»I stood on this corner, / Waiting for you to come along, / So my heart could feel satisfi-i-i-ied …«
Mit ploppenden Geräuschen wie von gedämpften Böllern gingen eine nach der anderen die Laternen neben Jim an und verbreiteten ihr gelbliches Licht im Kanalbett. Jetzt war es endgültig Nacht. Sie hatten draußen nichts mehr zu suchen.
»Wenn wir nicht gleich zu Hause sind, kriegen wir wochenlang Hausarrest. Jack?«
Jim schluckte, stieg ab und umfasste die Strahlenkanone fest mit seiner verschwitzten Hand. Dann ging er, das Fahrrad neben sich schiebend, in das Dunkel unter der Brücke. Dort war es zehn Grad kälter. Er zitterte. Die Stützräder drehten sich langsamer, klagten aber noch immer.
Quietsch, quietsch, quietsch.
Er ging bis zum Sportcrest. Das Vorderrad drehte sich immer langsamer. Plötzlich schien es Jim, als sei dieses Rad Jacks Herz, und wenn es stillstand, wäre sein Bruder für immer verschwunden.
Er blickte in die unergründliche Finsternis. Trotz eines Tröpfelns, das nach Feuchtigkeit klang, eines Huschens, das vielleicht von Ratten stammte, des Wummerns von Autoreifen über ihm und des Wimmerns von Don and Juan rief er:
»Jack! Jetzt komm schon! Ist dir was passiert? Jack, das ist nicht komisch!«
Als der Widerhall seiner Worte ihn erreichte, zuckte er zusammen. Das gelbliche Licht der Laternen, der lilafarbene Himmel, die klamme Kälte, das Echo, das sich über seine Angst lustig zu machen schien – wie hatte sich ein Traum so schnell in einen Albtraum verwandeln können? Jim drehte sich um, sah erst in eine Richtung in der Dunkelheit, dann in eine andere, immer hastiger sprang sein Blick umher, in seiner Brust stieg ein Schluchzen auf, und seine Wangen brannten vor Furcht. Nach einer Weile hatte er in jeden Winkel geschaut, nur eine Richtung hatte er vermieden.
Langsam hob er den Kopf und sah zur Unterseite der Brücke.
Dunkel. Nichts als Dunkel.
Doch dann bewegte sich das Dunkel.
Es war eine natürliche, fast anmutige Bewegung. Riesige, kräftige Gliedmaßen zeichneten sich von der Betondecke der Brücke ab und suchten Halt. Ein Kopf von der Größe eines Felsbrockens drehte sich herum, und orange leuchtende Augen, die wie Feuer glühten, kamen zum Vorschein. Als das Geschöpf Luft holte, schien die Brücke in ihren Eingeweiden zu erzittern. Dann atmete es aus, und die Wucht des stinkenden Luftschwalls warf Jim zu Boden.
Das Wesen ließ sich von der Unterseite der Brücke herabfallen. Schmutz und Staub wirbelten auf, und in dem Müll, der hochgeschleudert wurde, sah Jim ein paar Milchkartons hüpfen und tänzeln, zwei, drei, vier, fünf Stück. Beim Anblick der grinsenden Gesichter schien ihm, als machten sich die Kinder über ihr eigenes Verschwinden lustig. Das Wesen bäumte sich auf wie ein Grizzlybär, und im Licht der Laternen schimmerten zwei Hörner, die sich in die Betondecke rammten. Ein Maul öffnete sich, in dem riesige, schief stehende Zähne leuchteten. Zwei orangefarbene Augen waren starr auf Jim gerichtet. Dann griffen Arme nach ihm, lange, muskelbepackte Schlangen mit verfilztem Fell.
Jim schrie auf. In der Enge der Unterführung war sein Schrei dutzendfach lauter als sonst. Das Wesen hielt eine Sekunde lang inne. Jim nutzte die Gelegenheit, drückte sich vom Boden ab und schwang sich auf sein Rad. Dabei trat er mit dem linken Fuß gegen Jacks Radio und brachte Don and Juan für immer zum Schweigen. Im nächsten Moment jagte er schreiend und mit herumwirbelnden Beinen aus dem Dunkel unter der Holland Transit Bridge hinaus.
In seinem Rücken hörte er das rasende Trampeln eines gewaltigen Ungetüms, das ihm wie ein Gorilla auf allen vieren hinterhergaloppierte.
Vor Schreck vor sich hinbrabbelnd trat Jim so heftig in die Pedale wie noch nie. Das Quietschen der Stützräder wuchs zu einem Kreischen an. Das Wesen kam immer näher. Jedes Mal, wenn es einen seiner riesigen Füße auf den Boden wuchtete, erzitterte die Erde. Es schnaufte wie ein Stier, und sein Atem stank nach Abwasser. Jim fiel die Strahlenkanone aus der Hand; nie wieder würde er die Cleverness und die Kraft von Doctor X verspüren. Das Knurren des Wesens war jetzt so nahe, dass Jims Fahrrad vibrierte. Auf dem Boden vor sich sah er im Licht der Laternen den Furcht einflößenden Schatten eines Armes mit langen scharfen Krallen, der nach ihm griff.
Jim bog nach links, überwand die Böschung, pflügte durchs Ufergestrüpp und schoss hinaus auf den Gehsteig einer Straße. Vor ihm tauchte ein Hydrant auf, so leuchtend rot wie das Rad, das Jack zum Geburtstag bekommen hatte. Jack, was war um Gottes willen nur mit ihm geschehen? Jim umkurvte den Hydranten und raste mitten auf der Fahrbahn die Straße hinab. Ein Auto hupte und wich ihm aus. Jim kümmerte sich nicht um das wütende Geschrei des Fahrers. Er fuhr jetzt so schnell wie sein Bruder, war endlich auch ein echter Fahrradheld, und jetzt brachen auch die Stützräder ab, hüpften über die Straße und waren nur noch nutzlose kleine Gummiringe.
Sein Elternhaus war schon in Sichtweite, nur noch wenige Sekunden entfernt. Auf den letzten Metern nahm er alle Kräfte zusammen und hechelte nach Luft, während ihm die Tränen quer über die Wangen strömten.
Er machte einen Satz über den Bordstein, rammte den weißen Zaun und stürzte kopfüber in den Vorgarten. Die Büsche, die seine Mom immer so akkurat zuschnitt, zerkratzten ihm das Gesicht, und das Heftpflaster hielt die Teile seiner Brille nicht mehr zusammen.
Im Haus bellte der Hund. Jim hörte Schritte, die Haustür, die geöffnet wurde, und dann Mom und Dad, die aufgeregt die Treppe herabliefen. Als ihm bewusst wurde, dass er noch immer schrie, musste er wieder an das Monster denken. Er sammelte die beiden Hälften seiner Brille ein und hielt sie sich vor die Augen. Nichts. Er blickte über die Einfahrt, die stillen Vororthäuser, die Briefkästen, die Blumenbeete, die Rasensprenger. Nirgends waren Monster zu sehen, aber neben seinen Füßen lag etwas im Gras.
Es war ein Medaillon aus Bronze, das an einer rostigen Kette hing. Darin war ein unheilverkündendes Wappen eingraviert: eine hässliche Fratze, die die Zähne fletschte, umrandet von unverständlichen Zeichen einer fremden Sprache, darunter ein prächtiges Langschwert. Noch immer schluchzend griff Jim nach dem Medaillon.
»Jim! Was ist passiert?«
Seine Mom kniete sich neben ihn und wischte ihm Erdklumpen aus den Ohren. Kurz darauf kam sein Dad hinzu. Auch er kniete sich hin, packte Jim an einem Bein und schüttelte ihn, wie um ihn zu sich zu rufen. Immer wieder nannten sie ihn bei seinem Namen: Jim. Nie wieder würde ihn jemand Jimbo nennen. Eine furchtbare Vorstellung.
»He, Großer, schau mich an«, sagte sein Vater. »Alles in Ordnung? Ist alles okay? He, Großer.«
»Wo ist dein Bruder?« Die belegte, leise Stimme seiner Mutter verriet, dass sie etwas ahnte. »Jim, wo ist Jack?«
Jim antwortete nicht, sondern beugte sich zur Seite und sah an seinem Vater vorbei. Der Abdruck im Gras war noch zu sehen, doch das Medaillon war verschwunden – wenn es denn jemals existiert hatte. Jim war auf seltsame Weise traurig, weil es nicht mehr da war, aber mehr noch hatte er das Gefühl, versagt zu haben. Heulend und zitternd warf er sich seinen Eltern in die Arme. Er hatte erfahren, was wirkliche Angst war, und er hatte erfahren, was ein echter Verlust war.
Jim Sturges war mein Vater. Jack Sturges war mein Onkel. Die Geschichte, die ich euch eben erzählt habe, habe ich selbst erst fünfundvierzig Jahre später gehört, als ich fünfzehn war. Dabei habe ich auch erfahren, dass Jack das letzte Kind war, das in der Milchkartonepidemie verschwand, die genauso schnell zu Ende ging, wie sie begonnen hatte. Das kaputte Sportcrest ist eine Familienreliquie geworden, ich habe es Hunderte Male vor Augen gehabt. Als ich fünfzehn war, habe ich auch erfahren, wie mein Vater die Jahrzehnte danach verbracht hat, seine Jugend und einen Großteil seines Erwachsenenlebens. Er ging nachts mit einer Taschenlampe zur Holland Transit Bridge und suchte nach Hinweisen darauf, was seinem älteren Bruder widerfahren war. Doch von Jack war keine Spur mehr zu entdecken, außer auf den Milchkartons, die sein aufgewecktes, grinsendes Gesicht zeigten, neben dem nur ein Wort stand: VERMISST.
Besser könnte man den Zustand meines Vaters in den folgenden Jahren nicht beschreiben.
ERSTER TEIL
In die Tiefe
1
Zeitgenössischen Berichten zufolge fand die Schlacht der Gefallenen Blätter, die eine so große historische Bedeutung erlangen sollte, in den beiden Schlussminuten eines Footballspiels auf dem Harry G. Bleeker Memorial Field der San Bernardino High School statt, als unsere heiß geliebten Saint B. Battle Beasts mit nur sechs Punkten in Führung lagen und unser Quarterback wegen einer Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen werden musste. Zu diesem Zeitpunkt, während der wichtigsten Partie des Jahres und an diesem Ort, auf dem taunassen Rasen, kam ein tapferer Held zu Fall, und ein anderer feierte völlig unerwartet seinen Triumph. Bis zum heutigen Tag werden aus diesen Ereignissen Gutenachtgeschichten gesponnen, und Kinder jeden Alters träumen davon – die Kinder von Menschen, aber auch andere. Ihr tut daher gut daran, die folgenden Seiten mit der größten Aufmerksamkeit zu lesen. Jedes Wort davon ist wahr, glaubt mir. Und vielleicht wollt ihr diese Geschichte ja eines Tages euren eigenen Kindern erzählen.
Es sollten noch seltsamere Dinge geschehen. Wartet nur ab.
Mein Name ist James Sturges Jr., aber ihr könnt mich Jim nennen, so wie mein Vater genannt wurde. Auch ich war einmal in eurem Alter. Ich war fünfzehn, als mein Abenteuer begann. An einem Freitagmorgen im Oktober klingelte der Wecker wie üblich zu einer ungemütlichen Zeit. Ich ließ ihn läuten; ich hatte es mir antrainiert, über das Piepsen hinweg weiterzuschlafen. Leider hatte mein Dad, Jim Sturges Sr., den leichtesten Schlaf der Welt. Schon ein schwacher Windstoß, der gegen die Hauswand fuhr, weckte ihn auf. Wenn er dann wach war, kam er immer in mein Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung war, und weckte mich dadurch ebenfalls auf. Wahrscheinlich lag das am Schicksal seines älteren Bruders Jack. So was kann einen ganz schön durcheinanderbringen.
Dad kam in mein Zimmer und schaltete den Wecker aus. Die anschließende Stille war noch schlimmer als das Piepsen, weil ich wusste, dass er neben mir stand und mich ansah. Das machte er oft. Als könne er nicht glauben, dass ich wieder eine Nacht überlebt hatte. Mühsam öffnete ich die Augen. Er trug ein Hemd, das zu eng saß und am Kragen schmutzig war, und versuchte, den linken Ärmel zuzuknöpfen. Das versuchte er jeden Morgen so lange, bis ihm die Nerven versagten und er mich um Hilfe bat.
Mein Vater sah alt aus. Er war alt, älter als die meisten anderen Väter, die ich kannte. An seinen Augenwinkeln fächerten sich kleine Falten wie die Blätter eines Windrades auf, seine Augenbrauen und die Haare in seinen Ohren wucherten, und er war fast ganz kahl. Außerdem stand er immer irgendwie zusammengesackt da, was ich von anderen Vätern auch nicht kannte. Allerdings glaube ich nicht, dass das mit seinem Alter zu tun hatte, sondern mit etwas anderem, das auf ihm lastete.
»Raus aus den Federn.« Er klang alles andere als beschwingt. Wie immer.
Ich setzte mich auf und sah ihm zu, wie er sich an den stählernen Rollläden an meinem Fenster zu schaffen machte. Er holte seine kaputte Brille hervor, die von einem Heftpflaster zusammengehalten wurde, und las mit zusammengekniffenen Augen den Tastencode ab. Nachdem er die sieben Ziffern eingetippt hatte, drückte er die Stahllamellen mit einem Ruck nach oben, und das Sonnenlicht fiel herein.
»Das lohnt sich doch nicht«, grummelte ich. »Ich muss sie ja sowieso wieder runterlassen, wenn wir gehen.«
»Sonne ist wichtig für heranwachsende Jungs.« Er klang nicht gerade überzeugt.
»Ich wachse nicht.« Was die Körpergröße anging, kam ich nach meinem Vater. Ich wartete noch immer auf den Wachstumsschub, von dem alle redeten. »Mir kommt es eher vor, als würde ich schrumpfen.«
Er nestelte noch ein wenig an seinem linken Ärmelknopf herum und ging dann hinaus.
»Na los, beweg deine müden Glieder. Frühstück ist genauso wichtig.« Auch davon schien er nicht überzeugt.
Ich duschte und zog mich an, und als ich ins Wohnzimmer kam, stand Dad genau dort, wo ich es erwartet hatte: neben der Tür, vor dem Altar, den er zum Gedenken an Onkel Jack auf dem elektrischen Kamin errichtet hatte. Es war wirklich ein Altar, man kann es nicht anders bezeichnen. Der ganze Sims war mit Andenken an Jack und mit Fotos vollgestopft: Jack im Kindergarten mit einem Lone Ranger-T-Shirt und strahlendem Gesicht, in der zweiten Klasse mit breitem Grinsen und einer Menge Zahnlücken, in der fünften Klasse mit einem blauen Auge und ungebrochenem Stolz und in der achten Klasse – in der letzten Lebensphase, die er erreicht hatte – braun gebrannt und kraftstrotzend, als sei er drauf und dran, die Welt zu erobern.
Die anderen Gegenstände auf dem Altar waren befremdlicher, wie etwa die mit Rostflecken übersäte Klingel von Jacks Sportcrest, das Fahrrad-Radio, das sein letztes Lied 1969 gespielt hatte, und eine sonderbare Apparatur mit einer verbogenen Antenne. Daneben gab es noch andere Dinge, die nur für meinen Vater Bedeutung hatten: eine kaputte Armbanduhr, eine kleine Indianerfigur aus Holz, ein Klumpen Katzengold. Am gruseligsten war jedoch das Stück, das genau in der Mitte des Altars stand: ein gerahmter Ausriss eines Milchkartons mit einer Schwarz-Weiß-Reproduktion des Fotos von Jack aus der achten Klasse.
Dad bemerkte mein Spiegelbild in der Glasscheibe.
Er lächelte bemüht.
»Hi, Großer.«
»Hi, Dad.«
»Ich … mach nur ein bisschen sauber.«
Er hatte weder Putzmittel noch einen Lappen in der Hand.
»Klar.«
»Hast du Hunger?«
»Ja. Ja, schon.«
»Gut.« Er dehnte sein gespieltes Lächeln, so weit es ging. »Dann auf zum Frühstück.«
Frühstück bedeutete Frühstücksflocken mit kalter Milch. In früheren Zeiten hatten wir morgens warm gegessen, bis Mom irgendwann genug hatte von Dads Unsicherheit und uns verließ. Ich sagte mir, dass er tat, was er konnte. Über unsere Schälchen gebeugt saßen wir da und knabberten und schlürften, getrennt von der Fläche der Tischplatte. Manchmal blickte Dad sich um und vergewisserte sich, dass die stählernen Rollläden fest verschlossen waren. Ich seufzte und goss mir Milch nach. Milch gab es bei uns nur im Kanister. Dad kaufte niemals Kartons.
Er sah immer wieder auf die Uhr, bis ich schließlich aufstand und die Reste meines Frühstücks in den Mülleimer kippte. Während er an der Haustür stand und mit den Füßen tippelte, hastete ich in mein Zimmer, zog mir rasch die Jacke an, schnappte meinen Rucksack und gab den Tastencode ein, woraufhin sich die Rollläden schlossen. Erst als ich neben ihm stand, fing Dad an, die Haustür zu entriegeln.
Ich kannte dieses Ritual in- und auswendig. Die Tür war mit zehn Schlössern gesichert, eines beeindruckender als das andere. Während mein Vater Riegel zurückschob, Schlüssel umdrehte und Ketten aushängte, flüsterte ich das Percussion-Solo mit, das ich nun schon seit fünfzehn Jahren hörte: klick, ratsch, zing, ratsch, klack-klack-klack, dunk, knirsch, zling, ratsch-ratsch, fump.
»Jimmy. Jimmy!«
Ich sah ihn zwinkernd an. Er wirkte verletzlich, wie er dort in der Tür stand in seinem schlecht sitzenden Hemd und mit einer Hand auf der Stelle des Bauches, wo sein Magengeschwür planmäßig Schwierigkeiten machte. Ich verspürte Mitleid, doch er trieb mich mit einer ungeduldigen Geste zur Eile.
»Geh runter von der Veranda, sonst lösen die Drucksensoren aus. Los, mach schnell.«
Ich murmelte eine Entschuldigung und ging an ihm vorbei in den Vorgarten. Ich hörte, wie sich die elektronische Alarmanlage einschaltete, und kurz darauf die weibliche Computerstimme: »Innenräume sicher.« Dad atmete auf, als hätte die Nachricht auch anders lauten können, verriegelte die Tür mit den äußeren mechanischen Schlössern und sprang von der mit Drucksensoren ausgestatteten Veranda. Er landete neben mir. Die Haarbüschel über seinen Ohren waren feucht vom Schweiß.
Er war erschöpft, der arme Alte. Er hatte keine Kraft mehr, gegen die Dämonen zu kämpfen, die sich in seinen Gedanken zu wahren Drachen ausgewachsen hatten. Seine Brust hob und senkte sich rasch, und mein Blick fiel auf das Taschenrechneretui aus Vinyl, das in seiner Brusttasche steckte und eine Prägung mit dem Logo von San Bernardino Electronics trug. Gerüchten zufolge hatte Dad die Taschenrechnerhülle Excalibur erfunden, die von Wissenschaftsfreaks auf der ganzen Welt benutzt wurde, aber Dad bestritt diese Geschichte. Ich glaube, dass seine Chefs ihn einfach übers Ohr gehauen und um die Früchte seines Erfolgs betrogen haben. Das ist typisch für jemanden wie Jim Sturges Sr. Ich kam mir vor wie der letzte Idiot.
Er begleitete mich durch den Vorgarten. Die Überwachungskamera an der Haustür verfolgte uns mit einem Surren. Als unsere Füße einander berührten, sah ich, dass seine Socken wie immer mit grünen Flecken überzogen waren. Weil er in der Arbeit weder befördert wurde noch Prämien bekam, arbeitete er am Wochenende als Gärtner. Er mähte die Rasenflächen in den städtischen Parkanlagen und auf Friedhöfen und sogar das Footballfeld der San Bernardino High School, wobei er mit seiner Schutzbrille und den Handschuhen ziemlich albern aussah. Das brachte mir in der Schule natürlich eine Menge Bonuspunkte ein. Mit einer Hand, die nach Gras roch, schob er mich vor sich her.
»Los, Jimmy, sonst versäumst du noch den Bus. Und wenn du den Bus versäumst, muss ich dich zur Schule fahren und komme zu spät zur Arbeit.«
»Warum kann ich denn nicht einfach zu Fuß gehen?«
»Du weißt genau, wie viel Mühe es mich gekostet hat, dass wir beide zur selben Zeit das Haus verlassen können. Mein Chef hat mir die Hölle heißgemacht, Jimmy, das kannst du mir glauben.«
»Du hättest es ja nicht tun müssen. Busfahren ist was für Babys.«
Er warf mir einen strengen Blick zu.
»Man kann nie vorsichtig genug sein. Denk nur an meinen Bruder Jack. Er war so selbstständig und so voller Tatendrang. Er hat immer zu mir gesagt: ›Jimbo, mich kann nichts auf der Welt aufhalten.‹ Aber dann ist er doch aufgehalten worden, und das, obwohl er …«
Ich fiel ein: »… der mutigste Junge war, der je gelebt hat.«
Dad drehte sich um und seufzte. Er stand vor seinem Lieferwagen der San Bernardino Electronics Company (»das sicherste Fahrzeug in der ganzen Stadt«, wie er gern sagte), mit dem er auch die Gerätschaften transportierte, die er zum Rasenmähen brauchte. Unter seinem Jackett stand das offene Ende seines Hemdsärmels hervor. Wenn er mir nicht erlaubte, ganz normal aufzuwachsen und so einfache Dinge zu tun, wie allein zur Schule zu gehen, hatte er es nicht besser verdient, als so in der Arbeit zu erscheinen.
»Ja«, sagte er nach einer kurzen Pause. »Das war er wirklich.«
Er schloss den Wagen auf. Ich kickte einen Stein weg. Dad hatte recht, der Bus kam. Er war schon in der Maple Street zu hören, und ich würde rennen müssen, um ihn noch zu erreichen. Aber der offene Knopf hielt mich zurück. Ich stellte mir vor, wie Dads jüngere Kollegen sich über diesen ungepflegten, ängstlichen Kerl lustig machten, der seine Brille mit Pflaster flickte und sein Excalibur-Etui wie einen Orden trug. Ein Opfer in der Familie war genug.
Ich ging zu meinem Vater hinüber, zog den Hemdsärmel etwas weiter hervor und knöpfte ihn mit ein paar raschen Handgriffen zu. Dann versuchte ich ein Lächeln. Dad zwinkerte mir durch die schmutzigen Brillengläser zu.
»Der Bus, Jimmy …«
Ich seufzte.
»Bin schon unterwegs, Dad.«
2
Vor dem Schulgebäude waren Kürbisse aufgereiht. Ich zählte sie ab und kam bis einundvierzig, als der Bus stehen blieb, wie immer so abrupt, dass es einem den Magen umdrehte. Brotdosen und Bücher schlitterten über den schmutzigen Boden, und die Schüler krabbelten auf allen vieren ihren wegrollenden Wasserflaschen und davonfliegenden Stiften hinterher. Ich lehnte mich zurück und betrachtete das Schild, das vor dem Eingang der San Bernardino High School stand.
102. Fest der Gefallenen Blätter
Die ganze Woche lang
Zeig, was du kannst!
Vorwärts, Battle Beasts!
Wer in Saint B., wie wir San Bernardino nannten, aufwuchs, dem blieb das Fest der Gefallenen Blätter ein Leben lang in Erinnerung. Man marschierte, als Prinzessin oder Roboter verkleidet, beim Festumzug der Kinder mit oder meldete sich als Freiwilliger und half seinen Eltern, bei der Kiwanis-Pfannkuchen-Party die vom Sirup verklebten Tische sauber zu wischen. Das Fest ging auf ein ziemlich cooles sagenumwobenes Ereignis zurück, bei dem irgendjemand in die Verbannung geschickt worden war, aber ich konnte mir nie merken, wer wen verbannt hatte und weshalb.
Aber das war auch egal, denn im Lauf der Zeit nahm die Stadt das Fest immer mehr zum Anlass, sich selbst zu feiern. Eine Woche lang gab es Märkte, auf denen ortsansässige Künstler ihre zusammengeschmierten Meisterwerke zu völlig überzogenen Preisen verhökerten, Buden, in denen unverkäufliche Kleidung verschleudert wurde, Gratiskonzerte in den Pavillons der öffentlichen Parkanlagen und Sonderangebote in Autohäusern, Restaurants und Versicherungsbüros. Den Abschluss bildete ein großes Footballspiel an der Saint B. High, gefolgt von Shakespeare auf der 50-Yard-Linie, der Kurzfassung eines Stückes, die mitten auf dem Platz aufgeführt wurde. Da bekam man Sport und Kultur in einem und musste dabei nicht einmal seinen Chili-Käse-Hotdog aus der Hand legen.
Dieses Jahr war mit einem wahren Zuschaueransturm zu rechnen, und das nicht nur, weil die Battle Beasts noch ohne Niederlage waren. Westlich des Schulgebäudes lag das Harry G. Bleeker Memorial Field, eine gewöhnliche Anlage mit Torpfosten und Flutlichtern und einer Menge Schlupfwinkel, wo man Bier hineinschmuggeln und rumknutschen konnte. Nächsten Freitag jedoch sollte das Jumbotron eingeweiht werden, ein absurd großer Bildschirm, der schon seit Wochen montiert wurde, sich aber noch immer unter Planen verbarg. Auch heute Morgen standen die Arbeiter schon auf dem hohen Gerüst und rückten ihre Schutzhelme zurecht.
Dieses dämliche Fest, das mir völlig egal war, fing am Samstag an, also am folgenden Tag, und das bedeutete, dass nur noch wenige kostbare Stunden verblieben, bevor alle Leute durchdrehten und ganz Saint B. in den Stadtfarben Rot und Weiß schmückten. Für Schüler wie mich, die weder in Sport noch in Theaterspielen noch in sonst etwas gut waren, war diese Woche die schlimmste Zeit des Jahres, ehrlich.
Ich stieg als Letzter aus dem Bus. Kaum hatte ich einen Fuß auf den Gehweg gesetzt, kam ein Junge, den ich vom Versagertisch aus der Mensa kannte, aus dem Haupteingang geschossen. Er hielt sich an mir fest, um zu bremsen, und wir drehten uns umeinander, als würden wir miteinander tanzen. Er zeigte mit dem Finger auf das Schulgebäude.
»Tub …«, stieß er keuchend hervor. »In der Pokalgalerie …«
Mehr brauchte er nicht zu sagen. Die Pokalgalerie war ein Korridor im dritten Stock, in dem die Pokalsammlung der Schule aufbewahrt wurde, und der Ort für die fiesesten Mobbingaktionen. Als es Deutsch und Französisch noch als Wahlfächer gegeben hatte, hatte der Unterricht hier stattgefunden. Mittlerweile waren die Neonröhren kaputtgegangen oder beschädigt worden, und der Korridor war ein finsterer, unheimlicher Schlauch, den man um jeden Preis vermied, auch wenn man deshalb zu spät zum Unterricht kam oder eine weitere Stunde lang die Blase zusammenpressen musste. Immer wieder war von dort das Jammern der Opfer zu hören, die zum ersten (oder auch vierzehnten) Mal ihr Fett abkriegten.
Manche Schüler hatten das Pech, dass sich ihr Schließfach in dieser Folterkammer befand. Tobias »Tubby« D., mein bester Freund, war einer von ihnen.
Noch bevor ich die Pokalgalerie erreichte, wusste ich, wer dort gerade seine Macht ausübte. Ein beständiges FLAPP, FLAPP dröhnte durch den Korridor – das Markenzeichen von Steve Jorgensen-Warner. Steve dribbelte immer und überall mit seinem Basketball. In den Klassenzimmern, in der Cafeteria, auf dem Klo, auf dem Parkplatz. Manche Lehrer, meistens solche, die auch Sport unterrichteten, erlaubten es ihm sogar während des Unterrichts, damit er sich besser konzentrieren konnte, was die anderen Schüler schweigend und genervt ertrugen.
Steve war kein gewöhnlicher Schüler. Er war Kapitän der Basketballmannschaft und der gefeierte Star der Footballmannschaft. Aber das war noch nicht alles. Er war attraktiv, wenn auch auf befremdliche Weise. Seine Augen waren zu klein, und er hatte eine Schweinchennase. Er hatte unglaublich dichtes Haar, und einige seiner Zähne sahen aus wie die Hauer eines wilden Tieres, aber in seiner Gesamtheit war sein Äußeres faszinierend. Seine unnatürlich großen Muskeln und seine seltsame Art zu sprechen – deutlich und höflich wie ein ausländischer Schüler, der Englisch in der Schule gelernt hat – vervollständigten seine eigenartige Erscheinung. Steve Jorgensen-Warner war ein außergewöhnlicher Junge. Und er war, was die Lehrer nicht wussten, außergewöhnlich grausam.
In der Pokalgalerie waren eine Menge Leute versammelt. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und sah, wie Tub auf dem Boden kniete. Sein sommersprossiges Gesicht glühte tiefrot, und er rang nach Luft, während Steve ihn mit dem linken Arm im Würgegriff hielt. Mit der rechten Hand tippelte Steve den Basketball, und nebenher unterhielt er sich ganz locker mit einem Jungen aus seiner Mannschaft. Ich schob mich durch die Menge nach vorn. Von Tubs Unterlippe troff ein Speichelfaden, und er grub seine Finger in Steves Oberarm.
»Luft«, japste Tub. »Brauche … Luft … zum Atmen …«
Steve entschuldigte sich bei seinem Freund dafür, dass er ihre angenehme Unterhaltung unterbrechen musste, und widmete sich wieder dem übergewichtigen Zehntklässler, der sich unter seinem Zugriff krümmte. Wie in einem Lachkabinett spiegelte sich Tubs verzerrtes Gesicht in sämtlichen polierten Bronzeplaketten, Meisterschaftspokalen und gerahmten Fotografien, auf denen junge Männer in identischen Trikots nebeneinander aufgereiht standen, jeder von ihnen glücklicher und kräftiger als mein keuchender bester Freund.
FLAPP, FLAPP. FLAPP, FLAPP.
Steve lächelte so breit, dass seine Hauer zu sehen waren, aber seine Augen blieben eiskalt.
»Du kennst die Abmachung, Tubby. Ein Fünfer am Tag. Bitte entschuldige, falls ich mich nicht klar ausgedrückt habe.«
»Du hast dich … unfassbar … klar …«
»Ein Fünfer, das ist geradezu ein Schnäppchen. Einen besseren Deal findest du nirgends, das garantiere ich dir.«
»Ich hab dir … gestern … alles, was ich hatte …«
»Nun, falls das zutreffen sollte, weshalb entschuldigst du dich nicht?«
»Hals … gedrückt … Reden … schwierig …«
»Es tut mir leid ist nur ein kurzer Satz. Warum sagst du ihn nicht einfach?«
»Es tut … mir leid …«
»Das klingt einigermaßen aufrichtig, Tubby. Ich nehme deine Entschuldigung an. Bring mir den Fünfer einfach bis heute Abend, und wir kommen ohne weitere Gemeinheiten aus. Bis zum nächsten Mal natürlich.«
Ich hätte alles darum gegeben, hätte ich jetzt den Mumm gehabt, aus der Menge hervorzustoßen und Steve von meinem Freund wegzureißen. Doch dann wären wir beide erledigt gewesen. Daher ging ich in die andere Richtung, aber die Menge schob sich mir entgegen, ich stolperte, fiel rückwärts hin und lag plötzlich zu meinem Entsetzen in der Mitte des Folterkreises.
Steve sah mich mit seinen hellwachen Augen blinzelnd an. Er ließ Tub los, der in eine Lache seines Speichels fiel, die sich auf dem Boden gebildet hatte, und drehte sich zu mir um. Das Flappen des Basketballs wurde so langsam wie der Schlag eines Walherzens, den wir einmal in einem Film im Biologieunterricht gehört hatten. Die Zeit schien sich auszudehnen. Ich kam mir vor wie einer der Sportler, die für alle Ewigkeit in der Pokalvitrine gefangen waren.
»Sieh an. Sturges«, sagte Steve. »Willst du auch mitmachen? Ich bin entzückt.«
Im Lauf der Jahre hatte auch ich von Steve Jorgensen-Warner meinen Anteil an Quälereien abbekommen. In der dritten Klasse hatte er mir eine legendäre Brennnessel verpasst, und in der neunten Klasse hatte ich mir das Handgelenk verstaucht, weil ich auf der Hintertreppe der Schule »gestolpert« war. Keine dieser Abreibungen war jedoch meine Schuld gewesen. Tub lag noch immer zusammengekrümmt auf dem Boden und sah mich entgeistert an.
»Na ja«, sagte ich nach oben in Richtung Steve, »eigentlich muss ich zum Unterricht. Wir sollten alle zum Unterricht, oder? Es ist doch schon so weit, oder?«
Mein Geschwafel hallte durch die Weite der Pokalgalerie.
FLAPP, FLAPP! Der Ball klang jetzt deutlich lebhafter. Er war ein verlässliches Stimmungsbarometer, wie der Schwanz eines Hundes. Mit einem strahlenden Grinsen kam Steve auf mich zu und dribbelte den Ball um sich herum und zwischen seinen Beinen hindurch. Jetzt war er ganz in seinem Element. Wäre ein Korb in der Nähe gewesen, er hätte den Ball mit Wucht darin versenkt.
3
Alles in allem kamen wir glimpflich davon. Wir bekamen beide die »Müllpresse« verpasst, eine raffinierte Prozedur, bei der man in ein Schließfach gedrückt wird, das viel zu klein für einen Teenager ist, und dann die Tür so oft draufgeknallt bekommt, bis man schließlich doch hineinpasst. Klingt nicht so schlimm, ist es aber. Die Kleiderhaken reißen einem Furchen in die Kopfhaut, man holt sich blaue Flecken an den Schultern, und wenn man so dumm ist und versucht, sich gegen die zuschlagende Tür zu stemmen, kann man sich die Finger brechen. Das ist alles schon vorgekommen.
Zum Glück war ich schon so oft in die Müllpresse genommen worden, dass ich mittlerweile wusste, wie man ein Schließfach von innen wieder aufbekam. Ich wartete ab, bis das Flappen des Basketballs nicht mehr zu hören war, und befreite mich. Aus dem Schließfach nebenan war Tubs Wimmern zu hören, und ich nahm es ihm wirklich nicht übel, dass er so jammerte. Er war ein großer Kerl, weshalb es schon rein physikalisch keine leichte Sache sein würde, ihn da herauszuholen. Als Erstes erklärte ich ihm, wie er das Schloss öffnen sollte. Das dauerte, weil mir durch die Schlitze in der Tür ununterbrochen Flüche entgegenflogen. Irgendwann läutete es. Ich seufzte. Wir würden zu spät kommen.
Zehn Minuten später standen wir im Jungenklo und brachten uns wieder in Form. Keiner von uns war scharf darauf, verspätet und dann auch noch mit blutigen Lippen und Ellbogen zum Unterricht zu erscheinen. Also reinigten wir in aller Ruhe unsere Wunden mit kaltem Wasser und trockneten sie mit rauen braunen Papierhandtüchern.
»Diese Dinger sind was für Brutalos«, sagte Tub. Dann verschwand er in einer Kabine, kam mit einer Handvoll Toilettenpapier wieder zurück und drückte es auf seinen aufgeschürften Ellbogen. »Ja, so fühle ich mich richtig verwöhnt! Das ist doch hier nicht etwa ein Wellnesstempel? Wann kriegen wir denn das Salzpeeling? Und die erotische Heißsteinmassage? James, was steht heute auf dem Programm?«
Ich versuchte zu lächeln, zog aber nur eine Grimasse. Der blaue Fleck auf meiner Wange tat weh. Ich überlegte, wie ich ihn vor Dad verheimlichen konnte. Mit einer riesigen Sonnenbrille? Einem flotten Schal? Einer abgefahrenen Gesichtsbemalung? Wenn es um meine Sicherheit ging, setzte bei ihm das Denken aus.
Tub beugte sich vor und sah stirnrunzelnd in den Spiegel. Ich würde jetzt wirklich gern sagen, dass wahre Schönheit von innen kommt, denn wenn das stimmt, müssten Chirurgen beim Anblick von Tubs Innereien in Verzückung geraten. Wer liebevoll war, nannte Tobias Dershowitz pummelig, wer sich diplomatisch ausdrücken wollte, bezeichnete ihn als kräftig. Tatsache war: Er war fett, und damit hörten seine Probleme noch nicht auf. Seine Haare waren ein dichtes, nicht zu bändigendes hellrotes Gestrüpp. Sein Gesicht war mit der Art Sommersprossen übersät, die Jugendliche seines Schlages wie übergroße Kleinkinder aussehen lassen. Das Schlimmste war jedoch seine Zahnspange, ein Wunderwerk moderner Folterkunst: Über jedem Zahn verliefen kreuzweise dünne Fäden aus rostfreiem Stahl, festgezurrt von einem Dutzend Haken. Wenn Tub etwas sagte, klickerte die Spange so laut, dass man glaubte, sie würde gleich Funken schlagen.
Immerhin war er groß, was man von mir nicht gerade behaupten konnte. Er stand stocksteif vor dem Spiegel, als wolle er eine Uniform zurechtrücken. Dann ließ er den Blick durch den Raum wandern, um sicherzustellen, dass wir allein waren.
»Guck mal.« Er schob eine Hand unter sein T-Shirt und holte aus seiner Achselhöhle einen so schweißnassen Fünf-Dollar-Schein, wie ich noch nie einen gesehen hatte. Er hielt ihn mir hin, wie um zu testen, ob ich ihn streicheln wollte. »Ich hab die ganze Zeit einen Fünfer dabeigehabt! Dieser Spacko wusste nur nicht, wo er nachschauen musste!«
»Dem hast du’s richtig gezeigt, Tub.«
»Ja, schon, oder?«
Er gluckste, faltete den Schein zusammen und klemmte ihn sich wieder unter die Achsel.
Als er sich das T-Shirt wieder über den Wanst zog, wurde sein Lächeln brüchig. Wenn es darum ging, Verletzungen mit Witzeleien zu überspielen, war Tub der reinste Kung-Fu-Meister. Doch manchmal ging ihm die Kraft aus, und dann schien er sich für einen Augenblick die bittere Wahrheit einzugestehen. In diesem Fall war die Wahrheit, dass ein unter die Achsel geklemmter feuchter Fünf-Dollar-Schein seinen größten Triumph darstellte.
Ich drückte auf den Knopf des Händetrockners und hoffte, dass meine nächste Frage in seinem Lärmen unterging.
»Hast du geweint?«
»Nein. Diesmal nicht.« Er zuckte mit den Schultern und fügte hinzu: »Nur ein bisschen.«
Unser Schweigen dauerte unangenehm lange. Aber auf Tub war Verlass: Er schaffte Abhilfe, indem er sich lautstark räusperte und einen Schleimbatzen in das Pinkelbecken spuckte. Dann klopfte er mir auf die Schulter und ging zur Tür. Ich blieb kurz stehen und sah zu, wie der blutige Rotzklumpen sich in der Pisse eines Fremden auflöste. Ich fand, der Anblick passte zu unserem Leben. Als ich Tub nach draußen folgte, verspürte ich den Impuls, noch einmal zurückzugehen. Ich hätte schwören können, dass aus dem Abfluss des Pinkelbeckens ein Gurgeln zu hören war, das von irgendwo weit unter dem gekachelten Fußboden kam.
4
Die Mathematik hatte es auf mich abgesehen. Das wusste ich schon lange. Insgesamt war ich ein durchschnittlicher Schüler, aber die Symbole für Multiplikation und Division stachen mir wie Bajonette ins Hirn. An diesem Freitag half es auch nichts, dass Ms. Pinkton schlecht gelaunt war. Als die Vorsitzende der Schülermitverwaltung die morgendlichen Bekanntmachungen verlas, konnte sie nicht verbergen, wie aufgeregt sie wegen des Fests der Gefallenen Blätter war, wegen Shakespeare auf der 50-Yard-Linie, des Spiels gegen die Connersville Colts und der feierlichen Enthüllung des lange herbeigesehnten Jumbotrons. All das brachte die Pinkton auf die Palme.
»Eine Anzeigetafel«, schimpfte sie. »Warum schaffen wir keine neuen Bunsenbrenner an statt dieser lebensgefährlichen Flammenwerfer, die wir im Labor haben? Oder Taschenrechner für Stochastik? Ein WLAN, das zur Abwechslung mal funktioniert? Und habt ihr euch mal die Schweineföten angeschaut, die im Anatomieunterricht seziert werden? Die eine Hälfte ist völlig entstellt und die andere vom Gefrierbrand zerfressen.«
Sie hatte vollkommen recht. Was an unserer Schule wirklich zählte, kam ganz in dem Geräusch zum Ausdruck, das zwei Klassenzimmer weiter zu hören war: FLAPP, FLAPP. Wegen ihrer Ansichten hätte Ms. Pinkton einem Versager wie mir eigentlich sympathisch sein müssen, bloß ließ sie ihren Frust an den Schülern aus. Ich hoffte nur, in diesem Halbjahr das Schlimmste zu verhindern und mich mit einer Vier über die Runden zu retten. Wenn ich mir eine Chance darauf bewahren wollte, musste ich bei der Schulaufgabe am nächsten Freitag achtundachtzig Prozent erreichen, das hatte mir die Pinkton die ganze Woche eingebläut.
Es gehörte wesentlich zu Ms. Pinktons krankhaftem Zustand, Schüler öffentlich zu erniedrigen. Unerbittlich rief sie ihre Opfer reihenweise an die Tafel, um sie mit einem Kamikaze-Geschwader quadratischer Gleichungen niederzustrecken. Ich versteckte mich hinter einem Buch und versuchte, meine blanke Angst zu verbergen, indem ich so tat, als sei ich in einen faszinierenden Text vertieft. Das ging fünfunddreißig Minuten lang gut, aber dann spitzte ich über den Rand des Buches hinaus. Claire Fontaine stand an der Tafel, und das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen.
Was auch immer Claire tat – ich hätte mir alles am liebsten immer wieder in Zeitlupe angesehen. Mathe war da keine Ausnahme. Wenn sie an der Tafel stand, schoss die Kreide hinauf und tänzelte wieder nach unten. Ihr ausgewaschenes Sweatshirt dehnte sich hierhin und dorthin. Sie strich sich die langen schwarzen Haare hinter das Ohr und hinterließ auf ihnen hinreißende Streifen aus weißem Kreidestaub. Claire war wunderschön, wenn auch nicht im herkömmlichen Sinn. Die angesagten Mädchen fanden sie nicht dünn genug. Außerdem tuschelten sie darüber, dass sie sich weder schminkte noch ihre Haare in Ordnung hielt. Und ihre Kleidung – tja, was sollte man dazu sagen? Ihre Stiefel waren nicht kniehoch und sexy, sondern gingen ihr nur bis zu den Knöcheln, hatten Gummisohlen und sahen eher wie Wanderschuhe aus. Ihre Klamotten waren alt, aber ohne jeden Retro-Charme. Sie schienen eher aus den Magazinbeständen des Militärs zu stammen: erbsengrüne Mäntel, sandfarbene Röcke und Cargohosen mit Unmengen von Seitentaschen. All diese Kleidungsstücke sahen aus, als hätten sie den Zweiten Weltkrieg an vorderster Front mitgemacht. Und die Baskenmütze, die sie vor und nach der Schule trug, war keine von der Sorte »Guckt mal, wie französisch ich bin«, sondern ging eher in die Richtung »Ich werde in euer Land einmarschieren und dort eine Diktatur errichten«.
Nur eines passte nicht in das Bild, das sie abgab: ein grellpinker, ausgesprochen mädchenhafter Rucksack, der unerklärlicherweise weder einen revoluzzerhaften Aufnäher noch eine einzige Edding-Schmiererei trug. Die meisten Schüler fanden, dass Claire durch diesen makellosen Rucksack noch seltsamer wirkte. Mir dagegen kam es vor, als schenke sie ihm keine besondere Beachtung. Für sie war er einfach nur ein guter Rucksack.
Das alles soll aber nicht heißen, dass Claire sich nicht auch weiblich gab. Ganz im Gegenteil. Es war ihr nur einfach nicht das Wichtigste. Sie war zwar erst seit einem halben Jahr an unserer Schule, doch alle wussten, dass es in ihrem Leben auch noch andere Dinge gab. Die coolen Mädchen sahen das als Regelverletzung an, aber Claire schien diese ungeschriebenen Gesetze nicht zu kennen, vielleicht weil sie nicht aus Kalifornien stammte. Sie kam von jenseits des großen Teichs. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Claire Fontaine stammte aus England. Ganz recht, sie sprach mit britischem Akzent. Ich glaube, jetzt könnt ihr euch allmählich ein Bild von ihr machen.
Die Europäer müssen uns in Sachen Mathematik um Längen voraus sein. Anders kann ich mir nicht erklären, warum Claire komplizierte Gleichungen quasi mit links in ihre Einzelteile zerlegte. In ihrer Hand zerbröselte die Kreide zu Staub. Wenn sie eine Gleichung gelöst hatte – und sie löste jede Gleichung –, schmetterte sie einen Punkt hinter das Ergebnis, als würde sie einen Satz abschließen.
»Interpunktion ist hier überflüssig«, sagte die Pinkton. »Aber dennoch: eine reife Leistung, Claire.«
Sie schnaufte, als hätte sie einen Feind niedergerungen. Dann nahm sie den Schwamm und wischte die Tafel ab, schrieb eine neue Zeile Kauderwelsch an und spähte im Klassenzimmer nach ihrem nächsten Opfer.
»Für eine Gleichung haben wir noch Zeit. Freiwillige vor. Das ist gute amerikanische Tradition.«
Ich neigte den Kopf, um meine Versunkenheit in den Text noch stärker zu betonen. Ms. Pinktons Blick glitt über mich hinweg, und ich war schon ganz stolz auf meine schauspielerische Leistung. Doch dann passierte das Unglück: Während Claire zu ihrem Pult zurückstolzierte, klatschte sie in ihre mit Kreide bestäubten Hände, sodass sie immer wieder wie ein Rockstar aus dem Nebel auftauchte. Einmal fiel ihr Blick dabei auf mich, und ich konnte nicht anders, als sie anzustarren. Sie verzog den Mund zu einem sarkastischen Lächeln.
»Cheers, Mr. Sturges«, sagte sie.
Bei diesem Akzent verlor ich regelmäßig die Kontrolle über die unterschiedlichsten Körperteile. Diesmal machte sich Ms. Rechte Hand selbstständig. In einer übereifrigen Geste schoss sie nach oben, als wäre Claire kilometerweit entfernt, und auch Señor Dummes Mundwerk schaltete sich ein: »Cheers, Claire!«
»Bist du das, Jim?«, fragte die Pinkton. »Das ist ja eine nette Überraschung. Mal schauen, ob du diesen Knoten entwirren kannst.«
Mein Lächeln fiel in sich zusammen, und ich starrte auf die Gleichung. Die Tafel sah aus, als hätten sich das Alphabet und das Zahlensystem darauf erbrochen. Ich verzog das Gesicht und spürte die Prellung auf meiner Wange. Ich überlegte, ob ich Ms. Pinkton meine Verletzungen zeigen und ihr erklären sollte, dass ich unmöglich den weiten Weg zur Tafel gehen könnte, ohne dabei wegen der rasenden Schmerzen loszuheulen. Doch ich sah sie einfach nur flehend an.
Sie zeigte mir die »Stinkekreide«, wie wir es nannten, indem sie die Kreide so in der Hand hielt, dass sie aussah wie der ausgestreckte Mittelfinger.
Ich wappnete mich für das, was kommen würde, ging nach vorn, nahm die Kreide und stellte mich vor die Tafel. Als ich direkt davor stand, hob ich, ohne zu überlegen, den Arm. Erst in dem Moment erkannte ich, dass die Pinkton die Gleichung so weit oben angeschrieben hatte, wie Claires ausgestreckter Arm reichte, also etwa zehn Zentimeter höher, als ich selbst kam. Ich konnte die Aufgabe nicht einmal erreichen, geschweige denn lösen. Ich ließ das Lachen über mich ergehen, das in meinem Rücken laut wurde. Meine Sicht verschwamm, und der aufgewirbelte Kreidestaub verwandelte sich in Nebel. In einen Londoner Nebel, durch den atemberaubende Mädchen liefen, die aussahen wie Claire Fontaine, Baskenmützen trugen und abwechselnd gefährliche Gleichungen lösten und mit kleinen mutigen Männern energische Küsse tauschten.
5
Im Lauf der Geschichte hat sich immer wieder erwiesen, dass in den Herzen von Kindern mit Koordinationsproblemen nichts so starke Angst auslöst wie ein Seil, das von der Decke einer Turnhalle baumelt. Im Jahr zuvor hatte Tub deswegen sogar offiziell Beschwerde beim Schulsekretariat eingelegt, was ein Gespräch mit Direktor Cole zur Folge hatte. Tub hatte darauf beharrt, dass das Seil ein barbarisches Instrument sei. Außerdem stehe die Schule dabei in der Verantwortung: Was, wenn ein Schüler aus sechs oder sieben Metern Höhe auf den Boden fiel und für den Rest seines Lebens gelähmt war? Baseball – in Ordnung. Volleyball – okay. Mit diesen Sportarten konnte man im späteren Leben durchaus noch einmal zu tun haben. Aber wann zum Teufel stand man als Erwachsener vor einem Seil, das verzweifelt darauf wartete, dass jemand an ihm hinaufkletterte? Wie Tub erzählte, hatte er Direktor Cole voll in der Hand, bis ihm dieses zum Teufel rausrutschte. Bei Flüchen kannte Cole keine Gnade. Im nächsten Moment fand sich Tub vor der Tür wieder, und die Seile blieben, wo sie waren.
Tub und ich hatten als Einzige noch nicht die Mitte des Seils, das Minimalziel, erreicht. Während die anderen Jungs schon Basketball spielten, strampelte ich mich anderthalb Meter über dem Boden ab und fragte mich, wie die Steve Jorgensen-Warners dieser Welt es schafften, alle vier Gliedmaßen unabhängig voneinander zu bewegen. Ich hielt den Atem an und schob mich ein paar Zentimeter weiter nach oben. Meine Handflächen brannten, meine Beine fühlten sich an wie Pudding, und meine einzige Sorge war, wie ich bei einem Sturz meine empfindlichsten Körperteile schützen könnte.
»Los, Sturges!«, rief Coach Lawrence, unser Sportlehrer. »Schwung ist alles beim Klettern!«
Ich hörte ein Grunzen und sah zu dem Seil neben mir. Anders als ich mit meinen unregelmäßigen, ruckartigen Bewegungen schob Tub sich beständig nach oben, wenn auch im Schneckentempo. Der Schweiß troff ihm aus allen Poren, und sein vor Anspannung aufgerissener Mund entblößte sein metallenes Gebiss. Er zitterte am ganzen Körper, als würde er im nächsten Augenblick explodieren.
»Genau! Jetzt hast du’s raus, Tub!« Vor Aufregung sprach Coach Lawrence Tobias nicht, wie es sich gehörte, mit Nachnamen an. »Diesem Seil wirst du’s ordentlich zeigen! Gib jetzt bloß nicht auf! Ein echter Mann gibt nicht auf!«
»Möge der Herr mich zu sich holen«, winselte Tub. »Oder von mir aus der Leibhaftige.«
»Noch ein Meter«, sagte ich schnaufend. »Setz deine Schultern ein.«
»Was zum Teufel soll das heißen?«
»Keine Ahnung.«
»Dann hör mit diesem Motivationsgequatsche auf.«
»Okay«, sagte ich mit gepresster Stimme. »Wenn diese Seile doch bloß Schlingen hätten.«
»Ja, Mann, das wär klasse. Ein schneller, sanfter Tod. Und schmerzlos.«
Unter uns war ein Sprechgesang laut geworden: »Tub! Tub! Tub!« Ich sah hinab und bekam mit, wie Coach Lawrence zusammenzuckte. Er hatte den Spitznamen verwendet und damit die Anfeuerungsrufe ausgelöst. Ich konzentrierte mich wieder auf mein Seil. Die Mitte war mit einem roten Band markiert, das keine dreißig Zentimeter mehr entfernt war. Ich brauchte es nur zu berühren, dann konnte ich mich zu den Zuschauerplätzen schleppen und über meine zerstörten Muskeln jammern. Ruckartig holte ich Luft und griff mit schweißüberströmter Hand nach der Markierung. Die Fäden des Seils brannten sich wie glühende Eisendrähte in meine Handflächen.
»Los, Sturges!«, rief Coach Lawrence. »Gib alles!«
Ich war vor Anstrengung so benebelt, dass ich glaubte, ich würde es schaffen. Dann hörte ich, wie Tub plötzlich aufjaulte. Ich sah zu ihm hinüber. Er wackelte mit dem Kopf, wie um einer Biene auszuweichen. Weil unsere Seile schlingerten, konnte ich ihn nur schwer ins Auge fassen, doch ich erkannte das Problem: Ein Faden des Hanfseils hatte sich in seiner Zahnspange verfangen. Er verdrehte die Augen, und mir war klar, was er in seiner Panik befürchtete: Wenn er jetzt abrutschte, würde das Seil ihm den kompletten Unterkiefer herausreißen.
Sein Seil fing an, sich zu drehen. Ich holte mit einem Arm aus, um ihn anzuhalten, spürte aber nur kurz, wie er nach meiner Hand griff, bevor sein Gewicht ihn nach unten zog. Natürlich riss der Faden im selben Moment, und Tub sauste vor versammelter Mannschaft mit dem Hintern auf den Boden.
Bevor ich mit der Hand, die ich nach Tub ausgestreckt hatte, wieder mein eigenes Seil fassen konnte, fing ich an, damit herumzurudern, meine Füße glitten ab, und ich baumelte an einem Arm am Seil. Anders als Tub versuchte ich, mich festzuhalten, und rutschte das Seil hinab, das mir die Handflächen verbrannte, bis ich mit den Knien auf dem Boden aufschlug. Der Schmerz des Aufpralls schoss mir bis in den Schädel.
Coach Lawrence half uns beiden auf. Tub sah elend und geschunden aus, als hätte er sich seiner Fettleibigkeit ergeben. Der Sprechgesang mit seinem Namen, der kurze Zeit wie ernst gemeint klang, hatte sich in Gejohle und Geheule verwandelt. Nur ein vereinzelter Basketball ließ sein fortwährendes FLAPP, FLAPP hören. Schließlich rappelte Tub sich auf und rieb sich den geprellten Hintern. Genau in diesem Moment segelte der Basketball über die Köpfe der Umstehenden hinweg und knallte ihm ins Gesicht. Ein mördermäßiger Wurf, ohne Frage.
6
Schon zum zweiten Mal an diesem Freitag reinigten Tub und ich unsere Wunden. Diesmal hatte keiner von uns etwas parat, um die Stimmung aufzuhellen. Wir hatten in der Dusche herumgetrödelt, wo unser Blut im Abfluss in der Mitte des Raums verschwunden war. Wir waren die letzten in der Umkleide. Ich war schon fast angezogen, aber Tub saß noch tropfend und wie versteinert am anderen Ende der Bank, mit abgewandtem Gesicht und nichts als einem Handtuch um die Hüften.
»Lass dich von denen nicht ärgern, Tub.«
Das klang wie der Rat eines Lehrers, aber mir fiel einfach nichts Besseres ein.
»Herzlichen Dank auch für diesen unendlich vernünftigen und total nutzlosen Ratschlag, Herr Vertrauenslehrer.«
»Sie sind nicht unsere Freunde. Warum sollten wir uns dann darüber Gedanken machen, was sie von uns halten?«
»Und wer sind unsere Freunde, Jim? Zähl sie mir doch mal auf. Die null Sekunden, die das dauert, habe ich locker.«
»Red keinen Unsinn. Wir haben sehr wohl Freunde.«
»Ich meine nicht die Art von Freunden, die nur in Chatrooms existieren. Oder die katzen- oder hundeartigen. Ich rede von echten, menschlichen Freunden, die tun, was Menschen so tun: mit einem quatschen, abhängen, mit Messer und Gabel essen. Wäre das nicht klasse, Jim? Freunde, die mit Messer und Gabel umgehen können? Das wäre doch ein echter Fortschritt für uns.«
Er warf mir über die Schulter einen finsteren Blick zu.



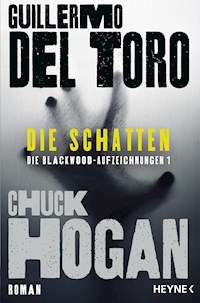















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









