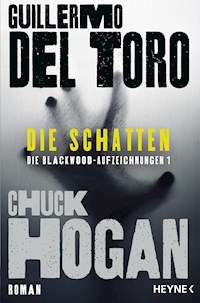14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein unglaubliches Geheimnis und eine unmögliche Liebe, die alle Grenzen überschreitet Der Mystery-Erfolg von SPIEGEL-Bestseller-Autor Guillermo del Toro Ein geheimes US-Militärlabor 1963: Im streng gesicherten Labortrakt F-1 wird eine Kreatur aus dem Amazonas gefangen gehalten, deren Erforschung einen Durchbruch im Wettrüsten des Kalten Krieges liefern soll. Doch eines Nachts entdeckt die Reinigungskraft Elisa das Wesen, das halb Mann und halb Amphibie ist. Die stumme junge Frau tut etwas, woran noch kein Wissenschaftler gedacht hat: Sie bringt dem Wasserwesen die Gebärdensprache bei und beginnt so entgegen aller Regeln eine vorsichtige, geheime Freundschaft mit ihm. Als sie erfährt, dass das »Projekt« schon bald auf dem Seziertisch enden soll, muss Elisa alles riskieren, um ihren Freund zu retten… Die ungewöhnlichste Liebesgeschichte des Jahres: Daniel Kraus und Guillermo del Toro erzählen ein ebenso unheimliches wie anrührendes Märchen für Erwachsene. Das neue Meisterwerk von Kultregisseur Guillermo del Toro und die Romanvorlage zum preisgekrönten Blockbuster "Shape Of Water - Das Flüstern des Wassers": nominiert für 13 Oscars!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Daniel Kraus / Guillermo del Toro
The Shape of Water
Roman
Ins Deutsche übertragen von Kerstin Fricke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Roman zum nächsten Hollywood-Blockbuster von Kult-Regisseur Guillermo del Toro
Ein geheimes US-Militärlabor 1963: Im streng gesicherten Labortrakt F-1 wird eine Kreatur aus dem Amazonas gefangen gehalten, deren Erforschung einen Durchbruch im Wettrüsten liefern soll. Doch eines Nachts entdeckt die Reinigungskraft Elisa das Wesen, das halb Mann und halb Amphibie ist. Elisa tut etwas, woran noch kein Wissenschaftler gedacht hat: Sie bringt dem Wasserwesen die Gebärdensprache bei. Als sie erfährt, dass das »Projekt« bald auf dem Seziertisch enden soll, weiß Elisa, dass sie ihren Freund retten muss – aus einem abgeriegelten Labor, einen sadistischen General ebenso im Nacken wie russische Spione …
Neue Mystery-Hochspannung für alle Fans von »Hellboy« oder »Pans Labyrinth«
Inhaltsübersicht
Motto
Organanlage
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Ungebildete Frauen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Kreative Taxidermie
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
Quäle dein Herz nicht mehr
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Danksagung
Für die Liebe in ihren vielen Formen und Facetten
Schnell wie des Wassers Fall kommt der Tod,
flüchtig wie das Trudeln von Blüte und Blatt.
So schnell, wie man einmal Atem holt,
so bald auch die Trauer ein Ende hat.
Conrad Aiken
Wenn du so oder so durch das Wasser waten musst,
ist es egal, ob es warm oder kalt ist.
Pierre Teilhard de Chardin
Organanlage
1
Richard Strickland liest den Auftrag von General Hoyt in elftausend Fuß Höhe. Die Doppelpropellermaschine wird so heftig herumgeschleudert wie der Boxsack eines Schwergewichtlers. Dies ist der letzte Abschnitt von Stricklands Reise von Orlando über Caracas und Bogotá nach Pijuayal, dem Loch im Arsch des Dreiländerecks zwischen Brasilien, Peru und Kolumbien. Die Anweisungen sind kurz und voller Schwärzungen. In der Poesie des Army-Jargons geben sie die Legende eines Dschungelgotts wieder, den die Brasilianer Deus Brânquia nennen. Hoyt verlangt, dass Strickland die angeheuerten Jäger begleitet. Er soll ihnen helfen, dieses Ding, was immer es auch sein mag, zu fangen und es in die Vereinigten Staaten bringen.
Strickland kann es kaum erwarten, die Sache hinter sich zu bringen. Das wird seine letzte Mission für General Hoyt sein, da ist er sich ganz sicher. Die Dinge, die er unter Hoyts Kommando in Korea tun musste, haben ihn zwölf Jahre lang an den Mann gefesselt. Ihre Beziehung gleicht einer Art Erpressung, und Strickland will sie endlich beenden. Nach diesem Job, dem größten seiner Laufbahn, wird er genug Geld haben, um aus Hoyts Diensten auszuscheiden. Dann kann er nach Hause gehen, nach Orlando, zu Lainie und den Kindern Timmy und Tammy. Dann kann er der Ehemann und Vater sein, der er dank Hoyts Drecksarbeit bisher nicht hatte sein können. Er kann ein völlig neuer Mann werden. Kann frei sein.
Er wendet sich wieder den Unterlagen zu. Geht in den gefühllosen Militärmodus über. Diese jämmerlichen Arschgeigen da unten in Südamerika. Natürlich ist nicht etwa der miese Ackerbau für ihre Armut verantwortlich, sondern ein Kiemengott, der sich über ihren Umgang mit dem Dschungel ärgert. Auf den Seiten prangen Flecken, weil die Maschine nicht dicht ist. Strickland wischt die Feuchtigkeit an einem Hosenbein ab. Da steht, dass das US-Militär der Ansicht ist, der Deus Brânquia könne von entscheidender militärischer Bedeutung sein. Stricklands Aufgabe ist es, die »US-Interessen« im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass seine Leute »motiviert« sind, wie Hoyt es so schön ausdrückt, und er weiß aus erster Hand, was Hoyt über Motivation denkt.
Er muss an Lainie denken, will das aber angesichts der Dinge, die er bald tun muss, lieber vermeiden.
Der portugiesische Pilot flucht zu Recht. Die Landung ist der reinste Albtraum, denn die Landebahn ist vom Dschungel regelrecht zerhackt worden.
Strickland taumelt aus dem Flieger und stellt fest, dass die Hitze die Luft zum Flimmern bringt. Ein Kolumbianer in einem T-Shirt der Brooklyn Dodgers und Hawaiishorts winkt ihn an einen Pick-up heran. Das kleine Mädchen auf der Ladefläche wirft Strickland eine Banane an den Kopf, aber ihm ist vom Flug noch so übel, dass er nicht darauf reagiert. Der Kolumbianer fährt ihn in die Stadt, die aus drei Blöcken klappernder Obstwagen mit Holzrädern und schuhlosen, dickbäuchigen Kindern zu bestehen scheint. Strickland geht an den Ständen vorbei und kauft, wonach ihm der Sinn steht: ein Feuerzeug, einen Becher dünne Limonade, verschließbare Plastiktüten und Fußpuder. Auf den Ladentheken, über die er die Pesos schiebt, hat die Luftfeuchtigkeit Tropfen hinterlassen.
Im Flugzeug hat er ein paar Sätze aus dem Sprachführer auswendig gelernt. »Você viu Deus Brânquia?«
Die Händler kichern und wedeln mit den Händen vor ihren Hälsen herum. Strickland hat nicht die leiseste Ahnung, was sie ihm damit sagen wollen. Diese Leute riechen streng und metallisch wie frisch geschlachtetes Vieh. Er geht über eine Asphaltstraße, die unter seinen Schuhen schmilzt, und sieht eine dürre Ratte im schwarzen Schlamm zappeln. Das Tier stirbt, und zwar langsam. Seine Knochen werden ausbleichen und in den Teer sinken. Dies ist die schönste Straße, die Strickland in den nächsten anderthalb Jahren sehen wird.
2
Der Wecker klappert auf dem Nachttisch. Ohne die Augen zu öffnen, tastet Elisa nach dem eiskalten Ausschalter. Sie wurde aus einem tiefen, sanften, warmen Traum gerissen und will dahin zurück, wenigstens für eine weitere wundervolle Minute. Aber der Traum verflüchtigt sich, so wie immer. Da war Wasser, dunkles Wasser – so viel weiß sie noch. Sehr viel Wasser, das Druck auf sie ausgeübt hat, und doch ist sie nicht ertrunken. Sie hat darin sogar besser atmen können als jetzt im Wachzustand, in diesem Leben mit den zugigen Räumen, dem billigen Essen und der unzuverlässigen Elektrizität.
Von unten dröhnt Tubalärm herauf, und eine Frau schreit. Elisa seufzt in ihr Kissen. Es ist Freitag, und ein neuer Film ist im Arcade Cinema Marquee angelaufen, dem Kino unter ihrer Wohnung, in dem rund um die Uhr Filme gezeigt werden. Das bedeutet neue Dialoge, Soundeffekte und Musikschnipsel, die sie in ihre Aufwachrituale integrieren muss, wenn sie sich nicht ständig zu Tode erschrecken will. Jetzt sind Trompeten zu hören und unzählige brüllende Männer. Sie schlägt die Augen auf und sieht zuerst, dass es 22.30 Uhr ist, danach fällt ihr das Licht des Filmprojektors ins Auge, das zwischen den Bodenbrettern hindurchschimmert und die Wollmäuse in Technicolor erstrahlen lässt.
Sie setzt sich auf und zieht vor Kälte die Schultern ein. Warum riecht es nach Kakao? Der seltsame Geruch wird von einem unangenehmen Geräusch begleitet: einem Feuerwehrfahrzeug nordöstlich von Patterson Park. Elisa setzt die Füße auf den kalten Boden und beobachtet das flackernde und sich verändernde Projektorlicht. Dieser neue Film ist heller als der letzte – ein Schwarz-Weiß-Film mit dem Titel Tanz der toten Seelen –, und die bunten Farben ergießen sich zu ihren Füßen. Schon ist sie in einem Wunschtraum gefangen, in dem sie sehr viel Geld hat und ihr kriecherische Verkäufer zahlreiche farbenfrohe Schuhe überstreifen. Sie sehen umwerfend aus, Miss. In diesen Schuhen können Sie die Welt erobern.
Stattdessen hat die Welt sie erobert. Selbst der ganze Schnickschnack, den sie für ein paar Pennys auf Garagenflohmärkten gekauft und an die Wände gehängt hat, lenkt nicht von den Käfern ab, die die Flucht ergreifen, sobald sie das Licht einschaltet. Elisa ignoriert sie, denn sonst könnte sie hier keine Nacht überstehen, geschweige denn mehrere Tage oder gar ihr restliches Leben. Sie geht zur Kochnische, stellt die Eieruhr, legt drei Eier in einen Topf mit Wasser und wandert weiter ins Badezimmer.
Elisa geht ausschließlich baden. Sie zieht sich den Flanellschlafanzug aus, während sie das Wasser einlässt. Berufstätige Frauen lassen immer ihre Zeitschriften auf den Tischen der Cafeteria liegen, und zahllose Artikel haben Elisa genau erklärt, welche Maße ihr Körper haben soll. Doch ihre Hüften und Brüste lenken nicht ab von den aufgeworfenen rosafarbenen Narben, die die Seiten ihres Halses zieren. Sie beugt sich vor, bis sie mit einer nackten Schulter gegen das Spiegelglas stößt. Jede Narbe ist genau sieben Komma sechs Zentimeter lang und reicht von der Halsschlagader bis zum Kehlkopf. Die Sirenen in der Ferne scheinen lauter zu werden. Sie lebt seit dreiunddreißig Jahren in Baltimore, ihr ganzes Leben lang, und hört daher, dass der Feuerwehrwagen den Broadway herauffährt. Ihre Halsnarben sind auch eine Straßenkarte, nicht wahr? Doch an diese Orte erinnert sie sich besser nicht.
Als sie mit den Ohren ins Badewasser taucht, werden die Kinogeräusche lauter. »Für Kemosch sterben heißt ewig leben«, ruft ein Mädchen im Film. Elisa ist sich nicht sicher, ob sie das richtig verstanden hat. Sie nimmt ein Seifenstück zwischen die Hände und genießt es, sich nasser als das Wasser zu fühlen und so schlüpfrig, als könnte sie wie ein Fisch durch die Flüssigkeit gleiten. Die Empfindungen ihres Traums drücken sie nieder wie ein schwerer Männerkörper. Es passiert plötzlich und ist ebenso überwältigend wie erotisch, sodass sie ihre eingeseiften Finger zwischen ihre Beine wandern lässt. Sie hatte Verabredungen, hat mit Männern geschlafen, das kennt sie alles – aber es ist Jahre her. Männer, die eine stumme Frau kennenlernen, nutzen sie aus. Bei keinem einzigen Date hat ein Mann versucht, mit ihr zu kommunizieren, nicht richtig zumindest. Sie haben sie sich einfach nur geschnappt und sich genommen, was sie haben wollten, als wäre sie nicht nur sprachlos wie ein Tier, sondern wirklich eines. Das hier ist besser. Der Mann aus dem Traum ist besser, mag er auch noch so verschwommen sein.
Aber der Timer, das teuflische kleine Ding, klingelingelingelt. Elisa prustet und schämt sich, obwohl sie allein ist, steht auf, und ihre nassen Gliedmaßen glitzern. In Bademantel und Hausschuhen läuft sie zitternd in die Küche, schaltet den Herd aus und nimmt die schlechte Nachricht zur Kenntnis: Es ist 23.07 Uhr. Wann hat sie denn so viel Zeit verloren? Sie zieht sich irgendeinen BH an, streift irgendeine Bluse über und greift sich irgendeinen Rock. In diesem Traum hat sie sich unglaublich lebendig gefühlt, aber jetzt ist sie ebenso träge wie die Eier, die auf einem Teller abkühlen. Auch hier im Schlafzimmer hängt ein Spiegel, doch sie schaut lieber nicht hinein. Nur für den Fall, dass ihre Ahnung sich bewahrheitet und sie tatsächlich unsichtbar ist.
3
Sobald Strickland das fünfzehn Meter lange Flussschiff gefunden hat, benutzt er sein neues Feuerzeug, um Hoyts Anweisungen vorschriftsgemäß zu verbrennen. Jetzt ist das ganze Ding schwarz, denkt er, komplett geschwärzt. Wie alles hier bietet ihm auch das Boot den vom Militär gewohnten Standard: Es ist auf Müll genagelter Müll. Der Schornstein ist mit gehämmertem Blech geflickt. Die Reifen an den Seitendecks sehen platt aus. Ein zwischen vier Stangen gespanntes Laken bietet den einzigen Schatten. Es wird verdammt heiß werden. Das ist gut. Die Hitze verbrennt die quälenden Gedanken an Lainie, an ihr kühles, sauberes Zuhause, an das Flüstern der Palmen in Florida. Die Hitze wird sein Gehirn zum Kochen bringen, bis er die Art von Zorn entwickelt hat, die für eine solche Mission benötigt wird.
Schmutziges braunes Wasser dringt zwischen den Brettern des Docks hervor. Einige Crewmitglieder sind weiß, manche gebräunt, andere rotbraun. Mehrere sind bemalt und gepierct. Alle schleppen Kisten über eine Planke, die sich bei ihrem Gewicht erschreckend stark durchbiegt. Strickland folgt ihnen zum Rumpf, auf dem Josefina steht. Kleine Bullaugen lassen auf das Vorhandensein von Kabinen schließen, die vermutlich gerade groß genug für den Kapitän sind. Allein das Wort »Kapitän« ärgert Strickland. Hier hat allein Hoyt das Sagen, und Strickland ist sein Stellvertreter. Er hat keine Lust auf aufgeblasene Schiffslenker, die sich zum Boss aufschwingen wollen.
Er entdeckt den Kapitän, einen bebrillten Mexikaner mit weißem Bart, weißem Hemd, weißer Hose und weißem Strohhut, der mit ausschweifenden Gesten irgendwelche Dokumente unterzeichnet. Der Mann ruft: »Mister Strickland!«, und Strickland hat das Gefühl, in eine der Zeichentrickserien seines Sohnes versetzt worden zu sein, in der jemand »Meester Streekland!« schreit. Irgendwo über Haiti hat er sich den Namen des Kapitäns eingeprägt: Raúl Romo Zavala Henríquez. Irgendwie passend, da auch der Name normal anfängt, um sich dann ins Pompöse aufzublasen.
»Sehen Sie! Escocés und puros cubanos, mein Freund, nur für Sie.« Henríquez reicht ihm eine Zigarre, zündet sich selbst eine an und schenkt ihnen Scotch ein. Strickland trinkt normalerweise während einer Mission nicht, aber er erwidert Henríquez’ Toast. »To la aventura magnífico!« Sie trinken, und Strickland muss sich eingestehen, dass es ein gutes Gefühl ist. Alles ist gut, was ihm hilft, den erdrückenden Schatten von General Hoyt für eine Weile zu ignorieren und was es für Stricklands Zukunft bedeutet, wenn es ihm nicht gelingt, Henríquez angemessen zu »motivieren«. Solange die Wirkung des Drinks anhält, passt sich die Hitze in seinem Körper der des Dschungels an.
Henríquez ist ein Mann, der zu viel Zeit mit dem Erzeugen von Rauchringen verbracht hat – sie sind perfekt.
»Rauchen, trinken, genießen! Das ist der ganze Luxus, den Sie für einige Zeit haben werden. Gut, dass Sie nicht später gekommen sind, Mister Strickland. Die Josefina will unbedingt ablegen. Wie der Amazonas wartet auch sie auf keinen Mann.« Strickland gefällt der Vergleich nicht. Er stellt sein Glas ab und sieht sein Gegenüber an. Henríquez klatscht lachend in die Hände. »Ganz genau. Männer wie wir, Gefangene der Sertão, müssen ihre Aufregung nicht zeigen. Los brasileños ehren uns mit einem Wort: sertanista. Das klingt gut, sí? Es bringt das Blut in Wallung, nicht wahr?«
Henríquez berichtet in quälender Detailliertheit von seiner Reise zu einem Außenposten des Instituto de Biologia Marítima. Er behauptet, er hätte eigenhändig – mit seinen eigenen dos manos! – Kalksteinfossilien transportiert, die auf den Deus Brânquia hinweisen. Laut der Wissenschaftler stammen diese Fossilien aus der devonischen Periode, die, »hätten Sie es gewusst, Meester Streekland«, Teil des Paläozoikums gewesen ist. »Das ist es, was Männer wie uns an den Amazonas zieht«, behauptet Henríquez. »Hier existiert noch primitives Leben. Hier kann man in der Zeit zurückreisen und das Unberührbare anfassen.«
Strickland hält seine Frage eine Stunde lang zurück. »Haben Sie die Karte erhalten?«
Henríquez drückt seine Zigarre aus und wirft sie durch das Bullauge. Dann grinst er breit und macht gebieterische Gesten.
»Sehen Sie die Gesichtstattoos? Die Nasenpflöcke? Das sind keine Indianer wie Ihr Tonto. Das sind índios bravos. Sie kennen jeden Kilometer des Amazonas, vom Negro-Branco bis nach Xingu, aus dem Effeff. Sie gehören vier verschiedenen Stämmen an. Und ich konnte sie als unsere Führer anwerben! Unsere Expedition kann sich unmöglich verirren, Mister Strickland.«
»Haben Sie die Karte erhalten?«, wiederholt Strickland seine Frage.
Henríquez fächelt sich mit seinem Hut Luft zu. »Ihre Amerikaner haben mir Kopien geschickt. Alles in Ordnung. Unsere expedição científica wird den gekritzelten Linien folgen, solange es möglich ist. Dann geht es zu Fuß weiter, Mister Strickland! Wir finden die vestigios, die Überreste der Urstämme. Diese Leute mussten mehr unter der Industrie leiden, als Sie es sich auch nur vorstellen können. Der Dschungel verschluckt ihre Schreie. Wir kommen hingegen in Frieden. Wir bringen Geschenke. Wenn der Deus Brânquia tatsächlich existiert, werden sie uns sagen können, wo wir ihn finden.«
Bedient man sich General Hoyts Ausdrucksweise, dann kann man den Kapitän als motiviert bezeichnen, das muss Strickland ihm lassen. Aber da sind auch Warnzeichen. Strickland hat genug Erfahrungen mit der Wildnis gemacht, um zu wissen, dass sie einen innerlich wie äußerlich zeichnet. Und man trägt keine weiße Kleidung, wenn man nicht ganz genau weiß, was zur Hölle man eigentlich vorhat.
4
Elisa nähert sich der westlichen Schlafzimmerwand erst im letzten Augenblick, damit der Anblick sie inspiriert. Der Raum ist nicht groß, also ist es die Wand auch nicht: zweieinhalb mal zweieinhalb Meter, und jeder Zentimeter ist mit Schuhen bedeckt, die sie im Laufe der Jahre in Billig- oder Secondhandläden gekauft hat. Federleichte Spectator-Pumps in Kirschrot und Braun. Zweifarbige Vintage-Schuhe mit breiter Zehenpartie. Champagnerfarbene Satin-Peeptoes mit hohen Absätzen, die an einen auf dem Boden liegenden Brautschleier erinnern. Westernstiefel mit Zehnzentimeterabsätzen in Knallrot, die am Fuß aussehen, als stünde man in weichen Rosenblättern. An den Seiten stehen hingegen die fleckigen Pantoletten, die Slingsandalen, die billigen Slipper und die hässlichen Nubukschuhe, die nur noch nostalgischen Wert haben.
Jeder Schuh hängt an einem kleinen Nagel, den sie als gewöhnliche Mieterin eigentlich gar nicht hätte in die Wand schlagen dürfen. Obwohl ihr die Zeit wegläuft, verharrt sie kurz und entscheidet sich schließlich für Daisy-Pumps mit einer blauen Lederblume auf einem durchsichtigen Plastikknöchelband, als wäre die Wahl der Schuhe von entscheidender Bedeutung. Das ist sie auch. Die Pumps werden heute wie an jedem Abend ihre einzige Art der Auflehnung sein. Die Füße sind das, was einen mit dem Boden verbindet, und wenn man arm ist, dann gehört einem nichts von dem, worauf man steht.
Sie setzt sich aufs Bett, um sich die Schuhe anzuziehen. Es kommt ihr vor, als wäre sie ein Ritter, der die Hände in Panzerhandschuhe schiebt. Während sie mit den Zehen wackelt, um den Sitz der Schuhe zu verbessern, fällt ihr Blick auf den Stapel alter LPs. Der Großteil davon wurde vor Jahren gebraucht gekauft, und fast alle sind mit Erinnerungen verknüpft, die zusammen mit der Musik in das Vinyl gepresst wurden.
The Voice of Frank Sinatra: der Morgen, an dem sie einem Schülerlotsen dabei geholfen hat, Tölpelküken hinter einem Abwassergitter hervorzuholen. Count Basies One O’Clock Jump: der Tag, an dem sie einen Baseball aus dem Memorial Stadium fliegen sah, selten wie ein Rotfußfalke, und gegen einem Feuerhydranten prallen. Bing Crosbys Stardust: der Nachmittag, an dem sie und Giles im Kino unten Stanwyck und MacMurray in Die unvergessliche Weihnachtsnacht sahen und Elisa den restlichen Tag auf dem Bett lag, die Nadel immer wieder auf die Schallplatte setzte und sich fragte, ob sie – wie Stanwycks Dieb mit dem goldenen Herzen – dieses Leben als eine Art Bestrafung durchleiden musste und ob jemand – wie MacMurray – auf sie warten würde an dem Tag, an dem man sie freiließ.
Genug: Das ist sinnlos. Niemand wartet auf sie, und es wird auch nie jemand tun, am wenigsten die Stechuhr bei der Arbeit. Sie zieht ihren Mantel über und greift sich den Teller mit den Eiern. Der seltsame Kakaogeruch hängt noch immer in der Luft, als sie durch den kurzen Flur geht, in dem unzählige eingestaubte Filmdosen herumstehen, in denen vermutlich einige Schätze auf Zelluloid verborgen sind. Zu ihrer Rechten befindet sich das einzige andere Apartment. Sie klopft zweimal an, bevor sie eintritt.
5
Keine Stunde später legen sie ab. Eine Wonne sei die Trockenzeit, sagen die Führer, die verão. Richtig schlimm wäre hingegen die Regenzeit, deren Namen Strickland nicht erfährt. Die Hinterlassenschaften der letzten Regenzeit sind die furos, die überfluteten Nebenarme an den Flussbiegungen. Die Josefina nutzt sie bei jeder Gelegenheit, doch sie lassen den Amazonas zu einem Tier werden. Er bäumt sich auf. Er versteckt sich. Er buckelt. Henríquez jauchzt vor Freude und drosselt den Motor, woraufhin sich giftiger schwarzer Rauch im grünen Dschungel ausbreitet. Strickland hält sich an der Reling fest und starrt ins Wasser. Es hat die Farbe von Vollmilchschokolade mit einem Schaumteppich aus Marshmallows. Viereinhalb Meter hohes Elefantengras ragt an den Ufern auf wie das Rückenhaar eines riesigen, erwachenden Bären.
Henríquez übergibt die Schiffssteuerung häufig an den Ersten Maat, um sich Notizen in seinem Logbuch zu machen. Er prahlt damit, dass er das alles später veröffentlichen und berühmt werden wird. Jeder wird den Namen des großen Forschers Raúl Romo Zavala Henríquez kennen! Er streichelt über den Ledereinband seines Logbuchs und träumt wahrscheinlich von einem Autorenfoto, auf dem er entsprechend selbstgefällig aussieht. Strickland schluckt seinen Hass, seinen Ekel und seine Furcht herunter. All das wäre ihm nur im Weg. Und es würde ihn verraten. Das hat ihn Hoyt in Korea gelehrt. Mach einfach deinen Job und am besten empfindest du rein gar nichts dabei.
Doch die Monotonie könnte sich als der heimtückischste Killer des Dschungels entpuppen. Tagein, tagaus folgt die Josefina dem endlosen Wasserstreifen durch wabernde Nebelschwaden. An einem Tag blickt Strickland auf und entdeckt einen großen schwarzen Vogel, der einem verschmierten Fleck gleich am blauen Himmel schwebt. Ein Geier. Jetzt, wo er ihn einmal bemerkt hat, sieht er ihn jeden Tag, wie er träge seine Kreise über ihren Köpfen zieht und nur auf Stricklands Ableben zu warten scheint. Strickland ist gut bewaffnet, er hat ein Stoner-M63-Sturmgewehr in der Kabine und eine Beretta im Holster, und er würde den Vogel am liebsten vom Himmel holen. Der Geier ist Hoyt, der ihn beobachtet. Er ist Lainie, die ihm Lebewohl sagt. Strickland ist sich nicht sicher, was von beidem zutrifft.
Das Wasser ist nachts trügerisch, daher ankern sie abends. Normalerweise steht Strickland allein am Bug. Soll sich die Crew doch den Mund zerreißen. Sollen die índios bravos ihn doch anstarren, als wäre er eine Art amerikanisches Monster. Der Mond gleicht an diesem besonderen Abend einem großen Loch, das in das Fleisch der Nacht geschnitten wurde und blasse, lumineszierende Knochen enthüllt. Strickland merkt nicht, dass Henríquez sich an ihn anschleicht.
»Haben Sie ihn gesehen? Den lustigen Pinken?«
Strickland ist wütend, jedoch nicht auf den Kapitän, sondern auf sich selbst. Welcher Soldat ließ seinen Rücken so ungeschützt? Außerdem wurde er dabei ertappt, wie er den Mond anstarrte. Das ist Weiberkram, etwas, das Lainie tun würde, während sie ihn bittet, ihre Hand zu halten. Er zuckt mit den Schultern und hofft, dass Henríquez wieder verschwindet. Stattdessen wedelt der Kapitän mit seinem Logbuch herum. Strickland sieht in die Ferne und bemerkt eine geschmeidige Silhouette und silbern aufspritzendes Wasser.
»Boto«, sagt Henríquez. »Flussdelfin. Was denken Sie? Zwei Meter? Zweieinhalb? Nur die Männchen sind so pink. Wir können von Glück reden, einen zu sehen. Boto-Männchen sind Einzelgänger. Sie haben gern ihre Ruhe.«
Strickland fragt sich, ob Henríquez mit ihm spielen und sich über seine zugeknöpfte Art lustig machen will. Der Kapitän nimmt seinen Strohhut ab, und sein weißes Haar schimmert im Mondlicht.
»Kennen Sie die Legende des Boto? Vermutlich nicht. Ihnen bringt man eher was über Waffen und Kugeln bei, richtig? Viele der Eingeborenen glauben, der pinkfarbene Flussdelfin wäre ein encantado, ein Gestaltwandler. In Nächten wie dieser verwandelt er sich in einen umwerfend gut aussehenden Mann und geht ins nächste Dorf. Man erkennt ihn an seinem Hut, unter dem er sein Atemloch versteckt. In dieser Verkleidung verführt er die schönsten Frauen des Dorfes und nimmt sie mit in sein Heim unter dem Fluss. Warten Sie es nur ab. Wir werden heute Nacht am Flussufer nur sehr wenige Frauen sehen, weil sie sich alle davor fürchten, vom encantado entführt zu werden. Aber ich bin der Meinung, dass einem diese Geschichte Hoffnung schenkt. Denn ist ein Unterwasserparadies einem Leben voller Armut, Inzest und Gewalt nicht vorzuziehen?«
»Er kommt näher.« Strickland hatte das gar nicht laut aussprechen wollen.
»Ah! Dann sollten wir lieber zu den anderen gehen. Es heißt, wenn man einem encantado in die Augen sieht, verflucht er einen mit Albträumen, die einen in den Wahnsinn treiben.«
Henríquez tätschelt Strickland den Rücken, als wäre er sein Freund, was er nicht ist, und schlendert pfeifend weg. Strickland kniet sich vor die Reling. Der Delfin taucht wie eine Stricknadel unter. Bestimmt weiß er, was Boote sind. Wahrscheinlich hofft er auf Fischabfälle. Strickland zieht seine Beretta und zielt auf die Stelle, an der der Delfin wieder auftauchen müsste. Fantasiereiche Geschichten haben es nicht verdient, weiterzuleben. Die raue Realität ist das, was Hoyt sucht und was Strickland finden muss, um hier lebend rauszukommen. Der Umriss des Delfins ist im Wasser zu erkennen. Strickland wartet. Er will dem Tier in die Augen sehen. Er will es sein, der die Albträume bringt und der den Dschungel wahnsinnig macht.
6
In der zweiten Wohnung wird Elisa von einer glücklichen Meute begrüßt: strahlende Hausfrauen, grinsende Ehemänner, ekstatische Kinder, arrogante Teenager. Sie sind nicht realer als die Figuren auf der Leinwand des Arcade Cinema. Es sind Charaktere von Werbeplakaten, und obwohl diese Originalgemälde von einem wahren Künstler geschaffen wurden, hängt kein einziges an der Wand. Leicht entfernbare, wasserfeste Wimpern verdeckt einen zugigen Riss in der Wand. Samt schimmernder Gesichtspuder dient als Türstopper. Die Strumpfsorgen von 9 von 10 Frauen hat einen neuen Bestimmungszweck als Tisch erhalten, auf dem die Farbdosen für die nächsten Plakate stehen. Diese Herablassung deprimiert Elisa, aber die fünf Katzen sehen das anders. Die unaufgeräumten Arbeitsflächen geben großartige Plattformen ab, von denen man auf Mäusejagd gehen kann.
Eine Katze putzt ihre Schnurrhaare an einem Toupet und bewegt es auf dem Menschenschädel, der aus Gründen, an die sich Elisa nicht mehr erinnern kann, den Namen Andrzej trägt. Der Künstler Giles Gunderson zischt, woraufhin die Katze quäkend verschwindet und sich vermutlich im Katzenklo dafür rächen wird. Giles stützt sich auf seine Leinwand und kneift hinter seinen dicken, von Farbspritzern übersäten Brillengläsern die Augen zusammen. Eine zweite Brille ruht über seinen buschigen Augenbrauen, und eine dritte hat er sich auf den Glatzkopf geschoben.
Elisa stellt sich auf die Spitzen ihrer Daisys und schaut sich das Bild über seine Schulter hinweg an: Es handelt sich um eine Familie körperloser Köpfe, die über einer Kuppel aus roter Gelatine schweben. Die beiden Kinder sperren den Mund auf wie hungrige Äffchen, der Vater reibt sich bewundernd das Kinn, und die Mutter blickt zufrieden auf ihre ekstatische Brut herab. Giles hat Probleme mit den Lippen des Vaters, und Elisa weiß aus Erfahrung, dass ihm Männergesichter zu schaffen machen. Sie beugt sich weiter vor und sieht, wie Giles die Lippen zu dem Lächeln verzieht, das er so gern malen würde. Es sieht so hinreißend aus, dass Elisa nicht widerstehen kann: Sie beugt sich vor und drückt dem alten Mann einen Kuss auf die Wange.
Er schaut überrascht auf und kichert.
»Ich habe dich gar nicht reinkommen gehört! Wie spät ist es? Haben dich die Sirenen geweckt? Wappne dich, Liebes, denn es kommt noch schlimmer. Im Radio haben sie gesagt, dass die Schokoladenfabrik brennt. Kannst du dir etwas Schlimmeres vorstellen? Vermutlich werfen sich jetzt zahllose Kinder im Schlaf unruhig hin und her.«
Giles verzieht den Mund unter seinem penibel gezogenen Menjoubärtchen zu einem Lächeln und hält die Hände hoch, in jeder einen Pinsel, einer rot, einer grün.
»Tragödie und Freude«, sagt er, »Hand in Hand.«
Hinter Giles steht ein schuhkartongroßer Schwarz-Weiß-Fernseher auf einem Rollwagen, auf dem ein Spielfilm immer wieder von Rauschen unterbrochen wird. Bojangles steppt gerade eine Treppe hinauf. Elisa weiß, dass das ihren Freund aufheitern wird. Bevor Bojangles Shirley Temple zuliebe langsamer werden muss, gibt Elisa ihrem Freund mit zwei Fingern ein Zeichen, damit er hinsieht.
Giles klatscht vor Begeisterung in die Hände und vermischt dabei rote und grüne Farbe. Was Bojangles da macht, ist unglaublich, und Elisa schämt sich bei dem Gedanken, dass sie besser mit ihm hätte mithalten können als Shirley Temple, wenn sie nur in eine andere Welt hineingeboren worden wäre. Sie wollte schon immer tanzen. Darum hat sie auch all die Schuhe: Sie sind potenzielle Tatkraft, die nur darauf wartet, abgerufen zu werden. Sie schaut den Fernseher mit zusammengekniffenen Augen an und zählt den Takt mit, wobei sie die dazu im Widerspruch stehende Musik aus dem Kino unter ihnen ignoriert, um dann parallel zu Bojangles zu steppen. Das macht sie gar nicht mal so übel, und wann immer Bojangles auf eine Stufe tritt, kickt Elisa gegen das, was ihr am nächsten ist – Giles’ Stuhl –, was diesen zum Lachen bringt.
»Weißt du, wer auch so schnell eine Treppe runterkommen konnte? James Cagney! Haben wir Yankee Doodle Dandy zusammen gesehen? Das sollten wir mal machen. Wie Cagney die Treppe runterkommt, das ist einmalig. Und er schwingt seine Beine herum, als stünde sein Hintern in Flammen. Alles improvisiert, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gefährlich das ist! Aber so ist wahre Kunst, meine Liebe – gefährlich.«
Elisa reicht ihm den Teller mit den Eiern und sagt in Gebärdensprache: »Bitte iss was.« Er grinst traurig und nimmt ihr den Teller ab.
»Ohne dich wäre ich wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes ein darbender Künstler. Weckst du mich, wenn du nach Hause kommst? Ich gehe einkaufen: Frühstück für mich, Abendessen für dich.«
Sie nickt und deutet mit entschlossener Miene auf das Schrankbett, das noch hochgeklappt ist.
»Wenn Giles Gunderson verlangt wird, muss er zur Tat schreiten! Aber ich verspreche dir, dass ich danach ins Traumland reise.«
Er schlägt ein Ei gegen Die Strumpfsorgen von 9 von 10 Frauen und schiebt eine Brille an den beiden anderen vorbei. Auf seinem Gesicht ist noch immer das Lächeln zu sehen, das er malen will; es ist jetzt etwas breiter, was Elisa sehr freut. Dann holt sie die laute Fanfare des Abspanns im Kino unter ihnen in die Realität zurück. Sie weiß, was als Nächstes passieren wird: Das Wort Ende erscheint auf der Leinwand, die Liste der Darsteller wird abgespult, das Licht geht an und man kann nicht mehr verbergen, wer man wirklich ist.
7
Die Einheimischen sind Mutanten, denen die Hitze nicht zu schaffen macht. Sie wandern, sie klettern, sie hacken. Strickland hat noch nie so viele Macheten gesehen. Sie nennen sie falcóns. Ihm ist völlig egal, wie sie heißen, denn er hat sein M63. Die Reise ins Landesinnere beginnt auf einer Seitenstraße, die irgendein vergessener Held direkt in den Regenwald gepflügt hat. Um elfhundert finden sie den von Schlingpflanzen überwucherten Pflug, auf dessen Sitz Philodendren wachsen. Na gut, er kann sich wohl doch nicht den Weg durch den Dschungel freischießen, stellt er fest und nimmt eine Machete.
Strickland hält sich für kräftig, aber am Nachmittag sind seine Muskeln butterweich. Der Dschungel kann wie der Geier Schwäche spüren. Ranken reißen ihnen die Hüte vom Kopf. Spitze Bambusstäbe stechen in ausgestreckte Gliedmaßen. Wespen mit fingerlangen Stacheln wuseln auf papiernen Nestern herum und warten auf einen Grund, auszuschwärmen, sodass jeder, der auf Zehenspitzen vorbeischleicht und unbehelligt bleibt, erleichtert erschaudert. Ein Mann lehnt sich an einen Baum. Die Borke zersetzt sich. Es ist keine Borke – es ist eine Schicht aus Termiten, die sich in seinen Ärmel zwängen und in ihn eingraben wollen. Die Führer haben keine Karten, aber sie streben energisch in eine Richtung.
Wochen vergehen. Vielleicht Monate. Die Nächte sind schlimmer als die Tage. Sie ziehen sich ihre Hosen aus, die bleischwer vom getrockneten Schlamm sind, kippen literweise Schweiß aus ihren Stiefeln und liegen hilflos wie Babys in mit Moskitonetzen geschützten Hängematten, während sie dem Quaken der Frösche und dem Sirren der Malariamotten lauschen. Wie kann sich ein solch riesiger Ort so klaustrophobisch anfühlen? Strickland sieht überall Hoyts Gesicht, in den Hüten der Baumpilze, den Mustern auf den Panzern der Terekay-Schildkröten, den Flugformationen der blauen Aras. Lainie sieht er hingegen nirgendwo. Er kann sie kaum spüren, sie ist wie der Puls eines Sterbenden. Das erschreckt ihn, aber hier gibt es so vieles, vor dem er zurückschreckt, jede Sekunde.
Nach tagelangem Marsch erreichen sie ein Dorf der vestigios. Eine kleine Lichtung, strohgedeckte malocas, zwischen Baumstämmen aufgespannte Tierhäute. Henríquez saust herum und fordert die Männer auf, die Macheten wegzustecken. Strickland kommt der Aufforderung nach, aber nur, weil er sein Gewehr dann besser bedienen kann. Ist es nicht sein Job, bewaffnet zu sein? Minuten später sind drei Gesichter in einer dunklen maloca zu sehen. Strickland erschaudert, was in der Hitze ein flaues Gefühl erzeugt. Kurz darauf bekommen die Gesichter Körper, die spinnengleich über die Lichtung auf sie zukommen.
Strickland wird bei diesem Anblick übel. Sein Gewehr wackelt. Lösch sie aus. Der Gedanke schockiert ihn. Es ist ein Hoyt-Gedanke. Aber er ist reizvoll, nicht wahr? Er will diese Mission schnell abschließen, nach Hause fahren und herausfinden, ob er noch derselbe Mann ist, der Orlando verlassen hat. Während Henríquez vorsichtig seine Geschenke – Kochtöpfe – enthüllt und einer der Führer versucht, in einem gemeinsamen Kauderwelsch eine Unterhaltung in Gang zu bringen, kommen ein Dutzend weiterer vestigios aus dem Schatten und starren Stricklands Waffe, seine Machete und seine geisterhaft weiße Haut an. Er kommt sich entblößt vor und hat keine Freude an den nachfolgenden Feierlichkeiten. Saure Wildvogeleier, die über dem Feuer gekocht werden. Ein bescheuertes Ritual, bei dem der Crew die Gesichter und Hälse bemalt werden. Strickland lässt alles über sich ergehen. Henríquez wird sich wegen des Deus Brânquia umhören. Hoffentlich bald, denkt Strickland. Er kann nur noch ein bestimmtes Maß an Insektenstichen verkraften, bevor er anfängt, die Dinge auf seine Weise zu regeln.
Als Henríquez vom Feuer aufsteht, um seine Hängematte aufzuhängen, versperrt ihm Strickland den Weg.
»Sie haben aufgegeben.«
»Es gibt noch andere vestigios. Wir werden sie finden.«
»Wir sind seit Monaten unterwegs, und Sie werfen einfach die Flinte ins Korn.«
»Sie glauben, der Deus Brânquia verliert seine Kräfte, wenn sie über ihn sprechen.«
»Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir ganz in der Nähe sind. Vielleicht wollen sie ihn beschützen.«
»Ach, jetzt glauben Sie also daran?«
»Was ich glaube, ist völlig unwichtig. Ich bin hier, um ihn einzufangen und mit nach Hause zu nehmen.«
»So simpel liegen die Dinge nicht, dass sie einander nur beschützen. Im Dschungel herrscht eher – Wie würden Sie das ausdrücken? – ein ständiges Hin und Her. Hier lebt man miteinander. Diese Menschen glauben, dass alles in der Natur verbunden ist. Eindringlinge wie wir können schnell einen Flächenbrand auslösen.« Henríquez’ Blick fällt auf das M63. »Sie halten Ihre Waffe ganz schön fest, Mister Strickland.«
»Ich habe Familie. Wollen Sie ein ganzes Jahr lang hier draußen bleiben? Vielleicht sogar zwei? Denken Sie, Ihre Leute halten so lange durch?«
Strickland lässt seine Augen sprechen. Henríquez ist nicht länger stark genug, um diesem Blick zu widerstehen. In seinem dreckigen weißen Anzug steckt ein Skelett. Die entzündeten Zeckenstiche an seinem Hals eitern und bluten, weil er immer wieder daran kratzt. Strickland hat mehrfach beobachtet, wie er den Pfad verlässt, um sich unbeobachtet von seinen Männern zu übergeben. Er hält sein Logbuch fest, um das Zittern seiner Hände zu verbergen. Strickland würde das wertlose Papierbündel am liebsten auf den Boden werfen und mit Blei spicken. Vielleicht würde das den Kapitän motivieren.
»Die jungen Stammeskrieger.« Henríquez seufzt. »Rufen Sie sie zusammen, wenn die Ältesten schlafen. Wir haben Beilköpfe und Schleifsteine, die wir eintauschen können. Vielleicht bringen wir sie damit zum Reden.«
Genau das passiert dann auch. Die Heranwachsenden sind gierig nach der Beute und beschreiben den Deus Brânquia derart detailreich, dass selbst Strickland überzeugt ist: Das ist keine Legende wie der pinkfarbene Flussdelfgin. Hier geht es um einen lebendigen Organismus, eine Art Fischmensch, der schwimmt, isst und atmet. Die Jungen sind fasziniert von Henríquez’ Karte und tippen auf den Nebenarm des Tapajós, den sie wiedererkennen. »Die saisonalen Wanderungen des Deus Brânquia reichen Generationen zurück«, übersetzt ihr Führer. Strickland erwidert, dass das keinen Sinn ergibt. »Sind es etwa mehrere?« Der Führer fragt die Jungen. »Vor langer Zeit ja«, antworten sie. »Jetzt ist nur noch einer da.« Einige fangen an zu weinen. Strickland vermutet, dass sie sich Sorgen machen, den Kiemengott durch ihre Gier in Gefahr gebracht zu haben. Mit dieser Vermutung haben sie recht.
8
Gegenüber von Elisas Bushaltestelle befinden sich zwei Geschäfte. Sie hat sie schon unzählige Male betrachtet, ohne jemals eines davon während der Öffnungszeiten betreten zu haben, denn sie spürt, dass sie damit einen Traum zerstören würde. Das erste ist Kosciuszko Electronics. Beim Tagesangebot handelt es sich um einen Großbildfarbfernseher mit Walnusskorpus, auf dem mehrere Models, alle mit Beinen, die der Antenne von Sputnik gleichen, die letzten Bilder des Abends präsentieren. Die amerikanische Flagge blendet in ein Qualitätssiegel über, bevor der Bildschirm erlischt, was Elisa zu verstehen gibt, dass sie wirklich spät dran ist. Sie hofft, dass der Bus bald kommt. Zu wem hat das Mädchen im Film doch gleich noch gebetet? Zu Kemosch? Vielleicht arbeitet Kemosch ja schneller als Gott.
Sie lässt den Blick zum zweiten Geschäft wandern: Julia’s Fine Shoes. Auch wenn sie keine Ahnung hat, wer diese Julia ist, beneidet sie sie heute Abend so sehr, dass sie weinen könnte, diese mutige, unabhängige Frau mit einem eigenen Laden, die ganz bestimmt wunderschön ist, mit schwingendem Haar und wippendem Schritt, und die darauf vertraut, dass ihr Geschäft im Viertel Fells Point derart geschätzt wird, dass sie nicht etwa abends das Licht ausschaltet, sondern ein einziges Schuhpaar auf einer Elfenbeinsäule mit einem Scheinwerfer anstrahlt.
Der Trick funktioniert. Und wie! An Abenden, an denen sie nicht spät dran ist, überquert Elisa die Straße und legt die Stirn gegen die Scheibe, um die Schuhe besser sehen zu können. Diese Schuhe gehören nicht nach Baltimore, vielmehr ist sie davon überzeugt, dass sie nirgendwohin außer auf die Pariser Laufstege gehören. Sie haben Elisas Größe, eine eckige Schuhspitze und an den Seiten so wenig Stoff, dass der Fuß herausrutschen würde, wäre da nicht die enge, nach innen gebeugte Fersenpartie. Eigentlich sehen sie aus wie Hufe, im bestmöglichen Sinne, versteht sich: wie die von Einhörnern, Nymphen oder Sylphen. Das Seidengewebe ist komplett mit glitzerndem Silber bedeckt, und die Einlagen sind glänzend wie Spiegel, in denen sie sich tatsächlich sehen kann. Die Schuhe rufen etwas in Elisa hervor, von dem sie glaubte, es wäre ihr in der Jugend im Waisenhaus aus dem Leib geprügelt worden. Sie sagen ihr, dass sie etwas erreichen kann. Dass sie jemand sein kann. Dass alles möglich ist.
Kemosch erhört ihr Flehen: Der Bus kommt den Hügel herunter. Wie immer ist der Fahrer zu alt, zu müde und zu lustlos, um vorsichtig zu fahren. Daher biegt der Bus hart rechts in die Eastern ein, ebenso hart nimmt er die Rechtskurve auf den Broadway, um dann nördlich am Dröhnen der Feuerwehrwagen und der brennenden und schmelzenden Schokoladenfabrik vorbeizurasen. Das lodernde, flackernde, zerstörerische Feuer ist wenigstens eine Art von Leben, und Elisa verdreht sich, um es anzusehen, wobei sie eine Minute lang das Gefühl hat, nicht etwa durch die Krätze der Zivilisation, sondern durch einen grausamen, lebendigen Dschungel zu fahren.
All das ist auf der langen, gelb beleuchteten Auffahrt des Occam Aerospace Research Centers vergessen. Elisa drückt die kalte Nase an das noch kältere Fenster, damit sie die erleuchtete Uhr über dem Schild erkennen kann: 23.55 Uhr. Ihre Schuhe berühren nur eine Stufe, als sie aus dem Bus stürmt. Der Wechsel von der geschäftigen Spätschicht zur dürftig besetzten Nachtschicht verläuft chaotisch und ermöglicht es Elisa, sich zu beeilen und vom Bus über den Bürgersteig zu hetzen. Unter dem gnadenlosen Außenscheinwerfer – alle Lampen in Occam sind gnadenlos – verschwimmen ihre Schuhe zu einem bläulichen Wirrwarr.
Sie fährt mit dem Fahrstuhl nur ein Stockwerk nach unten, aber da einige der Labore Hangars ähneln, braucht sie dafür eine halbe Minute. Die Kabine öffnet sich in einem zweistöckigen Lagerbereich, in dem die Angestellten durch Pfeiler auf schmale Wege geleitet werden. Drei Meter über dem Boden steht David Fleming in einer Beobachtungskammer aus Plexiglas. Er wurde mit einem Klemmbrett anstelle einer linken Hand geboren und lässt es immer wieder sinken, um seine Untergebenen zu überwachen. Es war Fleming, bei dem sie vor über zehn Jahren ihr Bewerbungsgespräch hatte, und er ist immer noch hier. Seine hyänenartige Kontrolle bewirkt, dass er von Jahr zu Jahr in der Befehlskette nach oben rutscht. Inzwischen leitet er das ganze Gebäude, lässt die einfachen Arbeiter aber immer noch nicht in Ruhe. Elisa macht noch immer denselben Job wie früher, da man in der Putzkolonne nun mal nicht befördert wird.
Sie verflucht ihre Schuhe. Damit fällt sie auf, was eigentlich der Grund dafür war, sie anzuziehen, aber die Sache hat eben auch einen Nachteil. Ihre Kollegen aus der Nachtschicht, Antonio, Duane, Lucille, Yolanda und Zelda, sind schon da. Die ersten drei verschwinden gerade am Ende des Flurs, während Zelda ihre Stempelkarte sucht, als würde sie sich eine Speisekarte ansehen. Die Karten werden jeden Tag in dasselbe Fach gesteckt; Zelda trödelt also nur Elisa zuliebe, denn Yolanda steht direkt hinter Zelda, und wenn Yolanda dran ist, wird sie dafür sorgen, dass Elisa die entscheidende Minute zu spät stempelt.
Dabei gibt es keinen Grund für Gehässigkeiten. Zelda ist schwarz und dick. Yolanda ist Mexikanerin und reizlos. Antonio ist ein schielender Dominikaner. Duane ist gemischtrassig und hat keine Zähne. Lucille ist ein Albino. Elisa ist stumm. Für Fleming sind sie alle gleich: unfähig, einen anderen Job zu machen, und daher vertrauenswürdig. Es beschämt Elisa, dass er recht haben könnte. Sie wünscht sich, sprechen zu können, denn dann würde sie sich auf die Bank in der Umkleidekabine stellen und ihre Kollegen mit einer Rede darüber wachrütteln, dass sie aufeinander aufpassen müssen. Aber so läuft das in Occam nicht. Soweit sie weiß, läuft es in ganz Amerika nicht so.
Die einzige Ausnahme ist Zelda, die schon immer auf Elisa aufgepasst hat. Zelda kramt in ihrer Handtasche nach ihrer Brille, die sie nie aufsetzt, was alle wissen, und ignoriert Yolandas Gejammer über die tickende Uhr. Elisa beschließt, dass sie ebenso mutig sein muss wie Zelda. Sie denkt an Bojangles und saust los, tanzt Mambo an gähnenden Kollegen vorbei und Foxtrott an anderen, die sich gerade den Mantel zuknöpfen. Fleming wird sie und ihre blauen Schuhe bemerken, und ihr Verhalten wird auf seiner Prüfliste landen, denn in Occam ist alles verdächtig, was keinem müden Schlurfen ähnelt. Doch in den Sekunden, die Elisa braucht, um zu Zelda zu gelangen, befreit sie das Tanzen von alldem. Sie erhebt sich über dieses unterirdische Stockwerk und schwebt, als hätte sie ihr wundervolles, warmes Badewasser niemals verlassen.
9
Südwestlich von Santarém gehen ihnen die Lebensmittel aus. Die Männer sind geschwächt, hungern und leiden unter Schwindelanfällen. Zufrieden schnatternde Affen hüpfen um sie herum auf den Ästen und verspotten sie. Daher fängt Strickland an zu schießen. Die Affen fallen wie Aguaje-Früchte zu Boden, und die Männer keuchen entsetzt auf. Das ärgert Strickland. Er tritt mit erhobener Machete vor einen Affen, dem er einen Bauchschuss verpasst hat. Das Tier mit dem weichen Fell krümmt sich und presst die Hände vor das tränenüberströmte Gesicht. Es erinnert ihn an ein Kind. An Timmy oder Tammy. Ihm ist, als würde er Kinder abschlachten. Er muss an Korea denken. An die Kinder, die Frauen. Ist er zu so einem Menschen geworden? Die unverletzten Affen kreischen vor Trauer, und der Lärm bohrt sich in seinen Schädel. Er wendet sich ab und schlägt mit der Machete auf einen Baum ein, bis weiße Holzsplitter durch die Luft fliegen.
Die anderen Männer sammeln die Leichen ein und werfen sie in kochendes Wasser. Hören sie das Kreischen der Affen nicht? Strickland sammelt Moos und steckt es sich in die Ohren. Es nützt nichts. Die Schreie, die Schreie! Zum Abendessen gibt es gummiartige graue Bälle aus Affenknorpeln. Er hat es nicht verdient, das zu essen, tut es aber trotzdem. Die Schreie, die Schreie!
Die Regenzeit, wie immer sie hier auch genannt wird, bricht über sie herein. Der Wolkenbruch ist so heiß wie frisches Blut. Henríquez versucht nicht länger, die beschlagenen Brillengläser zu putzen, und läuft blind weiter. Er ist blind, denkt Strickland. Er muss blind sein, wenn er sich einredet, er könne diese Expedition leiten. Henríquez, der nie in einem Krieg gekämpft hat. Henríquez, der die Schreie der Affen nicht hört. Strickland wird klar, dass die Schreie sich nicht von denen der Dorfbewohner in Korea unterscheiden. So schrecklich sie auch sein mögen, sagen sie ihm doch, was er zu tun hat.
Es ist nicht nötig, einen Putschversuch zu starten. Die Zermürbung reicht völlig aus. Ein Candiru-Wels, den der prasselnde Regen aufgepeitscht hat, springt in die Harnröhre des Ersten Maats, als dieser gerade in den Fluss pinkelt. Drei Männer bringen ihn in die nächste Stadt und sind nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag wacht der peruanische Ingenieur auf und ist mit lilafarbenen Bissen übersät. Eine Vampirfledermaus. Er und sein Freund sind abergläubisch und suchen das Weite. Wochen später sorgt ein eingerissenes Moskitonetz dafür, dass einer der índios bravos an den Bissen von Tracuá-Ameisen stirbt. Schließlich wird der mexikanische Steuermann, Henríquez’ bester Freund, von einer grellgrünen Papagalho-Viper in den Hals gebissen. Nur Sekunden später blutet er aus jeder Pore seines Körpers. Keiner kann ihm helfen. General Hoyt hat Strickland gelehrt, wo er die Beretta ansetzen soll – direkt an der Schädelbasis –, daher erhält der Steuermann einen schnellen Tod.
Sie sind nur noch fünf, sieben, wenn man die Führer mitzählt. Henríquez versteckt sich unter Deck und schreibt seine albtraumartigen Erfahrungen in sein Logbuch. Sein ehemals weißer Strohhut bekommt eine neue Aufgabe als Bettpfanne. Strickland sucht ihn auf und muss bei dem wirren Gemurmel des Kapitäns kichern.
»Sind Sie motiviert?«, fragt Strickland ihn. »Sind Sie motiviert?«
Niemand fragt Richard Strickland nach seiner Motivation. Bis jetzt hätte er darauf auch keine Antwort gehabt. Der Deus Brânquia ging ihm bisher am Arsch vorbei. Doch jetzt gibt es nichts auf der Welt, was er mehr begehrt. Der Deus Brânquia hat etwas mit ihm gemacht; er hat ihn auf eine Art und Weise verändert, die sich vermutlich nicht rückgängig machen lässt. Er wird ihn mit dem, was von der Crew der Josefina noch übrig ist, fangen – sind sie denn nicht jetzt die vestigios? Danach geht es nach Hause, endlich nach Hause, was immer das auch bedeuten mag. Er masturbiert im strömenden Regen über einem Nest aus Babyschlangen und malt sich den lautlosen, sauberen Sex mit Lainie aus. Zwei trockene Körper, die wie Holzblöcke auf einer endlosen Steppe aus glatten weißen Laken herumrutschen. Er wird es nach Hause schaffen. Ganz bestimmt. Er wird tun, was die Affen sagen, und dann wird alles vorbei sein.
10
Eigentlich soll Elisa ihre schicken Schuhe in der Umkleide gegen Turnschuhe tauschen, und stets kommt es ihr wie eine Amputation vor, als würde man ihr eine Hand abhacken. Man kann mit hochhackigen Schuhen nicht putzen, war eine von Flemings Maximen bei ihrer Einstellung. Wir wollen doch nicht, dass Sie ausrutschen und stürzen. Auch keine schwarzen hochhackigen Schuhe, da es auf einigen Fußböden in den Laboren wissenschaftliche Markierungen gibt, die nicht zerstört werden dürfen. Fleming hatte Tausende solcher Plattitüden auf Lager. Doch neuerdings ist er meist mit etwas anderem beschäftigt, und die unbequemen hochhackigen Schuhe sind zu Elisas Trost geworden; sie halten sie wach und empfindungsfähig, wenn auch nur bedingt.
Ein seit Langem defekter Duschraum dient ihnen als Umkleide. Zelda und Elisa füllen wie immer ihre Wagen aus Regalen auf, in denen die Vorräte für drei Monate aufbewahrt werden. Danach schieben sie ihre achträdrigen Wagen und die ebenfalls achträdrigen Wischeimer lautstark durch die langen weißen Korridore von Occam, als wären sie ein langsamer Zug ins Nirgendwo.
Sie müssen immerzu professionell bleiben, da einige Männer in weißen Kitteln noch bis zwei oder drei Uhr früh in den Laboren arbeiten. Die Wissenschaftler in Occam gehören einer seltsamen Unterart von Männern an, die völlig in ihrer Arbeit aufgehen. Fleming hat seine Putzkolonne angewiesen, ein Labor, in dem sie noch jemanden antreffen, sofort wieder zu verlassen, und das geschieht regelmäßig. Wenn schließlich zwei Wissenschaftler gemeinsam gehen, sehen sie mit kleinen Augen ungläubig auf die Armbanduhr des anderen, tauschen sich kichernd darüber aus, dass ihnen ihre Ehefrauen die Hölle heißmachen werden, und stellen dann seufzend fest, dass sie lieber gleich in den Wohnungen ihrer Freundinnen vorbeischauen würden.
Sie hüten auch nicht ihre Zunge, wenn sie an Elisa und Zelda vorbeigehen. So, wie der Putzkolonne beigebracht wurde, nichts als den Schmutz und den Müll in Occam zu sehen, nehmen die Wissenschaftler nichts als die Ergebnisse ihrer eigenen Genialität wahr. Elisa hat vor langer Zeit von einer Romanze am Arbeitsplatz geträumt, dass sie hier den Mann kennenlernen würde, der durch ihre dunklen Träume tanzt. Doch das waren die Wunschträume eines dummen Mädchens. Denn als Putzfrau, Dienstmädchen oder Hausmeister gleitet man ungesehen an anderen vorbei wie ein Fisch unter Wasser.
11
Der Geier kreist nicht mehr. Strickland hat einen der beiden letzten índios bravos dazu gebracht, das Tier zu fangen. Ihm ist schleierhaft, wie der Mann das geschafft hat, und es ist ihm eigentlich auch egal. Er bindet den Vogel an eine Stange, die er am Heck der Josefina anbringt, und vertilgt vor dessen Augen sein Abendessen, das aus getrockneten Piranhas besteht. Die Fische sind voller Gräten. Er spuckt sie aus, aber nicht so, dass der Vogel sie aufpicken könnte. Sein Gesicht ist lilafarben, sein Schnabel rot, sein Hals gebogen. Er breitet die Flügel aus, kann aber nicht weg.
»Jetzt sehe ich dir beim Verhungern zu«, sagt Strickland. »Ich bin gespannt, wie dir das gefällt.«
Es geht wieder in den Dschungel. Henríquez bleibt zurück, um auf das Boot aufzupassen. Strickland gibt nun die Regeln vor. Keine Geschenke mehr, dafür viele Waffen. Strickland jagt die Eingeborenen, als würde General Hoyt neben ihm stehen und die Befehle erteilen. Er bringt seinen Männern militärische Handzeichen bei. Sie lernen schnell. In herrlicher Synchronität ziehen sie den Kreis um das Dorf zusammen, und Strickland erschießt den ersten Dorfbewohner, um die Sachlage klarzumachen. Die vestigios werfen sich in den Dreck und spucken ihre Geheimnisse aus. Wann und wo sie den Deus Brânquia das letzte Mal gesehen haben.
Der Übersetzer sagt Strickland, dass die Dorfbewohner ihn für die Verkörperung eines Gringo-Mythos halten – für einen corta cabeza, einen Kopfabschneider. Das gefällt Strickland. Er gleicht keinem fremden Plünderer wie Pizarro oder Soto, sondern etwas, das dem Dschungel entsprungen ist. Seine weiße Haut ist die eines Piranhas. Sein Haar das eines schlüpfrigen Pakas. Seine Zähne sind die einer Lanzenotter. Seine Gliedmaßen sind Anakondas. Er ist ebenso ein Dschungelgott, wie der Deus Brânquia ein Kiemengott ist, und er hört nicht einmal den letzten Befehl, als er ihn erteilt, da die Schreie der Affen in seinen Ohren dröhnen. Aber seine Männer hören ihn. Sie schneiden jedem im Dorf den Kopf ab.
Er kann den Deus Brânquia riechen. Er stinkt wie der milchige Schlamm am Grund des Flusses. Wie eine Maracuja. Wie eine Salzkruste. Wenn er doch nur nicht schlafen müsste. Wieso werden die índios bravos eigentlich nie müde? Als er sich im Mondlicht an sie anschleicht, beobachtet er ein Ritual. Borkenstücke werden auf einem Blatt zu einer klumpigen Paste verrührt. Einer kniet sich mit offenen Augen hin. Der andere rollt das Blatt auf und drückt einen einzigen Tropfen der Flüssigkeit in jedes Auge. Der Kniende trommelt mit den Fäusten auf den Boden. Strickland wird von den Qualen angezogen, tritt zwischen den Bäumen hervor, kniet sich vor den stehenden Mann und hält seine Augenlider offen. Der Mann zögert. Er bezeichnet die Paste als buchité und macht eine Geste, mit der er zur Vorsicht rät. Strickland lässt sich nicht beirren. Endlich drückt der Mann das Blatt zusammen. Ein Tropfen weißer buchité wird zu seiner ganzen Welt.
Der Schmerz ist unbeschreiblich. Strickland windet sich, schreit und jault. Aber er hält durch. Das Brennen lässt nach. Er setzt sich auf. Wischt sich die Tränen weg. Sieht den Führern mit zusammengekniffenen Augen in die ausdruckslosen Gesichter. Er sieht sie. Mehr als das: Er kann in sie hineinblicken. Entlang der schiefen Kanäle, die ihre Falten bilden. Tief in den Wald ihrer Haare. Die Sonne geht auf, und Strickland entdeckt einen Amazonas von unendlicher Tiefe und Farbvielfalt. Sein Körper vibriert vor Vitalität. Seine Beine sind Wanderpalmen und scheinen meterlange Sehnen aus Wurzeln bekommen zu haben. Er streift sich die Kleidung ab, er braucht sie nicht mehr. Der Regen prallt von seiner nackten Haut ab, als wäre sie aus Stein.
Der Kiemengott weiß, dass er dem Dschungelgott nicht gewachsen ist. Letzterer nimmt die Josefina derart unter Feuer, dass Rumpfstücke ins Wasser fallen. Der Deus Brânquia zieht sich in einen sumpfigen Flussarm zurück. Dort gibt das Schiff den Geist auf. Die Bilgenpumpe ist verstopft, und obwohl die Kapitänskajüte voll Wasser läuft, will Henríquez nicht rauskommen. Der Bolivianer holt das Werkzeug raus. Der Brasilianer schleppt die Harpune, das Tauchgerät und das Netz an. Der Ecuadorianer rollt ein Fass Rotenon herbei, ein Fischpestizid aus Yambohne-Samen, das den Deus Brânquia an die Oberfläche locken soll. »Schön«, sagt Strickland. Er steht am Bug, nackt, mit ausgestreckten Armen, angepeitscht vom Regen, und ruft ihn. Keiner weiß, wie lange. Tage, vielleicht sogar Wochen.
Endlich erhebt sich an einer seichten Stelle der Deus Brânquia, die Blutsonne, die die Serengeti schuf, das uralte Auge der Eklipse, der aufplatzende Ozean, aus dem eine neue Welt hervorbricht, der unersättliche Gletscher, der Gischtspritzer, der Bakterienbiss, der wimmelnde Einzeller, die speienden Spezies, die strömenden Gefäße zum Herzen, die Erektion des Berges, die schwankenden Schenkel der Sonnenblume, das graue Fell der Demütigung, das rosafarbene schwärende Fleisch, die Nabelschnur, die uns mit dem Ursprung verbindet. Er ist all das und noch viel mehr.
Die índios bravos fallen auf die Knie, flehen um Vergebung und schneiden sich mit ihren Macheten die Kehlen durch. Die wilde, unkontrollierte Schönheit der Kreatur bewirkt, dass auch Strickland zerbricht. Er verliert die Kontrolle über Blase, Darm und Magen. Bibelverse von Lainies Pastor künden von einem vergessenen, blitzblanken Fegefeuer. Das, was war, ist das, was sein wird. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dieses Jahrhundert ist ein Augenblick. Alle sind tot. Nur der Kiemengott und der Dschungelgott sind noch am Leben.
Stricklands Zusammenbruch ist kurz und wiederholt sich nicht. Er wird versuchen, ihn zu vergessen. Als er eine Woche später mit der schief im Wasser liegenden und halb untergegangenen Josefina in Belém eintrifft, trägt er die Kleidung des Übersetzers. Der Mann wusste zu viel und hatte sterben müssen. Inzwischen hat sich Henríquez erholt, klammert sich an den Mast, starrt blinzelnd in den Dampf und schluckt immer wieder schwer, während er die Version der Geschichte verarbeitet, die Strickland ihm eingetrichtert hat. Henríquez war ein guter Kapitän. Henríquez hat die Kreatur gefangen. Alles lief wie erwartet. Henríquez will sich in seinem Logbuch vergewissern, kann es jedoch nicht finden. Strickland hat es an den Geier verfüttert und zugesehen, wie er daran erstickt und unter Krämpfen verendet ist.
Strickland bestätigt alles bei seinem Telefonat mit General Hoyt – das er nur übersteht, weil er sich mit harten grünen Bonbons ablenkt. Marke und Geschmack sind nichts Besonderes, aber das Aroma ist schmerzhaft konzentriert und wirkt elektrisierend. Er hat jeden Markt in Belém leergekauft und beinahe einhundert Tüten zusammengetragen, bevor er den Anruf machte. Die Bonbons knirschen laut in seinem Mund. Trotz der weiten Entfernung ist Hoyts Stimme noch lauter. Als wäre er die ganze Zeit über im Dschungel dabei gewesen und hätte, verborgen hinter klebrigen Blättern oder Moskitoschwärmen, Strickland überwacht.
Strickland kann sich nichts Schlimmeres vorstellen, als General Hoyt anzulügen, aber die Einzelheiten über die Gefangennahme des Deus Brânquia ergeben keinen Sinn, als er versucht, sich daran zu erinnern. Er glaubt, dass das Rotenon irgendwann ins Wasser gekippt wurde. Das Zischen und Sprudeln hat er noch vor Augen. Er erinnert sich an das M63, dessen Lauf sich an seiner fiebrigen Schulter wie ein Eisblock angefühlt hat. Alles andere ist verschwommen. Wie die Kreatur ballettartig durch die Tiefen geglitten ist. Ihre verborgene Höhle. Wie sie auf Strickland gewartet hat. Dass sie nicht gekämpft haben. Der Widerhall der Affenschreie vom Stein. Dass die Kreatur nach ihm gegriffen hat, als er die Harpune auf sie richten wollte. Kiemengott, Dschungelgott. Sie könnten dasselbe sein. Sie könnten frei sein.
Er kneift die Augen zu und sperrt die Erinnerungen aus. Entweder kauft ihm Hoyt seine Version der Gefangennahme ab oder es ist ihm egal. Stricklands Hände zittern vor Hoffnung, und der Hörer bebt. Schick mich nach Hause, fleht er innerlich. Selbst wenn das ein Ort ist, von dem er kein Bild mehr vor Augen hat. Aber General Hoyt ist kein Mann, der für so etwas empfänglich ist. Er fordert, dass Strickland die Mission bis zum Ende begleitet. »Bringen Sie das Paket ins Occam Aerospace Research Center. Sorgen Sie für die Sicherheit und Geheimhaltung, während die Wissenschaftler dort ihre Arbeit machen.« Strickland schluckt Bonbonsplitter herunter, schmeckt Blut und hört, wie er gehorcht. Ein letzter Reiseabschnitt. Das ist alles. Er wird nach Baltimore umziehen. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Auch die Familie kann in den Norden kommen, und er wird in einem sauberen, ruhigen Büro hinter einem Schreibtisch sitzen. Er weiß, dass es eine Chance auf einen Neuanfang ist, falls er denn einen Weg zurückfindet.
Ungebildete Frauen
1
Ich bringe ihn um. Letzte Woche hat er geschworen, dass er die Toilette repariert, damit sie nicht mehr blubbert und ich mal vernünftig schlafen kann, aber als ich nach Hause komme, hört es sich an, als würde da jemand acht Stunden lang unaufhörlich pinkeln. Er hat mich gefragt, warum ich sie nicht repariere, wo so was doch mein Beruf ist. Aber darum geht es doch gar nicht. Darum geht es einfach nicht. Denkt er etwa, ich will hundemüde und mit geschwollenen Füßen nach Hause kommen und meine Hand in das eiskalte Wasser des Spülkastens stecken, weil das so viel Spaß macht? Ich sollte seinen Kopf da reinstecken!«
Zelda regt sich über Brewster auf. Brewster ist Zeldas Ehemann. Ein Taugenichts. Elisa hat den Überblick über all die Gelegenheitsjobs verloren, die Brewster schon gemacht hat, über die unzähligen Arten, auf die er gefeuert worden ist, und über seine depressiven Anfälle, die er wochenlang in seinem Fernsehsessel aussitzt. Die Einzelheiten sind auch unwichtig. Elisa ist jedoch dankbar dafür und gebärdet Anmerkungen. Zelda hat an Elisas erstem Arbeitstag angefangen, die Gebärdensprache zu lernen, und Elisa weiß nicht, wie sie ihr das je vergelten kann.
»Und das Spülbecken ist auch undicht. Brewster sagt, es liegt an der Kupplungsmutter. Wenn du meinst, Albert Einstein. Wenn du mit deiner Relativitätstheorie fertig bist, könntest du ja mal in den Baumarkt gehen … Weißt du, was er auf diesen Vorschlag erwidert hat? Er sagte, ich könnte ja einfach eine Kupplungsmutter bei der Arbeit mitgehen lassen. Weiß er überhaupt, wo ich arbeite? Und dass es hier überall Überwachungskameras gibt? Ich sag dir ganz ehrlich, was ich vorhabe, Schätzchen. Ich werde diesen Mann erwürgen, ihn in kleine Stücke hacken und alles die Toilette runterspülen, damit ich, wenn ich wegen des Mistdings wieder mal nicht schlafen kann, wenigstens an die ganzen kleinen Brewster-Stücke denken kann, die dann in den Abfluss sausen, wo sie hingehören.«
Elisa muss trotz ihres Gähnens lächeln und teilt Zelda mit, dass dies einer ihrer besseren Mordpläne ist.
»Als ich heute Abend aufgestanden bin, weil ja irgendjemand in dieser Familie dafür sorgen muss, dass wir uns einen solchen Luxus wie Kupplungsmuttern leisten können, sah die Küche aus wie die Chesapeake Bay. Ich marschiere also direkt wieder ins Schlafzimmer, und weil ich das Seil, mit dem ich ihn erwürgen werde, noch nicht gekauft habe, wecke ich Brewster und sage, dass wir uns bald eine Arche Noah bauen müssen, wenn das so weitergeht. Und er sagt, gut. In Baltimore hat es schon seit einer Ewigkeit nicht mehr geregnet. Der Mann glaubt tatsächlich, ich würde vom Regen sprechen!«