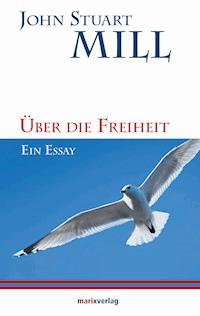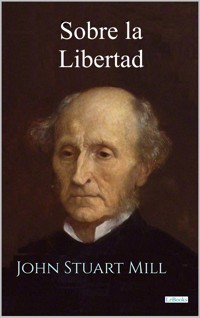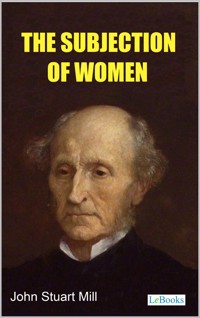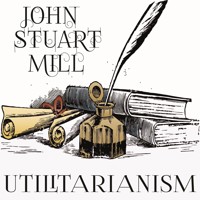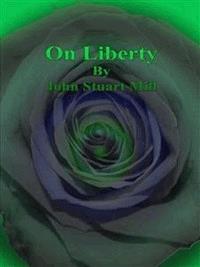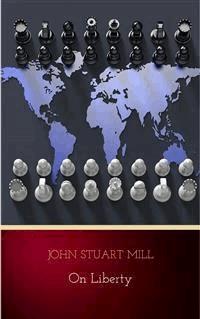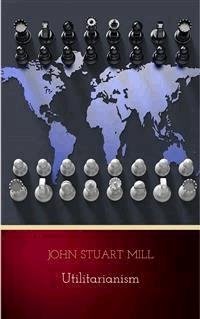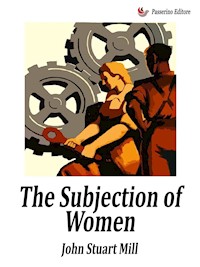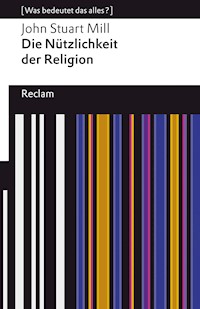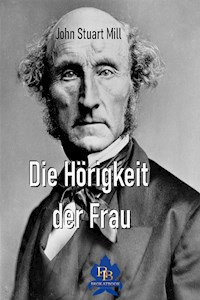Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SSEL
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Gegenstand dieser Untersuchung ist nicht die sogenannte "Willensfreiheit", die so unglücklich entgegengesetzt wird der zu Unrecht so genannten "Lehre von der philosophischen Notwendigkeit"; sondern es handelt sich um die bürgerliche oder soziale Freiheit. (...) Das einzige Ziel, um dessentwillen es der Menschheit gestattet ist, einzeln oder vereint, die Freiheit eines ihrer Mitglieder zu beschränken ist Selbstschutz."Über die Freiheit" ist ein philosophisches Werk des englischen Philosophen John Stuart Mill, das erstmals 1859 veröffentlicht wurde. Für den damaligen viktorianischen Leser war es ein radikales Werk, das moralische und ökonomische Freiheit von Individuen gegenüber dem souveränen Staat forderte. Es war ein enorm einflussreiches Werk.Inhalt dieser Ausgabe :- Über die Freiheit- Die Hörigkeit der Frau
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Die Freiheit
Und « Die Hörigkeit der Frau »
John Stuart Mill
SSEL
Inhalt
Einleitung Der Übersetzerin
Widmung
Über Die Freiheit
1. Einleitung
2. Von der Denk- und Redefreiheit
3. Individualität – ein Element der Wohlfahrt
4. Die Grenzen der Autorität der Gesellschaft über den Einzelnen
5. Nutzanwendungen
Die Hörigkeit der Frau
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Widmung
Dem geliebten und beweinten Andenken, an die Frau, die alles Beste in meinen Schriften angeregt und zum Teil geschaffen hat, der Freundin und Gattin, deren ausgeprägter Sinn für Wahrheit und Recht meine stärkste Anregung, und deren Anerkennung mein höchster Lohn war, widme ich diesen Band. Wie alles, was ich seit vielen Jahren geschrieben habe, gehört es ebenso sehr ihr, wie mir; aber das Werk hat, so wie es dasteht, nur in sehr ungenügendem Maße den unschätzbaren Vorzug ihrer Durchsicht gehabt; einige der wichtigsten Teile waren aufgehoben für eine sorgfältigere Nachprüfung, die sie nun niemals erhalten sollen; wäre ich nur imstande, der Welt die Hälfte der großen Gedanken und edlen Gefühle zu vermitteln, die nun in ihrem Grabe ruhen, so würde ich der Menschheit eine größere Wohltat erweisen, als jemals aus irgend etwas entstehen wird, was ich schaffen kann, ohne die Anregung und ohne die Hilfe ihrer fast unvergleichlichen Weisheit.
J. St. Mill.
Über Die Freiheit
Übersetzt von
Else Wentscher
Einleitung
Der Gegenstand dieser Untersuchung ist nicht die sogenannte »Willensfreiheit«, die so unglücklich entgegengesetzt wird der zu Unrecht so genannten »Lehre von der philosophischen Notwendigkeit«; sondern es handelt sich um die bürgerliche oder soziale Freiheit. Wir untersuchen die Natur und die Grenzen der Macht, die gesetzmäßig von der Gesellschaft über das Individuum ausgeübt werden darf. Eine Frage, die in so allgemeinen Zügen selten gestellt und kaum jemals diskutiert ist, aber sie beeinflußt tief, wenn auch unbewußt, die praktischen Gegensätze des Zeitalters und ist vielleicht bald dessen Lebensfrage. Sie ist soweit davon entfernt, neu zu sein, daß sie in gewissem Sinne die Menschheit schon von den ältesten Zeiten an in zwei Lager geteilt hat. Aber in dem fortgeschrittenen Stadium, in das die zivilisierteren Stämme der Menschheit jetzt getreten sind, stellt sie sich unter neuen Bedingungen dar.
Der Kampf zwischen Freiheit und Autorität ist der bemerkenswerteste Zug in den Perioden der Geschichte, mit denen wir am frühesten vertraut sind, vor allem in der Geschichte von Griechenland, Rom und England. Aber in alten Zeiten spielte dieser Kampf sich ab zwischen den Untertanen oder einigen Klassen von Untertanen und der Regierung. Unter Freiheit verstand man: Schutz gegen die Tyrannei der politischen Herrscher. Außer in einigen Volksregierungen in Griechenland standen die Herrscher in einem fast selbstverständlichen Gegensatz zu dem Volk, das sie beherrschten. Die Regierung bestand aus einem Herrscher oder einer Klasse oder Kaste von Herrschern, die ihre Autorität durch Eroberung oder Erbschaft erhalten hatten, jedenfalls nicht durch das Gutachten des Volkes. Seine maßgebenden Männer wagten nicht, ja wünschten vielleicht nicht, ihnen die Herrschaft streitig zu machen, so sehr sie sich gegen deren tyrannische Ausübung wehrten. Die Macht wurde als notwendig, aber als höchst gefährlich angesehen, als eine Waffe, die die Herrscher gegen ihre Untertanen nicht weniger als gegen äußere Feinde gebrauchten. Um zu verhüten, daß die schwächeren Glieder der Gemeinschaft von unzähligen Geiern beraubt wurden, war es nötig, daß ein Raubtier stärker war, als die übrigen, und beauftragt war, jene niederzuhalten. Aber da der König der Geier nicht weniger als die kleineren Harpyen darauf aus war, die Erde zu berauben, so war es unerläßlich, daß man in einer ständigen Verteidigungsstellung gegen dessen Schnabel und Klauen war. Darum war es das Bestreben der Patrioten, der Gewalt, die der Herrscher über seine Untertanen ausüben durfte, Grenzen zu setzen, und diese Begrenzung nannte man »Freiheit«. Auf zwei Wegen wurde versucht, sie zu verwirklichen. Erstens durch Erlangung gewisser Vorrechte, die der Herrscher anerkennen mußte; man nannte sie »politische Freiheiten« oder »Rechte«. Wenn der Herrscher sie nicht anerkannte, so hielt man den Widerstand Einzelner oder einen allgemeinen Aufstand für berechtigt. Ein zweites aber im Allgemeinen späteres Auskunftsmittel war die Errichtung verfassungsmäßiger Schranken, durch die die Zustimmung der Gemeinschaft oder einer gewissen Körperschaft, um deren Interessen es sich handelte, zur notwendigen Bedingung der wichtigsten Regierungakte gemacht wurde. Der ersten dieser Bestimmungen sich zu unterwerfen, wurde die Regierung in den meisten europäischen Ländern mehr oder weniger gezwungen. Anders war es mit der zweiten Bestimmung. Sie zu erreichen und, wenn sie in gewissem Grade schon gewährt war, sie zu vervollkommnen, wurde überall zum Hauptinteresse der Freiheitsfreunde. Und solange die Menschheit sich damit begnügte, einen Feind durch den andern zu bekämpfen, und von einem Herrn regiert zu werden, unter der Bedingung, daß sie gegen seine Willkürherrschaft mehr oder weniger geschützt sei, ging ihr Ehrgeiz darüber nicht hinaus. Es kam jedoch im Fortschritt der Menschheit eine Zeit, wo die Menschen es nicht mehr für naturnotwendig hielten, daß ihre Herrscher eine unabhängige Macht seien, deren Interessen den ihrigen entgegengesetzt waren. Es erschien ihnen weit besser, wenn die verschiedenen obrigkeitlichen Personen ihre Lehnsleute oder ihre Beauftragten wären, die sie nach Belieben abberufen könnten. Dieser Weg allein schien ihnen volle Sicherheit dafür zu bieten, daß die Regierungsgewalt niemals zu ihrem Nachteil mißbraucht werden könne. Mit der Zeit wurde das neue Verlangen nach einer wählbaren und zeitlich beschränkten Regierung der Hauptgegenstand für die Bestrebungen der liberalen Partei, und der Kampf darum überwog wesentlich die früheren Versuche, die Regierungsmacht zu beschränken. Da aber auch der Kampf um jene Festlegung der Regierungsgewalt fortdauerte, dachten manche, daß man der Beschränkung jener Gewalt zu viel Aufmerksamkeit gewidmet habe. Das — so schien es — war eine Sicherheit gegen solche Regierende, deren Interessen denen des Volks entgegengesetzt sind. Jetzt aber war es nötig, daß die Regierenden mit dem Volke einig seien, daß ihre Interessen und ihr Wille mit denen des Volks zusammenfielen. Das Volk aber brauchte gegen seinen eignen Willen nicht geschützt zu werden. Es brauchte nicht seine eigne Tyrannei gegen sich selbst zu fürchten. Wenn nur die Machthaber wirklich dem Volk verantwortlich und von ihm zu ersetzen waren, so konnte man wagen, sie mit einer Gewalt zu betrauen, deren Gebrauch das Volk selbst bestimmen konnte. Ihre Macht war nur die Macht des Volkes selbst, konzentriert und gebrauchsfertig. Diese Art zu denken, oder besser gesagt, zu fühlen, war der letzten Generation der europäischen Liberalen gemeinsam, und offenbar herrscht sie auf dem Kontinent noch vor. Glänzende Ausnahmen unter den Denkern des Festlandes sind die, die eine Grenze anerkennen für das, was eine Regierung tun darf, außer wenn die Regierung nach ihrer Meinung kein Recht hat, zu bestehen. Eine ähnliche Denkungsart würde in dieser Epoche in unserm eignen Lande herrschen, wenn die Umstände, die sie eine Zeitlang ermutigt, unverändert geblieben wären, aber in politischen und philosophischen Theorien, wie bei einzelnen Personen, offenbart der Erfolg oft Fehler und Schwächen, die sonst unentdeckt geblieben wären. Die Lehre, daß das Volk nicht nötig habe, seine Macht über sich selbst zu begrenzen, ist für sich einleuchtend erschienen, solange Volksherrschaft ein Ding war, von dem man nur träumte oder von dem man gelesen hatte, daß es in einer entfernten Periode in der Vergangenheit existiert hatte. Auch mußte der Glaube daran nicht notwendig gestört werden, durch so zeitweilige Abirrungen, wie die der französischen Revolution, deren schlimmste das Werk einiger weniger Usurpatoren waren. Ihre Einrichtungen gehören jedenfalls nicht zu den immerwährenden populären Institutionen, sondern sie stellen einen plötzlichen und konvulsivischen Ausbruch gegen monarchischen und aristokratischen Despotismus dar.
Mit der Zeit aber beschlagnahmte ein großer demokratischer Freistaat einen erheblichen Teil der Erdoberfläche. Er entwickelte sich zu einem der machtvollsten Glieder in der Gemeinschaft der Nationen. Dadurch wurde ein wählbares und verantwortliches Regiment der Beobachtung und Kritik unterworfen, der eine große reale Tatsache unterliegt. Es wurde nun bemerkt, daß Phrasen wie »Selbstregierung« und die »Herrschaft des Volkes über sich selbst« nicht den wahren Sachverhalt ausdrücken. Das Volk, das die Herrschaft ausübt, ist nicht immer dasselbe wie das, worüber sie ausgeübt wird, und die vielbesprochene »Selbstregierung« bedeutet nicht, daß jeder von sich selbst beherrscht werde, sondern jeder von allen übrigen. Der »Wille des Volkes« bedeutet praktisch: Der Wille des zahlreichsten und tätigsten Teiles des Volkes, die »Majorität«, umfaßt diejenigen, denen es gelingt, sich als Mehrheit geltend zu machen; es ist darum möglich, daß das Volk wünscht, einen Teil aus seiner Mitte zu unterdrücken, und so sind Vorsichtsmaßregeln gegen diesen wie gegen jeden Mißbrauch der Gewalt nötig. Die Beschränkung der Regierungsmacht über Einzelne verliert darum nichts von ihrer Wichtigkeit, wenn die Machtinhaber dem Volke, d.h. der stärksten Partei, verantwortlich sind. Mühelos hat sich diese Beurteilung der Dinge eingebürgert, die sich ebenso sehr der Einsicht der Denker empfahl, wie der Neigung der wichtigsten Klassen der europäischen Gesellschaft, zu deren wirklichen oder eingebildeten Interessen die Demokratie im Gegensatz steht, darum wird in politischen Erörterungen die Tyrannei der Mehrheit jetzt gewöhnlich unter den Übeln aufgezählt, vor denen die Gesellschaft auf ihrer Hut sein soll. Wie andere Tyranneien wurde und wird sie von den meisten noch heut hauptsächlich dann gefürchtet, wenn sie durch Akte der öffentlichen Gewalt ausgeübt wird. Aber nachdenkliche Personen bemerken, daß — wenn die Gesellschaft selbst der Tyrann ist — die Gesellschaft als Ganzes gegen die Einzelnen, aus denen sie besteht, in ihrem Machtmittel nicht beschränkt ist auf die Akte, die sie durch ihre politischen Funktionäre vollziehen kann. Die Gesellschaft kann ihre eignen Mandate gebrauchen und tut das auch, und wenn sie schlechte statt guter Befehle gibt, oder sich überhaupt in Dinge mischt, mit denen sie sich besser nicht befaßte, so übt sie eine soziale Tyrannei aus, die furchtbarer ist als manche Arten obrigkeitlicher Bedrückung. Sie bietet zwar für gewöhnlich nicht die äußersten Strafmittel auf; aber sie läßt weniger Wege zum Entkommen, sie dringt viel tiefer in die Einzelheiten des Lebens und versklavt die Seele selbst. So genügt es nicht, sich gegen die Tyrannei der Machthaber zu schützen, man muß sich auch wehren gegen die Bevormundung der herrschenden Meinung und des herrschenden Gefühls. Man muß sich schützen gegen die Absicht der Gesellschaft, durch andere Mittel als bürgerliche Strafen ihr eignes Denken und Tun als Regel auch solchen aufzuerlegen, die davon abweichen. Man muß sich hüten vor der Neigung der Gesellschaft, die Entwicklung zu hemmen und, wenn möglich, die Bildung jeder Individualität zu hindern, die mit den Wegen der Allgemeinheit nicht übereinstimmt, und alle Charaktere zu zwingen, sich nach ihrem eignen Muster zu richten. Es gibt eine Grenze für das berechtigte Eingreifen der allgemeinen Meinung in die persönliche Unabhängigkeit, und diese Grenze zu finden und sie gegen Übergriffe zu schützen, ist für eine gute Sicherung des menschlichen Lebens ebenso unentbehrlich, wie der Schutz gegen politischen Despotismus. Aber obgleich dieser Satz nicht leicht in allgemeinen Ausdrücken zu bestreiten ist, so ist die praktische Frage, wo die Grenze zu setzen sei, und wie man die geeignete Abgrenzung finde zwischen persönlicher Unabhängigkeit und der Kontrolle der Gesellschaft, ein Problem, bei dem fast alles noch zu lösen bleibt. Alles, was das Leben für den Einzelnen wertvoll macht, beruht darauf, daß man den Handlungen der andern Menschen Zwang und Schranken auferlegt. Darum müssen einige Verhaltungsmaßregeln gegeben werden, zunächst durch das Gesetz; bei den Dingen aber, die für die Gesetzgebung nicht geeignet sind, durch das Dafürhalten der Menschen. Eine wichtige Frage für die menschliche Gesellschaft ist die, worin diese Regeln bestehen sollen. Diese Frage gehört jedoch, wenn wir einige der einfachsten Fälle ausnehmen, zu den Problemen, deren Lösung den geringsten Fortschritt gemacht hat. Nicht zwei Zeitalter und kaum zwei Länder haben sich gleichmäßig entschieden, und die Entscheidung eines Zeitalters und eines Landes setzt die andern in Erstaunen, und doch vermuten die Menschen eines bestimmten Zeitalters oder Landes keine Schwierigkeit darin, so als ob die Menschheit in ihren Urteilen stets übereingestimmt hätte. Die Regeln, die unter ihnen gelten, erscheinen ihnen selbstverständlich und keiner Rechtfertigung bedürftig. Diese fast in der ganzen Welt verbreitete Täuschung ist ein Beispiel für die zauberhafte Macht der Gewohnheit, die nicht nur, wie das Sprichwort sagt, eine zweite Natur ist, sondern beständig für die erste genommen wird. Die Macht der Gewohnheit verhindert, daß man die Regeln des Benehmens irgendwie mißachtet, die die Menschen einander auferlegen. Und die Gewohnheit ist um so zwingender, weil man es meist nicht für nötig hält, Gründe für das zur Gewohnheit Gewordene anzugeben; man bringt solche Gründe weder anderen, noch sich selbst zum Bewußtsein. Die Menschen haben sich vielmehr gewöhnt, zu glauben — und einige, die sich Philosophen nennen1, haben sie in diesem Glauben bestärkt —, daß diese Dinge mehr durch Gefühl, als durch Vernunftgründe entschieden werden, ja, daß Gefühle die Vernunftgründe überflüssig machen. Das praktische Prinzip, das sie bei der Bestimmung menschlicher Handlungen leitet, ist das Gefühl jedes Menschen, daß jeder andere so handeln müsse, wie es ihm und seinen Freunden gefällt. Niemand zwar gesteht sich, daß der Maßstab für sein Handeln nur sein eignes Belieben ist; aber ein Urteil über Handlungen, das nicht von Vernunftgründen ausgeht, kann nur als persönliche Meinung eines Menschen gelten. Und wenn die Gründe nichts anderes geltend machen als ähnliche Meinungen anderer Menschen, so ist nur das Belieben vieler Menschen an Stelle des Einen getreten. Für einen gewöhnlichen Menschen ist jedoch sein eignes Belieben, wenn es durch das der andern gestützt wird, nicht allein ein vollkommen genügender Grund, sondern auch der einzige, den er anführen kann für alle Prinzipien der Moral, des Geschmackes oder der Eigenheit, sofern sie nicht in seinem religiösen Glauben besonders gestützt sind. Ja, selbst als Begründung der religiösen Begriffe ist das persönliche Belieben der hauptsächlichste Führer. Die Meinungen der Menschen über das, was zu loben oder zu tadeln ist, hängen von all den mannigfachen Gründen ab, die ihre Wünsche für das Verhalten der andern beeinflussen. Und diese Gründe sind so zahlreich wie diejenigen, die ihre Neigung in irgendeiner andern Hinsicht bestimmen. Zuweilen ist dieser Faktor ihre Vernunftansicht, ein andermal Vorurteil oder Aberglaube, oft soziale Regungen, nicht selten aber auch antisoziale, wie Neid oder Eifersucht, Anmaßung oder Hochmut, aber zumeist persönliche Wünsche oder persönliche Furcht, berechtigtes oder unberechtigtes Selbstinteresse. Wo es eine herrschende Klasse gibt, rührt ein großer Teil der moralischen Begriffe eines Landes von ihren Klasseninteressen, von ihrem Gefühl der Überlegenheit her. Das moralische Verhältnis zwischen Spartiaten und Heloten, zwischen Pflanzern und Negern, zwischen Fürsten und Untertanen, Adel und Bürgerschaft, Männern und Frauen ist zum größten Teil das Ergebnis dieser Klasseninteressen. Und die Gefühle, die so verallgemeinert sind, wirken wieder zurück auf das moralische Empfinden der Mitglieder der herrschenden Klasse, auf ihre Beziehungen untereinander. Wo andrerseits eine einst herrschende Klasse ihre Vorherrschaft verloren hat oder wo diese Herrschaft unzulänglich geworden ist, tragen die herrschenden moralischen Gefühle oft das Gepräge einer ungeduldigen Abneigung gegen jede Überlegenheit. Ein anderes, sehr bestimmendes Prinzip für das Tun und Lassen der Menschen, ein Prinzip, das durch Gesetz oder Meinung geheiligt wird, ist die Unterwerfung der Menschen unter die angenommenen Neigungen oder Abneigungen ihrer augenblicklichen Meister oder ihrer Götter. Diese Unterwerfung ist, obgleich ausgesprochen selbstsüchtig, doch nicht heuchlerisch. Aus ihr entstanden ganz echte Gefühle des Abscheus; sie bewirkte, daß die Menschen Zauberer und Ketzer verbrannt haben. Unter so vielen niederen Einflüssen haben allgemeine und offenkundige Interessen der Gesellschaft natürlich auch einen Anteil gehabt und zwar einen großen; er liegt zwar mehr in der Richtung der moralischen Gefühle als in der einer Vernunfterwägung, da jene Gefühle weniger um ihrer selbst willen gelten, als infolge der Sympathien und Antipathien, die aus ihnen entstanden. Es sind oft Neigungen und Abneigungen, die wenig oder nichts mit den Interessen der Gesellschaft zu tun haben und die doch auf die Bildung der moralischen Begriffe mächtig mit eingewirkt haben. So haben die Tendenzen der Gesellschaft oder einer mächtigen Clique hauptsächlich die Regeln bestimmt, die zur allgemeinen Befolgung festgelegt sind unter dem Schutz von Gesetz und öffentlicher Meinung. Sehr oft haben die, die in ihrem Denken und Fühlen der Gesellschaft voraus waren, diese Sachlage im Prinzip unberührt gelassen, wenn sie auch im Einzelnen damit in Konflikt gerieten. Sie haben sich lieber damit beschäftigt, zu bestimmen, welche Dinge die Gesellschaft billigen oder mißbilligen sollte, als zu fragen, ob diese Tendenzen ein Gesetz für das Individuum seien. Sie bemühten sich lieber, die Gefühle der Menschen in den Punkten zu ändern, in denen sie selbst ketzerisch waren, als um der Freiheit willen gemeinsame Sache mit Ketzern zu machen. Der einzige Fall, in dem der höhere Standpunkt prinzipiell von mehr als einem angenommen wurde, ist der des religiösen Glaubens. Das ist in mehr als einer Beziehung lehrreich, nicht zum mindesten darum, weil es einen schlagenden Beweis für die Unzulänglichkeit dessen bietet, was man »moralischen Sinn« nennt. Denn das odium theologicum eines ehrlichen Bigotten ist einer der unzweideutigsten Fälle des moralischen Sinnes. Diejenigen, die zuerst das Joch dessen brachen, was man die »allgemeine Kirche« nannte, waren zumeist ebensowenig gewillt, ein Abweichen von der religiösen Meinung zu dulden, wie jene Kirche selbst. Aber die Hitze des Kampfes ging vorüber, ohne irgendeiner Partei einen vollständigen Sieg zu verschaffen, und jede Kirche oder Sekte war auf die Hoffnung angewiesen, den einmal eroberten Grund weiter zu besitzen. Da die Minderheiten keine Aussicht hatten, einmal Mehrheiten zu werden, so mußten sie dennoch streben, diejenigen, die sie nicht bekehren konnten, um die Erlaubnis zu bitten, von ihnen abweichen zu dürfen. Auf diesem Schlachtfeld fast ausschließlich sind die Rechtsansprüche des Individuums gegen die Gesellschaft auf breiter Grundlage vertreten, und das Verlangen der Gesellschaft, Autorität über Abweichende auszuüben, ist oft bekämpft worden. Die großen Schriftsteller, denen die Welt das verdankt, was sie an religiöser Freiheit besitzt, haben zumeist die Gewissensfreiheit als unverlierbares Recht behauptet und haben absolut geleugnet, daß ein menschliches Wesen andern für seinen religiösen Glauben verantwortlich sei. Doch ist den Menschen Intoleranz in allem, was ihnen am Herzen liegt, so natürlich, daß religiöse Freiheit kaum irgendwo praktisch verwirklicht ist, außer da, wo religiöse Gleichgültigkeit, die ihren Frieden nicht durch theologische Streitigkeiten gestört haben will, ihr Gewicht in die Waagschale geworfen hat. Im Sinne fast aller religiöser Menschen, selbst in den tolerantesten Ländern, gilt die Pflicht der Duldung nur mit stillschweigender Reserve. Einer verträgt Widerspruch zwar in Dingen, die das Kirchenregiment angehen, aber nicht in Bezug auf das Dogma; ein Anderer übt Duldung gegen jeden, außer gegen Papisten oder Unitarier, wieder ein Anderer gegen jeden, der an eine geoffenbarte Religion glaubt. Einige erstrecken ihre Duldung ein wenig weiter, aber sie machen Halt beim Glauben an Gott und an die Unsterblichkeit. Überall, wo das Gefühl der Wahrheit noch echt und stark ist, findet man, daß es seinen Anspruch auf Herrschaft nur wenig gemildert hat.
In England wiegt infolge der besonderen Umstände unserer politischen Geschichte das Joch der Meinung vielleicht schwerer, das des Gesetzes vielleicht leichter, als in den meisten andern Ländern Europas. Ja, es besteht eine beträchtliche Eifersucht gegen direkte Eingriffe der gesetzgebenden oder ausführenden Gewalt in das Privatleben, aber nicht so sehr, weil man auf die Unabhängigkeit des Individuums gerechte Rücksicht nimmt, sondern weil man, nach alter Gewohnheit, in der Regierung eine dem Volksinteresse feindliche Macht sieht. Die Mehrheit hat noch nicht gelernt, die Macht der Regierung als ihre Macht oder deren Ansichten als eigene Meinungen anzusehen. Wenn sie das gelernt hat, dann wird wahrscheinlich die individuelle Freiheit Angriffen von Seiten der Regierung ebenso ausgesetzt sein wie jetzt denen der öffentlichen Meinung. Aber bis jetzt regt sich noch lebhafter Widerspruch gegen jeden Versuch des Gesetzes, die Einzelnen in Dingen zu beeinflussen, in denen sie bisher an eine Kontrolle nicht gewöhnt waren. Dabei unterscheiden sie wenig, ob die Sache in die legitime Sphäre gesetzlichen Einflusses gehört, oder nicht. So ist das Gefühl des Widerstandes, das im Ganzen höchst heilsam ist, im Einzelnen vielleicht ebenso oft übel angebracht wie gut begründet. Es gibt in der Tat kein anerkanntes Prinzip, nach dem das Eingreifen der Regierung als angemessen oder unangemessen bewertet wird. Einige wollen, sobald sie sehen, daß etwas Gutes getan oder etwas Übles verhindert werden kann, die Regierung sofort veranlassen, dies zu tun. Andere dagegen ertragen lieber jedes soziale Übel, als daß sie sich entschließen, für ein menschliches Interesse die Regierung verantwortlich zu machen. Gemäß dieser allgemeinen Richtung der Gefühle wählen die Menschen in jedem Einzelfalle die eine oder die andere Lösung, oder sie entscheiden sich nach dem Interesse, das sie an dem fraglichen Gegenstand nehmen. Andere wieder entscheiden sich, je nachdem sie glauben, daß die Regierung in der von ihnen gewünschten Weise handeln werde, oder nicht. Sehr selten aber urteilen sie auf Grund einer prinzipiellen Überlegung, welche Geschäfte der Regierung zustehen und welche nicht. Und mir scheint, daß infolge dieses Mangels an Prinzipien die eine Partei sich ebenso viel irrt wie die andere. Das Eingreifen der Regierung wird ebenso oft zu Unrecht angerufen wie zu Unrecht verurteilt. Der Zweck dieses Aufsatzes ist es nun, ein sehr einfaches Prinzip festzustellen, daß das zweckmäßige Eingreifen des Staates in die Angelegenheiten der Einzelnen regeln soll, mögen die Mittel des Eingreifens gesetzliche Strafen oder der moralische Druck der öffentlichen Meinung sein. Dieser Grundsatz lautet: das einzige Ziel, um dessentwillen es der Menschheit gestattet ist, einzeln oder vereint, die Freiheit eines ihrer Mitglieder zu beschränken ist Selbstschutz.