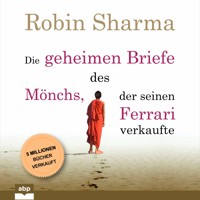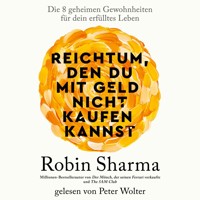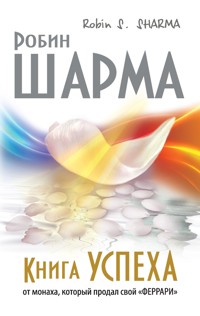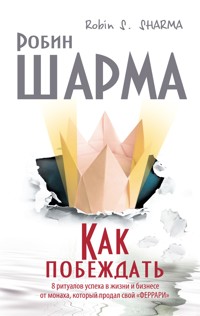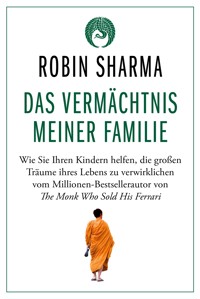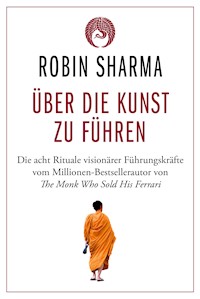
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Robin Sharma – weltbekannte Leadership-Legende – erzählt die Geschichte von Peter Franklin, einem frustrierten Inhaber eines angeschlagenen digitalen Softwareunternehmens. Gerade als die Dinge für Peter hoffnungslos scheinen, steht ein junger Mönch vor seiner Tür und bietet ihm einen todsicheren Rat, wie er das Schicksal seines Unternehmens wenden kann. Peter ist erstaunt, als er erfährt, dass es sich bei dem Mönch um seinen lang vermissten Freund handelt, der von seiner außergewöhnlichen Indien-Odyssee zurückgekehrt und bereit ist, seine zeitlosen Weisheiten für visionäre Führung zu teilen. Dieser inspirierende und erhellende Leitfaden, der auf einem einfach zu handhabenden Acht-Schritte-System praktischer Lektionen basiert, ist ein unentbehrbarer Wegweiser für visionäre Führung, der zeigt, wie Sie Vertrauen, Engagement und Glauben in Ihrer Organisation wiederherstellen und dabei gleichzeitig Ihr Leben verändern können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Robin Sharma
ÜBER DIE KUNST ZU FÜHREN
Robin Sharma
ÜBER DIE KUNST ZU FÜHREN
Die acht Rituale visionärer Führungskräfte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
2. Auflage 2024
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Copyright © 1998 by Robin Sharma
Published by arrangement with HarperCollins Publishers Ltd., Canada
Die englische Ausgabe erschien 1998 bei HarperCollins unter dem Titel Leadership Wisdom from The Monk Who Sold His Ferrari.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Antoinette Gittinger
Redaktion: Silke Panten
Korrektorat: Christine Rechberger
Umschlaggestaltung: in Anlehnung an das Cover der Originalausgabe Marc-Torben Fischer, München
Umschlagabbildung: Mönch, iStockPhoto
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-645-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-236-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-237-5
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Tochter Bianca. Mögest du immer die Freude verkörpern.
Für die vielen Leser von Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, die sich trotz ihres hektischen Alltags die Zeit genommen haben, mir zu berichten, wie sehr sie dieses Buch bewegt hat. Sie haben mich sehr berührt.
Und für all jene Führungskräfte, die das tiefe Vertrauen zwischen sich und den Menschen, die zu führen sie das Privileg haben, in höchstem Maße ehren. Wirken Sie weiterhin segensreich und decken Sie Talente auf.
Die wahre Freude im Leben ist, für ein Ziel gebraucht zu werden, das man selbst als wichtig anerkennt, eine regelrechte Naturgewalt zu sein statt ein fiebriger kleiner Klumpen von Leiden und Beschwerden, der darüber klagt, dass die Welt sich nicht der Aufgabe verschreibt, ihn glücklich zu machen … Wenn ich sterbe, möchte ich vollkommen verbraucht sein. Denn je härter ich arbeite, desto mehr spüre ich das Leben, das ich um seiner selbst willen genieße. Das Leben stellt für mich keine schnell abbrennende Kerze dar, sondern eine leuchtende Fackel, die ich im Augenblick hochhalten muss. Und ich möchte, dass sie so hell wie möglich leuchtet, bevor ich sie an künftige Generationen weitergebe.
George Bernard Shaw
Inhalt
Danksagung
Kapitel 1: Eine wilde Fahrt zum Erfolg
Kapitel 2: Ein Mönch in meinem Rosengarten
Kapitel 3: Die wundersame Verwandlung eines Unternehmenskriegers
Kapitel 4: Weise Mitarbeiterführung – Eine Vision
Kapitel 5: Das Ritual einer lohnenden Zukunftsvision
Kapitel 6: Das Ritual menschlicher Beziehungen
Kapitel 7: Das Ritual des Teamgeists
Kapitel 8: Das Ritual der Anpassungsfähigkeit und des Changemanagements
Kapitel 9: Das Ritual der persönlichen Effektivität
Kapitel 10: Das Ritual der Selbstführung
Kapitel 11: Das Ritual der Kreativität und der Innovation
Kapitel 12: Das Ritual des Beitrags und der Bedeutung
Der Autor
Danksagung
Ich danke den vielen Tausend Menschen, die Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte gelesen haben, sich von dessen Lektionen inspirieren ließen und ihre Erkenntnisse mit ihren Familien und Freunden teilten. Danke, dass Sie mir dabei behilflich waren, diese Botschaft zu verbreiten, um so viele Leben zu verbessern.
All jenen, die meine öffentlichen und firmeninternen Seminare in den Vereinigten Staaten und Kanada besucht haben. Mein besonderer Dank gilt den Firmenkunden von Sharma Leadership International, die persönliche und organisatorische Führungsprogramme für ihre Mitarbeiter gesponsert haben. Ich fühle mich privilegiert, einen Beitrag zu Ihrem Erfolg leisten zu können.
Dem gesamten Team von HarperCollins. Ihr habt es geschafft, dies für mich zu einer höchst erfreulichen und befriedigenden Erfahrung zu machen. Mein besonderer Dank gilt Claude Primeau für seine Beratung, Iris Tupholme für ihren Glauben an mich, Judy Brunsek, Tom Best, Marie Campbell, David Millar, Lloyd Kelly, Doré Potter, Valerie Applebee, Neil Erickson und Nicole Langlois, meiner klugen und höchst kompetenten Lektorin.
Meinem geschätzten Team bei Sharma Leadership International für die Energie, die Unterstützung und die Planung meiner zahllosen Termine für Firmenseminare und meiner Werbeaktionen.
Danken möchte ich auch meinen Eltern, denen ich meinen höchsten Respekt zolle, die ich wertschätze und liebe, meinem Bruder Sanjay, meinem unermüdlichen Unterstützer und Vertrauten, und seiner Frau Susan.
Und meinem kleinen Sohn Colby, der mich beim Schreiben des Manuskripts immer aufgemuntert hat (teilweise mit seinen Curious-George-Geschichten) sowie meiner Tochter Bianca, die immer mein Sonnenschein war.
Kapitel 1
Eine wilde Fahrt zum Erfolg
Es war der deprimierendste Tag meines Lebens. Als ich nach einem der seltenen langen Wochenenden, das ich mit meinen Kindern wandernd und lachend in den Bergen verbracht hatte, an meinen Arbeitsplatz zurückkehrte, sah ich, wie sich zwei hünenhafte Sicherheitsbeamte über den Mahagonischreibtisch in meinem heiß geliebten Eckbüro beugten. Beim Näherkommen erkannte ich, dass sie meine Unterlagen durchwühlten und auf die wertvollen Dokumente in meinem Laptop starrten, ohne zu bemerken, dass ich sie entdeckt hatte. Schließlich wurde einer von ihnen auf mich aufmerksam. Ich stand da mit vor Zorn gerötetem Gesicht; meine Hände zitterten beim Anblick dieses unverzeihlichen Übergriffs. Mit völlig regloser Miene blickte mich der eine Hüne an und sagte dreizehn Wörter, von denen sich jedes einzelne wie ein Schlag in meine Magengrube anfühlte: »Mr. Franklin, Sie sind gefeuert. Wir müssen Sie sofort aus dem Gebäude hinausgeleiten.«
Diese schlichte Mitteilung verwandelte mich vom Vizepräsidenten des am schnellsten wachsenden Softwareunternehmens in einen Mann ohne Zukunft. Und glauben Sie mir, meine Entlassung ging mir an die Nieren. Scheitern war für mich ein Fremdwort, eine Erfahrung, mit der ich nicht umzugehen wusste. Auf dem College war ich ein Musterknabe gewesen, der Junge mit den besten Noten, den schönen Mädchen und einer glänzenden Zukunft. Ich schaffte es in die Leichtathletikmannschaft, wurde zum Jahrgangssprecher gewählt und fand sogar die Zeit, eine äußerst beliebte Jazzsendung bei unserem Radiosender auf dem Campus zu moderieren. Alle Beteiligten glaubten, dass ich begabt und für eine erfolgreiche Karriere prädestiniert sei. Eines Tages bekam ich mit, wie einer meiner alten Professoren zu einem Kollegen sagte: »Hätte ich die Chance, mein Leben noch einmal von vorne zu beginnen, würde ich gern als Peter Franklin auf die Welt kommen.«
Meine Talente waren jedoch nicht so naturgegeben, wie alle glaubten. In Wirklichkeit gründeten meine Erfolge auf einer strikten Arbeitsmoral und einem fast zwanghaften Siegeswillen. Mein Vater war vor vielen Jahren als mittelloser Einwanderer mit der festen Vorstellung von einem ruhigeren, erfolgreichen und glücklichen Leben für seine junge Familie in dieses Land gekommen. Er änderte unseren Familiennamen, zog mit uns in eine Dreizimmerwohnung in einem gutbürgerlichen Stadtteil, arbeitete unermüdlich als Fabrikarbeiter für einen Mindestlohn und ging dieser Tätigkeit die nächsten vierzig Jahre seines Lebens nach. Obwohl er keine Schulbildung genossen hatte, hatte ich nie einen klügeren Mann kennengelernt – bis vor Kurzem, als ich einem außergewöhnlichen Mann begegnete, den Sie unbedingt ebenfalls kennenlernen müssen. Ich verspreche, dass ich Ihnen bald mehr über ihn verraten werde. Danach werden Sie ein anderer Mensch sein.
Der Traum meines Vaters für mich war einfach: Ich sollte eine erstklassige Ausbildung an einer erstklassigen Schule erhalten. Mein Vater nahm an, dass damit eine glänzende Karriere mit gerechter Entlohnung gesichert wäre; er glaubte fest daran, dass ein guter Grundstock an persönlichem Wissen die Basis für ein erfolgreiches Leben bildete. »Peter, was auch immer dir zustößt, denk immer daran: Niemand kann dir deine Bildung nehmen. Das Wissen wird immer dein bester Freund sein, egal, wohin du gehst oder was du tust«, erklärte er mir immer wieder, während er nach einem weiteren zermürbenden Vierzehn-Stunden-Tag in der Fabrik, in der er den größten Teil seines Lebens verbrachte, sein Abendessen beendete. Mein Vater war ein großartiger Mensch.
Er war auch ein hervorragender Geschichtenerzähler, einer der besten. In seiner Heimat verwendeten die Ältesten Parabeln, um ihren Kindern jahrhundertealtes Wissen zu vermitteln, und so nahm mein Vater diese lange Tradition mit in seine Wahlheimat. Von dem Tag an, an dem meine Mutter unerwartet starb, während sie in unserer abgenutzten Küche sein Mittagessen zubereitete, bis zu der Zeit, in der mein Bruder und ich ins Teenageralter kamen, las uns unser Vater jeden Abend, bevor er uns eine Gute Nacht und schöne Träume wünschte, eine wunderbare Geschichte vor, die immer eine Lektion fürs Leben enthielt. Eine Geschichte, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, handelte von einem alten Bauern, der im Sterben lag und seine drei Söhne um sich versammelte. »Meine Söhne«, sagte er, »der Tod lauert auf mich und bald werde ich meinen letzten Atemzug tun. Doch vorher muss ich euch noch ein Geheimnis anvertrauen. Auf dem Feld hinter unserem Bauernhaus liegt ein wertvoller Schatz. Wenn ihr tief grabt, findet ihr ihn. Dann werdet ihr euch nie wieder Sorgen ums Geld machen müssen.«
Nachdem der alte Mann tot war, rannten die Söhne zu dem Feld und fingen wild entschlossen an zu graben. Sie gruben viele Stunden und plagten sich noch viele Tage ab. Kein Teil des Felds blieb unbearbeitet, während sie all ihre jugendliche Energie in diese Aufgabe steckten. Aber leider fanden sie keinen Schatz. Schließlich gaben sie auf, verfluchten ihren Vater wegen seiner offensichtlichen Irreführung und fragten sich, warum er sie derart an der Nase herumgeführt hatte. Doch im Herbst des nächsten Jahres brachte dasselbe Feld eine Ernte hervor, wie sie die gesamte Gemeinde nie zuvor erlebt hatte. Die drei Söhne gelangten innerhalb kurzer Zeit zu Reichtum und brauchten sich nie wieder Sorgen ums Geld zu machen.
Von meinem Vater lernte ich also die Kraft des unermüdlichen Einsatzes, des Fleißes und der harten Arbeit. Während meiner Collegezeit büffelte ich Tag und Nacht, um auf der Bestenliste eines Studiengangs, der sogenannten Dean’s List, zu bleiben und die Träume zu erfüllen, die mein Vater für mich hatte. Ich gewann ein Stipendium nach dem anderen und schickte meinem Vater regelmäßig am Ende des Monats einen Scheck mit einer kleinen Summe, einem Teil des Lohns für meinen Teilzeitjob.
Dies war eine einfache Dankesgeste für alles, was er für mich getan hatte. Als es an der Zeit war, einen Beruf zu ergreifen, hatte man mir bereits ein lukratives Angebot für eine Managementposition im Hightechbereich, dem von mir gewählten Bereich, gemacht. Es handelte sich um das Unternehmen Digitech Software Strategies, eine Firma, bei der jeder arbeiten wollte. Sie war sehr erfolgreich und die Experten sagten voraus, dass ihr kometenhaftes Wachstum anhalten würde. Ich fühlte mich geehrt, dass das Unternehmen mich angeworben hatte, Teil des hochkarätigen Teams zu werden. Ich nahm das Angebot ohne Zögern an und begann sofort, achtzig Stunden pro Woche zu arbeiten, um zu beweisen, dass ich jeden Cent meines hohen Gehalts wert war. Ich konnte nicht ahnen, dass mich dasselbe Unternehmen sieben Jahre später so demütigen würde, wie ich noch nie gedemütigt worden war.
Die ersten paar Jahre bei Digitech waren wirklich angenehm. Ich fand gute Freunde, lernte viel und stieg schnell in die Führungsriege auf. Ich wurde der allgemein anerkannte Superstar, ein junger Mann mit messerscharfem Verstand, der hart arbeiten konnte und echtes Engagement für das Unternehmen an den Tag legte. Obwohl ich nie richtig gelernt hatte, Menschen zu führen, übertrug man mir immer verantwortungsvollere Posten.
Aber das Beste, was mir bei Digitech Software Strategies widerfuhr, war eindeutig die Begegnung mit Samantha, meiner späteren Frau. Sie war eine kluge junge Managerin, auffallend hübsch und verfügte über einen überragenden Intellekt. Wir hatten uns auf der Weihnachtsfeier kennengelernt, verstanden uns auf Anhieb prächtig und verbrachten schon bald das bisschen Freizeit, das uns blieb, zusammen. Vom ersten Tag an war Samantha mein größter Fan, glaubte fest an mein Potenzial und mein Talent. »Peter, du wirst der CEO«, erklärte sie mir regelmäßig und bedachte mich mit einem sanften Lächeln. »Ich weiß, du hast alles, was man dafür braucht.« Leider teilten nicht alle ihre Meinung. Oder vielleicht doch.
Der augenblickliche CEO von Digitech Software herrschte im Unternehmen wie ein Diktator. Er war ein Selfmademan mit einer gemeinen Ader, dessen Ego zu seinem maßlos überzogenen Gehaltsscheck passte. Als ich anfing, mit ihm zu arbeiten, war er höflich, aber reserviert. Doch als sich meine Fähigkeiten und meine Ambitionen in der Firma herumsprachen, wurde er kühl und kommunizierte häufig mit mir mittels knapper Memos, auch wenn die Situation weniger Förmlichkeit verlangte. Samantha nannte ihn einen »unsicheren kleinen Trottel«, aber Tatsache war, dass er Macht besaß. Echte Macht. Vielleicht hatte er, als ich in höhere Managementpositionen befördert wurde, das Gefühl, dass er ein schlechtes Bild abgeben würde. Oder vielleicht erinnerte ich ihn zu sehr an ihn selbst – und er mochte nicht, was er sah.
Doch ich muss zugeben, dass auch ich meine Schwächen hatte. In erster Linie war da mein aufbrausendes Temperament. Wenn etwas zum falschen Zeitpunkt schiefging, baute sich Wut in mir auf, die ich einfach nicht beherrschen konnte. Ich habe keine Ahnung, worauf sie zurückzuführen war, aber sie war da. Und gereichte mir in der Firma keineswegs zum Vorteil. Obwohl ich mich für einen anständigen Menschen halte, muss ich auch zugeben, dass ich im Umgang mit anderen etwas ungehobelt sein konnte. Wie bereits erwähnt, hatte ich nie ein Führungstraining erhalten und musste mich auf das bisschen Instinkt verlassen, das ich von Haus aus besaß. Ich hatte oft das Gefühl, dass nicht jeder in meinem Team meine Arbeitsmoral und mein Streben nach Höchstleistungen teilte, was Frust in mir hervorrief. Ja, ich schrie Leute an. Ja, ich übernahm viel mehr Verantwortung, als ich eigentlich verkraften konnte. Ja, ich hätte mehr Zeit für das Knüpfen von Beziehungen und die Pflege von Loyalität aufwenden sollen. Aber es gab immer zu viele Feuer zu löschen, und ich schien nie genug Zeit zu haben, mich um das zu kümmern, was verbessert werden musste. Ich glaube, ich war wie der Seemann, der all seine Zeit damit verbrachte, Wasser aus seinem Boot zu schöpfen, statt sich die Zeit zu nehmen, das Loch im Boot zu reparieren. Das war höchst kurzsichtig.
Und so kam der Tag, an dem ich gefeuert wurde. Die darauffolgenden Monate waren die düstersten meines Lebens. Zum Glück hatte ich Samantha und die Kinder um mich. Sie taten ihr Bestes, um mich aufzumuntern und mich zu ermutigen, die Scherben meiner einst atemberaubenden Karriere aufzusammeln. Diese Monate des Müßiggangs zeigten mir jedoch, dass unser Selbstwertgefühl mit unserem Job zusammenhängt. Bei einer Cocktailparty wird uns unweigerlich als Erstes die Frage gestellt: »Und was machen Sie beruflich?« Wenn wir unsere wöchentliche Golfrunde in Angriff nahmen, fragten meine Partner stets: »Und was macht der Job, Peter?« Der Pförtner unseres luxuriösen Hochhauses, ein Meister des Small Talks, erkundigte sich regelmäßig, ob bei mir im Büro alles glatt laufe. Aber da ich jetzt keinen Job mehr hatte, hatte ich auch keine Antworten mehr parat.
Ich stand morgens nicht mehr frühzeitig auf und eilte zur U-Bahn-Station, den Kopf voller Ideen, sondern wachte gegen Mittag in einem abgedunkelten Schlafzimmer auf, in dem sich leere Heineken-Flaschen, Marlboro-Packungen und klebrige Häagen-Dazs-Becher stapelten. Ich las nicht mehr das Wall Street Journal, sondern beschränkte mich auf kitschige Spionageromane, alte Westernheftchen und billige Boulevardblätter, in denen zu lesen war, dass Oprah eine Außerirdische sei und Elvis noch lebte und an der Westküste einen McDonald’s betrieb. Ich fand nicht die Kraft, mich der Wirklichkeit zu stellen. Ich weigerte mich, zu viel nachzudenken oder zu tun. Ein betäubender Schmerz erfasste meinen Körper, und der beste Platz für mich schien der unter der Decke unseres Himmelbetts zu sein.
Dann erhielt ich eines Tages einen Anruf. Am Apparat war ein alter Kommilitone, der als einer der besten Köpfe in der Softwarebranche galt. Er berichtete mir, dass er gerade seinen Job als Chefprogrammierer bei einem großen Unternehmen gekündigt habe und dabei sei, seine eigene Firma zu gründen. Ich erinnere mich noch, dass er mir sagte, er habe ein »brillantes Konzept« für eine neue Softwarelinie und suche einen vertrauenswürdigen Partner. Ich sei seine erste Wahl. »Peter, es ist deine Chance, etwas Großartiges auf die Beine zu stellen«, sagte er mit seiner üblichen Begeisterung. »Schlag ein, es wird Spaß machen.«
Ein Teil von mir zögerte, Ja zu sagen. Ein neues Unternehmen zu gründen ist nie einfach, besonders nicht in der Hightechbranche. Was, wenn wir scheitern würden? Unsere finanzielle Situation war ein Desaster. Als Vizepräsident bei Digitech Software war ich gut bezahlt worden und ich führte ein Leben, von dem mein Vater nur träumen konnte. Ich fuhr einen nagelneuen BMW und Samantha hatte einen Mercedes. Die Kinder besuchten eine Privatschule und verbrachten die Sommerferien in einem renommierten Segelcamp. Allein die Mitgliedsbeiträge für meinen Golfclub waren so hoch wie das Jahreseinkommen vieler meiner Freunde. Da ich jetzt aber arbeitslos war, stapelten sich die unbezahlten Rechnungen und viele Versprechen wurden gebrochen. Es war wahrlich nicht der ideale Zeitpunkt, von einer eigenen Firma zu träumen.
Andererseits hatte mir mein kluger Vater immer Folgendes eingeprägt: »Nichts kann dich besiegen, es sei denn, du besiegst dich selbst.« Ich brauchte diese Chance, um mich aus der Dunkelheit zu lösen, die mein Leben eingehüllt hatte. Ich brauchte morgens einen Grund, aufzuwachen. Ich musste dieses Gefühl von Leidenschaft und Zielbewusstsein wiederfinden, das ich auf dem College verspürt hatte, als ich glaubte, dass nichts mich aufhalten könne und die Welt ein Ort unbegrenzter Möglichkeiten sei. Ich besaß genug Intuition, um zu wissen, dass das Leben uns von Zeit zu Zeit Geschenke macht. Der Erfolg stellt sich bei denen ein, die diese Geschenke erkennen und annehmen. Also sagte ich meinem ehemaligen Kommilitonen zu.
Wir nannten das Unternehmen großspurig GlobalView Software Solutions und richteten uns in einem winzigen Büro in einem heruntergekommenen Industriekomplex ein. Ich war der CEO und mein Partner der selbsternannte Vorsitzende. Wir hatten keine Angestellten, kein Mobiliar und kein Geld. Aber wir hatten eine zündende Idee. Und so begannen wir, unser Softwarekonzept auf dem Markt zu präsentieren. Zum Glück stieß es auf große Begeisterung. Bald schloss sich Samantha unserem Team an und wir stellten weitere Mitarbeiter ein. Unsere innovativen Softwareprodukte verkauften sich in atemberaubendem Tempo und unsere Gewinne schnellten in die Höhe. In diesem ersten Jahr unserer Geschäftstätigkeit führte uns das Magazin Business Success als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Landes auf. Mein Vater war sehr stolz auf mich. Obwohl er damals bereits 86 Jahre alt war, traf er mit einem riesigen Obstkorb in unserem Büro ein, um unseren Erfolg zu feiern. Tränen liefen ihm über die Wangen, als er mich ansah und sagte: »Mein Sohn, deine Mutter wäre heute sehr glücklich gewesen.«
Das liegt mehr als elf Jahre zurück und wir haben unser rasantes Wachstumstempo beibehalten. GlobalView Software Solutions ist heute ein Zwei-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit 2500 Mitarbeitern an acht Standorten auf der ganzen Welt. Erst letztes Jahr haben wir unseren neuen internationalen Hauptsitz bezogen, einen erstklassigen Komplex mit einer hochmodernen Produktionsanlage, drei olympischen Schwimmbecken und einem Amphitheater für Meetings und andere Firmenevents. Mein Partner wirkt nicht mehr am Tagesgeschäft des Unternehmens mit, sondern verbringt die meiste Zeit auf seiner Privatinsel in der Karibik oder mit Bergsteigen in Nepal. Vor einigen Jahren hat sich Samantha aus der Leitung des Unternehmens zurückgezogen, um ihrer Leidenschaft für das Schreiben zu frönen und sich stärker in der Gemeindearbeit zu engagieren. Ich bin immer noch der CEO, trage aber eine erdrückende Verantwortung, die den größten Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt. Ich bin für den Lebensunterhalt von 2500 Menschen verantwortlich, und viele Tausende verlassen sich darauf, dass unser Unternehmen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellt, die ihnen im Alltag von Nutzen sind.
Leider starb mein Vater zwei Jahre nach der Unternehmensgründung. Obwohl er immer ahnte, dass ich überaus erfolgreich sein würde, glaube ich nicht, dass er sich hätte vorstellen können, wie gut wir heute dastehen. Ich vermisse ihn, aber bei all den Aufgaben, die ich zu bewältigen habe, bleibt mir wenig Zeit, über die Vergangenheit nachzudenken. Ich arbeite nach wie vor hart, in einer guten Woche immer noch etwa achtzig Stunden. Seit Jahren habe ich keinen richtigen Urlaub mehr gemacht, und ich bin noch genauso ehrgeizig und wettbewerbsorientiert wie an dem Tag, als ich als junger Mann von 23 Jahren bei Digitech Software Strategies zu arbeiten begann. Bis ich vor Kurzem das Glück hatte, einen ganz besonderen Lehrer kennenzulernen, versuchte ich immer noch, zu viel zu bewältigen und jeden Aspekt des Unternehmens bis ins kleinste Detail zu kontrollieren. Ich wusste, dass dies eine Schwäche war, aber ich hatte anscheinend trotzdem Erfolg.
Bis zu jenem denkwürdigen Meeting, von dem ich Ihnen gleich ausführlicher berichten werde, litt ich immer noch unter meinem Jähzorn, eine Eigenschaft, die sich verschlimmert hatte, je größer das Unternehmen und damit der Druck auf mich geworden waren. Und trotz der vielen Zeit, die vergangen war, fiel es mir immer noch schwer, Menschen zu führen und zu motivieren. Natürlich hörten meine Mitarbeiter auf mich. Aber nicht weil sie es wollten, sondern weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Sie empfanden weder Loyalität mir gegenüber noch fühlten sie sich dem Unternehmen wirklich verpflichtet. Eher aus Angst als aus Respekt befolgten sie die Anweisungen, die ich ihnen von meiner luxuriösen Führungsloge aus erteilte. Anscheinend beruhte meine Macht einzig und allein auf meiner Position. Und ich wusste, dass dies keine gute Situation war.
Lassen Sie mich ein wenig näher auf die Herausforderungen eingehen, mit denen ich als Chef eines schnell wachsenden Unternehmens in diesen turbulenten, schnellem Wandel unterworfenen Zeiten konfrontiert war. Trotz der Expansion unseres Unternehmens war die Arbeitsmoral gesunken. Mir kam zu Ohren, dass einige Angestellte der Meinung waren, das Unternehmen sei zu schnell gewachsen und die Gewinne würden eine größere Rolle spielen als die Menschen. Andere beklagten sich, dass sie zu viel arbeiten müssten und zu wenig Unterstützung bekämen. Es gab auch Klagen von Mitarbeitern, dass ihnen aufgrund der enormen Veränderungen, mit denen sie täglich konfrontiert waren – von technologischen Innovationen bis hin zu neuen Strukturen innerhalb der Verwaltung –, der Kopf schwirre und der Körper vor Anspannung kribbele. Es herrschte wenig Vertrauen, geringe Produktivität und noch weniger Kreativität. Und soweit ich wusste, war fast jeder Firmenangehörige der Meinung, dass nur eine Person für die Probleme verantwortlich sei: ich. Die einhellige Meinung war, dass ich keine Führungsqualitäten besaß.
Obwohl das Wachstum von GlobalView Software anhielt, gab es Anzeichen dafür, dass wir vielleicht zum ersten Mal seit Jahren rote Zahlen verzeichnen müssten. Zwar verkauften sich unsere Programme immer noch gut, dennoch verloren wir Marktanteile. Unsere Mitarbeiter waren nicht mehr so innovativ und inspiriert wie in den Anfängen des Unternehmens. Als Ergebnis waren unsere Produkte nicht mehr so gut konzipiert und einzigartig. Einfach gesagt: Den Mitarbeitern schienen sie einfach egal geworden zu sein. Und ich wusste: Wenn sich diese Einstellung nicht änderte, würde sie letztlich das Ende unserer Firma bedeuten.
Überall zeigten sich Zeichen von Apathie. Die Büros waren desorganisiert und die Mitarbeiter kamen ständig zu spät. An den Weihnachtsfeiern nahm kaum mehr jemand teil und Teamarbeit gab es so gut wie nicht. Konflikte waren an der Tagesordnung und so etwas wie Initiative war kaum noch vorhanden. Sogar unsere neue Produktionsanlage wies erste Anzeichen von Verfall und Vernachlässigung auf; ihre ehemals auf Hochglanz polierten Böden waren nun mit Müll und Schmutz verunreinigt.
Bemerkenswerterweise hat sich all dies geändert. GlobalView Software Solutions steht wieder als hervorragendes Unternehmen da. Und ich weiß, wir werden noch besser werden. Unsere Firma hat sich durch die Anwendung einer sehr speziellen Formel für Führungskräfte, die mir von einem ganz besonderen Mann vermittelt wurde, verändert. Dieses einfache, aber außerordentlich effiziente System hat die Begeisterung, die einst das gesamte Unternehmen durchdrungen hat, wieder aufleben lassen, hat unsere Mitarbeiter zu einem nie da gewesenen Engagement inspiriert, die Produktivität ansteigen lassen und unsere Gewinne in eine Höhe getrieben, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Unsere Angestellten sind jetzt zutiefst loyal und teilen unsere Zukunftsvision. Sie arbeiten als dynamisches und höchst kompetentes Team zusammen. Und noch besser: Sie gehen gern zur Arbeit und ich arbeite gern mit ihnen. Wir alle wissen, dass wir etwas Magisches entdeckt haben und dass wir jetzt etwas Großartiges anstreben. Erst letzte Woche war ich auf der Titelseite des Magazins Business Success zu sehen. Die Überschrift lautete: »Das GlobalView-Wunder: Wie ein Unternehmen groß wurde.«
Worin besteht also diese wunderbare und althergebrachte Formel für Führungskräfte, die mich zum Star der Geschäftswelt gemacht hat? Wer war dieser kluge Besucher, der unser Unternehmen revolutionierte und mir zeigte, wie ich mich zu der Art von Führungspersönlichkeit entwickeln könnte, die diese turbulenten Zeiten erfordern? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Antworten auf diese Fragen Ihre Führungsqualität sowie Ihre Lebensweise verändern werden. Es ist an der Zeit, dass Sie sie entdecken.
Kapitel 2
Ein Mönch in meinem Rosengarten
Es war eine bizarre Szene. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich immer noch nicht glauben, dass dies geschah. Ich hatte gerade meine übliche Montagmorgenbesprechung mit meinen Managern hinter mir, in der ich erfahren hatte, dass sich die Situation von GlobalView zunehmend verschlechterte. Bei dem Meeting hatte mir einer der Manager mitgeteilt, dass einige unserer besten Programmierer erwogen, für ein kleineres Unternehmen zu arbeiten, in dem ihre Arbeit mehr geschätzt würde. Er meinte auch, dass das Verhältnis zwischen dem Management und den Mitarbeitern täglich angespannter werde. »Sie trauen uns nicht mehr«, bemerkte er verärgert.
Ein anderer Manager fügte hinzu: »Nicht nur das, hier ist zudem nichts mehr von Teamwork zu spüren. Bevor wir so groß wurden, haben sich alle gegenseitig geholfen. Den Angestellten lag es am Herzen, ihre Arbeit gut zu machen. Wenn wir früher unter Zeitdruck standen, weil wir einen Großauftrag zu erledigen hatten, haben wir alle zusammengearbeitet, oft bis spät in die Nacht. Daran erinnere ich mich gut. Ich habe auch die Zeiten nicht vergessen, in denen die Programmierer und Manager die Ärmel hochgekrempelt haben, um den Leuten im Versand dabei zu helfen, Kartons zu versiegeln und sie für das Verladen auf die Lieferwagen vorzubereiten. Jetzt macht jeder sein eigenes Ding. Es herrscht eine Bunkermentalität, ich halte es wirklich nicht mehr aus.«
Obwohl ich während des Meetings ungewöhnlich ruhig blieb, brach mir der Schweiß aus, als ich den langen Flur hinunterging, der den Sitzungssaal mit meinem Büro verband. Die Anspannung der letzten Monate machte mich fertig und ich wusste, dass ich etwas unternehmen musste, um die Abwärtsspirale der Firma aufzuhalten. Ich wusste nur nicht, mit wem ich reden oder was ich tun sollte. Sicherlich konnte ich ein Team von Beratern beauftragen, ein paar schnelle Lösungen für die Probleme, die uns quälten, aus dem Hut zu zaubern. Aber ich spürte, dass ich tiefer graben musste, um den Ursachen dafür auf den Grund zu gehen, dass wir uns von einem visionären Unternehmen voller engagierter und mitfühlender Mitarbeiter zu einem schwerfälligen Verwaltungsapparat entwickelt hatten, in dem die Angestellten sich nach dem Feierabend sehnten.
Als ich in meinem Büro angelangt war, tropfte mir der Schweiß von der Stirn und mein Hemd war durchnässt. Meine Assistentin eilte auf mich zu, als sie meine Verfassung bemerkte, und ergriff meinen Arm. Während sie mich zu der teuren Ledercouch führte, die sich neben einem der vielen raumhohen Bücherregale in meinem luxuriösen Büro befand, fragte sie mich, ob sie meinen Arzt oder vielleicht sogar einen Krankenwagen rufen sollte. Ohne ihr zu antworten, legte ich mich auf die Couch und schloss die Augen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das Visualisieren einer beruhigenden Szene ein gutes Mittel sei, sich nach einem stressigen Erlebnis zu beruhigen. Und so tat ich mein Bestes.
Gerade als ich anfing, mich zu entspannen, schreckte ich durch ein lautes Geräusch zusammen. Es hörte sich an, als habe jemand einen Stein gegen eines der Fenster meines Büros geworfen. Ich sprang hoch und rannte zum großen Hauptfenster, um nach dem Übeltäter Ausschau zu halten. Doch ich konnte niemanden sehen. Vielleicht trieb der Stress, unter dem ich litt, Spielchen mit meiner Vorstellungskraft. Als ich langsam wieder zur Couch zurückkehrte, geschah es erneut, aber dieses Mal noch viel lauter. »Wer könnte das sein?«, fragte ich mich und überlegte, ob ich meine Assistentin beauftragen sollte, sofort den Sicherheitsdienst zu rufen. Vermutlich handelt es sich um einen weiteren verärgerten Computerprogrammierer, der sein Glück mit dem Chef herausfordert, dachte ich und ärgerte mich noch mehr über die Störung. Ich eilte erneut zum Fenster und entdeckte dieses Mal eine Gestalt in der Mitte des weitläufigen Rosengartens, auf den ich von meinem Büro im zweiten Stock hinunterblickte. Als ich die Augen zusammenkniff und genauer hinsah, war ich über den Anblick, der sich mir bot, völlig verblüfft.
Ich sah einen gut aussehenden jungen Mann, der Sandalen und ein rotes Gewand mit Kapuze trug, wie ich es bei einer Reise nach Tibet vor über einem Jahrzehnt bei den tibetischen Mönchen gesehen hatte. Als die Sonnenstrahlen das hübsche, faltenlose Gesicht des Fremden in Licht tauchten, flatterte sein Gewand in der leichten Brise und verlieh ihm ein geheimnisvolles, fast himmlisches Aussehen. Ein breites Lächeln überzog sein Gesicht.
Als mir klar wurde, dass es sich hier nicht um die Halluzination eines überarbeiteten CEOs handelte, dessen Unternehmen langsam ins Abseits geriet, hämmerte ich wütend gegen das Fenster. Der junge Mann blieb reglos. Er verharrte in seiner Position – und lächelte. Dann winkte er mir plötzlich eifrig zu. Diese Art von Respektlosigkeit fand ich unerträglich. Dieser Clown war unbefugt auf mein Grundstück eingedrungen, verschandelte meinen Rosengarten und versuchte eindeutig, mich zum Narren zu halten. Umgehend wies ich meine Assistentin Arielle an, den Sicherheitsdienst zu rufen. »Sie sollen unseren seltsamen Besucher sofort in mein Büro hochbringen, bevor er das Weite sucht«, befahl ich. »Ihm muss eine Lektion erteilt werden, die er sein Leben lang nicht vergessen wird.«
Innerhalb weniger Minuten standen vier Sicherheitsbeamte vor meiner Tür. Einer der Männer hielt den jungen Fremden, der mit ihnen zu kooperieren schien, behutsam am Arm fest. Zu meiner Überraschung lächelte der junge Mann nach wie vor und strahlte Stärke und Gelassenheit aus, als er im Türrahmen stand. Es schien ihn nicht im Geringsten zu beunruhigen, dass er von den Sicherheitskräften aufgegriffen und in mein Büro gebracht worden war. Und obwohl er schwieg, hatte ich das eigenartige Gefühl, dass ich es hier mit einem sehr weisen Mann zu tun hatte. Genauso war es mir immer mit meinem Vater ergangen. Ich kann es nicht anders erklären. Vielleicht war es Intuition, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass der junge Mann trotz seines jugendlichen Aussehens sehr weise war. Ich glaube, es waren seine Augen, die mir das verrieten.
Im Lauf meiner Geschäftstätigkeit habe ich festgestellt, dass die Augen eines Menschen die Wahrheit enthüllen können. Wenn man sich die Zeit nimmt, sie zu studieren, können sie Wärme, Unsicherheit, Unaufrichtigkeit oder Integrität verraten. Die Augen des jungen Mannes verrieten mir, dass er weise war. Sie ließen auch erkennen, dass er das Leben liebte und vielleicht sogar eine leicht verschmitzte Ader besaß. Das Sonnenlicht, das in mein Büro strömte, schien die Augen des Fremden zum Funkeln zu bringen. Aus der Nähe betrachtet, bestand das rubinrote Gewand des jungen Mannes aus einem hochwertigen Stoff und war hervorragend gefertigt. Obwohl er sich in meinem Büro befand, hatte er die Kapuze nicht zurückgeschlagen, was seine auffallende Erscheinung noch geheimnisvoller erscheinen ließ.
»Wer sind Sie und warum haben Sie Steine gegen mein Fenster geworfen?«, fragte ich. Ich spürte, dass mein Gesicht sich erhitzte und meine Handflächen noch feuchter wurden.
Der junge Mann schwieg immer noch, und nach wie vor umspielte ein Lächeln seine vollen Lippen. Dann bewegte er die Hände, führte die Fingerspitzen in einer Gebetshaltung zusammen und entbot mir den in Indien üblichen Gruß.
Dieser Kerl ist einfach unglaublich, dachte ich. Zuerst dringt er in meinen Rosengarten ein, auf den ich so gern von meinem Büro aus blicke, wenn alles um mich herum verrücktspielt. Dann wirft er Steine gegen mein Fenster und jagt mir einen Mordsschrecken ein. Und jetzt, umgeben von vier kräftigen Sicherheitsbeamten, die nicht zu scherzen pflegen und ihn im Nu in die Knie zwingen könnten, treibt er seine Spielchen mit mir.
»Hör zu, Junge, ich weiß nicht, wer du bist oder woher du kommst, und um ehrlich zu sein, ist es mir auch egal«, rief ich aus. »Du kannst weiterhin dieses alberne Gewand tragen und mich dumm anlächeln. Sei so großspurig, wie du willst, denn ich habe vor, die Polizei zu rufen. Aber wieso brichst du vorher nicht einfach das Schweigegelübde, für das ihr Mönche so berühmt seid, und erklärst mir, warum du hier bist?«
»Ich bin hier, um dir dabei zu helfen, deine Führungsrolle neu zu erfinden, Peter«, erwiderte der junge Mann in einem unerwartet gebieterischen Ton. »Ich bin hier, um dir zu helfen, dein Unternehmen wieder in Schwung zu bringen und ihm dann zu Weltklasseniveau zu verhelfen.«
Woher kannte er meinen Namen? Vielleicht war der Kerl gefährlich. Ich bin froh, dass die Sicherheitsleute in der Nähe sind, dachte ich insgeheim. Was sollte dieser Unsinn, mir zu helfen, meine Führungsrolle neu zu erfinden und mein Unternehmen wieder in Schwung zu bringen? Wenn dieser Clown eine Art Berater war, der versuchte, meine Aufmerksamkeit für einen lukrativen Vertrag zu gewinnen, dann ging er es völlig falsch an. Warum schickte er mir nicht einfach ein Angebot, so wie die anderen überbezahlten, unterbeschäftigten »Erneuerer«, die ein erstaunliches Talent dafür haben, nutzlose Projekte zu schaffen, die garantieren, dass sie rechtzeitig in Frührente gehen können?
»Peter, du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder?«, fragte er freundlich.
»Nein, ich bedauere, ich habe keine Ahnung. Und wenn du es mir nicht auf der Stelle verrätst, werde ich dir einen Tritt in deinen Allerwertesten verpassen und dich so durch den Flur auf den Parkplatz befördern«, brüllte ich drohend.
»Wie ich sehe, hast du immer noch dein aufbrausendes Temperament, Peter. Wir werden daran arbeiten müssen, denn dadurch gewinnst du wahrlich nicht die Loyalität deines Teams. Und ich weiß, dass es dir auch beim Golfen schadet, worin du noch nie besonders gut warst«, sagte der junge Mann und brach in Lachen aus.
»Hast du überhaupt eine Ahnung, mit wem du sprichst, du arroganter kleiner Störenfried?«, brüllte ich, ohne mich davon beeindrucken zu lassen, dass der Fremde fast zwei Meter groß und in hervorragender körperlicher Verfassung war. »Wie kannst du es wagen, mich wegen meines Temperaments zu kritisieren? Und woher weißt du so viel über mein Golfspiel? Wenn du mir nachgestellt hast, werde ich definitiv die Polizei einschalten und dich anzeigen, denn das ist ein sehr schweres Vergehen«, bemerkte ich und steigerte mich in eine Raserei hinein, die mich wieder stark ins Schwitzen brachte.
Dann tat der junge Mann etwas, das mich erstaunte. Er hob die Hand, griff tief in sein Gewand und förderte etwas zutage, das wie ein vergoldeter Golfball aussah. Diesen warf er hoch in die Luft, damit ich ihn auffing. »Ich dachte, du würdest ihn vielleicht zurückhaben wollen«, sagte er, immer noch lächelnd.
Voller Erstaunen blickte ich auf den Golfball, der nun in meiner Handfläche lag, denn er trug folgende Inschrift: Für Julian, den Mann, der alles hat, ein goldener Golfball zum fünfzigsten Geburtstag. Die Unterschrift lautete: Für immer dein Freund, Peter. Wie war der junge Mann an diesen Ball gekommen? Ich hatte ihn vor ein paar Jahren meinem ehemaligen Golfpartner Julian Mantle geschenkt. Dieser war eine Legende in der Geschäftswelt gewesen und einer der wenigen Freunde, die mir über die Jahre treu geblieben waren. Er war ein Mann mit einem brillanten Verstand und galt weithin als einer der besten Anwälte des Landes. Im Gegensatz zu mir stammte er aus einem reichen Elternhaus. Sein Großvater war ein berühmter Senator und sein Vater ein hoch angesehener Richter am Bundesgerichtshof gewesen. Schon von früh an auf Erfolg getrimmt, schloss Julian die Harvard Law School als Jahrgangsbester ab und ergatterte eine heiß begehrte Stelle in einer unglaublich erfolgreichen Anwaltskanzlei.
Innerhalb weniger Jahre erlangte er im ganzen Land Berühmtheit und zu seinen namhaften Mandanten zählten milliardenschwere Unternehmen, große Sportmannschaften und sogar Regierungschefs. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand er einem Team von 85 talentierten Anwälten vor und gewann eine Reihe von Prozessen, die mich bis heute staunen lassen. Mit einem siebenstelligen Einkommen konnte er sich alle Wünsche erfüllen: eine Villa in einer vornehmen Wohngegend, in der sich vorzugsweise Prominente niedergelassen hatten, einen Privatjet, ein Ferienhaus auf einer tropischen Insel und seinen wertvollsten Besitz – einen glänzenden roten Ferrari, der in der Mitte seiner Einfahrt geparkt war. Doch genau wie ich hatte auch Julian seine Schwächen.
Er war ein Workaholic, arbeitete regelmäßig die Nacht durch und gönnte sich dann ein paar Stunden Schlaf auf der Couch seines luxuriösen Eckbüros, bevor die Plackerei wieder von vorne losging. Obwohl ich sehr gern Golf mit ihm spielte, hatte er selten Zeit. Stets servierte mir seine Assistentin dieselbe Ausrede: »Mr. Franklin, es tut mir leid, aber Mr. Mantle kann diese Woche wegen eines dringenden Falls nicht Golf mit Ihnen spielen. Er bittet um Entschuldigung.« Der Mann verlangte sich ständig alles ab und verlor mit der Zeit die meisten seiner Freunde sowie seine einst so verständnisvolle Frau.
Ich vermutete ernsthaft, dass Julian so etwas wie Todessehnsucht oder dergleichen hatte. Er arbeitete nicht nur weit über seine physischen und psychischen Grenzen, sondern lebte auch dementsprechend. Er war bekannt für seine spätabendlichen Besuche der besten Restaurants der Stadt in Begleitung attraktiver junger Models und für seine leichtsinnigen Alkoholexzesse mit seinen Kumpanen, die oft in Schlägereien ausarteten, über die am nächsten Tag in den Zeitungen groß berichtet wurde. Trotz gegenteiliger Behauptungen war Julian Mantle dabei, sich ein frühes Grab zu schaufeln. Ich wusste es, die Anwälte seiner Firma wussten es, und ich vermute, tief in seinem Inneren wusste es auch Julian.
Ich beobachtete Julians stetigen Abstieg mit Bedauern. Mit 53 Jahren sah er aus wie Ende 70. Der Dauerstress und die Belastung, die sein aufreibender Lebensstil mit sich brachten, hatten ihm körperlich enorm zugesetzt und sein Gesicht mit Falten überzogen. Die spätabendlichen Dinner in teuren französischen Restaurants, das Rauchen dicker kubanischer Zigarren und das Hinunterkippen diverser Cognacs führten zu erschreckendem Übergewicht. Er beklagte sich ständig, dass er es satt hatte, dauernd krank und müde zu sein. Mit der Zeit verlor er auch seinen unverkennbaren Sinn für Humor und lachte nur noch selten. Er hörte sogar irgendwann auf, Golf zu spielen, obwohl ich wusste, dass er diesen Sport sowie unsere gemeinsamen Unternehmungen liebte. Vor lauter Arbeit hörte Julian auch auf, mich anzurufen. Ich wusste, dass er meine Freundschaft genauso benötigte wie ich seine, aber ich glaube, es kümmerte ihn einfach nicht.
Dann brach eine Tragödie über den großen Julian Mantle herein. An einem Montagmorgen brach er mitten in dem brechend vollen Gerichtssaal zusammen, in dem er Air Atlantic, seinen besten Firmenkunden, vertrat. Inmitten der hysterischen Schreie seiner Anwaltsgehilfin und klickender Kameras der anwesenden Medienreporter wurde er eilends ins Krankenhaus gebracht. Die Untersuchung ergab einen schweren Herzinfarkt und Julian wurde auf die kardiologische Intensivstation verlegt. Der Kardiologe meinte, er habe noch nie einen Patienten erlebt, der dem Tod so nahe gewesen sei wie Julian. Aber irgendwie überlebte er. Die Ärzte sagten, Julian sei ein Kämpfer und scheine »einen heroischen Lebenswillen« zu haben.
Dieser traurige Vorfall veränderte Julian tiefgreifend. Bereits am nächsten Tag gab er bekannt, dass er seine Anwaltstätigkeit für immer aufgeben werde. Mir war zu Ohren gekommen, Julian sei zu einer Art Expedition nach Indien aufgebrochen. Er erklärte einem seiner Partner, er »benötige ein paar Antworten«, und hoffe, sie in diesem alten Land zu finden, das im Lauf der Jahrhunderte große Weisheit gesammelt habe. In einem dramatischen Schlussakt hatte Julian seine Villa, seinen Privatjet und seine Privatinsel verkauft. Doch am meisten verblüffte mich seine letzte Tat vor seiner Abreise: Julian verkaufte seinen heißgeliebten Ferrari.
Ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den jungen Fremden in der Mönchskutte, der jetzt mitten in meinem Büro stand. Er lächelte immer noch und die Kapuze war nach wie vor über sein dichtes braunes Haar gezogen. »Wie bist du an diesen Golfball gekommen?«, fragte ich in ruhigem Ton. »Vor ein paar Jahren habe ich ihn einem lieben Freund zu einem ganz besonderen Geburtstag geschenkt.«
»Das weiß ich«, erwiderte der Besucher. »Und er hat dein Geschenk wirklich zu würdigen gewusst.«
»Darf ich erfahren, woher du das weißt?«, beharrte ich.
»Weil ich der gute Freund bin. Ich bin Julian Mantle.«
Kapitel 3
Die wundersame Verwandlung eines Unternehmenskriegers
Was ich gerade gehört hatte, versetzte mich in Erstaunen. Konnte sich hinter diesem jungen Mann, der sich bester Gesundheit erfreute, tatsächlich Julian Mantle verbergen, ein Mann, der vom Gipfel des Erfolgs so tief gefallen war wie niemand sonst, den ich kannte? Und wenn er es tatsächlich war, wie konnte sich dann sein Aussehen auf derart erstaunliche Weise verändert haben? Ich wusste, dass Julian seine Villa und sein Ferienhaus verkauft und sogar sein Glanzstück, seinen roten Ferrari, aufgegeben hatte. Ich wusste, dass er das Drum und Dran der Geschäftswelt hinter sich gelassen hatte und zum Wandern in den Himalaja aufgebrochen war, um Antworten auf die drängenden Fragen zu finden, die ihn bewegten. Doch eine einzige Reise zu diesem alten und mystischen Ort konnte einen Mann, der sich so aufgerieben hatte, wohl kaum so tiefgreifend verändern.
Verstört durch das bizarre Szenario, das sich soeben vor mir abgespielt hatte, erwog ich einige andere Möglichkeiten. Vielleicht handelte es sich hier um einen Streich, den einer meiner eher kindischen Manager ausgeheckt hatte, um etwas Leichtigkeit in die spannungsgeladene Woche zu bringen. Vielleicht war der junge Mann aber auch ein Spitzel eines Konkurrenten, der versuchte, sich in unser Unternehmen einzuschmuggeln, um festzustellen, wie prekär unsere Lage wirklich war. Vielleicht war dieser Besucher in Mönchskutte ein geistesgestörter Eindringling, der mir ernsthaften Schaden zufügen wollte. Doch bevor ich diese Optionen genauer unter die Lupe nehmen konnte, ergriff der junge Mann das Wort.
»Peter, ich weiß, es fällt dir schwer zu glauben, dass ich es wirklich bin. Wäre ich an deiner Stelle, würde es mir genauso gehen. Ich verlange von dir nur etwas Vertrauen, etwas Glauben an die kleinen Wunder des Lebens. Es gibt einen Anlass für meinen Besuch.«
»Und der wäre?«, fragte ich, immer noch unsicher, wer da vor mir stand.
»Ich will es dir gerne verraten. Ich habe gehört, dass du in großen Schwierigkeiten steckst, und ich bin hier, um dir zu helfen. Wenn das, was ich nach meiner Rückkehr vom Himalaja über GlobalView gehört habe, stimmt, kannst du es dir nicht leisten, dir das, was ich zu sagen habe, nicht anzuhören. Ich bin auf wertvolle Informationen gestoßen, die dir und deinem Unternehmen wieder zum einstigen Erfolg verhelfen werden. Ich verfüge über Wissen, das dich wieder zum Marktführer werden lässt. Ich habe Lektionen gelernt, die dir zeigen werden, wie du die loyalsten, engagiertesten und mitfühlendsten Mitarbeiter in deiner Firma haben wirst. Diese Informationen erhielt ich von einem sehr weisen Lehrer, den ich hoch oben in den Bergen traf. Die zeitlose Weisheit, die er mir vermittelte, ist hier im Westen nicht sehr bekannt. Doch sie ist so wirksam und so tiefgreifend, dass ich davon überzeugt bin, dass sie dein gesamtes Unternehmen revolutionieren und deine Bilanz wundersam verändern wird.«
»Sprich weiter«, erwiderte ich. Meine Neugier war geweckt.