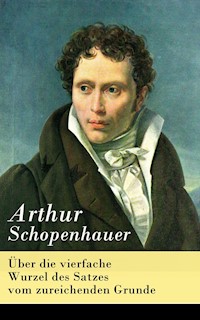
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieses eBook: "Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde ist Dissertation Schopenhauers aus dem Jahr 1813. Der Satz vom zureichenden Grund (lat. principium rationis sufficientis) ist in der Geschichte der Logik und der Philosophie der allgemeine Grundsatz, unterschiedlich formuliert und auch in unterschiedlicher Funktion verwendet: Jedes Sein oder Erkennen könne und/oder solle in angemessener Weise auf ein anderes zurückgeführt werden. Der "Satz vom Grunde" steht stellvertretend als gemeinsamer Oberbegriff, als gemeinschaftliche Wurzel aller Arten von Relation, wie sie in der vorgestellten Welt erscheinen. Diese Relationsbeziehungen ordnet Schopenhauer vier verschiedenen Klassen zu, in denen jeweils bestimmte Objekte auf unterschiedliche Weise aufeinander wirken, also eine unterschiedene Ausformung des Satzes vom Grunde herrscht. Arthur Schopenhauer (1788-1860) war ein deutscher Philosoph, Autor und Hochschullehrer. Schopenhauer entwarf eine Lehre, die gleichermaßen Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik und Ethik umfasst. Innerhalb der Philosophie des 19. Jahrhunderts entwickelte er eine eigene Position des Subjektiven Idealismus und vertrat als einer der ersten Philosophen im deutschsprachigen Raum die Überzeugung, dass der Welt ein irrationales Prinzip zugrunde liegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Diese elementarphilosophische Abhandlung, welche zuerst im Jahr 1813 erschien, als ich mir die Doktorwürde damit erworben hatte, ist nachmals der Unterbau meines ganzen Systems geworden. Dieserhalb darf sie im Buchhandel nicht fehlen; wie Dies, ohne dass ich es wußte, seit vier Jahren der Fall gewesen ist.
Nun aber eine solche Jugendarbeit nochmals mit allen ihren Flecken und Fehlern in die Welt zu schicken schien mir unverantwortlich. Denn ich bedenke, dass die Zeit, da ich nichts mehr werde emendiren können, nicht mehr sehr ferne sein kann, mit ihr aber erst die Periode meiner eigentlichen Wirksamkeit eintritt, von der ich mich getröste, dass sie eine lange sein wird, im festen Vertrauen auf die Verheißung des Seneka: etiamsi omnibus tecum viventibus silentium livor indixerit; venient qui sine offensa, sine gratia judicent (ep. 79). Ich habe daher, so weit es anging, der vorliegenden Jugendarbeit nachgeholfen und muß sogar, bei der Kürze und Ungewißheit des Lebens, es als ein besonderes Glück ansehn, dass mir vergönnt gewesen ist, im sechszigsten Jahre noch zu berichtigen was ich im sechs und zwanzigsten geschrieben hatte.
Dabei nun aber ist es mein Vorsatz gewesen, mit meinem jungen Menschen glimpflich zu verfahren und ihn, so viel als immer möglich, zum Worte kommen und auch ausreden zu lassen. Allein wo er Unrichtiges, oder Überflüssiges vorbrachte, oder auch das Beste zur Seite liegen ließ, habe ich ihm denn doch ins Wort fallen müssen; und Dies ist oft genug der Fall gewesen; so dass vielleicht Mancher den Eindruck davon erhalten wird, wie wenn ein Alter das Buch eines jungen Mannes vorliest, jedoch es öfter sinken läßt, um sich in eigenen Exkursen über das Thema zu ergehn.
Es ist leicht abzusehn, dass ein in dieser Art und nach so langer Zeit nachgebessertes Werk nimmermehr die Einheit und Abründung erlangen konnte, welche nur denen zukommt, die aus einem Gusse sind. Sogar schon im Stil und Vortrag wird eine so unverkennbare Verschiedenheit sich fühlbar machen, dass der taktbegabte Leser wohl nie im Zweifel sein wird, ob er den Alten oder den Jungen hört. Denn freilich ist ein weiter Abstand zwischen dem sanften, bescheidenen Ton des jungen Mannes, der seine Sache vertrauensvoll vorträgt, indem er noch einfältig genug ist, ganz ernstlich zu glauben, dass es Allen, die sich mit Philosophie beschäftigen, um nichts Anderes, als die Wahrheit, zu tun sein könne und dass folglich wer diese fördert ihnen willkommen sein werde; — und der festen, mitunter aber etwas rauhen Stimme des Alten, der denn doch endlich hat dahinterkommen müssen, in welche noble Gesellschaft von Gewerbsleuten und untertänigen Augendienern er da geraten ist, und worauf es bei ihnen eigentlich abgesehn sei. Ja, wenn jetzt mitunter ihm die Indignation aus allen Poren quillt; so wird der billige Leser ihm auch Das nicht verdenken; hat es doch nachgerade der Erfolg gelehrt, was dabei herauskommt, wenn man, das Streben nach Wahrheit im Munde, die Augen immer nur auf die Intentionen höchster Vorgesetzten gerichtet hält; und wenn dabei, von der andern Seite, das e quovis ligno fit Mercurius auch auf die großen Philosophen ausgedehnt und demnach ein plumper Scharlatan, wie Hegel, getrost zu einem solchen gestämpelt wird. Die Deutsche Philosophie steht nämlich da, mit Verachtung beladen, vom Auslande verspottet, von den redlichen Wissenschaften ausgestoßen, — gleich einer Metze, die, für schnöden Lohn, sich gestern Jenem, heute Diesem Preis gegeben hat; und die Köpfe der jetzigen Gelehrtengeneration sind desorganisiert durch Hegel'schen Unsinn: zum Denken unfähig, roh und betäubt werden sie die Beute des platten Materialismus, der aus dem Basiliskenei hervorgekrochen ist. Glück zu! Ich kehre zu meiner Sache zurück.
Über die Disparität des Tones also wird man sich zu trösten haben: denn ich konnte hier nicht, wie ich bei meinem Hauptwerke getan, die spätern Zusätze abgesondert beifügen; kommt es doch auch nicht darauf an, dass man wisse, was ich im sechs und zwanzigsten und was im sechzigsten Jahre geschrieben habe; vielmehr nur darauf, dass Die, welche in den Grundbegriffen alles Philosophierens sich orientieren, sich festsetzen und klar werden wollen, auch an diesen wenigen Bogen ein Büchelchen erhalten, woraus sie etwas Tüchtiges, Solides und Wahres lernen können: und Dies, hoffe ich, wird der Fall sein. Sogar ist, bei der Ausführung, die manche Teile jetzt erhalten haben, eine kompendiose Theorie des gesammten Erkenntnisvermögens daraus geworden, welche, indem sie immer nur dem Satz vom Grunde nachgeht, die Sache von einer neuen und eigentümlichen Seite vorführt, ihre Ergänzung dann aber durch das erste Buch der »Welt als Wille und Vorstellung«, nebst dazu gehörigen Kapiteln des zweiten Bandes, und durch die Kritik der Kantischen Philosophie erhält.
Frankfurt a. M. im September 1847.
Erstes Kapitel.
Einleitung
§ 1. Die Methode
Plato der göttliche und der erstaunliche Kant vereinigen ihre nachdrucksvollen Stimmen in der Anempfehlung einer Regel zur Methode alles Philosophierens, ja alles Wissens überhaupt*. Man soll, sagen sie, zweien Gesetzen, dem der Homogeneität und dem der Spezifikation, auf gleiche Weise, nicht aber dem einen, zum Nachteil des andern, Genüge leisten. Das Gesetz der Homogeneität heißt uns, durch Aufmerken auf die Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen der Dinge, Arten erfassen, diese eben so zu Gattungen, und diese zu Geschlechtern vereinigen, bis wir zuletzt zum obersten. Alles umfassenden Begriff gelangen. Da dieses Gesetz ein transzendentales, unserer Vernunft wesentliches ist, setzt es Übereinstimmung der Natur mit sich voraus, welche Voraussetzung ausgedrückt ist in der alten Regel: entia praeter necessitatem non esse multiplicanda. — Das Gesetz der Spezifikation drückt Kant dagegen so aus: entium varietates non temere esse minuendas. Es heischt nämlich, dass wir die unter einem vielumfassenden Geschlechtsbegriff vereinigten Gattungen und wiederum die unter diesen begriffenen, hohem und niederem Arten wohl unterscheiden, uns hütend, irgend einen Sprung zu machen und wohl gar die niedern Arten, oder vollends Individuen, unmittelbar unter den Geschlechtsbegriff zu subsumieren; indem jeder Begriff noch einer Einteilung in niedrigere fähig ist und sogar keiner auf die bloße Anschauung herabgeht. Kant lehrt, dass beide Gesetze transzendentale, Übereinstimmung der Dinge mit sich a priori postulierende Grundsätze der Vernunft seien, und Plato scheint das Selbe auf seine Weise auszudrücken, indem er sagt, diese Regeln, denen alle Wissenschaft ihre Entstehung verdanke, seien zugleich mit dem Feuer des Prometheus vom Göttersitze zu uns herabgeworfen.
*Platon. Philebos pp. 219-223. Politic. 62, 63. Phaedros 361-363. ed. Bip. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Anhang zur transzendentalen Dialektik.
§ 2. Ihre Anwendung in gegenwärtigem Fall
Das letztere dieser Gesetze finde ich, so mächtiger Empfehlung ungeachtet, zu wenig angewendet auf einen Hauptgrundsatz in aller Erkenntnis, den Satz vom zureichenden Grunde. Obgleich man nämlich längst und oft ihn allgemein aufgestellt hat, so hat man dennoch seine höchst verschiedenen Anwendungen, in deren jeder er eine andere Bedeutung erhält, und welche daher seinen Ursprung aus verschiedenen Erkenntniskräften verraten, gehörig zu sondern vernachlässigt. Daß aber gerade bei Betrachtung unserer Geisteskräfte die Anwendung des Prinzips der Homogeneität, mit Vernachlässigung des ihm entgegengesetzten, viele und langdauernde Irrtümer erzeugt und dagegen die Anwendung des Gesetzes der Spezifikation die größten und wichtigsten Fortschritte bewirkt hat, — dies lehrt die Vergleichung der Kantischen Philosophie mit allen früheren. Es sei mir deshalb vergönnt, eine Stelle herzusetzen, in der Kant die Anwendung des Gesetzes der Spezifikation auf die Quellen unserer Erkenntnisse empfiehlt, indem solche meinem gegenwärtigen Bestreben seine Würdigung gibt. »Es ist von der äußersten Erheblichkeit, Erkenntnisse, die ihrer Gattung und Ursprunge nach von andern unterschieden sind, zu isolieren und sorgfältig zu verhüten, dass sie nicht mit andern, mit welchen sie im Gebrauche gewöhnlich verbunden sind, in ein Gemische zusammenfließen. Was Chemiker beim Scheiden der Materien, was Mathematiker in ihrer reinen Größenlehre tun, das liegt noch weit mehr dem Philosophen ob, damit er den Anteil, den eine besondere Art der Erkenntnis am herumschweifenden Verstandesgebrauch hat, ihren eigenen Wert und Einfluß, sicher bestimmen könne.« (Kritik d. rein. Vern., der Methodenlehre 3. Hauptst.)
§ 3. Nutzen dieser Untersuchung
Sollte mir zu zeigen gelingen, dass der zum Gegenstand dieser Untersuchung gemachte Grundsatz nicht unmittelbar aus einer, sondern zunächst aus verschiedenen Grunderkenntnissen unsers Geistes fließt; so wird daraus folgen, dass die Notwendigkeit, welche er als ein a priori feststehender Satz bei sich führt, ebenfalls nicht eine und überall die selbe, sondern eine eben so vielfache, wie die Quellen des Satzes selbst ist. Dann aber wird Jeder, der auf den Satz einen Schluß gründet, die Verbindlichkeit haben, genau zu bestimmen, auf welche der verschiedenen, dem Satze vom Grunde liegenden Notwendigkeiten er sich stütze, und solche durch einen eigenen Namen (wie ich welche vorschlagen werde) zu bezeichnen. Ich hoffe, dass dadurch für die Deutlichkeit und Bestimmtheit im Philosophieren Einiges gewonnen sein wird, und halte die, durch genaue Bestimmung der Bedeutung jedes Ausdrucks zu bewirkende, größtmögliche Verständlichkeit für ein zur Philosophie unumgänglich nötiges Erfordernis, um uns vor Irrtum und absichtlicher Täuschung zu sichern und jede im Gebiet der Philosophie gewonnene Erkenntnis zu einem sicheren und nicht, durch später aufgedeckten Mißverstand oder Zweideutigkeit, uns wieder zu entreißenden Eigentum zu machen. Überhaupt wird der echte Philosoph überall Helle und Deutlichkeit suchen, und stets bestrebt sein, nicht einem trüben, reißenden Regenbach zu gleichen, sondern vielmehr einem Schweizer See, der, durch seine Ruhe, bei großer Tiefe große Klarheit hat, welche eben erst die Tiefe sichtbar macht. La clarté est la bonne foi des philosophes hat Vauvenargues gesagt. Der unächte hingegen wird zwar keineswegs nach Talleyrand's Maxime, durch die Worte seine Gedanken, vielmehr nur seinen Mangel daran zu verbergen suchen, und wird die aus eigener Unklarheit des Denkens erwachsende Unverständlichkeit seiner Philosopheme dem Leser ins Gewissen schieben. Hieraus erklärt sich, warum in einigen Schriften, z.B. den Schelling'schen, der didaktische Ton so häufig in den scheltenden übergeht, ja oft die Leser schon zum voraus, durch Antizipation ihrer Unfähigkeit, gescholten werden.
§ 4. Wichtigkeit des Satzes vom zureichenden Grunde
Sie ist überaus groß, da man ihn die Grundlage aller Wissenschaft nennen darf. Wissenschaft nämlich bedeutet ein System von Erkenntnissen, d.h. ein Ganzes von verknüpften Erkenntnissen, im Gegensatz des bloßen Aggregats derselben. Was aber Anderes, als der Satz vom zureichenden Grunde, verbindet die Glieder eines Systems? Das eben zeichnet jede Wissenschaft vor dem bloßen Aggregat aus, dass ihre Erkenntnisse eine aus der andern, als ihrem Grunde, folgen. Darum sagt schon Plato: kai gar hai doxai hai alêtheis ou pollou axiai eisin, heôs an tis autas dêsê aitias logismô. (etiam opiniones verae non multi pretii sunt, donec quis illas ratiocinatione a causis ducta liget.) Meno, p. 385. Bip. — Zudem enthalten fast alle Wissenschaften Kenntnisse von Ursachen, aus denen die Wirkungen sich bestimmen lassen, und eben so andere Erkenntnisse von Notwendigkeiten der Folgen aus Gründen, wie sie in unserer ferneren Betrachtung vorkommen werden; welches bereits Aristoteles ausdrückt in den Worten: pasa epistêmê dianoêtikê, ê kai metechousa ti dianoias, peri aitias kai archas esti. (omnis intellectualis scientia, sive aliquo modo intellectu participans, circa causas et principia est). Metaph. V, 1. — Da es nun die, von uns stets a priori gemachte Voraussetzung, dass Alles einen Grund habe, ist, die uns berechtigt, überall Warum zu fragen; so darf man das Warum die Mutter aller Wissenschaften nennen.
§ 5. Der Satz selbst
Weiterhin soll gezeigt werden, dass der Satz vom zureichenden Grunde ein gemeinschaftlicher Ausdruck mehrerer a priori gegebener Erkenntnisse ist. Vorläufig muß er indessen in irgend einer Formel aufgestellt werden. Ich wähle die Wolfische als die allgemeinste: Nihil est sine ratione cur potius sit, quam non sit. Nichts ist ohne Grund warum es sei.
Zweites Kapitel.
Übersicht des Hauptsächlichsten, so bisher über den Satz vom zureichenden Grunde gelehrt worden.
§ 6. Erste Aufstellung des Satzes und Unterscheidung zweier Bedeutungen desselben
Für einen solchen Ur-Grundsatz aller Erkenntnis mußte auch der, mehr oder weniger genau bestimmte, abstrakte Ausdruck sehr früh gefunden werden; daher es schwer und dabei nicht von großem Interesse sein möchte, nachzuweisen, wo zuerst ein solcher vorkommt. Plato und Aristoteles stellen ihn noch nicht förmlich als einen Hauptgrundsatz auf, sprechen ihn jedoch öfter als eine durch sich selbst gewisse Wahrheit aus. So sagt Plato, mit einer Naivetät, welche gegen die kritischen Untersuchungen der neuen Zeit wie der Stand der Unschuld gegen den der Erkenntnis des Guten und Bösen erscheint: anankaion, panta ta gignomena dia tina aitian gignesthai; pôs gar an chôris toutôn gignoito; (necesse est, quaecunque fiunt, per aliquam causam fieri: quomodo enim absque ea fierent?) Phileb. p. 240 Bip. und wieder im Timäos (p. 302) pan de to gignomenon hyp'aitiou tinos ex anankês gignesthai; panti gar adynaton chôris aitiou genesin schein. (quidquid gignitur, ex aliqua causa necessario gignitur: sine causa enim oriri quidquam, impossibile est.) — Plutarch, am Schlusse seines Buches de fato, führt unter den Hauptsätzen der Stoiker an: malista men kai prôton doxeie, to mêden anaitiôs gignesthai, alla kata proêgoumenas aitias. (maxime id primum esse videbitur, nihil fieri sine causa, sed omnia causis antegressis).
Aristoteles stellt in den Analyt. post. 1, 2 den Satz vom Grunde gewissermaßen auf, durch die Worte: epistasthai de oiometha hekaston haplôs, hotan tên t'aitian oiometha ginôskein, di hên to pragma estin, hoti ekeinou aitia estin, kai mê endechesthai touto allôs einai. (Scire autem putamus unamquamque rem simpliciter, quum putamus causam cognoscere, propter quam res est, ejusque rei causam esse, nec posse eam aliter se habere). Auch gibt er in der Metaphysik, Lib. IV. c. 1, schon eine Einteilung der verschiedenen Arten der Gründe, oder vielmehr der Prinzipien, archai, deren er acht Arten annimmt; welche Einteilung aber weder gründlich, noch scharf genug ist. Jedoch sagt er hier vollkommen richtig: pasôn men oun koinon tôn archôn, to prôton einai, hothen ê estin, ê ginetai, ê gignôsketai. (omnibus igitur principiis commune est, esse primum, unde aut est, aut fit, aut cognoscitur). Im folgenden Kapitel unterscheidet er verschiedene Arten der Ursachen; wiewohl mit einiger Seichtigkeit und Verworrenheit zugleich. Besser jedoch, als hier, stellt er vier Arten der Gründe auf in den Analyt. post. II, 11. aitiai de tessares mia men to ti ên einai; mia de to tinôn ontôn, anankê touto einai; hetera de, hê ti prôton ekinêse; tetartê de, to tinos heneka. (causae autem quatuor sunt: una quae explicat quid res sit; altera, quam, si quaedam sint, necesse est esse; tertia, quae quid primum movit; quarta id, cujus gratia). Dieses ist nun der Ursprung der von den Scholastikern durchgängig angenommenen Einteilung der causarum in causas materiales, formales, efficientes et finales; wie dies denn auch zu ersehn aus Suarii disputationibus metaphysicis, diesem wahren Kompendio der Scholastik, disp. 12, sect. 2 et 3. Aber sogar noch Hobbes (de corpore, P. II. C.10, § 7.) führt sie an und erklärt sie. — Jene Einteilung ist im Aristoteles nochmals, und zwar etwas ausführlicher und deutlicher, zu finden: nämlich Metaph. I, 3. Auch im Buche de somno et vigilia, c. 2, ist sie kurz angeführt. — Was jedoch die so höchst wichtige Unterscheidung zwischen Erkenntnisgrund und Ursache betrifft, so verräth zwar Aristoteles gewissermaßen einen Begriff von der Sache, sofern er in den Analyt. post. I, 13, ausführlich dartut, dass das Wissen und Beweisen, dass etwas sei, sich sehr unterscheide von dem Wissen und Beweisen, warum es sei: was er nun als Letzteres darstellt, ist die Erkenntnis der Ursache, was als Ersteres, der Erkenntnisgrund. Aber zu einem ganz deutlichen Bewußtsein des Unterschiedes bringt er es doch nicht; sonst er ihn auch in seinen übrigen Schriften festgehalten und beobachtet haben würde. Dies aber ist durchaus nicht der Fall: denn sogar wo er, wie in den oben beigebrachten Stellen, darauf ausgeht, die verschiedenen Arten der Gründe zu unterscheiden, kommt ihm der in dem hier in Betracht genommenen Kapitel angeregte, so wesentliche Unterschied nicht mehr in den Sinn; und überdies gebraucht er das Wort aition durchgängig für jeden Grund, welcher Art er auch sei, nennt sogar sehr häufig den Erkenntnisgrund, ja, die Prämissen eines Schlusses, aitias: so z.B. Metaph. IV, 18. Rhet. II, 21. de plantis I. p. 816. (ed. Berol.) besonders Analyt. post. I, 2, wo geradezu die Prämissen eines Schlusses aitiai tou symperasmatos heißen. Wenn man aber zwei verwandte Begriffe durch das selbe Wort bezeichnet; so ist dies ein Zeichen, dass man ihren Unterschied nicht kennt, oder doch nicht festhält: denn zufällige Homonymie weit verschiedener Dinge ist etwas ganz Anderes. Am auffallendesten kommt aber dieser Fehler zu Tage in seiner Darstellung des Sophisma's non causae ut causa, para to mê aition hôs aition im Buche de sophisticis elenchis, c.5. Unter aition versteht er hier durchaus nur den Beweisgrund, die Prämissen, also einen Erkenntnisgrund, indem das Sophisma darin besteht, dass man ganz richtig etwas als unmöglich dartut, dasselbe jedoch auf den damit bestrittenen Satz gar nicht einfließt, welchen man dennoch dadurch umgestoßen zu haben vorgibt. Von physischen Ursachen ist also dabei gar nicht die Rede. Allein der Gebrauch des Wortes aition hat bei den Logikern neuerer Zeit so viel Gewicht gehabt, dass sie, bloß daran sich haltend, in ihren Darstellungen der fallaciarum extra dictionem die fallacia non causae ut causa durchgängig erklären als die Angabe einer physischen Ursache, die es nicht ist: so z.B. Reimarus, G. E. Schulze, Fries und Alle, die mir vorgekommen: erst in Twesten's Logik finde ich dies Sophisma richtig dargestellt. Auch in sonstigen wissenschaftlichen Werken und Disputationen wird, in der Regel, durch die Anschuldigung einer fallacia non causae ut causa die Einschiebung einer falschen Ursache bezeichnet.
Von dieser, bei den Alten durchgängig vorhandenen Vermengung und Verwechselung des logischen Gesetzes vom Erkenntnisgrunde mit dem transzendentalen Naturgesetz der Ursache und Wirkung liefert uns noch Sextus Empirikus ein starkes Beispiel.
Nämlich im 9. Buche adversus Mathematicos, also dem Buche adv. physicos, § 204, unternimmt er, das Gesetz der Kausalität zu beweisen, und sagt: Einer, der behauptet, dass es keine Ursache (aitia) gebe, hat entweder keine Ursache (aitia), aus der er dies behauptet, oder er hat eine. Im ersten Falle ist seine Behauptung nicht wahrer, als ihr Gegenteil: im andern stellt er eben durch seine Behauptung fest, dass es Ursachen gibt.
Wir sehn also, dass die Alten es noch nicht zur deutlichen Unterscheidung zwischen der Forderung eines Erkenntnisgrundes zur Begründung eines Urteils und der einer Ursache zum Eintritt eines realen Vorganges gebracht haben. — Was nun späterhin die Scholastiker betrifft, so war das Gesetz der Kausalität ihnen eben ein über alle Untersuchung erhabenes Axiom: non inquirimus an causa sit, quia nihil est per se notius, sagt Suarez, Disp. 12, sect. 1. Dabei hielten sie die oben beigebrachte Aristotelische Einteilung der Ursachen fest: hingegen die hier in Rede stehende notwendige Unterscheidung haben, so viel mir bekannt, auch sie sich nicht zum Bewußtsein gebracht.
§ 7. Cartesius
Denn sogar unsern vortrefflichen Cartesius, den Anreger der subjektiven Betrachtung und dadurch den Vater der neueren Philosophie, finden wir, in dieser Hinsicht, noch in kaum erklärlichen Verwechselungen begriffen, und werden sogleich sehn, zu welchen ernstlichen und beklagenswerten Folgen diese in der Metaphysik geführt haben. Er sagt in der responsio ad secundas objectiones in meditationes de prima philosophia, axioma I: Nulla res existit, de qua non possit quaeri, quaenam sit causa, cur existat. Hoc enim de ipso Deo quaeri potest, non quod indigeat ulla causa ut existat, sed quia ipsa ejus naturae immensitas est causa sive ratio, propter quam nulla causa indiget ad existendum. Er hätte sagen müssen: die Unermeßlichkeit Gottes ist ein Erkenntnisgrund, aus welchem folgt, dass Gott keiner Ursache bedarf. Er vermengt jedoch Beides, und man sieht, dass er sich des großen Unterschiedes zwischen Ursache und Erkenntnisgrund nicht deutlich bewußt ist. Eigentlich aber ist es die Absicht, welche bei ihm die Einsicht verfälscht. Er schiebt nämlich hier, wo das Kausalitätsgesetz eine Ursache fordert, statt dieser einen Erkenntnisgrund ein, weil ein solcher nicht gleich wieder weiter führt, wie jene; und bahnt sich so, durch eben dieses Axiom, den Weg zum ontologischen Beweise des Daseins Gottes, dessen Erfinder er ward, nachdem Anselmus nur die Anleitung dazu im Allgemeinen geliefert hatte. Denn gleich nach den Axiomen, von denen das angeführte das erste ist, wird nun dieser ontologische Beweis förmlich und ganz ernsthaft aufgestellt: ist er ja doch in jenem Axiom eigentlich schon ausgesprochen, oder liegt wenigstens so fertig darin, wie das Hühnchen im lange bebrüteten Eie. Also, während alle andern Dinge zu ihrem Dasein einer Ursache bedürfen, genügt dem auf der Leiter des kosmologischen Beweises herangebrachten Gotte, statt derselben, die in seinem eigenen Begriffe liegende immensitas: oder, wie der Beweis selbst sich ausdrückt: in conceptu entis summe perfecti existentia necessaria continetur. Dies also ist der tour de passe-passe, zu welchem man die schon dem Aristoteles geläufige Verwechselung der beiden Hauptbedeutungen des Satzes vom Grunde, sogleich in majorem Dei gloriam, gebrauchte.
Beim Lichte und unbefangen betrachtet ist nun dieser berühmte ontologische Beweis wirklich eine allerliebste Schnurre. Da denkt nämlich Einer, bei irgend einer Gelegenheit, sich einen Begriff aus, den er aus allerlei Prädikaten zusammengesetzt, dabei jedoch Sorge trägt, dass unter diesen, entweder blank und baar, oder aber, welches anständiger ist, in ein anderes Prädikat, z.B. perfectio, immensitas, oder so etwas, eingewickelt, auch das Prädikat der Realität oder Existenz sei. Bekanntlich kann man aus einem gegebenen Begriffe alle seine wesentlichen, d.h. in ihm mit gedachten, Prädikate, und eben so auch die wesentlichen Prädikate dieser Prädikate, mittelst lauter analytischer Urteile, herausziehn, welche demnach logische Wahrheit, d.h. an dem gegebenen Begriff ihren Erkenntnisgrund haben. Demgemäß holt nun Jener aus seinem beliebig erdachten Begriff auch das Prädikat der Realität, oder Existenz, heraus: und darum nun soll ein dem Begriff entsprechender Gegenstand, unabhängig von demselben, in der Wirklichkeit existieren!
»Wär'der Gedank'nicht so verwünscht gescheut, Man wär'versucht ihn herzlich dumm zu nennen.«
Übrigens ist die einfache Antwort auf eine solche ontologische Demonstration: »Es kommt Alles darauf an, wo du deinen Begriff her hast: ist er aus der Erfahrung geschöpft; à la bonne heure, da existiert sein Gegenstand und bedarf keines weitem Beweises: ist er hingegen in deinem eigenen sinciput ausgeheckt; da helfen ihm alle seine Prädikate nichts: er ist eben ein Hirngespinst.« Daß aber die Theologie, um in dem ihr ganz fremden Gebiet der Philosophie, als wo sie gar zu gerne wäre, Fuß zu fassen, zu dergleichen Beweisen hat ihre Zuflucht nehmen müssen, erregt ein sehr ungünstiges Vorurteil gegen ihre Ansprüche. — Aber o! über die prophetische Weisheit des Aristoteles! Er hatte nie etwas vernommen vom ontologischen Beweise; aber, als sähe er vor sich in die Nacht der kommenden finstern Zeiten, erblickte darin jene scholastische Flause und wollte ihr den Weg verrennen, demonstriert er sorgfältig, im 7. Kapitel des 2. Buchs Analyticorum posteriorum, dass die Definition einer Sache und der Beweis ihrer Existenz zwei verschiedene und ewig geschiedene Dinge sind, indem wir durch das eine erfahren, was gemeint sei, durch das andere aber, dass so etwas existiere: und wie ein Orakel der Zukunft spricht er die Sentenz aus: to d'einai ouk ousia oudeni; ou gar genos to on: esse autem nullius rei essentia est, quandoquidem ens non est genus. Das besagt: »Die Existenz kann nie zur Essenz, das Dasein nie zum Wesen des Dinges gehören.« — Wie sehr hingegen Herr v. Schelling den ontologischen Beweis veneriert, ist zu ersehn aus einer langen Note S. 152 des ersten Bandes seiner philosophischen Schriften von 1809. Aber etwas noch Lehrreicheres ist daraus zu ersehn, nämlich, wie dreistes, vornehmthuendes Schwadroniren hinreicht, den Deutschen Sand in die Augen zu streuen. Daß aber gar ein so durchweg erbärmlicher Patron, wie Hegel, dessen ganze Philosophasterei eigentlich eine monströse Amplifikation des ontologischen Beweises war, diesen gegen Kants Kritik hat verteidigen wollen, ist eine Allianz, deren der ontologische Beweis selbst sich schämen würde, so wenig sonst das Schämen seine Sache ist. — Man erwarte nur nicht, dass ich mit Achtung von Leuten spreche, welche die Philosophie in Verachtung gebracht haben.
§ 8. Spinoza
Obgleich Spinoza's Philosophie hauptsächlich im Negiren des von seinem Lehrer Cartesius aufgestellten zwiefachen Dualismus, nämlich zwischen Gott und Welt, und zwischen Seele und Leib, besteht; so blieb er ihm doch völlig getreu in der oben nachgewiesenen Verwechselung und Vermischung des Verhältnisses zwischen Erkenntnisgrund und Folge mit dem zwischen Ursache und Wirkung; ja, er suchte aus derselben, für seine Metaphysik, wo möglich noch größere Vorteile zu ziehn, als sein Lehrer für die seinige daraus gezogen hatte: denn die besagte Verwechselung ist die Grundlage seines ganzen Pantheismus geworden.
In einem Begriffe nämlich sind alle seine wesentlichen Prädikate enthalten, implizite; daher sie, durch bloß analytische Urteile, sich explizite aus ihm entwickeln lassen: die Summe dieser ist seine Definition. Diese ist daher von ihm selbst, nicht dem Inhalt, sondern nur der Form nach, verschieden; indem sie aus Urteilen besteht, die alle in ihm mitgedacht sind, und daher in ihm ihren Erkenntnisgrund haben, sofern sie sein Wesen darlegen. Diese können demnach angesehn werden als die Folgen jenes Begriffs, als ihres Grundes. Dieses Verhältnis eines Begriffs zu den in ihm gegründeten und aus ihm entwickelbaren analytischen Urteilen ist nun ganz und gar das Verhältnis, welches Spinoza's sogenannter Gott zur Welt, oder richtiger, welches die einzige und alleinige Substanz zu ihren zahllosen Akzidenzien hat. (Deus, sive substantia constans infinitis attributis.. Eth. I. pr. 11. — Deus, sive omnia Dei attributa.) Es ist also das Verhältnis des Erkenntnisgrundes zu seiner Folge; statt dass der wirkliche Theismus (der des Spinoza ist bloß ein nomineller) das Verhältnis der Ursache zur Wirkung annimmt, in welchem der Grund von der Folge, nicht, wie in jenem, bloß der Betrachtungsart nach, sondern wesentlich und wirklich, also an sich selbst und immer, verschieden und getrennt bleibt. Denn eine solche Ursache der Welt, mit Hinzufügung der Persönlichkeit, ist es, die das Wort Gott, ehrlicherweise gebraucht, bezeichnet. Hingegen ist ein unpersönlicher Gott eine contradictio in adjecto. Indem nun aber Spinoza auch in dem von ihm aufgestellten Verhältnisse das Wort Gott für die Substanz beibehalten wollte und solche sogar ausdrücklich die Ursache der Welt benannte, konnte er dies nur dadurch zu Stande bringen, dass er jene beiden Verhältnisse, folglich auch den Satz vom Erkenntnisgrund mit dem der Kausalität, ganz und gar vermischte. Dies zu belegen bringe ich, von unzähligen, nur folgende Stelle in Erinnerung. Notandum, dari necessario uniuscujusque rei existentis certam aliquam causam, propter quam existit. Et notandum, hanc causam, propter quam aliqua res existit, vel debere contineri in ipsa natura et definitione rei existentis (nimirum quod ad ipsius naturam pertinet existere), vel debere extra ipsam dari. (Eth. P. I, prop. 8, schol. 2). Im letztern Fall meint er eine wirkende Ursache, wie sich dies aus dem Folgenden ergibt; im erstern hingegen einen bloßen Erkenntnisgrund: er identifiziert jedoch Beides und arbeitet dadurch seiner Absicht, Gott mit der Welt zu identifizieren, vor. Einen im Innern eines gegebenen Begriffes liegenden Erkenntnisgrund mit einer von außen wirkenden Ursache zu verwechseln und dieser gleichzustellen, ist überall sein Kunstgriff; und vom Cartesius hat er ihn gelernt. Als Belege dieser Verwechselung führe ich noch folgende Stellen an. Ex necessitate divinae naturae omnia, quae sub intellectum infinitum cadere possunt, sequi debent. (Eth. P. I, prop. 16.) Zugleich aber nennt er Gott überall die Ursache der Welt.
Quidquid existit Dei potentiam, quae omnium rerum causa est, exprimit. ibid. prop. 36. demonstr. — Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens. ibid. prop. 18. — Deus non tantum est causa efficiens rerum existentiae, sed etiam essentiae. ibid. prop. 25. — Eth. P. III, prop. 1. demonstr. heißt es: ex data quacunque idea aliquis effectus necessario sequi debet. Und ibid. prop. 4. Nulla res nisi a causa externa potest destrui. — Demonstr. Definitio cujuscunque rei, ipsius essentiam (Wesen, Beschaffenheit zum Unterschied von existentia, Dasein) affirmat, sed non negat; sive rei essentiam ponit, sed non tollit. Dum itaque ad rem ipsam tantum, non autem ad causas externas attendimus, nihil in eadem poterimus invenire, quod ipsam possit destruere. Dies heißt: weil ein Begriff nichts enthalten kann, was seiner Definition, d.i. der Summe seiner Prädikate, widerspricht; kann auch ein Ding nichts enthalten, was Ursache seiner Zerstörung werden könnte. Diese Ansicht wird aber auf ihren Gipfel geführt in der etwas langen, zweiten Demonstration der elften Proposition, woselbst die Ursache, welche ein Wesen zerstören oder aufheben könnte, vermischt wird mit einem Widerspruch, den die Definition desselben enthielte, und der sie deshalb aufhöbe. Die Notwendigkeit, Ursache und Erkenntnisgrund zu konfundiren, wird hiebei so dringend, dass Spinoza nie causa, oder auch ratio, allein sagen darf, sondern jedesmal ratio seu causa zu setzen genötigt ist, welches daher hier, auf Einer Seite, acht Mal geschieht, um den Unterschleif zu decken. Das Selbe hatte schon Cartesius in dem oben angeführten Axiom getan.
So ist denn Spinoza's Pantheismus eigentlich nur die Realisation des ontologischen Beweises des Cartesius. Zunächst adoptiert er den oben angeführten ontotheologischen Satz des Cartesius: ipsa naturae Dei immensitas est causa sive ratio, propter quam nulla causa indiget ad existendum: statt Deus sagt er (im Anfang) stets substantia, und nun schließt er: substantiae essentia necessario involvit existentiam, ergo erit substantia causa sui. (Eth. P. I, prop. 7.)
Also durch das selbe Argument, womit Cartesius das Dasein Gottes bewiesen hatte, beweist er das absolut notwendige Dasein der Welt, — die also keines Gottes bedarf. Dies leistet er noch deutlicher im 2. Scholio zur 8. Proposition: Quoniam ad naturam substantiae pertinet existere, debet ejus definitio necessariam existentiam involvere, et consequenter ex sola ejus definitione debet ipsius existentia concludi.
Diese Substanz aber ist bekanntlich die Welt. — Im selben Sinne sagt die Demonstration zur Prop. 24: Id, cujus natura in se considerata (d.i. Definition) involvit existentiam, est causa sui.
Was nämlich Cartesius nur ideal, nur subjektiv, d.h. nur für uns, nur zum Behuf der Erkenntnis, nämlich des Beweises des Daseins Gottes, aufgestellt hatte. Das nahm Spinoza real und objektiv, als das wirkliche Verhältnis Gottes zur Welt. Beim Cartesius liegt im Begriffe Gottes die Existenz und wird also zum Argument für sein wirkliches Dasein: beim Spinoza steckt Gott selbst in der Welt. Was demnach beim Cartesius bloßer Erkenntnisgrund war, macht Spinoza zum Realgrund: hatte jener im ontologischen Beweise gelehrt, dass aus der essentia Gottes seine
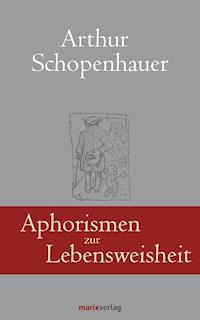








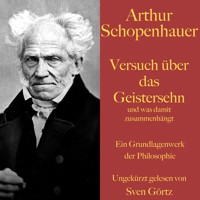
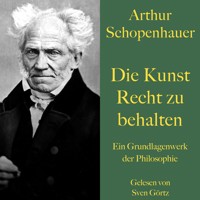





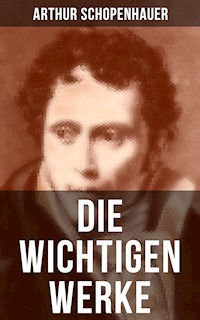
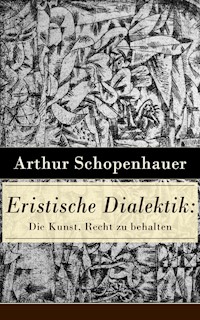

![Die Kunst, recht zu behalten. [Was bedeutet das alles?] - Arthur Schopenhauer - E-Book + Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/966abea72df1637e752b7e7faa0f274f/w200_u90.jpg)









