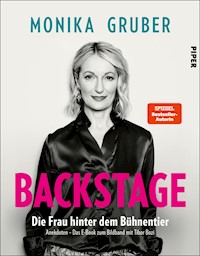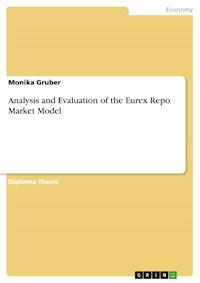11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Was sind das nur für Zeiten? Innerhalb weniger Jahre ist aus uns eine hysterisch-hyperventilierende Gesellschaft geworden, in der sich Wutbürger und Weltverbesserer, vermeintlich Ewiggestrige und Meinungsmissionare feindselig gegenüberstehen. Und die gegenwärtige Krise hat keineswegs zur Verbesserung des Miteinanders geführt, sie hat die Blödheit einiger eher noch verschlimmert. Die preisgekrönte Kabarettistin Monika Gruber und Bestsellerautor Andreas Hock gehen dem kollektiven Wahnsinn auf den Grund – und stellen fest, dass er seine Ursache vor allem in der Ignoranz und im Egoismus einiger Weniger hat. Mit Selbstironie und schwarzem Humor begeben sie sich auf die Suche nach dem gesunden Menschenverstand und gehen dorthin, wo es wirklich wehtut – eine unterhaltsame Reise durch die Gegenwart, die beweist: Lachen hilft!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de© Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Tibor BoziSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Corona veränderte alles – fast
Mit konsequenter Inkonsequenz
Von einer gebildeten Muslimin und der alten weißen Frau
Raucher, Autofahrer, Fleischesser, Kinder-nicht-in-die-Kita-Schicker
Weiberdämmerung
»Du Opfer« ersetzt nicht die förmliche Anrede
Bärwurz und Jutta Ditfurth
Unsere Scarlett schreibt keine Vier
Müllentsorgung mit Diplom
Love me, Gender
Aber bitte mit Charme
Von Burkinis, Schwimmbadkultur und Handtuchhelden
Berufswunsch Influencer
Schöne neue Welt
Das MORAL-O-METER
Von A wie Angst bis Z wie Zürich
»Gestern war’s noch so wie früher. Und jetzt – jetzt ist’s so wie nachher. Aber ich glaub, dass früher schöner war!«
aus »Irgendwie und Sowieso« von Franz Xaver Bogner
Corona veränderte alles – fast
Warum manche Verhaltensweisen selbst in der Krise so bescheuert blieben, wie sie waren
Monika Gruber / Andreas Hock
Es ist schon erstaunlich, wie kalt einen so ein maximal 160 Nanometer kleines Virus doch erwischen kann. Bis vor wenigen Monaten konnte man sich noch wunderbar über alltägliche Ärgernisse aufregen, die einem während der Corona-Krise plötzlich wie Verheißungen aus dem Paradies vorkamen. Musste man zuvor beispielsweise länger als fünf Minuten an der Wursttheke warten, hatte man gedanklich bereits den Beschwerdebrief an den Marktleiter verfasst, warum an einem sonnigen Samstagmittag nicht gefälligst mehr Personal für den Verkauf des Grillguts an die geneigte Kundschaft eingeteilt worden sei. Danach jedoch war man schon froh, wenn man wegen der Abstandsregeln nicht eine halbe Stunde vor dem Geschäft anstehen musste, bis man endlich eintreten durfte. Der nicht unserer Sprache mächtige Paketbote, der den Versandkarton unabhängig vom Inhalt einfach über das Gartentor warf, war trotz desselben Vorgehens nun ein fleißiger Dienstleister, dessen systemrelevante Tätigkeit nicht hoch genug wertgeschätzt werden konnte. Und jener den ganzen Tag am Wohnzimmerfenster rauchende Rentner, der jeden im Haus, der seinen Müll nicht trennte, bei der Verwaltung anschwärzte, tat sich als besonders gewissenhafter Mitbürger hervor, weil er jedes Mal die Polizei verständigte, wenn er mehr als zwei Personen gleichzeitig spazieren gehen sah. Die Sichtweise auf manche Dinge veränderte sich grundlegend.
Man könnte nun meinen, diese nie gekannte Ausnahmesituation habe auch eine gute Seite gehabt, weil wir alle enger zusammenrückten, je weiter wir beim Einkauf oder im Bus auseinanderstehen mussten. Im besten Falle hätte diese epochale Krise uns durchaus einander näherbringen und die allgemeine Skrupel- und Rücksichtslosigkeit, die Unvernunft und die himmelschreiende Blödheit für lange Zeit in den Hintergrund drängen können. Ja, es hätte eine bessere Gesellschaft entstehen können, in der wir wieder mehr aufeinander aufpassten und unser Ego mindestens die benötigten eineinhalb Meter hinter uns stellten. Aber trotz aller drolligen Hashtags, abendlichen Klavierkonzerte privater Symphonieorchester auf den Balkonen studentischer Wohngemeinschaften, virtuellen Stammtischrunden mit einsamen Freunden und gut gemeinten Einkaufshilfen für bettlägerige Senioren muss man leider festhalten, dass viele Menschen vor allem den geistigen Lockdown vollzogen haben. Und wir während und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nach diesem ganzen Corona-Wahnsinn genauso doof sind wie zuvor.
Nehmen wir nur mal die Sache mit dem Klopapier. Ausgerechnet in China wurde dieses praktische Hilfsmittel im 6. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt, indem ein Geschichtsschreiber namens Yan Zithui seinen Landsleuten empfahl, nach dem Geschäft den Allerwertesten keinesfalls mit Papier zu säubern, auf dem sich möglicherweise Zitate großer Gelehrter befanden. Die Chinesen, die knapp 1500 Jahre später leider eher weniger Wert auf besonders hygienische Umgangsformen zu legen schienen und zu allem Übel gerne mal ein halb gares Schuppentiergulasch oder ein pikantes Fledermausgröstl verzehrten, mussten das Zeug also damals schon gekannt haben. Und das zu einer Zeit, während der man sich hierzulande den Po noch mit Pestwurzblättern abwischte, weshalb diese Pflanze im alpenländischen Raum auch heute noch Arschwurz genannt wird.
Trotzdem setzte sich auch in Mitteleuropa nach und nach (spätestens nach der Erfindung des Wasserklosetts im 19. Jahrhundert) die Nutzung von eigens dafür hergestellten Papierstreifen als rektale Reinigungshilfe durch. Natürlich gab es immer wieder entbehrungsreiche Phasen. Mein Großvater, von dem in diesem Buch noch die Rede sein wird, erzählte jedenfalls oft davon, wie unsere Oma nach dem Krieg ein winziges Stück Speck mehrmals in heißem Wasser auskochte, um den Kindern so etwas Ähnliches wie eine Suppe bieten zu können. Der Mangel an Klopapier dürfte damals das geringste Problem gewesen sein: Man nahm sich ein paar alte Zeitungsseiten, die man halbierte und am stillen Örtchen auf einem Holzstab aufspießte. Und nachdem es wieder aufwärtsging und sich auch Oma und Opa eines Tages »Hakle Krepp« leisten konnten, hörte man nie wieder etwas von einer Toilettenpapierknappheit.
Der Ölpreis stieg und fiel und stieg wieder, während der jeweiligen Saison konnte es vorkommen, dass am Markt der einheimische Spargel oder die Erdbeeren aus waren, und wenn Aldi einen neuen Computer zum Schleuderpreis verschacherte, war der nach zwei Tagen ebenfalls vergriffen. Toilettenpapier jedoch war immer und überall ausreichend vorhanden, und es gab selbst nach dem Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen keinen objektiven Anlass, sich über das Jahr 2025 hinaus damit einzudecken: Die Zellstoffindustrie war nicht von Berufsverboten betroffen, alle Drogerien öffneten täglich um acht Uhr in der Früh, und dieses verfluchte Covid-19 befiel vorwiegend die Lunge und nicht den Darm. Dennoch begannen bis dahin selbst in dieser Hinsicht rational denkende Menschen, Rollen zu horten, als wäre das eine Geldanlage mit zweistelliger Rendite. Niemals hätte ich gedacht, in unserer oft perversen Überflussgesellschaft, in der man in jedem Dorfdiscounter aus 40 verschiedenen Joghurtsorten auswählen und sich zwischen chilenischen, südafrikanischen und kalifornischen Rotweinen entscheiden kann, vor leeren Klopapierregalen zu stehen.
Das aber war nur der Anfang. Es folgten (in absteigender Reihenfolge) Mehl, Nudeln, Reis, Konservendosen, Zucker, Tiefkühlpizzen, Fischstäbchen, Pommes frites, Wiener Würstel im Glas, Hefe und irgendwann sogar Bier und andere Getränke, sodass die Brauereien zwischenzeitlich kein Leergut mehr zur Verfügung hatten. Das Argument, sich die Ausgangsbeschränkungen schönzusaufen, leuchtete noch ein, aber ich selbst wurde Zeuge, wie ein alleinstehender Mann in einem Abholmarkt für 300 Euro Mineralwasser einkaufte und beim Einladen der Kästen in seinen Wagen fast vor Erschöpfung zusammenbrach. Auf meinen Einwand, er könne doch auch bedenkenlos Leitungswasser trinken, erwiderte er irgendetwas, das ich nicht verstand, weil er sich in Ermangelung einer Maske seinen Wollschal bis unter die Augen gezogen hatte.
Auch wenn längst wieder genug Backhefestückchen und Getränkekästen erhältlich sind, steht zu vermuten, dass es in vielen Kellern noch immer aussieht wie im Materiallager eines afghanischen Bundeswehr-Camps – und dass wir bis mindestens übernächsten Sommer entweder sehr oft Nudelauflauf mit Reis und Dosengemüse essen werden oder den ganzen Kram eines Tages in den Müll schmeißen, so wie wir es schon vor der Krise mit 75 Kilogramm Lebensmitteln pro Kopf und Jahr getan haben. Warum wir aber manche Produkte wie die Irren einkauften, während wir für die allgemeine Volksgesundheit weitaus wichtigere Lebensmittel wie Obst, Gemüse oder Schnapspralinen links liegen ließen, blieb weitgehend ein Rätsel. Und dass mancher Klopapierhersteller nach dem großen Ansturm zwischenzeitlich Kurzarbeit anmelden musste, weil die Leute die massenhaft gehorteten Rollen erst mal monatelang, mit Verlaub, abscheißen mussten, passte ebenfalls ins schiefe Bild. Zum Trost sei gesagt, dass in den USA sogenannte Pinkeltüten des Herstellers Travel John ausverkauft waren; kleine Einwegbeutel mit Granulat, an deren Ende ein Trichter befestigt ist: Die Amerikaner trauten sich wegen der Ansteckungsgefahr nicht mehr auf öffentliche WC-Anlagen, und weil die Vereinigten Staaten ein sehr großes Land sind und die Auto- und Zugfahrten oft sehr lang, schifften die Menschen lieber in diese Boxen, in denen der Urin durch die Kristalle in ein geruchloses Gel verwandelt wurde.
Ob sich Bill Maher oder Jimmy Fallon mit dem Ansturm auf Travel John beschäftigten, weiß ich leider nicht. Unser zeitweise überaus seltsames und soziologisch möglicherweise kritisch zu hinterfragendes Einkaufsverhalten wurde definitiv leider viel zu selten in den Talkshows thematisiert, die sich ab Ende Januar nur noch um Corona und die Folgen drehten. Es musste erst Ende Juni werden, bis sich Maybrit Illner bequemte, sich nach den furchtbaren Ereignissen von Göttingen mit dem Thema Kindesmissbrauch erstmals wieder einem anderen Aspekt als dem blöden Virus zu widmen. Zuvor hätte Donald Trump von einem arabischen Terroristen auf offener Straße enthauptet, Angela Merkel wegen Steuerbetrugs zu einer Haftstrafe verurteilt oder dem FC Bayern München die Lizenz für die Fußballbundesliga entzogen werden können, man hätte es in dieser absurd einseitigen Nachrichtenlage überhaupt nicht bemerkt. Stattdessen sah man bei Frau Illner, Anne Will, Sandra Maischberger, Frank Plasberg oder Markus Lanz die üblichen Verdächtigen aus dem Politikbetrieb wie Karl Lauterbach (angeblich früher mal Epidemiologe), Helge Braun (angeblich früher mal Arzt) oder Olaf Scholz (angeblich früher mal Olaf Scholz). Und darüber hinaus mikrobiologisch ausgebildete Fachkräfte, die der gebannten Nation ihre tagesaktuelle Einschätzung mitteilten – analog zu den mehr als 1000 Eilmeldungen, die uns bis heute über Reproduktionszahlen und Neuinfektionen auf dem Laufenden halten. Es gab Tage, an denen ein Experte in der ARD bereits das bevorstehende Ende des Katastrophenzustands in Aussicht stellte, während ein Berufskollege gleichzeitig im ZDF die nahende Apokalypse in unseren Heimen und Krankenhäusern beschwor. Oder umgekehrt. Dass der übervorsichtige Herr Lauterbach lieber in ein Fass mit heißem Frittierfett steigen würde, als eine volle Schule zu betreten oder sich in ein Fußballstadion zu setzen, hat auf alle Fälle mittlerweile jeder im Land begriffen.
Manche Fernsehzuschauer entwickelten zum jeweiligen Virologen ihres Vertrauens in diesen Wochen gar eine engere Bindung als zu ihrer eigenen Familie, mit der sie völlig unvorbereitet in einer sogenannten häuslichen Gemeinschaft gefangen gehalten wurden. Viele Paare stellten erst jetzt fest, nach vielen vermeintlich gemeinsamen Jahren, mit welchem Volltrottel beziehungsweise welcher Schreckschraube sie überhaupt zusammenlebten. Auf eine Situation, in der man tagtäglich von morgens bis abends im Homeoffice arbeiten und den Partner ertragen muss, anstatt wie gewohnt mit der oder dem Geliebten auf Dienstreise zu sein, kann einen eben niemand vorbereiten.
Und auf die Hausaufgabenbetreuung frühpubertierender Halbwüchsiger auch nicht. Schimpfte man zuvor regelmäßig auf die Unfähigkeit des Lehrkörpers, die verzogenen Blagen nicht besser bändigen und bilden zu können, und beschwerte sich wegen jeder Drei minus persönlich beim Direktor, stellten viele Väter und Mütter nun fest, dass eine Achtklass-Bruchungleichung gar nicht so einfach zu erklären ist, wenn man sich in den vergangenen 20 Jahren nur auf kicker.de oder im Frühstücksfernsehen fortgebildet hat. Nur wenige Eltern dürften sich zudem an die normalen schulischen Gewohnheiten angepasst und mit ihren Kindern Pornovideos am Smartphone getauscht, unter dem Esstisch »Minecraft« gedaddelt oder in der großen Pause zwischen »Volle Kanne« und dem Mittagessen einen Joint geraucht haben.
Dass unsere Kinder auch nach den Lockerungen schon bei einem leichten und demzufolge in aller Regel total harmlosen Schnupfen laut Empfehlung des Gesundheitsministeriums zu Hause bleiben mussten, trug natürlich auch nicht zur familiären Entspannung bei – und dürfte zur Folge haben, dass vor allem Frauen künftig echte Probleme im Berufsleben haben werden. Wer nimmt schon eine zweifache Mutter, wenn er befürchten muss, dass diese zwischen Oktober und März jede zweite Woche ausfällt, weil aufgrund der saisonbedingten Rotznase des Nachwuchses die neuerliche Corona-Panik in Kita und Schule ausbricht.
Sofern man sich nicht während dieser unfassbar langsam vergehenden Wochen gegenseitig die Schädel eingeschlagen, sondern sich, womöglich aus reiner Langeweile, der körperlichen Liebe ausnahmsweise sogar mit dem eigenen Partner hingegeben hat, könnte es wegen der seit »Kevin allein zu Haus« bekannten Vorbildfunktion öffentlich bekannter Figuren bald sehr viele Buben mit den Namen Christian (Drosten), Hendrik (Streeck), Alexander (Kekulé), Lothar (Wieler) oder Jonas (Schmidt-Chanasit) geben. Jedenfalls von den Eltern, die nicht irgendwann mit einem Hut aus Alufolie auf dem Kopf, selbst gebastelten Transparenten in den Händen und jeder Menge Wut im Bauch auf die Straße gingen und gegen die »in Wirklichkeit von Bill Gates, der Familie Rothschild oder außerirdischen Mächten« angezettelte virale Verschwörung demonstrierten.
Für die künftigen Töchter aller Virologenfans bleibt leider nur der etwas altbackene Vorname Melanie, repräsentiert von Frau Brinkmann (wie der Professor aus der Schwarzwaldklinik), die regelmäßig wie weiland Heidis Fräulein Rottenmeier all die Verhaltensweisen madig machte, die man sich gerade sehnlichst herbeisehnte. Gäbe es eine Tinder-Version nur für eintönige Pandemie-Experten, bei Frau Brinkmann und Herrn Lauterbach hätte es sicher gematcht. Wobei: Es dürfte wahrscheinlich auch einige besonders freigeistige Elternpaare geben, die beim Standesamt ersuchen, den Begriff »Pandemie« als Rufnamen für das neugeborene Mädchen eintragen zu lassen – genehmigte Beispiele wie Blümerella, Emilia-Extra, Imperial-Purity, Prestige oder Windsbraut lassen Schlimmes erahnen. Corona übrigens gibt es als Vornamen schon, nach Vorbild einer frühchristlichen Märtyrerin wurde er in den Jahren vor dem Schlamassel ein paarmal vergeben! Der Studiengang Infektionsepidemiologie, vorher allenfalls für zauselige Labornerds mit einem Elektronenmikroskop als einzigem Freund von Interesse, dürfte auf alle Fälle für die nächsten Jahrzehnte ausgebucht sein.
Blöd daran war nur, dass sich die Herren Virologen von Anfang an nicht ganz einig darüber waren, ob wir nun alle ohne flächendeckende häusliche Ausgangsverbote dem unweigerlichen Untergang geweiht wären oder unsere Politiker bei der totalen Stilllegung unserer Wirtschaft nicht doch ein kleines bisschen überreagiert haben. Ein Gastronom, der nach den ersten beiden Wochen Schockstarre erst verzweifelt einen Lieferservice eingerichtet, dann das Personal in Kurzarbeit geschickt und sich noch mal einige Zeit später wegen akuter Suizidgefahr selbst in die Psychiatrie eingewiesen hat, würde vermutlich Letzteres annehmen. Der Tochter wiederum, die ihre betagte Mutter wegen einer aufgrund des Corona-Virus aufgetretenen akuten Lungenentzündung verloren hat, könnten die Befindlichkeiten eines Geschäftsmannes in jenen Tagen wahrscheinlich sehr egal gewesen sein.
So tragisch die gesundheitlichen und vor allem die ökonomischen Folgen dieser Misere für viele von uns auch waren und vermutlich noch sehr lange sind, so sehr hat sich auch in diesen geschichtsträchtigen Monaten wieder einmal gezeigt: Der gesunde Menschenverstand kommt in schwierigen Situationen nicht zum Vorschein, wenn er bereits vorher, als alles normal lief, schlichtweg nicht vorhanden war. Das zeigte sich insbesondere im Umgang mit den für viele von uns vollkommen ungewohnten Abstandsregeln. Die wurden erstaunlicherweise vor allem von jenen Zeitgenossen am vehementesten eingefordert, die sich jedes Jahr im Hochsommer, ohne mit der Wimper zu zucken, knapp drei Zentimeter neben einen wildfremden anderen Badegast an den Strand von El Arenal quetschten. Oder die einem bis Ende Februar 2020 bei Aldi jedes Mal mit dem Einkaufswagen mit Vollgas in die Hacken fuhren, um schnellstmöglich ihre Ware aufs Band werfen zu können, nachdem aus dem Lautsprecher der magische Satz ertönt war: »Sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kasse 2.«
Manche Menschen, die ansonsten ungeniert quer durch die öffentlichen Verkehrsmittel niesten, ihr Gegenüber im Büro im Halbstundentakt gedankenlos anhusteten oder das Händewaschbecken auf öffentlichen WCs für ein Dekoobjekt hielten, wechselten auf einmal panisch die Richtung, wenn man ihnen auf einem weniger als drei Meter breiten Weg entgegenkam. Ein guter Freund von mir, dem es vorher im Bierzelt nicht eng genug zugehen konnte und der schon mal gerne unaufgefordert aus dem Maßkrug der Tischnachbarn trank, wenn die Bedienung nicht schnell genug Nachschub lieferte, saß mir nach drei Monaten Funkstille bei unserem ersten Wiedersehen mit einem Laser-Abstandsmesser gegenüber – um sicherzustellen, dass ich ihn nicht aus Versehen mit meinen Aerosolen kontaminierte.
»Social Distancing« lautete der überinterpretierte Modebegriff, der eigentlich unter dem Wort »Intimsphäre« jedem halbwegs zivilisierten Bürger längst hätte bekannt sein sollen. Dabei ging es doch nur um eine physische Distanz. Die tatsächliche »soziale Distanz« allerdings war von Anfang an absolut verkehrt: Tausende Menschen starben einsam, und ohne noch mal Besuch von ihren Angehörigen bekommen zu dürfen, in Alten- und Pflegeheimen oder Spitälern, sicherlich eine der schlimmsten Folgen von Corona. Leider führten darüber weder das Robert Koch-Institut noch das Helmholtz Zentrum oder das Bundesgesundheitsministerium eine Statistik. Wissenschaftler kamen aber zu dem Schluss, dass die Effekte für die Betroffenen ähnlich fatale Auswirkungen hatten, wie sie gemeinhin bei Mobbingopfern zu beobachten sind.
Der genaue Abstand, der nötig war, damit sich das Virus nicht allzu schnell weiterverbreitete, basierte allen Ernstes sogar auf der mathematischen Formel R=1-(1-a2)f0, von der zwar niemand genau wusste, was sie bedeuten sollte und wie man ausgerechnet darauf gekommen war. Kontrolliert wurden die damit berechneten eineinhalb Meter anfangs jedoch von einer Polizeipräsenz, wie man sie wohl seit den Tagen nach dem 11. September 2001 nicht mehr gesehen hatte: Reiterstaffeln patrouillierten durch Parkanlagen und lösten mit aller Härte unerlaubte Versammlungen von drei, manchmal sogar vier nebeneinander im Gras sitzenden subversiven Elementen auf. Illegal betriebene Eisdielen und Friseursalons wurden von Spezialeinheiten ausfindig gemacht und umgehend von Rollkommandos geräumt. Vor bekannten Ausflugsorten errichtete man Straßensperren und führte Personenkontrollen durch, als näherte man sich bewaffnet dem G-8-Gipfel. Hatte man bis vor Kurzem noch seine Dänische Dogge mitten auf den Bürgersteig scheißen lassen, den häuslichen Sperrmüll in den Wald werfen oder sein Altöl einfach in die Kanalisation kippen können, ohne dass dies wegen der personellen Knappheit der entsprechenden Ordnungsbehörden je aufgefallen wäre, wurden in manchen Bundesländern jetzt mit erstaunlicher Akribie Bußgelder von 500 Euro und mehr verhängt, wenn man nur auf einer Parkbank saß und mit einem Freund ein Stück Kuchen verzehrte.
Eilig wurden für jede Branche akribische Hygienekonzepte erarbeitet, die dazu führten, dass etwa der »Verband für Sex-Arbeit e. V.« seinen Mitgliedern (und wahrscheinlich auch jenen ohne Glied) empfahl, »gesichtsnahe Dienstleistungen« vorübergehend zu unterlassen, Berührungen aufs Nötigste zu beschränken und Gruppensex zu vermeiden. Beim Vögeln galt selbstverständlich strikte Maskenpflicht, und außerdem sollten die Personendaten der Freier analog zur Gastronomie vier Wochen lang aufbewahrt werden, was allerdings wenig praktikabel erschien: Welcher brave Ehemann begab sich schon gerne ins Puff, wenn er befürchten musste, dass das örtliche Gesundheitsamt ein paar Tage nach dem kurzen Vergnügen daheim anrufen und die ganze Familie in häusliche Quarantäne stecken könnte, bloß weil im »Palais d’Amour« zwei Corona-Verdachtsfälle gemeldet worden waren?
Dass auf einmal überall Desinfektionsmittel bereitgestellt werden mussten, war derweil auch nicht der Weisheit letzter Schluss: Zum einen mischten manche gebeutelten Geschäftsleute und Gastronomen für ihre plötzlich in Sachen Hygiene hypersensiblen Kunden einfach irgendwas aus billigem Fensterreiniger, altem Apfelessig und abgestandenem Leitungswasser zusammen, weil sie sich nicht jeden Tag ein paar neue Flaschen Antiseptika leisten konnten. Und zum anderen soffen einige Knallchargen das Zeug, das in allen Ladeneingängen oder Toilettenvorräumen herumstand, kurzerhand aus – entweder weil Donald Trump dazu aufgerufen hatte oder weil es einfach schneller reinknallte als ein paar Asbach-Schorlen.
Man verstand als hilf- und ratloser Laie sehr wenig in diesen geschichtsträchtigen Monaten – nicht, was es mit diesen Basisreproduktionszahlen auf sich hatte, was genau ein Tracing sein sollte und was eine Triage, welche Allgemeinverfügung gerade in welchem Bundesland galt oder worin der Unterschied zwischen Letalitäts- und Mortalitätsrate bestand. Wir hatten ebenfalls keine Ahnung, was ein »triftiger Grund« sein könnte, wegen dem man in der Hochphase der pandemischen Panikmache doch das Haus verlassen durfte: Für manche Menschen war es ausreichend triftig, sich einfach nur die Füße zu vertreten; andere hatten gute Argumente dafür, unbedingt den 50 Kilometer entfernt wohnenden Freund oder die Freundin zu treffen; wieder andere empfanden es als zwingend notwendig, mit ihren vollkommen am Rad drehenden Kindern in der Dämmerung einen gesperrten Spielplatz zu entern und illegalerweise zu benutzen.
Auch die täglichen Pressekonferenzen des RKI, die rund 100 aufeinanderfolgenden ARD-»Brennpunkte« oder die unterschiedlichen Äußerungen von Herrn Drosten trugen in keiner Weise zur Aufklärung bei. Es entstand vielmehr eine riesige allgemeine Unsicherheit – und der Eindruck, als würde sich eine einzelne Berufsgruppe an ihrer plötzlichen Bedeutung berauschen, während andere Stimmen, die zu mehr Maß mahnten – also Maß im Sinne von Augenmaß und nicht zu mehr Maß Bier, wobei auch der allgemeine Alkoholkonsum kummerbedingt stark anstieg –, nicht oder kaum von den Entscheidungsträgern gehört wurden.
Nach zwei Monaten lagen allerorten die Nerven blank, die Virologen gingen wie beleidigte kleine Kinder aufeinander los, und das Volk teilte sich in zwei Lager: Lager eins hatte nach wie vor große Angst und bestand aus denjenigen, denen die hektisch beschlossenen und wöchentlich aktualisierten Lockerungen des Lockdowns viel zu schnell gingen. Im Lager zwei waren die anderen, die nicht verstehen konnten, warum sich zwei befreundete Familien in einem Biergarten unter freiem Himmel weiter auseinandersetzen mussten als früher die Schulkameraden bei der abschließenden Matheklausur – und warum in Theatern 10 Quadratmeter Platz pro Person benötigt wurden, in Gaststätten 2,7 Quadratmeter zulässig waren und in Flugzeugen gar nur 0,5. Kein Wunder, dass sich einige zusammenrotteten und gegen die Regeln auflehnten, die zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern so unterschiedlich ausfielen wie die Dialekte.
Aber wir alle zusammen spürten zumindest, dass es der Staat verdammt ernst meinte mit der Handhabung der Seuche, und wünschten uns gelegentlich, dass diese Ernsthaftigkeit in den vergangenen Jahren auch bei der Verfolgung anderer Vorhaben an den Tag gelegt worden wäre – zum Beispiel bei der Bekämpfung bestimmter Verbrechen. Wahrscheinlich hätte man für kriminelle Clans in Essen, Drogendealer im Görlitzer Park oder millionenschwere Steuersünder einfach nur ein paar eindeutige Abstandsregelungen einführen müssen. Dann hätte man die Taten bei einer etwaigen Übertretung ebenfalls derart konsequent ahnden können, dass unser gesamtes Land längst ebenso sicher vor solchen kriminellen Umtrieben wäre wie unsere Fußgängerzonen, Spielplätze und Grünanlagen während der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen. Es wirkte ein wenig, sagen wir mal, unverhältnismäßig, dass man gegen das schiere Herumsitzen im Freien oder das Benutzen eines Klettergerüsts durch ein Kind kompromisslos durchgriff und einzelne Jugendämter im Falle einer innerfamiliären Infektion gar mit Zwangsarrest für den Nachwuchs drohten, wo ansonsten schon mal Verfahren gegen vorbestrafte Sexualtäter wegen Überlastung der Justiz folgenlos verjährten und die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber brachlag.
Wie auch immer: Eine gesetzlich festgelegte Mindestdistanz zu allen nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Mitmenschen könnte man aus meiner Sicht gerne auch künftig, also irgendwann nach Ende des Irrsinns in ein, drei oder zehn Jahren, für immer beibehalten. Allerdings war ja spätestens seit den massenhaften Demonstrationen aller Art (gegen die Corona-Regeln, gegen Rassismus, gegen rechte Gewalt, gegen die Willkür der Polizei, gegen alles zusammen) sichtbar, dass sich unsere alten menschlichen Gewohnheiten nach und nach wieder durchsetzten und man sich wieder ordentlich auf die Pelle rückte, als hätte es das Virus nie gegeben – bloß um auf jeden Fall in der Frontreihe am Pool zu liegen, für drei Stationen unbedingt einen Sitzplatz in der U-Bahn zu ergattern oder als Erster in die Gondel der nach jeder Fahrt aufs Neue desinfizierten Zugspitzbahn einsteigen zu dürfen. Und spätestens, seit in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Nürnberg Spezialkräfte der Polizei anrücken mussten, um abendliche Ansammlungen Tausender feierwütiger Menschen vor Kneipen, in Parks oder auf zentralen Plätzen aufzulösen, war klar: Es hat sich gar nix geändert. Nicht nach der ersten Welle, nicht nach der zweiten und auch nicht nach einer dritten, vierten, fünften.
Der Mundschutz sowie das Desinfektionsmittel als unverzichtbare Accessoires dürften sich dagegen noch einige Zeit in unserem Alltag halten – und auf Kosten des subjektiven Sicherheitsempfindens unsere Ökobilanz ruinieren: Abgesehen von den Millionen Exemplaren, die im Hausmüll landen, sieht man schon jetzt mehr achtlos weggeworfene Einwegmasken im Rinnstein als Zigarettenkippen. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die erste davon in einem Delfinmagen auftaucht.
Aber viele von uns fühlen sich einfach besser mit einem durchgeweichten Stück in China zusammengetackerten Vliespapiers vor der Nase und ein wenig Ethanol in den Händen, obwohl uns die meisten dieser Dinge insbesondere bei fehlerhafter Handhabung ebenso wenig vor einem Virus zu schützen vermögen wie ein Seitenaufprallschutz bei einem Frontalzusammenstoß. Vielleicht hätte man den Menschen erklären sollen, dass Einwegmasken deswegen so heißen, weil man sie nach einer Benutzung wegwerfen soll – und nicht, weil man sie wochenlang immer auf demselben Weg benutzt und dazwischen in der Hand-, Hosen- oder Gesäßtasche, am Autospiegel oder unter dem eigenen Kinn aufbewahrt. Andererseits wäre es wünschenswert, wenn man als paranoider Hypochonder, der keine Intensivpatienten zu behandeln und betreuen hat, auch künftig dem medizinischen Personal nicht hundertfach Klinikutensilien wegkaufen würde, nur um die eigene, oft irrationale Angst zu beruhigen.
Es bleibt die spannende Frage, welche Schlüsse wir aus alldem ziehen, wozu wir auch am Ende dieses Buches noch mal kommen werden. So wäre es, nur als Anregung, sehr erfreulich, nach den zahlreichen Covid-19-Erkrankungen in Schlachtbetrieben mal unser Verhältnis zum Fleisch zu überdenken. Denn damit ein Nackensteak für schlappe 99 Cent beim Discounter im Kühlregal liegen kann, müssen nicht nur die Schweine leiden – es wohnen eben auch 20 bulgarische Leiharbeiter gemeinsam in einem 50 Quadratmeter kleinen Container und teilen sich ein Klo und eine Dusche. Angesichts dieser für alle Lebewesen unwürdigen Verhältnisse nutzen auch die Hygieneschleusen in den Betrieben herzlich wenig. Dass Corona aber der biologischen Landwirtschaft und damit auch einer artgerechteren Tier- und Menschenhaltung zu einem Boom verholfen hat, ist bis jetzt nicht bekannt.
Selbstverständlich gab es auch in den verrückten Monaten voller sich überschlagender Ereignisse zahlreiche Beispiele voll bewundernswerter Empathie: von Leuten, die sich selbst in höchste Gefahr begaben, um anderen helfen zu können. Es gab Nachbarn, deren Namen bislang keiner im Haus kannte und die plötzlich für alle älteren Bewohner mit einkauften. Vorgesetzte, die kulante Regeln fanden, damit man von daheim aus arbeiten und gleichzeitig auf die Kinder aufpassen konnte. Verkäuferinnen und Kassierer, die sechs Tage die Woche zwölf Stunden täglich die Stellung in den Supermärkten hielten, damit die anderen hamstern konnten. Und natürlich Krankenschwestern, Pflegekräfte und Ärzte, die bis zum Umfallen arbeiteten, um Leben zu retten.
Doch es gab eben auch die anderen. Jene, deren angeborene Blockwartmentalität zum Vorschein kam und die sich daran erfreuten, wenn sie ein paar Jugendliche anzeigen konnten, die einfach nur zusammen Fußball spielen wollten. Jene, die sich hundertfach auf öffentlichen Plätzen, an Uferpromenaden, in anonymen Mietskasernen oder anderen Orten zusammenrotteten, weil ihnen Autoritäten jeder Art und deren Spielregeln einfach schon immer am Arsch vorbeigingen. Jene, die mit überteuerten Produkten Kasse machen und mit der Sorge anderer reich werden wollten. Jene, die genug Geld auf dem Schweizer Festgeldkonto hatten und trotzdem ihren um die Existenz kämpfenden Ladenmietern keinen einzigen Euro nachließen. Jene, die ihre bizarren Verschwörungstheorien ungestraft verbreiten konnten und so noch mehr zu Verunsicherung und Spaltung unserer brüchigen Gesellschaft beitrugen. Jene, die schon am frühen Morgen sämtliche Regale leer kauften und der Allgemeinheit zumindest vorübergehend dringend benötigte Grundversorgungsartikel entzogen. Und jene, die andere anhusteten und davon Filmchen ins Internet stellten, weil sie dachten, dass das lustig sei.
Man muss nicht allzu pessimistisch sein, um zu befürchten, dass ebenjene Leute gar nicht so wenige waren. Und darum hat Corona eben doch nicht alles verändert. Manche sind genau dieselben Trottel geblieben, die sie immer schon waren. Und ihnen ist dieses Buch gewidmet.
Mit konsequenter Inkonsequenz
Wie unser Staat immer wieder falsche Prioritäten setzt
Andreas Hock
Wer auch immer in der letzten Zeit behauptet hat, unsere Bürokratie funktioniere nicht richtig – etwa weil er ein halbes Jahr auf seinen neuen Reisepass warten musste –, der sieht sich spätestens seit dem Beginn der Corona-Krise eines Besseren belehrt. Wo sonst einfache Verwaltungsakte wie der Bauantrag für eine Fertiggarage mehrere Monate dauern und man für die Ummeldung der Wohnadresse beim Einwohneramt zwei Tage Urlaub beim Chef beantragen muss, wurden binnen Stunden in Bundes- und Landesministerien, Ordnungs- und Landratsämtern, Rathäusern, Kreisverwaltungsreferaten und anderen hoheitlichen Dienststellen akribisch genaue Richtlinien ausgearbeitet, um auch wirklich alle noch so abwegigen Lebensbereiche pandemiegerecht zu gestalten. Herausgekommen sind eine Fülle an Ausnahmeregelungen und Sondergesetzen, von denen jede einzelne umfangreicher ausfiel als, sagen wir mal, die Jahresbilanz von Wirecard oder die Schufa-Einträge aller Teilnehmer von »Promi Big Brother«.
Gut, ein paar der Regeln schossen vielleicht über das Ziel hinaus. Aber so ein systemrelevanter und damit manchmal womöglich aus Versehen übereifriger Beamter konnte ja nicht ahnen, dass ein Kind mit einem leichten Sommerschnupfen kein die Allgemeinheit gefährdender Superspreader, sondern höchstens eine kleine Rotznase ist. Es war auch kaum absehbar, dass ein 16 000 Quadratmeter großes Möbelhaus mit einer zeitweilig auf 800 Quadratmeter begrenzten Verkaufsfläche keinen Umsatz macht und Insolvenz anmelden muss. Wie sollte man bei all dem Stress noch daran denken, dass ein Theater, in dem vor der ganzen Misere 400 Menschen Platz fanden, mit 50 erlaubten Zuschauern seine Unkosten nicht zu decken imstande ist? Unmöglich zu verhindern, dass in Berlin, Stuttgart, München, Frankfurt und anderswo zigtausend Verschwörungstheoretiker, Rechts- und Linksextreme, Holocaust-Leugner, Impfgegner und andere Spinner in friedlicher Eintracht und ohne Abstandsregeln, Mundschutz und sonstigen Klimbim demonstrierten – man musste schließlich kontrollieren, ob der Caféhausbetreiber nebenan seine Speisekarten ordentlich desinfizierte.
Ja, man konnte es in dieser verflixten Ausnahmesituation niemandem recht machen, selbst wenn man sich noch so große Mühe gab:
Als eine der ersten Maßnahmen wurden bekanntlich von den Herren Maas und Seehofer strengste Aus- und vor allem Einreisebestimmungen verhängt – was übrigens vor fünf Jahren noch unmöglich schien, obwohl ein Virus sich gegebenenfalls weniger von einem uniformierten Zöllner beeindrucken lässt als ein potenzieller Zuwanderer ohne Ausweispapiere. Weil sich jedoch die meisten einheimischen Gelegenheitsarbeitnehmer ungern zehn Stunden bei sengender Hitze auf einem Acker aufhalten und zum Krisengespräch im Kanzleramt vermutlich gern Beelitzer Spargel gereicht wird, beschloss man kurz darauf, 80 000 vorwiegend osteuropäische Erntehelfer einreisen zu lassen. Die durften dann anstatt wie zuvor üblich zu sechst oder zu acht nur mehr zu viert in der kleinen Behelfsbaracke nächtigen, um die Virusgefahr einzudämmen. Für Bürokräfte legten die Behörden derweil fest, dass sich möglichst nur eine Person in jedem Raum aufhalten durfte, was den Schluss nahelegte, dass ein deutscher Angestellter eine schützenswertere Spezies darstelltals ein polnischer Spargelstecher. Aber das ist womöglich zu viel hineininterpretiert.
Pizza, Fischbrötchen und Currywürste durften bundesweit zum Mitnehmen verkauft werden, Eiscreme vielerorts wochenlang indes nicht. Kindergärten blieben auch dann noch für viele Mädchen und Jungen geschlossen, als die Grenzen schon wieder offen waren. Zur körperlichen Ertüchtigung während der Ausgangsbeschränkungen empfahlen uns die Politiker möglichst viel Bewegung im Freien, während gleichzeitig Wanderwege, Spiel- und Sportplätze hermetisch abgeriegelt und deren Benutzung mit drakonischen Strafen belegt wurden.
Jäger konnten zu zweit jagen gehen, aber zusammen picknicken war streng verboten. Schleswig-Holsteinern war es erlaubt, nach Hamburg zu fahren, aber Hamburgern blieb der Weg nach Schleswig-Holstein verwehrt. Kleidungsstücke mussten nach dem Anprobieren desinfiziert und in eine Art textile Quarantäne verbracht werden, bevor sie in den Verkaufsraum zurückgehängt wurden. In Mecklenburg-Vorpommern warf man die zuvor mit Willkommensprämien ins Land geholten Bewohner mit Zweitwohnsitz hochkant hinaus. Gäste sollten beim Besuch in Restaurants oder Biergärten ihre Adresse angeben, die das Personal allerdings nicht verifizieren durfte – weshalb auf den Erfassungsbögen ungewöhnlich viele Donald Trumps, Angela Merkels oder Günther Jauchs, wohnhaft in der Leckmichamarschstraße 3, Virenhausen, standen. Und in der Bundesliga mussten sich die Ersatzspieler, die in der gesamten Woche maskenlos miteinander trainierten, mit Mundschutz und mehreren Metern Abstand zueinander auf die leeren Tribünen setzen. Es gab offenbar wirklich nichts, was nicht in einen Paragrafen gegossen wurde, egal, wie unsinnig es in der Praxis auch erschien.
Zum Glück blieb sich unser plötzlich so aktionistischer Staatsapparat in einem Punkt treu, der uns Bürger seit Jahren um den Verstand bringt: der konsequenten Inkonsequenz.
»Null Toleranz gegenüber Rechtsbrechern im Kampf gegen das Corona-Virus«, gab etwa NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als Losung aus, um dann festzustellen, dass seine Vollzugsbehörden zwar allein bis Mitte des Jahres rund 15 000 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen ausmachten, die sogleich mit Geldstrafen bis zu 5000 Euro sanktioniert wurden. Bei den Soforthilfen indes schienen unsere Ämter dann endlich wieder in den üblichen Überforderungsmodus zu fallen. Anders ist kaum zu erklären, warum Tausende Fälle von mutmaßlichem Subventionsbetrug und ähnlicher Delikte bis heute ungeahndet blieben: Vermeintlich offizielle Antragsformulare waren wochenlang auf Fake-Webseiten zu finden und fischten die Kontodaten argloser Nutzer ab; Scheinfirmen und Briefkastengesellschaften mit Sitz in Kabul, Panama City oder den Cayman-Inseln meldeten coronabedingt Kurzarbeit an, und wohlhabende selbstständige Unternehmer räumten kurzerhand ihre Konten leer und täuschten Liquiditätsengpässe vor. Doch eigentlich wäre es enttäuschend gewesen, wäre all das in dieser Zeit nicht passiert. Denn man ist es nicht anders gewohnt.
Dass irgendetwas bei uns granatenmäßig schiefläuft, weiß nämlich jeder, der schon mal selbst eine Steuererklärung ausgefüllt, ein Gesuch auf die Fällung eines Laubbaumes auf dem eigenen Grundstück bei der Naturschutzbehörde eingereicht oder als Gastronom bei der Gemeinde einen Antrag auf die Erweiterung seiner Freischankfläche gestellt hat. Oder alle, die wie meine Frau und ich ein, zwei oder mehr Kinder in diese Welt gesetzt haben, ohne darüber nachzudenken, ob das so eine gute Idee war angesichts des gegenwärtigen Zustandes (der Welt, nicht der Kinder). Jedenfalls wird jeder neue Erdenbürger angemessen begrüßt: Bei der etwas schwierigeren Geburt unseres Erstgeborenen befanden sich er und seine geplagte Mutter noch im Krankenhaus, als ich schon einen Umschlag des Finanzamts im Briefkasten vorfand, adressiert an den Namen unseres Sohnes – seine allererste Post.
Ende der Leseprobe