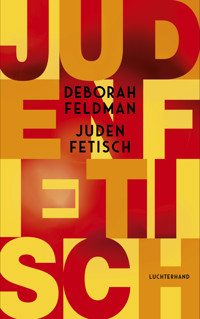11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
"Unorthodox ist ein Enthüllungsbuch, das sich wie ein Roman liest." (Die Welt)
Am Tag seines Erscheinens führte »Unorthodox« schlagartig die Bestsellerliste der New York Times an und war sofort ausverkauft. Wenige Monate später durchbrach die Auflage die Millionengrenze. In der chassidischen Satmar-Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldman führt uns bis an die Grenzen des Erträglichen, wenn sie von der strikten Unterwerfung unter die strengen Lebensgesetze erzählt, von Ausgrenzung, Armut, von der Unterdrückung der Frau, von ihrer Zwangsehe. Und von der alltäglichen Angst, bei Verbotenem entdeckt und bestraft zu werden. Sie erzählt, wie sie den beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum Verlassen der Gemeinde findet – um ihrem Sohn ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Noch nie hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich, so analytisch klug und dabei literarisch so anspruchsvoll erzählt.
Die Buchvorlage zur erfolgreichen Netflix-Serie „Unorthodox“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
Am Tag seines Erscheinens führte »Unorthodox« schlagartig die Bestsellerliste der New York Times an und war sofort ausverkauft. Wenige Monate später durchbrach die Auflage die Millionengrenze. In der chassidischen Satmar-Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldman erzählt, wie sie den beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum Verlassen der Gemeinde findet – um ihrem Sohn ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Noch nie hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich, so analytisch klug und dabei literarisch so anspruchsvoll erzählt.
Zur Autorin
DEBORAH FELDMAN, geboren 1986 in New York, wuchs in der chassidischen Satmar-Gemeinde im zu Brooklyn gehörenden Stadtteil Williamsburg, New York, auf. Ihre Muttersprache ist Jiddisch. Sie studierte am Sarah Lawrence College Literatur. Heute lebt die Autorin mit ihrem Sohn in Berlin.
Deborah Feldman
Eine autobiografische Erzählung
Aus dem Englischen von Christian Ruzicska
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Unorthodox – The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots« bei Simon & Schuster, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Deborah Feldman
Copyright © der deutschen Ausgabe 2016 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Covergestaltung: semper smile, München nach einem Entwurf von Erik Spiekermann und Robert Grund, Berlin unter Verwendung eines Umschlagmotivs von © Erik Spiekermann
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
mr · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-26978-4V004www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Vorwort zur Filmausgabe
Heute vor ziemlich genau zehn Jahren saß ich auf dem Sofa in meiner Mansardenwohnung in New York, während mein dreijähriger Sohn auf dem Doppelbett, das ich in unser winziges Schlafzimmer gequetscht hatte, schlief. Ich öffnete auf meinem Laptop das Dokument, das wenige Monate später »Unorthodox« werden sollte.
Ich schrieb damals stoßweise an dem Manuskript, meistens am Abend, während meine Collegekommilitoninnen und -kommilitonen in Bars und Restaurants gingen. Weil ich keine Kinderbetreuung hatte, konnte ich sie nicht begleiten und blieb zu Hause. Ich erinnere mich heute noch daran, wie seltsam komprimiert die Zukunft sich damals anfühlte, wie ein Akkordeon, aus dem alle Luft gewichen ist. Ich konnte mir damals nicht mehr als die Woche vorstellen, die vor mir lag, höchstens noch den nächsten Monat. Ich war einsam, und ich hatte Angst. Die Tage verbrachte ich mit meinem Kind, um das ich mich kümmern musste und das mich ablenkte, aber an den leeren, sich unendlich ausdehnenden Abenden hatte ich nichts außer meinem Manuskript, das sich gleichermaßen wie ein Geschenk und ein Fluch anfühlte.
Im November 2009 hatte ich schon einiges notiert, aber der Großteil meiner Aufgabe lag noch vor mir. Ich war dreiundzwanzig Jahre alt, und hatte vorher nie ernsthaft geschrieben, nicht einmal einen Zeitungsartikel oder eine Kurzgeschichte, von einem Buch ganz zu schweigen. Mir schien es, als hätte ich mir ein unerreichbares Ziel gesetzt.
Ein Buch zu schreiben war für mich Teil eines viel größeren Plans, eine Notwendigkeit, wenn ich tatsächlich frei sein und mit meinem Sohn außerhalb der Gemeinschaft in Williamsburg ein neues Leben anfangen wollte.
Meine Anwältin hatte mir kurz vorher erklärt, dass dieses Buch die Chance für mich war, die große Öffentlichkeit zu erreichen, die ich brauchte, um mich gegen eine Gemeinde zur Wehr zu setzen, die versuchte, mich stumm und hilflos zu machen. Dieses Buch war meine Chance, der Gemeinde klar zu machen, dass es besser wäre, mich einfach los- und mich gehen zu lassen.
Natürlich war ich mir des Privilegs, in einem so jungen Alter ohne jegliche Erfahrung einen Buchvertrag zu bekommen, bewusst. Dennoch, hätte ich den Luxus gehabt zu wählen, so ging es mir immer wieder durch den Kopf, hätte ich eigentlich erst nach etwas mehr Vorbereitung Schriftstellerin werden wollen. Inzwischen weiß ich, dass es keine bessere Vorbereitung für das Schreiben gibt, als das Schreiben selbst, aber damals lasteten die pragmatischen Gründe, aus denen ich mich für das Buch entschieden hatte, schwer auf mir. Das Schreiben fühlte sich weniger wie ein Akt des kreativen Ausdrucks an, sondern mehr nach dem Bau einer Strickleiter, die mich in Sicherheit bringen sollte. Das war doch nicht echt, so schrieb man doch kein Buch, dachte ich. Wenn man wirklich schreibt, tut man das doch nicht, um sein Überleben zu sichern. Dass ich keine echte Schriftstellerin war, würden meine Leserinnen und Leser doch auf jeden Fall merken.
Und doch öffnete ich an diesem windigen Herbstabend vor zehn Jahren aus Mangel an Alternativen meinen Laptop und fing an zu tippen. Ich sagte mir einen Spruch aus meiner Kindheit vor: »Tue deinen Teil und lass Gott seinen übernehmen.« Ich habe schließlich nicht das geschrieben, was ich eigentlich ursprünglich hatte schreiben wollen, ich habe mich nicht an meinen Schreibplan oder an meine vorsichtig skizzierte Chronologie gehalten. Ich versank einfach in einer Kindheitserinnerung und schrieb, als lebte ich auf einmal wieder in diesem Moment. Dieser führte mich in eine andere Erinnerung, in die ich eintauchte, und darauf folgte wieder eine andere. Das alles fühlte sich an, als hätte mich ein Gespenst besucht, als könnte ich den Teil meiner selbst ausschalten, der sich auf Chronologie und Kapitel und Charaktere und all die anderen Dinge konzentrierte, die ich in College-Schreibworkshops gelernt hatte. Stattdessen konnte ich mich auf eine inneren Stimme verlassen, die ich längst verloren geglaubt hatte. Irgendwann, Stunden später in dieser Nacht, schaute ich von meinem Bildschirm auf, und es war Mitternacht. Die Hälfte meines Manuskripts war fertig.
Heute, so viele Jahre später, arbeite ich an meinem ersten Roman, ich schreibe ihn auf Deutsch. Und ich warte manchmal Wochen, wenn nicht Monate, darauf, dass dieses Gespenst von damals mich wieder besucht. Ich setze mich hin, um zu schreiben, und alles, was passiert, ist, dass ich mich in meinem logisch denkenden Gehirn gefangen zu fühle. Ich baue die Geschichten wieder wie Strickleitern, und dann, ganz plötzlich, kehrt das Gespenst scheinbar aus dem Nichts zu mir zurück. Meine Finger tanzen fieberhaft über die Tastatur, während sich der Rest von mir in einer Art Schwebezustand befindet. Die Zeit scheint still zu stehen, und alles um mich herum verschwindet. Ich finde meine innere Stimme. Sie ist im Laufe der Jahre immer wieder zu mir zurückgekommen, wenn auch nicht so oft, wie ich es mir gewünscht hätte. Mit der Zeit ist mir klargeworden, dass sie eigentlich immer bereit und willens ist aufzutauchen, und dass ich es bin, die ihre Anwesenheit nicht immer zulässt. Weil diese Stimme aus der Vergangenheit kommt und der Rest von mir sehr bemüht ist, in der Gegenwart zu bleiben, vertragen wir uns nicht besonders gut. Wir sind wie zwei Frauen, eine verloren und eine gefunden, die immer noch darum kämpfen, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen.
Am Ende dieses Buches, das hier vor Ihnen liegt, schreibe ich über das Gefühl, mein altes Ich umgebracht zu haben, um Platz für mein neues Ich zu schaffen, das Buch seien ihre allerletzten Worte, heißt es da. Aber vor zehn Jahren war ich weder in meiner Vergangenheit noch in meiner Gegenwart verortet. Ich befand mich in einem Schwebezustand zwischen den beiden, und »Unorthodox« ist das Buch, das es geworden ist, weil es in ebendiesem sowohl verheerenden als auch magisch schwerelosen Zwischenraum entstanden ist. Hätte ich mir die Zeit genommen, mich auf das Schreiben vorzubereiten, hätte ich damit gewartet bis – sagen wir zum Beispiel jetzt –, wäre dabei mit Sicherheit ein gutes Buch herausgekommen, aber es wäre bestimmt nicht das Buch geworden, das es hatte sein sollen. Mit dem zeitlichen Abstand wäre es sicher viel weniger intensiv geworden, hätte nicht diese besondere Erfahrung bei der Lektüre ermöglicht, von der mir so viele Leserinnen und Leser berichten. Der Grund, warum »Unorthodox« so direkt, unmittelbar und mit solcher Wucht wirkt, ist der, dass auch der Schreibprozess sich genauso angefühlt hat: wie ein ganz besonderer Zustand, der so nie wieder herstellbar ist.
Nachdem ich mich also von meinem alten Selbst befreit hatte, entdeckte ich darunter zu meiner Überraschung nicht etwa eine authentischere Version, wie ich es mir so bequem vorgestellt hatte. Wenn man sich aus dem eigenen Leben herausschneidet, bleibt einem nicht viel. Es dauert mindestens ein Jahrzehnt oder länger, um ein neues Ich und auch ein dazugehöriges Leben aufzubauen. Und hätte mir jemand gesagt, wie schwer das sein würde, hätte ich mich der Herausforderung möglicherweise gar nicht gestellt.
Trotzdem, dem Glauben, dass es einfach werden würde, war ich eigentlich nie verfallen. Ich hatte kein märchenhaftes Ende im Kopf, und ich denke, das hat mir in all den Jahren sehr geholfen. Glück hat seine eigene Art, mit einem Verstecken zu spielen, wenn man es aktiv verfolgt, aber es überrascht einen oft, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich habe meine Version des Glücks in Berlin gefunden. Wenn mir das jemand vor zehn Jahren vorhergesagt hätte, hätte ich den Gedanken unglaublich witzig gefunden, ehrlich gesagt sogar ein bisschen wahnsinnig …
Ich lebe jetzt seit fünf Jahren in Berlin. Es gibt einige wie mich, die hier ein Zuhause gefunden haben. Berlin ist voller Geflüchteter, Aussteigerinnen und Aussteiger, darunter einige ehemalige chassidische und orthodoxe Jüdinnen und Juden. Das liegt teilweise an Berlin selbst, der Stadt, von der man scherzt, sie stünde auf Sand und Sümpfen und trüge keine tiefe Wurzeln in ihrem Boden, perfekt also für diejenigen, die sich selbst entwurzelt haben oder die gegen ihren Willen entwurzelt wurden. Aber es liegt bestimmt auch daran, dass die Vergangenheit für einen viel erträglicher wird, wenn man sie physisch hinter sich gelassen hat. In New York City zu leben ist für viele junge Menschen immer noch ein Traum, aber für mich war die Stadt viel mehr ein Hinterhof voller Skelette, ein Labyrinth vertrauter Gesichter und ein Minenfeld schlechter Erinnerungen. Was andere in New York suchen, habe ich in Berlin gefunden.
Zehn Jahre nach den Anfängen meines Schreibens in New York, fünf Jahre nach meinem Ankommen in Berlin wurde diesen Sommer eine Miniserie gedreht, die von dem Buch, das ich damals geschrieben habe, inspiriert ist. Die Serie wurde in meiner Muttersprache Jiddisch vor Berliner Kulissen von einem unglaublichen Team aus deutsch-jüdischen, amerikanisch-jüdischen und deutschen Frauen gedreht. (Und einige Männer waren auch beteiligt.) Meine Geschichte auf einer Leinwand zu sehen, ist ein Traum, der in Berlin seine Wurzeln schlug und der, da bin ich mir sicher, nur hier möglich war verwirklicht zu werden. Frauen zu finden, die in der Lage sind, so viel Weisheit und Leidenschaft in das Projekt einzubringen – und so viel Bereitschaft, Neuland zu erkunden –, hätte ich mir nicht vorstellen können, bevor ich in diese Stadt gekommen bin, an einen Ort, an dem kreativer Ausdruck kaum konventionelle Grenzen kennt.
Eine der größten Überraschungen bei der Entwicklung von »Unorthodox«, der Serie, war die magische Anziehungskraft, die sie auf so viele Männer und Frauen mit ähnlichen Hintergründen wie meinem auszuüben schien. Sie kamen als Schauspielerinnen und Statisten, als Beraterinnen und Übersetzer, so dass es sich am Set anfühlte, als würde man an einem besonders emotionalen Wiedersehen teilnehmen. Letztendlich ist die in der Serie erzählte Geschichte, obwohl sie von den Ereignissen in meinem eigenen Leben inspiriert ist, viel größer als das. Es ist die Geschichte von so vielen Menschen, eine Geschichte, die mir genauso gut wie anderen gehören könnte – sie könnte sogar Ihnen gehören. Wo kleine Details geändert wurden, bleiben die Themen Schmerz, Konflikt, Einsamkeit und Demütigung gleich. Indem ich zusah, wie »Unorthodox«, das Buch, zu »Unorthodox«, die Serie, wurde, war es für mich, als würde meine eigene Lebensgeschichte Teil einer größeren kulturellen Erzählung werden, ein Phänomen, das ich zutiefst berührend fand. Als ich jünger war, las ich Bücher über rebellische Musliminnen und Christen und schaute später auch Filme über deren Geschichten, aber es war immer schwierig, mich darin zu spiegeln. Der vielleicht größte Triumph von »Unorthodox« ist seine Fähigkeit, als Vorlage für eine Reise zu dienen, die viele bereist haben und für die es trotzdem noch keine detaillierte Karte gibt.
In den letzten zehn Jahren hat sich der Ausstieg aus der ultraorthodoxen Gemeinde von einer Anomalie zu einer Bewegung entwickelt. Früher konnte ich die Namen der Leute, die diese Reise antraten, an zwei Händen abzählen. Jetzt sind sie zu unzähligen Tausenden geworden, sie verschwinden in der Anonymität der Städte überall auf der ganzen Welt, erfinden sich nach besten Kräften neu. Einige von ihnen tauchen dann in Berlin wieder auf, um an einem Set zu arbeiten, an dem ihre Muttersprache gesprochen wird, an dem sie auf sofortiges Erkennen zählen können und wo die Geschichte, zu deren Erzählung sie jetzt beitragen, sich sehr nach ihrer eigenen anfühlt. Für den ehemaligen Rabbiner und die jugendliche Ausreißerin, den Fulbright-Gelehrten und die Spätentschlossene gibt es in den Szenen, die wir gedreht haben, eine Wahrheit, die auf eine ganz intuitive, tief in uns verwurzelte Art und Weise zu jedem von uns spricht.
Als ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal alle Folgen der Serie gesehen habe und endlich das volle Ausmaß unserer gemeinsamen Arbeit begriff, wurde mir schlagartig klar, dass »Unorthodox« jetzt nicht mehr zu mir gehört. Ich habe es losgelassen, und dabei ließ es mich ebenfalls los.
Deborah Feldman, Berlin 2020
Anmerkung der Autorin
SATU MARE, auf Jiddisch Satmar, ist eine an der Grenze von Ungarn zu Rumänien gelegene Stadt. Wie also kommt es, dass eine chassidische Sekte nach einer Stadt benannt wurde? Bei seinem Auftrag, berühmte Juden vor dem sicheren Tod während des Zweiten Weltkriegs zu schützen, rettete der jüdisch-ungarische Rechtsanwalt und Journalist Rudolf Kasztner das Leben des Rabbiners von Satu Mare. Dieser Rabbiner emigrierte später nach Amerika und versammelte eine große Gruppe weiterer Überlebender, mit denen er eine chassidische Sekte gründete, die er nach seiner Heimatstadt benannte. Andere überlebende Rabbiner folgten dem Beispiel, benannten ihre eigenen Sekten nach den Städten, aus denen sie kamen, und versuchten so, die Erinnerung an die Shtetlech und Gemeinden zu bewahren, die durch den Holocaust ausgelöscht worden waren.
Chassidische Juden in Amerika kehrten bereitwillig zurück zu einem Erbe, das an der Schwelle des Verschwindens gestanden hatte, trugen traditionelle Kleidung, sprachen, wie ihre Vorfahren auch, ausschließlich Jiddisch. Viele von ihnen lehnten die Gründung des Staates Israel bewusst ab, da sie glaubten, dass der Genozid an den Juden als Strafe für Assimilation und Zionismus über sie gekommen war. Chassidische Juden aber richteten ihr wichtigstes Augenmerk auf die Fortpflanzung und wollten die vielen, die umgekommen waren, ersetzen und ihre Reihen wieder erstarken lassen.
Bis zum heutigen Tag haben die chassidischen Gemeinden nicht aufgehört, rasant anzuwachsen, was als endgültige Rache an Hitler verstanden wird.
Die Namen und charakteristischen Identifikationsmerkmale aller Personen in diesem Buch wurden geändert. Wenngleich auch alle in diesem Buch beschriebenen Vorkommnisse wahr sind, so wurden doch bestimmte Ereignisse verkürzt, verdichtet oder neu angeordnet, um die Identität der in sie involvierten Personen zu schützen und den Fluss der Erzählung zu gewährleisten. Jeder einzelne Dialog ist, entsprechend meiner genauesten Erinnerung, eine bestmögliche Annäherung an die Form, in der er tatsächlich stattgefunden hat.
1Auf der Suche nach meiner geheimen Macht
»Matilda sehnte sich danach, dass ihre Eltern gut wären und liebevoll und verständnisvoll und ehrbar und intelligent. Die Tatsache, dass sie nichts davon waren, war etwas, das sie hinzunehmen hatte …
Da sie sehr klein war und sehr jung, war die einzige Macht, die sie über jeden in ihrer Familie besaß, die Macht ihrer Intelligenz.«
Aus: Matilda, von Roald Dahl
MEIN VATER HÄLT MEINE HAND, als er mit dem Schlüssel zum Warenhaus hantiert. Die Straßen sind merkwürdig leer und ruhig in diesem Industriegebiet von Williamsburg. Hoch oben am Nachthimmel leuchten schwach die Sterne; in unmittelbarer Nähe zischen gespenstig Autos über die Schnellstraße. Ich blicke hinunter auf meine offensichtlich ungeduldig auf dem Bürgersteig wippenden Lederschuhe und beiße mir auf die Lippe, um den Impuls zu unterdrücken. Ich bin dankbar, hier zu sein. Es geschieht nicht jede Woche, dass mein Tati mich mitnimmt.
Einer der vielen Gelegenheitsjobs meines Vaters besteht darin, die Öfen in Beigels koscherer Bäckerei wieder anzudrehen, sobald Shabbes vorbei ist. Jedes jüdische Geschäft muss während der Dauer des Shabbes ruhen, und das Gesetz will, dass es ein Jude ist, der die Dinge wieder in Bewegung bringt. Mein Vater eignet sich problemlos für einen Job mit so einfachen Anforderungen. Die nichtjüdischen Angestellten arbeiten bereits, wenn er ankommt, bereiten den Teig vor, formen ihn zu Brötchen und Brotlaiben, und wenn mein Vater durch das weite Wirtschaftsgebäude schreitet und die Schalter umlegt, startet ein surrendes und summendes Geräusch und kommt in Schwung, während wir durch die höhlenartigen Räume gehen. Dies ist eine der Wochen, in denen er mich mit sich nimmt, und ich finde es aufregend, von all dieser Betriebsamkeit umgeben zu sein und zu wissen, dass mein Vater in dessen Zentrum steht, dass diese Leute auf ihn warten müssen, bis er ankommt, bevor das Geschäft wieder seinen gewohnten Gang gehen kann. Ich fühle mich wichtig, allein da ich weiß, dass auch er wichtig ist. Die Arbeiter nicken ihm zu, während er an ihnen vorbeigeht, lächeln auch, wenn er zu spät ist, und tätscheln mir mit mehligen, behandschuhten Händen meinen Kopf. Als mein Vater mit dem letzten Abschnitt durch ist, pulsiert die gesamte Fabrik im Rhythmus der Mixmaschinen und Förderbänder. Der Zementboden vibriert leicht unter meinen Füßen. Ich sehe die Bleche in die Öfen wandern und auf der anderen Seite voller aufgereihter, golden glänzender Brötchen wieder herauskommen, während mein Vater sich mit den Arbeitern unterhält und dabei ein Eierkichel mampft.
Bubby liebt Eierkichel. Wir bringen ihr immer welche mit von unseren Ausflügen in die Bäckerei. Im Vorderraum des Warenlagers stehen Regale voller verpackter und versiegelter Schachteln unterschiedlicher Backwaren, die darauf warten, am Morgen versandt zu werden, und auf unserem Weg nach draußen nehmen wir immer so viele mit, wie wir tragen können. Da gibt es die berühmten koscheren Törtchen mit regenbogenfarbenen Streuseln, die Babka-Laibe mit Zimt und Schokoladengeschmack; die Schichtkuchen, schwer vor lauter Margarine, die kleinen schwarz-weißen Cookies, von denen ich nur den Schokoladeteil essen mag. Was auch immer mein Vater auf seinem Weg hinaus auswählt, es wird später im Haus meiner Großeltern abgeladen, wie eine Beute auf den Esszimmertisch gekippt, und ich darf alles kosten.
Was kommt schon gegen diese Art von Reichtum an, gegen den über die Damasttischdecke wie Auktionsware verstreuten Überfluss an Süßigkeiten und Konfekt? Heute Abend werde ich leicht einschlafen, werde den Geschmack von Glasur noch in den Zwischenräumen meiner Zähne spüren, während die Krümel in meinen Wangentaschen miteinander verschmelzen.
Dies ist einer der wenigen guten Momente, die ich mit meinem Vater teile. Meist liefert er mir kaum Gründe, dass ich auf ihn stolz sein könnte. Sein Hemd weist unter den Achseln gelbe Flecken auf, auch wenn Bubby den Großteil seiner Wäsche macht, und sein Lächeln wirkt wie das eines Clowns, dümmlich und zu breit. Wenn er mich in Bubbys Haus besuchen kommt, bringt er mir die in Schokolade getauchten Eiscremeriegel von Klein’s mit, sieht mich erwartungsvoll an, während ich esse, und wartet auf meine Dankbarkeitsbekundung. Das heißt Vatersein, muss er wohl denken – mich mit Leckereien beliefern. Dann geht er ebenso plötzlich, wie er auch kommt, geht hinaus zu einer seiner weiteren »Besorgungen«.
Die Leute stellen ihn aus Mitleid ein, ich weiß es. Sie heuern ihn an, damit er sie herumfahre, Pakete ausliefere, alles Mögliche erledige, von dem sie meinen, er sei dazu befähigt, ohne Fehler zu machen. Ihm fällt das nicht auf, er denkt, er vollbringe einen wertvollen Dienst.
Mein Vater erledigt allerlei Besorgungen, die einzigen aber, an denen er mir erlaubt teilzunehmen, sind die gelegentlichen Ausflüge in die Bäckerei und die sogar noch selteneren hin zum Flughafen. Die Ausflüge zum Flughafen sind aufregender, aber sie kommen nur wenige Male im Jahr vor. Ich weiß, dass es seltsam von mir ist, den Besuch des Flughafens selbst schon zu genießen, wo mir doch klar ist, dass ich nie in ein Flugzeug steigen werde, ich finde es aber aufregend, neben meinem Vater zu stehen, während er auf jene Person wartet, die er abholen soll, und der Menge zuzusehen, wie sie zielstrebig hin- und hereilt und ihr kreischendes Gepäck hinter sich herzieht. Was für eine wunderbare Welt das doch ist, denke ich mir, in der Vögel für kurze Zeit landen, bevor sie wie von Zauberhand an einem anderen Flughafen irgendwo auf halbem Weg über den Planeten wieder in Erscheinung treten. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich würde andauernd reisen wollen, von einem Flughafen zum nächsten. Um befreit zu sein aus dem Gefängnis des Stillstands.
Nachdem mich mein Vater zu Hause abgegeben hat, werde ich ihn eine Weile lang nicht wiedersehen, vielleicht für Wochen nicht, es sei denn, ich begegne ihm zufällig auf der Straße, dann aber werde ich mein Gesicht verbergen und so tun, als sähe ich ihn nicht, damit ich nicht zu ihm gerufen und der Person vorgestellt werde, mit der er gerade spricht. Ich kann die neugierigen, mitleidsvollen Blicke der Leute nicht ertragen, die sie auf mich richten, wenn sie herausfinden, dass ich seine Tochter bin.
»Das ist dein Meydele?«, summen sie von oben herab und kneifen mir dabei in die Wange oder heben mit gekrümmtem Finger mein Kinn. Dann blicken sie mich genauer an, halten Ausschau nach irgendeinem Zeichen, dass ich tatsächlich der Sprössling dieses Mannes bin, um hinterher sagen zu können: »Nebech, armes, kleines Seelchen, soll’s ihr Fehler sein, dass sie geboren wurde? An ihrem Gesicht kannst du’s sehen, sie ist nicht ganz da.«
Bubby ist die einzige Person, die denkt, ich sei zu hundert Prozent da. Bei ihr kannst du sicher sein, dass sie es niemals hinterfragen würde. Sie verurteilt Menschen nicht. Sie kam auch bei meinem Vater zu keinem Urteil, aber vielleicht war gerade das auch nur eine Form von Verleugnung. Wenn sie Geschichten erzählt über meinen Vater, als er so alt war wie ich, dann stellt sie ihn als liebenswert schelmisch dar. Er war stets viel zu dünn, also hatte sie alles versucht, um ihn zum Essen zu bewegen. Was immer er wollte, er hatte es bekommen, nie aber durfte er den Tisch verlassen, bevor sein Teller leer war. Einmal hatte er einen Hühnerschenkel an ein Stück Schnur gebunden und ihn für die Katzen im Hof aus dem Fenster hängen lassen, damit er nicht für Stunden an den Tisch gekettet sitzen bleiben musste, während alle anderen draußen spielten. Als Bubby zurückkam, zeigte er ihr seinen leeren Teller, und sie fragte: »Wo sind die Knochen? Du kannst nicht auch die Knochen gegessen haben.« So war sie ihm auf die Schliche gekommen.
Ich wollte meinen Vater für seine geniale Idee bewundern, meine Blase aus Stolz aber platzte, als Bubby mir erklärte, dass er nicht einmal klug genug war, vorauszudenken und die Schnur wieder hochzuziehen, um so den frisch abgenagten Knochen zurück auf den Teller legen zu können. Mit elf Jahren hätte ich mir eine feiner geschliffene Ausführung dessen gewünscht, was ein hervorragender Plan hätte sein können.
Als Teenager dann war sein harmloser Unfug nicht länger charmant. Er konnte in der Jeschiwa nicht still sitzen, also schickte Zeidi ihn ins Erziehungslager Gershom Feldman im nördlichen Hinterland von New York, wo sie eine Jeschiwa für schwierige Kinder unterhielten – eine ansonsten reguläre Jeschiwa, nur dass man Schläge verteilte, wenn sich einer nicht benahm. Es heilte das merkwürdige Verhalten meines Vaters nicht.
Vielleicht wird einem Kind exzentrisches Verhalten leichter vergeben. Wer aber versteht einen Erwachsenen, der monatelang Kuchen hortet, bis der Geruch von Schimmel unerträglich wird? Wer vermag die Reihe der Flaschen im Kühlschrank zu erklären, von denen jede einzelne mit jenen pinkfarbenen flüssigen Antibiotika gefüllt ist, die Kinder schlucken und die mein Vater wegen irgendeiner unerkannten Krankheit, die kein Arzt entdecken konnte, sich nicht abbringen ließ, tagtäglich zu trinken?
Bubby versucht trotzdem, sich um ihn zu kümmern. Sie kocht Rindfleisch eigens für ihn, auch wenn Zeidi seit dem Skandal vor zehn Jahren, als sich herausstellte, dass Teile des koscheren Rindfleischs am Ende doch nicht koscher waren, keines mehr isst. Bubby kocht noch immer für jeden ihrer Söhne, selbst für die verheirateten. Sie haben inzwischen Ehefrauen, die sich um sie kümmern, aber noch immer kommen sie abends zum Essen vorbei, und Bubby tut so, als wäre dies die natürlichste Sache der Welt. Jeden Abend um zehn Uhr wischt sie die Anrichte ab und erklärt scherzend das »Restaurant« für geschlossen.
Ich esse ebenfalls hier, und die meiste Zeit über schlafe ich hier sogar, da meine Mutter überhaupt nicht mehr anwesend zu sein scheint und meinem Vater die Verantwortung, für mich zu sorgen, nicht zugemutet werden kann. Als ich sehr klein war, das weiß ich noch, hat meine Mutter mir aus Büchern vorgelesen, bevor ich einschlief, Geschichten von hungrigen Raupen und Clifford, dem großen roten Hund. In Bubbys Haus sind die einzigen vorhandenen Bücher Gebetbücher. Bevor ich schlafen gehe, sage ich das Schma-Jisrael-Gebet auf.
Ich würde gern wieder Bücher lesen, denn dass mir vorgelesen wird, ist die einzige glückliche Erinnerung, die ich habe, aber mein Englisch ist nicht besonders gut und ich habe keine Möglichkeit, selbstständig an Bücher zu gelangen. Also nähre ich mich stattdessen mit Törtchen von Beigel’s und Eierkichel. Bubby zieht aus dem Essen eine so besondere Genugtuung und Begeisterung, dass ich gar nicht anders kann, als mich von ihrem Enthusiasmus anstecken zu lassen.
Bubbys Küche ist wie das Zentrum der Welt. Hier versammeln sich alle, um zu plaudern und zu tratschen, während Bubby Zutaten in den elektrischen Mixer gibt oder in den stets auf dem Ofen stehenden Töpfen rührt. Trübsinnige Gespräche mit Zeidi finden hinter geschlossenen Türen statt, gute Neuigkeiten aber werden immer in der Küche mitgeteilt. Soweit ich mich zurückerinnern kann, wurde ich immer von dem kleinen, weiß gekachelten Raum angezogen, der häufig wie vernebelt von den Kochdämpfen war. Als kleines Gör bin ich die eine Treppe von der dritten Etage unserer Wohnung hinuntergekrochen in Bubbys Küche im zweiten Stock, bin mit meinen pummeligen Babybeinen langsam über jede einzelne linoleumbedeckte Stufe gerutscht, voller Hoffnung, dass dort am Ende meiner Anstrengung Götterspeise mit Kirschgeschmack als Belohnung auf mich warten würde.
Hier in dieser Küche habe ich mich stets sicher gefühlt. Warum, kann ich nicht sagen, nur dass ich in der Küche nicht dieses vertraute Gefühl von Verlorenheit in einem fremden Land verspürte, wo niemand wusste, wer ich war oder welche Sprache ich sprach. In der Küche fühlte ich mich, als hätte ich den Ort erreicht, von dem ich kam, und um nichts wollte ich wieder ins Chaos zurückgezogen werden.
Meist rolle ich mich auf dem kleinen Lederstuhl zusammen, der zwischen Tisch und Kühlschrank eingeklemmt steht, schaue Bubby dabei zu, wie sie den Teig für Schokoladenkuchen rührt, und warte darauf, dass ich den Teigschaber bekomme, um ihn sauber abzulecken. Vor Shabbes presst Bubby mit einem hölzernen Stößel ganze Rinderlebern in den Fleischwolf, fügt von Zeit zu Zeit eine Handvoll karamellisierter Zwiebeln hinzu und hält eine Schüssel darunter, um die cremig zerquetschte Leber, die aus dem Fleischwolf quillt, aufzufangen. An manchen Morgen rührt sie kostbaren holländischen Kakao mit Vollmilch in einem Topf an und kocht ihn auf, bis er sprudelt, serviert mir dann eine dunkle, heiße Schokolade, die ich mit Würfelzucker süße. Ihr Rührei schwimmt in Butter, ihr Boondash, die ungarische Variante des French Toast, ist immer knusprig und perfekt gebräunt. Ihr zuzusehen, wie sie Speisen zubereitet, liebe ich noch mehr, als sie zu essen. Ich mag es, wenn sich das Haus mit den Gerüchen füllt, sie ziehen dann langsam durch die waggonartig aneinandergereihten Räume, dringen wie ein graziler Luftzug aus Gerüchen nacheinander, Zimmer um Zimmer, in jeden einzelnen vor. Allmorgendlich wache ich in meinem kleinen Zimmer am anderen Ende des Hauses auf und schnüffle in neugieriger Erwartung, womit Bubby wohl für diesen Tag beschäftigt ist. Sie steht stets früh auf, und immer wenn ich meine Augen öffne, sind Essensvorbereitungen im Gange.
Wenn Zeidi nicht zu Hause ist, singt Bubby. Sie summt wortlose Melodien mit ihrer dünnen, zarten Stimme, während sie kunstvoll einen luftigen Berg Eischnee in einer glänzenden Stahlschüssel schlägt. Das ist ein Wiener Walzer, sagt sie zu mir, oder eine Ungarische Rhapsodie. Melodien aus ihrer Kindheit, sagt sie, ihre Erinnerung an Budapest. Wenn Zeidi nach Hause kommt, unterbricht sie ihr Summen. Ich weiß, dass es Frauen nicht erlaubt ist zu singen, aber in Anwesenheit der Familie ist es gestattet. Und doch ermuntert Zeidi nur an Shabbes zum Singen. Da der Tempel zerstört wurde, sagt er, sollten wir nur zu besonderen Gelegenheiten singen oder Musik hören. Manchmal nimmt Bubby den alten Kassettenrekorder, den mein Vater mir gab, und spielt die Musik der Hochzeit meiner Cousine rauf und runter, sehr leise jedoch, damit sie hören kann, falls jemand kommt. Sie schaltet es beim geringsten Knarzen im Hausflur ab.
Ihr Vater war ein Cohen, erinnert sie mich. Er konnte seine Erbfolge bis zu den Tempelpriestern zurückverfolgen. Cohanim sind dafür berühmt, schöne, warme Stimmen zu haben. Zeidi kann um nichts in der Welt eine Melodie halten, aber er liebt es, die Lieder zu singen, die sein Vater damals in Europa sang, die traditionellen Shabbes-Melodien, die seine flache Stimme zu unmelodischen Fetzen verzerrt. Bubby schüttelt ihren Kopf und lächelt über seine Versuche. Sie hat es lange schon aufgegeben mitzusingen. Zeidi lässt jeden aus der Melodie geraten, sein lautes, flaches Geträller lenkt die Stimmen aller anderen so lange ab, bis man keine Melodie mehr erkennen kann. Nur einer ihrer Söhne habe ihre Stimme geerbt, sagt Bubby. Die anderen sind wie ihr Vater. Ich erzähle ihr, dass ich im Schulchor für eine Solopartie ausgewählt wurde, dass ich vielleicht meine starke, klare Stimme von ihrer Familie geerbt habe. Ich möchte, dass sie stolz auf mich ist.
Bubby fragt mich nie danach, wie ich in der Schule bin. Sie will sich nicht mit meinen Leistungen beschäftigen. Es ist beinahe so, als wollte sie eigentlich gar nicht wissen, wer ich wirklich bin. Sie verhält sich bei allen so. Ich glaube, das liegt daran, dass ihre ganze Familie in den Konzentrationslagern umgebracht worden war und sie nun nicht mehr die Energie aufbringen kann, sich mit anderen Menschen emotional zu verbinden.
Das Einzige, was sie kümmert, ist die Sorge, ob ich auch genug esse. Genügend dick mit Butter bestrichene Brotscheiben, genügend Teller herzhafter Gemüsesuppe, genügend Stücke feuchten, glänzenden Apfelstrudels. Es scheint, als stelle Bubby mir permanent Essen vor die Nase, selbst zu den unpassendsten Zeitpunkten. Koste mal diesen Truthahnbraten, zum Frühstück. Versuche mal diesen Krautsalat, um Mitternacht. Was gekocht wird, das ist auch zu haben. Es gibt keine Tüten Kartoffelchips im Vorratsschrank, auch keine Packungen mit Cornflakes. Alles, was in Bubbys Haus serviert wird, ist von Grund auf frisch zubereitet.
Zeidi ist derjenige, der mich zur Schule befragt, meist aber nur, um zu prüfen, ob ich mich benehme. Er möchte nur hören, dass ich mich regelgerecht verhalte, damit niemand sagen könne, er habe eine ungehorsame Enkeltochter. Letzte Woche, vor Jom Kippur, riet er mir, Buße zu tun, damit ich das Jahr neu beginnen könne, magisch verwandelt in ein ruhiges, gottesfürchtiges junges Mädchen. Es war meine erste Fastenzeit; auch wenn ich der Torah gemäß mit zwölf Jahren zur Frau werde, beginnen Mädchen mit elf zu fasten, nur um es auszuprobieren. Wenn ich die Brücke von der Kindheit zum Erwachsenenalter überquere, wartet auf der anderen Seite eine ganze Welt mit neuen Gesetzen auf mich. Das kommende Jahr ist eine Art Testlauf.
Es sind nur noch wenige Tage bis zum nächsten Feiertag, Sukkot. Zeidi braucht mich, um ihm zu helfen, die Sukkah zu bauen, die kleine, hölzerne Laubhütte, in der wir alle die nächsten acht Tage die Mahlzeiten zu uns nehmen werden. Um das Bambusdach zu richten, benötigt er jemanden, der ihm die einzelnen Stöcke anreicht, während er oben auf der Leiter hockt und die schweren Stangen an die richtige Stelle auf die frisch genagelten Balken rollt. Die Holzpflöcke scheppern laut, wenn sie auf ihren Platz fallen. Irgendwie erledige letztendlich immer ich diesen Job, was langweilig werden kann, wenn man über Stunden am Fuße der Leiter steht und Zeidi jeden einzelnen Stab in seine wartenden Hände reichen muss.
Doch ich mag es, mich nützlich zu fühlen. Auch wenn die Stäbe mindestens zehn Jahre alt sind und das ganze Jahr über im Keller gelagert wurden, so riechen sie doch frisch und süßlich. Ich drehe sie zwischen meinen Handflächen hin und her, und ihre Oberfläche, vom Gebrauch der Jahre ganz glänzend geworden, fühlt sich bei der Berührung kühl an. Zeidi hebt jeden einzelnen langsam und bedächtig hoch. Es gibt nicht viele häusliche Aufgaben, die Zeidi bereit ist zu übernehmen, aber für jegliche Arbeit, die mit der Vorbereitung auf Feste verbunden ist, nimmt er sich Zeit. Sukkot ist eines meiner liebsten, da es draußen gefeiert wird, bei frischem Herbstwetter. Wenn die Tage kürzer werden, sauge ich jeden letzten Rest an Sonnenschein auf Bubbys Veranda auf, auch wenn ich mich in mehrere Lagen Pullover packen muss, um die Kälte abzuwehren. Ich liege auf einem aus drei Holzstühlen gebildeten Bett und halte mein Gesicht zur Sonne geneigt, die zufällig durch die schmale Gasse zwischen einer Gruppe aneinandergereihter Sandsteinmietshäuser fällt. Nichts Wohltuenderes gibt es, als das Gefühl von schwacher Herbstsonne auf meiner Haut, und ich lungere herum, bis die Strahlen kraftlos von einem öden, staubigen Horizont her hinüberspähen.
Sukkot ist ein ausgedehntes Fest, aber die vier in seiner Mitte gelegenen Tage sind irgendwie weniger zeremoniell. Es gibt keine Verbote zum Fahren oder Geldausgeben an diesen Tagen, den Chol ha-Moed, und sie werden für gewöhnlich wie andere Wochentage auch verbracht, nur dass es nicht erlaubt ist zu arbeiten, und so unternehmen die meisten Familien Ausflüge. Meine Cousinen gehen an Chol ha-Moed immer irgendwohin, und ich bin zuversichtlich, dass ich mit einigen von ihnen mitgehen werde. Letztes Jahr fuhren wir nach Coney Island. Dieses Jahr, sagt Mimi, werden wir im Park Schlittschuhlaufen gehen.
Mimi ist eine der wenigen Cousinen, die nett zu mir sind. Ich glaube, es liegt daran, dass ihr Vater geschieden ist. Ihre Mutter ist nun mit einem anderen Mann verheiratet, der nicht zu unserer Familie gehört, Mimi aber kommt noch immer häufig in Bubbys Haus, um ihren Vater zu sehen, meinen Onkel Sinai. Manchmal denke ich, dass unsere Familie in zwei Teile geteilt ist, mit den Problemen auf der einen und den perfekten Menschen auf der anderen Seite. Nur die, die Probleme haben, sprechen auch mit mir. Aber egal; Mimi um sich zu haben, ist immer lustig. Sie geht zur Highschool und reist für sich allein, und sie föhnt ihr honigfarbenes Haar zu einer Stirnwelle.
Nach zwei geschäftigen Tagen, an denen ich Bubby helfe, die Festtagsessen zu servieren, sprich die Tabletts voller Speisen aus der Küche in die Sukkah und wieder zurück zu tragen, ist endlich Chol ha-Moed. Mimi kommt am Morgen und holt mich ab. Ich bin angezogen und bereit, habe ihren Anweisungen exakt entsprochen. Dicke Strumpfhosen und darüber noch ein Paar Socken, ein schwerer Pullover über meinem Hemd, um mich warm zu halten, bauschige Fäustlinge für meine Hände und dazu noch eine Mütze. Ich fühle mich angeschwollen und plump, aber gut vorbereitet. Mimi trägt einen stilvollen holzkohlefarbenen Wollmantel mit Samtkragen und Samthandschuhen, und ich beneide sie um ihre Eleganz. Ich sehe wie ein fehlangepasster Affe aus, da das Gewicht der Fäustlinge meine Arme auf komische Weise nach unten zieht.
Eislaufen ist zauberhaft. Anfangs eiere ich wackelig auf den ausgeliehenen Schlittschuhen, greife fest nach der Bande der Eisbahn, während ich meine Runde drehe, aber schnell habe ich den Bogen raus, und einmal kapiert, ist es, als flöge ich. Ich stoße mich mit den Kufen ab, schließe beim weichen Dahingleiten, das darauf folgt, meine Augen und halte, wie Mimi es mir zeigte, meinen Rücken gerade. Nie zuvor habe ich mich so frei gefühlt.
Ich kann den Klang von Gelächter hören, aber es scheint fern zu sein, verloren im Rauschen der Luft, die an meinen Ohren vorbeisaust. Der Klang der auf dem Eis kratzenden Schlittschuhe ist am lautesten, und ich verliere mich in seinem Rhythmus. Meine Bewegungen wiederholen sich und werden tranceähnlich, und ich wünschte, das Leben wäre immer so. Jedes Mal, wenn ich die Augen öffne, erwarte ich, irgendwo anders zu sein.
Zwei Stunden vergehen, und ich merke, dass ich einen Bärenhunger habe. Es ist eine neue Art Hunger, jener Hunger vielleicht, der von köstlicher Erschöpfung herrührt, und die Leere in mir ist ausnahmsweise einmal angenehm. Mimi hat koschere Sandwichs für uns eingepackt. Wir hocken uns außerhalb der Eisbahn auf eine Bank, um sie zu essen.
Während ich enthusiastisch auf meinem Thunfischroggenbrot vor mich hin mampfe, bemerke ich am Picknicktisch neben uns eine Familie, insbesondere ein Mädchen, das in meinem Alter zu sein scheint. Anders als ich tritt sie passend zum Eislaufen gekleidet auf, mit einem viel kürzeren Rock und dicken, farbenprächtigen Strümpfen. Sie hat sogar Pelzohrenschützer auf.
Sie sieht, dass ich sie anblicke, und rutscht von ihrer Bank herunter. Sie hält mir ihre geschlossene Hand hin, und als sie diese öffnet, liegt auf ihr eine Süßigkeit, eingewickelt in silbrig glänzendes Papier. Ich habe nie solch eine Süßigkeit gesehen.
»Bist du jüdisch?«, frage ich sie, um sicherzugehen, dass es koscher ist.
»Ah ja«, sagt sie. »Ich gehe sogar in eine hebräische Schule und so. Ich kenne das Aleph-Bet. Ich heiße Stephanie.«
Ich nehme vorsichtig die Schokolade von ihr an. »Hershey’s« steht darauf. Hersh ist Jiddisch für »Hirsch«. Es ist zugleich ein geläufiger jüdischer Name für Jungen. Das ans Ende angefügte ey macht einen warmherzigen Kosenamen daraus. Ich frage mich, was Hershey für eine Art Mann sein muss, ob seine Kinder stolz auf ihn sind, wenn sie seinen Namen auf der Verpackung einer Süßigkeit gedruckt sehen. Hätte ich nur das Glück, einen solchen Vater zu haben. Bevor ich den Schokoladenriegel öffnen kann, um zu sehen, wie er innen aussieht, schaut Mimi mit strengem Gesicht zu mir herüber und schüttelt warnend den Kopf.
»Danke«, sage ich zu Stephanie und schließe meine Faust um den Riegel, bis er dem Auge genommen ist. Sie schwenkt ihren Kopf und läuft zurück an ihren Tisch.
»Du kannst die Schokolade nicht essen«, vermeldet Mimi, sobald Stephanie außer Hörweite ist. »Sie ist nicht koscher.«
»Aber sie ist Jüdin! Sie hat es selbst gesagt! Warum kann ich ihn nicht essen?«
»Weil nicht alle Juden koscher halten. Und selbst bei denen, die es tun, ist es nicht immer koscher genug. Schau, siehst du den Hinweis auf der Verpackung? Da steht OU-D. Das bedeutet, dass die Molkerei nicht koscher ist. Es ist keine Cholow-Yisroel-Molkerei, was bedeutet, dass die verwendete Milch nicht der vorgeschriebenen rabbinischen Überwachung unterliegt. Zeidi wäre erschrocken, wenn du ihm das ins Haus schleppst.«
Mimi nimmt die Schokolade aus meiner Hand und wirft sie in den nächsten Mülleimer.
»Ich gebe dir eine andere Schokolade«, sagt sie. »Später, wenn wir zurück sind. Eine koschere. Du kannst eine La-Hit-Waffel haben; die magst du doch, stimmt’s?«
Ich nicke beschwichtigt. Während ich mein Thunfischsandwich aufesse, blicke ich nachdenklich zu Stephanie hinüber, die auf dem Gummiboden Sprünge vollführt. Die gezackten Vorderspitzen ihrer Schlittschuhe lassen jedes Mal, wenn sie landet, dumpfe Aufschläge erklingen, ihre Haltung ist dabei perfekt. Wie kannst du jüdisch sein und nicht koscher halten?, frage ich mich. Wie kannst du das Aleph-Bet kennen und trotzdem Hershey’s-Schokolade essen? Weiß sie es nicht besser?
Tante Chaya hat ihr abschätzigstes Gesicht aufgesetzt. Sie sitzt am Festtagstisch neben mir und lehrt mich, wie ich meine Suppe ohne zu schlürfen zu essen habe. Ihr stechender Blick ist angsteinflößend genug, um Ansporn für eine schnelle, effektive Lehrstunde zu sein. Ich lebe in der Angst, ihre Aufmerksamkeit zu erregen; es ist niemals positiv. Tante Chaya hat immer hinter jeder wesentlichen Entscheidung gesteckt, die über mein Leben getroffen wurde, auch wenn ich sie nicht mehr wirklich oft sehe. Ich habe früher bei ihr gelebt, damals, als meine Mutter für immer fortging und in ihrem kleinen schwarzen Honda davongefahren war und jeder auf der Straße seinen Kopf aus dem Fenster gesteckt hatte, um sich das Schauspiel anzusehen. Vielleicht war sie die erste Frau in Williamsburg, die Auto fuhr.
Ich war todunglücklich, dass ich bei Tante Chaya leben musste. Immer wenn ich weinte, hatte sie mich angeschrien, je stärker ich aber versuchte aufzuhören, umso heftiger sollten die Tränen fließen und mich verraten. Ich bettelte darum, bei Bubby leben zu dürfen, und obwohl meine Großeltern alt waren und ihre eigenen Kinder längst großgezogen hatten, wurde es mir schließlich doch erlaubt zurückzuziehen. Zeidi nimmt von Chaya immer noch Ratschläge an, wie ich zu erziehen sei, und ich frage mich, was sie wohl zum Experten macht, sie, die drei Töchter hat, die ihre Nahtstrumpfhosen umgehend ablegten, sobald sie ihren Schulabschluss hatten, und sofort nach Borough Park zogen, als sie verheiratet waren.
Vor Sukkot schickte Bubby mich hoch in Chayas Wohnung in der vierten Etage, um ihr zu helfen, für die Feiertage sauber zu machen. Chaya hatte Mausefallen aufgestellt, denn wir hatten, obgleich zweimal die Woche der Kammerjäger kam, ein Mäuseproblem, was jeder kennt, der in einem alten Haus in Williamsburg lebt. Chaya schmiert immer zusätzlich Erdnussbutter auf die klebrigen gelben Brettchen und schiebt sie unter die Möbel. Als ich ankam, überprüfte sie gerade sämtliche Fallen. Sie zog eine von ihnen mit einem Besen unter dem Ofen hervor, und siehe, da war eine Maus, die erbärmlich fiepende Geräusche machte und sich verzweifelt auf dem Brettchen wand. Mir wurde klar, dass es, steckte die Maus erst einmal fest, keine Möglichkeit mehr gab, sie daraus zu befreien, und doch sehnte ich mich nach einer gnädigeren Lösung, so wie man etwa einen Käfer einfängt, um ihn dann zur Straße hin freizulassen. Aber bevor ich noch etwas sagen konnte, griff Chaya mit beiden Händen nach der Falle und klappte sie zwischen ihren Handflächen mit einer schnellen, klatschenden Bewegung in ihrer Mitte zusammen und zerquetschte die Maus schlagartig zu Tode.
Mir stand der Mund offen. Noch nie habe ich jemanden sich so genüsslich einer Maus entledigen sehen. Wenn Bubby eine fand, war diese für gewöhnlich schon tot, und sie wickelte sie dann in eine Plastiktüte und brachte sie hinunter in die Mülltonne im Vorderhof. Vor einigen Monaten hatte ich eine der Schubladen meiner Kleiderkommode aufgezogen und darin eine Mäusefamilie vorgefunden, die in einem meiner zusammengefalteten Pullover nistete: Neun hellrosa, sich windende Kreaturen, jede so groß wie mein Daumen, huschten glücklich in einem Häufchen aus zerrissener Aluminiumfolie und Papierfetzen umher, das, wie ich annahm, ihre Mutter zusammengetragen haben musste. Ich ließ sie eine Woche lang dort, ohne jemandem von meiner Entdeckung zu erzählen. Eines Tages waren sie fort. Ich hatte damit dummerweise zehn weiteren ausgewachsenen Mäusen erlaubt, frei in unserem Haus herumzutollen, während Bubby sich stets darüber den Kopf zerbrach, wie man sie wohl loswerden konnte.
Es ist nicht so, dass ich Mäuse mag. Ich mag nur nichts töten. Zeidi meint, dass ein Mitgefühl wie meines unangemessen sei, fehl am Platz. Es ist, als wäre es gut, Mitgefühl zu haben, nur dass ich es irgendwie nicht richtig einsetze. Ich fühle mich für etwas schlecht, für das ich mich nicht schlecht fühlen sollte. Ich sollte mehr Mitgefühl mit den Menschen haben, die versuchen, mich großzuziehen, sagt er. Ich sollte stärker versuchen, ihn stolz zu machen.
All meine Tanten und Onkel sind, wie mir scheint, hartherzig zu ihren Kindern. Sie schelten sie, beschämen sie, schreien sie an. Das ist Chinuch, Kindererziehung nach der Torah. Es steht in der geistigen Verantwortung der Eltern, dass ihre Kinder zu gottesfürchtigen, gesetzestreuen Juden heranwachsen. Deshalb ist jegliche Form von Disziplinierung angebracht, solange sie diesem Zweck dient. Zeidi erinnert mich oft daran, dass es nur aus Pflichtgefühl geschieht, wenn er einem seiner Enkelkinder eine harsche Lektion erteilt. Wirklicher Zorn, sagt er, sei verboten, man müsse ihn aber um des Chinuch willen vortäuschen. In dieser Familie umarmen und küssen wir uns nicht. Wir machen einander keine Komplimente. Stattdessen beobachten wir einander genau, stets bereit, ruchniusdike oder gaschmiyusdike – spirituelle oder körperliche – Verfehlungen des einen oder anderen aufzuzeigen. Das, sagt Chaya, sei Mitgefühl – Mitgefühl für das geistige Wohlergehen von jemandem.
Und Chaya hat von allen in meiner Familie das meiste Mitgefühl für mein spirituelles Wohlergehen. Wann immer sie Bubby besucht, beäugt sie mich mit Argusaugen, weist alle fünf Minuten darauf hin, was ich alles falsch mache. Mein Herz schlägt schneller, wenn ich in ihrer Nähe bin; sein Rhythmus pocht laut in meinen Ohren, übertönt den Klang ihrer Stimme. Es ist nicht so, dass niemand sonst in der Familie mich kritisieren würde. Tante Rachel schaut mich immer so an, als wäre Schmutz auf meinem Gesicht, den ich vergessen hätte abzuwaschen, und Onkel Sinai schlägt mir auf den Kopf, wenn ich ihm im Weg bin. Chaya aber blickt mir in die Augen, wenn sie mit mir spricht, ihr Mund ist dabei von irgendetwas dem Zorn sehr Ähnlichem verhärtet, das ich nicht wirklich einzuordnen vermag. Sie ist stets in sehr teure, gut aufeinander abgestimmte Kostüme und Schuhe gekleidet, und sie schafft es immer, selbst beim Servieren oder Saubermachen, irgendwie zu vermeiden, dass ihre Sachen knittrig oder dreckig werden. Wenn ich einen kleinen Spritzer Suppe auf meinen Kragen abkriege, macht sie voller Verachtung ein schnalzendes Geräusch mit ihrer Zunge. Ich spüre mit aller Deutlichkeit, dass sie Gefallen an der Angst findet, die sie in mir erzeugt; es vermittelt ihr das Gefühl von Macht. Keiner der anderen scheint zu bemerken, was ich bei ihnen empfinde, sie aber weiß, dass sie mich ängstigt, und es gefällt ihr. Es gibt Zeiten, in denen sie sogar vorgibt, nett zu sein, und ihre Stimme vor zuckersüßer Lieblichkeit nur so triefen lässt, das Flackern in ihren engen blassblauen Augen aber verweist auf etwas anderes, wenn sie mich dann fragt, ob ich ihr helfen mag, Kirschtorte zu backen, und mich anschließend eingehend mustert, wie ich den Tortenteig in einer großen Stahlschüssel knete, und nur darauf wartet, dass ich den kleinsten Fehler begehe.
Chaya ist die einzig wirklich Blonde in der Familie. Auch wenn ich zwei weitere Tanten habe, die blonde Perücken tragen, so weiß doch jeder, dass ihr Haar, schon lange bevor sie geheiratet haben, aschfahl war. Allein Chaya hat die Färbung wahren Blondes: schöne, ebenmäßige Haut und Augen in der Farbe blau gefärbten Eises. Es ist sehr selten in Williamsburg, dass jemand natürliches Blond hat, und ich weiß, dass Chaya stolz auf ihre Schönheit ist. Manchmal presse ich Zitronensaft auf meinen Kopf und reibe ihn durch meine Strähnen, in der Hoffnung, dass sie aufhellen, aber eine Veränderung ist nicht zu bemerken. Einmal habe ich Chlorbleiche auf eine Stelle aufgetragen und es hat funktioniert, aber ich hatte plötzlich Angst, dass die Leute es bemerken würden, weil es so offensichtlich war. Sein Haar zu färben, ist verboten, und ich hätte den Tratsch nicht ertragen, den es gegeben hätte, wenn auch nur irgendwer wegen meiner neuen goldenen Strähnen argwöhnisch geworden wäre.
Chaya hat Zeidi davon überzeugt, mich von ihr zu einem anderen Psychiater bringen zu lassen. Wir waren bereits bei zwei anderen, jeweils orthodoxe Juden mit Praxen in Borough Park. Der erste sagte, ich sei normal. Der zweite hat Chaya alles anvertraut, was ich gesagt hatte, also machte ich dicht und weigerte mich, noch einmal zu sprechen, sodass er schließlich aufgab. Jetzt, sagt Chaya, werde sie mich zu einer Ärztin bringen.
Ich sehe ein, dass ich einen Arzt für Verrückte aufsuchen muss. Ich nehme an, dass auch ich verrückt bin. Ich warte noch immer auf den Tag, an dem ich mit Schaum vor dem Mund erwache wie meine Großtante Esther, die Epileptikerin ist. Chaya unterstellt, dass es von der Familie meiner Mutter herstammt. Ich kann bei meinem unglücklichen genetischen Erbe gewiss kaum darauf hoffen, geistig gesund zu sein. Ich verstehe daran nur nicht, warum sie, sollten diese Ärzte wirklich helfen können, nicht auch meine Eltern zu einem geschickt haben. Und sollten sie es doch getan haben, es aber nichts geholfen hat, warum es dann bei mir helfen sollte.
Der Name der Frau lautet Shifra. Sie hat ein Papier mit einer Graphik darauf, die sie als Enneagramm bezeichnet. Es ist eine Auflistung neun unterschiedlicher Persönlichkeitstypen, und sie erklärt mir, dass man einer der neun Persönlichkeitstypen sein, zugleich aber »Flügel« in die anderen Persönlichkeiten haben kann, sodass man also die Fünf sein kann, mit Vierer- oder Sechser-Flügeln.
»Die Vier ist der Individualist«, sagt sie zu mir. »Das bist du.«
Wie schnell sie mich in eine Schublade gesteckt hat, innerhalb der ersten zehn Minuten unserer Sitzung. Und ist irgendetwas so falsch daran, ein Individuum zu sein, selbstgenügsam und eigen, wie sie sagt? Ist das die Neurose, die Chaya aus mir herauslösen möchte, damit sie mich ihr ähnlicher machen kann: rigide, diszipliniert und, in erster Linie, angepasst?
Ich stürme früh aus der Sitzung. Sicherlich wird die »Ärztin« dies als Beweis dafür nehmen, dass ich tatsächlich ein Problem bin, das es zu lösen gilt, eine aufrührerische Persönlichkeit, die es umzugestalten gilt. Ich gehe die Sixteenth Avenue auf und ab, schaue den Frauen und Mädchen dabei zu, wie sie ihre Vorbereitungseinkäufe für Shabbes erledigen. Der Geruch alten Herings steigt vom schmuddeligen Rinnstein auf, und ich rümpfe die Nase. Ich verstehe nicht, warum ich nicht auch wie diese anderen Mädchen sein kann, in die die Bescheidenheit derart eingefleischt ist, dass sie durch ihre Adern fließt. Selbst ihre Gedanken sind still und ruhig, das sehe ich. Mir aber kann man an meinem Gesicht ablesen, was ich denke. Und auch wenn ich meine Gedanken niemals laut ausspreche, so weiß doch jeder sofort, dass sie verboten sind. Und tatsächlich hege ich genau jetzt einen verbotenen Gedanken. Ich denke, dass ich nicht in den nächsten eineinhalb Stunden in Williamsburg zurückerwartet werde und dass nur wenige Blocks weiter nördlich die öffentliche Bibliothek liegt, an der ich schon so oft vorbeigekommen bin. Es ist sicherer, wenn ich mich hier, in einem Viertel, wo mich niemand kennt, hineinschleiche. Ich muss dann nicht so sehr befürchten, erkannt zu werden.
In der Bibliothek ist es so ruhig und still, dass ich fühlen kann, wie sich meine Gedanken in diesem Raum, den die hohen Decken bilden, ausbreiten. Die Bibliothekarin richtet gerade eine Auslage in der Kinderbuchabteilung her, die zum Glück leer ist. Ich liebe die Kinderbuchabteilung, da es Platz gibt, um sich hinzusetzen, und die Bücher für mich schon herausgezogen sind. Die Bibliothekarinnen lächeln immer, wenn sie mich sehen, tragen in ihren Augen eine stille Ermunterung.
Ich besitze keinen Bibliotheksausweis, also kann ich keine Bücher mit mir mit nach Hause nehmen. Ich wünschte, ich könnte es, da ich mich immer so außergewöhnlich glücklich und frei fühle, wenn ich lese, dass ich überzeugt bin, es könnte alles andere in meinem Leben erträglich machen, dürfte ich nur immer Bücher bei mir haben.
Manchmal will es scheinen, als würden die Autoren dieser Bücher mich verstehen, als hätten sie diese Geschichten mit mir vor Augen geschrieben. Wie anders wären die Ähnlichkeiten zwischen mir und den Charakteren in Roald Dahls Erzählungen zu erklären: unglückselige, frühreife Kinder, die von ihren geistlosen Familien und Kameraden verachtet und vernachlässigt werden?
Nachdem ich James und der Riesenpfirsich gelesen hatte, träumte ich davon, im Bauch einer Frucht aus Bubbys Garten davonzurollen. Es scheint mir, dass in aller Literatur, die sich um Kinder dreht, um Kinder, die wie ich merkwürdig und unverstanden sind, an einem bestimmten Punkt etwas auftaucht, um ihre Leben zu verändern, um sie in die zauberhafte Unterwelt zu befördern, der sie wirklich angehören. Und dann bemerken sie, dass ihr vorheriges Leben nur ein Fehler war, dass sie die ganze Zeit über außergewöhnlich und für größere und bessere Dinge bestimmt waren. Heimlich warte auch ich darauf, durch ein Loch hindurch ins Wunderland zu fallen oder durch die Rückwand eines Kleiderschranks nach Narnia zu gelangen. Welche anderen Möglichkeiten sollte ich in Betracht ziehen können? In dieser Welt werde ich ganz bestimmt niemals zu Hause sein.
Ich schlage vor begieriger Erwartung meine Beine über Kreuz, als ich lese, wie Matilda eines Tages in der Schule ihre Macht an jenem ausweglosen Wendepunkt entdeckt, den jede Geschichte zu haben scheint, wo alle Hoffnung verloren geglaubt ist, sich dann aber plötzlich an unerwarteter Stelle doch wieder zeigt. Werde auch ich eines Tages herausfinden, dass ich eine Macht besitze, die mir bislang verborgen blieb? Ruht sie auch genau jetzt schlafend in mir? Dann würde sich all dies zusammenfügen, wenn ich wie Matilda wäre und zu guter Letzt eines Tages mit Miss Honey zurück nach Hause ginge.
In Kinderbüchern gibt es immer ein Happy End. Da ich noch nicht begonnen habe, Bücher für Erwachsene zu lesen, habe ich schließlich diesen Grundsatz auch als Tatsache des Lebens selbst akzeptiert. In der Physik der Vorstellungskraft gilt folgende Regel: Ein Kind kann nur und ausschließlich eine gerechte Welt akzeptieren. Ich habe lange Zeit darauf gewartet, dass jemand auftaucht und mich rettet, genau wie in den Geschichten. Es war eine bittere Pille, die ich zu schlucken hatte, als ich feststellte, dass niemand je den gläsernen Schuh aufheben würde, den ich zurückgelassen habe.
Eyn leydiger Keileh klingt hoych. Das ist der Spruch, den ich andauernd zu hören bekomme, von Chaya, von den Lehrerinnen an der Schule, von den jiddischen Lehrbüchern. Je lauter eine Frau, desto wahrscheinlicher ist sie geistig beraubt, wie eine leere Schale, die mit nachhallendem Echo vibriert. Ein volles Behältnis erzeugt keinen Klang; es ist so dicht gefüllt, dass es nicht klingt. Es gibt unzählige Sprichwörter, die mir in meiner Kindheit immer wieder vorgesagt werden, dieses aber schmerzt am meisten.
Ich versuche es zwar, kann aber meinem natürlichen Impuls zu widersprechen nicht widerstehen. Es ist nicht gerade klug, ich weiß, dass ich stets das letzte Wort haben will. Das endet in einer Welt voller Ärger, vor der ich mich einfach hüten könnte, wenn ich nur lernen würde, ruhig zu bleiben. Und doch kann ich den Fehler eines anderen nicht unbemerkt vorüberziehen lassen. Ich muss die grammatikalischen Schnitzer und falschen Zitate meiner Lehrerinnen aus einer unerklärbaren Wahrheitspflicht heraus einfach kommentieren. Dieses Verhalten hat mich gebrandmarkt als Mechizef, als Übermütige.
Ich besuche inzwischen die Satmar-Schule. Chaya hat entschieden, in welche Klasse ich zu stecken sei; sie ist die Leiterin der Unterstufenabteilung. Die anderen Schülerinnen waren zunächst eifersüchtig, da sie annahmen, ich wäre unendlich begünstigt, in Wahrheit aber ist es eine zusätzliche Möglichkeit für Chaya, mich weiterhin überwachen und meinen Großeltern Bericht erstatten zu können. Sie sagt, sie würde mich in die Klasse für die Schlauen geben, damit ich mich herausgefordert fühlen würde. Es gibt zwölf sechste Klassen, und jede einzelne ist bekannt für eine besondere Eigenschaft. Die Mädchen meiner Klasse sind engagiert und fleißig und verstehen meinen Wunsch nach Aufregung nicht.
Ich klopfe mit meinem Stift leise auf mein Pult, während die Lehrerin den Abschnitt der Torah für diese Woche erarbeitet. Ich kann das einfach nicht ertragen, ihr stundenlang zuhören zu müssen bei ihrem langatmigen Reden in ihrer gewohnt monotonen Stimme. Wenn sie sich doch nur bemühen würde, es etwas packender zu gestalten, damit es mir nicht so schwerfallen müsste, still zu sitzen. Aber gut, wenn sie nicht für Aufregung sorgen will, dann werde ich das machen.
Zwei Wochen ist es her, dass jemand eine tote Maus unter dem Heizkörper entdeckte. Der pure Wahnsinn brach aus, da alle zugleich versuchten, aus dem Klassenzimmer zu gelangen. Der Gestank war überwältigend. Ich weiß noch, wie Chaya aus ihrem Büro in der vierten Etage herunterkam, um nachzusehen, woher der Tumult rührte. Sie ging langsam auf das hintere Ende des Klassenzimmers zu, die eckigen Absätze ihrer Pumps hallten laut vom hölzernen Boden wider, ihre Arme lagen hinter ihrem extrem aufrechten Rücken gekreuzt. Sie schlug den Schal, der ihre kurze blonde Perücke bedeckte, über ihre Schulter, bevor sie sich niederbeugte, um unter den Heizkörper zu sehen. Als sie sich wieder aufrichtete, hing von ihrer behandschuhten Hand ein vertrockneter grauer Klumpen herab. Neben mir schluckte jemand einen Schrei hinunter. Chaya ließ die tote Kreatur in einen Plastikbeutel mit Zippverschluss fallen, hielt ihre Lippen geschürzt und ihre Augenbrauen vor Verachtung hochgezogen. Selbst die Lehrerin sah sichtbar aufgewühlt aus, ihr Gesicht war weiß. Ich war die Einzige, die nicht vor Überraschung baff war.
Ich kann mir meine Tante nicht erklären. Sie ist keine Blutsverwandte meiner Familie und über ihre Vergangenheit weiß ich wenig. Ich weiß nur, dass ihre Kinder, so wie sie, merkwürdig sind. Sie haben alle das gleiche kalte Benehmen, die gleiche strenge Körperhaltung und Gesinnung. Und deshalb ist sie stolz auf sie und möchte auch mich so haben. Es ist, als ginge sie davon aus, dass ich niemals Schmerz empfinden und also fähig sein würde, mich so zu verhalten, wie es von mir erwartet wird. Manchmal denke ich, sie hat recht. Aber ich bin nicht bereit, auch nur die Möglichkeit von Freude aus meiner Existenz zu verbannen und so zu leben wie sie, also jegliche eigene Regung aufzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass meine Fähigkeit, tief zu empfinden, mich außergewöhnlich macht und dass sie meine Fahrkarte ins Wunderland ist. Jeden Tag nun könnte auf meinem Nachttischchen eine Tinktur stehen mit dem Hinweis »Trink mich«. Bis das aber geschieht, sitze ich in diesem Klassenzimmer fest. Ich muss einen Weg finden, um die Zeit schneller vergehen zu lassen.
Wenn doch nur eine weitere Maus entdeckt würde. Wie mein Stift so auf das Pult klopft, kommt mir eine Idee, die wie ein wunderbarer Schauer meine Wirbelsäule emporschießt. Was, wenn – nein, das könnte ich wohl nicht. Aber vielleicht – nein, das Risiko ist zu groß. Zu behaupten, da wäre eine Maus, wo keine ist? Aber wenn ich es durchzöge, wer könnte schon auf mich verweisen? Wäre es abwegig, beim Anblick einer über den Boden huschenden Maus alarmiert zu sein? Man kann es wohl kaum vorsätzlich nennen. Meine Gliedmaßen kribbeln inzwischen in nervöser Vorfreude. Wie könnte ich diesen Streich umsetzen? Das ist es – ich werde meinen Stift fallen lassen. Dann, wenn ich mich niederbeuge, um ihn aufzuheben, werde ich auf meinen Stuhl springen und vor Entsetzen schreien. Ich werde »Maus!« ausrufen, und das wird reichen.
Mein Magen schwankt, als ich langsam den Stift an den Rand meines Pults rolle, ihm zusehe, wie er auf den Boden scheppert, und dabei sicherstelle, dass ich so gelangweilt und verschlafen wie möglich erscheine. Ich reiche hinunter unter mein Pult, um ihn aufzuheben, und für einen Augenblick halte ich dort inne, ein Moment zögerlicher Folter, bevor ich hoch auf meinen Stuhl springe. »Aaaah!«, schreie ich. »Eine Maus! Ich hab eine Maus gesehen!«
Augenblicklich ist das Klassenzimmer belebt von Kreischen, als die Mädchen auf ihre Tische springen, in der Hoffnung, dem bedrohlichen Nager zu entkommen. Selbst die Lehrerin sieht erschrocken aus. Sie schickt die Klassenaufseherin, um den Hausmeister zu holen. In der Zwischenzeit wird es keinen Unterricht geben, bis der Hausmeister das Klassenzimmer untersucht hat und es für mäusefrei erklärt, was er, wie ich weiß, tun wird.
Dennoch befragt er mich, um herauszufinden, welchen Weg die Maus eingeschlagen haben könnte, um das Loch zu entdecken, durch das sie verschwunden sein mochte, und keinen Moment kommt er auf die Idee, meine Behauptung anzuzweifeln. Liegt es daran, dass er sich unmöglich vorstellen kann, dass ein gutes Satmarer Mädchen einen solchen Streich ausheckt? Oder liegt es daran, dass die Furcht und der Schock auf meinem Gesicht zum Teil wahr sind? Selbst ich bin von meinem eigenen Wagemut bestürzt.
In der Pause versammeln sich meine Klassenkameradinnen, von grässlicher Neugier gepackt, um mich herum, wollen jedes kleine Detail der Sichtung wissen. »Dein Gesicht war so weiß!«, merken sie an. »Du sahst echt erschrocken aus.« Was ich doch für eine Schauspielerin bin. Ein weißes Gesicht und zitternde Hände, perfekt zu meinem Aufschrei passend. Nicht auszudenken, was ich mit einer Begabung wie dieser anstellen könnte – die Fähigkeit, andere von Gefühlen zu überzeugen, die ich nicht wirklich fühle. Es ist ein erregender Gedanke.
Später, als Bubby und Zeidi durch Chaya von dem Vorfall hören, lachen sie darüber. Nur Chaya dreht sich mir mit argwöhnischem Blick zu, sagt aber nichts. Es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl von Triumph habe, und ich begegne ihrem Blick ganz ruhig. Dies also ist meine Macht. Vielleicht kann ich die Dinge nicht mit meinem Geist bewegen, wie Matilda es kann, aber ich kann so tun als ob; ich kann mich derart überzeugend verhalten, dass niemand je die Wahrheit zu entdecken vermag.
»Bubby, was bedeutet virgin?«
Bubby blickt vom gusseisernen Tisch, wo sie Teig für Kreplech