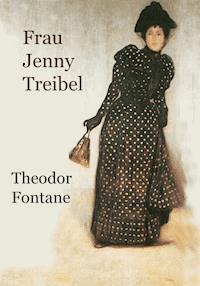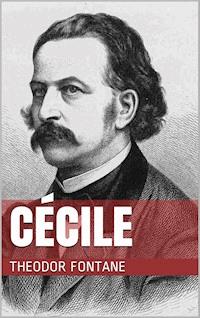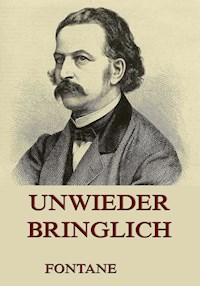
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman spielt in den Jahren 1859 bis 1861 in Schleswig, das damals zwar als selbstständige Einheit, aber als Teil des Deutschen Bundes von Dänemark aus regiert wurde - wenige Jahre vor dem Deutsch-Dänischen Krieg, sowie in Kopenhagen und auf Schloss Frederiksborg. Graf Helmuth Holk und seine Frau Christine leben mit ihren zwei Kindern in einem einsamen Schloss an der Flensburger Förde. Christine wird als eine fromme Frau von hohen moralischen Ansprüchen geschildert, Holk dagegen als ein eher unreflektierter und lebensfroher Mann, der seine vom Herrnhutertum beeinflusste Frau zwar bewundert, aber unter ihrer Grundsatzstrenge leidet ... (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unwiederbringlich
Theodor Fontane
Inhalt:
Theodor Fontane – Biografie und Bibliografie
Unwiederbringlich
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Unwiederbringlich, T. Fontane
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849613099
www.jazzybee-verlag.de
Theodor Fontane – Biografie und Bibliografie
Dichter und Essayist, geb. 30. Dez. 1819 in Neuruppin, gest. 20. Sept. 1898 in Berlin, war, ursprünglich zum Apotheker bestimmt, 1840–43 in der Neubertschen und Struveschen Apotheke in Leipzig und Dresden tätig und machte während dieser Zeit wichtige literarische Bekanntschaften. 1844 bereiste er England, ließ sich dann in Berlin nieder, wo er sich seit 1849 ausschließlich literarischer Tätigkeit widmete. 1852 unternahm er eine zweite Reise nach England, um die altenglische Balladenliteratur an Ort und Stelle zu studieren; es entstand daraus: »Ein Sommer in London« (Dessau 1854). Ein dritter Aufenthalt da selbst (1855–59) war dem Studium der englischen Theater, Kunst und Literatur gewidmet; seine Frucht war: »Aus England. Studien und Briefe« (Stuttg. 1860) und »Jenseits des Tweed. Bilder und Briefe aus Schottland« (Berl. 1860, zusammen mit »Ein Sommer in London« nach Fontanes Tod neu herausgegeben u. d. T.: »Aus England und Schottland«, das. 1899). Von 1860–70 war F. Redakteur des englischen Teiles an der »Neuen Preußischen Zeitung«, daneben durchreiste er seine Heimat, die Mark Brandenburg, durchforschte ihre Städte, Dörfer, Klöster und Schlachtfelder, woraus seine klassischen, in vielen Auflagen erschienenen »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« (Berl. 1862–82, 4 Bde.) entstanden. Später beschrieb er die Waffenerfolge des preußischen Heeres in Schleswig und Böhmen: »Der schleswig-holsteinische Krieg im Jahr 1864« (Berl. 1866) und »Der deutsche Krieg von 1866« (das. 1869–71, 2 Bde.; 2. Aufl. 1871), besuchte 1870 den Kriegsschauplatz in Frankreich und wurde Anfang Oktober in Domremy von Franktireurs gefangen genommen und erst nach drei Monaten vieler Leiden wieder freigelassen. Seine Erlebnisse schilderte er mit ergreifender Kunst in dem Werke: »Kriegsgefangen. Erlebtes 1870« (Berl. 1871, 6. Aufl. 1904). Später schrieb er: »Aus den Tagen der Okkupation; eine Osterreise durch Nordfrankreich und Elsaß-Lothringen« (Berl. 1872, 2 Bde.); »Der Krieg gegen Frankreich 1870–1871« (das. 1874–76, 2 Bde.). Auch als origineller Theaterkritiker (für die Vossische Zeitung) genoss F. großes Ansehen (1870–1890). Wegen seiner Verdienste um die deutsche Dichtkunst wurde ihm 1891, da der Schillerpreis nicht verteilt werden konnte, vom deutschen Kaiser eine Prämie von 3000 Mark verliehen. 1894 ernannte ihn die philosophische Fakultät der Berliner Universität zum Ehrendoktor. Als Dichter ist F. schon 1851 mit »Gedichten« (8. Aufl., Stuttg. 1902) hervorgetreten, doch ist er erst im Alter zu größeren Erfolgen als Erzähler gelangt. Seine »Balladen« (Berl. 1861) zeichnen sich durch große Kraft in der knappsten sprachlichen Form aus. Seine lyrische Muse ist spröde und weich zugleich, darum trifft sie den Soldatenton so gut. Sein origineller Prosastil ist von großer Anschaulichkeit, natürlich und farbenreich. F. erzählt realistisch treu bis zur Rücksichtslosigkeit und doch voller Gemüt. Er wird herb, um ja nicht sentimental zu erscheinen, sein Humor ist echt plattdeutsch. In seinen Erzählungen hat er alle Gesellschaftsschichten Norddeutschlands geschildert; die hervorragendsten sind: »Vor dem Sturm«, Roman aus dem Winter 1812–13 (Berl. 1878, 4 Bde., 3. Aufl. 1898); die Novellen: »Grete Minde« (das. 1880), »Ellernklipp« (das. 1881), »L'Adultera« (Bresl. 1882, 4. Aufl. 1903), »Schach von Wuthenow« (Leipz. 1883, 4. Aufl. 1901); die Romane: »Graf Petöfy« (4. Aufl., das. 1903), »Unterm Birnbaum« (Berl. 1885), »Cecile« (das. 1887, 3. Aufl. 1900), »Irrungen, Wirrungen« (das. 1888, 8. Aufl. 1902), »Stine« (das. 1890, 4. Aufl. 1901),»Quitt« (das. 1891), »Unwiederbringlich« (das. 1891, 4. Aufl. 1902), »Frau Jenny Treibel« (das. 1892, 7. Aufl. 1903), »Effi Briest« (das. 1895, 11. Aufl. 1902), »Die Poggenbühls« (das. 1896, 6. Aufl. 1902) und »Der Stechlin« (das. 1899, 10. Aufl. 1903), »Von, vor und nach der Reise«, Plaudereien und kleine Geschichten (das. 1893). Ferner schrieb er: »Christ. Friedr. Scherenberg und das literarische Berlin von 1840–1860« (Berl. 1885) und »Meine Kinderjahre«, autobiographischer Roman (das. 1894, 4. Aufl. 1903), dazu als Fortsetzung: »Von Zwanzig bis Dreißig« (das. 1898). Die »Gesammelten Romane und Novellen« Fontanes erschienen in 12 Bänden (Berl. 1890–91). Aus seinem Nachlass gab Schlenther »Causerien über Theatereindrücke« heraus (Berl. 1904). Vgl. Servaes, Theo dor F. (Berl. 1900); Erich Schmidt, Charakteristiken, Bd. 2 (das. 1901).
Unwiederbringlich
Erstes Kapitel
Eine Meile südlich von Glücksburg, auf einer dicht an die See herantretenden Düne, lag das von der gräflich Holkschen Familie bewohnte Schloß Holkenäs, eine Sehenswürdigkeit für die vereinzelten Fremden, die von Zeit zu Zeit in diese wenigstens damals noch vom Weltverkehr abgelegene Gegend kamen. Es war ein nach italienischen Mustern aufgeführter Bau, mit gerade so viel Anklängen ans griechisch Klassische, daß der Schwager des gräflichen Hauses, der Baron Arne auf Arnewiek, von einem nachgeborenen »Tempel zu Pastum« sprechen durfte. Natürlich alles ironisch. Und doch auch wieder mit einer gewissen Berechtigung. Denn was man von der See her sah, war wirklich ein aus Säulen zusammengestelltes Oblong, hinter dem sich der Unterteil des eigentlichen Baues mit seinen Wohn- und Repräsentationsräumen versteckte, während das anscheinend stark zurücktretende Obergeschoß wenig über mannshoch über die nach allen vier Seiten hin eine Vorhalle bildende Säuleneinfassung hinauswuchs. Diese Säuleneinfassung war es denn auch, die dem Ganzen wirklich etwas Südliches gab; teppichbedeckte Steinbänke standen überall die Halle entlang, unter der man beinahe tagaus, tagein die Sommermonate zu verbringen pflegte, wenn man es nicht vorzog, auf das Flachdach hinaufzusteigen, das freilich weniger ein eigentliches Dach als ein ziemlich breiter, sich um das Obergeschoß herumziehender Gang war. Auf diesem breiten, flachdachartigen Gange, den die Säulen des Erdgeschosses trugen, standen Kaktus- und Aloekübel, und man genoß hier, auch an heißesten Tagen, einer vergleichsweise frischen Luft. Kam dann gar vom Meer her eine Brise, so setzte sie sich in das an einer Maststange schlaff herabhängende Flaggentuch, das dann mit einem schweren Klappton hin- und herschlug und die schwache Luftbewegung um ein geringes steigerte.
Schloß Holkenäs hatte nicht immer auf dieser Düne gestanden, und noch der gegenwärtige Graf, als er sich, siebzehn Jahre zurück, mit der schönen Baronesse Christine Arne, jüngsten Schwester seines Gutsnachbarn Arne, vermählte, war damals in die bescheidenen Räume des alten und eigentlichen Schlosses Holkenäs eingezogen, das mehr landeinwärts in dem großen Dorfe Holkeby lag, gerade der Holkebyer Feldsteinkirche gegenüber, die weder Chor noch Turm hatte. Das alte Schloß, ebenso wie die Kirche, ging bis ins vierzehnte Jahrhundert zurück, und ein Neubau war schon unter des Grafen Großvater geplant worden. Aber erst der gegenwärtige Graf, der, neben anderen kleinen Passionen, auch die Baupassion hatte, hatte den Plan wieder aufgenommen und bald danach das viel beredete und bespöttelte, aber freilich auch viel bewunderte Schloß auf der Düne entstehen lassen, in dem sich's nicht bloß schöner, sondern vor allem auch bequemer wohnte. Trotzdem war der Gräfin eine nicht zu bannende Vorliebe für das alte, mittlerweile zum Inspektorhause degradierte Schloß geblieben, eine Vorliebe, so groß, daß sie nie daran vorüberging, ohne der darin verbrachten Tage mit einem Anfluge von Wehmut zu gedenken. Denn es war ihre glücklichste Zeit gewesen, Jahre, während welcher man sich immer nur zur Liebe gelebt und noch keine Meinungsverschiedenheiten gekannt hatte. Hier, in dem alten Schlosse, gegenüber der Kirche, waren ihnen ihre drei Kinder geboren worden, und der Tod des jüngsten Kindes, eines Knaben, den man Estrid getauft hatte, hatte das schöne und jugendliche Paar einander nur noch nähergeführt und das Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit gesteigert.
All das war seit der Übersiedelung in das neue Schloß nicht ganz so geblieben, von welchem Wandel der Dinge die bei den Herrnhutern erzogene, zudem von Natur schon gefühlvoll gestimmte Gräfin eine starke Vorahnung gehabt hatte, so stark, daß ihr ein bloßer Um- und Ausbau des alten Schlosses und somit ein Verbleiben an alter Stelle das weitaus Liebere gewesen wäre, der Graf aber trug sich enthusiastisch und eigensinnig mit einem »Schloß am Meer« und deklamierte gleich bei dem ersten Gespräch, das er mit der Gräfin in dieser Angelegenheit hatte:
»Hast du das Schloß gesehen?
Das hohe Schloß am Meer?
Golden und rosig wehen
Die Wolken drüber her –«
ein Zitat, das freilich bei derjenigen, die dadurch günstig gestimmt und für den Plan gewonnen werden sollte, nur den entgegengesetzten Eindruck und nebenher eine halb spöttische Verwunderung hervorgerufen hatte. Denn Holk war ziemlich unliterarisch, was niemand besser wußte als die Gräfin.
»Wo hast du das her, Helmuth?«
»Natürlich aus Arnewiek. Bei deinem Bruder drüben hängt ein Kupferstich, und da stand es drunter. Und ich muß dir sagen, Christine, es gefiel mir ganz ungemein. Ein Schloß am Meer! Ich denke es mir herrlich und ein Glück für dich und mich.«
»Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen. Und dann, Helmuth, daß du gerade das zitieren mußtest. Du kennst, wie ich glaube, nur den Anfang dieses Uhlandschen Liedes... es ist nämlich von Uhland, verzeih..., aber es verläuft nicht so, wie's beginnt, und am Schlusse kommt noch viel Trauriges:
Die Winde, die Wogen alle
Lagen in tiefer Ruh,
Einem Klagelied aus der Halle
Hört ich mit Tränen zu...
Ja, Helmuth, so schließt es.«
»Vorzüglich, Christine. Gefällt mir auch«, lachte Holk. »Und von Uhland, sagst du. Allen Respekt davor. Aber du wirst doch nicht verlangen, daß ich mein ›Schloß am Meer‹ nicht bauen solle, bloß weil aus einem erdichteten Schloß am Meer, auch wenn von Uhland erdichtet, ein Klagelied aus der Halle klang?«
»Nein, Helmuth, das verlang ich nicht. Aber ich bekenne dir offen, ich bliebe lieber hier unten in dem alten Steinhause mit seinen Unbequemlichkeiten und seinem Spuk. Der Spuk bedeutet mir nichts, aber an Ahnungen glaub ich, wiewohl die Herrnhuter auch davon nichts wissen wollen, und werden wohl auch recht damit haben. Trotzdem, man steckt nun mal in seiner menschlichen Schwachheit, und so bleibt einem manches im Gemüt, was man mit dem besten Spruche nicht loswerden kann.«
So war damals das Gespräch gegangen, auf das man nicht wieder zurückkam, ein einziges Mal ausgenommen, wo beide (die Sonne war schon unter) die Düne hinaufstiegen, um nach dem Neubau, der inzwischen begonnen hatte, zu sehen. Und als sie oben waren, lächelte Holk und wies auf die Wolken, die gerade »golden und rosig« über ihnen standen.
»Ich weiß, was du meinst«, sagte die Gräfin.
»Und...«
»Ich habe mich inzwischen meiner widerstreitenden Wünsche begeben. Damals, als du zuerst von dem Neubau sprachst, war ich trüben Gemüts; du weißt weshalb. Ich konnte das Kind nicht vergessen und wollte der Stelle nahe sein, wo es liegt.«
Er küßte ihr die Hand und gestand ihr dann, daß ihre Worte während ihres damaligen Gesprächs doch einen Eindruck auf ihn gemacht hätten. »Und nun bist du so gut. Und wie schön du dastehst in dem goldenen Abendrot. Ich denke, Christine, wir wollen hier glücklich sein. Willst du?«
Und sie hing sich zärtlich an seinen Arm. Aber sie schwieg.
Das war das Jahr vor Abschluß des Baues gewesen, und bald danach, weil's in dem alten Schloß unten immer unwohnlicher wurde, war Holk mit seinem Schwager übereingekommen, Christine und die Kinder nach Arnewiek zu schicken und sie daselbst bis nächste Pfingsten, um welche Zeit alles fertig sein sollte, zu belassen.
Und das war denn auch geschehen.
Und nun kam Pfingsten heran, und der Tag zur Beziehung des neuen Schlosses war da. Der Garten am Rückabhange der Düne zeigte sich freilich nur halb bepflanzt, und überhaupt war vieles erst im Werden. Aber eines war doch fertig geworden: die schmale, säulenumstellte Front nach dem Meere zu. Hier waren schon Bosquets und Blumenrondels, und weiter hin, wo sich die Düne nach vorn zu senken begann, stieg eine Treppenterrasse zum Strande hinunter und setzte sich unten in einer Stegbrücke fort, die, weit ins Meer hinaus gebaut, zugleich als Anlegestelle für die zwischen Glücksburg und Kopenhagen fahrenden Dampfer dienen sollte.
Christine war voller Bewunderung und Freude, weit über ihr eigenes Erwarten hinaus, und als sie, nach einem Umgang um das Haus, das Flachdach erstiegen hatte, vergaß sie angesichts des sich vor ihr ausbreitenden herrlichen Panoramas alles, was sich auch nach der vorjährigen Aussöhnung mit dem Neubau noch immer wieder von Sorgen und Ahnungen in ihrer Seele geregt hatte; ja, sie rief die Kinder, die noch unten an der Terrasse standen, herbei, daß sie mit teilnehmen möchten an ihrer Freude. Holk sah ihre tiefe Bewegung und wollte sprechen und ihr danken. Sie kam ihm aber zuvor und sagte:
»Bald ist es ein Jahr nun, Helmuth, daß wir zuletzt hier auf der Düne standen und du mich fragtest, ob ich hier glücklich sein wolle. Ich schwieg damals...«
»Und heute?«
»Heute sag ich ja.«
Zweites Kapitel
So schloß der Tag, an dem die Gräfin in das neue Schloß einzog. Einige Wochen später war auch eine Freundin aus den zurückliegenden Gnadenfreier Pensionstagen her auf Holkenäs eingetroffen, Julie von Dobschütz, ein armes Fräulein, bei deren Einladung zunächst nur an einen kurzen Sommerbesuch gedacht worden war. Bald aber regte sich der Wunsch, das Fräulein als Gesellschafterin, Freundin und Lehrerin im Hause verbleiben zu sehen, ein Wunsch, den Holk teilte, weil ihn Christinens Einsamkeit mitunter bedrückte. So blieb denn die Dobschütz und übernahm den Unterricht Astas und Axels, der beiden Kinder des Hauses. Asta ward ihr auch weiterhin anvertraut. Axel aber wechselte mit dem Unterrichte, als Kandidat Strehlke ins Haus kam.
Das alles lag jetzt sieben Jahre zurück, Graf und Gräfin hatten sich eingewöhnt, und die »glücklichen Tage«, die man dort oben leben wollte, man hatte sie wirklich gelebt. Die herzlichste Neigung, die beide vor einer Reihe von Jahren zusammengeführt hatte, bestand fort, und wenn es namentlich in Erziehungs-und religiösen Fragen auch gelegentlich zu Differenzen kam, so waren sie doch nicht angetan, den Frieden des Hauses ernstlich zu gefährden. An solchen Differenzen war nun freilich neuerdings, seit die Kinder herangewachsen, kein Mangel gewesen, was bei der Verschiedenheit der Charaktere von Graf und Gräfin nicht wundernehmen konnte. Holk, so gut und vortrefflich er war, war doch nur durchschnittsmäßig ausgestattet und stand hinter seiner Frau, die sich höherer Eigenschaften erfreute, um ein beträchtliches zurück. Darüber konnte kein Zweifel sein. Aber daß es so war, was niemand mehr einsah als Holk selber, war doch auch wieder unbequem und bedrücklich für ihn, und es kamen Momente, wo er unter den Tugenden Christinens geradezu litt und sich eine weniger vorzügliche Frau wünschte. Früher war dies alles nur stiller Wunsch gewesen, kaum zugestanden, seit einiger Zeit aber hatte der Wunsch doch auch sprechen gelernt; es kam zu Auseinandersetzungen, und wenn Julie Dobschütz, die geschickt zu diplomatisieren verstand, auch meist leichtes Spiel bei Begleichung derartiger Streitigkeiten hatte, so blieb doch das eine nicht aus, daß Christine, die das alles geahnt, mit einer Art Wehmut der Tage im alten Schloß gedachte, wo dergleichen nicht vorgekommen war oder doch jedenfalls viel, viel seltener.
Nun war Ende September 1859 und die Ernte längst herein. Die ringsherum unter dem Säulengange nistenden Schwalben waren fort, eine Brise ging, und das Flaggentuch oben auf dem Flachdache schlug träge hin und her. Man saß unter der Fronthalle, den Blick aufs Meer, den großen Eßsaal, dessen hohe Glastür aufstand, im Rücken, während die Dobschütz den Kaffee bereitete. Neben der Dobschütz, an einem anderen Tisch, hatte die Gräfin Platz genommen im Gespräch mit dem Seminardirektor Schwarzkoppen, der vor einer halben Stunde mit Baron Arne von Arnewiek herübergekommen war, um des schönen Tages in dem gastlichen Holkschen Hause zu genießen. Arne selbst schritt mit seinem Schwager Holk auf den Steinfliesen auf und ab und blieb mitunter stehen, weil das Bild vor ihm ihn fesselte: Fischerboote fuhren zum Fange hinaus, das Meer kräuselte sich leis, und der Himmel hing blau darüber. Keine Wolke war sichtbar, und nichts sah man als die schwarz am Horizont hinziehende Rauchfahne eines Dampfers.
»Du hattest doch recht, Schwager«, sagte Arne, »als du hier hinaufzogst und dir deinen ›Tempel‹ an dieser Stelle bautest. Ich war damals dagegen, weil mir Ausziehen und Wohnungswechsel als etwas Ungehöriges erschien, als etwas Modernes, das sich...«
»... das sich nur für Proletarier und Beamte schicke, so sagtest du damals.«
»Ja, so was Ähnliches wird es wohl gewesen sein. Aber ich habe mich inzwischen in manchem bekehrt und auch darin. Indessen es sei, wie's sei, soviel steht mir fest, wenn ich auch politisch und kirchlich, und selbst landwirtschaftlich, was für unsereinen doch eigentlich immer die Hauptsache bleibt, derselbe geblieben wäre, das müßt ich doch einräumen, es ist entzückend hier oben und so windfrisch und gesund. Ich glaube, Holk, als du hier einzogst, hast du dir fünfzehn Jahre Leben zugelegt.«
In diesem Augenblicke ward ihm von einem alten Diener in Gamaschen, der noch vom Vater des Grafen her mit übernommen war, der Kaffee präsentiert, und beide nahmen und tranken.
»Deliziös«, sagte Arne. »Freilich etwas zu gut, besonders für dich, Holk; solcher Kaffee wie der zieht wieder fünf Jahre von den fünfzehn ab, die ich dir eben zugesprochen, und die philiströse, wenn auch höchst bemerkenswerte Homöopathie, die, wie du weißt, von Mokka und Java nichts wissen will, würde vielleicht noch stärker subtrahieren. Apropos Homöopathie. Hast du denn schon von dem homöopathischen Veterinärarzt gehört, den wir seit ein paar Wochen in Lille-Grimsby haben...?«
Und langsam auf und ab schreitend, fuhren beide Schwäger in ihrem Gespräche fort.
Ein sehr anderes Thema behandelte mittlerweile die Gräfin in ihrer Unterredung mit Seminardirektor Schwarzkoppen, der vor Jahr und Tag erst aus seiner Wernigeroder Pfarre hierher nach Schleswig-Holstein verschlagen und an das Arnewieker Seminar berufen worden war. Er hatte den Ruf und das Ansehen einer positiven kirchlichen Richtung, was der Gräfin aber fast mehr bedeutete, war das, daß Schwarzkoppen zugleich Autorität in Schul- und Erziehungsfragen war, in Fragen also, die sich seit kurzem zu brennenden Fragen für die Gräfin gestaltet hatten. Denn Asta war sechzehn, Axel beinahe fünfzehn Jahre. Schwarzkoppen, auch eben jetzt wieder in dieser diffizilen Frage zu Rate gezogen, antwortete sehr vorsichtig, und als die Gräfin merkte, daß er, vielleicht mit Rücksicht auf Holk, nicht unbedingt auf ihre Seite treten wollte, ließ sie das Gespräch wieder fallen, wenn auch ungern, und wandte sich einem anderen schon öfter mit dem Direktor verhandelten Lieblingsplane zu, der Errichtung einer Familiengruft.
»Nun, wie steht es damit?« sagte Schwarzkoppen, der froh war, aus der Erziehungsfrage heraus zu sein.
»Ich habe«, sagte Christine, »die Sache noch immer nicht besprechen mögen, weil ich mich vor einer Ablehnung von seiten Holks fürchte.«
»Das ist nicht gut, gnädigste Gräfin. Solche Furcht ist immer vom Übel, sie will dem Frieden dienen, aber eigentlich dient sie nur der Verstimmung und dem Kriege. Und zu beidem ist kein Grund. Sie müssen, wenn bessere Beweggründe nicht zu haben sind, auf seine Liebhabereien rechnen. Hat er doch, wie Sie mir selber oft versichert, die Baupassion.«
»Ja, die hat er«, bestätigte die Gräfin. »Dies Schloß ist dessen ein Zeugnis und Beweis, denn es war eigentlich unnötig; ein Umbau hätte dasselbe getan. Aber so gerne er baut, so bevorzugt er doch das eine vor dem anderen, und was ich vorhabe, wird seinen Beifall kaum haben. Ich wette, daß er lieber eine Halle bauen würde, darin man Federball spielen kann oder, wie das jetzt Mode ist, auf Rollschuhen Schlittschuh laufen, jedenfalls alles lieber als irgendwas, was mit Kirche zusammenhängt. Und nun gar eine Gruft bauen. Er denkt nicht gern an Sterben und schiebt das, was man so schön und sinnig ›sein Haus bestellen‹ heißt, gerne hinaus.«
»Ich weiß«, sagte Schwarzkoppen. »Aber Sie dürfen nicht vergessen, daß auch all seine liebenswürdigen Eigenschaften mit dieser Schwäche zusammenhängen.«
»Seine liebenswürdigen Eigenschaften«, wiederholte sie. »Ja, die hat er, fast zuviel, wenn man von liebenswürdigen Eigenschaften je zuviel haben kann. Und wirklich, er wäre das Ideal von einem Manne, wenn er überhaupt Ideale hätte. Verzeihen Sie diese Wortspielerei, sie drängt sich mir aber auf, weil es so und nicht anders liegt, und ich muß es noch einmal sagen, er denkt nur an den Augenblick und nicht an das, was kommt. Jeglichem, was ihn daran erinnern könnte, geht er aus dem Wege. Seit wir unseren Estrid begruben, ist er noch nicht in der Gruft gewesen. So weiß er auch nicht, daß beinahe alles einzustürzen droht. Und doch ist es so, und die neue Gruft muß gebaut werden. Muß, sag ich, und wenn ich nicht alles Spitze und Verletzliche vermeiden möchte, so würd ich ihm sagen, es handle sich gar nicht darum, den Reigen durch ihn eröffnet zu sehen, ich wolle es...«
Schwarzkoppen wollte unterbrechen, aber Christine achtete dessen nicht und fuhr, ihre letzten Worte wiederholend, fort: »Ich wolle es; aber ich müsse darauf bestehen, meinerseits in eine Wohnung einzuziehen, die mir gefiele, nicht in eine, darin alles zerbröckelt und zerfallen sei... Doch lassen wir Vermutungen über das, was ich sagen oder nicht sagen würde; mir liegt für den Augenblick mehr daran, Ihnen eine auf meinen Bauplan bezügliche Aquarelle vorzulegen, die mir die Dobschütz in den letzten Tagen angefertigt hat. Natürlich auf meinen Wunsch; sie zeichnet so gut. Es ist eine offene Halle, gotisch, und die Steine, die den Fußboden bilden, decken zugleich die Gruft. Worauf ich aber das meiste Gewicht lege (die kleine Zeichnung läßt natürlich nur wenig davon erkennen), das ist der Bilderschmuck an Wand und Decke. Die Längswand mit einem Totentanz, vielleicht unter Anlehnung an den in Lübeck, und in die Gewölbekappen Engel und Palmenzweige. Je schöner, desto besser. Und wenn wir erste Künstler nicht haben können, weil unsere Mittel dafür nicht ausreichen, so zweite und dritte; schließlich ist doch, der Gedanke die Hauptsache. Liebe Julie, verzeih, daß ich dich bemühe. Aber bring uns das Blatt...«
Holk und Arne hatten inzwischen ihren Gang unter der Säulenhalle fortgesetzt und waren zuletzt auf einen Kiesweg zugeschritten, der in einer Schlängellinie bis an die nächsten Stufen der zur See niedersteigenden Terrasse lief. An eben dieser Stelle befand sich auch ein aus Zypressen und Lorbeer gebildetes Bosquet, mit einer Marmorbank in Front, und hier setzten sich die beiden Schwäger, um ungestört ihre Zigarre rauchen zu können, was die Gräfin, wenn man unter der Halle saß, zwar nie verbot, aber auch nicht eigentlich gestattete. Das Gespräch beider drehte sich sonderbarerweise noch immer um das Wunder von Tierarzt, was ziemlich unerklärlich gewesen wäre, wenn nicht Holk, außer seiner Bauleidenschaft, auch noch eine zweite Passion gehabt hätte: die für schönes Vieh. Er war kein großer Landwirt wie sein Schwager Arne, ja, tat sich was damit, es nicht zu sein; aber auf sein Vieh hielt er doch, fast nach Art eines Sportsman, und freute sich, es bewundert zu sehen und dabei von mirakelhaften Milcherträgen erzählen zu können. Aus diesem Grunde war ihm der neue Veterinärarzt eine wirklich wichtige Persönlichkeit, und nur die homöopathische Heilmethode desselben ließ immer wieder einige Bedenken in ihm aufsteigen. Aber Arne schnitt diese Bedenken ab. Das sei ja gerade das Interessanteste an der Sache, daß der neue Doktor nicht bloß gute Kuren mache, das könnten andere auch, sondern wie er sie mache und wodurch. Die ganze Geschichte bedeute nicht mehr und nicht weniger als den endlichen Triumph eines neuen Prinzips, erst von der Viehpraxis her datiere der nicht mehr anzuzweifelnde Sieg der Homöopathie. Bis dahin seien die Quacksalber alten Stils nicht müde geworden, von der Macht der Einbildung zu sprechen, was natürlich heißen sollte, daß die Streukügelchen nicht als solche heilten; eine schleswigsche Kuh aber sei, Gott sei Dank, frei von Einbildungen, und wenn sie gesund würde, so würde sie gesund durch das Mittel und nicht durch den Glauben. Arne verbreitete sich noch des weiteren darüber, zugleich hervorhebend, daß es sich bei den Kuren des neuen, beiläufig aus dem Sächsischen stammenden Doktors allerdings auch noch um andere Dinge handele, die mit Allopathie oder Homöopathie nichts Direktes zu schaffen hätten. Unter diesen Dingen stehe die durchgeführteste, schon den Luxus streifende Reinlichkeit obenan, also immer neue Stallbauten und unter Umständen selbst ein Operieren mit Marmorkrippen und vernickelten Raufen. Holk hörte das alles mit Entzücken und empfand so große Lust, mit Christine darüber zu sprechen, daß er die Zigarre wegtat und auf die Säulenhalle zurückschritt.
»Ich höre da eben interessante Dinge, Christine. Dein Bruder erzählt mir von homöopathischen Kuren eines neuen sächsischen Veterinärdoktors, der in Leipzig seine Studien gemacht hat. Ich betone Leipzig, weil es Hochburg der Homöopathie ist. Wahre Wunderkuren...! Sagen Sie, Schwarzkoppen, wie stehen Sie zu der Sache? Die Homöopathie hat so etwas Geheimnisvolles, Mystisches. Interessant genug, und in ihrer Mystik eigentlich ein Thema für Christine.«
Schwarzkoppen lächelte. »Die Homöopathie verzichtet, soviel ich weiß, auf alles Geheimnisvolle oder gar Wunderbare. Es ist einfach eine Frage von viel oder wenig und ob man mit einem Gran so weit kommen kann wie mit einem halben Zentner.«
»Versteht sich«, sagte Holk. »Und dann gibt es noch einen Satz, ›Similia similibus‹, worunter sich jeder denken kann, was er will. Und mancher denkt sich gar nichts dabei, wohin wohl auch unser tierärztlicher Pfiffikus und Mann der Aufklärung gehören wird. Er gibt seine Streukügelchen und ist im übrigen, als Hauptsache, für Stallreinlichkeit und Marmorkrippen, und ich möchte sagen, die Tröge müssen so blank sein wie ein Taufbecken.«
»Ich glaube, Helmuth, daß du deine Vergleiche rücksichtsvoller wählen könntest, schon um meinetwillen, namentlich aber in Schwarzkoppens Gegenwart.«
»Zugestanden. Übrigens alles ipsissima verba des neuen Wunderdoktors, Worte, die dein Bruder zitierte, wobei freilich nicht bestritten werden soll, daß es sich auch für den Doktor empfehlen würde, solche Vergleiche lieber nicht zu brauchen, zumal er Konvertit ist. Er heißt nämlich Lissauer.«
Schwarzkoppen und Christine wechselten Blicke.
»Wenn er übrigens auf den Hof kommt, so lad ich ihn unten in der Inspektorwohnung zum Lunch. Hier oben...«
»Ist er entbehrlich.«
»Ich weiß, und du darfst unbesorgt sein. Aber ich rechne es ihm an, daß er selbständige Gedanken hat und den Mut der Aussprache. Das mit den Marmorkrippen ist natürlich mehr oder weniger Torheit und nichts als ein orientalischer Vergleich, den man ihm zugute halten muß. Aber mit der Forderung der Reinlichkeit so ganz im allgemeinen, damit hat er doch recht. Meine Ställe, die noch sämtlich aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts sind, müssen fort, und ich freue mich, endlich eine Veranlassung und einen Sporn zu haben, mit dem alten Unwesen aufzuräumen.«
Die Gräfin schwieg und suchte mit der Nadel in den Seidenfäden, die vor ihr auf dem Tische lagen.
Den Grafen verdroß dies Schweigen. »Ich dachte, du würdest mir deine Zustimmung ausdrücken.«
»Es sind Wirtschaftssachen, in denen ich, was auch beliebt wird, nicht mitzusprechen habe. Hältst du Marmorkrippen oder ähnliches für nötig so werden sie sich finden, und wenn es in Carrara wäre.«
»Was läßt dich wieder so bitter sprechen, Christine?«
»Verzeih, Helmuth, aber es trifft sich unglücklich. Eben hab ich mit Schwarzkoppen über Dinge gesprochen, die mir mehr am Herzen liegen, übrigens auch Bausachen, und im selben Augenblick willst du Ställe bauen, Ställe...«
»Freilich will ich das. Du vergißt immer, Christine, wenn du auch nicht mitsprechen willst, wie du eben sagtest, du vergißt immer, daß ich in erster Reihe Landwirt bin, und für einen Landwirt ziemt sich eben das Landwirtschaftliche. Das Landwirtschaftliche ist die Hauptsache.«
»Nein, die Hauptsache ist es nicht.«
»Nun, was denn?«
»Es ist ein Unglück und ein Schmerz für mich, daß ich das Selbstverständliche dir gegenüber noch immer wieder hervorheben muß.«
»Ach, ich verstehe. Die Kirche soll ausgebaut werden oder ein Schwesternasyl oder ein Waisenhaus. Und dann ein Campo santo, und dann wird der ganze Cornelius aufgekauft und in Wasserfarben an die Wand gemalt...«
Es war selten, daß der Graf zu solchen Worten seine Zuflucht nahm, aber es gab ein paar Punkte, wo Verstimmung und Gereiztheit sofort über ihn kamen und ihn die feinen Umgangsformen vergessen ließen, deren er sich sonst rühmen durfte. Sein Schwager wußte das und schritt deshalb rasch ein, um das Gespräch in andere Wege zu leiten, wozu sein guter Humor ihn jederzeit befähigte.
»Schwester, Schwager, ich meinerseits denke, das eine tun und das andere nicht lassen. Da habt ihr meine Weisheit und den Frieden dazu. Zudem, Holk, du weißt noch nicht einmal, um was es sich handelt.«
Holk lachte gutmütig.
»Du weißt es nicht«, fuhr Arne fort, »und ich weiß es auch nicht, der ich doch sonst in die Geheimnisse Christinens eingeweiht zu sein pflege. Freilich, wenn mich nicht alles täuscht, so haben wir hier den Schlüssel...« Und dabei nahm er das aquarellierte Blatt, das die Dobschütz inzwischen gebracht hatte. »Charmant, von welcher Hand es auch herrühren möge. Gotik, Engel, Palmen. Soll man selbst unter diesen nicht ungestraft wandeln dürfen? Und an allem ist dieser unglückselige Veterinärarzt schuld, ein Mann in Stulpenstiefeln, an dem nichts komischer ist als die Tatsache, daß er sächsisch spricht. Er müßte eigentlich plattdeutsch sprechen, sogar mecklenburgisch. Wobei mir einfällt, wißt ihr denn schon, daß sich in Kiel und Rostock eine plattdeutsche Dichterschule gebildet hat, oder eigentlich zwei, denn die Deutschen, wenn sich irgendwas auftut, zerfallen immer gleich wieder in zwei Teile. Kaum ist das Plattdeutsche da, so haben wir auch schon wieder itio in partes, und die Mecklenburger marschieren unter ihrem Fritz Reuter und die Holsteiner unter ihrem Klaus Groth. Aber Klaus Groth hat einen Pas voraus, weil er Lyriker ist und komponiert werden kann, und davon hängt eigentlich alles ab. Kein Jahr, vielleicht kein halbes, so kommt er von keinem Klavier mehr herunter. Ich habe da schon was auf eurem Flügel liegen sehen. Asta, du könntest was von ihm singen.«
»Ich mag nichts Plattdeutsches.«
»Nun, dann singe was Hochdeutsches, aber natürlich etwas recht Hübsches und Lustiges.«
»Ich mag nichts Lustiges.«
»Nun, wenn es nichts Lustiges sein kann, dann singe was recht Trauriges. Aber es muß dann auch ganz traurig sein, daß man auf seine Kosten kommt. Etwas von einem Pagen, der für Comtesse Asta stirbt, oder von einem Ritter, der von seinem Nebenbuhler erschlagen und am Wege begraben wird. Und daneben wacht der Hund am Grabe des Ritters, und drei Raben sitzen in einer Pappelweide und kreischen und sehen zu.«
Asta, die mit dem Onkel auf einem Neckfuß stand, würde ihm auch diesmal eine Antwort nicht schuldig geblieben sein, wenn nicht in eben diesem Augenblick ihre Aufmerksamkeit nach einer anderen Seite hin in Anspruch genommen worden wäre.
»Da kommt Elisabeth«, rief sie freudig erregt. »Und der alte Petersen mit ihr und Schnuck auch.«
Und als sie das sagte, traten alle von der Halle her in den Vorgarten und grüßten mit ihr zugleich hinunter.
Drittes Kapitel
Pastor Petersen und seine Enkelin Elisabeth, vielleicht weil das Licht sie blendete, bemerkten von dem ihnen geltenden Gruße nichts, aber um so deutlicher sah man oben, von Terrasse und Vorhalle her, die unten am Strand immer näher Kommenden. Der Alte, seinen Hut in der Hand (so daß der Wind mit seinem dünnen, aber langen weißen Haare spielte), ging ein paar Schritte vorauf, während Elisabeth sich nach den Holz- und Borkenstückchen bückte, die zwischen dem Seetang umherlagen, und sie ins Meer warf, um Schnuck, einen wundervollen schwarzen Pudel, danach apportieren zu lassen. Jetzt aber ließ sie davon ab und begnügte sich, ein paar Blumen zu pflücken, die zwischen dem Strandhafer standen. Und so schlendernd, kamen sie schließlich bis an den Pier, wo sie links abbogen, um die Terrasse hinaufzusteigen.
»Sie kommen«, brach Asta in erneutem Jubel aus. »Und Elisabeth bringt ihren Großvater mit.«
»Ja«, sagte Baron Arne. »Vielleicht könnte man auch sagen, der Großvater bringt Elisabeth mit. Aber so seid ihr; die Jugend ist die Hauptsache; wenn man alt wird, ist man nur noch Beigabe. Jung sein heißt selbstsüchtig sein. Aber eigentlich ist es später auch nicht besser. Mein erster Gedanke war, als ich den Alten sah, da kommt unsere Whistpartie. Schwarzkoppen ist freilich nicht für Spiel, aber Gott sei Dank auch nicht dagegen, und würde, wenn er Katholik wäre, wahrscheinlich von einer, ›läßlichen Sünde‹ sprechen. Und das sind mir die liebsten. Im übrigen bewundere ich diesen Pudel, wie heißt er doch?«
»Schnuck«, sagte Asta.
»Richtig, Schnuck: eigentlich mehr ein Name für eine Lustspielfigur. Er war schon dreimal oben und immer wieder zurück. Offenbar freut er sich ganz unbändig. Und nun sage, Asta, worauf freut er sich, auf dich oder auf die Kunststücke, die er machen darf, oder auf den Zucker, den er dafür kriegt?«
Zwei Stunden später war es still unter der Säulenhalle; der Abend war hereingebrochen, und nur am Horizont lag noch ein roter Widerschein. Alles hatte sich in das Wohn- und Empfangszimmer zurückgezogen, das, in gleicher Größe wie der Eßsaal, unmittelbar hinter diesem lag und den Blick zunächst auf einen wohlgepflegten, mit Treibhäusern besetzten Vorgarten hatte, der weiter hin in große, bergabsteigende Parkanlagen überging.
Das Wohn- und Empfangszimmer war reich möbliert und hatte doch Raum genug zu freier Bewegung. Neben dem Flügel, in der geschütztesten Ecke, stand ein großer runder Tisch, mit einer Moderateurlampe darauf. Hier saßen die Gräfin und ihre Freundin, die Dobschütz, die vorlesen sollte, während Asta und Elisabeth dicht neben ihnen auf zwei Fußbänken Platz genommen hatten und abwechselnd leise plauderten oder den Pudel zu dessen eigener sichtlicher Freude Kunststücke machen ließen. Aber zuletzt wurde er müde von der Anstrengung und schlug, weil er die Balance nicht mehr halten konnte, mit einer seiner Pfoten auf die Tasten des offenstehenden Flügels.
»Ach, nun spielt er auch noch«, lachte Asta. »Ich glaube, wenn er will, spielt Schnuck besser als ich; er ist so geschickt, und Tante Julie wird es nicht bestreiten. Vorhin sollt ich spielen und sogar singen, Onkel Arne bestand darauf, aber ich hütete mich wohl. Ich habe bloß Lust und gar kein Talent. Hast du was mitgebracht, Elisabeth? Ihr habt ja immer was Neues, und du hattest ja auch eine Mappe am Arm, als du kamst. Laß uns sehen.«
So plauderten die Mädchen weiter. In der schräg gegenüberliegenden Zimmerecke aber saßen die vier Herren beim Whist, Arne wie gewöhnlich mit dem alten Petersen scheltend, daß er noch so langsam spiele wie zur Zeit des Wiener Kongresses.
»Ja«, lachte Petersen, »wie zur Zeit, des Wiener Kongresses; da spielte man langsam, das galt für vornehm, und muß ich Ihnen nachher eine Geschichte davon erzählen, eine Geschichte, die wenig bekannt ist und die, soviel ich weiß, von Thorwaldsen stammt, der sie von Wilhelm von Humboldt hörte...«
»Von Alexander«, sagte Arne.
»Nein, erlauben Sie, Arne, von Wilhelm von Humboldt. Wilhelm war überhaupt...«
»Aufpassen, Petersen...«
Und das Spiel nahm, ohne weitere Zwischenrede, seinen Fortgang, und auch die Mädchen dämpften ihre Stimme. Denn die Dobschütz hatte zu lesen begonnen, und zwar aus einem großen Zeitungsblatt, das im Laufe des Nachmittags der Postbote gebracht hatte. Freilich war es noch kein rechtes Vorlesen, sondern erst der Versuch dazu, wobei sich's die Dobschütz – in den Zeitungen zitterte der italienische Krieg noch nach – angelegen sein ließ, zunächst nur die Kopftitel zu lesen, und zwar in einem anfragenden Tone. »Erzherzog Albrecht und Admiral Tegetthoff...« Die Gräfin schüttelte den Kopf... »Auf dem Marsche nach Magenta«... »Die Kürassierbrigade Bonnemain«... Neues Kopfschütteln... »Man schreibt uns aus Charlottenburg über das Befinden König Friedrich Wilhelms des Vierten...«
»Ja«, unterbrach hier die Gräfin, »das lies, liebe Dobschütz. Das aus Charlottenburg. Ich habe kein Interesse für Kriegsgeschichten, es sieht sich alles so ähnlich, und immer bricht wer auf den Tod verwundet zusammen und läßt sterbend irgendein Etwas leben, das abwechselnd Polen oder Frankreich oder meinetwegen auch Schleswig-Holstein heißt. Aber es ist immer dasselbe. Dieser moderne Götze der Nationalität ist nun mal nicht das Idol, vor dem ich bete. Die rein menschlichen Dinge, zu denen, für mich wenigstens, auch das Religiöse gehört, interessieren mich nun mal mehr. Dieser unglückliche König in seinem Charlottenburger Schloß;... ein so heller Kopf, und nun umnachtet in seinem Geiste. Ja, das interessiert mich. Ist es lang?«
»Eine Spalte.«
»Das ist viel. Aber fange nur an, wir können ja abbrechen.«
Und nun las die Dobschütz:
»... Alle Nachrichten stimmen dahin überein, daß es mit dem Befinden des Königs schlechter geht; seine Teilnahme läßt nach, und die Stunden, in denen er folgen kann, werden immer seltener. Selbstverständlich beginnt dieser Zustand des Kranken auch das staatliche Leben zu beeinflussen, und gewisse Rücksichten, die man bisher nahm, lassen sich nicht mehr durchführen. Es läßt sich nicht verkennen, daß sich ein vollständiger Systemwechsel vorbereitet und daß sich dieser Wechsel demnächst auch in der auswärtigen Politik zeigen wird. Das Verhältnis zu Rußland und Österreich ist erschüttert, ein freundschaftliches Verhältnis zu den Westmächten bahnt sich mehr und mehr an, zu England gewiß. Alles, was geschieht, erinnert an die Zeit von 6 bis 13, die, nach voraufgegangener Erniedrigung, eine Zeit der Vorbereitung und Wehrhaftmachung war. Mit solcher Wehrhaftmachung beschäftigen sich unausgesetzt die Gedanken des Prinzregenten, und ist Preußen militärisch erst das, was der Prinzregent aus ihm zu machen trachtet, so werden wir sehen, was wird. Und in keiner Frage wird sich das deutlicher zeigen als in der schleswig-holsteinschen.«
»Es ist gut«, sagte die Gräfin. »Ich dachte, der Artikel würde Mitteilungen vom Hofe bringen, anekdotische Züge, Kleinigkeiten, die meist die Hauptsache sind, und nun bringt er politische Konjekturen. Ich glaube nicht an Vorhersagungen, die meist von denen gemacht werden, die die geringste Berechtigung dazu haben... Aber was ist das für ein Bild, das ich da auf der Rückseite der Zeitung sehe, Schloß und Schloßtürme...«
Die Dobschütz, die nichts davon wußte, wandte die Zeitung und sah nun, daß es eine Annonce war, die, mit ihrem großen Holzschnitt in der Mitte, beinahe die ganze Rückseite der Zeitung einnahm. Das Auge der Dobschütz glitt darüber hin. Dann sagte sie: »Es ist eine Pensionsanzeige aus der Schweiz, natürlich vom Genfersee: hier, das kleine Gebäude, ist das Pensionat, und das große Hotel im Vordergrunde ist nur Zugabe.«
»Lies. Ich interessiere mich für solche Annoncen.«
»... Unsere Pension Beau-Rivage tritt nun in ihr fünfundzwanzigstes Jahr. Es haben in dieser Zeit junge Damen aus allen Teilen der Erde Aufnahme bei uns gefunden und bewahren uns, soviel wir erfahren, ein freundliches Gedenken. Wir verdanken dies, neben dem Segen, der nicht fehlen darf, auch wohl den Grundsätzen, nach denen wir unsere Pension unausgesetzt leiten. Es sind dies die Grundsätze der Internationalität und konfessioneller Gleichberechtigung. Ein kalvinistischer Geistlicher steht leitend an der Spitze des Ganzen, aber durchaus von einem Geiste der Duldung erfüllt, überläßt er es den Eltern und Vormündern, die Zöglinge, die man uns anvertraut, an diesem Religionsunterricht teilnehmen zu lassen oder nicht...«
Die Gräfin erheiterte sich sichtlich. Sie hatte den Zug der meisten Frommen und Kirchlichen, die Kirchlichkeit anderer nicht bloß auzuzweifeln, sondern meist auch von der komischen Seite zu nehmen, und so waren ihr denn Mitteilungen aus dem Lager der Katholiken und beinah mehr noch der Genferischen immer eine Quelle vergnüglicher Unterhaltung, auch wenn sich nicht, wie hier, eine das Heitere so direkt herausfordernde Geschäftlichkeit mit einmischte. Sie nahm das Blatt, um die Pensionsanzeige, die sich noch fortsetzte, weiterzulesen, aber der Diener, der schon seit einer Viertelstunde den Whisttisch beobachtet und den Schluß des Robbers abgewartet hatte, trat jetzt vor, um zu melden, daß der Tee serviert sei.
»Trifft sich vorzüglich«, sagte Baron Arne. »Wenn man gewonnen hat, zählt ein Rebhuhn, worauf ich rechne, zu den gesundesten Gerichten; sonst freilich nicht.«
Und damit erhob er sich und reichte dem Fräulein von Dobschütz den Arm, während Schwarzkoppen mit der Gräfin voranschritt.
»Nun, Petersen«, sagte der Graf, »wir müssen miteinander fürlieb nehmen.« Und an Asta und Elisabeth vorübergehend, rief er diesen zu: »Nun, meine Damen...«
Aber Asta streichelte nur zärtlich seine Hand und sagte: »Nein, Papa, wir bleiben hier, Mama hat es schon erlaubt; wir haben uns noch allerlei zu erzählen.«
Viertes Kapitel
In dem Eßsaale war gedeckt, die Flügeltüren standen auf, und ein heller Lichterglanz empfing die Eintretenden. Die Gräfin nahm ihren Platz zwischen den beiden Geistlichen, während Fräulein von Dobschütz mit Holk und Arne ihr gegenübersaßen. Einen Augenblick später erschienen auch der Hauslehrer und Axel.
»Ich habe mich eben sehr erheitert«, wandte sich die Gräfin an Schwarzkoppen...
»Ah«, warf Holk dazwischen, in einem Tone, der, wenn weniger spöttisch, ergötzlich gewesen wäre, und Arne, der den Spott darin nur zu sehr herausfühlte (denn Christine war eigentlich nie heiter), lachte herzlich vor sich hin.
»Ich habe mich eben sehr erheitert«, wiederholte die Gräfin mit einem Anfluge von Empfindlichkeit und fuhr dann fort: »Es ist doch ein eigen Ding um diese Schweizerpensionen, in denen sich Geschäftlichkeit mit Kalvinismus so gut verträgt. Es war immer die häßliche Seite des Kalvinismus, so lebensklug zu sein...«
Schwarzkoppen, an den sich auch diese zweite Bemerkung gerichtet hatte, verneigte sich. Ihr Bruder aber sagte: »Das ist mir neu, Christine. Calvin, soviel ich weiß, war unbequem und unerbittlich, Knox desgleichen, und Coligny benahm sich jedenfalls nicht allzu lebensklug, sonst lebte er vielleicht noch. Und dann La Rochelle. Und dann die zehntausend Ausgewanderten um Glaubens willen. Es soll den Lutherschen schwer werden, Seitenstücke dazu zu finden oder wohl gar Besseres. Ich beantrage Gerechtigkeit; Schwarzkoppen, Sie dürfen mich nicht im Stich lassen gegen meine Schwester. Und Petersen, Sie auch nicht.«
Holk, der seinen Schwager überhaupt sehr liebte, hatte seine herzliche Freude, daß Arne so sprach. »Das ist recht, Alfred. Für die, die nicht da sind, muß man eintreten.«
»Und wenn es Preußen wären«, setzte Arne lachend hinzu. »Wobei mir der Artikel einfällt, der vorher vorgelesen wurde. Was war es eigentlich damit? Ich habe nämlich die Tugend, beim Whist gewinnen und doch so ziemlich allem folgen zu können, was nebenher gelesen oder gesprochen wird. Ich hörte was vom Charlottenburger Hof und von Wehrhaftmachung und Anno 13. Oder war es nicht so? Anno 13 habe ich bestimmt gehört und Wehrhaftmachung auch...«
»Ach, liebe Dobschütz, erzähle, was es war«, sagte die Gräfin.
»Es war genauso, wie der Herr Baron annimmt, und alles in allem schien der Artikel sagen zu wollen, daß es mit Dänemark vorbei sei, wenn es sich in der Sprachenfrage nicht handeln lasse.«
Holk lachte. »Mit Dänemark vorbei! Nein, Herr Preuß, soweit sind wir noch nicht, und unter allen Umständen haben wir immer noch die Geschichte vom Storch und Fuchs. Der Fuchs in der Fabel konnte nicht an das Wasser heran, weil es in einer Flasche war, und der neueste Fuchs, der Preuße, kann nicht an Dänemark heran, weil es Inseln sind. Ja, das Wasser! Gott sei Dank. Es ist immer dieselbe Geschichte, was der eine kann, kann der andere nicht, und so gut die Preußen ihren Parademarsch marschieren, über die Ostsee können sie nicht rüber, wenn es auch bei Klaus Groth heißt: ›De Ostsee is man en Puhl.‹«
Arne, der, bis spät in den Herbst hinein, seine Abendmahlzeit regelmäßig mit einem Teller saurer Milch einleitete, streute eben Brot und Zucker auf die vor ihm stehende Satte, nahm einen ersten Löffel voll und sagte dann, während er seinen Bart putzte: »Schwager, da divergieren wir. Der einzige Punkt. Und ich setze hinzu, glücklicherweise. Denn mit seiner Schwester darf man schon allenfalls Krieg führen, aber mit seinem Schwager nicht. Ich berufe mich übrigens auf Petersen, der hat am meisten vom Leben gesehen...«
Petersen nickte.
»Sieh, Holk«, fuhr sein Schwager fort, »du sprichst da von Fuchs und Storch. Nun gut, ich habe nichts dagegen, daß wir in die tiergeschichtliche Fabel hineingeraten, im Gegenteil. Denn es gibt auch eine Fabel vom Vogel Strauß. Lieber Holk, du steckst den Kopf wie Vogel Strauß in den Busch und willst die Gefahr nicht sehen.«
Holk wiegte sich hin und her und sagte dann: »Ah bah, Alfred. Wer sieht überhaupt in die Zukunft? Nicht du, nicht ich. Aber schließlich, alles ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, und zu dem Unwahrscheinlichsten von der Welt gehört eine Gefahr von Berlin oder Potsdam her. Die Tage der Potsdamer Wachtparade sind vorüber. Nichts über den Alten Fritzen, er hat keinen größeren Verehrer als mich, aber alles, was er getan, hat, hat den Charakter einer Episode, die für sein Land geradezu verhängnisvoll geworden.«
»Also der Ruhm eines Landes, oder gar seine Größe, sein Verhängnis.«
»Ja, das klingt sonderbar, und doch, lieber Arne...«
Holk unterbrach sich, denn man hörte vom Nebenzimmer her, daß Asta sich mühte, die Begleitung eines Liedes auf dem Flügel herauszutippen. Es wurde aber gleich wieder still, und Holk seinerseits wiederholte: »Ja, Schwager, klingt sonderbar, daß der Ruhm ein Verhängnis sein soll, und doch, dergleichen kommt vor und entspricht dann immer der Natur der Dinge. Möglich, daß auf diesem brandenburgischen Sumpf- und Sandland, auf dem ja die Semnonen und ähnliche rothaarige Welteroberer gelebt haben sollen, ein neues Welteroberungsvolk hätte gedeihen können, gut, zugegeben, aber da hätte dies Land einen langsamen normalen Werdeprozeß durchmachen müssen. Den hat dieser große Friedrich gestört. Als Kleinstaat legte sich Preußen zu Bett, und als Großstaat stand es wieder auf. Das war unnormal und kam einfach daher, daß es die Nacht über, oder genauer gerechnet etliche vierzig Jahre lang, in einem Reck- und Streckbett gelegen hatte.«
»Holk, das sind nicht deine Ideen«, sagte Christine.
»Nein, und ist auch nicht nötig; es genügt, daß ich sie mir angeeignet. Und so laß mich denn in meinen entlehnten Ideen fortfahren. Allen Respekt vor dem großen König, er ist eine Sache für sich. Aber das sozusagen posthume Preußen, das Preußen nach ihm, ist kein Gegenstand meiner Bewunderung, immer im Schlepptau, heute von Rußland, morgen von Österreich. Alles, was ihm geglückt ist, ist ihm unter irgendeinem Doppelaar geglückt, nicht unter dem eigenen Adler, er sei schwarz oder rot. Es hat etwas für sich, wenn Spötter von einem preußischen Kuckuck sprechen. Ein Staat, der sich halten und mehr als ein Tagesereignis sein will, muß natürliche Grenzen haben und eine Nationalität repräsentieren.«
»Es gibt noch anderen Mörtel und Staatenkitt«, sagte Arne, und Schwarzkoppen und Christine sahen zustimmend einander an.
»Gewiß«, replizierte Holk. »Zum Beispiel Geld. Aber wer lacht da? Preußen und Geld!«
»Nein, nicht Geld; eine andere Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit ist nichts weiter als eine Vorstellung, ein Glauben. In den Russen lebt die Vorstellung, daß sie Konstantinopel besitzen müssen, und sie werden es besitzen. An solchen Beispielen ist die Geschichte reich, und in den Preußen lebt auch so was. Es ist nicht wohlgetan, darüber zu lachen. Solche Vorstellungen sind nun mal eine Macht. In unserem Busen wohnen unsere Sterne, so heißt es irgendwo, und was die innere Stimme spricht, das erfüllt sich. In Preußen, das du von Jugend an nicht leiden kannst und von dem du klein denkst, ist seit anderthalb Jahrhunderten alles Vorbereitung und Entwickelung auf ein großes Ziel hin; nicht der Alte Fritz war Episode, sondern die Schwächlichkeitszeit, von der du gesprochen, die war Interregnum. Und mit diesem Interregnum ist es jetzt vorbei. Was der Zeitungsartikel da sagt, ist richtig. Die Werbetrommel geht still durchs Land, und gamle Dänemark, wenn es zum Klappen kommt, wird schließlich die Zeche bezahlen müssen. Petersen, sagen Sie ein Wort! In Ihren Jahren hat man das Zweite Gesicht und weiß, was kommt.«
Der Alte lächelte vor sich hin. »Ich will die Frage doch lieber weitergeben. Denn was unsereinem erst kommt, wenn man achtzig Jahre hinter sich hat (und ich stehe doch noch davor), das haben die Frauen von Natur, die Frauen sind geborene Seher. Und unsere Gräfin gewiß.«
»Und ich will auch antworten«, sagte Christine. »Was meine liebe Dobschütz da gelesen – anfangs bin ich eigentlich nur mit halbem Ohre gefolgt, denn ich wollte von dem mir teuren Königspaar hören und nicht von Wehrhaftmachung und neuer Zeit. Aber was da gesagt wurde, das ist richtig...«
Arne warf der Schwester eine Kußhand zu, während sich Holk, der sich schon als Opfer einiger Anzüglichkeiten fühlte, mit einem Krammetsvogel zu schaffen machte.
»... Den Brief in der Hamburger Zeitung«, fuhr Christine fort, »hat offenbar jemand geschrieben, der dem neuen Machthaber nahesteht und seine Pläne kennt. Und wenn es noch nicht Pläne sind, so doch Wünsche. Ganz und gar aber muß ich allem zustimmen, was Alfred eben über die Macht gewisser Vorstellungen gesagt hat. Die Welt wird durch solche Dinge regiert, zum Guten und Schlechten, je nachdem die Dinge sind. Und bei den Preußen wurzelt alles...«
»In Pflicht«, warf Arne dazwischen.
»Ja, in Pflicht und in Gottvertrauen. Und wenn das zuviel gesagt ist, so doch wenigstens in dem alten Katechismus Lutheri. Den haben sie da noch. Du sollst den Feiertag heiligen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht begehren deines Nächsten Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist – ja, das alles gilt da noch...«
»Und ist im übrigen aus der Welt verschwunden«, lachte Holk.
»Nein, Helmuth, nicht aus der Welt, aber doch aus dem Zipfelchen Welt, das unsere Welt ist. Ich meine nicht aus unserem teuren Schleswig-Holstein, das hat Gott in seiner Gnade so tief nicht sinken lassen, ich meine, das Treiben drüben, drüben, wo doch unsere Obrigkeit sitzt, der wir gehorchen sollen und der zu gehorchen ich auch willens bin, solange Recht Recht bleibt. Aber daß ich mich an dem Treiben drüben erfreuen sollte, das kannst du nicht fordern, das ist unmöglich. In Kopenhagen...«
»Dein alter Widerwille. Was hast du nur dagegen?«
»In Kopenhagen ist alles von dieser