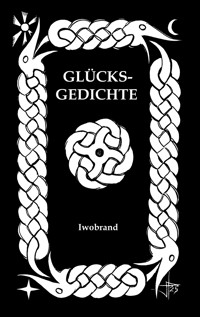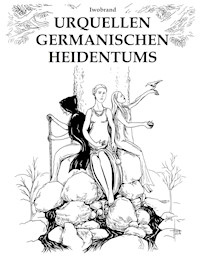
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Das Wissen über den vorchristlichen Glauben der Germanen ist bruchstückhaft und die Quellen sind oft schwierig zu deuten. Was wurde damals wirklich geglaubt, welche Bräuche übte man aus und welche Feste feierte man? Dieses Buch erschließt aus schriftlichen Belegen, Bodenfunden und späterer Volksüberlieferung ein umfassendes Bild vom germanischen Heidentum. Dabei zeigt sich, daß der alte Glaube aus der Landschaft, den Jahreszeiten und der Lebensweise des damaligen Menschen herausgewachsen ist und einem übergeordneten, zeitlosen Muster folgt. Ausführlich behandelt werden die Jahreskreisfeste von Ostern über die Mittsommerfeuer und das herbstliche Totenfest bis zu den Weihenächten der Julzeit. Eine Vielzahl von Zeichnungen gewährt Einblicke in eine heute fast vergessene Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
A. SCHRIFTQUELLEN VON NORD BIS SÜD
1. Altwestnordisches Heidentum in Edda und Saga
2. Altschwedisches Heidentum bei Adam von Bremen
3. Altsächsisches Heidentum in den Bekehrungsschriften
4. Alamannisches Heidentum in den Heiligenleben
5. Suebisches Heidentum bei Tacitus
6. Germanisches Heidentum im Geheimnis der Runen
B. DER GERMANISCHE JAHRESKREIS
1. Blüte
Frühlingstagundnachtgleiche
Die Göttin Ostara
Die Heiligung der Felder
Donars Ostlandfahrten
Walpernnacht und Hexenbrennen
Maikönig und Maikönigin
Wölwen und Hagedisen
Walburgas Spiegel
2. Reife
Sommersonnenwende
Zwillingsgötter
Das Notfeuer
Die Alken
Haus und Herd
Holdas Schicksalsquell
Zius Weltensäule
Ernte und Garbenopfer
3. Tod
Herbsttagundnachtgleiche
Kirmes und Herbstmarkt
Disenopfer
Albenopfer
Hallowe'en, Allerheiligen und Allerseelen
Rübengeistern und Hollengeistern
Das Totenreich
Ahnen und Götter
4. Wiedergeburt
Wintersonnenwende
Wolfspelze und Bärenhäuter
Walvaters Weihe
Mütternacht
Perchtenlauf und Werwolfbund
Wilde Jagd und Wütend Heer
Die Rauhnächte
Julfest und Fasnacht
SCHLUSSWORT
QUELLENVERZEICHNIS
STICHWORTVERZEICHNIS
VORWORT
Das Wort Heidentum wird erst durch Angabe eines besonderen Volkstums genauer bestimmt. Es geht zurück auf das althochdeutsche heidan (heidnisch), das im Zuge der Christianisierung über das Gotische ins Deutsche und die anderen westgermanischen Sprachen gelangte. Die Goten entlehnten es als Gegenbegriff zum Christentum aus dem altgriechischen ethnikós (volkstümlich, heidnisch), wobei es für sie sicher auch an das gotische Wort haiþi (Heide, Feld, Weideland) anklang. Es bezog sich damit auf die noch in ihrem angestammten Glauben verwurzelten Völker, vor allem die noch lange heidnisch bleibende Landbevölkerung. Das Christentum strebte danach, all diese Völker zu einem einzigen Gott zu bekehren. Zum Heidentum hingegen gehörten die je nach Volk und Stamm besonderen Gottheiten, Feste und Bräuche, der Zugang zu einer Anderswelt mit ihren Tier-, Pflanzen- und Ahnengeistern, der Glaube an das Schicksal und die jeweils daraus folgenden Werte und Haltungen zum Leben und zum Tod.
Das Wort germanisch ist in seiner Herkunft weniger gut geklärt. Der Name der Germanen wird meist als ein keltisches Wort für „die Schreienden“ oder „die Nachbarn“ gedeutet, wäre also eine Fremdbezeichnung aus dem Munde eines keltischen Nachbarvolkes. Germanischen Ursprungs ist das Wort deutsch, das auf ein altes Wort für Volk oder Stamm zurückgeht. Die Germanen sind die zwischen Kelten, Slawen und Römern lebenden Stämme aus dem Norden, die durch die gemeinsame germanische Sprache und Wesensart verbunden sind. Die Frage, was genau das Wesen der Germanen ausmacht, wird man nur teilweise durch das Aufzeigen einzelner Unterschiede zu anderen Völkern beantworten können, umfänglicher aber indem man die germanische Wesensart aus sich selbst heraus als ein in sich geschlossenes Ganzes begreift. Funde und Überlieferungen von germanischem Boden sehen sich dabei stets der unvergleichbar dichteren Quellenlage des Mittelmeerraums gegenüber. Es wäre indessen verfehlt, einen germanischen Fund oder Brauch beim Auftreten ähnlicher Muster im Süden immer nur als Abklatsch südlicher Einflüsse erklären zu wollen. Der mündlich überlieferte und geistige Reichtum der Nordvölker stand dem des Südens bestimmt in nichts nach, aber da es im Mittelmeerraum eine unvergleichbar ausgeprägtere Schrift- und Sachüberlieferung gibt, muss die Dichte der Zeugnisse im Süden freilich viel größer sein und so entsteht zwangsläufig ein täuschender Eindruck. Zudem wimmelt es bei der Erforschung des germanischen Heidentums noch immer von lateinischen Begriffen, die zwar klug klingen mögen, die germanische Eigenart aber gleich einer fortgesetzten interpretatio romana mehr verunklären als deutlich machen. In der Zuversicht, dem germanischen Wesen besser gerecht zu werden, wenn es aus dem eigenen Wortschatz heraus erklärt wird, will ich deshalb zu einer eigenen Sprache finden, die frei ist von Fremdwörtern und blassen Allerweltsbegriffen.
Mit Urquellen schließlich sind Quellen in einem zwiefachen Sinne gemeint. Zum einen behandelt das Buch einen reichhaltigen Hort an Urquellen im Sinne ursprünglicher Funde und Schriftzeugnisse, die dem Leser einen möglichst unverstellten Einblick in die Glaubenswelt der Germanen ermöglichen sollen. Auf eine umfassende Zusammenstellung von Quellen zielt das vorliegende Buch freilich nicht ab. Es lädt vielmehr zu einem Streifzug durch die seelische Landschaft Germaniens ein, bei dem einige besonders hell auffunkelnde und ergiebige Quellen erschlossen werden. Statt nur Meinungen zu vertreten, die aus den Quellen abgeleitet wurden, sollen vermehrt die Quellen selbst sprechen und der Leser kann zu seinen eigenen Schlüssen kommen. Zum andern sind mit Urquellen aber jene Quellen gemeint, aus denen sich das germanische Heidentum seinerzeit speiste: Landschaft, Himmelserscheinungen und Vorgeschichte. Über die Lückenhaftigkeit der Quellen zum altgermanischen Glauben haben sich Forscher und Heiden viel beklagt, und das wohl zurecht. Doch im Gegensatz zum Christentum ist das germanische Heidentum keine festgelegte Lehre, die in einem Buch niedergeschrieben werden kann. Vielmehr bezeichnet es eine bestimmte Seelenhaltung, die im Laufe der Geschichte aus den Erscheinungen der Erde und des Himmels geschöpft wurde und ihren Ausdruck findet in den Gebräuchen, Sitten, Tänzen, Liedern, Weihehandlungen, Umzügen und Spielen der Germanen. Jene nichtmenschlichen Quellen aber sind uns Heutigen zugänglich wie eh und je und sie rinnen so reich wie schon vor Tausenden von Jahren. Auch in diesem zweiten Sinne forscht das vorliegende Buch darum Urquellen nach.
Hohes Alter verspricht eine gewisse Beständigkeit und Ursprünglichkeit. Daher wähnen wir in alter Weisheit eine Lebensart und Geisteshaltung, die noch näher an der Wirklichkeit liegt, in einer Zeit bevor Verbildung und Verfall Einzug gehalten haben. Die Grundsätze der Aufklärung und das lange Zeit siegreiche Christentum sind uns bereits hinreichend bekannt, aber wo noch viel verschüttet liegt, gibt es auch viel auszugraben. Falsch wäre bei der Betrachtung des altgermanischen Glaubens ein oft bei Fachgelehrten verbreiteter Fortschrittsglaube, demzufolge sich der menschliche Geist auf einem Weg stetiger Höherentwicklung befindet, sodaß die in den alten Quellen bewahrten Vorstellungen nur einer unterentwickelten Stufe von Aberglauben entspringen, die durch das Christentum oder die spätere Aufklärung widerlegt worden wären. Andererseits gibt es vor allem unter Laien eine gewisse Neigung, die Vergangenheit als heile Welt eines goldenen Zeitalters zu überhöhen. In Kunst und Dichtung hat das sicher seine Berechtigung. Aus wissenschaftlicher Sicht aber besteht die Gefahr, sich die Quellen als bloße Spiegelfläche der eigenen Gesinnungen und Steckenpferde zurechtzumachen und dabei ihr wahres Wesen zu verkennen. Fruchtbarer ist eine in beide Richtungen offene Sichtweise. Vieles mag seit jener Zeit verloren gegangen, vieles neu errungen worden sein. Aberglauben und geistige Verirrungen hat es zu allen Zeiten gegeben, aber früher nicht unbedingt mehr als heute.
Das Verhältnis von Deutung und Aneignung ist ein schwieriges und man sollte daher stets zwischen der geschichtlichen Wirklichkeit und den eigenen Auffassungen zu unterscheiden wissen. Auf der anderen Seite will man sich den Zugang zu der alten Welt der Germanen freilich nicht durch eine allzu trockene und zwanghaft an allem zweifelnde Sichtweise verbauen. Der gegenwärtige Hochschulbetrieb hat in der Tat viel von den rechtswissenschaftlichen Schulen des Mittelalters geerbt. Er ist stark am Richtmaß beweisbarer, berechenbarer und messbarer Ergebnisse ausgerichtet. Es herrscht dadurch allerdings ein Zeitgeist, der den Geisteswissenschaften wesensgemäß zuwiderläuft, denn der menschliche Geist lässt sich weder messen noch berechnen. Immer schwingt heute der Grundsatz mit, daß ein Forscher nur dann den richtigen Blick auf einen Forschungsgegenstand haben könne, wenn er möglichst großen Abstand zu ihm wahrt. Nur kalt von außen soll die Vergangenheit betrachtet werden, dabei aber unberührbar und fremd bleiben, um sie dann sauber verglast in einen Schaukasten zu stellen. Was nicht in den Quellen belegt ist, hat es auch nicht gegeben. Durch diese Haltung wurden die Ergebnisse zwar nüchterner, was gewiss nicht immer nur zum Nachteil der Forschung war. Denn im 19. Jahrhunderts nahm man sich zugegebenermaßen einiges an Deutungsfreiheit heraus. Mit der Zeit aber lief es darauf hinaus, daß man sich in immer größerer Nüchternheit überbot. Die kühle Abstandnahme wurde immer weniger Mittel zur Annäherung an die Wahrheit und immer mehr zum Mittel der gelehrten Selbstdarstellung. Mittlerweile scheint ein Forschungsergebnis je höher angesehen, desto schnöder es ist. Nichts hat mehr mit nichts zu tun, man verliert sich in fachlichen Einzelheiten und an Stelle des wissenschaftlichen Zweifels ist Dünkel und Feigheit getreten.
Wenn man heute Fachbücher über die Germanen aufschlägt, dann lassen sie zudem deutlich den Einfluss der Klöster auf die Entwicklung der Universitäten erkennen. Da werden erst einmal die Sünden aufgezählt, die man bei der Befassung mit solch anrüchigen Dingen begehen kann. An die Stelle der Heiden, Ketzer und Besessenen sind Ewiggestrige, Spinner und Tümler getreten. Die deutsche Vergangenheit scheint einen regelrechten Bannfluch auf die Germanenforschung zu werfen und allerorten wird vor den Gefahren gewarnt, die in der Beschäftigung mit dem Germanentum und der eigenen Herkunft liegen. Man muss sich aber fragen, ob diesen Warnungen ein ehrliches Streben nach Völkerverständigung zugrundeliegt, oder ob es nicht eher darum geht, sich selbst als besonders aufgeklärt und sittlich überlegen darzustellen. Während die Vereinnahmung des Germanentums zuerst der völkischen Bewegung vorgeworfen wurde, ist es in letzter Zeit eben die entgegengesetzte Seite, die ihre Weltsicht in die Vergangenheit hineinliest und sie sich zur Vorantreibung ihrer eigenen Ziele zurechtmacht. Die ältere Forschung wird dabei kaum mehr anhand ihres Inhalts bewertet, sondern unbesehen aus der wissenschaftlichen Verhandlung ausgesondert. Wer sollte das auch alles lesen? Bei der wissenschaftlichen Arbeit stapeln sich der ungelesenen Bücher ohnehin genug.
Wer aber mit seiner Wissenschaft nur die vom Zeitgeist aufgestellten Erwartungen erfüllt, der trifft das Rechte nicht. Statt den bequemen Lehrstuhl zu wärmen, kommt es darauf an, sich für eine alte, längst vergessene Welt zu öffnen und mutig neue Schlüsse zu wagen. Ich folge der Auffassung, daß ein geistigseelischer Gegenstand nur verstanden und durchdrungen werden kann, wenn der Forscher sich mit Geist und Seele auf ihn einlässt. Das vorliegende Buch erfüllt durchaus die Anforderungen eines wissenschaftlichen Buches, strebt aber darüberhinaus einen ganzheitlichen und anschaulichen Zugang zur germanischen Vergangenheit an. Durch zahlreiche Tuschezeichnungen soll ein Bild davon entworfen werden, wie eine bestimmte Begebenheit, ein Ort oder ein Brauch ausgesehen haben könnte. Durch die Arbeit an diesen Lebensbildern entstanden ganz neue Überlegungen und Schlussfolgerungen, die das vor- und frühzeitliche Geschehen aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten lassen. Ich hoffe, daß die Zeichnungen auch dem Leser wertvolle Anstöße zur Einfindung in eine uns mehr oder weniger fremd gewordene Welt geben können.
Das führt weiter zu der Frage, in welcher Form die Befassung mit dem altgermanischen Heidentum auch für uns heute noch fruchtbar sein kann. Glaube und Brauchtum lassen sich gar nie ganz scheiden von den Lebensumständen des Gesellschaftsverbandes, in dem sie herrschen und ausgeübt werden. Unsere heutige Gesellschaft ist nicht mehr die eines in Sippen und Stämme gegliederten Kriegerbauerntums, wie noch zu altgermanischer Zeit. Aber von einem Bachlauf, der ausgetrocknet war und von neuen Wasserströmen erfüllt wird, muss man nicht erwarten, daß er wieder eins zu eins seine alte Gestalt annimmt. Einen Urzustand germanischen Glaubens als solchen gibt es nicht, denn das Heidentum des Frühmittelalters unterscheidet sich von den Ausprägungen, die es noch in der Eisen- oder gar Bronzezeit annahm. Die Nordgermanen in Skandinavien lebten und empfanden auch nicht ganz gleich wie die Germanen des Festlands und der britischen Inseln.
Ein lebendiges Flussbett nimmt stets neue Gestalt an, greift bald hierhin und bald dorthin aus, während sein Ursprung immer im selben Quell liegt. Germanisches Heidentum verweigert sich daher einer festschreibbaren Gestalt, seine Gottheiten wachsen lebendig aus den ihnen das Jahr hindurch gewidmeten Sitten, Festen und Bräuchen. Der zweite Teil des vorliegenden Buches behandelt darum den germanischen Jahreskreis als eine zeitlose Quelle, die es dem heutigen Leser erlauben soll, mehr über die Vergangenheit zu erfahren und daraus zu schöpfen.
An der Quelle
A. SCHRIFTQUELLEN VON NORD BIS SÜD
Beginnen soll unser Streifzug mit einigen Schriftquellen, die über das Heidentum in unterschiedlichen Teilen Germaniens berichten. Die schriftlichen Quellen sind dabei verschiedenster Art und werfen immer wieder die Frage nach dem Gewinn auf, den wir jeweils aus ihnen ziehen können. Denn kaum eine von ihnen können wir eins zu eins als Wiedergabe germanischen Heidentums lesen. Jeder Überlieferer verfolgt mit seinen Aufzeichnungen andere Zwecke und ist anderen Einschränkungen des Blickwinkels unterworfen. Manche Quellen stammen von christlichen Germanen, andere von heidnischen Römern, von heidnischen Germanen haben wir nur das allerwenigste. Die Erforschung des germanischen Heidentums zieht daher auch immer gleich eine Erforschung der ganzen nachheidnischen Geschichte mit den Eigentümlichkeiten ihrer verschiedenen Überlieferungsweisen mit sich.
Zudem beziehen sich die Schriftquellen auf ganz verschiedene Räume und Zeiten. Das fällt mit dem bereits genannten Umstand zusammen, daß die germanische Glaubenswelt stets aus der Landschaft und der geschichtlichen Entwicklung ihrer Stämme herausgewachsen ist. Wenngleich sie insgesamt eine ziemliche Einheit bilden, zeigt jede Gegend Germaniens wieder eigene Züge, die nicht übergangen werden sollen. Neben Skandinavien gab es auf dem Festland die Elbgermanen, Nordseegermanen, Rhein-Weser-Germanen und Ostgermanen. Später verschmolzen sie in unterschiedlichen Anteilen zu Goten, Thüringern, Alamannen, Bajuwaren, Franken, Friesen, Angeln und Sachsen.
Unsere Karte (Abb. 1) unterteilt die Stämme in ihre räumlichen Großgruppen, soweit sie aus den Quellen des Altertums und den Bodenfunden erschlossen werden können:
1. Zu den Nordseegermanen gehören die Friesen, Amsivarier und Chauken.
2. Richtung Süden schließen sich die in Nachbarschaft zum Römischen Reich siedelnden Rhein-Weser-Germanen an, zu denen unter anderem die Brukterer, Marser, Cherusker und Chatten gehören. Von letzteren hatten sich schon vorher die Bataver abgespalten, um sich auf römischem Reichsgebiet an der Rheinmündung anzusiedeln.
3. Das größte Gebiet bewohnen die elbgermanischen Suebenstämme, zu denen die Semnonen, Langobarden, Warnen, Fosen und Hermunduren. Schon früh sind immer wieder suebische Unterstämme abgewandert, wie die Markomannen im späteren Böhmen und die Quaden im heutigen Österreich. Über den Main und den Neckar dringen kleinere Gruppen der Sueben auch bereits nach Südwesten vor.
4. Von den Ostgermanen sind die Burgunder, Gotonen bzw. Goten und Wandalen bzw. Lugier mit einigen Unterstämmen bekannt.
5. Von den Nordgermanen in Skandinavien kennen die griechischen und römischen Geschichtsschreiber kaum mehr als die Angeln und Jüten.
500 Jahre später (Abb. 2) hat sich das germanische Gebiet nach Süden und Westen ausgedehnt, weicht aber im Osten. Die Stämme am mittleren und unteren Rhein sind zu den Franken verschmolzen, die sich alsbald nach Westen ausdehnen, dort über die romanisierten Gallier herrschen, das katholische Christentum annehmen und das Frankenreich begründen. Viele Germanenstämme sind mittlerweile zu weiten Wanderungen aufgebrochen und haben sich in kurzer Zeit im ganzen Abendland und darüber hinaus verteilt. Sie bilden aber in der Fremde meist eine dünne, christianisierte Oberschicht, wie etwa die arianischen Goten in Italien. Das Burgunderreich im Rhônetal wird bald ins Frankenreich eingegliedert.
Langsamer vonstatten geht die Wanderung der suebischen Stämme in das ehemals keltisch-römische Gebiet zwischen Main und Oberrhein, wo sie den Limes überqueren und fortan Alamannen genannt werden. Östlich der Elbe ist nur eine suebische Restbevölkerung geblieben, die ab dem 7. Jahrhundert mit den einwandernden Slawen verschmelzen wird. In Südostdeutschland bilden sich aus verschiedenen Stammessplittern bereits die Bajuwaren heraus.
Zwischen Donau und Elbe erstreckt sich das Thüringerreich, in Norddeutschland die nun zum Großstamm angewachsenen Sachsen und die noch immer in der alten Heimat verbliebenen Friesen. Aus den Küstengebieten setzen zudem Angeln, Sachsen und Jüten auf die britischen Inseln über und bilden in England dauerhafte angelsächsische Siedlungen. Erst ab dem 9. Jahrhundert wird Island von Norwegen aus besiedelt werden.
Abb. 1: Die germanischen Stämme im 1. Jahrhundert
Abb. 2: Die germanischen Stämme im 6. Jahrhundert
Der Stammbaum der germanischen Sprachen (Abb. 3) gibt einen Überblick auf die Entwicklung der germanischen Sprachen, auch zur Einordnung der im Buch angegebenen Wortherkünfte. Freilich handelt es sich nur um grobe Überbegriffe, während es in Wirklichkeit zahlreiche verschiedene Mundarten gab, die sich gegenseitig beeinflussten. Im Stammbaum fehlt noch das Langobardische, das wohl den althochdeutschen Mundarten am nächsten stand und im 10. Jahrhundert in Norditalien ausstarb.
Die germanische Gesellschaft war in aufsteigend größer werdende Verbände gegliedert. Die Sippe war die kleinste Einheit der Opfergemeinschaften und ist für das Verständnis der germanischen Gesellschaft und ihrer Glaubensvorstellungen von größter Wichtigkeit.1 Letztlich wohnte in jedem heiligen Hain, in jedem Fels und in jeder Quelle eine kleine Gottheit. Die Sippen bildeten den Gau, die Gaue den Stamm, Kleinstämme gegebenenfalls wieder einen Großstamm. Beim großen Landesfest fand nicht nur das Allding, also die Gerichtsversammlung, sondern immer auch ein gemeinsames Stammesopfer statt. In späterer Zeit finden sich große Heiligtümer im altsächsischen Markloh, im schwedischen Uppsala, im dänischen Lerje, im jütischen Viborg und die Norweger trafen sich unter anderem in Hlaðir und Skíringssalr. Eine eher zufällige Auswahl älterer Verbände kennen wir aus den römischen Quellen: Die Semnonen verehrten in einem besonderen Hain irgendwo im heutigen Brandenburg ihre Stammesgottheit, die Stämme der Ostsee verehrten besonders die Mutter Erde, die Naharnavaler als Teilstamm der schlesischen Lugier die göttlichen Alken-Zwillinge. Auf noch ältere Zeit zurück geht die Unterteilung nach den drei Söhnen der germanischen Urgottheit Mannus: Die Germanen sind demnach unterteilt in Ingaevonen (Ingwaz-Freyr, Küstengebiet), Erminonen (Irmin-Tiwaz?, Mittelgebiet) und Istaevonen (Istio-Wodanaz?, Restgebiet).2 Zwar ist die gebietsmäßige Verortung dieser Großverbände aufgrund der ungenauen Angaben bei Tacitus schwierig und auch die Zuordnung der Götter Wodan und Tiwaz kann nur nur unter Vorbehalt gelten. Die Verehrung dieser beiden Gottheiten finden wir nämlich auf dem gesamten Festland ohne wirkliche Schwerpunkte. Freyr ist aber in der Tat ein ausgesprochener Schwedengott und auf dem Festland sind Belege für ihn selten. Zwischen den Schriften des Tacitus und den Edden liegen zudem über tausend Jahre, sodaß die Glaubensvorstellungen in dieser Zeit nicht unverändert geblieben sein werden.
In der Zeit zurück und von Norden bis Süden reisend sollen nun bestimmte Schriftquellen einer Betrachtung unterzogen werden, um ihre jeweiligen Eigenarten aufzuzeigen. Wenn die Abschnitte in einzelne Völker- oder Stammesgebiete unterteilt sind, so ist damit weniger gemeint, daß die dort gegebenen Bräuche und Glaubensinhalte allein für den entsprechenden Stamm gelten. Vielmehr sollen einzelne Opferverbände herausgegriffen werden, um beispielhaft das Wesen eines bestimmten Verbandes in seiner lebenswirklichen Ausprägung beleuchten zu können. Im Verlauf dessen ergibt sich bereits ein erster Eindruck vom germanischen Heidentum, der sich im zweiten Teil des Buches vertiefen wird.
Abb.3: Stammbaum der germanischen sprachen
1 Siehe hierzu Wilhelm Grönbech: Kultur und Religion der Germanen, Bd. 1, Darmstadt 1954.
2 Zu den Stammes- und Opferverbänden siehe auch Jan de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 1, Berlin 1970, S. 483-486 (§ 327-329). Die Deutung eines Istio als Gott Wodan ist eine bloße Vermutung.
1. Altwestnordisches Heidentum in Edda und Saga
Snorri Sturluson, die isländischen Sagas und die Lieder-Edda
Wenn wir nach Quellen zum germanischen Heidentum fragen, denken wir zuerst an die Lieder-Edda und die Snorra-Edda, beides in altisländischer Sprache verfasste Schriften des 13. Jahrhunderts. Durch die Besiedlung Islands gelangten diese Stoffe vom westnordischen Raum auf die Insel. Doch wie viel sagt ihr Inhalt überhaupt über den wirklich im Volk bestehenden Glauben aus? Welche der dort erwähnten Götter waren wirklich Gegenstand des vom Volk geübten Brauchtums, wurden mit Opfern und Heiligtümern bedacht? Welche waren hingegen mehr eine Schöpfung der Dichter, oder gar bloße Sagengestalten aus bereits christlicher Zeit?
Wie Wilhelm Mannhardt schreibt, muss unterschieden werden zwischen der lebendigen Sage und den späteren Überlieferungen, in denen diese bereits zu einer bestimmten festen Gestalt erstarrt ist. Hinzu kommt die Frage, durch wen der Sagenstoff schließlich in seine spätere Form gebracht wurde, sodaß oft der mündliche Volksglaube eine viel ursprünglichere Gestalt bewahrt:
Ueberdies ist uns die nordische Mythologie nicht in der Form ursprünglicher Volksanschauung, sondern in der Gestalt aufbewahrt, welche sie im Munde höfisch gebildeter Dichter angenommen hatte; der heutige Volksglaube der skandinavischen Länder weist die Mythen der Edda oft in weit roherer und ursprünglicherer Gestalt auf, und gerade mit dieser stimmen die Traditionen der südgermanischen Stämme, wie fast aller indogermanischen Völker Nordeuropas in so merkwürdiger Weise überein, dass – wo nicht auf irgendeiner Seite Entlehung dargetan werden kann –, eine ältere gemeinsame Quelle vermutet werden muss.3
Bei der Betrachtung der Volksbräuche, Märchen, Volkssitten und Lieder ist freilich ebenso zu beachten, daß sie sehr unterschiedlichen Schichten angehören können. Während manche bereits in vorindogermanische Zeit zurückreichen, sind manche erst im Christentum gebildet worden. Gerade das bäuerliche Leben hat sich über die Jahrhunderte hinweg nur wenig geändert und weist einen Gleichlauf auf, aber freilich hat es auch hier Brüche gegeben. Das wären etwa die Völkerwanderung, die Christianisierung, die deutsche Ostsiedlung, die Zeit Luthers, die Hexenverfolgung und der Dreißigjährige Krieg. Wie Jan de Vries ausführt, müssen darum auch die durch die Volkskunde erschlossenen Quellen mit Vorsicht betrachtet werden, denn vieles daran hat Züge der schwankhaften Erzählung oder des reinen Märchens angenommen.4 Diese Erscheinungsformen sind zwar noch immer Ausdruck germanischer Volksart, aus dem innersten Wesenskern des alten Glaubens spricht aber nur das, was darin noch auf urtümliche Göttersage und heidnische Bräuche zurückgeht.
Snorri Sturluson war ein Geschichtsschreiber, Dichter und Gesetzessprecher auf dem isländischen Allthing. Während Island bereits im Jahr 1000 zum Christentum übertrat, wurde Snorri erst 1179 geboren. Er stammte aus Oddi, wo er eine christliche Bildung erhielt, und verfasste neben der Snorra-Edda wohl auch die Heimskringla („Weltkreis“), die außerdem als Königsbuch bekannt ist.
Snorris Schriftem entstanden zu einer Zeit, als das Christentum auf Island schon lange herrschend geworden war. Damit muss nicht gesagt sein, daß Snorri nicht an die ursprüngliche Macht der alten Götter geglaubt hat, aber zu seiner Zeit waren sie bereits lange durch den christlichen Gott ersetzt und ihre Macht daher geschwunden. Die ihnen gewidmeten Bräuche und Opfer waren auf den neuen Gott übertragen oder ganz fallen gelassen worden.
Snorris Edda ist im Wesentlichen in zwei Teile unterteilt.5 Nach einem kurzen Vorwort (Formáli) beginnt die Geschichte von Gylfis Täuschung, die Gylfaginning, in der Snorri in Form eines Gesprächs zwischen Gylfi und den sogenannten drei Hohen die Grundzüge der nordischen Sagenwelt vermittelt. Diese drei Gestalten, den Hohen, den Höheren und den Dritten, trifft Gyfi in der Götterburg Asgard an und sie belehren ihn über die Erschaffung der Welt, die Götter und ihre Wohnsitze, ihren Kampf untereinander und gegen die Riesen, Balders Tod und das Weltenende. Gylfi unterzieht die mächtigen Asen und ihre Weltsicht einer Prüfung, in der Snorris Einordnung des alten Glaubens durchscheint.
Als zweiter Teil folgt darauf eine Abhandlung über die Sprache der Dichtkunst (Skáldskaparmál), in der sich wiedergegebene Gedichtstücke und Erläuterungen derselben abwechseln. Zweck dieser Aufzeichnung ist vordergründig die Unterrichtung des Lesers in der Dichtkunst am Beispiel der überlieferten Dichtung. Zu deren Verständnis sind aber die heimischen Sagen aus heidnischer Vorzeit unabdingbar. Denn die Lieder der Skalden, also der altnordischen Kunstdichter, leben von den Kenningen. Bei der Kenning handelt es sich um eine Art der Sinnübertragung: Für einen bestimmten Begriff werden Umschreibungen eingesetzt, die sich oft auf jene heidnische Sagenwelt beziehen. So ist in den Skaldengedichten statt von Gold etwa von „Sifs Haar“ die Rede. Ohne das Wissen um jene Geschichte in Skáldskaparmál 35, in welcher Loki der schönen Sif das Haar abschneidet und daraufhin von ihrem zornigen Gatten Thor (Þórr) dazu gezwungen wird, im Reich der Zwerge neues Haar aus reinem Gold für seine Gattin zu besorgen, kann der Vers also nicht verstanden werden. Mit der Christianisierung geht für gewisse Zeit ein Bruch durch diese Verfahrensweise und die Götter werden aus der Skaldendichtung verbannt. Doch schon bald ist die Bezugnahme auf sie wieder unverfänglich, da sie ohnehin nur noch als Sagengestalten aus alter Zeit eine Rolle spielen. Es kommt bei den Isländern daher die Frage nach dem Bedeutungshintergrund der alten Gedichte auf, die nach wie vor erhalten geblieben sind.6 In diese Zeit fällt Snorris Tätigkeit und eben darum muss er auch in der Gylfaginning erst einmal die Grundzüge der nordischen Sagenwelt erklären. Das wenigste in der Edda wird von Snorri selbst neu erdichtet worden sein, wohl ist aber manches mittlerweile aus einer christlichen Sichtweise heraus neu gedeutet und mit gelehrten Versatzstücken aus anderen Teilen der Erde zusammengeschmolzen.
Wie aufgepfropft wirkt daher auch das Vorwort (Formáli), das den alten Götterglauben in ein christliches Weltbild einzufügen versucht. Flickwerk ist die hier aufgezählte Ahnenreihe der Götter, die sie als menschliche Helden deutet, die aus Troja und Asien stammend nach Deutschland und Skandinavien eingewandert sind. Ihr Allvater Óðinn ist ein Zauberer und König, der als seltsame Doppelung der Gottheit auf Erden wandelt. Den Namen Asen bringt Snorri fälschlicherweise mit Asien in Verbindung. Indessen ließe sich überlegen, ob der Mär von der Einwanderung der Asen aus dem Osten („Tyrkland“) nicht doch ein gewisser wahrer Kern innewohnt, wenn man die Asen mit vom Schwarzen Meer her über Deutschland nach Skandinavien eingewanderten Indogermanen gleichsetzt. Nach etwa 3000 Jahren hätte sich von den geschichtlichen Tatsachen der Indogermanenwanderung freilich nur eine verschwommene Erinnerung erhalten, die über die Zeit mit anderem Erzählgut verschmolz. Auf Deutschland weisen aber eindeutig die altsächsischen Namensformen hin, die Snorri mitnennt:
Friallaf, den wir Fridleif nennen; er hatte den Sohn, der Woden genannt wird und bei uns Odin heißt. Er war ein an Weisheit und allen Fähigkeiten hervorragender Mann. Seine Frau hieß Frigida, die wir Frigg nennen.
4. Odin besaß wie seine Frau die Sehergabe, und aus seinen Visionen erfuhr er, daß sein Name oben in der Nordhälfte der Welt bekannt sein würde und daß er darüber hinaus von allen Königen geehrt würde. Aus diesem Grund wollte er seine Reise von Tyrkland antreten. (Formáli 3-4).
Auch innerhalb der Gylfaginning fallen einige Dinge als spätere Zutat auf, wie etwa die Rahmenhandlung. Snorri lässt König Gylfi in den drei Hohen einen dreifaltigen Óðin antreffen, der sich als Allvater und Weltschöpfer ausgibt, oder diesen als irdische Erscheinungsform vertritt. Im Früh- und Hochmittelalter deutete man die Wirkung der heidnischen Götter gerne als Blendwerk böser Geister oder hochmütiger Zauberer und auch die drei Hohen lösen sich zuletzt samt Asgard in Luft auf. Doch den Schrecken des reinen Bösen haben die heidnischen Götter bei Snorri bereits verloren. Der Isländer scheint nicht die Verteufelung der alten Götter beabsichtigt zu haben, sondern bringt dem Glauben der Vorväter sogar eine gewisse Würdigung entgegen.7 Die alten Sagen können aus seiner Sicht sogar als erster Schritt zur Gotterkenntnis angesehen werden, wie Walter Baetke schreibt: „Odin ist für den Verfasser der Gylfaginning der Gott der natürlichen Religion, der aus seinen Werken auch von den Heiden zu erkennen ist.“8 Der heidnische Allvater wird von Snorri als eine Art mangelhafte Vorstufe zum christlichen Gott ausgelegt, um den Glauben der heidnischen Vorfahren zu erklären, die den wahren Gott vergessen und erst durch das Christentum wieder zu ihm zurückgefunden haben. Für die Frage nach der echt heidnischen Sicht auf Óðin gibt das freilich wenig her, da seine Zeichnung ganz aus christlich-antiken Erklärungen erwächst.
Wirklich altheidnische Überlieferung findet sich erst in dem von den drei Hohen vermittelten Sagenwissen. Selbst hier wurde von der Forschung vieles in seiner Ursprünglichkeit angezweifelt, wenngleich die Neuerungen dann wohl weniger auf Snorri zurückgehen, sondern auf vorherige Dichter und Bearbeiter. Für Eugen Mogk war der von Snorri gegebene Bericht von der Weltentstehung eine Neuschöpfung des 13. Jahrhunderts, und damit einhergehend auch der Ort Niflheim, der Zusammenhang der Muspellsöhne und des Surtr mit dem Feuer, die Schaffung der Welt durch die Götter. Sogar die Götterdreiheiten wie Óðinn, Vili und Vé zweifelt er an.9 Daß Óðinn und Vili schon in heidnischer Zeit Brüder sind, zeigen aber die Kenninge alter Skaldengedichte (Egil: Sonatorrek 23; Þjóðólfr: Ynglingatal 3). Wahrscheinlich geht die Dreiheit sogar in urnordische Zeit zurück, also die Zeit vor dem Verlust des W-Anlauts bei Óðinn im Altnordischen, als urnordisch Woðin noch mit Wili und Wé einen Stabreim bildete. Eine stabende Götterdreiheit liegt auch schon bei den drei Söhnen des Mannus (*Irmin, *Istwaz und *Ingwaz) vor, für die christliche Einflüsse bestimmt ausscheiden. Denn von ihnen erzählt bereits Tacitus im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende.
Die von Snorri genannten Götterdreiheiten sind nichtsdestotrotz zumindest erklärungsbedürftig. So haben einmal Óðinn, Vili und Vé die Welt erschaffen, dann aber Óðinn, Hoenir und Lóðurr das erste Menschenpaar mit Leben erfüllt.
Götter, die eigentlich zu den Wanen gehören, werden in der Überlieferung manchmal Asen genannt und die Trennung zwischen beidem darf man sich zur heidnischen Spätzeit wohl nicht allzu deutlich denken. Rudolf Simek zweifelt sogar an, daß die scharfe Trennung zwischen Asen und Wanen ursprünglich ist und sieht sie als Fehldeutung durch Snorri an. Als Hauptgrund für diese Deutung führt er an, daß die Wanen in der frühen Skaldendichtung nie genannt werden.10 Das kann aber nicht überzeugen, da bekanntlich die Skalden einem höfischen Dichterstand von Asenverehrern im westnordischen Raum angehören, während die Wanen eher in den bäuerlichen Schichten und im Osten verehrt werden. Es nimmt daher nicht Wunder, wenn Wanengötter aus skaldischer Sicht eine untergeordnete Rolle spielen und in das asische Göttergeschlecht eingemeindet würden. Darum werden Njǫrðr, Freyja und Freyr von Snorri schlicht Asen genannt.
Insgesamt kann man sagen, daß gegenüber der Snorra-Edda die Lieder-Edda, auf die sich Snorri wiederholt bezieht, als Quelle tatsächlicher Glaubensvorstellungen zu bevorzugen ist. Denn hier hat sich in gebundener Rede ein älterer Bestand erhalten, der ohne Einordnung in eine christliche Nachzeit auskommt. Einige ausschließlich bei Snorri überlieferten Inhalte haben aber dennoch großen Wert und können durchaus uralt sein. Das gilt beispielsweise für die Geschichte von der Weltenmühle Grotti in Skáldskaparmál 42, die als Weltnabe und Weltenachse viele Entsprechungen in Sagen und Darstellungen anderer Völker hat.11
Ähnlich sieht es in Bezug auf den Quellenwert mit Snorris Heimskringla aus, dem Buch der schwedischen und norwegischen Könige.12 In mehrere Sagas unterteilt erzählt es die Geschichte der nordischen Königsgeschlechter von den Stammvätern Óðinn, Yngvi-Freyr und den Ynglingen bis hin zu den christlichen Königen. Wieder sind die Götter zu Heldenkönigen geworden, die aus dem Osten nach Skandinavien einwanderten. Damit lassen sich kaum Einzelheiten erschließen, Snorris Schilderungen vermitteln aber immerhin die Grundzüge ihres Wesens.
Der Hauptwert der Königssagas besteht im Gegensatz zur Edda darin, daß sie nicht die heidnische Gedankenwelt und das Wesen der Götter, sondern das Leben der Menschen beschreiben, die diese verehren. Dadurch gewinnen wir einen Einblick in die Bräuche und Sitten der Zeit. Freilich ist auch das aufgrund des großen zeitlichen Abstands zur Heidenzeit wieder mit Einschränkungen belegt.
Ein Beispiel für den Quellenwert der Heimskringla sind die Beschreibungen der Opferfeste, die ein Herzstück des germanischen Heidentums darstellen. Den heutigen Auffassungen sind sie so fremd geworden, daß man sich erst einmal in sie hineindenken und hineinfühlen muss, um ihre tiefere Sinnhaftigkeit nachvollziehen zu können. In Snorris Königssaga von Hakon dem Guten wird beschrieben, wie man sich im 13. Jahrhundert ein heidnisches Opferfest vorstellte. Wie Klaus Düwel und Anders Hultgård darlegen, muss hier bereits mit einem Einwandern christlicher Begriffe in die Schilderungen gerechnet werden, wie etwa das Wort signa (segnen, von lateinisch signum).13 Sind die geschilderten Handlungen zum Teil vielleicht sogar spätere Rückdeutungen, die in Wahrheit Sitten mittelalterlicher Gilden wiedergeben, etwa das Minnetrinken? Der von Hultgård mit den altnordischen Begriffen ergänzte Auszug aus der Saga von Hakon dem Guten sei hier wiedergegeben:
Sigurd Jarl war ein sehr eifriger Götterverehrer (blótmaðr), und so war auch sein Vater Hakon. Sigurd Jarl veranstaltete im Namen des Königs alle Opferfeste (blótveizlur) dort in Tröndelag. Es war alte Sitte (forn siðr), daß, wenn man eine Opferfeier (blót) abhalten sollte, alle Bauern dorthin kommen sollten, wo es ein Kulthaus (hof) gab, und das Essen mitbrachten, das sie haben müßten solange das Fest währte. Bei diesem Fest sollten alle Männer Bier mitbringen. Man hatte auch allerlei Kleinvieh geschlachtet, sowie Pferde, und all das Blut, das daraus kam, wurde Opferblut (hlaut) genannt, und Opferblutgefäße (hlautbollar) das, worin jenes Blut stand; und Opferblutzweige (hlautteinar) das, was wie Weihwedel (stǫklar) geformt war. Damit sollte man alle „Opferaltäre" (stallar) röten und auch die Wände des Kulthauses, außen und innen, und dann die Menschen besprengen. Das Fleisch aber sollte man zum Festessen kochen. Feuer mit Kesseln (katlar) darüber sollten auf dem Boden mitten im Kulthaus brennen. Man sollte einen Becher (full) um das Feuer herumtragen und derjenige, der das Opfermahl veranstaltete und zugleich Häuptling war, sollte dann den Becher und die Opferspeise (blótmatr) segnen (signa). Erst den Trunk (full) auf Odin — den sollte man auf den Sieg und auf die Herrschaft des Königs trinken — und darauf den Trunk auf Njord und Frey für gute Ernte und Frieden (til árs ok friðar).Viele Männer hatten auch die Gewohnheit, danach den Bragetrunk (Braga full) zu trinken, die Männer tranken auch die Trünke auf ihre Verwandten, auf diejenigen, die in den Grabhügel gelegt waren, und das wurde Erinnerungsbecher (minni) genannt. (Heimskringla: saga Hákonar goða 14).
Für viele der hier verwendeten Begriffe, wie etwa stallr (Gestell) für den Opferaltar, gibt es keine Belege aus heidnischer Zeit, wie Hultgård anmerkt. Allerdings erschließt sich das Wort, das auch in anderen Quellen oft genannt wird, im Grunde allein aus dem Umstand, daß der Altar in vorchristlicher Zeit eine Art hölzernes Gestell war, auf das man Opfergaben hängen konnte. Vieles ergibt also schon grundsätzlich nur aus einem heidnischen Blickwinkel Sinn. Heidnisch muss das Wort hlaut für das Opferblut sein, denn es ist verwandt mit unserem deutschen Wort Los und weist damit auf das Opferblut als Mittel der Weissagung hin.14 Weniger aufschlussreich ist die Angabe, daß Becher und Opferspeise „gesegnet“ wurden (signa), wie ja auch im Christentum. Man kann hier höchstens bestimmte Handgesten vermuten, oder es wurde ein feierlicher Spruch im Stabreim beim Erheben des Horns vorgetragen.15 Laut der Beschreibung trank man den ersten Becher auf Óðin als höchsten Gott, und zwar für den Sieg des Königs als höchstem Herrscher, dann den zweiten Becher auf die beiden Wanengötter für Ernte und Frieden. Anschließend tranken manche Männer noch den Bragetrunk. Dieser Name mag mit dem Skaldengott Bragi zusammenhängen, aber aus anderen Quellen, etwa Ynglinga saga 36, geht hervor, daß man dabei immer ein Gelübde ablegte, und eben darum tranken ihn also nicht alle. Er war ein besonderer Schwurbecher. Zuletzt trank man dann den Minnebecher auf die Ahnen. Das Wort minni (Andenken) für diesen Erinnerungsbecher kam offenbar erst im Mittelalter vom Deutschen her in den Norden, ohne daß aber etwas besonders Christliches in dem Wort liegen würde.16 Das spätere Minnetrinken auf die Heiligen hat sich höchstwahrscheinlich vielmehr gerade aus dem germanischen Trunk auf die Götter und Ahnen entwickelt und war unter anderem Namen auch in Skandinavien schon längst verbreitet.
Vom Christentum gemieden wurde schon bald das Wort blót, das im Mittelpunkt heidnischen Brauchtums steht und oft als Opferfest übersetzt wird, eigentlich aber eine umfangreichere Bedeutung hat. Wie Wilhelm Grönbech über das Blóten schreibt, umschließt es verschiedene Weihe-, Opfer- und Zauberhandlungen im germanischen Heidentum:
Es drückt das Vermögen des Menschen aus, einen Gegenstand von gewöhnlicher Heiligkeit so zu verwandeln, daß er mit der Kraft der Göttlichkeit erfüllt wird und der menschlichen Welt Stärke vermittelt.17
Geblótet wird etwas meist, indem man es mit dem Blut eines Opfers rötet oder einen Trunk darauf leert. Man blótet etwa ein Heiligtum oder Götterbild, aber auch Tiere, Grabstätten, oder lebendige Menschen können durch diese Handlung einer Gottheit geweiht und ein Tor zu ihrer Macht werden. Gerade durch das wiederholte Blóten bekommen sie ihre Heiligkeit und werden von der Macht (megin) der Gottheit erfüllt. Die Blótfeste stärken jene besondere Art des Sippenglücks, die das Altnordische hamingja nennt. Es gibt beim Blót also immer viere:
1. Den oder die Blótenden.
1. Die Blótgabe; ein Opfertier, dessen Blut, Met, Bier, Sachopfer.
2. Die Sache, die man blótet; ein Ort, ein Gegenstand oder ein Wesen.
3. Die Gottheit, deren Macht man dadurch beschwört.
Es kann für unterschiedliche Anlässe geblótet werden, eine Heirat, eine Weihe, ein Jahresfest. Beim gegebenen Beispiel in Tröndelag trinkt man auf Njord und Frey für „gute Ernte und Frieden“. Diese Formel, ár ok friðr, ist nur aus christlicher Zeit belegt, allerdings entspricht ihr Inhalt genau der alten heidnischen Auffassung: ár als Ernteheil und friðr als heilige Umfriedung und Geschlossenheit von Sippe und Blótgemeinschaft wurden vor allem mit dem Gott Freyr in Verbindung gebracht.18 Man wird also die Grundzüge des in der Hakon-Saga beschriebenen Ablaufs als wahr annehmen können: ein Zusammenkommen der Blótgemeinde zum festlichen Gelage, wobei zu Beginn das Opfertier draußen geschlachtet und das Heiligtum mit dessen Blut gerötet wird, woraufhin man gemeinsam das Fleisch verspeist und noch geweihte Trünke den Göttern und den Ahnen widmet. Snorris Königssagas in der Heimskringla sind somit als Quelle nicht unhinterfragt hinzunehmen, geben aber, sobald man spätere Einflüsse ausgeschlossen hat, einiges an Auskunft über den heidnischen Brauch.
Dasselbe kann im Wesentlichen über die Isländersagas gesagt werden, die nicht von Snorri stammen. Diese Sagas erzählen von der nicht allzu weit zurückliegenden Frühzeit Islands, der Besiedlung, den Fehden und Rechtshändeln der Bewohner. Sie wurden aber letztlich von Christen des Mittelalters niedergeschrieben, die andere Absichten verfolgten, als eine möglichst wahrheitsgetreue Darstellung des alten Heidentums zu liefern. Heidnische Isländer werden hier zwar mitunter als gute und anständige Männer gelobt, noch mehr aber solche, die bereits „den richtigen Glauben“ angenommen haben. Geschichtsschreibung im heutigen Sinne darf man auch diese Sagas nicht nennen. Sie sind aber auch keine bloßen Fabeleien, sondern tragen ihre Geschichten oft mit großem Wirklichkeitssinn vor. Der Blick auf die heidnischen Vorfahren war nicht notwendigerweise abschätzig, wenngleich meist von einem gewissen Unverständnis geprägt. Zudem war man oft schon aufgrund der eigenen Wissenslücken zum Hinzudichten gezwungen.
Dennoch lässt sich aus den Isländersagas einiges Wertvolle herauslesen. Wenn oben vom Blót die Rede war, dann wirft das die Frage nach dem Ort der Feierlichkeiten und der Priesterschaft auf. Der Priester des nordischen Heidentums ist der Gode (goði). Ein vom Goden Thorolf erbautes Opfer- und Festhaus (altnordisch hof) wird in der Eyrbyggjasaga beschrieben:
Dort ließ er ein Kulthaus (hof) aufführen, und das war ein großes Gebäude. Es gab eine Tür an den Langseiten, und zwar nahe an der einen Kurzseite. Drinnen standen die Hochsitzpfeiler und darauf waren Nägel. Sie wurden Götternägel (reginnaglar) genannt. Alles drinnen galt als geschützter Platz. Weiter innen im Kulthaus gab es einen Raum von ähnlicher Art wie jetzt der Chor in der Kirche, und dort stand der Opferaltar mitten auf dem Boden, wie ein Kirchenaltar, und darauf lag ein Ring aus einem Stück geschmiedet, der zwanzig Unzen schwer war, und auf ihn sollte man alle Eide schwören. Den Ring sollte der Kulthäuptling bei allen Volksversammlungen an seinem Arm (oder: in seiner Hand) tragen. Auf dem Opferaltar sollte auch ein Opferblutgefäß stehen und darin ein Opferblutzweig nach der Art eines Weihwedels. Damit sollte man das Blut, das Opferblut genannt wurde, aus den Gefäßen verspritzen. Das war solches Blut, das man von den geschlachteten Tieren auffing, die man den Göttern als Gabe mitgebracht hatte. Rings um den Opferaltar im Innenraum (afhús) hatte man die Götter aufgestellt. Alle sollten an das Kulthaus Abgaben entrichten und dem Kulthäuptling zu allen Fahrten verpflichtet sein, wie jetzt die Dingmänner ihren Häuptlingen. Der Kulthäuptling (goði) aber sollte das Kulthaus aus eigenen Mitteln unterhalten, damit es nicht verfiel, und darin Opferfeste veranstalten. (Eyrbyggja saga 4).
Der Quellenwert dieses Abschnitts wird in der Forschung oftmals angezweifelt und in der Tat erinnert der Aufbau des hof schon stark an den einer Kirche. Wenn das eine bloße Rückdeutung durch einen unwissenden Sagaerzähler wäre, würde dieser aber wohl kaum auf die Gemeinsamkeiten zwischen Kirche und hof hinweisen. In manchen Fällen werden Gemeinsamkeiten genannt, in anderen Fällen werden aber auch heidnische Besonderheiten hervorgehoben. Der Eidring und die Hochsitzpfeiler mit den Götternägeln lassen sich weder aus christlicher Denkungsart noch als bloße Erfindungen erklären. Sie werden auch in anderen Quellen erwähnt und sind als ursprünglich anzusehen. Auch für das Verspritzen des Opferblutes mit einem Weihewedel wird man kaum christlichen Kirchenbrauch als Vorbild heranziehen wollen. Abwegig ist daher die Behauptung, daß die Beschreibung von Thorolfs hof bloß nachträglich aus christlichen Denkmustern heraus erdichtet wurde.19 Man kann eher davon ausgehen, daß die Blóthäuser in der Spätzeit des Heidentums schlicht bereits vom Aufbau der christlichen Kirchen beeinflusst waren. Zur Zeit der isländischen Landnahme waren dazu bereits einige Jahrhunderte Zeit gewesen.
Abb. 4: Hofstaðir
Einige Mitteilungen der Sagas werden auch durch Bodenfunde auf Island bestätigt, bei denen ich mich im Wesentlichen auf das umfangreiche Buch von Olof Sundqvist berufe.20 So scheint etwa Thorolfs hof mit der Halle Hofstaðir zusammenzufallen, die in Mývatnssveit gefunden wurde (Abb. 4). Der unberechtigte Einwand, daß es sich hierbei nur um die Festhalle eines Bauernhofs gehandelt hat, hängt meiner Meinung nach noch an christlichen Denkgewohnheiten fest und verkennt daher die Zusammenhänge. Denn im Heidentum waren ja gerade die Gelage ein ganz wichtiger Teil des Glaubenslebens und erst später spaltet sich die heilige Feier in Kirchgang und weltliches Gelage auf. Mit 36 Metern Länge und 8 Metern Breite weist Hofstaðir eine beträchtliche Größe auf und war für Blótfeste sicher gut geeignet. In der Mitte der Halle scheint eine Feuergrube zum Aufhängen der Kessel gelegen zu haben. Ein Nebenraum am Nordende der Halle entspricht, wenngleich er von kirchlicher Baukunst angeregt worden sein mag, dem in der Saga genannten afhús für die Götterbilder und den Armring. Ich nehme an, daß ursprünglich die Hochsitzpfeiler im Norden einer Festhalle standen, daß sie aber später einstweilen von regelrechten Götterbildern abgelöst wurden, als die Festhalle mehr und mehr mit dem Heiligtum zusammenwuchs. Im Südwestteil der Halle Hofstaðir lag laut Sundqvist ein Raum mit Kochgruben und Herd. Wahrscheinlich fanden die Hochsitzpfeiler nun dem Herd gegenüber Platz. Hofstaðir war von einfacher Bauart und wenn keine Feste gefeiert wurden, war sie sicher auch Wohn- und Arbeitsraum des Goden und seines Gesindes. Für ihre Nutzung als Blóthalle sprechen aber vor allem die tierischen Überreste dort. Schnitt- und Wetterspuren auf mehreren Rinderschädeln zeigen auf, daß die Tiere enthauptet und die Schädel an der Außenwand des Gebäudes oder am Dach aufgehängt wurden. Die letzten Schlachtungen lassen sich auf die Zeit um das Jahr 1000 festlegen und fallen damit genau in die Zeit des Glaubenswechsels. Eine Grube südlich vom Gebäude enthielt Asche und Tierknochen und aus der runden Einhegung und der Lage kann man schließen, daß es sich nicht um eine bloße Abfallgrube handelt, sondern um eine Opfergrube.21 Es lässt sich für den Hergang des Blóts also folgendes vermuten: An der Opfergrube im Süden wurden die Tiere geschlachtet und zerlegt. Die nicht zum Verzehr gedachten Teile, wie Felle oder Schädel, wurden dort oder am Giebel der Halle als Zeichen für die Götter aufgehängt. In der Küche wurde das Fleisch weiterverarbeitet und dann in der Festhalle in den Kesseln gesotten. Im Nordteil wurden schließlich mit dem Opferblut die dort unter Dach und Fach aufgestellten Götterbilder gerötet.
Weitere Festhallen fand man in Helgö, im schwedischen Eskilstuna sowie in Lade und Mære im norwegischen Trøndelag. Anders als in Hofstaðir tauchten hier auch vermehrt kostbare Gegenstände aus Glas und Gold auf, wie Trinkgefäße oder die sogenannten Guldgubber.22 Bei diesen handelt es sich um kleine, hauchdünne Goldpressbleche mit Darstellungen von Brautpaaren oder Männern mit Kelch und Keule oder Stab, bei denen es sich meiner Ansicht nach um blótende Goden handelt. Die Guldgubber gehören in die Zeit vor der Landnahme auf Island, treten vor allem im 7. Jahrhundert auf und wurden wohl im hof als Sachopfer abgegeben.
In den Isländersagas walten des Godenamts meist angesehene Häuptlinge und Großbauern, wie etwa der Thorolf der Eyrbyggjasaga, der auf Thors Weisung hin nach Island gekommen ist. Seinen Sohn Stein blótet er, das heißt er weiht ihn dem Thor, und er wird seither Thorstein genannt und übernimmt später die Rolle des Hofgoden (hofgoði). Als selbst Geblóteter steht der Gode den Blótfeiern vor und heißt Blótmann (blótmaðr). Das gesellschaftliche Umfeld des Hofgoden bildet einen halböffentlichen Opferverband, in dem jeder seinen Beitrag leistet.
Besondere Bewandtnis haben im nordischen Godenwesen die Hochsitzsäulen. Oft waren oben in die Pfeiler Götterbilder geschnitzt, sodaß sie hoch an der Nordseite der Halle thronten, zwischen ihnen auf dem Hochsitz der Gode. In der Eyrbyggjasaga ist es ein Schnitzbild von Thor und vielleicht sind auf der zweiten Säule die sogenannten Götternägel (reginnaglar) eingeschlagen. Worum es sich hierbei handelt, ist nicht ganz klar zu sagen. Bei vielen am Polarkreis lebenden Völkern ist ein sogenannter Weltnagel (veraldarnagli) bezeugt, in dem man mit großer Sicherheit ein Abbild des Nordsterns vermuten kann. Die in Thors Säule eingeschlagenen Götternägel bilden wohl ebenso das um den Nordstern kreisende Sternbild des Großen Wagens nach. In einem Wagen fährt Thor über den Himmel.23
In der altnordischen Blóthalle
Von den Sami, die Thor von den Norwegern übernommen haben, sind gleichfalls Säulen bekannt, in die oben ein Nagel eingeschlagen ist.24 Bei Thorolfs Ansiedlung auf Island zu Beginn der Saga wirft er die dem Thor geweihten Hochsitzsäulen von Bord, um an der Stelle, wo sie an Land gespült werden, die in Norwegen abgebrochene Halle wieder neu aufzubauen und dem Thor zu weihen.
Die Hochsitzpfeiler finden von alleine den Ort, an dem sie erneut gen Nordhimmel aufragen sollen, und sogar einen Teil der Erde, auf der sie in Norwegen standen, hat Thorolf abgegraben und mitgenommen.
Für das Blóten von Tieren liefert die isländische Überlieferung einige Beispiele. Einer der ersten Landnehmer, genannt Raben-Floki, blótet seine drei Raben (blótaði hrafna þrjá), lässt sie vor der Küste Islands fliegen und sich von ihnen den Weg zu seiner neuen Heimstatt weisen (Landnámabók 2).
Daß das Blóten einstweilen zu abergläubischem Priesterdünkel ausarten konnte, legt hingegen die Geschichte vom Freysgoden Hrafnkel nahe. Ihr Quellenwert ist vermutlich nicht allzu hoch, aber dennoch soll ihr Inhalt kurz wiedergegeben werden: Hrafnkel blótet d.h. weiht dem Freyr einen Hengst namens Freyfaxi, gelobt gar, jeden zu töten, der auf dem Tier zu reiten wagt. Der hochmütige Gode scheint sich vom Weihen und Opfern eine gewisse Unantastbarkeit zu versprechen, doch als man ihm ohne weiteres den Hof wegnimmt, sein Freyheiligtum verbrennt und den armen Freyfaxi im Fluss ertränkt, opfert er nie mehr.
Das Verhältnis des nordischen Heiden zu seiner Gottheit wird vor allem da deutlich, wo sein Glaubensabfall beschrieben wird, wie etwa in der Geschichte der Leute aus Floi. Ein Mann namens Thorgils stammt aus einer Sippe von Thorverehrern, ist aber unter den ersten Isländern, die sich beim Aufkommen des Christentums taufen lassen. So erscheint ihm der enttäuschte Gott Thor im Traum:
In einer Nacht träumte er, daß Thor mit finsterem Gesicht zu ihm käme und sagte, er hätte ihn betrogen: Du hast dich übel gegen mich benommen, sagte er, mir das Schlechteste ausgewählt, was du hattest, und das Silber, das mir gehörte, in einen stinkenden Pfuhl geworfen. (Flóamanna saga 20).
Als Thorgils einen dem Thor geweihten Ochsen über Bord wirft, ist das nichts weniger als ein Frevel am Eigentum des Gottes. Der Glaubensabfall wird vor allem als Treuebruch beschrieben, gerade so, als hätte man einen guten Freund hintergangen und die Regeln der Gegenseitigkeit gebrochen. Zwar entstand auch die Geschichte von Thorgils in christlicher Zeit, aber die darin festgehaltene Göttervorstellung entspricht weder der christlichen Gottesvorstellung, noch ist sie deren teuflisches Gegenbild. Sie verspricht daher eine in den Grundzügen getreue Wiedergabe heidnischer Gesinnung. So heißen die Götter auch in anderen Sagas einstweilen fulltrui, werden erlebt als gute Freunde, denen man voll vertrauen kann.
Mehr Fabelei enthalten bereits die Vorzeitsagas, wie etwa die von den Wölsungen oder Hrolf Kraki. Hier stehen nicht mehr greifbare Sippen im Vordergrund, sondern urige Vorzeithelden, deren Taten längst sagenhaft überhöht und kaum mehr geschichtlichen Ereignissen zuzuordnen sind. Nicht die jährlichen Feste der Bauern stehen hier im Vordergrund, sondern die Welt der Wikingfahrten, Zweikämpfe und großen Fehden. Von Vorteil ist aber das große Alter dieser Sagas, denn sie reichen weit in heidnische Zeit zurück und haben viel alten Sagenstoff aufgenommen. Die Völsunga saga lässt Óðin selbst als graubärtigen Alten auftreten, der dem in Hunaland in der norddeutschen Tiefebene sitzenden Helden Siegmund das Schwert Gram überbringt. In Siegmunds letzter Schlacht zerschmettert der Gott ihm das Schwert und ruft den dadurch Todgeweihten zu sich nach Walhall. Man muss die Vorzeitsagas vorsichtig als Quelle heranziehen und um zwei Ecken herum betrachten, weil hier vieles der Erzähllust halber hinzugedichtet worden sein kann, aber in vielen Fällen lässt sich die Überlieferung durch Vergleichsfälle aus anderen Quellen bestätigen.
Ich komme schließlich zur Lieder-Edda. Diese Liedersammlung ist die Schöpfung einer bestimmten Gesellschaftsschicht, die oben bereits als adeliger Krieger- und Skaldenstand Westskandinaviens umrissen wurde. Dennoch hat sie für das germanische Heidentum im Allgemeinen als Quelle einen großen Wert. Die enthaltenen Lieder lassen sich grob in Göttersagen, Spruchdichtung und Heldensagen unterteilen. Besonders ursprünglich und wichtig sind die Völuspá („der Seherin Gesicht“), das Wahthrudnirlied (Vafþrúðnismál), das Grimnirlied (Grímnismál) und die Hávamál („das Lied des Hohen“), die alle in das 11. oder 10. Jahrhundert zurückreichen. Die feste Vers- und Reimform dieser Lieder hat viele Verfallserscheinungen verhindert und die Lieder im Wesentlichen als ursprüngliche Zeugnisse der heidnischen Spätzeit bewahrt.
In Hinblick auf das Opferblót kann als Beispiel für eine sicherlich alte und echte Quelle das Hyndlalied gelten, in dem Freyja dem Ottar für seine Opfer dankt:
Er stellte das Weihtum aus Stein mir auf, dem Glase gleich glänzt nun der Stein; er rötet ihn frisch mit Rinderblut: Ottar ehrte die Asinnen stets. (Hyndlulióð 10).
Bei dem hier genannten Weihtum aus Stein ist sicher nicht an ein Steingebäude zu denken, sondern an eine Anhäufung von geweihten Steinen, altnordisch hǫrgr genannt. Daß sie „dem Glase gleich“ sind, deutet auf eine Verglasung durch Opferfeuer hin. Soweit war zwar vor allem von größeren Festhallen die Rede, in der die Kessel angefeuert und Gelage gefeiert wurden. Aber wahrscheinlich schloss sich die Festhalle erst später an das eigentliche Heiligtum an, das aus einem heiligen Hain oder hǫrgr bestand. Entsprechende Steinhäufungen samt Scherben, Brandresten und Trinkhorn fanden sich etwa in einem ehemals bewaldeten Moor bei Rosbjerggaard.25
Daß die heidnischen Sagen anders als die christliche Heilsgeschichte in Gedichten und Liedern überliefert wurden, markiert bereits einen kennzeichnenden Unterschied. Der heidnisch-germanischen Dichtung ist, wie schon die skaldischen Kenninge zeigen, die Sinnübertragung in besonderem Maße eigen. Sie allzu wörtlich zu nehmen, hieße die Vielschichtigkeit der alten Dichter und ihre Liebe für die Sinnübertragung zu verkennen. Zudem sind die Lieder der Edda sicher einer mündlichen Überlieferung entsprossen. Nicht nur nach alten Glaubensinhalten, sondern auch nach einer Verbindung mit dem Brauchtum können wir in den Liedern der Edda suchen, denn jede Art von mündlicher Dichtung hat einen ursprünglichen Rahmen, in dem sie vorgetragen wurde. Auch wenn es nicht die Lieder der Edda in ihrer überlieferten Form gewesen sind, so doch sicher ein sehr ähnliches Liedgut.
Kennzeichnend für heidnisch-germanische Dichtung ist die Wechselrede, woraus man schließen kann, daß die Gedichte von mehreren Sprechern vorgetragen wurden. Oftmals messen sich die Sprecher in ihrem Wissen über die nordische Sagenwelt, wobei schließlich einer von ihnen sich als gescheiter erweist. Das Muster der Wissensabfrage und der Prüfung spielt gerade bei der Einweihung in bestimmte Bünde oder Gesellschaftsschichten eine wichtige Rolle, etwa beim Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter. Der Eingeweihte soll eine Leistung erbringen und sich als fähiger Träger der Überlieferung erweisen. Das legt den Schluss nahe, daß diesen Dichtungen Wettkämpfe zugrunde liegen, daß sie beim Vollzug von Weihehandlungen gesungen oder gesprochen wurden und daß diese Weihe durch ihre Wiederholung immer wieder erneuert und bekräftigt wurde.
Bestes Beispiel für eine solche Wechselrede ist die Vafþrúðnismál, die ein Gespräch zwischen Óðinn und dem Riesen Wafthrudnir (altnordisch Vafþrúðnir: Webetrümmerer) wiedergibt. Behandelt werden von den beiden Tag und Nacht, die Gestirne, Schöpfung, einige Riesen und Götter, sowie der Untergang der Welt. Beide wissen die vom jeweils anderen gestellten Fragen alle zu beantworten, bis Vafþrúðnir zuletzt doch dem Óðin unterliegt. Denn dieser bedient sich eines geschickten Winkelzuges, indem er fragt:
was sagte Odin dem Sohn ins Ohr, eh man auf den Holzstoß ihn hob? (Vafþrúðnismál 54).
Was Óðinn dem toten Baldr ins Ohr flüsterte, kann freilich nur Óðinn selbst wissen. Durch solches Sonderwissen unterscheidet sich edle Asensippschaft von tumbem Riesengeschlecht.
Ebenso auf Einweihung weist die Grímnismál hin, wenngleich hier alles Gesagte dem Óðin in den Mund gelegt ist, der hier am Hofe König Geirröds als Grímnir verkleidet in Erscheinung tritt. Es ist schwer zu sagen, wer hier Prüfer und wer Geprüfter ist. König Geirröd lässt Grímnir an den Feuern sitzen und achtet seiner nicht, nur sein Sohn Agnarr gibt dem Fremden Speise und Trank. Auch Grímnirs Rede geht an Geirröd vorbei und erst als der verkappte Gott ihm den nahen Tod voraussagt und sich als Óðinn offenbart, springt der König auf, ihm entgegenzueilen – doch er stürzt dabei unversehens in sein eigenes Schwert. Auch Óðinn ist auf eine Probe gestellt, denn acht Nächte wartet, hungert und brät er am heißen Feuer. Die Bewährung unter widrigem Schicksal gehört zum Wesenskern nordisch-heidnischer Gesinnung und findet Ausdruck in allerlei Wettkämpfen, Prüfungen und Proben, auf die ich in der Folge noch näher eingehen werde.
Es lässt sich mit Grönbech vermuten, daß Vorträge beim Blót einstweilen die Gestalt regelrechter Aufführungen annahmen, in der die Anwesenden in die Rollen der Götter traten. In der Verteilung der Rede auf mehrere Rollen ist ja der Grundstein für das Schauspiel schon angelegt. Bekanntlich ist das griechische Drama aus dem Tanz, dem Gesang und der Dichtung des Dionysus-Kultes entstanden. Die Fasnachts- und Osterschauspiele des Mittelalters hat man lange Zeit als ausschließlich aus der kirchlichen Liturgie entstandenes Gut erklärt. Die nichtchristlichen Anteile seien demnach das bloße Zeichen einer später einsetzenden Verweltlichung. Doch daß diese einfache Herleitung nicht hinhaut, hat die umfassende Untersuchung von Robert Stumpfl zu den Kultspielen der Germanen dargelegt.27 Zu gut ausgebildet und vor allem zu stark von volkstümlichen Mustern durchdrungen treten uns die Spiele schon zu Beginn des Hochmittelalters entgegen. Es muss also auch auf dem Festland heidnische Vorläufer gegeben haben, die man nicht mehr vollends loswerden konnte, und die darum durch neue kirchliche Spiele in christliche Bahnen gelenkt werden sollten. Dabei sollte man nicht unbedingt von Schauspielen zur bloßen Unterhaltung im heutigen Sinne ausgehen. Vielmehr sind es noch tief im Brauchtum verwurzelte Handlungen, die nicht so sehr etwas nachstellen als vielmehr zauberisch wirken, verkörpern, weihen und heiligen sollen.
Sehr wahrscheinlich ist etwa, daß die in der Vafþrúðnismál beschriebene Hinschlachtung des Urriesen Ymir der Schlachtung des Opfertiers beim Blót entspricht, wie es von Grönbech gedeutet wurde: „So wie das Opfer zerschnitten und auf die Kessel verteilt wird, wird der Urriese Ymir von den Göttern getötet“28:
Aus Ymirs Fleisch ward die Erde geschaffen, aus dem Gebein das Gebirg, der Himmel aus dem Schädel des schneekalten Riesen, die Brandung aus dem Blut. (Vafþrúðnismál 21).
Die von den Göttern gestiftete Schöpfung und ihre Urgesetze erneuerten sich so in jedem Blót und durch das Mahl hat die Opfergemeinschaft Anteil an dieser Eneuerung. Hier zeigt sich die Wurzel der Dichtung im tatsächlich geübtem Brauchtum, der tiefere Zusammenhang zwischen germanischer Sagenwelt und Lebenswirklichkeit wird offenbar.
Ein weiteres Kennzeichen der eddischen Dichtung ist, daß es sich oftmals um Weissagungen handelt, die von der fernen Vergangenheit bis in die ferne Zukunft reichen. Das Schicksal ist den Seherinnen, den Wölwen, bereits bekannt, aber nicht einmal die Götter können ihm entfliehen. Die Muster, in denen das Schicksal sich vollzieht, gewinnen durch die Verdichtung in Liedern eine zeitlose Gestalt. Sie zeigen Anfang, Mitte und Ende, Licht, Dämmerung und Schatten, entwerfen mithin eine ganzheitliche Grundordnung des Seins, in der alles mit allem zusammenhängt und deren Muster sich an allen Stellen des Lebens wiederfindet. Kennzeichnend hierfür und vielleicht das wichtigste der eddischen Gedichte ist das große Gesicht der Seherin, altnordisch Völuspá („Wölwenspähung“). Grönbech erachtet die Völuspá als eine große, eigenständige Schöpfung, ihr Dichter sei „weder Christ noch Heide“, doch merke man den Zeilen ihre Herkunft aus der heidnischen Blóthalle noch deutlich an.29 Der Dichter schöpft aus der alten Überlieferung, um die große Seherin selbst sprechen und Anfang und Ende der Welt verkünden zu lassen. Von den Riesen kamen die Götter, von den Göttern wiederum die Menschen. Das Sein gewinnt dabei Gestalt im Sinnzeichen des riesigen Weltenbaumes, der seine Äste und Wurzeln über die neun Welten der nordischen Sagenwelt erstreckt. So spricht die Seherin:
Gehör heisch ich heiliger Sippen, hoher und niedrer Heimdallssöhne: du willst, Walvater, daß wohl ich künde, was alter Mären der Menschen ich weiß.
Weiß von Riesen, weiland gebornen, die einstmals mich auferzogen; weiß neun Heime, neun Weltreiche, des hehren Weltbaums Wurzeltiefen. (Völuspá 1-2).
Abb. 5: Stammtafel der nordischen Sagengestalten
3 Wilhelm Mannhardt: Germanische Mythen. Forschungen, Berlin 1858, S. VIII.
4 Zum Wert der altnordischen Schriftquellen und der volkstümlichen Überlieferung siehe de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 1, S. 1-8 (§ 1-4) und S. 13-17 (§ 8- 10).
5 Die Edda des Snorri Sturluson, übersetzt von Arnulf Krause, Stuttgart 1997.
6 Vgl. de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 1, S. 43f. (§ 30).
7 Vgl. Jan Alexander van Nahl: Snorri Sturlusons Mythologie und die mittelalterliche Theologie, Boston und Berlin 2013, S. 87-89.
8 Walter Baetke: Die Götterlehre der Snorra-Edda, Leipzig 1950, S. 51. Vgl. auch S. 6468.
9 Eugen Mogk: Zur Bewertung der Snorra-Edda als religionsgeschichtliche und mythologische Quelle des nordgermanischen Heidentums, Leipzig 1932, S. 13-18.
10 Vgl. Rudolf Simek: Religion und Mythologie der Germanen, Darmstadt 2003, S. 129f.
11 Vgl. Otto Sigfrid Reuter: Germanische Himmelskunde. Untersuchungen zur Geschichte des Geistes, München 1934, S. 237-243.
12 Snorri Sturluson: Heimskringla. Sagen der nordischen Könige, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Hans-Jürgen Hube, Wiesbaden 2006.
13 Anders Hultgård: Altskandinavische Opferrituale und das Problem der Quellen, in: Tore Ahlbäck (Hg.): The Problem of ritual. Åbo 1993, S. 221-259, v. a. S. 225f.
14 Vgl. de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 1, S. 434f. (§ 298).
15 Vgl. Wilhelm Grönbech: Kultur und Religion der Germanen, Bd. 2, Darmstadt 1954, S. 170ff.
16 Vgl. de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 1, S. 424 (§ 292).
17 Grönbech: Kultur und Religion der Germanen, Bd. 2, S. 201.
18 Vgl. Grönbech: ebd. S. 242-252.
19 Etwa bei Simek: Religion und Mythologie, S. 95.
20 Olof Sundqvist: An Arena for Higher Powers. Ceremonial Buildings and Religious Strategies for Rulership in Late Iron Age Scandinavia, Leiden und Boston 2016, S. 150155.
21 Vgl. Olaf Olsen: Vorchristliche Heiligtümer in Nordeuropa, in: Herbert Jankuhn (Hg.): Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa, Göttingen 1970, S. 259-278, S. 273f.
22 Siehe Sundqvist: An Arena for Higher Powers, S. 127ff. und S. 155.
23 Laut Grimm bezieht eine altschwedische Chronik den Großen Wagen (karlwagen) auf Thor: Deutsche Mythologie, S. 604.
24 Siehe in Anlehnung an Uno Holmberg und Hugo Pipping die Stellen bei Reuter: Germanische Himmelskunde, S. 77 und S. 226-229.
25 Vgl. de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte, Bd. 1, S. 378-380 (§ 267); Zu Rosbjerggaard siehe Sophus Müller: Nordische Altertumskunde nach Funden und Denkmälern aus Dänemark und Schleswig, Bd. 2: Eisenzeit, Straßburg 1898, S. 179ff.
26 Vgl. Andreas Heusler: Altgermanische Dichtung, Darmstadt 1957, S. 110f.
27 Robert Stumpfl: Kultspiele der Germanen als Ursprung des mittelalterlichen Dramas, Berlin 1936.
28 Grönbech: Kultur und Religion der Germanen, Bd. 2, S. 238. In manchen Fällen erscheinen Grönbechs Ausdeutungen der Eddalieder allzu weitgehend, aber im Grundmuster werden sie doch das Richtige treffen.
29 Grönbech: Kultur und Religion der Germanen, Bd. 2, S. 228.
2. Altschwedisches Heidentum bei Adam von Bremen
Das Opferfest zu Alt-Uppsala in der Hamburgischen Kirchengeschichte
Während die Edda eine späte Auffassung von der nordischen Sagenwelt in vielfach ausdeutbaren Gedichten wiedergibt und die Sagas vor allem das Ziel haben, aus der Früh- und Vorzeit der Isländer zu erzählen, ist die Hamburgische Kirchengeschichte des Adam von Bremen eine Quelle ganz anderer Art. Der Hauptzweck ist hier Geschichtsschreibung und Adam von Bremen schreibt sein Werk bereits in den 1070ern, einer Zeit, zu der in Schweden gerade erst die letzten Heiden vor der Taufe stehen. Zu dieser Zeit gab es im alten Uppsala (Gamla Uppsala) bei der heutigen Stadt Uppsala im Osten Schwedens noch ein bedeutendes heidnisches Heiligtum. Was der norddeutsche Mönch zu berichten hat, verspricht daher, nah an den tatsächlichen Begebenheiten des Brauchtums und Opferwesens zu liegen. Einschlägig ist freilich die Sichtweise auf das Geschehen, die stark von christlicher Missgunst gegen das Heidentum geprägt ist. Außerdem war Adam von Bremen nie in seinem Leben selbst in Uppsala, sodaß er sich auf die Berichte anderer stützt. Sein Wissen hatte er vermutlich vom dänischen König Sven Estridsson und verschiedenen Gesandten am dänischen Hof, die in Uppsala gewesen waren.
Eine unentbehrliche Quelle ist Adams Kirchengeschichte