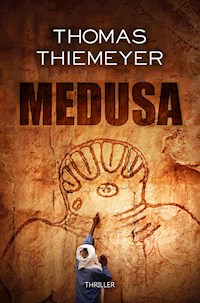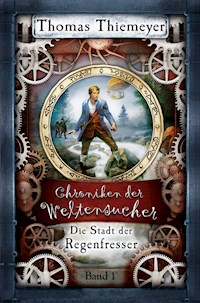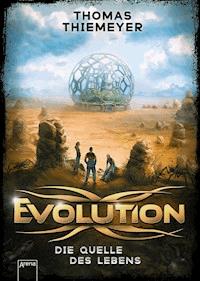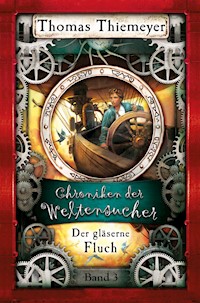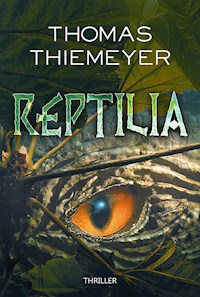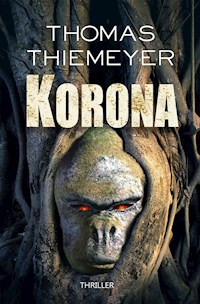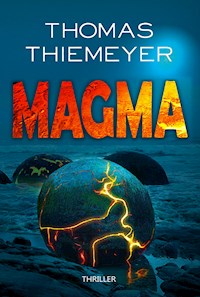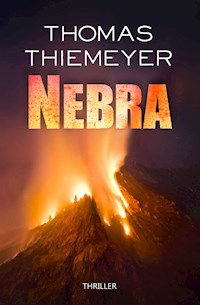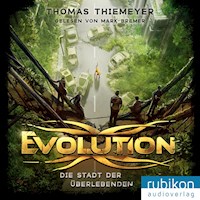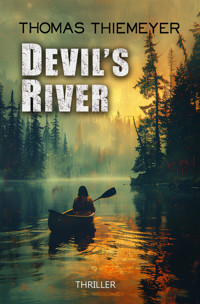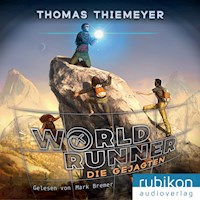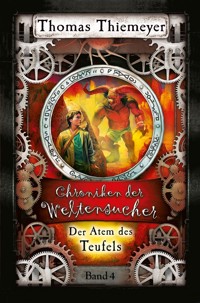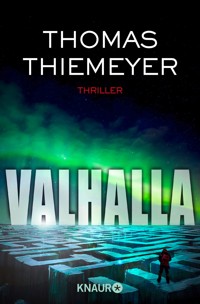
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Hannah Peters
- Sprache: Deutsch
2015. Spitzbergen – der nördlichste Siedlungspunkt der Menschheit. Eine Welt aus Eis und Schnee, überschattet von vier Monaten Polarnacht. Dort plant Archäologin Hannah Peters, geheimnisvolle Strukturen unter dem arktischen Eis zu untersuchen: Das Abschmelzen der Gletscher hat mutmaßlich Fundamente eines mythischen Nordreiches zutage gefördert. Doch Hannah ist nicht die Erste, die diese Ruinen erkundet ... 1944. Im annektierten Norwegen, fernab jeder Siedlung, reift ein Projekt, das grauenvoller ist als alles, was Menschen je ersonnen haben. Eine biologische Zeitbombe, verborgen unter dem ewigen Eis. Ihr Codename: Valhalla.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Thomas Thiemeyer
Valhalla
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
2015. Spitzbergen – der nördlichste Siedlungspunkt der Menschheit. Eine Welt aus Eis und Schnee, überschattet von vier Monaten Polarnacht. Dort plant Archäologin Hannah Peters, geheimnisvolle Strukturen unter dem arktischen Eis zu untersuchen: Das Abschmelzen der Gletscher hat mutmaßlich Fundamente eines mythischen Nordreiches zutage gefördert. Doch Hannah ist nicht die Erste, die diese Ruinen erkundet …
1944. Im annektierten Norwegen, fernab jeder Siedlung, reift ein Projekt, das grauenvoller ist als alles, was Menschen je ersonnen haben. Eine biologische Zeitbombe, verborgen unter dem ewigen Eis. Ihr Codename: Valhalla.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Teil 2
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Teil 3
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
Epilog
Für Carolin
Februar 1944 …
Der Orkan peitschte den Schnee in Wellen über das Eis. Er zersprengte den Atem, machte den Mann stumm und taub. Nadelspitze Kristalle drangen unter die Kapuze und bohrten sich in seine Haut. Das Heulen war ohrenbetäubend. Eine Kakophonie verdammter Seelen, die mit ihren Schreien die Dunkelheit erfüllten.
»Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name …«
Der Wind drückte ihm die Stimme zurück in den Hals. Siebzig Stundenkilometer, Tendenz steigend. Seine Lungen schmerzten. Es war, als hätte man der Luft jeglichen Sauerstoff entrissen.
Die Sicht war auf unter zwanzig Meter gefallen. Selbst das zuckende Licht der Lampe vermochte die Finsternis nicht zu durchdringen. Keuchend unterbrach der Mann seinen Lauf, lüftete den Pelzkragen und linste über den Rand des Schals. Wo war nur diese vermaledeite Hütte? Eigentlich hätte sie genau hier sein sollen. Hier, wo er stand. Stattdessen brüllende, zornige Finsternis. Panik überfiel ihn. Erst gestern hatte er noch zur Wetterstation hinübergeblickt, da war die Luft windstill gewesen und der Himmel klar. Ein Traum von einer arktischen Winternacht, mit Sternen, die bis zum Boden reichten. Doch hier auf Spitzbergen konnte das Wetter binnen weniger Stunden umschlagen. Dann ließ es den Menschen spüren, dass er nur geduldet war.
Die Wetterstation Heißsporn befand sich gut einen Kilometer vom Eingang der Forschungseinrichtung entfernt, doch bei diesem Wetter hätte sie genauso gut am anderen Ende der Welt liegen können. Und er hatte in der Eile vergessen, den Kompass einzustecken. Idiot, hirnverbrannter. Es waren schon Männer wegen geringerer Vergehen gestorben – verirrt, verloren, im Eis gefangen und erst zur Schneeschmelze wiederaufgetaucht wie starr gefrorene Rinderhälften. Andererseits, ob der Kompass unter diesen Verhältnissen überhaupt funktioniert hätte? Nadeln konnten einfrieren, magnetische Unregelmäßigkeiten zu Abweichungen führen.
Eine neue Böe fegte über ihn hinweg und riss ihn beinahe von den Füßen.
Der Mann rammte seine Stöcke ins Eis und klammerte sich fest. Unter Aufbietung all seiner Kräfte wartete er den arktischen Wutausbruch ab, dann zog er sich mit den Armen weiter vorwärts. Seine Tränen gefroren zu Eis. Immer ein Schritt nach dem anderen, so hatte es ihnen ihr Ausbilder beigebracht. Nur nicht den Halt verlieren. Zurückgehen war ausgeschlossen, nicht nach dem, was geschehen war. Nicht nach dem, was er gesehen hatte.
Er spürte das Feuer durch seine Adern rauschen. Eine unnatürliche Hitze, die sich tief in seine Eingeweide fraß. Obwohl hier draußen 30 Grad minus herrschten, schien er innerlich zu kochen. Was hatten sie getan? Was hatten sie nur angerichtet?
Zur Beruhigung seiner fiebrigen Nerven und in Ermangelung einer besseren Idee begann er, leise vor sich hin zu summen. Falsch und verstockt erst, dann mit der Zeit sicherer und beherzter. Er spürte, dass die Füße auf seine Stimme reagierten. In dieser lebensfeindlichen Umgebung war jeder menschliche Laut willkommen.
»Ein Jä… Jäger aus Kurpfalz, der reitet durch den grünen Wald, er schießt d… das Wild daher, gleich wie es ihm gefällt. Hur…ra, hurra, gar lustig ist die Jägerei, all…hier auf grüner Heid’, allhier auf grüner …«
Er verstummte.
Drüben, am äußeren Rand seines Sichtfeldes, war ein kurzes rotes Blitzen zu sehen gewesen. Er schaltete die Lampe ab, und sofort war die Finsternis wieder da. Laut, brüllend, erstickend. Er hielt den Atem an, versuchte, seine Panik zu bezwingen.
Da. Da war es wieder. Das Positionslicht des Wetterpostens. Viel weiter rechts als erwartet, aber immerhin. Vermutlich hatte der Wind für die Abdrift gesorgt. Und dabei hatte er sich so bemüht, die Richtung zu halten. Er spürte einen Anflug von Hoffnung. Wenigstens für den Moment war er gerettet.
Mit neu erwachtem Mut machte er sich auf den Weg. Jeder Schritt, den er zwischen sich und die Forschungseinrichtung brachte, war eine Erleichterung. Er wollte nur noch weg. Weg von dieser kalten Insel, weg aus der ewigen Finsternis und Einsamkeit, vor allem aber weg von dem Grauen, das hinter ihm unter dem Eis lauerte.
Oberleutnant Karl-Heinz Kaltensporn fiel es schwer, seine Augen von der Karte abzuwenden. Das Wegenetz war ungeheuer. Viel größer als zunächst gedacht. Ein einziges gewaltiges Labyrinth aus Gängen, Stollen und Wegen, das keiner richtigen Logik zu folgen schien. Weder gab es Kanten noch rechte Winkel noch ebene Flächen. Die Anlage hatte mehr Ähnlichkeit mit einer Kinderzeichnung als mit dem Grundriss einer Siedlung. Und doch wohnte der Sache eine tief verborgene Logik inne. Die Menschen, die das erbaut hatten, waren vielleicht keine Architekten gewesen, aber sie waren Künstler. Gesegnet mit der Gabe der Harmonie und Vollkommenheit. Nicht Präzision oder Effizienz waren ihre Kriterien gewesen, sondern Schönheit und Einklang von Mensch und Natur. Ein Ideal, das den heimatlichen Architekten, allen voran Albert Speer mit seinen aberwitzigen Mammutprojekten, ein Dorn im Auge sein musste. Den Bauprojekten von Hitlers Generalbauinspektor und jetzigem Rüstungsminister hatte schon immer eine gewisse Hybris angehaftet, doch mittlerweile schienen die Herren in Berlin nur noch von Größenwahn getrieben zu sein. Alles musste immer gerader, weiter, höher und größer sein. Das Kleine wurde vom Großen erdrückt, das Starke fraß das Schwache – wie in der Architektur, so auch in der Gesellschaft. Waren Bauwerke nicht seit jeher ein Spiegel der Zivilisation? Doch solche Gedanken behielt man besser für sich, wenn einem die eigene Karriere lieb war. Außerdem: Kaltensporn hätte sich nicht zu dieser Mission gemeldet, wenn er nicht wenigstens zum Teil an die Versprechen des Führers geglaubt hätte. Den wortreichen Bekundungen vom schnellen Sieg, vom allumfassenden Triumph. Doch hier oben, im arktischen Norden, weit weg von daheim, fiel es ihm zunehmend schwer, den Traum vom tausendjährigen Reich zu träumen. Nicht, weil die Freunde von der Propaganda sich nicht redlich bemühten, diese Vision aufrechtzuerhalten, sondern weil die Meldungen, die man hier auf Spitzbergen über Funk aus anderen Teilen der Welt empfing, so ganz anders lauteten.
Kaltensporn konzentrierte sich wieder auf den Plan. Die Forschungseinrichtung des Kaiser-Wilhelm-Instituts, kurz KWI, befand sich am Rand dessen, was früher einmal eine Stadt gewesen sein musste. Eine Metropole, die mittlerweile vollständig von Eis überzogen war und damit einen gewissen Rückschluss auf ihr Alter zuließ. Dabei machte der Abschnitt, den man für die Labors in Beschlag genommen hatte, nur einen Bruchteil des ungeheuren Wegenetzes aus, das sich unterhalb des Gletschers in alle Richtungen ausdehnte. Niemand konnte ahnen, wie weit es sich noch ausdehnte. Es war im wahrsten Sinne des Wortes die Spitze des Eisbergs, und noch immer hatte niemand eine Ahnung, was genau sie da eigentlich gefunden hatten. Wer immer die Erbauer waren, sie hatten ihr Wissen bereits vor Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Jahren mit ins Grab genommen. Generation um Generation hatte das Geheimnis unter dem Eis geschlummert, nur um von deutschen Archäologen nach jahrelangem Suchen endlich entdeckt zu werden. Es war, als hätte der liebe Gott Himmlers Gebete erhört und ihm seinen langgehegten Traum erfüllt, den Traum von der Unsterblichkeit und der Nähe zu den Göttern. Aber mal davon abgesehen, hatte die Anlage auch einen praktischen Nutzen. Anstatt den Forschungsbetrieb in eigens konstruierten Baracken unterbringen zu müssen, konnte man nun das vorhandene Stadtgebiet nutzen und es zu höheren Zwecken umfunktionieren. Das bedeutete natürlich, dass die prähistorische Fundstätte und die Berichte darüber ebenfalls der obersten Geheimhaltungsstufe unterlagen. So kam es, dass kaum ein Mensch von diesem Fund wusste.
Die Lage war ideal. Abseits der gängigen Schifffahrtsrouten, geschützt und getarnt von einem mächtigen Gletscher, bot sie alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit. Als weiterer Vorteil kamen Ruhe, Abgeschiedenheit und vor allem die Entfernung zur nächstgelegenen menschlichen Niederlassung hinzu. Dieser Aspekt war besonders wichtig in Hinblick auf das, was hier erforscht wurde.
Kaltensporn wollte gerade ein paar Notizen machen, als von nebenan plötzlich ein heftiges Rumpeln zu hören war. Zeitgleich ertönte das Kläffen der Hunde.
Die Stimmen der Männer erstarben. Einen Moment lang herrschte Stille, dann entstand plötzlich ein mörderischer Lärm. Rufe ertönten, Stühle fielen um, und Stiefel polterten über den Holzboden. Kaltensporn sprang auf und griff nach seinem Karabiner. Er glaubte das Wort »Eisbär« gehört zu haben. Mit entschlossenem Blick stürmte er aus dem Funkraum hinüber zum Gemeinschaftsraum, wo bereits helle Aufregung herrschte. Bis auf den Funk-Obergefreiten Junghans, der mit blassem Gesicht über seinen Spielkarten hockte, waren alle aufgesprungen und hielten ihre Waffen in den Händen.
Wieder donnerte es gegen die Tür.
Kaltensporn lauschte einen Moment, dann nickte er.
»Scheint, dass wir Besuch bekommen, Männer.« Er blickte in die Runde. »Könnte der Bär sein, der neulich versucht hat, unserem Smut die Rentierschnitzel zu stibitzen. Junghans, schnapp dir die Mauser-Repetierbüchse aus dem Waffendepot und lad sie mit Teilmantelgeschossen. Brenn dem Kerl ordentlich einen auf den Pelz. Bring ihn zur Strecke, wenn er zudringlich wird, mit diesem Burschen ist nicht zu spaßen.«
»Jawohl, Herr Oberleutnant.«
»Und nimm den Notausgang, ich habe keine Lust, eine 250 Kilo schwere Fressmaschine in unserer Unterkunft stehen zu haben.«
»Zu Befehl, Herr Oberleutnant.«
Kaltensporn, dem zu Ehren die Station den Spitznamen Heißsporn erhalten hatte, lauschte in den Sturm hinaus. Wenn es wirklich wieder dieser Eisbär war, dann hatten sie jetzt die Chance, ihn zu erlegen. Diese Biester konnten ganz schön zudringlich werden, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatten. Darüber hinaus waren Eisbärenschnitzel eine nicht zu verachtende Delikatesse.
Das Rumpeln war wieder zu hören, aber diesmal hatte Kaltensporn das Gefühl, eine menschliche Stimme gehört zu haben. »Warte mal, Junghans.« Er ging hinüber zum Fenster, entfernte die Holzverschalung und blickte nach draußen.
Der Sturm hatte den Schnee meterhoch aufgehäuft, doch ein kleiner Zipfel im linken oberen Eck war noch frei. Er erklomm eine der Vorratskisten und spähte hinaus. Der Wind donnerte mit aller Gewalt gegen die Hütte. Ein einziges Chaos da draußen. Doch mittendrin und gar nicht so weit entfernt, tanzte ein Licht.
»Ja, da laust mich doch der Affe. Das ist kein Bär, das ist einer von uns. Was treibt der denn da draußen? Und das bei dem Sturm. Ist der lebensmüde? Baumann, Tür öffnen, aber schnell!«
Er stieg von der Kiste und half dem MA-Gefreiten, den Riegel von der Tür zu entfernen. Der Wind drückte mit ungeheurer Kraft von außen dagegen. Fast hätte man den Eindruck bekommen können, er wolle verhindern, dass der Mann zu ihnen hereinkam. Doch nachdem Obermaat Wegener, der über Muskeln wie Stahl verfügte und den alle nur »Kombüsen-Kurt« nannten, mit anpackte, gelang es ihnen endlich, den Balken zu bewegen. Die Tür sprang mit einem Knall auf. Eine Böe von Schnee fegte in die Hütte. Schlagartig fiel die Temperatur.
Donnernd und fauchend spie der Sturm einen einzelnen Mann aus und schleuderte ihn dem Kommandanten vor die Füße. Kaltensporn wich zurück. Der Kerl war bis zur Unkenntlichkeit mit Eis und Schnee bedeckt. Er kroch aus der Gefahrenzone hin zum Ofen.
»Tür zu, Tür zu!«, brüllte Kaltensporn. »Beeilt euch, oder wir werden alle erfrieren!«
Vier Männer waren nötig, die Schneewehe beiseitezuräumen, die sich in der kurzen Zeit gebildet hatte. Dann drückten sie die Tür zurück in Position und legten den Balken vor. Der Sturm war ausgesperrt.
Kaltensporn atmete tief durch. Der Sturm hatte den Schnee bis in die entlegensten Winkel der Hütte geweht, auf den Boden, die Tische, Stühle und in die Regale. Auf dem warmen Holz begannen sich bereits erste Pfützen zu bilden.
»Čapek, Müller, Baumann – holt Eimer und Lappen und macht hier sauber. Achtet auf die Bücher, ich will nicht, dass sie hinterher nur noch als Brennmaterial taugen. Und Junghans, die Petroleumöfen auf volle Leistung. Mir frieren gerade die Eier ab.« Mit diesen Worten wandte er sich ihrem Gast zu. »Himmelherrgott, was haben Sie sich nur dabei gedacht? Wer sind Sie überhaupt?«
Der Mann schob seine Kapuze vom Kopf und richtete sich auf. Dunkle Haare, braune Augen und ein markantes Kinn. Vielleicht 23 oder 24 Jahre alt, kaum älter als die Männer vom Wettertrupp. Als er seine Felljacke auszog und die Wehrmachtsuniform darunter erschien – braunes Koppelzeug und Kragenspiegel –, dämmerte es Kaltensporn. Er hatte den Mann schon mal gesehen. Unterarzt bei den Sanitätern. War mit dem letzten Schwung Personal vor sechs Monaten gekommen. Die Sanitäter waren die Einzigen, mit denen sie von Zeit zu Zeit mal Kontakt hatten; die anderen ließen sich so gut wie nie blicken.
Der Mann versuchte zu salutieren, was allerdings ziemlich seltsam aussah, da er immer noch am Boden hockte.
»O… Oberfähnrich Grams bittet darum, Meldung machen zu dürfen.«
»Jetzt reden Sie nicht so geschwollen daher und beruhigen Sie sich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf die Füße.« Kaltensporn reichte ihm die Hand und zog ihn hoch. »Lassen Sie sich anschauen. Mein Gott, Sie sind ja völlig am Ende. Kurt, bring mal ’nen Pott Kaffee für unseren Oberfähnrich. Drei Stück Zucker und Kondensmilch, wenn ich bitten darf. Dasselbe für mich.«
»Wird gemacht«, tönte es aus der Kombüse.
»Na, Sie haben uns ja einen schönen Schreck eingejagt.« Kaltensporn half dem Mann beim Ausziehen der Jacke und forderte ihn auf, sich an den Tisch zu setzen. Die Männer scharten sich um den nächtlichen Besucher, die Gesichter vor Neugier und Erregung gerötet.
Grams sah schlimm aus. Rote Flecken auf den Wangen, dunkle Ringe unter den Augen, die Nasenspitze verfärbt. Kaltensporn spürte, dass etwas passiert war, aber es war wichtig, dass der Mann sich erst mal beruhigte.
»So, da kommt schon der Kaffee«, sagte er und lächelte. »Und noch ein paar Kekse dazu. Danke, Kurt. Na, dann erzählen Sie mal. Sind Sie mit dem Klammerbeutel gepudert oder warum statten Sie uns mitten in einem Sturm einen Besuch ab?«
»Es … es ist was schiefgegangen, Oberleutnant. Es hat Tote gegeben und … ach, es ist schrecklich. Die F… Funkanlage ist defekt. Ich habe Be… Befehl, Ihnen mit… mitzuteilen, dass Sie eine Verbindung zum Flottenoberkommando und zu Admiral Ci… Ciliax herstellen sollen. Er soll so… sofortige Evakuierungsmaßnahmen ergreifen. Er m… muss uns ein U-Boot oder einen Eisbrecher schicken, ansonsten wer… werden wir alle …«
»Halt, halt, immer der Reihe nach.« Kaltensporn hob die Hand. Der Junge redete, als wäre er im Fieberwahn.
»Ich kann bei diesem Sturm keine Funkmeldung rausschicken und schon gar nicht werde ich der Admiralität irgendwelche Räuberpistolen auftischen. Nicht, ehe ich weiß, was los ist. Jetzt versuchen Sie mal, sich am Riemen zu reißen, und erstatten Sie mir anständig Meldung, verstanden?«
Grams nickte und nahm noch einen Schluck aus seinem Pott. Seine bleichen Finger zitterten, als hätte er Schüttelfrost, dabei war ihm eindeutig heiß. Auf seiner Stirn glänzten Schweißperlen.
»Ich s… saß gerade beim ersten Wachoffizier im Aufenthaltsraum. Wir spielten eine Partie Sch… Schach, als plötzlich das rote Warnlicht anging und die Sirene ertönte. Ich … ich sprang auf und rannte raus. Wir alle rannten raus. Auf dem Gang herrschte Chaos. Wiss… Wissenschaftler, Assistenten, Offiziere. Nie… niemand schien eine Ahnung zu haben, was da l… los war.«
Grams sog die Luft ein und ließ ein donnerndes Niesen hören.
Kaltensporn lächelte. Der arme Kerl konnte einem richtig leidtun. »Gesundheit, mein Lieber. Brauchen Sie ein Taschentuch?«
»G… geht schon. Ich hab mein ei… eigenes.« Grams griff in die Tasche, zog ein Tuch heraus und putzte seine Nase. Roter Schleim bedeckte den Stoff. Kaltensporn schaute nach unten. Der Tisch rund um den Kaffeepott war voller roter Punkte.
»Jesus, Maria und Josef!« Instinktiv rückte er mit seinem Stuhl ein Stück weg.
Grams schien sich entschuldigen zu wollen und wischte mit dem Ärmel über die Holzplatte. Mitten in der Bewegung hielt er inne und fing an zu zittern. Er schien einen Anfall zu haben. Er wurde geschüttelt wie Espenlaub und musste sich an der Tischkante festhalten, um nicht vom Stuhl zu rutschen. Ein einzelner Blutstropfen trat aus seinem Augenwinkel und lief seitlich die Nase entlang.
Kaltensporn sprang auf. Mit einer Mischung aus Ekel und Mitgefühl blickte er auf ihren Gast. Er wusste nur aus Gerüchten, was drüben in den Labors erforscht wurde: biochemische Kampfstoffe, die schlimmsten, die es jemals gegeben hatte. Oberste Geheimhaltungsstufe. Die Tatsache, dass diese Labors unter solch lebensfeindlichen Bedingungen errichtet worden waren, sprach Bände. Offenbar wollte man verhindern, dass eventuell ausbrechende Erreger eine Masseninfektion auslösten.
Auch den anderen schien zu dämmern, in welcher Gefahr sie sich befanden. Stück für Stück wichen sie vor dem unglücklichen Oberfähnrich zurück, der mit blutigem Schaum vor dem Mund am Tisch saß und verzweifelt versuchte, die Contenance zu bewahren. Was immer es war, das ihm so zu schaffen machte, die Wärme und der Kaffee machten es schlimmer.
»Was ist da drüben passiert?«, fragte Kaltensporn, seine Stimme eine Spur zu schrill. »Sie sagten, etwas sei schiefgegangen. Ist es was Biologisches? Habt Ihr euch mit irgendetwas infiziert? Was ist es? Reden Sie endlich, Mann!«
Grams wollte etwas antworten, doch er bekam nur ein dumpfes Blubbern heraus. Dann fiel er seitlich vom Stuhl. Sein Körper zappelte wie ein Aal in der Pfanne. Mit weit aufgerissenen, blutunterlaufenen Augen starrte er an die Decke. Dann fing er an zu schreien.
Kaltensporn hatte schon einiges erlebt. Er hatte Freunde fallen sehen, er hatte gesehen, wie Menschen vor seinen Augen von Granatfeuer in Stücke gerissen wurden oder an Wundbrand langsam verreckten. Doch das hier war schlimmer. Der Mann schwamm in einer dunklen Lache. Er schwitzte im wahrsten Sinne des Wortes Blut.
»Weg von ihm! Dass ihm niemand zu nahe kommt. Alle rüber in den Schlafraum. Setzt eure Gasmasken auf, könnte sein, dass er was Ansteckendes hat. Wir müssen hier raus und alles gründlich desinfizieren. Los jetzt, raus mit euch, ich komme gleich nach.« Kaltensporn drückte sein Taschentuch vor Nase und Mund.
Draußen donnerte der Sturm gegen die Hütte. Während seine Männer rausstürmten, zappelte der Mann vor ihm und schrie sich die Lunge aus dem Leib. Inmitten seiner schrecklichen Todesqualen glaubte Kaltensporn immer wieder ein einzelnes Wort zu vernehmen. Ein Wort, das seine schlimmsten Befürchtungen weckte.
»Valhalla! Valhalla!«
Teil 1
Jenseits des Nördlichen
1
Kambodscha, 70 Jahre später …
Hannah schlenderte, von Banteay Samré kommend, auf dem Grand Circuit ein Stück entlang der roten Staubpiste, bog links in den Wald ab und folgte dem kleinen Pfad, der zur Tempelanlage von Prasat Prei führte. Die untergehende Sonne färbte die Schäfchenwolken rosa. Laut Wetterbericht sollte morgen ein strahlend schöner Tag werden. Die Luft im November war noch warm, aber die Schwüle der zurückliegenden Regenzeit war vergangen. Ein sanfter Wind hatte eingesetzt, der von den nördlich gelegenen Bergen in die Ebene strömte. Sie schaute auf die Uhr, es war kurz nach sechs. John wartete bestimmt schon. Der Abend hatte sich auf die Tempelstadt gelegt. Aus der Ferne waren vereinzelte Rufe und Gelächter zu hören, ansonsten war es still geworden in Angkor. Hin und wieder sah man noch einen Guide oder Parkangestellten, der Müll aufsammelte, ansonsten herrschte tiefe Ruhe. Die Kassenhäuschen waren verriegelt und die Ausgänge verschlossen; sie wurden nur bei Bedarf noch einmal geöffnet, um letzte Nachzügler hinauszulassen.
Hannah hob den Kopf. Im Auftrag des Milliardärs und Großindustriellen Norman Stromberg waren John und sie nach Südostasien gereist, um bei der Erkundung und Rekonstruktion der archäologischen Stätte im Norden des Landes mitzuhelfen.
Groß-Angkor galt als die größte Tempelstadt der Welt. Ein historisches Erbe, das sogar der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in den Jahren 1975 bis 1978 widerstanden hatte. Die Stadt, die durch die Tempelanlage Angkor Wat zu Weltruhm gekommen und von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden war, erstreckte sich auf einer Fläche, die so groß war wie New York City. Mit insgesamt eintausend Quadratkilometern war sie die größte vorindustrielle Stadt der Welt. In ihrer Blütezeit hatten hier mehr als eine halbe Million Menschen gelebt, die es mit Reisanbau und Handwerkskunst zu Wohlstand und Ansehen gebracht hatten. Selbst die gewaltigen Metropolen der Maya nahmen sich dagegen winzig aus. Und die Erforschung war noch lange nicht abgeschlossen. Immer mehr Straßen, Kanäle und Bauwerke waren in den letzten Jahrzehnten entdeckt worden, vor neugierigen Blicken aus der Luft durch das dichte Blätterdach des Dschungels geschützt. Für Hannah, die ihre ersten Forschungsjahre in den Wüstengebieten Nordafrikas verbracht hatte, war es eine ziemliche Umstellung, hier zu arbeiten. Andererseits: Sie liebte Herausforderungen. Angkor war nicht nur wegen seiner Vielzahl von Baudenkmälern so faszinierend, die gesamte Anlage barg ein Geheimnis. Ohne Zweifel war sie eine hydraulische Stadt: eine Metropole, in der alles – Transport, Verkehr, Bewässerung – über Kanäle geregelt worden war. Das Areal war durchzogen von einer Unzahl von Wasserwegen, die sämtliche Bereiche der Stadt miteinander verbanden. Selbst die bis zu eineinhalb Tonnen schweren Sandsteinblöcke, aus denen die atemberaubenden Tempel erbaut worden waren, hatte man auf diesen Wasserwegen transportiert. Heute waren die Kanäle natürlich verlandet, aber wenn man nach ihnen suchte, konnte man sie immer noch erkennen.
Den Forschern des Greater Angkor Projekts, kurz GAP genannt, war es mit Hilfe von NASA-Satelliten und Ultraleichtflugzeugen gelungen, 1000 künstlich angelegte Seen sowie 74 neue Tempelanlagen zu entdecken, die anschließend beschrieben, vermessen und kartographiert wurden. Angkor war endlich der Rang zuerkannt worden, den es bei einer Vielzahl bedeutender Forscher in aller Welt schon lange genoss: als das größte städtische Netzwerk der Antike.
Hannah blieb kurz stehen, um sich zu orientieren. Ein Schwarm Bartsittiche fegte über sie hinweg und strebte johlend und krakeelend in Richtung Westen. Über den Wipfeln der Bäume konnte sie schon die Spitzen des Tempels von Prasat Prei erkennen. Der betörende Duft von Khmer-Küche umschmeichelte ihre Nase. Etwa zwanzig Meter abseits des Pfades, inmitten der Bäume, saßen ein paar Waldarbeiter um einen Kochtopf versammelt. Den Federn auf dem Boden und dem Geruch in der Luft nach zu urteilen, schmorte darin gerade ein frisch geschlachtetes Hühnchen. In einem zweiten Topf direkt daneben köchelte eine Suppe. Hannah lief das Wasser im Mund zusammen. Ihr fiel ein, dass ihr Lunchpaket immer noch unangetastet war. Sie war so in die Arbeit vertieft gewesen, sie hatte es schlichtweg vergessen.
Die Männer sahen sie und winkten sie zu sich herüber. Hannah entschied, die Einladung lieber nicht anzunehmen. Die Kerle sahen ziemlich verwegen aus, außerdem wurde sie erwartet. Sie hob die Hand, lächelte und ging weiter.
Weshalb hatte John sie hierherbestellt?
Die Notiz, die heute Morgen auf ihrem Nachttisch gelegen hatte, lautete schlicht und ergreifend: Prasat Prei, 18 Uhr. Verspäte dich nicht. Und sieh zu, dass du allein kommst. Kuss, John.
Ihr schlug das Herz bis zum Hals, als sie daran dachte, was diese Botschaft bedeuten könnte. John hatte in den letzten Tagen immer wieder verschiedene Andeutungen gemacht. Er und Hannah waren zwar seit beinahe zwei Jahren ein Paar, aber von Heiraten war nie die Rede gewesen. Ihre Lebensplanung war einfach zu unsicher. Bis vor kurzem hatte es noch so ausgesehen, als ob John ans entgegengesetzte Ende der Erde reisen müsste, doch Stromberg hatte ein Einsehen gehabt und sie beide nach Südostasien geschickt. Doch wie lange? Und war das überhaupt wichtig?
Vielleicht war heute der Tag, an dem John die eine Frage stellen würde. Hannah musste lächeln, als sie daran dachte, wie sie sich kennengelernt hatten. Dass sie zueinandergefunden hatten, grenzte schon fast an ein Wunder, vor allem wenn man bedachte, was ihnen in der Zwischenzeit alles widerfahren war. Manche Paare wären danach in verschiedene Himmelsrichtungen davongerannt, doch nicht Hannah und John. Es schien, als wären Schweiß, Blut und Adrenalin der Kitt, durch den ihre Beziehung nur noch fester wurde.
Zugegeben, seit sie hier in Kambodscha waren, hatten sie nicht gerade viel voneinander gehabt. Die meiste Zeit ging für die Arbeit drauf, und abends, wenn alle zusammenhockten, gab es kaum mal die Möglichkeit, sich unbemerkt zu verziehen. Von den dünnwandigen Hütten, in denen sie untergebracht waren, ganz zu schweigen.
Hannah gehörte einem Team an, das für die Restauration der empfindlichen Sandsteinfiguren zuständig war. Hauptsächlich Apsaras – Tänzerinnen – die unter der Wärme, Schwüle und Feuchtigkeit zu leiden hatten. Hannah war dank ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Sandsteinritzungen ein idealer Partner für das German Apsara Conservation Project; mittlerweile hatte sie fast jede der knapp zweitausend Tempeltänzerinnen auf diesem Gelände schon mal berührt. Durch das Beklopfen der Figuren war sie in der Lage, sehr rasch festzustellen, ob eine Figur hohl war oder nicht.
Ihre bisherige Einschätzung war niederschmetternd. Von den Skulpturen waren rund 1300 akut bedroht und weitere 360 kaum noch zu retten. Die Gründe waren vielfältig: Wasserschäden, Erosion, Vulkanaschebefall. In jüngster Zeit waren zwei neue Patienten hinzugekommen: die kolossalen Tempel und Paläste in Ayutthaya und die buddhistische Tempelpyramide von Borobudur, die wie Angkor zum Weltkulturerbe gehörten.
Ziel war es, die Tempel so lange wie möglich vor dem Verfall zu retten, doch das war natürlich nur ein Spiel auf Zeit. In einhundert oder zweihundert Jahren würden Pracht und Herrlichkeit der alten Khmer-Kultur zerfallen sein. Es sei denn, man erfand Verfahren, die diese Kunstgegenstände unzerstörbar machten.
John arbeitete auf einem völlig anderen Gebiet. Er gehörte einem Team von Spezialisten an, die mit Hilfe eines neuartigen 3-D-Scanners ganze Steinblöcke vermaßen und virtuell im Rechner zusammensetzten. Auf diese Weise konnten Gebäude rekonstruiert werden, die vor Jahrhunderten eingestürzt waren, und zwar ehe man auch nur einen einzigen Stein anfassen musste. Das Ganze glich einem einzigartigen dreidimensionalen Puzzlespiel, bei dem jeder Stein individuell geformt war und mit den anderen in einem Verbund gänzlich ohne Mörtel zusammenhielt. Selbst die Schwerkraft und ihre Auswirkungen auf die darunterliegenden Felsblöcke wurden rechnerisch mit einbezogen. Erst wenn der Tempel vollständig rekonstruiert war, konnte man damit beginnen, die durchnumerierten Blöcke in der Realität zusammenzusetzen. Ein ungeheurer Vorteil, wenn man bedachte, dass so ein Tempel aus bis zu tausend einzelnen Steinen bestehen konnte.
Auch Prasat Prei war zum großen Teil in sich zusammengefallen. Der große Hauptturm allerdings stand noch. Majestätisch erhob er sich über die Rasenfläche und ließ das Licht der untergehenden Sonne auf seinen Flanken schimmern. Zu dieser Stunde und so völlig verlassen von Menschen, wirkte er wie ein verwunschener Palast aus Tausendundeiner Nacht.
Hannah trat auf die Lichtung hinaus und sah sich um. Ihr Lebensgefährte war nirgends zu sehen.
»John?«
Ihr Ruf verklang in der Ferne.
»Bist du da?«
Keine Antwort.
Hannah zog den Brief aus der Tasche und überflog noch einmal die Zeilen. 18 Uhr. Gut, sie hatte sich ein paar Minuten verspätet, aber John würde doch bestimmt auf sie warten. Er wusste, dass Uhrzeiten hier draußen immer nur eine vage Annäherung bedeuteten. Hatte sie sich im Tag geirrt? Sie drehte die Notiz um, aber es stand kein Datum drauf.
»John?«
Immer noch nichts.
Nun, vielleicht war sie ja diejenige, die zu früh dran war. Machte nichts, dann nutzte sie die Zeit eben, um sich ein bisschen umzuschauen.
Sie war schon lange nicht mehr hier gewesen. Die Ruinen erschienen ihr wie aus einem Hollywoodfilm. Tatsächlich waren unweit von hier, im Bayon Tempel, Teile des Films Tomb Raider gedreht worden. Die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels mit Angelina Jolie in der Rolle der unverwüstlichen Lara Croft war der finanziell erfolgreichste Actionfilm aller Zeiten, in dem ein weiblicher Star die Hauptrolle spielte. Die Dreharbeiten hatten im Jahr 2000 hier stattgefunden und Kambodscha »zurück auf die Landkarte« gebracht, wie es im Pressetext zum Film so vollmundig hieß. Welch großen Einfluss die Kinoindustrie mittlerweile auf den Fremdenverkehr hatte, ließ sich an der Zahl der Touristinnen ermessen, die sich in Lara-Croft-Pose von ihren Begleitern vor dem Tempel ablichten ließen. Der Film war herrlich albern und fernab jeglicher Realität, aber immerhin konnte man ein paar Gesichtstürme sowie die sensationellen Reliefs des Tempels bewundern. Sie zogen sich um die gesamte innere Galerie und erzählten aus dem Alltag der Khmer. Vom Leben im Palast, von den Besuchen chinesischer Gesandter – die an ihrem Haarschmuck und ihrer Kleidung zu erkennen waren –, von Königen und Königinnen und natürlich von den vielen Schlachten, die zum Erhalt des Reiches geschlagen worden waren. So konnte man zum Beispiel eine Seeschlacht bewundern, bei der ein getöteter Soldat aus dem Boot geworfen und von hungrigen Krokodilen gefressen wurde.
Hannah schlenderte an der Hauptfront des Turms vorbei und blieb kurz stehen. Im Inneren brannte eine einzelne Kerze. Was mochte das bedeuten? Neugierig betrat sie das Dunkel.
»John?« Ihre Stimme hallte von den Wänden wider.
Es roch feucht und modrig. Die Kerze stand hinter einer Absperrung am Fuß eines wackelig aussehenden Holzgerüsts, auf dem eine Staffel von Leitern in Abschnitten steil nach oben führte. Gleich auf der ersten Zwischenstufe befand sich eine zweite Kerze, und eine dritte noch weiter oben.
Keine Frage, jemand war hier.
Aber wer? Niemand würde es wagen, unbeaufsichtigt in einem Tempel Feuer brennen zu lassen. Die Antwort lag auf der Hand.
Wieder spürte Hannah ihr Herz klopfen, diesmal stärker.
Sie sah sich kurz um, stieg über die Absperrung und setzte ihren Fuß auf die Leiter. Der Botschaft aus Lichtern folgend, stieg sie nach oben.
Sie hatte die vierte Ebene erreicht, als ihr Aufstieg unvermutet gestoppt wurde. Die Leiter endete an einer hölzernen Decke, die mit einer Falltür versperrt war. Das Holz sah alt aus, war also vermutlich vor etlichen Jahrzehnten hier eingezogen worden. Hannah warf einen kurzen Blick nach unten, bereute diese Entscheidung aber sofort wieder. Der Höhe nach zu urteilen, befand sie sich knapp unterhalb der Turmspitze. Sie ergriff den eisernen Ring der Falltür und öffnete sie vorsichtig. Goldenes Abendlicht strömte ihr entgegen.
Vor dem Turmfenster zeichnete sich Johns Silhouette ab. Er beugte sich zu ihr herunter, reichte ihr seine Hand und zog sie mit einem kräftigen Griff hinauf.
»Na, hast du den Weg zu mir gefunden? Gerade noch rechtzeitig würde ich sagen.«
Er lächelte sie an und senkte seine Lippen auf die ihren. Sie erwiderte den Kuss, doch als sie daran dachte, was er hier für ein Spiel mit ihr spielte, ließ sie ihn los und trat einen Schritt zurück.
John hatte es geschafft, in den Jahren, seit sie zusammen waren, immer noch besser auszusehen. Scharf geschnittene Nase, ein markantes Kinn und dazu diese unverwechselbaren Augen. Gut, sein Haaransatz war ein bisschen zurückgegangen, aber es stand ihm. Es ließ ihn männlicher und entschlossener wirken.
»Ich hoffe, du nimmst mir meinen kleinen Scherz nicht übel«, sagte er mit weicher Stimme. »Ich habe dich schon eine ganze Weile beobachtet, aber ich wollte, dass du den Weg allein findest. Ich wollte den Zauber nicht dadurch zerstören, dass ich dich wie ein Touristenführer behandle.«
Hannah strich eine Strähne aus ihrem Gesicht und lächelte. Sie hatte John noch nie wegen irgendetwas böse sein können.
»Ich muss gestehen, deine Nachricht hat mich neugierig gemacht. Ich trage sie bereits den ganzen Tag mit mir herum. Was ist denn nun das Geheimnis?«
Er lächelte. »Keine dreißig Sekunden, und du willst, dass ich alle meine Karten auf den Tisch lege? Du bist die ungeduldigste Frau, die ich kenne.«
»Hättest du es gerne anders? Ich kann auch ganz zahm sein. Still, fügsam und langweilig.« Sie verschränkte die Arme und zog einen Schmollmund.
Er lachte. »Nein, lass nur. Ich liebe dich so, wie du bist, mit allen Ecken und Kanten. Ich mag unsere kleinen Auseinandersetzungen. Und Reibung erzeugt ja erwiesenermaßen Wärme.«
Sie zwinkerte ihm zu. »Heißt das, du findest mich anstrengend?«
»Nicht doch. Herausfordernd vielleicht, aber du weißt ja, wie sehr ich Herausforderungen liebe. Außerdem wollte ich, dass du das hier siehst.«
Er trat einen Schritt zurück und deutete auf die Basreliefs entlang der Wände. Hannah zog eine Braue in die Höhe. Die tiefstehende Sonne fiel durch eine schmale Öffnung in der Außenwand und beleuchtete den hinteren Teil des Raumes. Zu jeder anderen Stunde wären die Bildhauerarbeiten unsichtbar gewesen, doch jetzt lagen sie in voller Pracht vor ihr. Schlagartig wurde ihr bewusst, warum John so sehr auf Pünktlichkeit Wert gelegt hatte. Sie schritt die Darstellungen ab und fuhr mit den Fingern darüber. Als ihr klarwurde, was sie da sah, zuckte ihre Hand zurück.
»Oh«, sagte sie. »Das ist … also wirklich … ich muss schon sagen …« Sie spürte, wie sie rot wurde, und musste sich räuspern.
Die Arbeiten waren schlicht und ergreifend pornographisch. Ganz unzweifelhaft fielen sie in den Zeitraum der Regentschaft von Yasovarman I., der von 889 bis 910 nach Christus geherrscht hatte und einer der bedeutendsten Könige des Khmer-Reiches war. Während seiner Herrschaft waren einige der schönsten Steinmetzarbeiten aller Zeiten entstanden. So wie diese. Wieder mal Apsaras, aber diesmal anders.
Dem hinduistischen Glauben folgend, sind Apsaras weibliche Wolken- und Wassergeister, die in zwei Formen vorkommen: die weltlichen Laukika, von denen 34 existieren, und die göttlichen Daivika, von denen es nur zehn gibt. Geschaffen von Brahma, sind sie die Hofdamen im himmlischen Palast des Gottes Indra. Ihre Aufgabe besteht darin, die Götter und Göttinnen zu unterhalten. Ihre Namen sind in Indien auch heute noch unter den Frauen sehr beliebt. Urvashi, Surotama, Rambha, Vishala und Vasumati, was so viel wie »von unvergleichlichem Glanz« bedeutete. In den meisten Fällen sieht man sie beim Tanz, doch es gibt auch Darstellungen, in denen sie den Göttern bei Tisch aufwarten oder sie mit Spielen unterhalten. Niemals jedoch hat man sie bei sexuellen Kontakten gesehen, weder mit Göttern noch mit Menschen. Doch genau das war hier der Fall. Das Relief zeigte so ungefähr jegliche mögliche Spielart des Geschlechtsverkehrs, heterosexuell wie gleichgeschlechtlich. Selbst was den Gruppensex betraf, schien es keine Beschränkungen zu geben. Eine Frau mit drei Männern? Hier war es zu sehen, und zwar in allen Einzelheiten.
»Mmh …« Hannah strich mit den Fingern über ihre Lippen. Die Schwüle stieg ihr zu Kopf. Die Energie dieser Bilder sprang ungefiltert auf sie über. Als sie einen Schritt zurücktrat, spürte sie, dass John hinter ihr stand.
»Und, gefallen sie dir?«
»Sie sind großartig, nein, mehr noch: sensationell.« Sie lachte. »Ein vorzeitlicher Gangbang. Das ist … also … tja.«
John grinste. »So sprachlos? Na, das muss ich ausnutzen und dir ein bisschen was darüber erzählen. Ein Freund von mir hat sie entdeckt. Es war blanker Zufall, das Relief ist nämlich nur zu einer bestimmten Tageszeit zu sehen. Die Sonne muss ganz flach über dem Horizont stehen, damit das Licht durch das Fenster bis in den hinteren Teil der Kuppel fallen kann. Als er sie mir zeigte, bat ich ihn, die Entdeckung noch nicht rauszugeben. Ich wollte, dass du sie völlig unvoreingenommen siehst. Erkennst du, wie schön die Formen hervortreten? Fast als wären sie lebendig.«
»Sie scheinen sich zu bewegen …«
Er senkte seine Lippen auf ihren Nacken und küsste sie. »Habe ich dir schon einmal gesagt, wie unwiderstehlich du riechst?«
»Ich bin verschwitzt.«
»Vielleicht eben darum. Dein Geruch bringt mich um den Verstand.«
Hannah stutzte einen Moment, dann drehte sie sich um. Ein Zwinkern in ihren Augen. »Moment mal … was genau soll das hier werden?«
Er zuckte die Schultern und setzte sein verführerischstes Lächeln auf. »Wonach sieht es denn aus?«
Hannah spürte, wie ihr trotz der Temperaturen noch ein paar Grad wärmer wurde. »Nicht nach einem archäologischen Fachtreffen, so viel ist mal sicher.«
Er fuhr mit seinen Händen über ihre Schultern und dann die Hüften hinab. »Nein?«
»Nein.«
Seine Hände wanderten weiter bis zu ihrem Po, während er fortfuhr, ihren Hals zu liebkosen. »Ich hasse dieses Camp«, murmelte er. »Ich hasse es, wie die Sardinen zusammengepfercht zu wohnen, obwohl doch so viel Platz um uns herum ist. Das Camp kann nur von Leuten erbaut worden sein, die entweder noch nie in einem tropischen Land waren und die daher nicht wissen, wie rollig einen diese Temperaturen machen, oder – und das halte ich für wahrscheinlicher – die nur für ihre Arbeit leben und nie einen Gedanken an Sex verschwenden. Wenn man verhindern möchte, dass alle im Camp etwas mitbekommen, muss man also erfinderisch sein.« Seine Hände griffen fester zu.
»So erfinderisch, wie du es gerade bist?«
»Das hoffe ich doch.« Er lächelte.
Sie warf einen Blick zu Seite. »Der Holzboden sieht recht hart aus …«
»Wenn das deine einzige Sorge ist, ich würde mich freiwillig anbieten …« Seine Lippen suchten die ihren. Der Kuss stieg ihr zu Kopf und machte sie willenlos. Hannah spürte, wie sie in seinen Armen zerschmolz, wie eine Woge von Gefühlen über sie hereinbrandete und der Anblick der Apsaras sie nur noch mehr anstachelte. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging sie vor ihm auf die Knie und öffnete seine Hose.
Der Spaziergang zurück zum Camp verlief wie auf Wolken. Hannah spürte kaum noch, wie ihre Füße den Boden berührten. Ihre Schritte waren weich und federnd. Über ihnen prangte groß und unverkennbar das Sternbild des Orion. Hinter den Zinnen der Tempel war ein sichelförmiger Mond aufgegangen. Von links, aus einer Gruppe hoher Bäume, die nur als Schattenriss zu sehen waren, erklang der melancholische Ruf einer Eule.
Hannah ergriff Johns Hand und ließ sie nicht mehr los. Sie genoss seine Nähe, seine Berührungen und seinen Geruch. Und sie liebte es, an der Seite dieses Mannes durchs Leben gehen zu dürfen. Glücklich lächelnd legte sie ihren Kopf an seine Schulter. Keine Macht der Welt konnte sie jetzt noch auseinanderbringen.
Kaum waren sie im Lager angekommen, lief ihnen Arun Sang über den Weg. Arun war ihr einheimischer Berater und Ansprechpartner in religiösen Fragen. Niemand wusste so viel über die Traditionen der Khmer wie er, darüber hinaus war er noch ein ausgezeichneter Pokerspieler. Hannah hatte bereits über fünfzig amerikanische Dollar an ihn verloren und sich geschworen, nie wieder gegen ihn zu spielen. Zumindest nicht um Geld.
Als er sie bemerkte, leuchtete er ihnen mit seiner Taschenlampe ins Gesicht. »Hannah, John. Wir haben schon überall nach euch gesucht.«
Hannah hob ihre Hand gegen den blendenden Schein. »Mach das Licht aus. Wieso habt ihr uns gesucht, ist etwas vorgefallen?«
»Das nicht, aber … ach, ich glaube, es ist besser, ihr seht es euch selbst an.«
Hannah und John warfen sich einen bedeutungsvollen Blick zu und folgten Arun ins Camp. Wie üblich für diese Zeit waren die Mitglieder der Restaurations- bzw. Archäologieteams beim Abendessen versammelt und sprachen über ihre Arbeit. In einigen Hütten brannte Licht, was darauf hindeutete, dass manche ihre Abschlussberichte noch nicht fertiggestellt hatten. Es wurde geredet, gelacht und gegessen. Das Buffet verströmte einen betörenden Geruch.
»Da seid ihr ja«, ertönte ein Ruf, als sie in den Lichterkreis traten. Köpfe wandten sich ihnen zu, und die Gespräche verstummten.
»Wir wollten schon eine Vermisstenmeldung rausschicken. Ist es nicht etwas spät für archäologische Erkundungen?« Auf etlichen Gesichtern war ein breites Grinsen zu sehen. Hannah spürte, wie sie rot anlief. Sie hatte das Gefühl, schnell von hier verschwinden zu müssen.
»Kümmert euch um euren Kram«, rief John zurück. »Und lasst uns noch etwas zu essen übrig. Ich bin hungrig wie ein Bär.«
Wissendes Gelächter ertönte, gefolgt von ein paar anzüglichen Bemerkungen. Hannah folgte Arun mit schnellen Schritten.
Drüben in der Funkhütte standen Satellitenempfangsanlagen, Drucker und Kommunikationsrechner. In einem Regal waren etliche Ablagefächer, auf denen ihre Namen standen. Arun griff in Hannahs Fach und reichte ihr ein Schreiben. Noch ehe sie ihre Hand danach ausstrecken konnte, hatte John ihr den Zettel vor der Nase weggeschnappt.
»Na, hör mal …«, stieß sie aus, doch er überflog die Mitteilung bereits. Typisch John. Er war der Meinung, Paare dürften keine Geheimnisse voreinander haben. Ihre Empörung wich echter Sorge, als sie seinen Gesichtsausdruck bemerkte.
»Was ist los?«, fragte sie.
Wortlos reichte er ihr das Papier. Es war der Ausdruck einer verschlüsselten Nachricht aus dem Hauptquartier in Washington D.C. Das Symbol in der Adresszeile war unverkennbar.
Stromberg!
2
Freiburg …
Das Gebäude des Bundesmilitärarchivs, abgekürzt BArch-MA, war ein grober grauer Klotz an der Wiesentalstraße im Süden der Stadt. Es beherbergte das Archivgut des Bundesministeriums der Verteidigung, der Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung sowie die Unterlagen der Wehrmacht, der Waffen-SS und der Reichswehr. Vor allem aber war es für seine unermessliche Anzahl von Bildern, Karten und Plänen, von Nachlässen, Unterlagen von Soldatenverbänden und privaten Sammlungen bekannt. Eine Fundgrube für jeden Historiker, der es verstand, die Zeichen und Spuren richtig zu deuten.
Dr. Wolfram Siebert von der Universität Potsdam saß im vierten Obergeschoss an einem Fenstertisch, seine Nase tief über ein verwittertes Tagebuch gebeugt. Mit unverhohlener Erregung studierte er die Eintragungen, die vor langer Zeit mit geübter Handschrift zu Papier gebracht worden waren. Was dort zu lesen stand, konnte sich als Entdeckung von historischer Dimension herausstellen.
Sieberts Fachgebiet war die Besetzung Norwegens durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Sein Vater war damals aktiv am Unternehmen Weserübung beteiligt gewesen, was das Thema für ihn zu einer persönlichen Angelegenheit machte. Offiziell war Siebert zwar Angestellter der Universität, doch inoffiziell verdiente er sich etwas hinzu, indem er als Informant für einen Mann arbeitete, der sich in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend gab. Ein amerikanischer Großindustrieller, der mit seinen ausgedehnten Ölvorkommen in Alaska, der weltweit größten Tankerflotte und einem Verbund von Radio- und Fernsehsendern recht breit aufgestellt war. Mit einem geschätzten Vermögen von 50 Milliarden Dollar galt Norman Stromberg als einer der reichsten Männer der Erde, zwar hinter Bill Gates, der 61 Milliarden besaß, aber noch vor seinem Freund und Kollegen, dem amerikanischen Großinvestor Warren Buffet mit 41 Milliarden. Doch schien sich Stromberg aus seinem Reichtum nur insofern etwas zu machen, als er ihm den Weg in die Welt der Vergangenheit ebnete. Stromberg galt als einer der versiertesten Kenner historisch bedeutsamer Epochen, und er war obendrein ein besessener Sammler. Ihm gehörten Höhlen in Südfrankreich, Paläste in Indien, Tempel in Japan und Schiffe, die mitsamt ihren Schätzen in den Tiefen des Meeres versunken waren. Sein Hunger auf Relikte mit einer außergewöhnlichen Geschichte war unerschöpflich. Ebenso wie sein Bankkonto.
Was die Nazizeit betraf, so war Strombergs Interesse begrenzt. Die Epoche lag noch nicht lange genug zurück, und der braune Sumpf, wie er ihn nannte, widerte ihn an. Immerhin war Stromberg jüdischer Abstammung. Was ihn aber faszinierte – und das wiederum verband ihn mit Siebert –, war das Faible führender Nazis wie Adolf Hitler oder Heinrich Himmler für das Okkulte.
Die Bewegung der Nazi-Archäologie hatte die Aufgabe gehabt, die Größe und Glorie des alten germanischen Reiches wiederauferstehen zu lassen. Ganz im Sinne der Thesen, die Tacitus in seinem Werk Germania beschrieben hatte. Der römische Dichter lobte in seinem 98 n. Chr. verfassten Buch die Germanen über den grünen Klee und setzte sie als Kontrapunkt zur römischen Dekadenz, Faulheit und Lasterhaftigkeit. Dieses idealisierte Sittenbild gefiel den Nazis natürlich, die daraufhin die Schrift als Grundstein für ihre Rassenlehre und die pseudowissenschaftliche Konstruktion eines Germanenmythos nutzten. Gipfel dieser geistigen Verirrungen waren zahlreiche archäologische Expeditionen in die Region des Südpols sowie in den Himalaja, auf der Suche nach Resten des großen Reiches von Atlantis, dessen Bewohner – so Himmler – die Vorfahren der Germanen waren.
Die dritte Expedition führte in den hohen Norden. Im Gegensatz zu den vorangegangenen fanden sich hierüber kaum Hinweise. Fast so, als wären sämtliche Spuren bewusst verwischt worden. Alles, was darüber zu finden war, beschränkte sich auf eine knappe Notiz, der zufolge drei U-Boote mit Wissenschaftlern an Bord unter oberster Geheimhaltungsstufe in Richtung Polarkreis entsandt worden waren. Ihr Ziel: die Entdeckung des Reiches Hyperborea. Die Spur führte nach Spitzbergen, wo angeblich Mauerreste einer prähistorischen Zivilisation unter dem Eis zu finden waren. Um was genau es dabei ging, war nicht festzustellen. Weder gab es Unterlagen darüber, noch war irgendwann, irgendwo auf Spitzbergen die Existenz solcher Ruinen dokumentiert worden. Die Spur verlief nicht im Sand, dafür jedoch im Schnee.
Dass Siebert das Gelesene Jahre später mit einer zweiten Spur in Verbindung brachte, dafür konnte er sich heute noch auf die Schulter klopfen. Sie hatte den Stein ins Rollen gebracht und ihn auf Umwegen bis zu dem Punkt gebracht, an dem er heute stand. Kaum mehr als eine Fußnote und für jemanden ohne Sieberts Weitblick nicht erwähnenswert, im richtigen Kontext aber der reinste Sprengstoff. Es handelte sich um die Erwähnung einer geheimen Forschungseinrichtung auf Spitzbergen, das zu dieser Zeit bereits unter der Führung der Wehrmacht stand. Die Quelle schwieg sich aus, was für eine Art von Einrichtung das war, aber sie musste etwas mit gefährlichen Kampfstoffen zu tun haben, sonst hätte man sie nicht ans Ende der Welt verbannt. Sieberts Interesse war geweckt. Nach Monaten erfolgloser Quellensuche war er hier in Freiburg auf ein Tagebuch gestoßen, das seinen Vermutungen neue Nahrung verschaffte. Das Dokument stammte aus NS-Archiven, die jahrzehntelang in Sankt Petersburg unter Verschluss gelegen hatten und die im Zuge der deutsch-russischen Freundschaft zurück nach Freiburg gewandert waren. Das Tagebuch eines gewissen Oberleutnant Karl-Heinz Kaltensporn, Kommandant einer kleinen Wetterstation weit jenseits des Polarkreises. Was dieser Mann zu berichten hatte, konnte einem den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Wenn man die stetig schlechter werdende Schrift berücksichtigte, hatte er bis zu seinem Tod weitergeschrieben. Bis zu dem Moment, als er sein Leben mit einem letzten verseuchten Atemzug ausgehaucht hatte. Das Buch war dann nach dem Krieg im Schnee gefunden worden, zusammen mit ein paar Leichen, die offenbar seltsame physiognomische Merkmale aufgewiesen hatten.
Eine Geschichte ganz und gar nach Sieberts Geschmack. Auch Stromberg hatte sich beeindruckt gezeigt. Nicht so sehr von den Berichten über Kampfstoffe und unmenschliche Experimente, dafür aber von dem Begriff Hyperborea – was so viel wie Jenseits des Nördlichen bedeutete. Dieses Wort, geschrieben in der Handschrift eines sterbenden Mannes, veränderte alles. Mit einem Mal öffneten sich die Kassen, und es floss Geld auf Sieberts Konto. Mehr, als er sich je zu erträumen gewagt hatte. Für ihn das Zeichen, dass die Jagd nun erst richtig beginnen konnte.
Siebert blätterte aufgeregt ein paar Seiten zurück, als plötzlich ein Schatten auf ihn fiel. Er war so vertieft in seine Lektüre gewesen, dass er das Kommen der Archivarin nicht gehört hatte.
»Noch eine Tasse Kaffee, Herr Professor?«
Sein Kopf schoss empor.
»Wie bitte … was?«
Die Frau wedelte mit der Thermoskanne.
Sie war Mitte 40, ein wenig mollig und von einnehmendem Wesen. Siebert kannte sie schon von vorangegangenen Besuchen. Ihre Augen leuchteten, und um ihren Mund spielte ein bezauberndes Lächeln. So ganz anders, als man sich eine Archivarin gemeinhin vorstellte.
»Ob Sie noch einen Kaffee möchten? Ach nein, ich sehe, Sie haben Ihre Tasse ja noch gar nicht leer getrunken. Hat Ihnen der Kaffee nicht geschmeckt?« Ein sorgenvolles Augenklimpern.
»Oh, doch … ich war nur so beschäftigt …«
»Was Interessantes gefunden?« Sie verdrehte den Kopf, um einen Blick auf das Tagebuch zu erhaschen.
»Ziemlich interessant, ja. Ich wünschte, ich könnte mir das Buch ein paar Tage ausleihen.«
»Wenn es nach mir ginge, dürften Sie das gerne, aber die Statuten verbieten es leider. Kein Ausleihen, keine Kopien, nur handschriftliche Notizen. Sie wissen ja, wie das ist.« Sie zuckte die Schultern. »Ich habe mir das nicht ausgedacht …«
Wieder dieses ansteckende Lächeln.
Siebert war sich ziemlich sicher, dass sie nicht »nein« sagen würde, wenn er das Gespräch auf ein kleines Rendezvous heute Abend lenkte. Er hatte ein recht gutes Gespür, was Frauen betraf, und konnte sehr charmant sein. Wenn er seine Karten richtig ausspielte, würde er noch heute Nacht mit ihr im Bett landen. Eine verlockende Vorstellung. Andererseits, er war verheiratet, und die Sache hier war zu wichtig, um jetzt den Don Juan zu spielen. Er hatte vor, einen Verstoß gegen die Hausordnung zu begehen, und wollte lieber kein Risiko eingehen.
»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ich bin so folgsam wie ein Schoßhund. Und was den Kaffee betrifft …«, er griff nach seiner Tasse und leerte sie in einem Zug, »… ich hätte tatsächlich gerne noch einen. Er schmeckt phantastisch.« Er hielt ihr die Tasse hin, und sie füllte nach.
Als sie fertig war, wartete sie noch einen Moment. Doch als Siebert sich demonstrativ wieder seiner Lektüre zuwandte, zog sie einen kleinen Schmollmund und verschwand.
Von draußen klatschte Regen gegen die Scheiben. Siebert kannte das Gebäude wie seine Westentasche. Er war schon mindestens zwanzig Mal hier gewesen und hatte sich bei seinen Begehungen die Sicherheitseinrichtungen genau eingeprägt. Außer der üblichen Magnetschranke im Erdgeschoss sowie Gesichtskontrolle und Tascheninspektion gab es nur noch die Videoüberwachung, die in jedem Stockwerk gleich war. 24 Kameras, so ausgerichtet, dass sie praktisch die gesamte Etage lückenlos überblickten. Allerdings waren darunter vier Positionen, bei denen die Kameras nur ein eingeschränktes Bild lieferten. Eine davon hatte Siebert gewählt. Der Tisch, an dem er saß, wurde lediglich von einer einzigen Kamera erfasst. Keine Überschneidungen. Außerdem war sie auf seinen Rücken gerichtet; man konnte also nicht erkennen, was er mit seinen Händen tat. Dritter und entscheidender Vorteil: Es war ein Fensterplatz. Zu dumm, dass heute so ein trüber Tag war. Er hoffte trotzdem, dass die Aufnahmen gelingen würden. Er nahm noch einen Schluck aus seiner Tasse, raffte seinen ganzen Mut zusammen und griff in die Innentasche seines Jacketts. Dort war sein Autoschlüssel, der zusätzlich eine getarnte Fernsteuerung enthielt. Die Dokumentenkamera selbst war gut versteckt im Inneren seiner Krawatte. Er rückte sie zurecht, spielte ein wenig mit seinem Schlüssel herum und betätigte dabei den Auslöser. Jetzt hieß es alles oder nichts. Die Automatik war auf zehn Sekunden eingestellt. Während er so tat, als würde er lesen und sich dabei Notizen machen, blätterte er um und schoss weitere Fotos in Serie. Weder ein Geräusch noch ein Lichtsignal verriet die Arbeit der Kamera. Angespannt lauschte er, ob seine Spionageaktivität irgendein Aufsehen erregte, doch es blieb still. Keine Alarmsirene, kein blinkendes Licht, kein aufgeregt herbeilaufendes Sicherheitspersonal. Es schien alles zu klappen.
Als er das Tagebuch durchfotografiert hatte, warf er aus dem Augenwinkel einen Blick auf das Digitaldisplay seines Schlüssels und stellte erleichtert fest, dass 30 Aufnahmen gemacht worden waren. Er beendete die Aufnahme, schob den Schlüssel zurück in seine Innentasche und setzte die Tasse an seine Lippen. Obwohl ihm das Herz bis zum Hals schlug, war es unmöglich, ein Grinsen zu unterdrücken. Mein Gott, tat das gut, hin und wieder mal etwas Verbotenes zu tun. Erst der Flirt mit der Bibliothekarin und jetzt das hier. Er kam sich vor wie James Bond.
3
Washington D. C. …
Hannah bestieg den Aufzug, betätigte den Knopf für den sechsten Stock und wartete, bis die Tür zuging. Dann spürte sie den Andruck. Strombergs Büro lag in der siebenten Etage, wobei diese nur über einen separaten Eingang erreicht werden konnte. Das bedeutete vermutlich eine weitere Überprüfung ihrer Personalien und eine zusätzliche Leibesvisitation. Hannah überraschte das nicht. In Zeiten der Terrorgefahr gerieten solche Termine immer mehr zu einem Spießrutenlauf.
Die Fahrt dauerte zum Glück nicht lange. In Washington D.C. gab es keine Wolkenkratzer. Eine Eigenart, die die Metropole von anderen Millionenstädten der USA unterschied. Ein Gesetz des House of Congress aus dem Jahre 1910 hatte festgelegt, dass kein Gebäude höher als das Kapitol sein durfte. Später wurde das Gesetz dahingehend abgewandelt, dass die Gebäudehöhe die Straßenbreite nur um maximal 20 Fuß überschreiten durfte; dadurch war Washington verhältnismäßig flach bebaut.
Strombergs Firmensitz an der Pennsylvania Avenue war ein beeindruckendes Sandsteingebäude, das den Charme des ausgehenden 19. Jahrhunderts verkörperte. Der Architekt hatte den neoromanischen Baustil favorisiert, der Ende des 19. Jahrhunderts in den USA sehr populär gewesen war. Dieser zeichnete sich durch eine Vielzahl von Rundbögen, Türmchen und Erkern aus. So zumindest stand es in der Broschüre zu lesen, die Hannah, während sie auf ihre Anmeldung wartete, in der Lobby überflogen hatte.
Der Aufzug sauste nach oben, und Hannah drückte in banger Erwartung ihre Handtasche gegen die Brust. Zweimal war sie Stromberg bisher begegnet, doch immer an auswärtigen Orten. Einmal in Schottland, ein zweites Mal in Halle, wo sie ihn während einer Pressekonferenz anlässlich der Himmelscheibe von Nebra getroffen hatte.
John hätte ihr sicher einiges über den Washingtoner Firmensitz erzählen können – schließlich war er hier früher ein und aus gegangen. Doch leider hatte es dazu keine Gelegenheit gegeben. Strombergs Anweisungen waren klar: »Hannah, ich wünsche, dass Sie Ihre Zelte unverzüglich abbrechen und zu mir nach Washington kommen. Habe wichtige Neuigkeiten für Sie. Ein Ersatz für Sie ist schon auf dem Weg nach Angkor. Ihr Flug ist bereits gebucht. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Anhang. Sprechen Sie mit niemandem darüber und sagen Sie auch John nichts davon. Ich möchte Sie allein sehen. Hochachtungsvoll, Norman Stromberg.«
John musste also in Kambodscha bleiben. Grund genug für ihn, beleidigt die Ohren anzulegen und abzutauchen. Seine Enttäuschung war nachvollziehbar, immerhin war er jahrelang Strombergs Darling gewesen. Nun wurde sie statt seiner eingeladen, was schrecklich demütigend für ihn sein musste. Er hatte sich nicht mal die Zeit genommen, Hannah angemessen zu verabschieden. Und das nach dieser wundervollen Liebesszene.
Männer und ihr Ego!
Sie räusperte sich und richtete ihre Gedanken wieder nach vorne. Stromberg war kein gewöhnlicher Mensch. Fragte man ihn, was für ein Gefühl es sei, der drittreichste Mann der Welt zu sein, lief man Gefahr, vor die Tür gesetzt zu werden. Zeigte man ihm jedoch ein Mosaiksteinchen oder eine alte, angelaufene Münze, begannen seine Augen zu leuchten. Dann konnte es geschehen, dass man in ein stundenlanges Gespräch über Weltgeschichte verwickelt wurde.
John war ihm 1996 anlässlich des Weltklimagipfels in Kyoto begegnet, als er einen Vortrag über das rapide Abschmelzen des antarktischen Schelfeisgürtels hielt. Sein fundiertes Wissen über die klimatischen Veränderungen im Laufe der letzten Jahrtausende hatte den Milliardär beeindruckt, und er hatte John das Angebot gemacht, in seine Dienste zu treten.
Hannah hoffte, die Sache wieder einrenken zu können. Sie liebte John von ganzem Herzen und wollte nicht, dass er verletzt war. Bestimmt war es ohnehin nur eine Kleinigkeit, die Stromberg von ihr wollte.
Die Fahrstuhltür öffnete sich mit einem Glockenton. Hannah verließ den Aufzug und betrat weichen Teppichboden.
Direkt gegenüber dem Fahrstuhl befand sich eine kirschholzgetäfelte Rezeption, hinter der eine atemberaubend schöne Empfangsdame saß. Dunkle Haut, hochgesteckte Haare, maßgeschneidertes Business-Outfit. Als sie Hannah sah, hob sie ihren Kopf. Ihr Lächeln wirkte natürlich. »Ms. Peters?«
»Das bin ich, ja.«
Die Rezeptionistin stand auf und kam hinter dem Empfang hervor. »Mein Name ist Susan. Mister Stromberg erwartet Sie bereits. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?« Nichts an ihr war aufgesetzt oder übertrieben. Sie bewegte sich mit der Anmut einer Katze, ohne dabei sexy oder billig zu wirken. Stromberg hatte ein gutes Gespür für die Wahl seiner Mitarbeiter, so viel war sicher.
»Hatten Sie eine angenehme Reise?«
»Alles bestens, danke.«
Susan deutete auf eine Holztreppe, neben der sich ein schmaler, schmiedeeiserner Fahrstuhl befand. Offenbar der separate Zugang, von dem sie in der Lobby gelesen hatte.
»Mr. Strombergs persönliche Räume befinden sich ein Stockwerk höher. Wir können gerne den Aufzug nehmen, wenn Sie möchten …«
»Die Treppe ist perfekt. Um ehrlich zu sein, ich sehne mich nach ein bisschen Bewegung.«
»Sie sprechen mir aus der Seele.« Susan lächelte und trippelte mit kleinen, präzisen Schritten die stoffbespannten Stufen hinauf. Hannah hatte Mühe, mit ihr Schritt zu halten.
»Bitte warten Sie hier, ich werde Sie anmelden.«
Susan ging den Gang hinunter bis ans Kopfende und klopfte an eine schwere, überdimensionierte Holztür. Das gab Hannah einige Momente Zeit, zu Atem zu kommen und sich umzusehen.
Das Obergeschoss trug ganz eindeutig die Handschrift des exzentrischen Kunstsammlers. Rechts stand auf einem Marmorsockel eine wunderschön bemalte Ming-Vase. Links daneben hing eine Steintafel aus Assyrien, die König Assurbanipal zu Pferde auf einer seiner geliebten Löwenjagden zeigte. Eine in Gold gefasste Weltkarte markierte einzelne Fundorte und Herkunftsstätten. In den Regalen zu beiden Seiten des Flurs reihten sich goldene Trinkkelche aus Persepolis neben bemalten Krügen aus dem Palast von König Minos. Statuen, Kelche, Schmuck und Waffen, so weit das Auge reichte. Keines der Fundstücke war hinter Glas verborgen, was bei Hannah schon den Verdacht aufkommen ließ, dass es vielleicht nur Reproduktionen waren. Doch es war ihr Arbeitgeber persönlich, der ihren Verdacht zerstreute, als habe er ihre Gedanken gelesen.
»Keine Kopien, nur Originale. Ich hoffe, Sie sind beeindruckt.«
Hannah drehte sich um. Stromberg hatte sein Büro in Begleitung Susans verlassen und steuerte zielstrebig auf sie zu.
»Beeindruckt wäre untertrieben«, sagte Hannah. »Überwältigt trifft es eher.«
Strombergs zufriedenes Nicken zeigte ihr, dass sie den richtigen Ton getroffen hatte.
»Ich brauche Sie dann nicht mehr, Susan, danke.«
Die Empfangsdame lächelte Hannah zum Abschied zu und lief dann leichtfüßig die Treppenstufen hinab.
Stromberg hatte sich seit ihrer letzten Begegnung kaum verändert. Er war immer noch kahl wie eine Billardkugel, und auch sein Leibesumfang war – wenn überhaupt – kaum angewachsen. Allerdings zierte ein kleiner Spitzbart sein Gesicht, und der war neu. Gekleidet in einen passenden Anzug mit Weste und Uhrkette, bot Stromberg einen äußerst respektablen Anblick. Ein Mann, der wusste, was er wollte und wie er es bekam. Er streckte Hannah seine Hand entgegen.
»Es freut mich, dass ich Sie immer noch beeindrucken kann«, sagte er. »Noch mehr aber freut es mich, Sie endlich bei mir zu haben. Wie war die Reise?«
»Ich arbeite noch an den zwölf Stunden Zeitunterschied.«
»Daran sollten Sie sich in meinen Diensten doch langsam gewöhnt haben«, sagte er lachend. »Andererseits gibt es Dinge, die sind und bleiben ein pain in the ass, habe ich recht?«
»Sie sagen es.«
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen das zugemutet habe, aber ich hätte es nicht getan, wenn es nicht wirklich dringend gewesen wäre. Wir sind da auf eine Sache gestoßen, bei der ich Ihres Rates und Ihrer Einschätzung bedarf. Wo haben Sie Ihr Gepäck?«
»Ist bereits im Hotel. Weshalb haben Sie mich kommen lassen?«
»Das werden Sie gleich erfahren. Möchten Sie vorher noch etwas essen oder trinken? Wasser oder vielleicht etwas Stärkeres?« Er zwinkerte ihr zu.
»Nichts, danke.«
»Prima, dann können wir gleich aufbrechen. Folgen Sie mir.«
»Aufbrechen? Wohin wollen Sie mich denn bringen?«
»Lassen Sie sich überraschen. Es ist nicht weit, aber es wäre eine Ochsentour, es über den Landweg zu versuchen. Luftlinie hingegen sind es nur etwa dreißig Kilometer.«
»Luftlinie?«
Der Firmenmagnat drückte auf eine kleine Fernbedienung, und ein Summton erklang. Am Ende des Flurs öffnete sich eine Tür, durch die ein Schwall frischer Luft hereinströmte.
Ein schlanker Helikopter mit den Initialen von Strombergs Firmenimperium stand auf dem Landeplatz hoch über der Stadt. Sonnenlicht spiegelte sich auf seinen silbernen Flanken.
Stromberg machte eine einladende Geste. »Für mich immer noch die bequemste Art, zu reisen. Ich hoffe, Sie haben den Mut, sich meinen Flugkünsten anzuvertrauen?«
Die Metropole hinter sich zurücklassend, fegte die Bell 427 über das Wasser. Der Potomac funkelte im Licht der niedrig stehenden Sonne. Zahlreiche Boote flitzten wie weiße Möwen unter ihnen dahin. Der Fluss wurde breiter. Am rechten Ufer tauchten einige kleine Inseln auf. Hannah hatte ihre Ohrenschützer aufgesetzt und genoss den Flug. Norman Stromberg steuerte die Hightech-Flugmaschine persönlich, und er tat es mit der Leichtigkeit und Präzision eines Profis.
»Da drüben liegt Belle Haven«, rief Stromberg ihr über Lautsprecher zu und wies nach Westen. »Unter uns sehen Sie die Marina und den Golfplatz. Beides gehört mir, genau wie die Insel, die dort vorne auftaucht. Haben Sie das flache Gebäude bemerkt? Eine Forschungseinrichtung der Universität. Sie wird ebenfalls von mir finanziert. Das ist unser Ziel.«
Hannah beugte sich vor. Das Gebäude sah aus wie ein Bunker. Zahlreiche Antennen und Satellitenschüsseln befanden sich auf seiner Oberseite. Die Bell flog eine Kurve und steuerte dann auf einen kreisrunden Landeplatz am flussseitigen Ufer zu. Das Wasser aufwirbelnd, setzte der Helikopter auf. Ein Mann kam mit gesenktem Kopf aus einem nah gelegenen Häuschen gerannt, seine Haare vom Wind der Rotoren verwirbelt.
Stromberg ließ den Steuerknüppel los, drückte einige Knöpfe und löste seinen Gurt. Das Triebwerk erstarb. Hannah setzte die Kopfhörer ab, hängte sie an einen Haken und löste ebenfalls ihren Gurt, ehe sie den Hubschrauber durch die Seitentür verließ. Der Mann mit den verstrubbelten Haaren erwartete sie bereits. Er war jung, vielleicht 25, und trug eine dunkel gefasste Brille.
»Schön Sie wiederzusehen, Mister Stromberg. Guten Tag, Frau Dr. Peters. Ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Marcus. Ich werde für die nächsten Stunden Ihr Begleiter und Ansprechpartner sein. Wenn Sie etwas brauchen, Fragen haben oder einfach nur plaudern wollen, ich bin Ihr Mann.« Er lächelte herzlich.
»Freut mich, Marcus. Und bitte nennen Sie mich Hannah.«