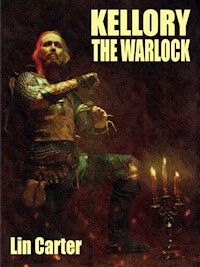8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
23 Erzählungen internationaler Spitzen-Autoren und -Autorinnen, vereint in einer Fantasy-Anthologie der Extra-Klasse (zusammengestellt und herausgegeben von Christian Dörge): u. a. von Tanith Lee, Michael Moorcock, Karl Edward Wagner, Robert E. Howard, Lin Carter, Roger Zelazny, C. J. Cherryh, Andrew J. Offutt, Ramsey Campbell, L. Sprague de Camp, Andre Norton, Henry Kuttner, Fitz Leiber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
CHRISTIAN DÖRGE (HRSG.)
Valkyrie
Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
L. Sprague de Camp: EUDORICS EINHORN (Eudoric's Unicorn)
Karl Edward Wagner: ZWEI SONNENUNTERGÄNGE (Two Suns Setting)
Clark Ashton Smith und Lin Carter: DIE TREPPE IN DER GRUFT (The Stairs In The Crypt)
C. J. Cherryh: DER DUNKLE KÖNIG (The Dark King)
Lin Carter: SCHWARZES MONDLICHT (Black Moonlight)
Robert E. Howard und Andrew J. Offutt: NEKHT SEMERKEHT (Nekht Semerkeht)
Poul Anderson: DIE GESCHICHTE VON HAUK (The Tale Of Hauk)
Andre Norton: DAS SCHWERT DES ZWEIFELS (Sword Of Unbelief)
Tanith Lee: EINER GEGEN DIE GÖTTER (Odds Against The Gods)
Ramsey Campbell: DIE SCHWINGEN DES GRAUENS (The Pit Of Wings)
Michael Moorcock: ELRIC AM ENDE DER ZEIT (Elric At The End Of Time)
Karl Edward Wagner: IM BANNE YSLSLS (In The Lair Of Yslsls)
Lin Carter: DER SCHWARZE FALKE VON VALKARTH (Black Hawk Of Valkarth)
Henry Kuttner: DONNER IN DER MORGENDÄMMERUNG (Thunder In The Dawn)
Roger Zelazny: DER WEG NACH DILFAR (Passage To Dilfar)
Andre Norton: DER TRÄUMESCHMIED (Dream Smith)
Fritz Leiber: STERNHÖH (In The Witch's Tent & Stardock)
Grail Undwin: EIN LANDMANN AM CLYDE (A Farmer On The Clyde)
Clark Ashton Smith: PRINZ ALCOUZ UND DER MAGIER (Prince Alcouz And The Magician)
Lin Carter: DIE SÄULEN DER HÖLLE (The Pillars Of Hell)
Philip Coakley: LOK, DER VERSETZER (Lok The Depressor)
Pat McIntosh: DER TRAUMUMHANG (The Cloak Of Dreams)
Phyllis Eisenstein: DAS LAND DER SORGEN (The Land Of Sorrow)
Das Buch
23 Erzählungen internationaler Spitzen-Autoren und -Autorinnen, vereint in einer Fantasy-Anthologie der Extra-Klasse (zusammengestellt und herausgegeben von Christian Dörge): u. a. von Tanith Lee, Michael Moorcock, Karl Edward Wagner, Robert E. Howard, Lin Carter, Roger Zelazny, C. J. Cherryh, Andrew J. Offutt, Ramsey Campbell, L. Sprague de Camp, Andre Norton, Henry Kuttner, Fitz Leiber.
L. Sprague de Camp: EUDORICS EINHORN (Eudoric's Unicorn)
Als Sir Eudoric Dambertsons Überlandkutschengeschäft gut lief, erwog er eine Erweiterung. Er würde den Linienverkehr von Kromnitch nach Sogambrium, der Hauptstadt des Neunapolitanischen Reiches, weiterführen. Er würde eine zweite Kutsche anschaffen. Er würde einen Schreiber anstellen, der ihm die lästige Buchführung abnahm.
Als erstes aber würde er sich das sogambrische Ende der Route näher ansehen. Also ließ er Bekanntmachungen in Zurgau und Kromnitch anschlagen, dass er an einem bestimmten Tag nicht in Kromnitch umkehren würde, um nach Zurgau zurückzukehren, sondern nach Sogambrium weiterzufahren gedachte, und jene mitnähme, die bereit waren, die entsprechenden Gebühren zu entrichten.
Sein stiller Teilhaber, Baron Emmerhard von Zurgau, der fast einmal sein Schwiegervater geworden wäre, gab ihm ein Empfehlungsschreiben mit, das Eudoric bei Erzherzog Rolgang, dem Bruder des Kaisers, einführen sollte.
»Als Geschenk«, sagte Emmerhard und strich über seinen graumelierten Bart, »schicke ich ihm einen meiner besten Hunde. Ohne Präsente erreicht man am Hof nichts.«
»Zu gütig von Euch, Sir«, bedankte sich Eudoric.
»Gar nicht so gütig, wie du glaubst. Vergiss nicht, den Preis der Hündin zu den Betriebskosten zu rechnen.«
»In welcher Höhe?«
»Klea würde mindestens fünfzig Mark einbringen...«
»Fünfzig! Mein guter Herr, das ist absurd! Dafür bekomme ich.«
»Werde nicht impertinent, mein Junge! Von Hunden verstehst du nichts!«
Nach längerem Hin und Her feilschte Eudoric den Preis für Klea auf dreißig Mark herunter, allerdings erschien auch der ihm noch viel zu hoch. Ein paar Tage später brach er mit einer Kutsche auf, an die er Klea gebunden hatte. Nach genau einer Woche trafen sie, mit Eudorics Gehilfe Jillo als Kutscher, in Sogambrium ein.
Nur ein einziges Mal, doch da war er fast noch ein Säugling gewesen, hatte Eurodic die Kaiserstadt gesehen. Im Vergleich mit ihr war Kromnitch eine Kleinstadt und Zurgau ein Dorf. Die Schiefergiebeldächer schienen sich wie die Wellen des Meeres endlos zu erstrecken.
Beim Anblick der Menschenmenge, die sich durch die breiten Straßen wälzte, fühlte Eudoric sich unbehaglich. Ihre Mode war von einer Art, wie sie in den ihm bekannten ländlichen Gegenden fremd war. Die Männer trugen Schuhe mit langen, nach oben gebogenen Spitzen und einer bis unter die Knie reichenden Verschnürung. An den Frauen fiel ihm vor allem die Kopfbedeckung auf: ein meterhoher Spitzhut. Jeder hier schien in größter Eile zu sein. Eudoric hatte seine liebe Not, den Dialekt dieser Leute zu verstehen. Die Sogambrier sprachen undeutlich und verschluckten ganze Silben. Außerdem benutzten sie kaum noch das höfliche Ihr und Euch.
Nachdem er sich Unterkunft in einem bürgerlichen Gasthof besorgt hatte, überließ er Kutsche und Gespann der Obhut des getreuen Jillos und machte sich mit Klea an der Leine durch das Grau des Nieselregens zum erzherzoglichen Schloss auf. Er versuchte zwar einerseits, sich nichts von den Sehenswürdigkeiten unterwegs entgehen zu lassen, wollte andererseits aber auch nicht auffallen, wenn er sich halb den Kopf verrenkte, um staunend alles aufzunehmen.
Der mit phantastischen, verschnörkelten Skulpturen modernen Stils verzierte Palast befand sich unmittelbar gegenüber der Kathedrale des Heiligen Paares. Eudoric hatte viel am Hof seines eigenen Souveräns, König Valdhelm III. von Locanien, zu tun, und so konnte er sich in etwa vorstellen, was er hier zu erwarten hatte: hauptsächlich endlose Wartezeiten, die sich nur durch reichliche Schmiergelder verkürzen ließen. Dank letzterer bekam er schon am nächsten Tag eine Audienz beim Erzherzog.
»Ein niedliches Tierchen«, sagte Rolgang und streichelte Kleas Kopf. Der in gold- und silberfarbene Seide gekleidete Erzherzog war ein feister Mann mit kleinen, leicht hervorquellenden Perlenäuglein. »Erzählt mir doch ein wenig von diesem Kutschenunternehmen, Sir Eudoric.«
Eudoric erzählte, wie er sich auf seiner Reise nach Pathenien zum erstenmal der Annehmlichkeiten des geregelten Postkutschendiensts erfreut hatte, der im Reich unbekannt war. Er berichtete, dass er sich daraufhin, auf seinem Heimweg nach Arduen in der Baronie von Zurgau, Grafschaft Treverien im Königreich Locanien, mit dem Gedanken befasst hatte, sich von den einheimischen Wagenbauern eine Kutsche nach pathetischem Vorbild anfertigen zu lassen.
»Das bedarf reiflicher Überlegung«, erklärte der Erzherzog. »Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Einführung für die Regierung unerwünschte Folgen haben könnten. Gesetzesbrechern wäre es durch diese Kutschen möglicherweise ein leichtes, sich der Gerechtigkeit durch rasche Flucht zu entziehen. Bankrotteure könnten mit diesen Fahrzeugen ihren Schuldnern entkommen und sich anderswo neu etablieren. Aufrührer würden viel weiter herumkommen und überall den Mob gegen die Monarchen aufwiegeln.«
»Andererseits, Eure Majestät«, gab Eudoric zu bedenken, »wenn das Unternehmen erst gut läuft, könntet Ihr es eines Tages besteuern.«
Die Perlenaugen leuchteten auf. »Aha, junger Herr. Ihr habt einen gesunden Geschäftssinn. Nun, wenn Ihr danach handelt, bin ich sicher, dass Seine Kaiserliche Majestät Eurem Unternehmen keine Hindernisse in den Weg legen wird. Wisst Ihr was? Seine Kaiserliche Majestät gibt morgen um zehn Uhr einen Morgenempfang. Findet Euch mit dieser Einladung in seiner Residenz ein, dann stelle ich Euch meinem kaiserlichen Bruder vor.«
Dieser unerwartete glückliche Umstand erfreute Eudoric so sehr, dass er daran dachte, sich einen neuen, modischen Anzug zu erstehen, obgleich seine sparsame Natur vor einer solchen Ausgabe zurückschreckte, ehe sein gegenwärtiger guter Anzug die ersten merklichen Spuren von Abnutzung aufwies. Aber würde es nicht vielleicht sogar einen besseren Eindruck machen, präsentierte er sich als Landedelmann, der er schließlich war, in dezenter, wenn auch nicht modischer Kleidung, statt zu versuchen, städtischen Gecken nachzuahmen? Dieser Gedanke erleichterte ihn ungemein.
Am nächsten Morgen stellte sich Eudoric - untersetzt, mit eckigem Kinn, ernster Miene, in einfachem Weinrot und Schwarz - in einer Reihe mit einem guten halben Hundert weiterer Edlen des Reiches auf. Kaiser Thorar IX. und sein Bruder schritten sie majestätisch ab, während der Zeremonienmeister jeden einzelnen mit ein paar Worten präsentierte:
»Eure Kaiserliche Majestät, gestattet, Euch Baron Gultholf von Drin vorzustellen. Er kämpfte heldenhaft in den Kaiserlichen Streitkräften bei der Unterwerfung der kürzlichen Rebellion in Avonien. Jetzt beschäftigt er sich mit der Erneuerung seiner Deiche und der Gewinnung neuen Polderlands.«
»Sehr schön, mein Lord von Drin«, lobte der Kaiser. »Wir müssen unseren irregeleiteten Untertanen, die von selbstsüchtigen Aufrührern aufgewiegelt wurden, zeigen, dass sie trotz allem unsere Gunst nicht verloren haben.« Thorar war groß, hager und von leicht gebeugter Haltung, mit einem graumelierten Spitzbart, zweifellos einem Toupet gleicher Haarfarbe, und etwas rasselnder Stimme. Er war ganz in Schwarz gekleidet, das jedoch durch zwei juwelenverzierte, riesige Orden aufgelockert wurde.
»Eure Kaiserliche Majestät«, sagte der Zeremonienmeister als nächstes, »das ist Sir Eudoric Dambertson von Arduen. Er führte eine Kutschenlinie zwischen Zurgau und Kromnitch ein.«
»Er ist es, von dem ich Euch erzählte«, murmelte der Erzherzog.
»Ah, Sir Eudoric!« rasselte der Kaiser. »Wir wissen von Eurem Unternehmen. Wir werden sogleich darauf zurückkommen. Aber - seid Ihr nicht dieser Eudoric, der einen Drachen in Pathenien tötete und später gegen jene monströse Spinne im Wald von Dimshaw kämpfte?«
Eudoric stotterte fast vor Verlegenheit. »Der bin ich, Eure Kaiserliche Majestät, doch ich muss gestehen, dass ich beides dem Glück zu verdanken hatte.« Er verschwieg, dass nicht er, sondern Jillo den Drachen getötet hatte, und das durch reinen Zufall. Und er selbst hatte aus Sentimentalität die Riesenspinne Fraka laufenlassen, als er nur noch seine Armbrust hätte abdrücken müssen.
»Unsinn, mein Junge«, wehrte der Kaiser seine Bescheidenheit ab. »Das Glück ist nur jenen hold, die sich seiner auch zu bedienen wissen. Da Ihr solches Glück mit ungewöhnlichen Ungeheuern bewiesen habt, hätten wir einen Auftrag für Euch.« Der Kaiser drehte sich halb zum Erzherzog um. »Hast du nach diesem Empfang eine halbe Stunde Zeit, Rolgang?«
»Selbstverständlich, Sire.«
»Gut. Dann bring diesen Jungen in mein Privataudienzgemach. Und lass dir von Heinmar Sir Eudorics Akte heraussuchen.«
Im Privataudienzgemach fand Eudoric den Kaiser, den Erzherzog, den Minister für Öffentliche Angelegenheiten, den Schreiber seiner Kaiserlichen Majestät, und zwei Leibwächter in Silberharnischen und Kammhelmen vor. Der Kaiser blätterte in einem dünnen Aktenordner.
»Setzt Euch, Sir Eudoric«, forderte Thorar ihn auf. »Dies benötigt Zeit, und Wir muten Unseren getreuen Untertanen nicht nutzlos schmerzende Knie zu. Ihr seid unverheiratet, wie wir sehen, obgleich Ihr die Dreißig fast erreicht habt. Wieso das?«
Eudoric dachte: der alte Junge mag vielleicht tatterig aussehen, aber sein Verstand ist zweifellos in Ordnung. Laut sagte er: »Eure Kaiserliche Majestät, ich war verlobt, doch jedes Mal raubten die Umstände mir die versprochene Braut. Nicht aus fehlender Neigung gegenüber dem holden Geschlecht bin ich noch unbeweibt.«
»Hm. Dagegen müssen wir etwas tun. Rolgang, ist deine jüngste Tochter schon versprochen?«
»Nein, Sire.«
Der Kaiser wandte sich wieder dem Landedelmann zu. »Sir Eudoric, es ist folgendes: Nächsten Monat besucht Uns der Großcham der Pantorozianer und bringt als Staatsgeschenk für Unsere Menagerie einen jungen Drachen mit. Wie Ihr vielleicht gehört haben mögt, ist Unsere zoologische Sammlung nach Unserer Sorge um das Wohlergehen Unserer Untertanen Unsere größte Leidenschaft. Aber um Unserer Ehre willen dürfen wir nicht zulassen, dass dieser heidnische Ostmann Uns an Großzügigkeit übertrumpft.
Drachen sind in Unserem Reich ausgestorben, außer es hausen vielleicht noch vereinzelte Exemplare in einsamen Gegenden. Wir erfuhren jedoch, dass sich westlich von Hessel, in Eurem Gebiet, die Wildnis von Bricken befindet, in der es einige sehr ungewöhnliche Tiere geben soll, unter anderem ein Einhorn.«
Eudoric hob eine Braue. »Eure Majestät möchten diesem Pantorozianer als Gastgeschenk ein Einhorn übergeben?«
»Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen. Nun, wie sieht es damit aus?«
»Oh - ah, so sehr ich auch diese Ehre zu schätzen weiß, Eure Kaiserliche Majestät, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich imstande wäre, diesen Auftrag auszuführen. Wie ich Euch bereits gestand, Eure Kaiserliche Majestät, verdanke ich es lediglich meinem Glück, dass ich bei meinen bisherigen Abenteuern mit dem Leben davonkam. Außerdem bedarf meine Kutschenlinie ständiger Aufmerksamkeit, und ich muss ihr deshalb meine ganze Zeit widmen...«
»Unsinn, mein Junge! Ihr sehnt Euch nach gebührender Anerkennung für Eure Mühen, wie wir alle, obgleich wir vom blauen Blut natürlich über diese niederen Gedanken an materielle Gewinne erhaben sind. Nicht wahr, Rolgang?«
Der Kaiser blinzelte verschmitzt. Eudoric fand diesen milden Zynismus sehr erfrischend nach all dem Hochmut der Landedelleute, unter denen er lebte und die so taten, als bedeute ihnen Geld überhaupt nichts. Thorar fuhr fort:
»Im Augenblick haben wir bedauerlicherweise keine unbesetzten Baronien oder Grafschaften zu vergeben, aber mein Bruder hat eine heiratsfähige Tochter. Zwar ist sie nicht gerade die Schönste aller Schönen.«
»Petrilla ist ein gutes Mädchen!«, unterbrach ihn der Erzherzog.
»Das leugnet niemand. Doch würde auch niemand sie für eine Wahl zur Schönsten der Schönen vorschlagen. Nun, Sir Eudoric, was haltet Ihr davon? Ein Einhorn für die Hand von Petrilla Rolgangstochter?«
Eudoric nahm sich Zeit für eine Antwort. »Die junge Dame müsste ihre Einwilligung selbst geben. Dürfte ich um die Ehre bitten, sie kennenzulernen?«
»Aber gewiss doch. Rolgang, sorge dafür.«
Eudoric war mehrmals verliebt gewesen, aber der Ausgang dieser Leidenschaften hatte ihm eine etwas zynische, durch keine rosa Brille verfälschte Einstellung zum Kampf der Geschlechter verliehen. Fette Weiblichkeiten hatte er nie anziehend gefunden, und Petrilla war fett - vielleicht noch nicht übermäßig, aber er konnte sich sehr bildhaft vorstellen, wie sie in wenigen Jahren aussehen würde. Ihr Teint war dunkel, ihre Figur untersetzt, ihre Züge waren grobgeschnitten, und sie kicherte offenbar gern.
Seufzend rechnete Eudoric die Vor- und Nachteile einer Verbindung mit dieser nicht gerade hübschen jungen Frau aus, die jedoch aus einflussreichem Hause kam. Für eine Karriere als Höfling und Magnat überwogen die Vorteile, der Schwiegersohn des Erzherzogs zu sein, allerdings alle Nachteile. Immerhin schien Petrilla gesund und von angenehmem Wesen zu sein. Sollte sie sich als zu langweilig herausstellen, würde er zweifellos anderswo Trost und Ablenkung finden.
Als Eudoric wieder zu Hause in Arduen war, suchte er seinen alten Lehrer, Doktor Baldonius auf, der sich als Halbpensionär in eine Blockhütte im Wald zurückgezogen hatte. Baldonius, ein Gelehrter und nicht ganz ohne Zauberkräfte, besserte sich seine Rente durch gelegentliche magische Dienste auf. Er holte seine dickbauchige Enzyklopädie hervor und öffnete den gewaltigen eisernen Verschluss.
»Einhorn«, murmelte er vor sich hin, während er die knisternden Pergamentseiten umblätterte. »Ah, da haben wir es schon. Das Einhorn, Dinohygus helicornus, ist der letzte Überlebende der Gattung Entelodontidae. Das spiralenförmig gedrehte Horn, das aus der Stirn des Tieres wächst, ist nicht wirklich ein Horn. Das wäre aufgrund der frontalen Sutur entlang der mittleren Stirnlinien unmöglich. Die Legende, dass dieses Tier sich von einer menschlichen Jungfrau lenken und milde stimmen lässt, beruht auf Tatsachen. Nach der Geschichte... Aber du kennst sie ja, Eudoric.«
»Ja«, antwortete der Landedelmann. »Man bittet eine Jungfrau - sofern man eine zu finden vermag -, sich in einem Wald, wo es ein Einhorn geben soll, unter einen Baum zu setzen. Das Tier wird schließlich kommen und seinen Kopf in ihren Schoß legen, woraufhin die Jäger herbeieilen und das bedauernswerte Geschöpf ungestraft erlegen können. Weshalb ist das so?«
»Mein Kollege Dr. Bobras«, erwiderte Baldonius, »hat eine Monographie verfasst... Wo habe ich sie denn? Ah, hier ist sie.« Baldonius zog eine Schriftrolle aus einem Regal mit Öffnungen wie bei einem Taubenschlag. »Nach seiner Theorie, an der er arbeitete, seit wir beide in Saalingen studierten, ist das Einhorn in einem Übermaß geruchsempfindlich. Nun, bei seinen großen Nüstern wäre das verständlich. Bobras geht von der Voraussetzung aus, dass eine Jungfrau einen anderen Geruch als ein nicht mehr jungfräuliches weibliches Wesen hat, und dass diese Ausdünstung die normale Wildheit des Tieres dämpft.«
»Aha«, murmelte Eudoric. »Angenommen, ich finde eine Jungfrau, die bereit ist, mich bei diesem Experiment zu unterstützen, wie geht es dann weiter? Es dürfte doch wohl etwas anderes sein, einem benommenen Tier einen Jagdspeer in die Eingeweide zu stoßen, als es lebend gefangen zu nehmen und unverletzt nach Sogambrium zu schaffen.«
»Oh! Tut mir leid, mein Junge, aber ich fürchte, ich habe keinerlei Erfahrungen in diesen Dingen. Als Vegetarier verstehe ich nichts vom Waidwerk.«
»Wer, glaubt Ihr, Meister, könnte mir in dieser Sache raten?«
Baldonius überlegte, dann lächelte er durch seinen Katarakt von Bart. »Ganz in der Nähe von Baron Rainmars Ländereien wohnt ein etwas ungewöhnlicher Experte in diesen Dingen, nämlich meine Base Svanhalla.«
»Die Hexe von Hesselbourn?«
»Eben diese, aber nenn sie nie so, wenn sie es hören kann. Eine Hexe oder ein Hexer, behauptet sie, übt Schwarze Magie aus, sie dagegen sei eine ehrenwerte Fee oder Zauberin, deren Künste gesetzlich zulässig sind und nur ausgeübt werden, um zu helfen und Gutes zu tun. Meine Enzyklopädie leitet diese Worte auf...«
»Nicht so wichtig«, sagte Eudoric hastig, als Baldonius sich daran machte, in dem dicken Werk zu blättern. »Ich kenne sie nicht persönlich, aber nach dem, was ich von ihr gehört habe, ist sie reichlich verschroben. Was könnte sie schon vom Waidwerk verstehen?«
»Oh, sie weiß Erstaunliches. In der Bruderschaft ist es ein offenes Geheimnis, dass man von ihr Auskunft über die scheinbar unwichtigsten Dinge bekommen kann, für die sich sonst kein Mensch auf der Welt interessiert. Sagen wir, beispielsweise, was Graf Holmer, der Prätendent, am Morgen seiner Hinrichtung zum Frühstück hatte. Svanhalla weiß es. Ich gebe dir ein Empfehlungsschreiben an sie mit. Wegen ihrer etwas bissigen Zunge habe ich sie seit Jahren nicht mehr besucht.«
»So, du bist also jetzt Ritter?«, sagte Svanhalla, als Eudoric in ihrer Hütte neben ihr saß. »Aber das verdankst du gewiss nicht irgendwelchen ritterlichen Taten, sondern deinem Geschick, das Glück beim Schopf zu packen, eh? Ich kenne die Geschichte, wie du den pathenianischen Drachen getötet hast - ja, ich weiß, wie du ihn mit der serikanischen Donnerröhre verfehlt hast, und Jillo durch Zufall mit seiner Fackel den Sack mit schwarzem Pulver entzündete, gerade als der Drache darüber watschelte.«
Eudoric verfluchte insgeheim Jillos lose Zunge, aber er beherrschte sich. »Selbst wenn ich doppelt so tapfer gewesen wäre und dreimal so viel Erfahrung mit der Donnerwaffe gehabt hätte, hätte es ohne Glück nichts genutzt. Wir hätten nichts weiter als armselige Brosamen für das Riesenreptil abgegeben. Aber sprechen wir von etwas anderem. Meister Baldonius meinte, Ihr könntet mir raten, wie sich in Bricken ein Einhorn fangen ließe.«
»Das wäre schon möglich, wenn es sich für mich rentiert.«
»Wieviel verlangt Ihr?«
Nach längerem Feilschen einigten sich Eudoric und Svanhalle auf sechzig Mark, eine Hälfte sofort, den Rest, sobald das Einhorn gefangen war. Eudoric bezahlte murrend die verlangte Hälfte sofort.
»Als erstes«, sagte die Hexe von Hesselbourn, »musst du eine Jungfrau finden, die älter als fünfzehn ist. Wenn die Geschichten stimmen, dürfte das in Arduen gar nicht so einfach sein. Du und deine unzüchtigen Mitbrüder...«
»Madam! Ich habe seit fast einem Jahr keine fleischlichen Beziehungen zu hiesigen Mädchen.«
»Ja, ja, ich weiß. Wenn dein Verlangen dich übermannt, eilst du zu den Huren von Kromnitch. Du solltest längst anständig beweibt sein, aber die Mädchen halten dich alle für einen eiskalten Opportunisten. Damit haben sie nicht einmal so ganz Unrecht. Zwar magst du Frauen ganz gern, aber deine wahre Liebe gilt dem Gold, he he!«
»Gar nicht nötig, dass Ihr mir das so unter die Nase reibt«, brummte Eudoric. »Ich bin schließlich nicht hierhergekommen, um mir Euren Rat in Sachen Liebe zu holen, sondern in Dingen, die die Jagd betreffen.«
»Heh! Wie dem auch sei, dein Bruder Olf trägt viel dazu bei, deine Aussichten auf eine Jungfrau zu mindern. Nicht, dass ich dem Jungen daran die ganze Schuld gebe. Er sieht gut aus, und leider bilden sich allzu viele Bauernmaiden ein, sie könnten sich mit ihrer Schönheit einen Lordling angeln, wenn auch vielleicht nicht für eine anerkannte Gemeinschaft, so doch für eine gewinnbringende heimliche Verbindung. Und so fehlt nicht viel, dass sie geradezu hinausschreien: Nehmt mich, edler Herr! In einer verderbten Zeit leben wir!«
»Da Ihr offenbar so viel über dergleichen in Arduen wisst, könnt Ihr mir vielleicht auch sagen, wer noch eine Jungfrau ist?«
»Da muss ich erst meine Vertraute befragen.«
Sie erteilte Eudoric nähere Anweisungen, was den Fang des Einhorns betraf, und schloss: »Komm morgen wieder. Such inzwischen Frotz, den Seiler, auf, um das Netz zu bestellen, und Karlvag, den Wagner, damit er dir einen Käfig auf Rädern baut. Aber sieh zu, dass beides auch etwas aushält, sonst hast du vielleicht weniger Glück als mit deinem Drachen, he he!«
Als Eudoric in Svanhallas Hütte zurückkehrte, besprach sie sich gerade mit einer Fledermaus von der Größe eines Adlers. Diese Kreatur hing mit dem Kopf nach unten von einem der Deckenbalken, zwischen Räucherschinken, Netzen mit Zwiebeln und anderem Essbaren. Als Eudoric erschrocken zurückfuhr, kicherte die Hexe.
»Du brauchst dich nicht vor Nigmalkin zu fürchten, tapferer und mächtiger Held. Sie ist ein süßer, liebevoller kleiner Teufel, wie du ihresgleichen nicht so schnell im ganzen Reich findest. Außerdem hat sie mir verraten, was du so gern wissen wolltest.«
»Und was sagt sie?«
»Dass es in ganz Arduen nur ein Mädchen gibt, das deine Ansprüche erfüllen würde. Gewiss, es gibt auch noch andere Jungfrauen, aber keine, die sich für diesen Zweck eignen. Cresseta Almundstochter ist krank und dem Tode nahe; Greda Paerstochters Vater ist ein religiöser Fanatiker, der sie keinen Herzschlag lang aus den Augen lässt; und so weiter.«
»Und wer wäre dann geeignet?«
»Bertrud, die Tochter Ulfreds, des Ungewaschenen.«
»Ihr Götter! Sie schlägt ihrem Vater nach! Man riecht sie schon eine halbe Meile gegen den Wind! Sonst kennt Ihr keine Geeignete, Svanhalle?«
»Keine. Tu, was du willst. Aber einem stolzen, tapferen Abenteurer wie du es bist sollte doch ein bisschen Gestank nichts ausmachen, oder?«
Eudoric seufzte. »Also gut. Ich werde mir vorstellen, ich sei wieder in dieser Kerkerzelle in Pathenien. Da war der Gestank sogar noch schlimmer.«
Bertrud Ulfredstochter wäre saubergewaschen ein recht hübsches Mädchen, ja manche würden sie dann sogar schön finden. Eine Wahrsagerin hatte Ulfred, dem Ungewaschenen, einmal prophezeit, dass er an einer Krankheit sterben würde, die er sich durch Waschen zuzöge. Er hatte deshalb jeglicher äußerer Anwendung von Wasser abgeschworen, und seine Tochter trat in seine Fußstapfen.
Eudoric machte von Arduen aus einen Umweg in die Wildnis von Bricken, weil er sich nicht in die Nähe der Domäne seines alten Feindes, Baron Rainmar von Hessel, begeben wollte. Er war sehr darauf bedacht, sich an Bertruds dem Wind zugewandten Seite zu halten.
Außer Bertrud ritt mit Eurodic noch Jillos jüngerer Bruder, ein einfacher Landarbeiter namens Theovir Godmarson, um bei der schwereren Arbeit zu helfen. Jillo folgte mit dem beräderten Käfig. Am Rand des Waldes ließ Eurodic Jillo damit zurück, denn es gab keinen Waldpfad, der breit genug dafür gewesen wäre.
Nach einem langen Tag ständiger Suche, während sie auch noch aufpassen mussten, sich nicht in den fast unsichtbaren Netzen der Riesenspinnen zu verfangen, fand Eudoric endlich einen Ort, den er für geeignet hielt. Hier wuchs eine mächtige Buche, deren Äste tief genug zum Boden herabreichten, dass man sie ohne größere Schwierigkeiten erklimmen konnte. Diese Stelle hatte auch noch den Vorteil, sich in der Nähe eines Nebenflusses der Lupa zu befinden, an dem sie ihr Lager aufschlugen.
Den Rest des Tages brauchten sie, das Netz zu spannen. Sie befestigten es mit Ziehknoten an den höheren Buchenzweigen und den Ästen zweier benachbarter Bäume, so dass ein einziger Zug genügen würde, es herabfallen zu lassen. Bleigewichte entlang des Netzrandes sollten dafür sorgen, dass es auch wirklich am Boden landen und das Tier umhüllen würde.
Es war ein heißer Sommertag, und bis sie mit ihrer Arbeit fertig waren, rann Eudoric und Theovir der Schweiß in Strömen über den ganzen Körper. Erschöpft ließen sie sich auf den Boden fallen und lauschten keuchend dem Summen und Zirpen der Insekten.
»Ich bin für ein Bad«, stöhnte Eudoric. »Was hältst du davon, Theovir? Bertrud, wenn du die Flussbiegung hochgehst, kannst du dich vor fremden Blicken geschützt waschen. Es würde dir nichts schaden.«
»Ich mich waschen?«, rief das Mädchen entrüstet. »Das ist eine sehr ungesunde Angewohnheit! Aber wenn Ihr Euch den Tod holen wollt, ist das Eure Sache.«
In der Nacht hörte Eudoric das Schnauben eines Einhorns. Er veranlasste deshalb in aller Früh, dass Bertrud sich am Fuß der Buche niederließ, während er und Theovir auf den Baum kletterten, um dort zu warten. Eudoric, der den Strick für das Netz in der Hand hielt, spähte durch das bronzegrüne Laub. Bertrud versuchte mit müden Handbewegungen die Fliegenwolke zu verscheuchen, von der sie fast ständig umgeben war.
Das Einhorn, das am Nachmittag kam, sah den zierlichen Kreaturen, halb Pferd, halb Gazelle, wie sie auf den Wandteppichen des Kaisers abgebildet waren, gar nicht ähnlich. Schon eher glich es, was seinen Körperbau betraf, einem mächtigen Büffel von gut sechs Fuß Höhe, vom Boden bis zu seiner höchsten Stelle, dem fleischigen Buckel, gerechnet. Der Schädel dagegen war mehr der eines riesigen Ebers. Das gewundene Horn wuchs oberhalb der Augen aus dem Kopf.
Es näherte sich vorsichtig, Schritt um Schritt, der Buche, unter der Bertrud saß. Als es sich fast unter dem Netz befand, blieb es stehen und schnupperte mit weitgeblähten Nüstern.
Dann schnüffelte es noch heftiger, warf den Schädel zurück und stieß ein erschreckendes Grunzen aus, fast wie ein Löwengebrüll. Es rollte die Augen und scharrte mit den gespaltenen Vorderhufen.
»Bertrud!«, rief Eudoric. »Es greift an! Schnell auf den Baum!«
Als das Einhorn vorwärtsstürmte, stolperte das Mädchen, das mit seinem schmutzverkrustetem Gesicht das Tier mit zunehmendem Schrecken beobachtet hatte, auf die Füße und kletterte die Äste hoch. Das Einhorn kam rutschend zum Halt und schaute sich mit blutunterlaufenen Augen um.
Eudoric zog an der Schlinge. Gerade als das Netz hinunterfiel, sprang das Einhorn wieder vorwärts, wich im letzten Augenblick dem Stamm aus, und stürmte weiter. Sein Hintern schloss flüchtige Bekanntschaft mit einem der Bleigewichte, doch ansonsten senkte sich das Netz hinter ihm auf den Boden.
Mit einem grauenvollen Gebrüll wirbelte das Einhorn herum und knirschte furchterregend mit den gewaltigen Zähnen oder Fängen. Als es keinen Gegner sah, galoppierte es in den Wald davon, und schon bald verstummte sein Hufschlag.
Die Einhornjäger kletterten wieder auf den Boden hinunter. »Jetzt reicht es mir! Baldonius sagte, diese Tiere sind sehr geruchsempfindlich, und du, meine Teure, hast Körpergeruch für zehn. Theovir, du begibst dich nach Hessel Minor und kaufst Seife und einen Schwamm. Hier hast du Geld.«
»Wäre es nicht vielleicht besser, Ihr besorgt es selbst und ich bleibe und bewache das Mädchen?«, fragte Theovir mit listig glitzernden Augen.
»Nein, denn würde ich erkannt, hetzte Rainmar seine Hunde auf uns. Also halt den Mund, während du dort bist. Wenn du dich beeilst, kannst du bis zum Mittagessen zurück sein.«
Seufzend sattelte Theovir sein Pferd und ritt von dannen. Mit zitternden Lippen fragte Bertrud: »Was - was habt Ihr mit mir vor, Sir? Soll ich geschlagen oder geschändet werden?«
»Unsinn, Mädchen. Dir wird kein Haar gekrümmt. Du darfst nicht glauben, dass ich, nur weil ich ein Sir vor meinem Namen habe, herumgehe und das einfache Volk schikaniere. Ich versuche, die Menschen so zu behandeln, wie sie es verdienen, ob sie nun Leibeigene sind oder Könige.«
»Was werdet Ihr dann tun?«
»Das wirst du schon sehen.«
»Ihr wollt mich waschen, das ist es! Ich lasse es nicht zu! Ich laufe in den Wald...«
»Wo sich Einhörner und andere gefährliche Tiere herumtreiben? Nein, das glaube ich nicht.«
»Ich werde es Euch zeigen! Ich gehe.«
Sie rannte aufs Geratewohl davon. Eudoric ahmte das Brüllen des Einhorns nach. Bertrud kreischte erschrocken auf, rannte zurück und warf die Arme um Eudorics Hals. Der Landedelmann befreite sich unsanft und sagte:
»Wenn du gewaschen bist und das Einhorn gefangen ist und du dann immer noch solche Einfälle hast, können wir es uns ja noch überlegen.«
Theovir kehrte gegen Sonnenuntergang zurück. »Hier ist die Seife und alles, mein Lord. Jillo fragte nach Euch, und ich sagte ihm, dass alles in Ordnung sei.«
Da Bertrud ihr Abendessen kochte, verschob Eudoric das Bad bis zum Morgen. Nachdem er sich bis auf sein Lendentuch entblößt hatte, zerrte er, mit nur zu gern von Theovir geleisteter Hilfe, die sich heftig wehrende und weinende Bertrud zum Nebenflüsschen der Lupa. Die beiden Männer befreiten sie von Rock und Bluse und stießen sie ins Wasser. »Ihr Götter, ist das kalt!«, schrillte sie.
»Wärmeres Wasser haben wir nicht, Mädchen«, erklärte ihr Eudoric und schrubbte mit aller Kraft. »Beim Heiligen Paar, Dirn! Du hast ja Schmutzschicht über Schmutzschicht! Halt dich still, verdammt! Gib mir den Kamm, Theovir. Ich möchte wenigstens versuchen dieses Haargestrüpp ein wenig zu entwirren. So, gut, jetzt. Den Rest schaffe ich auch allein. Es ist Zeit, dass du die Pferde fütterst.«
Theovir kehrte zu ihrem Lager zurück, und Eudoric beschäftigte sich weiter damit, sein Opfer einzuseifen, abzuschrubben und unterzutauchen.
»So«, brummte er schließlich. »Ist es wirklich so schrecklich, sauber zu sein?«
»Ich - ich weiß nicht, Sir. Es ist ein Gefühl, wie ich es nie zuvor kannte. Aber mir ist so kalt. Gestattet mir, mich an Euch zu wärmen. Oh, Ihr seid aber ein starker Mann!«
»Du bist selbst kein Schwächling. Du hast ganz schön Widerstand geleistet, bis ich dich endlich im Wasser hatte!«
»Ich arbeite schwer. Wer sollte sonst die Arbeit machen, seit meine Mutter mit diesem Hausierer durchgebrannt ist? Es bleibt alles Vater und mir! Was für Muskeln!«
Sie betastete seinen Bizeps und schmiegte sich immer fester an ihn, bis ihr praller Busen sich an seine Brust presste. Eudoric spürte das vertraute Schwellen unter seinem Lendentuch.
»Na, na, meine Liebe«, murmelte er. »Ich sagte doch, nach dem Einfangen des Tieres, nicht zuvor.« Als ihre Finger sich immer forschender betätigten, schnaubte er: »Ich sagte, nein!« und schob sie von sich.
Er stieß sie härter als beabsichtigt, so dass sie rückwärts wieder ins Wasser fiel. Mit erboster Miene tauchte sie hoch.
»So!«, sagte sie. »Der hohe und mächtige Ritter ist also zu vornehm, eine arme Bauerndirn auch nur anzusehen! Er ist sich für alle zu gut, außer für diese parfümierten, bemalten Huren am Hof! Ihr könnt sie meinetwegen alle mit Euch zur Hölle nehmen, teurer Sir!«
Sie kletterte aus dem Fluss, griff nach ihren Kleidern und verschwand in Richtung Lager.
Eudoric schaute ihr mit einem besorgten Lächeln nach. Dann widmete er sich seinem eigenen Morgenbad, bis der verlockende Duft von brutzelndem Frühstück ihn an die Zeit gemahnte.
Er und Theovir befestigten das Netz erneut. Diesmal kam das Einhorn gegen Mittag. Wie zuvor schien es sich der unter dem Baum sitzenden Bertrud nähern zu wollen, doch dann bekam es offenbar einen Wutanfall. Wider musste das Mädchen sich auf dem Baum in Sicherheit bringen.
Diesmal wartete das Tier nicht einmal darauf, dass Eurodic die Schlinge zog. Es verschwand sofort im Wald.
Eudoric seufzte. »Zumindest müssen wir das verdammte Netz nicht ein drittes Mal an den Ästen befestigen. Aber was ist wohl diesmal schiefgelaufen?« Da bemerkte er das zufriedene Grinsen auf Theovirs Gesicht. »Aha! Daher weht der Wind! Während ich mein Morgenbad nahm, sorgtest du dafür, dass wir keine Jungfrau mehr haben!«
Theovir und Bertrud kicherten.
»Ich werde es euch zwei Wahnsinnigen schon zeigen!«, heulte Eudoric.
Er riss seinen Jagdpallasch aus der Scheide und rannte auf das Pärchen zu. Obgleich er nur beabsichtigt hatte, ihnen den Hintern mit der flachen Klinge zu versohlen, flohen sie schreiend vor Todesangst. Eudoric rannte ihnen säbelschwingend nach, bis er über eine Wurzel stolperte und aufs Gesicht fiel. Als er wieder auf die Füße stolperte, waren Theovir und Bertrud längst verschwunden.
Am Rand der Wildnis wandte Eudoric sich an Jillo: »Wenn dieser Trottel, dein Bruder, zurückkommt, dann sag ihm, falls er seinen Lohn haben will, soll er seine Arbeit erst einmal zu Ende führen. Nein, ich werde ihm nichts tun, auch wenn er da ganz schön etwas angestellt hat. Aber ich hätte es ja vorhersehen müssen! Jetzt bleibt mir nichts übrig, als die Gäule bei dir zu lassen und auf meiner Daisy noch einmal zu Svanhallas Hütte zu reiten.«
Als Eudoric die Hütte der Hexe von Hesselbourn betrat, kicherte Svanhalla. »Nun ja, du hast dein Bestes getan, aber wenn der Teufel der Fleischeslust einen Jüngling oder eine Maid plagt, gehört schon mönchische Härte dazu, ihm zu widerstehen. Und das war etwas, das keiner der beiden besaß.«
»Sehr richtig, Madam«, pflichtete Eudoric ihr bei. »Aber was soll ich jetzt tun? Wo finde ich eine andere Jungfrau mit gesunden Gliedern?«
»Ich schicke meine Vertraute Nigmalkin aus, um sich in den benachbarten Ländereien umzusehen. Baron Rainmars Tochter Maragda ist noch ein unberührtes Füllen, aber sie soll in einem Monat heiraten. Außerdem glaube ich nicht, dass du mit dieser Wahl einverstanden wärst.«
»Damit habt Ihr allerdings Recht. Rainmar würde mich vom nächsten Ast baumeln lassen, wenn er mich erwischte. Aber... Wie wäre es denn mit Euch, Madam Svanhalla? Wäret Ihr denn nicht geeignet?«
Das knochige Kinn der Hexe sackte hinab. »Daran, Sir Eudoric, hätte ich nie gedacht. Ja, all diese Jahre - hundert und mehr - entsagte ich der Fleischeslust, um den höchsten Grad magischer Weisheit zu erringen. Für einen großzügigen Preis würde ich vielleicht... Aber wie willst du ein altes Knochengerüst wie mich in diese Wildnis bringen? Ich habe zwar keine Schwierigkeiten, hier in meiner kleinen Hütte allein fertig zu werden, aber für ausgedehnte Märsche oder einen längeren Ritt dürften meine Knochen wohl doch schon zu morsch sein.«
»Ich werde Euch eine Pferdesänfte besorgen«, versprach Eudoric. »Bleibt hier, ich komme bald zurück.«
So geschah es, dass einen halben Monat später die alte Hexe von Hesselbourn am Fuß des Baumes saß, an dessen Zweigen Eudoric das Netz befestigt hatte. Nach einer Wartezeit von einem Tag näherte sich das Einhorn. Es schnüffelte aufgeregt, kniete sich schließlich vor Svanhalla nieder und legte seinen schweineähnlichen Schädel in Svanhallas Schoß.
Eudoric zog die Schlinge. Das Netz fiel. Als Svanhalla sich stolpernd in Sicherheit brachte, sprang das Einhorn auf und schüttelte schnaubend den Schädel. Doch in seinem Bemühen, sich aus dem Netz zu befreien, verschlang es sich nur umso mehr darin. Eudoric sprang vom Baum, griff nach seinem Jagdhorn auf dem Rücken, und rief mit einem unmelodiösen Schmettern Jillo herbei.
Eudoric, Jillo und Theovir, dem ersterer verziehen hatte, rollten das erschöpfte, sich aber immer noch heftig wehrende Einhorn auf ein Ochsenfell. Wachsam den um sich schlagenden Hufen und schäumenden Lefzen ausweichend, banden sie es. Dann spannten sie drei Pferde an das Ochsenfell, die das unförmige Bündel durch den Wald bis zum Käfig zogen.
Sie brauchten fast einen ganzen Tag, das Tier in den beräderten Käfig zu kriegen. Einmal gelang es ihm beinahe auszubrechen. Ein heftiges Gewitter, bei dem der Himmel alle Schleusen öffnete, erleichterte ihnen die Arbeit auch nicht gerade. Doch endlich war das Einhorn sicher hinter Schloss und Riegel.
Eudoric und seine Gehilfen schoben ganze Getreidegarben durch das Gitter. Das Tier, das seit zwei Tagen nichts mehr zu fressen bekommen hatte, fiel gierig darüber her.
Erzherzog Rolgang sagte: »Sir Eudoric, Ihr habt Eure Sache gut gemacht. Der Kaiser ist erfreut, nein, zuhöchst entzückt. Um ehrlich zu sein, er ist so sehr von diesem Tier begeistert, dass er beschlossen hat, es in seinem eigenen Zoo zu behalten, statt es dem Cham der Pantorozianer zu verehren.«
»Freut mich, das zu hören, Eure Hoheit«, sagte Eudoric. »Aber mir deucht, da war doch noch eine Sache, die auch Eure Tochter Petrilla betrifft. Oder täusche ich mich?«
Der fette Erzherzog hüstelte hinter der Hand. »Ah - oh - das versetzt mich in größte Verlegenheit. Ihr müsst wissen, die Demoiselle ist nicht mehr zu haben, so edel und tugend- sam auch ihr Freier sein mag.«
»Sie ist doch nicht gar tot?«, rief Eudoric erschrocken. »Nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte sie ja für Euch bestimmt, aber meine Pflicht gegenüber dem Kaiser musste mich alle persönlichen Erwägungen vergessen lassen.«
»Hättet Ihr vielleicht die Güte, mir das genauer zu erklären, mein Lord?«
»Gewiss doch. Der Großcham stattete wie vorgesehen seinen Besuch ab. Doch kaum hatten seine Augen Petrilla erblickt, bemächtigte sich seiner eine überwältigende romantische Leidenschaft. Und ihr erging es ähnlich.
Ihr müsst wissen, mein Junge, sie jammerte schon lange, dass kein galanter Edelmann des Reiches ein untersetztes, üppiges Mädchen mit dunkler Haut wie sie lieben wollte. Und da kommt dieser mächtige Cham Czik, Herr über gewaltige Horden pelzbemützter Nomaden. Auch er ist untersetzt, üppig und von dunkler Hautfarbe, dazu noch O-beinig. Es war Liebe auf den ersten Blick.«
»Ich dachte«, murmelte Eudoric, »dass wir - sie und ich - uns bereits das gegenseitige Versprechen gegeben hatten - zwar nicht öffentlich, aber...«
»Ich erinnerte sie daran. Aber wenn Ihr mir verzeiht, das war doch nicht mehr als eine geschäftliche Abmachung.«
»Und sie ist...«
»Mit dem Großcham in seine Heimat, die endlosen Steppen, abgereist, um seine siebzehnte - vielleicht auch achtzehnte Frau zu werden. Wirklich nicht die Art von Gatten, den ich für sie erwählt hätte, schließlich ist er Heide und bereits vielfach beweibt. Aber sie ließ sich nicht mehr davon abbringen. Darum hielt mein kaiserlicher Bruder es auch nicht für nötig, dem Cham Euer Einhorn zu schicken. Immerhin hat er ja inzwischen eine Perle von unbezahlbarem Wert mit sich genommen.
Doch das heißt selbstverständlich noch lange nicht, dass mein Bruder und ich beabsichtigen, Eure Dienste unbelohnt zu belassen. Erhebt Euch, Sir Eudoric! Im Namen Seiner Kaiserlichen Majestät verleihe ich Euch hiermit das Großkreuz des Einhornordens mit Eichenlaub und Brillanten.«
»Ahhh!«, entfuhr es Eurodic. »Eure Hoheit, ist es unbedingt erforderlich, die Medaille auch an meiner Haut, nicht nur an meinem Rock zu befestigen?«
»Oh! Verzeiht, Sir Eudoric.« Der Erzherzog fummelte mit seinen Wurstfingern, und endlich gelang es ihm, den Orden richtig anzustecken. »Ah, sehr schön, mein Junge. Werft einen Blick in den Spiegel.«
»Eine prachtvolle Medaille. Bitte übermittelt Seiner Kaiserlichen Majestät meinen nie endenden Dank.«
Innerlich kochte Eudoric. Der Orden war ja recht hübsch, aber er war schließlich kein städtischer Höfling, der bei den kaiserlichen Bällen in Galastaat prunken musste. Auf seinem ländlichen Anzug wirkte die Medaille lächerlich. Zwar konnte Eudoric auf Petrilla verzichten, ohne ihr sein Leben lang nachzutrauern, aber wenn sie ihn schon für den Fang des Einhorns belohnen wollten, hätten sie sich wohl etwas Besseres einfallen lassen können - eine anständige Rente wäre zweifellos besser gewesen. Oder zumindest hätten sie ihm die Unkosten für die Einhornjagd ersetzen können. Gewiss, wenn die Zeiten einmal schlechter wurden und er den Orden bis dahin nicht auf irgendeine Weise verloren hatte, konnte er ihn immer noch versetzen oder verkaufen...
Von all dem sagte er jedoch nichts. Im Gegenteil, er bemühte sich, überrascht, geschmeichelt, stolz und dankbar dreinzuschauen.
Rolgang fügte noch hinzu:
»Da ist natürlich noch die Sache, von der wir zuvor sprachen. Ihr habt die kaiserliche Erlaubnis, Eure Kutschenlinie bis nach Sogambrium und weiter auszudehnen, wenn Ihr das wollt. Nach einem Dekret Seiner Kaiserlichen Majestät werden jedoch die Fahrpreise für diese Linienkutschen ab sofort mit fünfzig Prozent besteuert. Diese Steuer ist monatlich abzuführen...«
Karl Edward Wagner: ZWEI SONNENUNTERGÄNGE
(Two Suns Setting)
1. Allein mit dem Nachtwind
Als düstere rote Scheibe ging die Sonne an einem eintönigen Horizont in einer hügeligen Steinwüste unter, die sich unzählige Meilen hinter ihm erstreckte - und wahrscheinlich war sein Pferd das einzige, das je hindurchtrabte. Lange ehe das Licht der Sonne erlosch, war in der Leblosigkeit der Wüste von ihrer Wärme nichts mehr zu spüren, so dass sie schließlich in ihrer letzten Stunde so freudlos wirkte wie der aufgegangene Mond. In seiner Röte schien der Vollmond die Sonne zu verhöhnen. Zu früh ging er auf, ohne Achtung, wie ein habgieriger Erbe, der ungeduldig vor dem Totenbett seines Herrn auf und ab läuft. Eine Weile offenbarte der endlose Zwielichthimmel zwei rötliche Scheiben an den gegenüberliegenden Horizonten, so dass Kane sich schon fragte, ob sein langer Ritt durch die Wüste ihn nicht vielleicht in eine fremde Dämmerwelt geführt hatte, wo zwei Sonnen am Himmel schwelten. Das Land wirkte wahrhaftig unirdisch in seiner kalten Trostlosigkeit - und zweifellos hing eine Aura unvorstellbaren Alters als grauer Schleier um jeden Steinblock.
Kane hatte Carsultyal planlos, ohne ein bestimmtes Ziel verlassen, nur mit dem Gedanken, dem Einflussbereich dieser Stadt zu entfliehen. Es gab solche, die behaupteten, er sei aus Carsultyal getrieben, seine Macht wäre dort von seinen Magiergenossen gebrochen worden, die eifersüchtig auf sein schon vor langem erworbenes Ansehen gewesen waren - und erschrocken über die auf bizarre Weise fremdartigen Wege, die seine Studien in den vergangenen Jahren genommen hatten. Kane selbst betrachtete seinen Aufbruch als mehr oder weniger freiwillig, wenn auch etwas überstürzt, und er sagte sich, hätte er es wirklich gewollt, so wäre er durchaus imstande gewesen, sich gegen die Angriffe seiner ehemaligen Kollegen erfolgreich zur Wehr zu setzen - auch wenn er keinem Gott oder Dämon verschworen war, der ihn vielleicht hätte unterstützen können. Nein, er hatte die Stadt verlassen, weil diese erste große Metropole der Menschheit seit Jahrhunderten stagnierte. Der Forschergeist, der Geist der Erneuerung, der ihn in ihren frühen Jahren in diese Stadt gezogen hatte, war ausgebrannt, so dass ihn wieder einmal Langeweile, seine Nemesis, übermannt hatte. Es stimmte, die Ruhelosigkeit hatte nach ihm gegriffen, immer mehr hatten seine Gedanken sich mit der Welt jenseits von Carsultyal beschäftigt - Gebiete, die erst noch erforscht werden wollten. Aber dass er fast ohne jegliche Vorbereitung zu seinem ziellosen Wanderleben zurückkehrte, war schon daraus zu ersehen, dass Kane die Stadt mit wenig mehr als dem Allernötigsten verlassen hatte, mit zwei Handvoll Goldmünzen, einem schnellen Pferd, und einem Schwert aus feinem Carsultyaler Stahl. Jene, die seine aufgegebene Macht für sich beanspruchten, mochten ihr Erbe vielleicht bedauern, doch das spielte jetzt keine Rolle.
Mit der Düsternis kam der Wind auf, ein eisiger Hauch aus den Bergen, deren Gipfel noch unter den letzten Strahlen der untergehenden Sonne gerötet waren. Kane fröstelte und zog seinen rotbraunen Umhang dichter um die breiten Schultern, und bedauerte den Verlust seiner warmen Pelze, um die sich jetzt gewiss die menschlichen Aasgeier in Carsultyal in den Haaren lagen. Die Herratlonai war eine kalte, öde Wüste, wo die Temperatur des Nachts unter den Gefrierpunkt sank. Bei diesem Bergwind war seine Kleidung - sie bestand aus einem grünen Wollhemd, einer dunklen Weste und Hose aus Leder - wohl doch nicht gerade das Richtige.
Am vergangenen Tag hatte er die letzten Reste Dörrfrüchte und Pökelfleisch gegessen, nachdem er sich schon eine ganze Woche mit einer Hungerration begnügt hatte. Wasser hatte er glücklicherweise noch einen halben Beutel voll. Er hatte ihn am Rand der Wüste noch prall gefüllt, und dann war ihm das Glück auch insofern hold gewesen, als er auf der Spur eines Pfades, dem er folgte, auf ein Wasserloch gestoßen war. Das heißt, er glaubte, dass er einem Pfad folgte. Die Steinwüste südöstlich von Carsultyal grenzte angeblich an eines der Reiche einer vormenschlichen Kultur an, die längst vergessen war. Man erzählte sich von unvorstellbar alten Städten, die unter den Steindünen begraben lagen. Kane war auf etwas gestoßen, von dem er hoffte, dass es ein vergessener Pfad durch die Wüste zu den legendären Bergen des Ostkontinents war. Er hatte sich entschlossen, ihm zu folgen, und war mehrmals an gewaltigen Steinblöcken vorbeigekommen, deren fast verwitterte Glyphen möglicherweise jenen glichen, die er in Büchern über vormenschliche Kulturen gesehen hatte. Genauso gut mochten sie jedoch auch nur ein täuschend ähnliches Werk von Wind und Frost sein. Außer dieser quälenden Ungewissheit gab es nichts, das die Monotonie für ihn hätte brechen können. Nur vereinzelt säumte karges Buschwerk und hier und da herrliche, natürliche Säulen versteinerten Holzes seinen Weg, und stellenweise gab es dürres Gras, das sein Pferd mampfte. Für sich selbst fand er nichts Essbares. Seit Tagen schon hatte er nicht einmal mehr Eidechsen gesehen. Vielleicht war es wirklich etwas voreilig gewesen, diese grenzenlose Wüste, die kein lebender Mensch kannte, ohne zumindest ein Packtier mit Verpflegung und der nötigsten Ausrüstung überqueren zu wollen. Aber Kane hatte diese Reise ja nicht gerade unter den günstigsten Voraussetzungen angetreten, außerdem brannte immer noch, auch nach all diesen Jahren, tollkühner Wagemut in ihm. Und auf philosophische Weise gratulierte er sich sogar, dass er einen Weg gewählt hatte, auf dem ihm kein Feind folgen würde.
Schließlich hatten die Berge sich hinter dem Dunst am östlichen Horizont wie eine Reihe unregelmäßiger, verfärbter Zähne abgehoben. Das war durchaus Grund zu gewissem Optimismus - denn bedeutete es nicht, dass die Wüste bald hinter ihm liegen würde? Aber leider wurde diese Hoffnung gedämpft, als die Spätnachmittagssonne diese Berge als nicht mehr denn eine vertikale Variation des gegenwärtigen Terrains enthüllte. Die kahlen Hänge aus grobem Sand und rauem Fels wirkten nicht sehr vielversprechend mit ihrem spärlichen Bewuchs mit dürrem Buschwerk. Da und dort an den Wänden spiegelte sich die Sonne in allen Regenbogenfarben schillernd auf riesigen Tafeln versteinerten Holzes, die wie die gehorteten Juwelen eines Riesen herumlagen.
Doch mit der zunehmenden Dämmerung brachte der Bergwind auch den überraschenden Geruch von Holzrauch mit sich - geradezu unheimlich in dieser menschenleeren Öde! Kane strich seinen zerzausten Bart glatt, der seine grobgeschnittenen Züge bedeckte, und schob die Strähnen flatternden roten Haares zurück unter das mit Lapislazuli-Plättchen besetzte lederne Stirnband. Ungläubig rümpfte er witternd die Nase. Sein Reittier stapfte weiter, die Nacht brach herein - und am Fuß der vor ihm liegenden Berge lockten die Flammen eines Lagerfeuers. Nein, lediglich Feuerschein, verbesserte Kane sich, er durfte sich keine falschen Hoffnungen machen. Aber so viel man aus der Entfernung schließen konnte, musste es ein recht beachtliches Feuer sein.
Er lenkte sein Pferd in diese Richtung, und es suchte sich im Mondschein vorsichtig einen Weg über die spitzen Steine. Kanes Magen krampfte sich zusammen, als ihm beim Näherkommen unverkennbar der Geruch brutzelnden Bratens in die Nase stieg. Abschätzend betrachtete er das immer noch ferne Lagerfeuer. Die Berge hatten nicht ausgesehen, als beherbergten sie Leben, und es war auch unwahrscheinlich, dass in dieser Öde irgendjemand hauste. Selbst wenn es fast genauso unwahrscheinlich war, schien es in dieser Einsamkeit außer ihm noch einen Wanderer zu geben. Wer oder was jedoch dieses Feuer entzündet hatte, und welchem Grund seine Anwesenheit zu verdanken war, war Kane rätselhaft. Von jenen, die möglicherweise außerhalb der besiedelten Nordwestsichel des Großen Südkontinents lebten, war nichts bekannt. Man wusste lediglich, dass es in früher Zeit, ehe der Mensch zum vernunftbegabten Wesen geworden war, andere Rassen hier gegeben hatte.
Wer immer dieses Feuer gemacht hatte, mochte sein Fleisch also nicht roh und konnte demnach nicht allzu fremdartig sein. Aus der Größe des Lagerfeuers schloss Kane, dass es sich um einen kleinen Trupp handelte, Nomaden vielleicht, oder Wilde, irgendjemand sicherlich von jenseits der Berge. Von wirklicher Bedeutung war für ihn gegenwärtig eigentlich nur das so aufregend duftende Fleisch. Kane fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Er nahm das Schwert vom Sattel und schnallte es sich über den Rücken, dass der vertraute Griff beruhigend über seine rechte Schulter ragte. Die Scheidenspitze befestigte er nicht, damit sie sich frei drehen konnte, wenn er das Schwert herausziehen wollte. Vorsichtig näherte er sich dem Lagerfeuer.
2. Zwei, die sich am Feuer trafen
Kanes scharfe Nase nahm über Holzgeruch und Bratenduft säuerlichen Tiergeruch auf. Anfangs verbargen die Flammen die dahinter kauernde Gestalt, also lenkte Kane sein Pferd vorsichtig ein Stück weiter herum. Seine Vermutung bestätigte sich. Unwillkürlich spannten sich seine Züge. Nur ein Mann saß neben dem Feuer - wenn man einen Riesen als »Mann« bezeichnen konnte.
Kane war viel herumgekommen und hatte im Lauf seiner Wanderschaft auch Riesen kennengelernt, obgleich er in den vergangenen Jahrzehnten keinen mehr gesehen hatte. Er wusste, dass sie eine stolze, wortkarge Rasse waren, die zurückgezogen lebte. Nur wenige ihresgleichen gab es noch. Sie blickten voll Verachtung auf die aufstrebende Zivilisation der Menschen herab, und führten ein nahezu barbarisches Leben in Gebieten, die von den Menschen gemieden wurden. Gewiss, es gab schreckliche Schauergeschichten über vereinzelte ihrer Rasse, die abgelegene Siedlungen der Menschen terrorisierten, aber bei diesen Riesen handelte es sich um Ausgestoßene - oder öfter noch um monströse, hybride Oger.
Dieser Riese hier am Feuer wirkte nicht feindselig. Zwar hatte er zweifellos das Klappern der Hufe von Kanes Pferd auf den Steinen gehört, aber er verriet in Haltung und Miene lediglich Neugier. Nun ja, einer von seiner Statur brauchte sich ja schließlich auch nicht vor einem einsamen Reiter zu fürchten. In Reichweite des Riesen lag eine Hakenaxt, deren Bronzeblatt gut und gern als Schiffsanker hätte dienen können. Kane wurde klar, dass der Riese seine Annäherung aus seiner höheren Position über das Feuer hinweg schon längst bemerkt hatte. Trotzdem hatte er keine bedrohliche Haltung eingenommen. Über den prasselnden Flammen drehte sich am Spieß etwas, das wie eine ganze, gehäutete Ziege aussah. Heißes, saftiges Fleisch...
Hunger überwältigte Kanes Vorsicht. Bereit, beim ersten Anzeichen von Gefahr herumzuwirbeln und davonzugaloppieren, ritt Kane kühn bis zum Rand des Feuerscheins und hielt an.
»Guten Abend«, grüßte er mit ruhiger Stimme. Er beherrschte die Sprache der Riesen fließend. »Ich sah Euer Lagerfeuer aus der Ferne und fragte mich, ob Ihr vielleicht gestattet, dass ich mich zu Euch setze.«
Der Riese brummte und legte eine Hand in der Größe eines Spatens schirmend über die Augen. »Was ist denn das? Ein Mensch, der der Alten Sprache mächtig ist.
Und aus dem Nichts noch dazu - in einem Land, das sogar von allen Geistern verlassen ist. Das muss ich näher in Augenschein nehmen. Komm ins Licht, Männlein. Sei meiner Gastfreundschaft versichert.« Seine Stimme, die in ihrer Lautstärke dem Brüllen eines Menschen glich, war von angenehmem Bass.
Kane bedankte sich und schwang sich aus dem Sattel. Er hatte beschlossen, die Chance einzugehen, dem Riesen zu trauen. Als er vor dem Feuer anhielt, musterten die beiden einander neugierig. Mit seinen etwas über sechs Fuß und fast dreihundert Pfund Knochen und muskulösem, sehnigem Fleisch ließ Kane sich körperlich nicht so leicht von einem anderen beeindrucken. In dieser Nacht allerdings befand er sich allein in der Wüste mit einem, der ihn, wenn er es wollte, so leicht überwältigen konnte, als wäre er ein schwächliches Kind.
Die Größe des Riesen war nicht so genau abzuschätzen, da er mit hochgezogenen Knien auf dem Boden saß und von einem Bärenpelzumhang, der wie ein unförmiges Zelt aussah, eingehüllt war. Aber Kane nahm an, dass er so etwa fünfzehn Fuß groß sein mochte. Jedenfalls sah der Riese nicht anders als ein viel zu groß geratener Mensch aus. Seine Proportionen waren die eines Mannes im besten Alter, aufgrund seiner langen Glieder wirkte er allerdings ein wenig schlaksig, obgleich er ungeheure Muskeln aufwies. Er musste ein enormes Gewicht haben. Er trug Stiefel von Tragkorbgröße, und unter dem Umhang ein grobgenähtes Wams und Beinkleider aus Fell. Seine Arme, und was von den Waden zu sehen war, wiesen borstigen Haarwuchs auf. Seine knochigen Züge wirkten keineswegs abstoßend. Sein Bart war zottelig, und sein braunes Haar trug er zu einem kurzen Zopf geflochten, der über den Nacken hing. Auch seine Augen unter der hohen, Intelligenz verratenden Stirn waren braun und standen weit auseinander.
So wie ein Mensch vielleicht einen zugelaufenen Hund betrachtet, musterte der Riese Kanes Gesicht. Nachdenklich blickte er flüchtig in seine kalten blauen Augen - etwas, das nur wenige gern taten. »Du bist Kane, nicht wahr?«, fragte er schließlich.
Kane starrte ihn überrascht an, dann lächelte er bitter. »Tausend Meilen von den Städten der Menschen entfernt, und ein Riese nennt mich beim Namen.«
Das schien den Riesen zu amüsieren. »Oh, du musst schon sehr viel weiter wandern, wenn du ein Fleckchen finden willst, wo man dich nicht kennt. Wir erinnern uns gut, wie die Menschheit dem Mutterschoß entschlüpfte und vortäuschte, erwachsen zu sein. Für euch Menschen sind diese paar Jahrhunderte eine unendlich, lange Zeitspanne, für uns nicht mehr als ein nostalgisches Gestern. Und sehr wohl erinnern wir uns Kanes Fluch und erkennen sein Zeichen.«
»Diese Geschichte ist längst entstellt und verzerrt«, murmelte Kane, und sein Blick ruhte in weiter Ferne. »Kane wird zur verschwommenen Legende in den alten Heimen der Menschheit - und ist in den neuen Landen vergessen. Ich reiste bereits durch Länder, wo man mich nicht als den erkannte, der ich bin.«
»Und du bist weitergewandert - weil die Menschen bald lernen würden, den Namen Kane zu fürchten«, fuhr der Riese fort. »Nun, Kane, mein Name ist Dwassllir, und ich freue mich, dass sich mir eine Legende an meinem einsamen Feuer zugesellt.«
Kane zuckte in ironischer Bestätigung die Schulter. »Was grillt Ihr da Interessantes an Eurem einsamen Feuer?« Er blickte hungrig auf den fettriefenden Braten.
»Eine Bergziege, die ich heute Nachmittag mit einem Stein erlegte. Wild ist hier sehr spärlich, musste ich feststellen. He, dreh doch den Spieß um!«
Kane tat, wie geheißen. »Werdet Ihr alles davon essen?« Der Hunger ließ ihn seinen Stolz vergessen.
Dwassllir hätte es normalerweise bestimmt getan, aber offenbar war er froh über die Gesellschaft. Er riss eine großzügige Portion des Rippenstücks ab, mit der er allerdings sogar Kanes wölfischen Hunger überschätzte. Wieder schob Kane sich das Bild eines zugelaufenen Hundes vor die Augen, aber er hing ihm nicht nach, sein knurrender Magen verlangte seine oberste Aufmerksamkeit. Die Ziege war zäh und sehnig, noch halbroh und von aufdringlichem Wildgeschmack, aber Kane kaute voll Ekstase daran. Mit einem Auge beobachtete er den Riesen weiter wachsam, während er genussvoll das Fleisch von den Rippen riss und das Fett mit tiefen Schlucken abgestandenen Wassers aus Dwassllirs Lederbeutel hinunterspülte.
Mit einem Rülpser, der die Flammen auflodern ließ, stand Dwassllir auf und streckte sich. Er leckte seine Finger ab, wischte sich mit den Händen über das Gesicht, ehe er sie mit dem groben Sand säuberte. Als der Riese aufrechtstand, sah Kane, dass er sich in seiner Größe getäuscht hatte, er war nicht fünfzehn, sondern bestimmt gut achtzehn Fuß groß. Dwassllir betrachtete die Bratenreste. »Magst du noch?«, fragte er. Kane schüttelte den Kopf. Er kämpfte immer noch mit seinem Rippenstück. Der Riese riss das noch übriggebliebene Hinterbein los und setzte sich mit einem zufriedenen Seufzer wieder, um sich kauend damit zu beschäftigen.
»Wie ich schon sagte, Wild ist hier in diesen Bergen schwer zu finden«, murmelte er und deutete mit dem Knochen. »Ich bezweifle, dass es in der Wüste dort überhaupt etwas Essbares gibt. Vermutlich wird dein Pferd das einzige, Fleisch sein, bis du die Steppe östlich von hier erreichst.«
»Ich dachte schon daran, es zu essen«, gestand Kane. »Aber zu Fuß hätte ich überhaupt keine Chance, diese Öde zu überqueren.«
Dwassllir schnaubte geringschätzig. Aufgrund ihrer enormen Größe betrachteten die Riesen Pferde lediglich als genießbares Wild. »Wie gebrechlich eure Rasse ist! Nimmt man dem Menschen seine Krücken weg, ist er hilflos in dieser Welt.«
»Ihr seht bloß, was ihr sehen wollt«, protestierte Kane. »Die Menschheit wird sich diese Welt noch unterwerfen. In nur ein paar Jahrhunderten sah ich, wie unsere Zivilisation aus einem sterilen Paradies entstand. Aus verstreuten Barbarenstämmen wurde ein sich immer weiter ausbreitendes Reich mit Städten, Dörfern und Farmen. Unsere Zivilisation ist die am schnellsten wachsende, die es je auf dieser Welt gegeben hat.«
»Aber nur, weil der Mensch seine Zivilisation auf den Ruinen besserer Rassen, die vor ihm hier waren, aufbaute. Die menschliche Zivilisation ist parasitär - ein schillernder Pilz, der seine Vitalität dem toten Genie verdankt, aus dessen Leiche er wuchert!«
»Weisere Rassen, das gebe ich zu. Aber nicht die Älteren Rassen überlebten, sondern die Menschheit. Der Findigkeit des Menschen ist es zu verdanken, dass er das Wissen vormenschlicher Zivilisationen zum Aufstieg seiner eigenen Rasse richtig zu nutzen versteht. Carsultyal ist von einem Fischerdorf zu der größten Stadt der erforschten Welt geworden. Das wiedergewonnene Wissen der Menschen dort hat zum Stand unserer gegenwärtigen Zivilisation geführt.«
Dwassllir brach den Oberschenkelknochen und saugte das Mark heraus. »Zivilisation! Du prahlst damit, als wäre es eine großartige Leistung von euch Menschen! Sie ist es nicht - lediglich ein Auswuchs menschlicher Schwäche! Der Mensch ist zu zerbrechlich, als dass er in einer natürlichen Umwelt leben könnte. Er braucht die Krücken seiner Zivilisation. Meine Rasse lernte in der echten Welt zu leben, sich der Natur anzupassen. Wir brauchen keine Zivilisation. Der Mensch ist ein Krüppel, der mit seiner Gebrechlichkeit, mit seinen Krücken prahlt. Ihr zieht euch hinter die Mauern eurer Zivilisation zurück, weil ihr zu schwach seid, euch als zur Umwelt gehörend der unverfälschten Natur zu stellen. Statt als ihr Partner zu leben, verkriecht der Mensch sich hinter seiner Zivilisation, verflucht und verhöhnt das natürliche Leben, er entstellt seine Umwelt, um sein Versagen zu vertuschen. Passt nur auf, dass sie sich nicht einmal für alle Schändungen rächt und zurückschlägt, denn dann würde die Menschheit ausgelöscht werden.
Selbst du, Kane, der du als der gefährlichste Mann deiner Rasse geschmäht wirst. Ohne dein Pferd, deine Kleidung, deine Waffen - hättest du ohne sie die Wüste lebend überqueren können, wie du es jetzt fast geschafft hast? Einem meiner Rasse würde es keine Schwierigkeiten bereiten.
Meine Rasse ist älter als deine. Wir hatten unsere Reife erreicht, als ein wahnsinniger Gott sich mit dem dummen Spiel beschäftigte, die Menschheit aus dem tierischen Schlamm zu formen, den er von dort nahm, wo die Schatten am tiefsten waren. Wäre der Mensch in der Jugend meiner Rasse auf der Erde gewandelt, so hätte seine Zivilisation ihn nicht besser als eine Eierschale geschützt. Die Erde zu jener Zeit war viel wilder, als die Menschheit sie jetzt kennt. Meine Vorfahren trotzten Stürmen, Gletschern und Katastrophen, die eure Städte wie trockenes Laub im Wind davongepustet hätten. Nackt standen sie Raubtieren gegenüber, die furchtbarer als alle waren, die der Mensch je kennengelernt hat. Sie kämpften und bezwangen den Säbelzahntiger, das Riesenfaultier, den Höhlenbären, das Mammut und andere Kreaturen, deren Stärke und Wildheit in dieser zahmen Zeit unbekannt sind! Hätte der Mensch dieses heroische Zeitalter überleben können? Ich bezweifle, dass selbst all seine List und seine Kniffe ihn hätten retten können.«
»Vielleicht nicht, aber Ihr müsst auch bedenken, dass eure Rasse beachtliche körperliche Vorteile hat«, argumentierte Kane, obgleich er sich fragte, ob es klug war, den anderen zu provozieren. »Wenn meine Schritte so lang wären wie Eure, brauchte ich kein Pferd, um die Wüste zu durchqueren. Allerdings glaube ich nicht, dass ihr Riesen so abfällig auf ein Pferd herabschauen würdet, wenn es Reittiere gäbe, die groß genug wären, euch zu tragen. Auch mein Schwert würde ich nicht brauchen, wäre ich von eurer Statur und könnte einen Löwen zwischen meinen Händen zerquetschen, als wäre er nicht mehr denn ein Schakal. Und mit Berechtigung prahlen könnt ihr auch nur, weil eure Statur euch physisch allen Gefahren der Umwelt überlegen macht. Das ist mehr, als selbst jedes riesige und mächtige Tier von sich behaupten könnte, wäre es zu Worten fähig. Wer ist mutiger - einer eurer Vorfahren, der mit bloßen Händen einen Höhlenbären etwa seiner Größe erwürgte, oder ein Mensch, der mit einem Speer einen ihm an Kraft vielfach überlegenen Löwen tötete?«
Er hielt inne, um zu sehen, ob der Riese seine Worte als Beleidigung aufgefasst hatte. Offenbar war Dwassllir jedoch nicht leicht zu reizen. Mit vollem Bauch und warmen Füßen war er in blendender Stimmung für eine Debatte am Lagerfeuer mit seinem für ihn zwergenhaften Besucher.
»Es stimmt, dass ihr eine alte Rasse seid, und die Menschheit nicht mehr als ein arroganter Halbwüchsiger ist. Aber was hat eure Rasse vorzuweisen? Wenn ihr es voll Verachtung ablehnt, Städte zu errichten, Schiffe zu bauen, die Wildnis zu kolonisieren, die Geheimnisse vormenschlichen Wissens zu erforschen - welche Leistungen habt ihr dann vollbracht? Kunst, Poesie, Philosophie, Spiritualismus - sind das Bereiche, in denen ihr Großes geleistet habt?«
»Wir rühmen uns des friedlichen Zusammenlebens mit unserer Umwelt - wir leben als ein Teil der Natur, statt Krieg gegen sie zu führen«, erklärte Dwassllir ruhig.
»Gut. Das erkenne ich an«, sagte Kane. »Vielleicht habt ihr Erfüllung in eurer doch etwas primitiven Lebensart gefunden. Die Leistungen einer Rasse beweisen ihren endgültigen Wert in ihrer Fähigkeit auf ihre erwählte Weise zu blühen und zu gedeihen. Wenn eure Rasse den richtigen Weg genommen hat, weshalb wird eure Zahl dann immer geringer, während die Menschheit sich über die ganze Erde verbreitet? Nie war eure Rasse zahlenmäßig stark, und heutzutage stößt man nur noch selten auf Riesen. Werdet ihr im Lauf der Jahre völlig vom Angesicht der Erde verschwinden, bis man euch eines Tages nur noch aus Legenden kennt, so wie die wilden Tiere, die eure Vorfahren bezwangen? Was wird bleiben, das von eurem verlorenen Ruhm zeugen könnte?«
Dwassllir fiel in melancholische Nachdenklichkeit. Kane bereute es, dieses Thema weiter verfolgt zu haben. Schließlich hob der Riese den Kopf und sagte: »Euch Menschen befriedigt es offenbar, eure Leistungen in der Qualität zu sehen. Aber ich kann deine Logik nicht ganz widerlegen. Unsere Zahl nimmt tatsächlich seit Jahrhunderten ab, und ich könnte dir nicht einmal so recht sagen, wieso. Wir leben lange. Ich glaube nicht, dass ich an Jahren viel jünger bin, als du vielleicht meinst, Kane. Wir lassen uns Zeit, uns zu Paaren zusammenzuschließen und Kinder aufzuziehen, doch das war schon immer so. Unsere natürlichen Feinde sind längst ausgestorben, oder haben sich in die fernsten Winkel dieser Erde zurückgezogen. Unsere einfachen Heilmittel genügen, uns zu kurieren, wenn wir wirklich einmal krank sind oder uns verletzen. Todesfälle unter uns sind nicht häufiger geworden.
Ich glaube, unsere Rasse ist ganz einfach alt, müde. Vielleicht hätten wir den gigantischen wilden Tieren der Vergangenheit ins Schattenreich folgen sollen. Unsere alten Feinde verliehen unserem Leben zumindest Würze! Ja, es ist, als hätte unsere Rasse ihre Zeit überlebt, und jetzt gehen wir an Langeweile zugrunde. Wir sind wie einer eurer Könige, der alle seine Gegner besiegt hat und nun nicht mehr als ein eintöniges Altern zu erwarten hat.