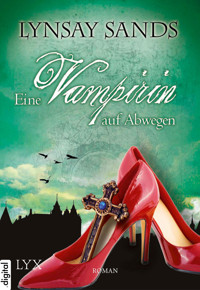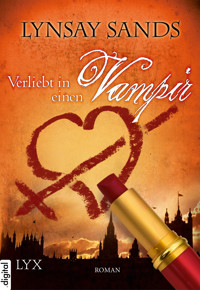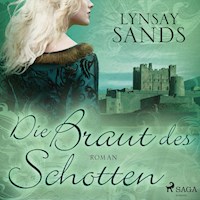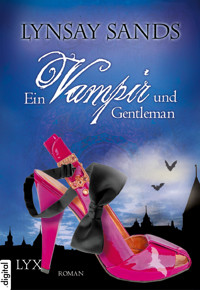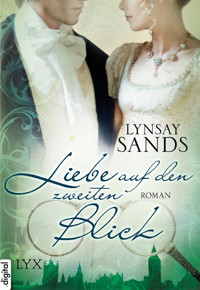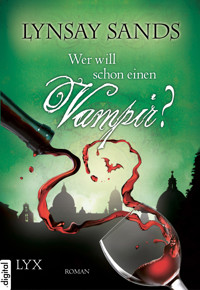9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Argeneau
- Sprache: Deutsch
Das Rettungsteam der Argeneaus befreit die junge Valerie, die von einem wahnsinnigen Unsterblichen entführt wurde. Als der Vampir Anders Valerie begegnet, fühlt er sich zu der eigensinnigen, attraktiven Frau sofort hingezogen. Er verspricht, Valerie um jeden Preis zu beschützen, denn ihr Entführer ist immer noch auf freiem Fuß und trachtet ihr nach dem Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die Autorin
Die Romane von Lynsay Sands bei LYX
Impressum
LYNSAY SANDS
Vampir verzweifelt gesucht
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Ralph Sander
Zu diesem Buch
In vollkommener Finsternis wird die Tierärztin Valerie Moyer in einem Käfig gefangen gehalten, zusammen mit sechs weiteren Frauen. Ihr Entführer ist Ambrose, ein abtrünniger Vampir, der sich vom Blut seiner Gefangenen ernährt. In einem günstigen Augenblick kann sie sich jedoch befreien, einen Notruf absetzen und fliehen – aber dabei wird sie schwer verletzt. Kurz darauf treffen Anders und sein Vollstrecker-Team am Ort des Geschehens ein: Der Abtrünnige konnte zwar flüchten, doch die Frauen werden aus dem Haus des Schreckens befreit und ihre Erinnerung gelöscht, während Valerie, die viel Blut verloren hat, ins Haus von Lucien Argeneau gebracht wird, um dort zu genesen. Anders muss schnell erkennen, dass Valerie seine Seelengefährtin ist. In ihrem traumatisierten Zustand kann er ihr allerdings die Wahrheit über sich nicht offenbaren, doch er schwört, alles in seiner Macht zu tun, um die temperamentvolle Ärztin zu beschützen, denn noch immer ist Ambrose auf freiem Fuß – und er hat Rache geschworen …
1
Valerie schlug die Augen auf und sah … Finsternis. Einen Moment lang fühlte sie sich desorientiert, und sie überlegte, wodurch sie aufgewacht war. Aber dann hörte sie von oben Schritte. Regungslos lag sie da und lauschte, während jemand über ihr in der Küche mit irgendetwas hantierte. Als die Schritte verstummten, versteifte sie sich am ganzen Leib, da zuerst ein Schloss, dann ein weiteres und schließlich ein drittes Schloss geöffnet wurden.
Es folgte sekundenlang Stille, ehe die Tür geöffnet wurde. Sofort fiel Licht auf die Stufen der Treppe und auf den Betonboden des Kellers. Das Licht, das bis zu ihrem Käfig drang, war nur noch ein schwacher Schein, doch im Vergleich zur völligen Schwärze, in der sie die meiste Zeit des Tages verbrachte, war der immer noch so hell, dass sie die Augen zusammenkneifen musste.
Sie hörte, wie sich die andere Frau regte, und spürte, wie ihre Anspannung auf der Stelle zunahm. Mit einem Mal war die Angst so gegenwärtig, als würde sie als lebendes, atmendes Wesen hinter ihr in diesem finsteren, feuchten Raum stehen. Valerie versuchte, sich von dieser Angst nicht überwältigen zu lassen, und begann von hundert an rückwärts zu zählen, um sich abzulenken. Wenn ihr die Flucht gelingen sollte, dann brauchte sie einen klaren Kopf. Angst dagegen führte nur zu panikartigen Aktionen und Reaktionen. Sie führte zu Fehlern, doch wenn sie sich und die anderen aus diesem Haus des Schreckens retten wollte, durfte sie sich keine Fehler erlauben.
Ihre Aufmerksamkeit wurde auf das obere Ende der Treppe gelenkt, wo soeben das wenige in den Keller fallende Licht blockiert wurde, da sich eine hünenhafte Gestalt im Türrahmen aufgebaut hatte und diesen fast völlig ausfüllte. Es war Igor, der ein Tablett in der Hand hielt. Das konnte sie an der Silhouette der Gestalt erkennen. Das Licht tanzte um seinen Körper herum und huschte auf dem Boden hin und her, als er sich in Bewegung setzte und nach unten kam. Seine schweren Schritte auf den Holzstufen wirkten umso lauter, da im Keller völlige Stille eingekehrt war. Die Frauen waren so in ihren Bewegungen erstarrt wie Rehe, die vom Scheinwerferlicht eines Autos erfasst worden waren.
Valerie hielt den Atem an und wartete ab, bis Igor auch noch die letzte Stufe hinter sich gelassen hatte. Er ging an ihrem Käfig vorbei, ohne ihr auch nur einen Blick zuzuwerfen, und steuerte den hinteren Teil des Raums und die dortigen Käfige an. Immer fing er dort hinten an und versorgte jede Gefangene mit einer Flasche Wasser und einer Schüssel mit Haferbrei und Obst. Jede von ihnen bekam diese Verpflegung, nur nicht die eine, die ausgesucht worden war, um in dieser Nacht für Unterhaltung zu sorgen. Da Valerie dieses System inzwischen kannte, versuchte sie zu erkennen, welche der Frauen nichts bekam. Wegen der fast völligen Dunkelheit, in die die anderen Käfige getaucht waren, und aufgrund der Tatsache, dass ihr Käfig der vorderste war, konnte sie jedoch so gut wie nichts erkennen. Es kam ihr so vor, als würde Igor kurz bei jeder Frau stehen bleiben, um ihr Wasser und Essen zu geben, doch völlig sicher war sie sich nicht.
Dann war Igor bei ihrem Käfig angekommen, und sie sah, dass er das leere Tablett in einer Hand nach unten baumeln ließ. Fast lautlos atmete sie aus. Diesmal war sie diejenige, die »Ausgang« bekam. Endlich. Sie rührte sich nicht, während er das Tablett auf den Boden legte und den Schlüsselbund aus der Hosentasche zog. Das Tablett würde dort liegen bleiben, bis er sie in ihren Käfig zurückbrachte, denn er benötigte es, um die bis dahin leer gegessenen Schüsseln mitzunehmen.
Zumindest würde er das so machen, wenn er hierher zurückkehrte. Aber sie hatte sich vorgenommen, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.
Die Käfigtür ging auf, aber Valerie wartete auf sein knappes »Komm mit«, ehe sie auf Händen und Knien nach draußen kroch. Seit zehn Tagen war ein Raum ihr Zuhause, der in jede Richtung etwa ein Meter zwanzig maß. Er war zu klein, um aufrecht zu stehen, und zu klein, um sich auf dem Boden auszustrecken. Also hatte sie seit zehn Tagen entweder zusammengerollt dagelegen oder an eine Wand gelehnt gesessen und die Beine so angezogen, dass sie die Arme um ihre Knie legen konnte. Ausstrecken konnte sie die Beine nur, wenn sie so wie jetzt aus dem Käfig geholt wurde, und das war bislang nur einmal passiert, seit man sie nach hier unten verschleppt hatte. Von diesem einen Mal abgesehen hatte sie die gesamte Zeit in ihrem Käfig verbracht, sie hatte dort gegessen und sogar in der bereitgestellten Bettpfanne ihre Notdurft verrichtet. Die wurde einmal täglich geleert, wenn er die leeren Schüsseln einsammelte.
»Aufstehen«, sagte er nur, als sie auf Händen und Knien auf dem kalten Betonboden kauerte. Es überraschte Valerie nicht, dass er sie umgehend am Arm packte und hochzog. Nachdem sie so lange Zeit in gekrümmter Haltung verbracht hatte, benötigte sie Hilfe beim Aufstehen. Als sie sich aufrichtete, konnte sie ein schmerzhaftes Stöhnen kaum unterdrücken. Tatsächlich war sie sogar dankbar für den Halt, den er ihr mit seiner Hand gab, während er sie die Treppe hinaufbrachte.
Zu Valeries Erleichterung hatten sich die schlimmsten Schmerzen gelegt, als sie die oberste Stufe erreichte, doch sie ließ sich weiter von ihm stützen, und auf der letzten Stufe stolperte sie sogar absichtlich, um den Eindruck zu erwecken, dass sie noch nicht ganz sicher auf den Beinen war. Etwas anderes sollte er auch nicht von ihr erwarten, denn die Medikamente, die man ihnen unters Essen mischte, verloren erst jetzt allmählich ihre Wirkung. Folglich sollten ihre Bewegungen immer noch träge und unkoordiniert sein.
Nur war das bei ihr nicht der Fall.
Nach ihrem letzten »Ausgang« hatte Valerie aufgehört, die tägliche Portion Haferbrei zu essen, deshalb war sie in diesem Moment auch bei klarem Verstand. Ihre einzige Sorge war die, dass sie nach vier Tagen ohne Nahrung zu geschwächt sein könnte. Aber daran ließ sich nun mal nichts ändern, also musste sie sich einfach darauf verlassen, dass sie all das, was vor ihr lag, mit Geschick und Stärke und dem Überraschungsmoment auf ihrer Seite bewältigen würde. Sie hatte nicht vor, in diesem verdammten, stinkenden Käfig im Kellergeschoss zu verrotten.
Sie ließ sich weiter von Igor stützen und stolperte noch ein paarmal, als er sie durch die Küche führte. Den Kopf hielt sie gesenkt, um den Eindruck zu erwecken, dass sie zu kraftlos und noch zu benommen war. Auf diese Weise konnte sie von ihren langen, ins Gesicht fallenden Haaren geschützt unbemerkt den Blick durch die Küche wandern lassen, um nach etwas Ausschau zu halten, das sich als Waffe eignete oder ihr den Weg in die Freiheit bahnen konnte.
Aber da war nichts. Tresen und Küchentisch waren leer, da war kein Messerblock, aus dem sie eine lange Klinge hätte ziehen können. Keine Gläser oder Tassen, die sie zerschlagen konnte, um die Scherben als Waffe zu benutzen. Es gab nicht mal eine Kaffeemaschine oder einen Toaster. Das hier hätte ebenso gut ein verlassenes Haus sein können.
Im Flur suchte sie weiter vergeblich nach etwas Brauchbarem, dann ging es noch eine Treppe hinauf in den ersten Stock des Hauses. Oben angekommen wunderte es sie nicht, dass er sie nach links dirigierte, also zum rückwärtigen Teil des Hauses. Sie war hier schon einmal gewesen, aber da hatte sie unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden, weshalb ihr die Erinnerung an den Flur, an das Porträtgemälde und die getäfelten Wände sowie an den blauen Teppichboden leicht verschwommen vorkam.
Der Flur führte zu einem großen Schlafzimmer. Sie weigerte sich beharrlich, auch nur Notiz von dem altmodischen Bett zu nehmen, als er sie daran vorbei zum angeschlossenen Badezimmer führte. Das Haus war vermutlich schon über hundert Jahre alt, aber das Badezimmer hatte man vor einer Weile renoviert. Sie tippte auf die Fünfziger- oder Sechzigerjahre. Alles war in Grün gehalten. Die Wände waren grün gestrichen, die Toilette und das Waschbecken waren grün, und das galt auch für die Wanne. Die Wand dahinter war mit kleinen grünen Kacheln verkleidet.
Das Ganze war abgrundtief hässlich, überlegte Valerie, während Igor sie zur Seite schob, damit er sich über die Wanne beugen und den Hahn aufdrehen konnte, um Wasser einzulassen. Valerie wusste, was als Nächstes kommen würde, doch sie weigerte sich standhaft, in Panik auszubrechen. Stattdessen sah sie sich in dem kleinen Raum um und betrachtete das, was auf dem Tresen zu beiden Seiten des Waschbeckens lag: ein Handtuch, ein Waschlappen, ein Stück Seife, Shampoo, Conditioner und ein sorgfältig zusammengelegter weißer Bademantel. Alles war für sie hingelegt worden, um sie »für das Abendessen vorzubereiten«, wie Igor es formuliert hatte.
Gerade wandte Valerie sich ab, als ihr ein Gedanke kam. Igor hatte soeben den Stöpsel in den Abfluss gedrückt, gleich würde er sich zu ihr umdrehen, also konnte sie keine Zeit mehr verlieren. Hastig griff sie nach der Shampooflasche, schraubte den Deckel ab und drückte, so fest sie konnte. Das Shampoo spritzte heraus und landete in Igors Gesicht, gerade als der sich zu ihr umdrehen wollte. Als er vor Schreck einen Laut ausstieß und die Hände hochnahm, wirbelte Valerie herum und versetzte ihm einen Tritt in die Magengrube.
Eigentlich hatte sie gehofft, ihn mit genügend Wucht zu treffen, damit er nach hinten in die Wanne fiel, aber entweder war er standfester als erwartet oder sie war schwächer, als sie es nach vier Tagen ohne Essen für möglich gehalten hatte. Auf jeden Fall wich er gerade mal einen Schritt zurück, mehr aber auch nicht, und dabei holte er auch noch mit einer Hand nach ihr aus und traf sie an der Brust.
Der Treffer war so heftig, als wäre direkt vor ihr eine Sprengladung explodiert. Sie wurde durch die Luft gewirbelt und dabei aus dem Badezimmer geschleudert. Im Schlafzimmer landete sie dann mit solcher Wucht auf irgendeinem Gegenstand, der unter ihr zusammenbrach, dass sie auch noch mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Vor Schmerzen schnappte sie nach Luft und sah Sterne vor den Augen.
Sie kämpfte gegen den Schmerz an, der durch ihren ganzen Körper schoss, und versuchte durchzuatmen. Zu ihrer großen Erleichterung gelang ihr das, und sie war wieder in der Lage sich zu bewegen. In diesem Moment hätte es ihren sicheren Tod bedeutet, wenn sie sich nicht hätte rühren können. Igor kam aus dem Badezimmer und wischte sich das Shampoo aus seinen geröteten Augen, während er sie wutentbrannt anstarrte.
Hastig drehte sie sich auf den Bauch, damit sie aufspringen und weglaufen konnte, doch sie hielt inne, als ihre Hand ein längliches Stück Holz ertastete. Es handelte sich um einen Teil eines der vier Beine der kleinen Sitzbank, die am Fußende des Betts gestanden hatte.
Darauf war sie also gelandet. Ihr fiel auf, dass das Bein diagonal zerbrochen war und in eine recht stabil wirkende Spitze auslief. So was wie ein Pflock, schoss es ihr durch den Kopf, und sie umfasste das Holzstück, gerade als sich Igors Finger brutal in ihre Schulter bohrten. Dann riss er sie zur Seite, sodass sie wieder auf dem Rücken landete.
Valerie wehrte sich nicht dagegen, sondern nutzte vielmehr die Drehbewegung, um dem hünenhaften Mistkerl das abgebrochene Stück Holz in die Brust zu rammen. Sekundenlang rührte sich keiner von ihnen, sie sahen sich nur gegenseitig an. Doch dann richtete Valerie ihren Blick auf die Stelle, wo sie ihn getroffen hatte. Alles war so schnell gegangen, dass sie gar nicht erst hatte zielen können. Aber offenbar war das Glück auf ihrer Seite gewesen, da sich der Pflock genau in sein Herz gebohrt hatte. Vorausgesetzt natürlich, er besaß überhaupt eines, wie ihr erst jetzt in den Sinn kam. Sie weigerte sich, Schuldgefühle für ihr Handeln zu empfinden.
Ein keuchender Atemzug aus Igors Mund lenkte ihre Aufmerksamkeit zurück auf den Mann vor sich, der sie losließ und nach hinten taumelte. Ungläubig starrte er auf die provisorische Waffe, die aus seiner Brust herausragte, bis er schließlich nach hinten kippte und mit dumpfem Knall auf dem Holzboden aufschlug. Dieser Knall war aber nicht laut genug, um das Geräusch zu übertönen, als sein Schädel beim Aufprall zerbrach.
Einen Moment lang gönnte sich Valerie die Muße, einfach nur dazusitzen und ihren Widersacher anzustarren. Ihre Brust schmerzte an der Stelle, an der Igor sie getroffen hatte, ihr Kopf pochte wie verrückt vom Aufprall auf dem Boden, und ihr restlicher Körper – allem voran ihr Rücken – beklagte sich über die raue Behandlung, als sie auf die Bank aufgeschlagen war. Dennoch hatte sie das Monster niedergerungen, das sie und die anderen Frauen so brutal und demütigend behandelt hatte.
Allerdings war er nur eines der Monster gewesen, überlegte sie und seufzte leise. Igor war dabei nicht mal derjenige, der das Sagen gehabt hatte. Vielmehr arbeitete er nur für den Bastard, der sie überfallen und hierher verschleppt hatte. Und da Igor beabsichtigte, sie für das Abendessen vorzubereiten, musste das bedeuten, dass sein Boss bald hier eintreffen würde. Sie konnte sich nicht den Luxus gönnen, dazusitzen und ihre Kräfte zu sammeln oder ihre Wunden zu lecken.
Unter Schmerzen zwang sie sich dazu, sich aufrecht hinzusetzen, dann griff sie nach dem nächsten Bettpfosten und zog sich daran hoch. In ihrem Kopf drehte sich alles, und ein irrsinniger Stich bohrte sich durch ihren Rücken, aber sie schaffte es sich hinzustellen. Während sie darauf wartete, dass der Schwindel nachließ, schaute Valerie nach unten. Dabei entdeckte sie ein blutverschmiertes Stück Holz, das aus dem Polster der zertrümmerten Sitzbank ragte. Wie es schien, war Igor nicht als Einziger durchbohrt worden.
Rechts hinten auf ihrem schmutzigen T-Shirt entdeckte sie einen roten Fleck. Erschrocken zog sie den Stoff hoch, stellte dann aber erleichtert fest, dass es sich wohl nur um eine Fleischwunde handelte. Zwar blutete sie noch, dennoch schienen innere Organe nicht betroffen zu sein.
Sie presste eine Hand auf die Wunde, um die Blutung zu stoppen, dann sah sie zu Igor. So wie er dalag, sollte er eigentlich tot sein. Beruhigt schaute sie sich um und entdeckte ein Telefon auf dem Nachttisch an der anderen Seite des Betts. So wie die ganze Einrichtung mutete auch der Apparat steinzeitlich an, aber das sollte ihr egal sein, wenn sie nur damit telefonieren konnte.
Sie stieß sich vorsichtig vom Bettpfosten ab und ging zum Nachttisch. Beunruhigt stellte sie dabei fest, dass sie noch immer sehr wacklig auf den Beinen war. Aber sie ignorierte es einfach, nahm den Hörer ab und wählte den Notruf.
Während sie dem Freizeichen lauschte, fiel ihr auf, dass ihre Beine zitterten und sich in ihrem Kopf alles drehte. Aus Angst, womöglich jeden Moment zusammenzubrechen, hätte sie sich beinahe auf die Bettkante gesetzt. Sie konnte sich aber in letzter Sekunde noch davon abhalten, da sie fürchtete, nicht wieder hochzukommen, wenn sie erst einmal saß.
Zum Glück stand der Nachttisch nicht weit von der Wand entfernt, dort fand sich ein Fenster, das ihr einen Blick nach draußen erlaubte. Das geringelte Kabel zwischen Hörer und Apparat war stramm gespannt, als sie endlich am Fenster stand und sich gegen die Fensterbank lehnte.
»Notrufzentrale«, ertönte es aus dem Hörer.
»Ich brauche Polizei und Krankenwagen. Sofort«, sagte Valerie und staunte, wie schwach und zittrig ihre Stimme klang.
»Um welche Art von Notfall handelt es sich, und wie lautet die Adresse?«, wurde sie gefragt.
»Die Adresse weiß ich nicht. Man hat mich entführt und …«
»Entführt?«, unterbrach sie der Mann am anderen Ende der Leitung.
»Ja, und es sind noch sechs andere Frauen im Keller eingesperrt. Zumindest waren es sechs«, fügte sie grimmig hinzu und warf Igor einen Seitenblick zu. »Ich glaube, er hat zu viel von ihrem Blut genommen, und jetzt ist eine von ihnen tot, vielleicht sogar zwei.«
»Er hat zu viel Blut genommen?«, wiederholte der Mann, in dessen sachlichem Tonfall nun eine Spur Misstrauen mitschwang. »Haben Sie gesagt, Sie wurden entführt, Ma’am? Und diese anderen Frauen wurden ebenfalls entführt?«
»Ja«, antwortete sie ungeduldig. »Sie werden mehr als einen Rettungswagen schicken müssen. Ich bin verletzt, Igor ist tot, und dann sind da noch die anderen Frauen.«
»Igor?« Der Tonfall des Mannes in der Notrufzentrale wurde unüberhörbar argwöhnisch, als er den Namen hörte, den sie und die anderen Frauen ihrem Bewacher gegeben hatten. »Sagten Sie gerade, Igor ist tot?«
»Ja«, bestätigte sie und kniff frustriert die Augen zu, während sie sich wünschte, sie hätte diese Information erst mal für sich behalten. Das hatte sie nicht, und nun musste sie eine plausible Erklärung liefern, damit der Mann sie nicht für verrückt hielt. »Sehen Sie, wir haben ihn nur Igor genannt. Keiner von uns weiß, wie er eigentlich heißt. Er hat uns Essen gebracht und uns aus den Käfigen geholt, um uns zu seinem Boss zu bringen, von dem wir dann gebissen wurden. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Igor getötet habe. Ich habe ihm nämlich einen Pflock ins Herz gerammt.«
»Habe ich das richtig verstanden, dass Sie von jemandem gebissen wurden? Und dass Sie jemandem einen Pflock ins Herz getrieben haben?« Der Argwohn war jetzt nicht mehr zu überhören. Zweifellos war er längst der Meinung, dass sie ihn nur auf den Arm nehmen wollte.
Valerie ließ den Kopf nach vorn sinken, bis ihre Wange das kalte Glas der Fensterscheibe berührte. Sie versuchte, ihre immer verworrener werdenden Gedanken zu ordnen, um einen Weg zu finden, dass man ihren Anruf ernst nahm und Hilfe zu ihr schickte.
Schließlich sagte sie: »Mir ist klar, dass ein paar von den Dingen, die ich gesagt habe, ziemlich verrückt klingen müssen, und das tut mir auch leid. Aber der Mann, der uns entführt hat, ist ein Wahnsinniger. Er spielt Vampir und beißt uns. Aber ich glaube, von Janey und Beth hat er zu viel Blut getrunken. In den letzten Nächten haben sie nicht mehr viel geredet, und wenn sie inzwischen nicht schon tot sind, dann liegen sie zumindest im Sterben. Sie müssen Hilfe schicken. Krankenwagen und Polizei. Jede Menge, und zwar schnell. Er ist …« Sie brach mitten im Satz ab und versteifte sich, als sie von weit her ein leises Surren hörte. Es war der Motor, der das Garagentor öffnete. Sofort schoss ihr Adrenalinspiegel in die Höhe. Das Tor war vermutlich das einzig Neuzeitliche im ganzen Haus, und sie war unendlich dankbar dafür, dass sie diese Vorwarnung erhalten hatte.
»Ma’am?«, fragte der Mann in der Zentrale, als sie nicht weiterredete.
»Er ist zurück«, flüsterte sie. »Schicken Sie Hilfe!«
»Wer ist zurück?«
»Was glauben Sie denn wohl, wer zurück ist?!«, herrschte sie ihn an. »Der Mann, der uns entführt hat! Wenn er sieht, dass Igor tot ist, wird er mich vermutlich auf der Stelle umbringen … und vielleicht auch all die anderen Frauen. Schicken Sie Hilfe, und zwar sofort!«
»Ma’am, bleiben Sie bitte ruhig. Ich …«
»Haben Sie den Anruf inzwischen zurückverfolgen können? Kennen Sie jetzt die Adresse?«, fiel sie ihm ins Wort. Als das Surren verstummte, fügte sie hinzu: »Ist auch egal jetzt. Ich lege den Hörer nicht auf, dann können Sie das ja weiter versuchen und jemanden herschicken.«
»Ma’am, Sie müssen Ruhe bewahren und am Apparat bleiben, damit …«
»Das würde ich gern machen, wenn ich eine UZI und ein Magazin voll mit Silberkugeln hätte, aber das habe ich nicht, und das dürfte wohl bedeuten, dass wir beide Pech haben«, konterte sie ironisch. »Ich lege jetzt den Hörer daneben. Verfolgen Sie den Anruf zurück und schicken Sie Hilfe«, wiederholte sie eindringlich, während sie hörte, wie sich das Garagentor wieder schloss. Sie legte den Hörer auf den Nachttisch und überlegte, was sie tun sollte. Er hatte den Wagen in die Garage gestellt, und gleich würde er nach hier oben kommen. Ihr blieben nur noch wenige Augenblicke.
Anstatt nach unten zu gehen und Gefahr zu laufen, mit dem Ungeheuer zusammenzutreffen, vor dem sie davonlaufen wollte, drehte sie sich zum Fenster um und schob es hoch, was zu ihrer Erleichterung ganz mühelos ging. Glücklicherweise gab es auch kein Fliegengitter, das sie nur noch mehr Zeit gekostet hätte. Bei einem neuen Fenster wäre das alles viel schwieriger gewesen, und sie hätte das Zimmer durch die Tür verlassen müssen.
Sie lehnte sich aus dem Fenster und sah nach unten. Sie befand sich im ersten Stock, unter ihr erstreckte sich eine ausgedehnte Rasenfläche. Es gab weder einen Baum in Reichweite noch ein Rankgitter, das ihr hätte von Nutzen sein können. Aber wenigstens wurde das Haus von dichten Büschen gesäumt, die im schlimmsten aller Fälle ihren Sprung in die Tiefe abfedern würden.
In Anbetracht einer solchen Aussicht verzog sie missmutig den Mund, dann stieg sie mit einem Bein voran durch das Fenster. Sie erstarrte mitten in der Bewegung, als sie hörte, wie irgendwo im Haus eine Tür geschlossen wurde. Vermutlich die Verbindungstür zwischen Garage und Haus. Sie drehte sich so, dass beide Beine aus dem Fenster hingen, hielt aber erneut inne. Unter ihr befand sich ebenfalls ein Fenster, aber sie war nicht mit dem Grundriss des Gebäudes vertraut und wusste daher nicht, ob er sich jetzt womöglich genau im Zimmer unter ihr befand. Falls ja, und er sah sie vor dem Fenster im Gebüsch landen …
Valerie kniff die Augen zu und zwang sich zu warten, während sie auf jedes noch so leise Geräusch im Haus achtete. Erst als sie Schritte auf der Treppe in den ersten Stock vernahm, gab sie sich einen Ruck und sprang aus dem Fenster.
Anders ging nach draußen auf die Veranda und atmete tief die frische Luft ein. In dem Haus, aus dem er gekommen war, herrschte kein angenehmer Geruch, aber die Situation, die sie dort vorgefunden hatten, war auch alles andere als angenehm gewesen. Er hatte kaum jemals Schlimmeres gesehen.
Als er Justin Bricker sah, der die Auffahrt hinaufkam, ging er ihm entgegen. »Hast du die Polizei abwimmeln können?«, fragte er.
»Die lassen uns jetzt in Ruhe«, versicherte Bricker ihm, als er ihn erreicht hatte. Er warf einen neugierigen Blick in Richtung Haus. »Hast du die Anruferin gefunden?«
»Nein«, antwortete er ernst und schaute ebenfalls zum Haus. Ihr Team war auf die Situation in diesem Haus aufmerksam geworden, als ihnen ein mitgehörter Notruf merkwürdig vorgekommen war. Normalerweise war in Notrufen nicht von Silberkugeln oder von Pflöcken die Rede, mit denen jemand seinen Angreifer durchbohrt hatte.
Sämtliche Anrufe unter der Notrufnummer wurden von ihren Leuten überwacht, damit man unter anderem auch auf Aktivitäten von Abtrünnigen aufmerksam wurde, um deren Treiben sie sich kümmern mussten. Dieser Anruf war definitiv in die Kategorie derartiger Aktivitäten gefallen, aber bei ihrem Eintreffen waren die Sterblichen in Gestalt der Polizei bereits am Ort des Geschehens. Als sie die Gedanken der Beamten lasen, wurde ihnen klar, dass die Anruferin sich keinen Scherz erlaubt hatte. Aus diesen Gedanken erfuhren sie auch, dass sie im Keller auf sieben Käfige stoßen würden, einer davon leer, fünf mit noch lebenden Frauen und der siebte mit einer Toten darin. In einem Hinterzimmer waren sie auf ein halbes Dutzend Leichen gestoßen. Alle – die Lebenden wie die Toten – wiesen Bisswunden auf, die die sterblichen Officers sehr beunruhigten.
Da es ihnen nicht gelungen war, die Schlösser der Käfige zu öffnen, hatten sie sich erst mal im Erdgeschoss und im ersten Stock umgesehen. Nachdem sie die Anruferin nicht gefunden hatten, waren sie zunächst wieder nach draußen gegangen, um nachzusehen, ob sie irgendwelches Werkzeug fanden, mit dem sich die Käfigtüren aufbrechen ließen, um die Frauen zu befreien. Zu dem Zeitpunkt waren Anders und der Rest eingetroffen. Während Bricker damit begonnen hatte, die Erinnerungen der Polizisten zu löschen, waren die übrigen Vollstrecker ins Haus gegangen.
Zunächst hatten sie das Erdgeschoss und den ersten Stock durchsucht, aber viel gründlicher, als es zuvor von den Polizisten erledigt worden war. Nachdem sie die Anruferin nicht hatten finden können, waren sie in den Keller gegangen, um die Frauen aus den Käfigen zu holen und sie zu versorgen. Unterdessen machte sich Anders draußen erneut auf die Suche nach der verschwundenen Frau.
»Im Schlafzimmer steht ein Fenster offen«, ließ Anders Bricker wissen. »Sie könnte auf dem Weg entkommen sein.«
»Ach, verdammt«, knurrte er. »Wenn sie sich an die Behörden wendet und das in allen Einzelheiten erzählt, dann macht sie alle meine Anstrengungen zunichte, die Erinnerungen der Cops zu löschen.«
»Dazu wird es nicht kommen«, sagte Anders. »Sie ist nämlich verletzt.« Er ließ dabei unerwähnt, dass es im Schlafzimmer Hinweise auf einen Kampf und jede Menge Blut gab. Und auch, dass sie nicht mehr lange leben würde, wenn nur die Hälfte davon ihr Blut war.
»Verletzt?« Bricker sah nachdenklich zum Haus. »Dann ist ihr die Flucht vielleicht gar nicht erst geglückt. Der Abtrünnige könnte sie überwältigt und mitgenommen haben. Immerhin ist er nach Hause gekommen, während sie noch telefoniert hat.«
»Möglicherweise«, räumte Anders ein und hielt es für eine Schande, wenn es tatsächlich so abgelaufen sein sollte. Was für eine schreckliche Vorstellung, dass diese Anruferin, deren Namen und Gesicht er nicht kannte, es geschafft hatte, die Polizei zu alarmieren, dann aber womöglich erneut in die Fänge dieses Abtrünnigen geraten war, noch bevor jemand eintreffen konnte, um sie zu retten.
»Ich schätze, wir müssen uns trotzdem Gewissheit verschaffen«, murmelte Bricker.
Anders nickte. »Decker und Mortimer kümmern sich um die Frauen im Keller, währenddessen sehen wir uns hier um und überzeugen uns davon, dass sie nicht irgendwo hier draußen liegt.«
»Alles klar.« Wieder sah sich Bricker die Fassade des Hauses an. »Welches Fenster steht offen?«
Anstatt zu antworten machte Anders auf dem Absatz kehrt und führte ihn um das Haus herum.
Sie waren eben um die Ecke gebogen, und Anders zeigte gerade auf das Fenster im ersten Stock, da klingelte Brickers Handy. Er hielt inne und sah zu dem jüngeren Mann, als der das Telefon aus der Tasche zog und sich die Rufnummer ansah. Als Bricker seufzte, zog Anders fragend eine Braue hoch. »Schwierigkeiten?«
»Es ist Lucian«, sagte Bricker und verzog missmutig das Gesicht.
Es gelang Anders, das Lächeln zurückzuhalten, das sich auf seine Lippen stehlen wollte. Lucian war das Oberhaupt des Rats der Unsterblichen, und er führte auch die Vollstrecker an, deren Aufgabe es war, diejenigen dingfest zu machen, die die Gesetze des Rats ignorierten oder brachen. Außerdem hatte er eine Ehefrau, die schon vor einer Woche ihr Kind hätte bekommen sollen … was den Mann ein Stück weit in den Wahnsinn trieb und ihn dazu veranlasste, seine Vollstrecker ständig anzurufen, um sich von ihnen den aktuellen Stand der Dinge berichten zu lassen.
»Du solltest besser rangehen«, riet Anders ihm.
»Ich weiß«, gab Bricker seufzend zurück und fügte hinzu: »Wahrscheinlich will er nur wieder, dass ich auf dem Rückweg irgendwas mitbringe, worauf Leigh gerade Heißhunger hat. Der Himmel weiß, warum er sie nicht für ein paar Minuten aus den Augen lassen und das selbst erledigen kann.«
Anders zog eine Grimasse und ging voraus, damit Bricker in Ruhe telefonieren konnte. Es war bereits nach Mitternacht, aber es war Vollmond, und Anders’ Augen konnten im Dunkeln fast genauso gut sehen wie am helllichten Tag. Als Erstes begab er sich zu den Büschen hinter dem Haus. Auf dem Weg dorthin suchte er den Boden nach Blutspuren oder anderen Hinweisen ab, dass sich ein Kampf zugetragen hatte. Erst als er fast genau unter dem offenen Fenster stand, fiel ihm etwas auf. Von dem Busch darunter waren etliche Zweige abgerissen worden, und überall lagen Blätter auf dem Boden. Außerdem war die Erde rings um den Busch aufgewühlt worden.
Anders folgte den Spuren, die sich gut drei Meter entlang der Rückseite des Hauses fortsetzten, bis ihm ein nackter Fuß auffiel, der unter dem Gebüsch herausragte. Sein Blick wanderte weiter über ein Paar Beine, die in einer Jeans steckten, nur den Oberkörper konnte er von seiner Position aus nicht erkennen, da der von dem Gebüsch verdeckt wurde.
Seiner Meinung nach musste es sich um die Frau handeln, die den Notruf gewählt hatte, und nach den Spuren in der lockeren Erde zu urteilen hatte sie sich wohl bis zu dieser Stelle geschleppt, um sich im Gebüsch zu verstecken. Hier war sie dann vermutlich ohnmächtig geworden … oder gestorben, sinnierte er mit finsterer Miene. Auf jeden Fall hatte sie auf keines der Geräusche reagiert, das er beim Näherkommen verursacht hatte.
Er bückte sich, umfasste ihr Fußgelenk und zog sie mühelos unter dem Busch hervor. Sie entpuppte sich als junge Frau mit schmutzverschmiertem Gesicht, und auch ihre blonden Haare waren voller Dreck. Ihre Kleidung war in einem noch erbärmlicheren Zustand, die Jeans war eher braun als blau und ihr T-Shirt so mit Schmutz- und Blutflecken übersät, dass nur ein paar weiße Stellen auf die eigentliche Farbe des Stoffs hinwiesen. Aber dann sah er, dass sich ihre Brust langsam hob und senkte. Sie lebte noch!
Neben ihr ging er in die Hocke und schob ihr T-Shirt hoch, weil er nach Verletzungen suchen wollte. Dabei stellte er fest, dass sie nicht nur unverletzt war, sondern auch keinen BH trug. Er zog sie in eine sitzende Haltung hoch und bemerkte sofort eine Stichverletzung am Rücken. Es war eine Wunde von beträchtlicher Größe, und es trat noch immer Blut aus, aber hier auf dem Rasen wollte er sie nicht versorgen. Er musste sie zum Van bringen, da hatte er alles, um Erste Hilfe leisten zu können.
In dem Moment, als Bricker um die Ecke kam, hob Anders sie gerade vom Boden auf. »Ja, er hat sie gefunden«, hörte er den anderen Mann sagen.
Ein Blick über die Schulter ließ ihn erkennen, dass sich Bricker ihm näherte, aber immer noch sein Handy ans Ohr gedrückt hielt.
»Lucian will wissen, ob sie noch lebt«, sagte Bricker und blieb hinter ihm stehen.
»Ja, das tut sie.« Anders drückte den Rücken durch. »Aber sie ist verletzt. Ein Stich in den Rücken. Dani oder Rachel müssen sie sich ansehen.«
Dann ging Anders los, während er es Bricker überließ, diese Information weiterzugeben. Er hatte den vorderen Teil des Gartens erreicht, als er von Bricker eingeholt wurde.
»Lucian sagt, wir sollen sie zu ihm nach Hause bringen«, ließ der Mann ihn wissen und ging neben ihm her. »Er will mit ihr reden, sobald sie wieder bei Bewusstsein ist. Dani oder Rachel werden ebenfalls zu ihm kommen.«
»Dann solltest du das Mortimer sagen«, gab Anders mit einem Achselzucken zurück. »Ich warte beim Van auf dich.«
»Okay.« Bricker steuerte auf die Veranda zu, während Anders mit der Frau in seinen Armen zum Wagen ging. Mit ein wenig Balancieren gelang es ihm, die Schiebetür allein zu öffnen, dann legte er die Frau auf die Ladefläche und zog den Erste-Hilfe-Koffer heran, den sie vorsorglich mitgebracht hatten. Gerade erst hatte er die Verletzte auf die Seite gedreht, das T-Shirt hochgeschoben und damit begonnen, die Wunde zu säubern, als die Frau plötzlich das Bewusstsein wiedererlangte und vor Schmerzen aufschrie. Reflexartig drang Anders in ihren Geist ein, um diese Schmerzen zu lindern, damit er ungestört weitermachen konnte, als er erkennen musste, dass ihm das nicht gelingen wollte.
Überrascht riss er die Augen auf, dann musterte er die Frau genauer. Unter all dem Dreck lag ein hübsches Gesicht verborgen, und ihr Haar war von einem helleren Blond, als es ihm im ersten Moment vorgekommen war. Mit ihren wunderschönen Augen sah sie ihn misstrauisch an.
»Sie sind in Sicherheit«, sagte er mit rauer Stimme.
Sie starrte ihn weiterhin an, als würde sie in seinem Gesicht irgendetwas suchen … was, das wusste er nicht. Schließlich schien sie das Gesuchte gefunden zu haben, da sie sich auf einmal entspannte und die Angst zumindest ein wenig aus ihrem Gesichtsausdruck wich.
»Wie heißen Sie?«, fragte er und versuchte abermals, in ihre Gedanken vorzudringen. Er schaffte es nicht. So etwas hatte er noch nie erlebt.
»Valerie«, kam es mit kratzender Stimme über ihre Lippen.
»Valerie«, wiederholte er und fand, dass der Name zu ihr passte. »Sie sind in Sicherheit, aber Sie sind verletzt. Ich muss die Blutung stoppen.«
Sie nickte zur Bestätigung.
Anders zögerte, aber er musste einsehen, dass es ihm nicht möglich war, ihre Schmerzen zu lindern. Und das Stoppen der Blutung duldete keinen Aufschub. Also ging er an die Arbeit und reinigte zügig die Verletzung. Es wunderte ihn nicht, dass sie nach einer Weile erneut bewusstlos wurde. Einerseits hatte sie viel Blut verloren, andererseits tat er ihr unfreiwillig weh – so sehr, dass er sich über ihre Widerstandsfähigkeit wunderte, mit der sie bis zur Ohnmacht seine Behandlung über sich ergehen ließ, ohne vor Schmerzen zu schreien.
Als Bricker zu ihm kam, hatte Anders bereits einen Verband angelegt und stand neben der reglos daliegenden Frau, die er nur ungläubig anstarren konnte.
»Soll ich fahren?«, wollte Bricker, der die Frau im Van neugierig musterte, wissen.
»Ja.« Eigentlich hatte Anders das gar nicht sagen wollen, doch es überraschte ihn auch nicht, dass ihm diese Antwort über die Lippen kam. Es war sogar eine gute Idee, denn wenn Bricker den Wagen fuhr, konnte er hier bei Valerie bleiben. Sollte sie unterwegs das Bewusstsein wiedererlangen, dann war er da, um sie zu beruhigen und sie daran zu hindern, sich während der Fahrt weitere Verletzungen zuzuziehen.
»Lass uns fahren«, sagte er entschieden, stieg ein und zog die Schiebetür hinter sich zu.
2
Als Valerie aufwachte, hatte sie das Gefühl, unter eine Dampfwalze geraten zu sein. Jede Faser ihres Körpers schien zu schmerzen. Doch als sie dann auch noch versuchte, sich etwas bequemer hinzulegen, da musste sie erkennen, dass eine Stelle am Rücken noch viel schlimmer wehtat. Die Bewegung verursachte einen so intensiven Stich, dass sie nicht anders konnte, als nach Luft zu schnappen. Gleich darauf setzte die Erinnerung ein und stürmte wie ein wilder Stier auf sie los, ohne dass sie ausweichen konnte. Reflexartig riss sie die Augen auf – und kniff sie gleich wieder zu, da grelles Licht nur noch mehr Schmerzen auslöste. Nachdem sie zehn Tage lang fast rund um die Uhr nur in völliger Finsternis in ihrem Käfig gekauert hatte, schienen ihre Augen nun besonders empfindlich zu reagieren. Doch sie musste wissen, wo sie war und in welcher Lage sie sich jetzt befand. Sie war sich zwar ziemlich sicher, dass sie nicht länger auf der Erde unter den Büschen draußen vor dem Haus des Schreckens lag – aber wohin hatte man sie gebracht? War Hilfe gekommen? Lag sie im Krankenhaus? Oder hatte ihr Entführer sie inmitten der Büsche entdeckt und dann auf seiner Flucht vor der Polizei mitgenommen? Das grelle Licht legte für sie zumindest die Vermutung nahe, in Sicherheit zu sein. Aber Valerie musste Gewissheit haben.
Sie zwang sich dazu, die Augen einen Spaltbreit zu öffnen, dann noch ein wenig mehr, bis sie schließlich eine weiße Zimmerdecke über sich entdeckte. Das war schon mal beruhigend, und sie machte die Augen noch ein klein wenig mehr auf, während sie ihren Kopf auf etwas bewegte, das sich wie ein weiches Kissen anfühlte. Das Erste, was sie zu sehen bekam, war ein Tropf zu ihrer Linken, an dem ein zur Hälfte geleerter Plastikbeutel mit einer klaren Flüssigkeit darin hing.
Sie ließ es zu, sich ein wenig zu entspannen, dennoch zwang sie sich, die Augen offenzuhalten und sich weiter umzusehen. Ihre Anspannung steigerte sich jedoch wieder leicht, als sie die blassblau gestrichenen Zimmerwände und die Einrichtung in dunklem Holz bemerkte. Sie lag in einem Schlittenbett, ringsum standen ein Sideboard, zwei Nachttische und an der Wand links vom Bett ein Stuhl, während sich zu ihrer Rechten vor dem Fenster mit der hellblauen Jalousie ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen fand. Das war alles sehr schön anzusehen … aber so was gab es nicht in einem Krankenhauszimmer!
Diese Erkenntnis veranlasste sie zu dem Versuch, sich aufzusetzen, was sich aber als Kampf gegen den eigenen Körper entpuppte. Sie war geschwächt und ihr tat alles weh, dennoch gelang es ihr, und als sie diese Strapaze hinter sich gebracht hatte, zog sie als Nächstes die Infusionsnadel aus ihrem Handrücken.
Sie gönnte sich einen Moment, um sich über das Geschaffte zu freuen, schließlich drehte sie sich zur Seite und drückte sich von der Matratze ab, um auf zittrigen Beinen dazustehen. So weit, so gut, sagte sie sich, nachdem sie die Gewissheit hatte, dass ihre Beine nicht unter ihr wegknicken würden.
»Oh, gut. Sie sind wach.«
Die fröhliche Stimme lenkte ihren Blick zur Tür, wo eine schwangere, eine sehr schwangere Frau stand. Auch wenn sie einen enormen Bauch vor sich her schob, war sie von zierlicher Statur. Unwillkürlich fragte sich Valerie, ob die Frau unter ihrer Kleidung wohl eine Schlinge um ihren Bauch trug, um das Gewicht besser zu verteilen.
»Ich weiß, ich sehe aus wie ein Wal«, sagte die Frau, lachte verlegen und rieb über ihren Bauch, während sie sich dem Bett näherte.
Als Valerie klar wurde, dass sie der Frau unverhohlen auf den Bauch starrte, richtete sie ihren Blick auf das Gesicht ihres Gegenübers. »Wo bin ich?«
Ihre Stimme war schrecklich rau, und jeder Ton schmerzte, als hätte jemand versucht, ihre Stimmbänder mit Stahlwolle zu reinigen.
»In einem sicheren Unterschlupf«, antwortete die braunhaarige Frau und stellte sich zu ihr. Sie beugte sich vor und nahm ein Glas mit einer klaren Flüssigkeit vom Nachttisch. Sie hielt es Valerie hin. »Das ist nur Wasser. Es dürfte inzwischen Zimmertemperatur angenommen haben, aber auf jeden Fall hilft es gegen Ihren trockenen Hals.«
Nach kurzem Zögern nahm Valerie das Glas entgegen. Sie kannte diese Frau nicht, aber immerhin hatte sie gesagt, das hier sei ein sicherer Unterschlupf, und sie wirkte nicht im Geringsten bedrohlich. Es war schwer vorstellbar, dass sie gemeinsame Sache mit Igor oder dessen Boss machte und ihr mit dem Wasser irgendein Betäubungsmittel einflößen wollte. Also ging Valerie das Risiko ein und trank einen kleinen Schluck. Als sie keinen verdächtigen Geschmack bemerkte, kippte sie hastig das halbe Glas in einem Zug runter. Das Wasser fühlte sich in Mund und Rachen seidig und lindernd an, und erst dabei wurde ihr bewusst, dass ihr Körper nahezu ausgedörrt sein musste.
»Danke«, murmelte Valerie, während sie das Glas sinken ließ.
»Keine Ursache.« Die Brünette sah sie freundlich an, dann hielt sie ihr die Hand hin. »Ich bin Leigh Argeneau.«
»Valerie Moyer«, erwiderte Val und schüttelte die Hand.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Valerie. Wie fühlen Sie sich?«
»Mir tut alles weh, ich bin schlapp, und ich glaube, ich könnte eine Dusche gebrauchen«, antwortete sie ehrlich.
»Dass Ihnen alles wehtut, wundert mich nicht«, stimmte Leigh ihr zu. »Sie haben verdammt viel einstecken müssen. Sie sind von oben bis unten mit blauen Flecken übersät, und die Verletzung am Rücken dürfte auch ziemlich schmerzhaft sein. Aber dagegen kann man nichts tun, das muss verheilen«, fügte sie entschuldigend hinzu. »Was die Dusche angeht, denke ich, da lässt sich was arrangieren. Können Sie allein gehen, oder soll ich Sie stützen?«
»Das kriege ich schon hin«, versicherte Valerie ihr.
»Dann kommen Sie bitte mit«, sagte Leigh und drehte sich um, ging zu einer Tür auf der anderen Seite des Betts und fügte hinzu: »Das Schwächegefühl sollte sich bald legen. Bevor unsere Ärztin Sie zusammenflicken konnte, hatten Sie bereits sehr viel Blut verloren. Sie hat Ihnen ein paar Blutkonserven verabreicht, jetzt benötigen Sie nur noch Kochsalzlösung. Da Sie nur eine Fleischwunde davongetragen haben, dürften Sie schnell wieder bei Kräften sein.«
Valerie erwiderte nichts, vermutete aber, dass Leigh recht hatte. Sie war schon jetzt nicht mehr ganz so wacklig auf den Beinen, und wenn sie erst geduscht und etwas gegessen hatte, würde sie sich bestimmt noch etwas besser fühlen. Sie konnte es kaum noch erwarten, aber für den Augenblick hatte sie noch so viele Fragen. »Dieses sichere Haus …«
»… ist mein Haus«, sagte Leigh und machte ihr die Tür auf, die in ein in Dunkelblau gehaltenes Badezimmer führte. Sie sah Valerie über die Schulter an und lächelte ihr zu. »Genau genommen gehört es mir und meinem Ehemann Lucian. Er leitet das Vollstreckerteam, das auf Ihren Notruf reagiert hat.« Sie hielt inne und korrigierte sich: »Eigentlich hat Mortimer das Kommando über die Leute, aber er ist Lucian unterstellt.« Dann zuckte sie beiläufig mit den Schultern. »Jedenfalls sind sie auf die anderen Frauen im Keller gestoßen, und nach einigem Suchen hat man Sie in den Büschen am Haus entdeckt. Die anderen Frauen sind ins Hauptquartier der Vollstrecker gefahren worden, aber Sie hat man hierher zu uns gebracht, damit die Ärztin sich um sie kümmern konnte. Es war nur zu Ihrem Besten«, versicherte sie rasch, als Valerie stutzig wurde, weil man sie von den anderen Frauen getrennt hatte. »Im Quartier der Vollstrecker stehen nicht genug Betten zur Verfügung, außerdem mussten Sie aufwändiger behandelt werden als die übrigen Frauen.«
Valerie nickte beruhigt, fragte aber dennoch: »Und wieso bin ich nicht im Krankenhaus?«
»Ihr Entführer konnte entkommen, und es ist zu befürchten, dass Sie in einem Krankenhaus nicht sicher genug aufgehoben wären«, antwortete Leigh leise.
Angesichts dieser Neuigkeit erschrak Valerie. Sie hatte Igor umgebracht, aber sein Boss, der für all das Schreckliche verantwortlich war, das man ihr angetan hatte, war entwischt. Dieser verdammte Mistkerl!
»Hier sind Sie in Sicherheit«, beteuerte Leigh. »Lucian wird nicht zulassen, dass Ihnen irgendetwas zustößt.«
Valerie äußerte sich nicht dazu. Dass Igors Boss entkommen war, jagte ihr weniger Angst ein, als dass es sie wütend machte. Einmal war sie von ihm überwältigt und verschleppt worden, aber noch einmal würde sie das nicht mit sich machen lassen. Außerdem ärgerte sie sich darüber, dass der Kerl ungeschoren davongekommen war. Allerdings konnte sie daran ohnehin nichts ändern, also ignorierte sie diesen Gedankengang.
»Ich lasse Sie dann mal Ihr Bad nehmen«, sagte Leigh.
»Ich würde ja lieber duschen als baden«, erwiderte sie ein wenig missmutig.
An der Tür angekommen blieb Leigh stehen und drehte sich zu ihr um. »Tut mir leid, aber es ist besser, wenn Sie dieses eine Mal baden. Sie sind noch immer ein bisschen wacklig auf den Beinen, und ich möchte vermeiden, dass Sie in der Dusche ausrutschen und sich noch ein paar blaue Flecke mehr holen. Außerdem hat Dani gesagt, dass der Verband nicht nass werden darf, und das ist beim Baden am ehesten gewährleistet.«
»Dani?«, wiederholte Valerie.
»Dr. Dani Pimms«, erklärte Leigh. »Sie hat Sie wieder zusammengeflickt und Ihre Wunden versorgt.«
»Oh«, machte Valerie leise, seufzte und beugte sich über die Wanne, um den Stöpsel in den Abfluss zu drücken und die Wasserhähne aufzudrehen. »Dann werde ich mich wohl mit einem Bad zufriedengeben müssen.«
Leigh reagierte mit einem flüchtigen Lächeln auf Valeries Unmutsbekundung, dann brachte sie ihr einen Waschlappen und ein Handtuch. »Shampoo, Conditioner und Seife finden Sie am Rand der Wanne.«
»Danke«, sagte Valerie und nahm Handtuch und Waschlappen entgegen.
»Bitte sehr. Ich lasse Sie dann mal allein«, meinte Leigh gut gelaunt und ging zur Tür. »Vergessen Sie nicht, dass der Verband nicht nass werden darf. Lassen Sie also etwas weniger Wasser ein. Ich warte so lange im Schlafzimmer, falls Sie meine Hilfe benötigen. Rufen Sie, wenn Sie mich brauchen.«
Abermals bedankte sich Valerie. Als die Tür ins Schloss gefallen war, drehte sie sich zur Wanne um, die inzwischen zur Hälfte vollgelaufen war. Sie legte Handtuch und Waschlappen zur Seite und drehte die Wasserhähne zu, dann richtete sie sich auf und sah an sich hinab.
Mit Erstaunen nahm sie das hübsche Nachthemd aus weißer Baumwolle wahr, das man ihr angezogen hatte, das aber nicht so ganz ihrem üblichen Stil entsprach. Normalerweise trug sie zum Schlafen ein übergroßes T-Shirt. Sie vermutete, dass dieses Nachthemd eigentlich Leigh gehörte und sie es ihr überlassen hatte, da sie selbst nichts anzuziehen gehabt hätte.
Aber ob es nun ihrem Stil entsprach oder nicht, sie wusste die Leihgabe zu schätzen. Ihre eigene Kleidung war allein schon davon schmutzig geworden, dass sie sie zehn Tage hintereinander hatte tragen müssen. Und nachdem sie dann nach dem Sprung aus dem Fenster auch noch zwischen den Büschen hindurchgerobbt war, konnte nichts davon mehr für irgendetwas zu gebrauchen sein.
Vermutlich sahen ihre alten Sachen noch schlimmer aus als ihre Haare, überlegte sie, als sie sich im Spiegel über dem Waschbecken betrachtete. Leigh oder die Ärztin mussten zumindest ansatzweise versucht haben, sie vom schlimmsten Dreck zu befreien, da Gesicht und Arme sauber waren, während ihre blonden Haare fettig und verklebt aussahen. Kleine Klümpchen Erde hatten sich in ihnen verfangen und klebten auch auf ihrer Kopfhaut. Himmel, sie besaß keinerlei Erinnerung an das, was nach dem Sprung aus dem Fenster geschehen war, aber wenn sie sich so im Spiegel betrachtete, dann konnte man meinen, dass sie mit dem Kopf voran im Gebüsch gelandet war.
Der Gedanke ließ sie schwach grinsen, so albern war er. Sie zog das Nachthemd aus und stieg in die Wanne, musste aber einen Fuß unter ihren Po platzieren, weil sie sonst zu tief im Wasser gesessen hätte und der Verband nass geworden wäre. So sehr wie ihr Körper bei jeder Bewegung schmerzte, war das alles andere als eine bequeme Haltung. Daher beschloss sie, nur ein schnelles Bad zu nehmen.
Während sie zügig Schweiß und Gestank der letzten zehn Tage von ihrer Haut schrubbte, musste sie an all die Fragen denken, die sie Leigh noch gar nicht hatte stellen können. Ihre Gastgeberin hatte davon gesprochen, die anderen Frauen seien ins Hauptquartier der Vollstrecker gebracht worden, was sich so anhörte, als sei das ein noch sichereres Haus. Aber von Leigh war kein Wort gekommen, in welcher körperlichen und geistigen Verfassung sich diese Frauen befanden. Jetzt, da sie selbst in Sicherheit war, hätte sie dazu gern Genaueres erfahren.
»Alles in Ordnung?«, rief Leigh durch die geschlossene Tür.
»Ja, alles in Ordnung«, antwortete Valerie.
»Vielleicht brauchen Sie ja Hilfe, um sich die Haare zu waschen«, sagte Leigh. »Geben Sie Bescheid, wenn Sie so weit sind, dann komme ich rein und helfe Ihnen.«
Valerie reagierte mit einem undefinierbaren Laut, aber sie machte sich über das Problem durchaus Gedanken. Sie konnte sich nicht einfach nach hinten sinken lassen und den Kopf ins Wasser eintauchen, da sonst der Verband nass wurde.
Dann fiel ihr Blick auf den Duschkopf, der ein Stück weit über ihr an der Wand befestigt war. Er war abnehmbar, und mit dem langen Schlauch war das die ideale Lösung für ihr Problem. »Na bitte«, sagte sie zu sich selbst, stieg aus der Wanne und trocknete sich rasch ab. Nachdem sie das Handtuch um sich gewickelt und festgemacht hatte, nahm sie den Duschkopf ab und beugte sich über den Wannenrand. Während sie so dastand und das Wasser über ihren Kopf lief, glaubte sie einmal, jemand habe ihren Namen gerufen. Sie hielt inne und sah zur Tür, horchte aufmerksam hin, konnte aber nicht mit Sicherheit sagen, ob sie tatsächlich etwas gehört hatte oder ob es nur ein Effekt des laufenden Wassers gewesen war. Dann ging plötzlich die Tür auf, und Leigh warf einen besorgten Blick ins Badezimmer.
»Ah, gut, es ist ja doch alles mit Ihnen in Ordnung«, sagte sie, kam herein und legte ein anderes weißes Nachthemd neben das Waschbecken. »Ich hatte nur schnell ein frisches Nachthemd geholt und eben nach Ihnen gerufen, ob alles in Ordnung ist, aber von Ihnen kam keine Antwort.« Nach kurzem Zögern schlug sie vor: »Kommen Sie, ich helfe Ihnen dabei.«
»Das kriege ich schon hin«, beteuerte Valerie.
»Davon bin ich überzeugt, aber es geht schneller, wenn ich Ihnen helfe. Außerdem müssen Sie aufpassen, dass die Nähte nicht aufgehen.«
Da die Fäden, die die Fleischwunde zusammenhielten, schon jetzt wehtaten, protestierte Valerie nicht länger. Als sie die Arme runternahm, ließ das Ziehen nach. Vermutlich war es das Sinnvollste, Leighs Drängen nachzugeben.
»Was ich schon die ganze Zeit fragen wollte«, begann sie, als Leigh ihre Haare abgerubbelt hatte und etwas Shampoo auf ihrem Kopf verteilte. »Wie geht es eigentlich den anderen Frauen? Haben sie es gut überstanden?«
Leigh schwieg, während sie das Shampoo verrieb. »Bedauerlicherweise«, räumte sie dann seufzend ein, »war eine von ihnen bereits tot, als die Männer eintrafen. Im Verlauf der Nacht starb eine weitere Frau.«
»Bethany und Janey«, sagte Valerie und verzog verbittert den Mund. Wenn sie auf der Straße einer der Frauen aus dem Haus des Schreckens begegnet wäre, sie hätte sie nicht erkannt, weil sie nur mit ihren Stimmen vertraut war, jenen Stimmen, die ihr in der Dunkelheit geholfen hatten, nicht den Verstand zu verlieren. Sie hatten sich gegenseitig Mut gemacht und Trost zugesprochen, aber Bethany und Janey waren mit jedem Tag stiller geworden. In der vorletzten Nacht war Janey dann völlig verstummt, und von Bethany hatte sie in der letzten Nacht nichts mehr gehört. Valerie war vom Schlimmsten ausgegangen, und wie es schien, hatten sich ihre Befürchtungen bestätigt.
»Den anderen geht es aber gut«, fuhr Leigh aufmunternd fort und spülte das Shampoo aus. »Ein paar von ihnen waren sehr geschwächt, aber stärkende Mahlzeiten und ein paar Nächte ungestörten Schlafs haben ihnen gutgetan.«
»Ein paar Nächte?«, fragte Valerie überrascht und wollte sich instinktiv zu Leigh umdrehen, bekam dabei aber eine Ladung Wasser ins Gesicht.
»Oh, tut mir leid. Alles okay? Brauchen Sie ein Handtuch, um Ihr Gesicht abzutrocknen?«, wollte Leigh wissen.
»Nein, nein, ist schon gut.« Mit den Fingern wischte sie das Wasser weg. »Und wie lange bin ich schon hier?«
»Ach, ich habe ja ganz vergessen, Ihnen das zu sagen. Das ist jetzt die dritte Nacht, die Sie hier verbringen.«
»Ich bin schon seit drei Nächten hier?«, gab Valerie ungläubig zurück. »Ich kann mich nicht daran erinnern, was passiert ist, bevor ich vorhin aufgewacht bin.«
»Das wundert mich nicht«, sagte Leigh. »Dani hat die Wunde gesäubert und Ihnen sofort ein Antibiotikum gegeben, aber da war es bereits zu spät gewesen. Es war schon zu einer Entzündung gekommen, und bis heute Morgen hatten Sie noch hohes Fieber. So, fertig«, wechselte sie abrupt das Thema und drehte die Wasserhähne zu. »Warten Sie, ich gebe Ihnen ein Handtuch.«
Valerie blieb über den Wannenrand gebeugt und wrang ihre langen Haare aus, während Leigh den Duschkopf wieder in die Wandhalterung steckte. Gleich darauf war die Frau wieder neben ihr und gab ihr das Handtuch.
»Danke.« Sie nahm das Handtuch entgegen, wickelte es um ihren Kopf und richtete sich auf.
»Und? Besser?«, fragte Leigh, als Valerie sich zu ihr umdrehte.
»Viel besser«, antwortete sie ehrlich. Sie fühlte sich schon unendlich viel besser als noch vor ein paar Minuten. Wenn sie jetzt noch etwas zu essen und zu trinken bekäme, dann würde sie wieder ganz die Alte sein … na ja, von den blauen Flecken und der genähten Fleischwunde am Rücken natürlich abgesehen. Aber sie war es gewöhnt, dass ihr immer irgendwas wehtat. Seit ihrem fünften Lebensjahr begeisterte sie sich für Kampfsport, und fast genauso lange nahm sie auch schon an Wettkämpfen teil. Blaue Flecken und Schrammen waren für sie nichts Ungewöhnliches.
»Einer der Männer wird zu Ihnen nach Hause fahren, um etwas zum Anziehen für Sie zu holen, aber für den Augenblick werden Sie sich damit begnügen müssen«, redete Leigh weiter und hielt ihr das frische Nachthemd hin.
Valeries Blick wanderte vom Nachthemd zu Leigh, dann fragte sie zögerlich: »Woher wissen Sie, wo ich wohne?«
»Die Adresse steht auf Ihrem Führerschein. Die Männer haben Ihre Brieftasche gefunden, als sie das ganze Haus geräumt haben. Eine Handtasche wurde nicht entdeckt, nur die Brieftasche und ein Schlüsselbund in dem Mantel, der in Ihrem Käfig hing.«
»Ich hatte auch keine Handtasche bei mir«, bestätigte sie und entspannte sich ein wenig. »Dann hätte ich mich Ihnen vorhin gar nicht vorstellen müssen?«
»Nein, aber es ist immer ein netter Einstieg für eine Unterhaltung.«
Aus einem unerfindlichen Grund entlockte das Valerie ein kurzes Lachen, dann nahm sie das Nachthemd an sich, das Leigh ihr hinhielt. »Ich danke Ihnen.«
»Keine Ursache«, gab Leigh zurück und sah zur Tür, als nebenan angeklopft wurde. »Das dürfte Anders sein. Er ist der Vollstrecker, der Sie draußen vor dem Haus gefunden hat. Mein Ehemann hat ihn beauftragt, auf Sie aufzupassen, bis der Abtrünnige gefasst ist, der Sie und die anderen Frauen entführt hat. Er ist sozusagen Ihr Leibwächter.«
»Ein Vollstrecker? Sie haben den Begriff schon ein paarmal benutzt. Sie meinen einen Polizisten, richtig? Oder gehört er zur RCMP?«
Nach kurzem Zögern antwortete sie: »Die Vollstrecker gehören weder zur Polizei noch zur Royal Canadian Mounted Police. Es handelt sich um eine Spezialeinheit, die sich um besondere Fälle wie diesen hier kümmert.« Ehe Valerie weitere Fragen stellen konnte, redete Leigh bereits weiter: »Während Sie gebadet haben, bin ich nach unten gegangen und habe ihn gebeten, für Sie etwas Suppe zu holen. Seit Sie hier sind, haben Sie noch keinen Bissen zu sich genommen. Sie müssen halb verhungert sein.«
Valerie nickte. Schließlich war es nicht so, als hätte sie nur in den letzten drei Tagen nichts gegessen, sondern sie hatte ja auch an den vier Tagen davor nichts mehr zu sich genommen, um nicht länger die Medikamente zu schlucken, die ihnen allen in ihre Portion Haferbrei gemischt worden waren. Sie wollte sich darüber aber nicht beklagen, denn ihr Plan, befreit zu werden, war schließlich aufgegangen. Aber gerade eben war ihr klar geworden, dass ein Teil ihrer Schmerzen durch den leeren Magen verursacht wurde.
»Ich lasse ihn rein. Kommen Sie ins Schlafzimmer, wenn Sie fertig sind«, sagte Leigh und machte die Badezimmertür auf. »In der Schublade rechts vom Waschbecken finden Sie übrigens eine Bürste.«
Erst als die Frau die Tür hinter sich geschlossen hatte, ließ Valerie das Handtuch zu Boden sinken und zog schnell das Nachthemd an. Es gab noch jede Menge Fragen, auf die sie Antworten haben wollte, aber die meisten davon konnten warten, bis sie endlich etwas im Magen hatte. Sie hatte keine Ahnung, was für eine Spezialeinheit das sein sollte, zu der Anders und der Ehemann von Leigh gehörten, aber allem Anschein nach hatte die Notrufzentrale diese Einheit auf ihren Anruf hin losgeschickt. Oder die Polizei hatte zuerst reagiert und dann diese Einheit angefordert, als sich herausstellte, dass es sich tatsächlich um eine Entführung handelte. Entführung war ein Kapitalverbrechen, und dafür waren staatliche Stellen zuständig und nicht die örtliche Polizei, nicht wahr? Oder traf das nur auf die USA zu?
Egal, sie war auf jeden Fall frei und in Sicherheit, so wie die anderen Frauen auch, die dieses entsetzliche Verbrechen überlebt hatten. Jetzt hatte sie vor allen Dingen Hunger, alles andere konnte warten, bis sie gegessen hatte. Langsam ging sie zum Waschbecken und betrachtete sich im Wandspiegel. Ihr Gesicht war blass, aber sauber. Es war ihr Hals, der ihre Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Auf der Seite befand sich eine große, mit Schorf bedeckte Stelle, wobei die Haut ringsum rot und gereizt war. Eine zweite, ähnliche Verletzung auf der linken Seite war fast völlig verheilt.
Grausige Andenken an das Haus des Schreckens, überlegte Valerie grimmig. Sie wünschte, sie hätte einen Schal oder irgendetwas, um die Wunden zu bedecken, aber das hatte sie nun mal nicht, und auch wenn sie sich noch sosehr einen Schal wünschte, würde er sich nicht einfach so materialisieren. Also war es das Beste, wenn sie sich gar nicht erst zu viele Gedanken machte. Entschlossen zog sie das Handtuch um ihren Kopf weg, wobei ihre feuchten Haare völlig durcheinander auf die Schultern fielen. Wie Leigh gesagt hatte, lag die Bürste tatsächlich in dieser einen Schublade. Valerie nahm sie heraus und begann sich zu bürsten, bis alles geglättet war und die schnell trocknenden Haare sich in Wellen um ihr Gesicht legten. Das war zwar nicht ganz so gut wie ein Schal, aber ihr Hals wurde zumindest teilweise bedeckt.
Als sie fand, dass sie fertig war, wandte sie sich vom Spiegel ab und ging zur Tür, blieb aber im Durchgang zum Schlafzimmer stehen. Leigh hielt sich am Tisch vor dem Fenster auf, nahm Suppenteller und Löffel von einem Tablett und stellte sie dort ab, wo die Stühle standen. Es war aber nicht ihr Anblick, der sie am Weitergehen hinderte, sondern der eines großen Mannes gleich neben ihr, der komplett in Schwarz gekleidet war. Schweigend sah sie zu, wie er den dritten Stuhl von der anderen Seite des Betts zum Tisch trug. Dabei fielen ihr sofort seine schmalen Hüften und die ebenso schmale Taille auf, die seine Arme und die Brust unter dem eng anliegenden T-Shirt umso muskulöser erscheinen ließen. Er besaß genau die Statur, die Bildhauer ins Schwärmen brachte, weil sie sie in Stein gemeißelt festhalten wollten, während Hersteller von Badehosen und Unterwäsche förmlich danach lechzten, ihn für ihre Produkte werben zu lassen. Nur zu gut konnte Valerie sich vorstellen, wie er, die Haut von Sonnenlotion glänzend, an einem Strand lag und mit einem strahlenden Lächeln seine wunderschönen Augen vor lauter Lebensfreude umherschweifen ließ. Valerie wusste beim besten Willen nicht, wie sie auf diesen Gedanken gekommen war. Schließlich lächelte er doch gar nicht, vielmehr waren seine Gesichtszüge als völlig ausdruckslos, wenn nicht sogar als ein wenig mürrisch zu bezeichnen.
Leigh hatte von einem gewissen Anders gesprochen, und Valerie konnte nur annehmen, dass es sich bei ihm um diesen Mann handelte. Sie hatte jedoch nicht damit gerechnet, ihm noch zu begegnen, da sie davon ausgegangen war, er würde nur die Suppe bringen und dann wieder gehen. Nun sah es jedoch so aus, als wolle er ihnen Gesellschaft leisten.
»Ah, da sind Sie ja«, sagte Leigh gut gelaunt und deutete auf den Platz ihr gegenüber. »Kommen Sie, setzen Sie sich hin und essen Sie, bevor die Suppe kalt wird.«
Valerie ging zum Tisch und blieb hinter dem freien Stuhl stehen, dann betrachtete sie den Teller, den Leigh ihr hingestellt hatte. Sie konnte Kartoffeln, Möhren, Kohlrüben und Nudeln erkennen, außerdem Fleischstücke. Alles zusammen ergab eine dickliche Suppe, die so wundervoll duftete, dass Valeries Magen sich vor Verlangen danach noch stärker verkrampfte.
Sie musste schlucken, da ihr buchstäblich das Wasser im Mund zusammengelaufen war, während ihr Blick zu dem Mann wanderte, der den dritten Stuhl an den Tisch getragen hatte und soeben zwischen ihr und Leigh Platz nahm.
»Das ist Anders«, machte Leigh sie mit dem Mann bekannt und stellte beiläufig ein Glas Milch neben den Suppenteller.
Valerie nickte dem Mann zu, der mit der gleichen Geste antwortete.
Leigh nahm von dieser wortlosen Begrüßung mit Verwunderung Notiz, dann sagte sie zu Valerie: »Setzen Sie sich, und greifen Sie zu. Sie müssen doch halb verhungert sein.«
Ein drittes Mal würde sie sich nicht darum bitten lassen, also setzte sie sich hin und stutzte, da Anders im selben Moment wieder aufstand und sich hinter sie stellte, um ihren Stuhl an den Tisch zu schieben. Es war eine altmodische höfliche Geste, von der sie glaubte, dass sie sie außer in alten Filmen noch nie irgendwo beobachtet hatte. Zumindest war sie ihr selbst bislang noch nie zuteil geworden … und aus einem unerklärlichen Grund hatte diese Geste sie verunsichert.
»Danke«, brachte sie heraus und fühlte sich hoffnungslos verlegen, als sie merkte, wie rau ihre Stimme klang.
Als Anders nur mit einem Brummen darauf reagierte, schürzte Leigh die Lippen und erklärte: »Er macht nicht gern viele Worte.«
Valerie lächelte daraufhin flüchtig und widmete sich dann ganz dem Suppenteller vor ihr. Ein köstliches Aroma, das ihren Magen ungeduldig knurren ließ, stieg ihr in die Nase. Sie nahm einen Löffel voll und probierte vorsichtig davon. Fast wären ihr die Tränen gekommen, so wunderbar schmeckte das, was auf ihrer Zunge lag. Das war eindeutig selbst gemacht, daran gab es keinen Zweifel. Voller Begeisterung aß Valerie weiter.
»Nicht so hastig«, ermahnte Leigh sie mit einem Schmunzeln. »Es freut mich ja, dass Ihnen mein Eintopf schmeckt, aber Sie haben seit einigen Tagen nichts mehr gegessen. Es könnte sein, dass Ihr Magen das übel nimmt.«