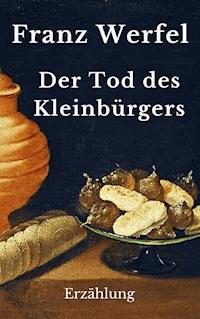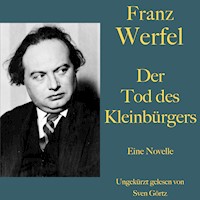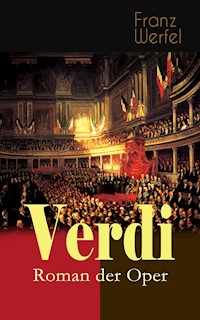
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Verdi - Roman der Oper" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. In Werfels Roman fährt der Komponist Giuseppe Verdi 1883 zum Karneval nach Venedig, wo sich gerade sein künstlerischer Antipode, der selbstbewusste und erfolgreiche Richard Wagner aufhält. Zu Beginn des Romans begegnen sich die beiden Musiker: Wagner erkennt Verdi nicht, es werden keine Worte gewechselt. Verdi selbst arbeitet seit langem an einer neuen Oper, König Lear, deren Komposition ihm Schwierigkeiten macht. Er empfindet sich selbst als ein Vertreter eines älteren Opernstils, einer alten Ordnung. Das wird ihm auch durch Gespräche und Diskussionen mit seinen langjährigen Freunden schmerzlich bestätigt. Verdi befindet sich seit bald zehn Jahren in einer Schaffenskrise; der Vergleich zwischen seinen eigenen, längst zurückliegenden Erfolgen und Wagners völlig neuartigen Opern lässt ihn nicht los. Er kommt schließlich auf den Gedanken, dass er nur wegen Wagner, "dem Deutschen", nach Venedig gereist ist. Verdi gibt die Arbeit an seinem Lear auf und verbrennt rigoros die bereits entstandenen Skizzen. Seine Krise gipfelt in einem nächtlichen Ohnmachtsanfall... Franz Werfel (1890-1945) war ein österreichischer Schriftsteller jüdischer Herkunft mit deutschböhmischen Wurzeln. In den 1920er und 1930er Jahren waren seine Bücher Bestseller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verdi - Roman der Oper
Ein Künstlerroman
Inhaltsverzeichnis
Vorbericht
Vor zwölf Jahren schon ist der Plan dieses Buches entworfen worden.
Immer wieder wurde die Niederschrift vertagt.
Künstlerische Bedenken wirkten lähmend. Bedenken, die der historischen Erzählung im allgemeinen gelten. Sie spielt ja auf zwei Ebenen, auf der dichterischen und auf der geschichtlichen, in einer erfabelten Welt und in der Welt erforschbarer Wirklichkeit. Dadurch schon kann ein Mißklang entstehn.
Dieser Mißklang verstärkt sich, je näher uns die Zeit liegt, in der die Erzählung verläuft. Für das Gestern gar, das so viele noch miterlebt haben, herrscht ein tiefes Feingefühl, das dem Wahrheits-Takt des Autors große Verantwortung auferlegt.
Am schwersten aber ist dieser Mißklang zu überwinden, wenn es sich um einen sogenannten Künstlerroman handelt. Die Darstellung in sich gekehrter Menschen, berühmter Geister, schöpferischer Vorgänge verführt leicht zu Fälschung, Übertreibung, Phrase. Viel ist hierin gesündigt worden.
Niemals aber können rein ästhetische Gefahren schrecken. Es gilt nur durch die Tat zu beweisen, daß sie keine sind.
Darum auch liegt der Grund des langen Zagens viel tiefer. Er liegt im Helden der Erzählung selbst.
Er, der vor der Öffentlichkeit Schauder empfand, der die Zeitungen die Geißel unserer Epoche nannte, der die Publikation nachgelassener Briefe als Unrecht brandmarkte, der (nach Rossinis Ausspruch) sich in Paris alle Chancen verdarb, weil er es verabscheute Visiten zu machen, der Mann, der unnahbar auf seinem Hof lebte, – er sollte sich nicht wehren, als Hauptperson in einem Roman zu figurieren?
Die Liebe, die Begeisterung, die ungetrübte Leidenschaft für seine Musik, ein Nicht-Loskommen von ihr, die Vertiefung in sein Werk, sein Leben, seine Menschlichkeit, all dies hat ihn schließlich überwunden. Nicht ohne Bedingung freilich wollte er sich ergeben. Wie in alten Büchern die Nachsicht des Lesers, mußte während dieser Arbeit die Nachsicht des strengen Helden angerufen werden, der nicht die geringste Verletzung seiner Wahrheit dulden wollte. Allerdings, das genaueste biographische Material eines Lebens, alle Tatsachen und Widersprüche, Deutungen und Analysen sind diese Wahrheit noch nicht.
Wir müssen sie aus ihnen gewinnen, ja sie erst erschaffen die reinere eigentliche mythische Wahrheit, die Sage von einem Menschen.
Der Maestro selbst bekennt sich zu ihr, wenn er in einem Brief das Geheimnis der Kunst in folgende herrliche Formel faßt:
»Die Wahrheit nachbilden mag gut sein, aber die Wahrheit erfinden ist besser, viel besser ...«
Breitenstein, im Sommer 1923. F.W.
Erstes Kapitel Ein Konzert im Teatro la Fenice
Glockengeläute hatte unsere Gondeln zum Saal begleitet, in der Stille glitten wir zurück ...
Aus Glasenapps Wagner-Biographie
Der unirdische Monddunst dieser lau-bezaubernden Weihnacht drang durch das Wasserportal des Fenicetheaters und verklärte die finstere Mündung des langen Ganges, der vorwärts zum erleuchteten Foyer führte. An der grünspanigen Mauer, unbewegt in der Schwärze des Kanals, ein wenig abseits von Treppe und Pflöcken, ruhten einige Gondeln entlang des Fondamento.
Die Ruderer, die zuerst meinten, es gebe eine Oper zu hören, und die ihren Herrschaften nachgeschlichen kamen, um durch einen Türspalt oder gar auf unbezahlten Stehplätzen den Gesang zu genießen, waren enttäuscht worden. Das Orchester da drinnen – alle Musiker in schwarzer Parade – machte eine endlose, langweilige Musik. Und diese Musik wurde vor nicht mehr als fünfzehn Menschen gelärmt. Wußte man nichts Besseres aufzuführen, jetzt, im Dezember, zur Zeit der Stagione?
Die Gondelführer saßen längst schon in einer der Tavernen auf dem Campo del Teatro. Einer von ihnen stand von Zeit zu Zeit immer auf, um nachzusehen, ob die Geschichte nicht schon zu Ende sei. Im übrigen waren sie nicht um Musik betrogen. In der offenen Tür der Nachbarschenke hatte ein Invalide in vergilbter vergessener Uniform Platz genommen und ein kleines Cello mit hohem Stachel zwischen die Knie gestemmt. Unter seinem Bogen beklagte dieses mittelalterliche Bettel-Instrument, das sich auf irgendeinem geheimnisvollen Wege in unsere Zeit verirrt hatte, sein trübes Schicksal. In der Taverne, wo die Wartenden lachten und stritten, produzierte sich ein Paar von Straßensängern: der Knabe mit seiner Mandoline und eine blinde Alte mit schrecklichen Augenhöhlen und einer hell-stechenden Tenorstimme. Dazu kam, daß fast alle Leute, die über den Platz gingen, einen Melodieteil sangen, summten, grölten, pfiffen, daß liederliche Aufschreie, Rufe, Gelächter aus plötzlich sich öffnenden und zuschlagenden Türen brachen, und daß jede Viertelstunde von allen Türmen herab die in dieser Nacht heilig erregten Glockenfluten auf die Stadt Venedig stürzten.
Über dem Hauptportal des so großen, so reizenden Theaters, das in Blau und Gold das Wappen des singenden Schwanes schmückt, brannten die Gasflammen in den beiden gewaltigen Milchglaskugeln. Das goldene Gitter war halb geschlossen. Kein Betreßter stand davor, und auch die Kolporteure der Textbücher, die sonst wütend zu Beginn der Vorstellung und während der Pausen ihr »Libri dell' opera! Libri dell' opera!« der ungerührten Kirche gegenüber an den Kopf werfen, fehlten bei der heutigen Veranstaltung.
Das große Foyer mit seiner zu den Logengängen emporsteigenden Marmorfreitreppe strahlte in den vielfachen Lichtgraden der offenen, in Schalen und hinter Gitterkäfigen brennenden Flammen.
Übertriebenes Schlagschattendunkel war über die beiden Nischen geworfen, in denen rechts ein weißer Empireofen, links der gutmütig-höhnische Riesenkopf G. Rossinis (»von der Gesellschaft im Jahre 1869 gestiftet«) die Dinge und Zeiten ertrugen.
Zwei Damen in höchster Eleganz, mit einem mantilleartigen Schleier über dem auffrisierten Kopf – als gelte es die Papstmesse zu besuchen –, standen verwirrt und unschlüssig im Raum. Oh, wie ruhig betraten sie sonst dieses Haus, wenn der erste Akt schon seinem Ende zuging, da Verspätung doch gute Manier der Vornehmen ist. Heute aber flüsterten sie erregt und pressiert miteinander, drängten sich gegenseitig vom Spiegel weg, zupften die Locken, tupften die Wangen, wiegten sich in den Hüften, und verschwanden, da niemand sie hinderte, ihre weitläufigen Röcke raffend, über die Treppen im ersten Stockwerk der Logen.
Jetzt war das feierlich-lichte Foyer ganz leer, das Büfett im Hintergrund unbewacht, obwohl man darauf eine ziemliche Reihe von Champagnergläsern und einige Schüsseln mit glanzvoll ausgebotenen Speisen bemerken konnte. Deutlich durchfauchte das Gaslicht die tiefe Stille. Nur dann und wann drang durch die dickgepolsterten Türen des Saals das Tutti des Orchesters: einzelne grimmige Akkorde, wie wenn in einem Nebenraum ein unhörbares Gespräch plötzlich zum Streit wird und aufbegehrend trotzige Worte fallen.
Der lange Gang hingegen, der vom Vestibül des Theaters zum Canal la Fenice führt, war nur von drei Petroleumlampen über den Notausgängen erhellt. Er lief dunkel den Riesenkörper des Zuschauer- und Bühnensaals entlang, der wie ein Meerschiff im Dock zu hängen schien. Zwei kleine Stiegen führten zu Eingangstüren empor, aus deren runden Fensterchen das grünlichgelbe Festlicht mit den Strahlen eines Sommernachmittags ins Dunkel lugte. Durch Gucklöcher konnte man auch die Konstruktion der Unterbühne betrachten, wo beim Schein einer abgeblendeten Laterne der Feuerwächter der apathischen Trauer seines Berufs nachhing.
In dem dämmrigen Gang patrouillierte mit tönendem Schritt ein alter Mensch in der dunkelgrünen Livree des Theaterbediensteten. Er trug den weißen ausgeschnittenen Bart der kaiserköniglich österreichischen Zeit, der eigens erfunden worden war, um ein Stück Brust für gewisse Orden und Ehrenzeichen frei zu lassen. Diese Barttracht war hier unter alten Leuten keine Seltenheit, denn man schrieb das Jahr 1882, und nicht viel mehr als ein Jahrzehnt seit Befreiung Venetiens und seit der Einigung des Königsreichs war vergangen.
Der Alte hielt ein erregt düsteres Selbstgespräch. Er schien mit seinem heutigen Dienst übel zufrieden zu sein. Immer wieder schritt er schallend auf und ab, als hätte er es darauf angelegt, sich durch Widerspruch zur Geltung zu bringen, den Leuten im Saal zu zeigen, daß er auf seinem Posten sei, und übrigens in uneingestandener Bosheit das Spiel zu stören. Plötzlich hob er den Kopf, seine schon etwas gebeugte Gestalt bekam Gewicht, er ging mit jener Amtslangsamkeit, mit der sich der Polizist ruhig an die Stätte eines Vergehens begibt, einem Herrn entgegen, der den Gang gemächlich herankam.
»Kein Zugang heute! Der Eintritt verboten! Es findet hier eine private Feierlichkeit statt!«
Der also abgefertigte Herr trug einen dunkelbraunen Überrock und hielt seinen schwarzen Schlapphut in der Hand. Er blieb ruhig vor dem Livrierten stehn und sah ihn mit langsamen, sehr blauen, etwas feuchten Augen an, deren Blick erst aus der Ferne zurückgeholt werden mußte. Dieser Augen abwesend-verträumte Kühnheit war von der stark vorspringenden Stirnwölbung überdunkelt und drückte nicht Ärger, sondern nur eine leichte Verwunderung aus, daß jemand diesen Einspruch gewagt hatte. Obgleich der natürlich gewachsene, kurze Bart fast schon durchwegs weiß, das weiche, noch jünglingshaft-dichte Haar – es fiel in schöner Locke über ein großes, gleichsam gierig geöffnetes Ohr –, obgleich dieses Haar schon mehr als grau war, wäre es doch niemandem eingefallen, zu sagen, der Mann sei alt.
Dem widersprach die nicht allzu kleine, ökonomisch wie ein Geigenkörper gebaute Gestalt mit ihren kräftigen und dabei fast zierlichen Gliedern. Sie stak mit ruhig atmender Gelassenheit in den Kleidern und bewies dadurch zehnfach mehr des alten Mannes Jugend als es jede aufgereckte Straffheit vermocht hätte. Eine große, sehr gebogene sonnverbrannte Nase, ein ganzes System von Falten und Fältchen um die Augen, die von Zeit zu Zeit auch im Dunkel wie von einer unsichtbaren Sonnenblendung zusammengekniffen wurden, gaben diesem Gesicht die wechselnde Miene eines Bauern, der im weiten Abendstrahl sein Land betrachtet, den großen Ausdruck eines verwegenen Piraten, der von seiner Klippe aufs Meer hinausblickt, meist aber die Ruhe eines vornehmen Mannes, der alle Zweifel überwunden und keine Mühe mehr hat, seines Wertes sich bewußt zu sein.
Die Götter, deren Attribut die ewige Jugend ist, wurden keineswegs immer als Jünglinge, viel öfter als reife, ältere Menschen dargestellt: Jupiter, Neptun und Vulkan! Auch auf diesem Gesicht war das Alter nichts als eine schön verwandelte Form der göttlichen Jugend und Zeitlosigkeit.
Der Herr, nachdem er in seiner abwesenden Art den Bediensteten lange und langsam betrachtet hatte, schickte sich an, weiterzugehen.
Der andere wurde strenger:
»Der Eintritt ist verboten! Es findet im Theater eine Feierlichkeit statt!«
Der Herr lächelte mit den fein ausstrahlenden Fältchen um sein Aug ein reizendes Lächeln:
»So?! Dann muß ich umkehren, Dario!«
Der Alte mit dem österreichischen Bart verstummte, gluckste auf, der Blitz schlug in ihn ein, er riß die roten Augen auf und begann seine Wange zu ohrfeigen:
»Ich Esel! Ich Tölpel! Ich Tier! ... Er erkennt mich und ich habe ihn nicht erkannt. Oh, Signor Maestro! ... Was soll ich tun? ... Das Herz klopft mir! ... Unverändert seid Ihr, und ich habe Euch nicht erkannt! ... Ihr beehrt uns! ... Welche Überraschung ... Beim Bacchus! ... Lang habt Ihr uns nicht beehrt, Signor Maestro! ... Wartet einmal: Im Jahre sechzig habt Ihr uns das letztemal beehrt ... Nein, im Jahre neunundfünfzig bei der Stagione vor dem Krieg! ... Mein Kopf ist wirr von dem Schreck! ... Vielleicht wars noch früher, als Ihr den ›Boccanegra‹ hier aufführtet! ... Seht Ihr's, das hab ich mir genau gemerkt ... Viele Stücke haben sie seither gespielt, Signor Maestro, viele neue Stücke! ... Aber alle taugen sie nichts! ... Unter uns, Signor Maestro!«
»Es freut mich, daß Ihr noch beim Theater seid, Dario!«
»Ein Veteran, ein armer Veteran!«
Der elektrisierte Dario nahm Stellung:
»Habe noch beim ›Ernani‹ mitgeholfen! ... Das ist Schönheit, das ist Musik: ›Si ridesti il Leon di Castiglia‹. Das ist Musik, das ist Schönheit. Da kenn ich alles, alles! ... Aber obwohl ich solch ein Kenner bin, haben sie mich wegen meines Alters hier heruntergeschickt und zum Aushilfsbilletteur gemacht ... Vierzig Jahre war ich dort oben angestellt, habe im Chor, in der Komparserie mitgewirkt, als Beleuchter, als Mechaniker, als Bühnenportier ... Ihr habt mich erkannt, Signor Maestro, Ihr habt mich gekannt ... Alle Herren Maestri kennen mich ... Ihr habt uns immer schöne Diskretion gegeben ... Den gelungenen Sturm im ›Rigoletto‹ beliebtet Ihr extra zu honorieren ... O Schreck! ... Ihr beehrt uns! ... Hier sollt Ihr nicht stehn! ... Ihr sollt empfangen werden! ... Ich lauf zum Sekretär! ...«
»Im Gegenteil!«
Verdi berührte den Arm des Dario:
»Kein Mensch erfährt ein Wort davon, daß ich hier war. Ich bin einen Tag lang in Venedig gewesen, reise heute nacht nach Hause ... Es ist nur so ein Einfall, daß ich mir euer altes Theater wieder einmal ansehe ...«
»Ich verstehe! Ich schweige! Inkognito! Königsbesuch!«
»Und da drinnen?«
Der Maestro machte eine kleine Bewegung mit dem Kopf zum Saal hin. Er wußte sehr wohl, was da drin vorging, und deshalb war ihm die Frage, die er stellte, unangenehm.
»Da drin? Sie feiern den Deutschen!«
»Welchen Deutschen?«
»Nun ihn, der seinen Geburtstag hat. Vielleicht auch ist es die Frau, die Geburtstag hat. Kann auch sein, daß sie wegen des Festes diese Musik aufführen.«
Es schien, daß Dario von diesem Thema nicht gerne sprach. Er sah plötzlich auf seine armselig verbeulten Stiefel und machte es dem Maestro schwer.
»Wie heißt der Deutsche?«
»Wagner! Arrigo, oder Riccardo, oder Federigo, oder sonstwie. Sie spielen seine Sinfonia. Er schlägt selbst den Takt. Diese Sinfonia dauert schon fast eine Stunde, und es kommt keine Oper nachher. Dieser Wagner ist überhaupt ein Querkopf und Teufel. Man hat mir manches erzählt.«
»Was erzählt man?«
»Er will im Theater die Pausen abschaffen. Bedenkt nur, Signor Maestro! Man soll hintereinander drei oder vier oder fünf Akte hören, stillesitzen, nicht aufstehen, nicht reden, nicht einmal schneuzen darf man sich eine ganze opera ballo lang. Was ist das für Tollheit, frage ich? – Der Mensch hat einen Akt gehört, seinen Genuß gehabt, jetzt will er sich ergehen, ein wenig rauchen, das Publikum betrachten, ein Gespräch beginnen, die Sänger beurteilen. – Aber nein, das wird verboten sein, wie sie das ›bis‹ schon verboten haben.«
»Sind das all seine Übeltaten?«
»Ah! Man hat mir noch Ärgeres erzählt. In einem Stück bringt dieser Ketzer das allerheiligste Sakrament auf die Bühne. Das ist Lästerung! Gehört so etwas auf die Szene?«
Der Maestro schien längst nicht mehr zuzuhören. Sein Blick hing wieder irgendwo im Weiten. Erst nach einer Weile fragte er sehr gleichgültig, als wollte er aus einem ganz bestimmten Grund das Gespräch ausdehnen:
»Und was gehört, Eurer Ansicht nach, auf die Bühne, Dario?«
Dario begann zuerst zu stammeln, entschloß sich dann zu einer großen Armbewegung und rief:
»Ein guter Gesang! Ein Gesang, der einschlägt! Opern mit gutem Gesang ...«
In diesem Augenblick riß der C-Dur-Akkord des Finales im höchsten Crescendo seines Paukenwirbels festlich ab. – Nach der kleinen Generalpause, die solchen musikalischen Wirkungen folgt, erhob sich Applaus, der zu hellen langgehaltenen Evviva-Rufen anwuchs. Die jugendlichen Musiker, zumeist Schüler des Liceo Benedetto Marcello, feierten den Meister.
Dario gab Laute des Unmuts von sich:
»Ich muß denen dort beim Büfett beistehn. Es ist leider meine Pflicht! Verzeihet!«
Mit seinem hageren, greisen Pas trabte er vorwärts zum Foyer. Noch einmal drehte sich dieses theatralische Unikum in seiner einfältigen und überheblichen Art um: »Signor Maestro! Wartet hier auf mich! Sie werden nicht lange umhertanzen. Gleich bin ich wieder bei Euch!«
Verdi wunderte sich darüber, daß die Worte des Dieners einen gewissen Bann auf ihn ausübten. Es wäre noch Zeit gewesen, durch den leeren langen Gang zu seiner Gondel zurückzukehren. Aber in seiner seltsamen Gefühlsmischung, die er selbst nicht verstand und deren geringster Bestandteil Neugierde war, blieb er, ja machte einige Schritte gegen das Foyer zu.
Dabei bemächtigte sich seiner immer mehr eine schwere, peinliche Empfindung, die ein Erbteil seiner Abkunft, seiner oft erniedrigten Kindheit, seiner schwankenden Jugend war, und die ein ganzes langes Leben der unerhörtesten Triumphe, der glänzendsten Siege im Angesichte Europas nicht hatte überwinden können. Es war dies das Gefühl, als Fremder ohne Berechtigung, ohne Einladung in einen geschlossen ablehnenden Kreis geraten zu sein. Eine schmerzvolle Schüchternheit, eine traurige Scham trotz seinen neunundsechzig Jahren.
Indessen hatte sich die Festgesellschaft, deren Hauptelement, die jungen Musiker des Liceo Marcello mit ihren schwarzen Röcken und Fräcken, das Bild beherrschte, um das Büfett versammelt. Unterm Lärm des Pfropfenknalls, des rasch-stakkatierten italienischen Schwatzes waren breite deutsche Laute vernehmlich, mit ihrer ein wenig verwischten, nicht voll ausgeatmeten Vokalbildung. Diese Laute wurden immer zusammenhängender und bildeten schließlich eine hellschwingende kleine Rede, die neuerdings durch Klatschen und Hochrufe begrüßt wurde.
Mit jener unfehlbaren Gedächtniskraft, die alle Menschen von hervorragender Energie besitzen, hatte der Maestro einige ihm von früher her flüchtig bekannte Gesichter entdeckt. Dies war Graf Boni, der Präsident des Konservatoriums von Venedig, ein Kunst-Aristokrat, der jetzt mit aller Unnötigkeit und Wichtigtuerei des Veranstalters hin und her durch den Raum schoß, ferner der Klarinettist Cavallini, einst eine Konzertkoryphäe, jetzt im Lehr- und Orchesterberuf untergegangen, und schließlich der führende Musikkritiker der ›Perseveranza‹: Filippo Filippi.
Herr Filippi, der sich sogar schmeicheln durfte, einige allerdings leicht rügende Briefe Giuseppe Verdis zu besitzen, gehörte zu jenen Musikschriftstellern, die sich weder durch eine musikalische, noch schriftstellerische Gabe auszeichnen, sondern durch die gewitzte Art, wie sie mit der Zeit gehn, von einer zur andern Richtung wechseln, feinfühlig die Werte der Moden-Börse makeln, zu immer größerem Einfluß gelangen und, nachdem ihr Pensum von Selbsterniedrigung und Frechheit absolviert ist, schließlich auf einem respektablen Thron sitzen.
Der Maestro suchte Schutz, denn jetzt hatte er auch Liszt erkannt. Doch anstatt das Haus zu verlassen – der Weg stand ja noch frei –, trat er rasch über die vier Stufen an eine der Saaltüren heran. Das Dunkel und die Höhe seines Standpunktes gaben ihm das Gefühl der Geborgenheit.
Der Cercle war zu Ende. Schon liefen einige beflissene Knaben an Verdi vorbei und den Gang hinab, die Gondeln zur Abfahrt bereit zu machen. Es folgten die unerwachsenen Kinder Wagners, die mit den betäubt-erregten Augen versäumten Schlafs und ungewohnter Erlebnisse dreinblickten. Sie wurden von ihrem Abbé-Großvater geleitet, der in einer halb anmutigen, halb lehrhaft gedehnten Manier mit ihnen sprach.
Und jetzt kam der große Mann selbst, während der Schwarm hinter ihm sich stieß und drängte. Wagner trug einen hellen Überzieher über dem Frack und den Zylinder in der Hand. Der weißüberflaumte und ungeheuer vorgewölbte Schädel schimmerte durchscheinend wie von einem Zauberlicht. Sein kleiner Körper bäumte sich unter dem wilden Ausdrucksleben, das rastlos aus ihm hervorbrach. Er redete sehr laut sein ausladendes Deutsch mit übermäßig breiten Selbst- und Umlauten, er belehrte, erklärte, scherzte und war der erste, der dem eigenen Witz ein sympathisch-fassungsloses Gelächter nachsandte. Niemand schien zu merken, wie das irdische Gefäß dieser gewaltigen Lebenskraft, eine arme überanspruchte Maschine, klopfte und zuckte. Nur seine Frau neben ihm war nervös, suchte ihn zu beruhigen, seine Rede zu dämmen, seinen Gang zu beschleunigen, um ihn endlich von dieser Gefolgschaft zu retten.
Die jungen Menschen, an die Wagner sein Wort und seine Gebärden richtete, waren nicht bei sich. Mit den Augen von Wüst-Begeisterten, mit dem schlaff-offenen Mund von Trunkenen, mit den pfeifenden Atemstößen von Ekstatikern tranken sie die Worte, die sie nicht verstanden, nein, nicht die Worte tranken sie, sie tranken die Laute, sie tranken das Leben dieses Menschen, ein Leben hundertfach weiterer Artung und höheren Grades, wie es schien, als jedes andere.
Maestro Verdi stand ruhig in dem Schatten seiner erhöhten Türnische. Als er den berauschten Schwarm näherdrängen sah, ging es ihm durch den Kopf, daß trotz den frenetischen Jubelstürmen, die er erlebt, trotz den Fackelzügen, die man ihm gebracht, trotz der Anbetung, die ein dankbares Volk ihm gezollt hatte, all die Vergötterung im Grunde nicht ihm gegolten, nicht dem Schöpfer der Melodien, sondern den Melodien selbst. Sein Name mit den fünf Buchstaben, den zündenden Chiffren der italienischen Erhebung, war Sinnbild geworden. Aber die Person, hinter diesem Namen, hinter diesem Werke blieb dunkel, lebte ungekannt jenseits ihrer Taten und Siege.
Jener aber, der vier Schritt vom Ort eben stehen blieb, um zu neuer Rede auszuholen, sein Werk war immer noch brennende Beunruhigung, entzweite die Menschen, hatte ihm selbst mit höhnischer Verachtung mehr als genug Freunde geraubt, brachte ruhige Seelen außer sich, hing über der geistigen Welt wie ein riesiges Gewölke, das einzig Licht, Farbe, Schatten verteilt.
Doch als er nun die umdrängte Gestalt sah, ahnte der Maestro noch eines sehr tief: Es ist nicht das Werk, es ist der Mensch! Wie beim echten Usurpator war hier das Werk die Person. Sich selbst verewigt er in jedem Augenblick, und kein Mensch ist zu gering, daß nicht auch ihm der Feuerstempel eingebrannt werde; der Stein, den sein Fuß tritt, bleibt Vasall. Seine Tat ist an ihn gebunden, sein Ruhm ist er selbst, und soweit er sein heißes Leben in die Zeit vorauswerfen kann, solange wird er wirken, solange wird er unsterblich sein.
In diesem Augenblick blieb Wagner dicht vor der Türnische des Maestro stehen. Jemand hatte etwas in französischer Sprache gesagt, und der Meister beeilte sich, französisch zu antworten. Während er den Ausdruck suchte, wandte er den Kopf und gewahrte den Mann dort oben im Schatten.
Die Erscheinung Verdis hatte sich plötzlich verwandelt. Die heitere Mildigkeit, die sein Antlitz im Alter gewonnen, war gewichen und der düster-knappe Mann seiner jüngeren Jahre stand da. Das sehr blaue, tiefliegende Auge war erkaltet, in allen Zügen lauerte scharf die empfindsame Gefährlichkeit einer starken Rasse. Die Blicke der beiden Männer trafen einander und der Augenblick ward Ereignis.
Die Dramen der Gestirne laufen in Äonen ab, die Dramen der Menschengeschichte in Stunden, Tagen, Jahren – aber das Ereignis der Seelen mißt nicht nach Zeit und Bewußtsein.
Wagners Blick sah ein Menschengesicht, das er nicht kannte, ein Menschengesicht von großer Fremdheit, über das ihm keine Macht gegeben war, ein Gesicht, das sich hart verschloß und ihm nicht entgegenschmeichelte wie jedes andere. Er sah einen Augenstrahl, getränkt von Stolz und unnahbarer Einsamkeit, eine mühelose Kraft, die seiner nicht bedurfte, die ohne verborgenen Erobererwunsch bestand und wirkte.
Verdis Blick sah zuerst ein fragendes, betroffenes und gleichsam gestörtes Auge. Aber sogleich verschwand die Hemmung, und die diesem Auge eingeborene Strahlung flammte auf: Liebeswerben, Einbeziehen, etwas fast Weiblich-Mächtiges, etwas Ewig-Stürmisches, ein stummer, selbstbegeisterter Ruf: »Sei mein!«
Die Gesellschaft war im finsteren Portal verschwunden. Man hörte das Gezänke der Ruderer.
Der Maestro stand noch unbewegt auf seinem Platz. Sein altes Gesicht voll gelassener Güte war rückgekehrt. Eine Weile lang verblaßte der Abglanz einer Betörung auf diesen lieben Zügen.
Ganz außer sich, kam Dario:
»O Signor Maestro! Ich hätte die Ehre melden müssen, verkünden sollen, daß Ihr da seid. Ich habe einen Verstoß begangen. Sie wollen mich los sein, nun, sie werden mich jetzt wegen Pflichtversäumnis fortjagen. Ihr seid eine Staatspersönlichkeit. Folglich können sie mich auch einsperren. Madonna! Wir haben Mitglieder des königlichen Hauses hier gehabt. Da gabs Reglement, und gar dasselbe wie früher, wenn Mitglieder des allerhöchsten Kaiserhauses, die gottverfluchten Herren Erzherzöge, kamen. Da hieß es: Du stehst hier, und du stehst dort! Und als der Kaiser Napoleon hier war, derselbe, den der Radetzky oder Bismarck, einer von diesen Deutschen, hat erschießen lassen, wars geradeso! Signor Maestro, soll ich nicht doch den Sekretär rufen?«
»Ihr werdet keinen Unsinn reden und schweigen, Dario!«
Ein Geldstück glitt in die Hand des Schwätzers.
Ein unnatürlich starker Mond waltete in und über Venedig. Weichlich gleißende Nebel lagen auf den Kanälen, von denen alle Barken und Gondeln verschwunden waren. Die letzten Glockenwellen eines späten Stundenschlags verebbten zum Himmel. In schneeweißer Leichenstarre grinsten verzerrt die Steinmasken von den Toren des Verfalls.
Seinen kleinen englischen Handkoffer vor sich, saß der Maestro auf dem weichen Sitz der Gondel, diesem Pfühl der Willensschwäche, wie ers immer empfand. Die Welt der kleinen Kanäle war tot. Kein Mensch stieg mehr über die Bogen der Brücken, kein Schatten regte sich unterm Lämpchen der Sottoportici. Nur der Ruderer, hoch auf dem Heck der Gondel, sandte, wenn er um eine Ecke bog, seinen uralten Ruf voraus, der die vornehm-lichte und degenerierte Macht der Stadt zu beleidigen schien.
Von Takt zu Takt stieß der Mann sein Holz in das Element, das etwas weit Menschhafteres, viel Komplizierteres war als nur dickes dunkles Wasser. Mit einem kaum merklichen Akzent glitt die Barke vor, bis die Kraft des Stoßes zu Ende war und eine Hemmung einsetzte. So immer wieder: Lange Note, kurze Note. Lang, kurz! Diese Bewegung war die Mutter aller Barkarolen. ›Venezianischer Sechsachteltakt‹, so hatte sie Verdi einmal in jener Zeit getauft, da er hier den ›Rigoletto‹ einstudierte.
Heute tat ihm dieser Rhythmus nicht wohl. Er liebte das Wasser nicht. Er fürchtete jede Meerfahrt. War es ein Zufall, daß er vor kurzem in dem kleinen Teich seines Parks von Sant Agata fast verunglückt wäre? Wasser war Abgrund. Den undurchsichtigen Abgrund konnte er nicht beherrschen.
Die Unruhe in seinem Gemüt, die nun schon seit Jahren ihn peinigte, steigerte sich in diesem Augenblick zur Beklemmung. Er begann in seiner leidenschaftlichen Art nur reine Verhältnisse zu dulden, sich über diese drei letzten Tage Rechenschaft zu geben. Der Takt der Fahrt mit seiner leisen, erregenden Ungleichmäßigkeit trug die Gedanken:
›Am Einundzwanzigsten bin ich von Genua fort ... Peppina war nicht sehr zufrieden ... Es hat eine Verstimmung gegeben ... Ganz verständlich ... Sie läßt mich nicht gerne allein reisen ... Ich bin neunundsechzig Jahre alt ... Waren diese Geschäfte in Mailand wirklich so wichtig? ... In Genua schien's mir so ... Ein paar Vertragsabschlüsse wegen des neuen ›Boccanegra‹ ... ›Don Carlos‹ in Wien ... Schließlich hätte auch Ricordi zu mir kommen können. Aber man muß hie und da die Verleger persönlich erschrecken ... Es ist doch ein unkontrollierbares Diebsgeschäft! ... Köstlich ... Selbst die Buchhalter machen listig-betretene Augen, wenn ich erscheine! ... Und Boito? Dieser ›Otello‹ ist nicht übel! ... Dieser ›Otello‹ ist sogar außerordentlich! ... Welch ein lächerlicher Einfall! ... Ich werde nicht mehr schreiben. Da es in meinem sechzigsten Jahr zu Ende war, müßte die Natur verrückt werden, damit mir im siebzigsten auch nur vier Takte einfallen! ... Man muß schon die unnützen Tage zu Ende leben! ... Und wenn ich eine neue Oper schriebe und aufführte? ... Das Publikum würde sie gutmütig mit Rücksicht auf den ›ehrwürdigen Meister von Sant Agata‹ und das Repertoire der Leierkästen hingehen lassen ... Die sublimen Herren von Europa würden dasselbe schreiben, was sie seit dem ›Don Carlos‹ immer über mich schreiben: Ich bin ein mäßiger Wagnerepigone. Ich nasche an seiner Harmonik. Ich versuche seine erhabene Polyphonie in mein tölpelhaftes Bussetanisch zu übersetzen! ... Ah! Ah! Weg damit ...‹
Wie der Nachtruf eines großen Tieres durchscholl die Mahnung des Gondoliers die Einöde der Stunde. Der Maestro betastete seinen Koffer:
›Dieser ‹Lear› ist mein Fluch! ... Wohl! ... Gesünder bin ich denn je. Das dumme Halsleiden meiner Jugend ist überwunden ... Treppen kann ich bis zum vierten Stockwerk steigen, zwei Stufen auf einmal, und das Herz klopft mir weniger als vor zwanzig Jahren. Aber diese Empfindsamkeit ist gewiß eine Folge des Alters ... Warum wären mir sonst, als ich unlängst den ›Nabucco‹ und die ‹›Battaglia di Legnano‹ nach unendlicher Zeit wieder las, mehr als einmal die Tränen in die Augen gekommen? ... Altes Zeug! ... Da sind keine Taktwechsel in jeder Phrase drin, keine Alterierungen, verbotenen Quinten, verzwickten Modulationen und Querstände, keine der modernen Eitelkeiten. Aber dafür ist etwas drin, etwas ... etwas Mächtiges! ... Für mich und für keinen sonst! Übrigens, um nur aufrichtig zu sein, hat mich die Musik weniger gerührt als die Erinnerungen, die an ihr hängen ... Daß Gott erbarm, der Anblick meiner Noten ist mir entsetzlich ... Immer die gleichen Bilder ... Basta, basta ... Ist die Reise nach diesem Venedig nicht auch nur eine Sentimentalität? ... Hätte ich früher so weich reagiert? ... Ricordi erzählt mir, der alte Vigna sei sterbenskrank. Oh, wie tut mir gleich das Herz weh! ... Ich sehe sehnsüchtig das Venedig von einundfünfzig und dreiundfünfzig vor mir. Vigna! Das war doch ein Mensch, ein Kerl, ein Entdecker, ein Forscher! Bis drei Uhr morgens haben wir uns gegenseitig immer nach Hause begleitet! ... Wie brannte der Kopf uns vom Gespräch! ... Und dann Gallo! Unser Spaßmacher, dieser unverschämte, brutale, herzensgute venezianische Gallo, den man leider in keinem Museum aufbewahrt als letzten Impresario aus der verruchten und glorreichen Reihe der Barbaja und Merelli ... Ach! Ach! ... Ich Schwerfälliger sitze schon im Zug und fahre hierher ... Aber wenn man selbst alt ist, soll man den Tod nicht besuchen! Da liegt das arme, zusammengeschrumpfte Männchen ... Man hält eine schlüpfrige Hand ... Der hochangesehene Arzt kann sich selber nicht helfen! ... Nun, die moderne Wissenschaft wird auch über dich hinweggeschritten sein! ... Auch über dich!‹
Plötzlich durchfährts peinlich die Gedanken des Maestro:
›Bin ich wirklich nur des kranken Freundes wegen nach Venedig gekommen? Hat mich nichts anderes hergetrieben? Täusche ich mich nicht selbst?‹
Da gleitet die Gondel bei Sant Angelo in den großen Kanal. Die Nebel sind gewichen, übertrieben und ohne Plastik umstarrt die Front der Paläste die schaukelnde, silberschuppige Fläche. Drei Gondeln heben und senken sich müde einen Steinwurf weiter voran. Es sind die Gondeln der wagnerschen Gesellschaft, die von La Fenice heimkehren; keine gewöhnlichen Mietboote wie das, darin der Maestro sitzt, sondern sehr aristokratische Gondeln mit livrierter Bedienung.
Die Fremden schweigen. Eine Totenstille ohne alle Wahrscheinlichkeit verschluckt selbst das schwache Glucksen des tauchenden Ruders. Bald ist die kleine Flottille eingeholt. Aber wie die höhere Verschlagenheit des Schicksals es will, Verdis Gondelführer überholt sie nicht, sondern läßt sein Fahrzeug ruhig in mäßigem Abstand neben der mittleren von den drei fremden Gondeln gleiten. Wagner sitzt links von seiner Frau. Sein Haupt mit dem vorgebauchten Schädel, der in der hexenhaft-bösen Schattenverteilung des Mondlichts dem bleichen Riesenschädel eines Gnomen gleicht, dieses Haupt ist nach hinten gelehnt und die Augen sind geschlossen. Das mächtige Leben von vorhin, das diesen Kopf fast sichtbar vibrieren ließ, die Liebeshast in jedem Zug, der Werbe-, der Siegerwille sind nicht mehr da. Ist Wagner der großen Übermüdung, dem Schlaf, der Gondelerschlaffung, gefährlichen Einflüssen des Mondes erlegen? Schläft er, wacht er, oder genießt er die zauberhafte Stunde der Stadt?
Der Maestro hatte sich in der großen Spannung, mit der er die Gestalt des Deutschen betrachtete, ein wenig von seinem Sitz erhoben.
Das also war der Mann, dessen Name, dessen Wirken, dessen Sein, dessen tausend Schatten ihn seit wenigstens zwanzig Jahren verfolgten. Jetzt kreuzten sich nicht die Blicke, jetzt konnte er sich sattsehen. Wo er in diesen Jahrzehnten nur ein Wort über seine eigene Kunst gelesen hatte, stand genannt oder ungenannt der Name Wagner darin, ihn auszulöschen. Aber nicht nur die Öffentlichkeit in jedem Sinn, auch die Freunde, die Nahen, die Nächsten korrigierten in einer uneingestandenen Verbissenheit ihr Verhältnis zu ihm. Er mußte da nicht gerade nur an den hochbegabten Angelo Mariani denken, an den wirklichen tiefen Schmerz, den er durch diesen Menschen erlebt hatte. Höhnisch wagte es der Dirigent, sein Wort zu brechen, zynisch, wie es einem Wertlosen gegenüber Sitte ist. Er wollte die Premiere von ›Aida‹ nicht leiten. Warum? Weil ihn das nicht mehr interessierte. Sein Ehrgeiz ging höher hinaus: den ›Lohengrin‹ hatte er aufgeführt und nun wollte er sich gar bis zum ›Tristan‹ versteigen. Aber nicht nur Mariani war ein Judas. In jedem Urteil, jedem Lob, jedem Glückwunsch, in der Bewunderung, ja in der Verhimmelung selbst spürte Verdi diesen bitteren Tropfen, in seinem Briefwechsel, im Gespräch mit Freunden, im scheuen Geflüster der Menschen, wenn er in Genua, Mailand, Parma erkannt wurde, in der gönnerisch-ehrerbietigen Art, wie man ihn jüngst in Paris gefeiert hatte, überall empfand er diese verborgen-kränkende Nachsicht, überall und selbst in seiner Ehe. Aber wie es nennen?! Es war keine Abkühlung, es war keine Lieblosigkeit, es war keine Mißachtung – es war nicht zu fassen. Die Menschen hatten ihre Stellung zu ihm ganz und gar verändert, wenn sie auch selber nichts davon wußten. Dennoch, aus jedem Tonfall vermochte sein furchtbar geschärftes Ohr dies zu hören: ›Du bist ein großer Meister. Du bist der Ruhm Italiens! Du bist ein Monument. Aber nun genug! Die Epoche des Puppenspiels, der Theaterritter, der schönen Melodien, des Rampen-Furiosos ist vorbei. Du hast gelebt und triumphiert. Gib dich zufrieden!‹
Ja, so war es. Die niederträchtige Überhebung, das schulmeisterliche deutsche Urteil über ihn, über das italienische Melodram, hatte in der Welt gesiegt, und nicht nur in Paris, auch in seinem eigenen Vaterland hatte es die Jugend, hatte es die Besten überzeugt. Wer glaubte noch an Italiens echte Musik? Die jungen Leute verrieten sie und schrieben Streichquartette. Überall wurden Kammermusikvereine und Symphonieorchester gegründet, um fremden Göttern zu dienen. Wer vom Theater sprach, sprach einzig von Wagner. An die Oper glaubte niemand mehr. Und er selber? Glaubte er noch an die Oper?
Ach, die Bitterkeit in seiner Seele war nichts Eitles, nicht Kränkung oder Neid! Ihm war mehr als allen anderen gespendet worden von der narkotischen Speise des Ruhmes. Er hatte genug, er war satt, er wollte nichts mehr empfangen. Aber geben wollte er, sich selber geben mußte er noch.
Und er konnte es nicht!
Zehn Jahre, Jahre des Alters, die eine Gnade in jeder Sekunde sind, hatte er fortgeworfen. Seit zehn Jahren war er nutzlos, müßig, erbärmlich, tot! Nur tot? Man hatte ihn getötet! Jener dort hatte ihn getötet, der schlummernde, nichtsahnende Feind!
Unter der Wucht dieser Anwandlung richtete sich der Maestro in der Gondel auf. Unberührt schimmerte Wagners Riesenschädel. Die Frau sandte trübe Blicke geradeaus. Und wie er so stand und im ungeheuren, alles verwandelnden Mondlicht den Bord der Nachbargondel die seine fast berühren sah, wollte er denken: ›Zum Greifen nah!‹ Aber in seinem erregten Geiste, in dem die Begriffe des Todes und Tötens noch irrten, verwirrten sich die Worte. Dem Maestro schien es als hätte er sich in Gedanken versprochen. Betroffen und beschämt ließ er sich niederfallen.
Nein, es war kein Haß in ihm. Er betrachtete die schöne, reine Erscheinung des hilflos hingleitenden Wagner. Wie es dem Starken geziemt, schon war der Feind, der Gegensatz, der Widerpart jenes Kampfes, den er in mancher schlaflosen Nacht führte, ihm der Werteste auf der Welt. Bisher zwar hatte er es vermieden, dem Gegner Aug in Aug zu stehen. Die Partituren und Klavierauszüge, die ihm höhnisch Beflissene brachten, pflegte er nach kurzem Einblick, nach raschem Durchblättern in unsicherer Angst vor sich selbst zur Seite zu legen. Nur ›Lohengrin‹ kannte er. Einmal hatte er das Werk in der Wiener Hofoper gehört, das andre Mal unter Leitung des abtrünnigen Mariani in Bologna. Nun, er war nicht zu Grunde gegangen. Ebenbürtig, wenn nicht stärker, verließ er das Theater. Sein Gesang war reiner, sein Ensemblesatz begeisternder. Unbestechlich hatte er damals gefühlt: Das ist gut und dies ist schlecht, jene Stelle zu lang und diese leer. – Vielleicht ist seine ganze Scheu unberechtigt, und die anderen Wunderwerke würden ihn auch nicht verschlingen. Mußte denn alles wahr sein, was er in übertriebener Empfindsamkeit spürte, was ihm durch unzuverlässige Wichtigtuer hinterbracht wurde: Die Verachtung seiner Oper, seines Stils durch Wagner? Sollte ein genialer Mann nicht die Wahrheit einer andern Rasse erfassen können?
Und vor einer halben Stunde, als im Halbdunkel des Theaterkorridors sich die beiden wildfremden Blicke trafen, war nicht eine Flamme in Wagners Aug gewesen, ein höheres Erkennen, ein Ruf über allen Zwist und Zufall der Geburt, des Volks, der Bildung hinweg, der Ruf: ›Komm!‹
›Ich bin Verdi und du bist Wagner.‹ Leise sann der Maestro diese Worte vor sich hin, und kaum waren sie gedacht, hatte sich seine Ahnung enträtselt!
›Nicht Vignas, des Sterbenden wegen bin ich nach Venedig gekommen, sondern um diesen Wagner zu sehn, ihm zu begegnen ... Gott weiß, warum! ... Wir beide sind alt. Im gleichen Jahr geboren. Er bewegt und beherrscht alles ... Ich bin schüchtern und stumm, noch immer der scheue Dorfköter von Roncole ... Dies dürfte die Wahrheit sein!‹
Scharf und grell wie eine überbeleuchtete Kulisse ans Gebäude gelehnt, erschien die Fassade des Palazzo Vendramin. Die drei Gondeln landeten.
Gleichgültig und ohne es zu beachten, zog die vierte ihres Wegs.
Eine Weile später fragte der Maestro seinen Gondoliere nach der Zeit.
»Viertel elf Uhr, Herr, und noch etwas drüber. Wir sind sofort beim Bahnhof.«
»Mein Zug geht erst in zwei und einer halben Stunde.«
»Ah! Der Schnellzug nach Mailand!«
»Kehren Sie um! ...«
Der Fremde nannte eine Adresse.
Der Schiffer wendete. Sein Fahrgast breitete eine Reisedecke übers Knie. Die unnatürlich milde Dezembernacht wurde jetzt frostig fühlbar.
Zweites Kapitel Der Hundertjährige und seine Sammlung
I
Der Mann, der das Tor geöffnet hatte, leuchtete dem Maestro mit einer Laterne ins Gesicht. Es war der Senator selbst.
Er erkannte den Freund, Innigkeit bemächtigte sich seiner Gestalt. Stumm stellte er zuerst die Laterne fort, dann umarmte er den Gast:
»Die Götter lügen nicht, mein Verdi! Heute Nacht hat mir geträumt, ich würde dich sehen!«
Diese Worte, die trotz ihrem klassischen Anklang nicht geschraubt waren, die Welle von Liebe, mit der sie zu ihm kamen, versetzten den Maestro in Verlegenheit.
Der Panzer von Scham und Einsamkeit, der all seine Bewegungen hemmte, machte ihn hilflos vor jeder Offenheit der Empfindung. Selbstoffenbarung und Qual war ein und dasselbe.
Mit zusammengebissenen Zähnen, im Sturmschritt, den Atem schmerzhaft verhaltend, stürzte er (wie oft!) nach dem letzten Akt der Premiere vor die Rampe, wenn das Publikum sich nicht mehr zügeln ließ, wenn der Opernunternehmer, augenrollend, schon die Haare raufte, um des Erfolges willen ihn jammervoll beschwor, und die Sänger wütend auf ihn eindrangen. Und ebenso schnell wieder im Sturmschritt verließ er die Rampe.
Die gleiche Pein war jede seelische Schaustellung. Eine Sängerin konnte sich rühmen, nach dem letzten Akkord der großen ›Macbeth‹-Szene seine Tränen gesehen zu haben. Aber er verzieh es ihr niemals.
War ihm die Überwindung, sich selbst zu zeigen, fast unmöglich, so erschrak er zart davor, wenn ein anderer ihm sein Gemüt aufschloß. Widrige Gefühle freilich, Feindschaft, Angriff, Haß waren leicht zu ertragen. Liebe und Wohlwollen beschämten tief. Im Wort lag Tod.
Und so war er mißverstanden worden, kalt, hart, hochfahrend gescholten jahrzehntelang!
Verdi hielt die Hand des Senators sehr lang in der seinen, dann die Verlegenheit hinter dem ihm eigenen leichtspöttischen Humor verlarvend, sagte er mit etwas gezwungener Wohlgesetztheit:
»Nun! Da du alle Einladungen mit Absicht ignorierst und man einmal nur im Jahrzehnt deine böse Miene sieht, komme ich hier selbst, Freund!«
II
Der Senator – wir nennen ihn so, obgleich er schon vor vielen Jahren diesen vom Königreich verliehenen Rang abgelegt hatte – war ein sehr würdiger Name des Risorgimento. Sohn eines Mannes, der nur durch eine gnädige Laune Franz des Ersten und Antonio Salvottis, des Inquisitors, dem Tod auf dem Spielberg entgangen war, hatte er an allen Phasen der Revolution vom Jahre fünfunddreißig an, dem dreiundzwanzigsten seines Lebens, tätig teilgenommen.
In seiner Schwäche für idealistische Schwärmereien, die ihn sein ganzes Leben nicht verließ, war er aus einem Anhänger des Priester-Träumers Gioberti zum Schüler des nur um acht Jahre älteren Mazzini geworden, in dem er den geliebten und endgültigen Meister fand. – An der Seite Mazzinis und Garibaldis schlug er sich vor den Toren des befreiten Rom gegen den französischen Pfaffengeneral Oudinot, der die Aufgabe hatte, den nach Gaeta geflüchteten Pius wieder auf den Lateran zu führen.
Die kurzen Rauschtage der Römerrepublik galten ihm als die große Zeit seines Lebens. Später war er einer von den wenigen, der des großen Sozialphilosophen und Patrioten englisches Asyl eine Zeitlang freiwillig teilte.
Wenn der Senator auch nicht in der allerersten, berühmtesten Führer- und Heldenreihe der Giovane Italia stand – zum Politiker großen Stils war seine Natur zu weich, zu musisch –, so war er doch der nächste Freund der Großen, und mehr als das, Anreger, Mann des Einfalls, den man im Rat der Verschwörung nur ungern mißte.
Der Glanz der großen Epopöe hatte sich schließlich auch um seinen Namen gesammelt. Dieser Name stand dicht unter dem von Manin und Enrico Cosenz auf dem Revolutionsdekret Venedigs. Zwanzig Jahre später bemühten sich schon die Ministerpräsidenten, vor allem Lanza, vergebens, ihn in ihr Kabinett einzureihen.
Nach erfolgter Einigung der Nation wurde er in den Senat des Dritten Rom berufen. Ein Jahr – er hielt es für seine patriotische Pflicht – blieb er Senator. Dann kam auch über ihn die große Enttäuschung aller revolutionären Demokraten am Königreich, die Enttäuschung der feurig-hoffenden Geister, die den jugendlichen Sturm des Jahrhunderts mitgestürmt hatten, um seinen schlaffen, genüßlerischen Ausgang miterleben zu müssen. Nach einem kurzen Siegestaumel, dessen Rausch nur einen Augenblick lang die quälende Wahrheitsstimme übertäubte, legte der Republikaner und Mazzinist die Senatswürde in die Hände des Königs zurück.
Der unmittelbare Anstoß zu dieser Tat war der Tod seines Helden und Meisters, der im gleichen Jahr, unversöhnt mit der Fügung der Dinge, zu Pisa starb.
Keiner historischen Generation geschieht in unseren Tagen so viel Unrecht wie der unserer Großväter, deren Geburtsstunde in das erste und zweite Jahrzehnt des abgelaufenen Säkulums fällt. Ihr reiner Begriff der Freiheit, ihre seelische Einfachheit, ihre gesunde Kampflust und Kühnheit, ihr Streben nach Autonomie des Einzelnen und Ganzen, all das wird mit dem politischen Schimpfwort »Liberalismus« niedergeschlagen. – Der Geist der Romantik hat über den Geist von Achtundvierzig gesiegt. Der Geist der Romantik, Verbündeter aller heiligen Allianzen, Knecht jeder zweifelhaften Autorität, dieser Geist des Wahnsinns, sofern Wahnsinn die Flucht vor der Wirklichkeit bedeutet, dieser Dämon unaufgeräumter und deshalb schwulstiger Gemüter, dieser Narzissus der Tiefe, dem der Abgrund ein lüsterner Kitzel ist, dieser Gott der Verwicklung und Widerklarheit, dieser Abgott erstorbener Sinnlichkeit, verbotener Reize, scheinheiliger Gebärden, krankhafter Vergewaltigungen, der böse Geist der Romantik, terroristisch von rechts und links, diese Pest Europas hat die lebenswilligste Jugend besiegt, um heute noch zu herrschen.
Der Senator, Verdis Freund, war die inkarnierte Erscheinung der Generation von 1848. Hochgewachsen, beleibt, mit vorgewälzt wasserblauen Augen, deutlicher Neigung zum Kropf, das große, beängstigend rote Gesicht von grauer Löwenmähne und kurzem Bart umrahmt, füllte diese laute Figur jeden Raum aus, den sie betrat, zog mit ihrer lebensvollen Schwerkraft die Gesellschaft sogleich an sich. Dazu kam noch eine dunkelschwingende Stimme, die jeden Satz, den sie sprach, mit Melodie erfüllte, und ein Lachen aus der Tiefe, an dem jeder Widerspruch zunichte ward.
Der Senator, gleichen Alters wie der Maestro, hatte dessen Aufstieg mit einer Art unersättlichen Musikheißhungers verfolgt. In den ersten Jahren der verdischen Entwicklung, seit ›Nabucco‹, dieser Oper, die durch ihren sakralen Herzensklang das italienische Publikum aus seinem süßen Schlendrian riß – seit ›Nabucco‹ hatte der Senator keine Premiere eines Verdi-Werkes versäumt. Ja, zumeist war er, mochten die Geschäfte noch so sehr drängen, über die dritte und vierte Wiederholung hinaus in der Stadt der Aufführung geblieben. Oft waren diese noch mit der Diligence getanen Reisen, bei den elenden Postverhältnissen, den ausgesuchten Schikanen der österreichischen, römischen, neapolitanischen Polizei, wahre Opfer an diese Musik, die mehr als jede andere seinen Lebenssinn berauschte.
Im Hause der Comtesse Maffei wurde oft eine Geschichte zum besten gegeben, laut welcher zur Uraufführung des ›Corsaro ‹ in Triest der vertraglich verpflichtete Komponist nicht, dafür aber der Senator rechtzeitig eingetroffen sei.
Man hat der Musik des Maestro nachgerühmt, sie habe die Kraft, selbst gänzlich unmusikalische Menschen hinzureißen. Als Beispiel wird Cavour angeführt, der zerebrale Mensch, der Mann der konstruktiven Intrige, ohne eine Spur von Musik in sich selbst, der dennoch im Augenblick, da er die Nachricht des gelungenen Anschlags von 1859 empfing, das Fenster zum übervölkerten Platz aufriß und, ohnmächtig ein Wort vor Erregung zu sprechen, die Stretta aus dem ›Trovatore‹ falsch, bebend und heiser hinaussang.
Der Senator selbst war alles andere eher als unmusikalisch. Für einen Laien und Italiener seiner Zeit durfte er sogar für erheblich musikalisch gebildet gelten. Er hatte, wenn auch nur knapp ein Jahr, bei Angelesi, einem kontrapunktischen Zopf, Theorie studiert, in dem schönen Drange, eine Herzenssache auch verstehen zu wollen. So hat er auch an einem großangelegten Werke Mazzinis über Musik fleißig mitgearbeitet. Bei einem monatelangen Aufenthalt in Deutschland lernte er durch die guten Orchester der Hauptstädte die nordische Symphonik kennen. Überdies spielte er selbst Klavier, Flöte und Flügelhorn.
Viel Musik kannte er und gab sich Rechenschaft über ihre vielfachen Wirkungen:
Die französische erfüllte ihn mit Widerwillen, mochte sie sich in der Opera comique oder in den Werken der Thomas, Gounod, Massenet darbieten. Er fühlte den Widerwillen des geradlinigen leidenschaftlichen Menschen gegen alles nur Anmutige, Süße, Schmeichlerische.
Die deutsche Musik des Jahrhunderts machte ihm die Seele schwer. Er empfand unaufgelöste Pein, manchmal überkam ihn eine kurze melancholische Wonne, gleich aber war er wieder in finsteres Schicksal verstrickt, das keine Träne, kein Trotz überwand.
Der Senator sagte einmal zu Verdi:
»Deutschland ist gar nicht kalt und rauh. Aber es regnet dort immer.«
Und er mußte daran denken, wie er einst als junger Mensch verzweifelt auf der Weidendammer Brücke gestanden war, mitten im Grau, in einem Meer grauer Kontrastlosigkeiten, rettungslos in einer Polyphonie grauer Halbtöne, grauen Lärms, grauverdrossener Menschen. Fast wäre er damals dieser grauen Schwermut erlegen.
Während desselben Gesprächs, es war zu Beginn des deutsch-französischen Krieges, hatte er auch den Maestro nach seiner Ansicht über Beethovens Neunte Symphonie gefragt.
Verdis Auge blitzte bei der Antwort:
»Siehst du, das sind die Götter, denen auch die Unwilligen opfern müssen. Da hilft nichts. Aber ich habe meinen klaren Kopf behalten. Die drei ersten Sätze sind gut. Der letzte Teil ein ödes empfindungsloses Durcheinanderschreien. Wenn sie singen wollen, zeigen diese Überzivilisierten, daß sie Barbaren sind.«
Doch eine halbe Stunde später, als das Gespräch längst schon um andre Dinge ging, unterbrach sich der Maestro plötzlich:
»Mir scheint, da vorhin habe ich einen ausgewachsenen Unsinn über Beethoven von mir gegeben. Wenn man sich nur das Urteilen abgewöhnen könnte, dieses dilettantische Verfälschen der Dinge! Wir wollen immer verstanden werden und sind selber unerbittlich verständnislos.«
Die Musik, die des Senators Lebensnerv, den nackten Ort der Empfindung, sein Cor cordium (wie er es in seiner Vorliebe für den Humanismus nannte) am gewaltigsten traf, war die seines Freundes und Jugendgefährten.
Es muß eines der vielen unerforschten Geheimnisse der Generation sein, daß unsere Sprache, das heißt, die ganze sinnliche, nervöse, gedankliche, übersinnliche Welt, die in unserer Sprache zum Licht will, am unmittelbarsten und reinsten nur von denjenigen verstanden wird, die unter demselben Sterngesetz geboren worden sind wie wir. Die ganze Sterblichkeit der Kunst, des menschlichen Ausdruckslebens, liegt in diesem Generations-Geheimnis beschlossen, doch ebenso ihre Unsterblichkeit, denn immer wieder werden Generationen unter ähnlicher Stern-Konstellation geboren.
Die Gesänge Verdis wirkten auf den Senator wie Bergwasser auf einen Durstigen. Wenn sie ertönten, rötete sich der ohnehin schon sanguinische Kopf noch mehr, die Augen wuchsen, wurden wildlustig, der Mund tat sich auf, der Atem folgte den kurzen Schritten der Baßbegleitung in kleinen erregten Stößen, das ganze Muskelwerk des Körpers straffte sich, stapelte Energie auf, immer mehr bereit, sich elektrisch zu entladen. – Natürlich hatte diese Spannung je nach dem Charakter der betreffenden Nummer ihre Arten und Grade. Bei den Adagien, Andanti, Larghi, dem lyrisch geschwungenen Einleitungs-Cantabile der Arien oder konzertanten Ensembles war die Wirkung ein Ruhen im Glück. Aber wenn die Nummer sich steigerte und übers Geröll kurzer tragischer Ausrufe oder über eine plötzliche breite Akkordtreppe in die Formen ihrer Beschleunigung vom Allegro agitato bis zum Prestissimo stürmte, dann füllte sich die Brust des Senators mit Atem zum Bersten, wie ein Kessel sich mit Dampf füllt, und eine begeisterte Kraft erschütterte seine Natur, die sich Luft machen mußte, in einem Aufschrei, in Gesang, oder sinnlos rhythmischen Bewegungen des Körpers.
Doch über die augenblickliche hinreißende Wirkung hinaus lebte jede neuerfaßte Melodie in seinem Innern weiter wie ein Erlebnis, das im bewußten Dasein nicht stattgefunden hat, und das die Seele seit Äonen her auf ihrer Weltreise mit sich führt. Und dann. Diese Gesänge belebten und begeisterten ihn auch moralisch. Wo auch immer sie dem Senator einfielen, bei der Arbeit in seinem Zimmer, unter Leuten, in jenen Zeiten, wo er noch verhandeln, Reden halten mußte, augenblicks fühlte er sich besser werden, den Menschen zugewandter.
Gesundungsmacht ging von ihnen aus. Einmal hatte er sich selbst während eines beginnenden Fiebers dadurch geheilt, daß er innerlich stundenlang diese stürmischen Melodien sang. Er schlief selig ein, und während dieses Schlafes wich die drohende Krankheit.
In dieser Stunde hatte er vor allem die Kabaletten und Stretten Verdis in sich hervorgerufen, jene verpönten quadratischen Perioden, die dem Musiker auf dem Notenblatt lächerlich erscheinen, in Wirklichkeit aber wie ein Orkan in die Menge fahren durch ihr verborgenes oder offenes Unisono.
In einem Gespräch diese Kabaletten und die ganze musikalische Jugend Verdis verteidigend, prägte einmal der Senator die Sentenz:
»Es kommt mehr auf Exspiration (Ausatmung) als auf Inspiration (Einatmung) an.«
Ein Satz jener weltzugewandten edlen Jugend, die, wäre sie nicht zuschanden geworden, Europas Schicksal anders gestaltet hätte als die siegreiche Romantik.
III
Die zwei Männer standen noch immer im schmalen Flur dieses venezianischen Hauses. Jetzt hatte sie beide die Beklemmung erfaßt, die gute Freunde wohl kennen, die sich lange Zeit nicht gesehen und in dieser Zeit viel miteinander beschäftigt haben. Der offenere von ihnen, der Senator, schüttelte als erster den Zwang ab:
»Es ist wirklich sehr merkwürdig, Verdi! Ich sitze oben mit meinen Söhnen am Tisch. Wir diskutieren und streiten wie immer. Denn was soll ein Vater anderes mit seinen Söhnen tun, wenn sie ihm großmütig einen ihrer Abende schenken!? (O, du Glücklicher!) Kulturfragen, Kunstfragen! Man ist ein Schwätzer und Ofenhocker geworden. Plötzlich will ich bei irgendeinem Anlaß deinen Namen in die Diskussion werfen. Aber ich tue es nicht. Warum? Weil mir gerade einfällt, daß ich von dir geträumt habe. Und da läutet es, weißt du, geradezu dramatisch läutet es. Italo will öffnen gehn. Ich halte ihn zurück. Und während ich die Schlüssel suche, das Licht nehme, die Treppen hinuntersteige, weiß ich die ganze Zeit, daß du vor dem Tor stehst.«
»Du hast mir das Rechte zugetraut. Es geht auf elf. Du wirst aber um deinen Schlaf nicht kommen. Ich fahre mit dem Nachtzug noch nach Mailand zurück.«
Auf dem Gesicht des Senators zeigte sich ein schwerer Vorwurf. Der Maestro fühlte die Pflicht, sich zu entschuldigen:
»Ich bin nur einige Stunden hier in Venedig gewesen, Freund, einen Tag lang. Habe den armen Vigna besucht. Es war eine von diesen unkontrollierten Ideen und Handlungen, die mich in letzter Zeit leider heimsuchen.«
Der Senator zog Verdi mit sich:
»Komm! Benutzen wir die Stunde, die du hast. Wie seltsam!«
Über die Treppe traten sie in einen dunkeln Vorraum, der bewies, daß die Gedrängtheit, Enge und Baufälligkeit so vieler Gebäude Venedigs nur scheinbar ist. Hinter diesen wunden und räudigen Fassaden verbergen sich oft prunkende Riesenräume, und es dünkt uns dann, wenn wir sie betreten, daß in dieser Stadt unser Sinn für Maß nicht genüge. So auch war das Wohnzimmer weit und hoch, dessen vier mächtige Fenster auf einen guten und stillen Rio hinausblickten.
Der Einrichtung dieses Zimmers fehlte vollkommen jener unangenehme Geschmack, der den Wohnräumen venezianischer Patrizier fast immer anhaftet, der museale Charakter, der daher kommt, daß alle Möbel, Spiegel, Luster aus den großen Epochen der Stadt in die unsere herübergeerbt wurden, von der auch kein Luftzug in solchen Gräberkammern uns erfrischt. Der Senator haßte, trotz seinem Humanismus, alles Antiquitätentum, und Venedig, soweit es die Riesenscheuer abgemähter Zeit-Ernten ist, liebte er nicht. Dennoch hatte er den Sitz in seiner provinziellen Heimatstadt aufgeschlagen, aus Groll gegen Rom und Mailand.
»Sieh«, sagte er zu Verdi, »bei mir wirst du nicht den Trödel der Ahnen finden, der doch nur der Trödel der Händler ist. Verfluchte Zeit das! Unfruchtbare Jugend! Sie schreiben Gedichte à la Horaz, Dramen à la Sophokles, malen Bilder à la Cinquecento, machen Politik à la Byzanz, à la, Allah ist groß. Snobismus, mein Lieber!«
In der Tat war der noble, altertümliche Raum mit Protesten gegen seinen eignen Stil angefüllt. So stand in dem herrlichen Marmorkamin, der sich als unpraktisch erwiesen hatte, ein kleiner glühender Eisenofen, und auf der Platte oben, vor einem einzigartig schönen Spiegel eine Petroleumlampe von höchst durchschnittlicher Form.
Vor dem Fenster dehnte sich ein Flügel mit Notenstößen auf seinem Rücken. Die dunkle breite Zimmerwand war von der Bibliothek ausgefüllt, deren Kompagnien zerrüttet und strapaziert aneinanderlehnten. Eine Leiter stand vor den Regalen, auf zwei Tischchen lagen Folianten. Trotz seinem Widerwillen gegen alles Antiquarische war die klassische Philosophie Lieblingsbeschäftigung des Senators.
Als die beiden Herren das Zimmer betraten, erhoben sich zwei junge Leute vom mächtigen Mitteltisch, die Söhne des Senators: Italo und Renzo.
Italo, groß, sehr schmal, in makellosem Frack, auf dem seines eignen Reizes bewußten Gesicht den Zug von Ironie, wie er von allen unsicheren und ehrgeizigen Menschen so gern affektiert wird. – Renzo, nach Manzonis Helden genannt, ein etwas träger Bär mit einer schlecht vernickelten und überdies zerbrochenen Brille auf der Stumpfnase. Dieser knapp Zwanzigjährige, dessen Geburt das Leben der Mutter gekostet hatte, ahmte in seiner Kleidung die Manier der Volkstribunen nach, wie sie aus Rußland und Deutschland zu damaliger Zeit in die Schweiz flüchteten. Er war vor einem Jahre Schüler des materialistischen Historikers Labriola in Rom geworden. Jetzt befand er sich auf Ferien bei seinem Vater.
Die Jünglinge standen stramm wie Soldaten, als sie das Gesicht des Gastes erkannten, dessen Büste sie so oft im Schlafzimmer des Vaters gesehen hatten. Junge Menschen, in ihrer noch ungebrochenen Ehrfurcht werden von einer eitlen Erregung ergriffen, wenn sie vor einem bedeutenden oder berühmten Manne stehn. Ein fast erotischer Drang, sich selber auszuzeichnen (vor einer unsichtbaren Frau zu glänzen), wird durch den Anblick dessen, der schon alles erreicht hat, in ihren Herzen erweckt.
»Meine Söhne!« Mit einem etwas mürrischen Ton stellte der Senator vor.
Italo und Renzo verbeugten sich unwillkürlich sehr tief, als ihnen der Maestro die Hand reichte.
Es ging von Verdi, und nicht nur von seinem Ruhm, eine sehr starke Wirkung auf alle aus, die ihn kennen lernten. Das war weder eine bezaubernde, noch hinreißende Wirkung, viel eher etwas Einschüchterndes, das die Fama so lange Zeit unterm falschen Namen »Kälte« verbreitet hatte. Angesichts dieser fernsichtig blauen, stark überwölbten Augen, die, wie mans sonst wohl von einer Stimme sagt, soviel Metall besaßen, wurde so mancher von einem unruhigen Zweifel gepackt, ob er sich auch ganz der Wahrheit gemäß betrage.
Die Söhne des Senators schienen von derselben Empfindung heimgesucht zu sein, denn beide hielten ihre Blicke abgewandt. Doch wie zur Rache verstärkt, kehrte bald der ursprüngliche Ausdruck auf die noch kindlichen Gesichter zurück, bei Renzo eine unterstrichen-gleichmütige Festigkeit, bei Italo eine ironische Höflichkeit, vermehrt um einen Zug von Ungeduld und Überhebung.
Die vier Herren hatten um den Tisch Platz genommen. Das Wesen des Senators, von innerlichster Freude erwärmt, war ganz Genugtuung, ganz Stolz. Er wäre jetzt zu mancher stürmisch guten Tat, zu Mut und Übermut fähig gewesen, wenn nicht die gebändigte Art des Freundes und das Bewußtsein, daß seine Liebe nicht so stark erwidert wurde, wie sie hinströmte, seine Glut gedämpft hätten.
Ein Diener mit neugierigem Gesicht stand in der Tür.
»Den Santo, meinen Santo bring!«
Als der dunkelgoldene Wein im Kristall auf dem Tisch stand, begann der Senator sehr breit Wachstum, Pflege, Lagerung dieses auf seinem Gute gezüchteten Weines darzustellen. Bei dem Thema wurde nun auch der Maestro lebhaft, beschrieb seinerseits eine Bordeaux-Rebe, die er in Sant Agata gepflanzt hatte, erzählte, wie er bei seinen vielen Aufenthalten in Frankreich das Geheimnis der Rotweinbehandlung hier und dort erlistet, und wie er es nun zustande gebracht habe, daß in seinem Keller ein Wein liege, der sich vor dem besten Bordeaux nicht zu schämen brauche und, im Gegensatz zu allem italienischen Gewächs, mit dem Alter gewinne.
Während dieses Gespräches machten die beiden alten Herren keineswegs den Eindruck von Genießern, sondern sie glichen zwei großen Bauern, die nach dem Wochenmarkt in der Kleinstadt-Osteria sitzen und sich über Kauf, Verkauf, Wetter und Ernte unterhalten.
»Aber du rauchst ja!«
Der Senator stürzte zu einem Kasten, den er nach nervöser Schlüsselsuche umständlich aufschloß. Er häufte vor Verdis Platz einen Berg von Havannakistchen. Da zeigte sich auch auf des Maestro Gesicht einen Augenblick lang etwas wie Gier. Sie prüften und berochen all die Henry Clays, Upmans, Bocks, Rogers und Carvayals, die langen knorrigen Zigarren, die am oberen Ende stumpf abgeschnittenen, die dicken und zugespitzten, die mit breiten, die mit schmalen Binden und die in Stanniolsilber verpackten.
Der kräftig pflanzenhafte Geruch des amerikanischen Tabaks verbreitete sich rings. Der Senator pries besonders eine Sorte, die ihm von einem Offizier in Diensten der ehemaligen Südstaaten geschenkt worden war. Die Freunde brannten sich zwei große, grün übersprenkelte Zigarren an. Nun stieg der wie eine satte Harmonie duftende Rauch zur dunkeln Decke.
»Ihr mit euren dummen Zigaretten«, sagte der Senator mit einem Seufzer zu seinen Söhnen, als bedaure er ein weibisches Geschlecht.
»Ich rauche nicht, Vater«, berichtigte Renzo, der übrigens auch keinen Wein trank, mit einer leicht dogmatischen Betonung.
Der Maestro betrachtete die jungen Leute, dann wandte er sich an Vater und Söhne:
»Es tut mir sehr leid, meine Herren, daß ich Ihre Unterhaltung gestört habe ...«
»Geckerei! Ich sage nichts als dies ...«
– Nach diesem ebenso unverständlichen wie unbegründeten Ausruf wischte der Senator sich die Stirn, die aus Gründen einer sehr zusammengesetzten Erregung feucht geworden war.
Verdi blickte fragend zu ihm hin.
»Nichts als Geckerei! Du kennst mich. Bei Gott, ich bin kein laudator temporis acti. Aber nun sind wir oben auf dem Berg und zeigen unsern Kindern das Gelobte Land. Ja! Danke schön! Sie steigen auf der andern Seite wieder hinunter. Ich habe einen Pallavicino gekannt, der dem Viktor Emanuel, dem Sohn des Verräters, seinen sowieso nur vergoldeten Annunziatenorden zurückgeschickt hat. Und das war ein alter Mann. Aber die heutigen jungen Männer?!
Darum der ganze Aufschwung, die dynamitgeladenen Worte und Taten? Damit eine banale Gesellschaft von Schleichern und Strebern, den Rüssel im Dreck von gestern, die Körner von vorgestern sucht? Mein Verdi ...«
Asthmatisch schnappte der Senator:
»Verdi, mir scheint nun, daß wir mit unsern patriotischen Moralen und Idealen nichts als Phrasendrescher gewesen sind, und daß die Herrschaften des Tages die Geschäfte, worauf es doch nur ankommt, viel besser verstehn. Diese Realisten ...«
In dem beschämenden Gefühl, übers Ziel geschossen und sich nicht klar ausgedrückt zu haben, schlug der Senator auf den Tisch und versicherte nochmals voll Ekel:
»Diese Realisten!«,
als nagle er mit diesem harmlosen und vieldeutigen Ausdruck all seine Feinde ans Holz.
Renzo sah seinen Vater an, wie ein Mann, der einer Rede, wenn sie auch aus unzureichendem und unberufenem Munde kommt, teilinhaltlich dennoch zustimmen kann. Italo verkniff Zorn, indem er, ohne bemerkt zu werden, eine impertinente Verbeugung gegen den Senator hin machte.
Verdi wandte sich mit einem schwach mißbilligenden Lächeln an seinen Freund als derjenige, dem es vor allem um die Gerechtigkeit geht:
»Mein Alter! Es hat unter uns gewiß mehr Phrasendrescher und Poseure gegeben als ehrliche Burschen. Aber einige waren doch darunter. Heute wirds nicht anders sein, als es gestern und immer gewesen ist.«
Italo machte eine sehr artige Kopfbewegung zu Verdi hin. Seine Stimme klang schüchtern:
»Ich danke Ihnen, Signor Maestro! Papas Philippika sollte vor allem mich kränken.«
Wie so viele gutmütige Menschen fühlte der Senator leidend, daß er irgendein Unrecht begangen habe. Aber indem er litt, ward er nur noch unklarer und verletzender:
»Ja du!« – Er sah seinen Sohn Italo nicht an. – »Dein Um und Auf ist, daß dich der Prätendent von Spanien in seinem Palazzo gnädig empfängt, und daß diese ganze Sippschaft der Mocenigo, Morosini, Albrizzi, Balbi, Colalto dich ja nur entzückend findet.«
Italo hatte die unbezahlbare Eigenschaft, im Ärger ruhig zu werden, ein Vorzug, den er mit allen Menschen teilte, deren Wirkungs-Bewußtsein niemals aussetzt. So konnte er jetzt mit verbindlichem Ton ohne eine Spur von Gereiztheit fragen:
»Papa! Warum soll denn diese Gesellschaft schlechter sein als irgendeine andere? ...«
Ohne weiterzusprechen, wurde er mit Rücksicht auf die Anwesenheit des Maestro rot. Jetzt mischte sich auch Renzo ins Gespräch:
»Aber, wir haben doch eine abstrakte Unterhaltung geführt, Vater, wozu diese persönlichen Ausfälle?«
Verdi gab stumm zu verstehn, daß er in diesem Fall die abstrakte Unterhaltung vorziehe. Renzo setzte sich in Positur:
»Es wurde die Frage besprochen, ob die Kunst innerhalb der menschlichen Gesellschaft einen Zweck habe, ohne den sie nicht zu denken ist. Nein, Zweck ist nicht das Wort, einen Sinn ... eine Aufgabe ...«
Der junge Theoretiker wurde verlegen, geriet ins Stottern: »Gehört zu einem dramatischen Werk, zu einer Musik der Zuhörer als ebenso notwendiger Teil wie dieses Drama, diese Musik selbst? Oder lebt ein Kunstwerk unabhängig ...«
Der Senator war aufgesprungen und schrie:
»Und ich sage euch, ein Kunstwerk hat nur den einen einzigen Zweck, Menschen zu begeistern und göttlich zu machen! Alles andere ist kein Kunstwerk, sondern ein eitles Krankenexkrement.«
Renzo, ebenso wie Italo, übte gegen ihren hitzigen Vater eine Art spöttischer Nachsicht. Mit der ganzen einfältigen Wichtigtuerei eines Knaben, der seit vier Wochen eine imponierende Terminologie beherrscht, überhörte Renzo den Ausbruch des Senators und fuhr belehrend fort:
»Ich für meine Person stehe auf dem Standpunkt, daß man einen Teil des ökonomisch-sozialen Gesamtlebens nicht für sich allein betrachten darf. ›Willst du den Zeiger verstehn, – mußt du ins Uhrwerk sehn‹, sagt das Sprichwort.«
»Ach du mit deinem Labriola und deinem Marx!«
Der Senator setzte sich wieder hin:
»Maestro! Nur du kannst darüber Richter sein.«
Verdi haßte solche »Kunstgespräche« wie den Teufel. Trotzdem zeigte sich in den vielen Fältchen um sein Auge wieder das reizende Lächeln: