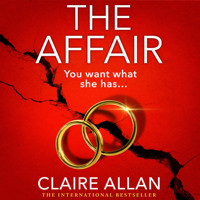9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißender Thriller mit brandaktuellen Themen um die wachsende Bedrohung durch sich im Internet radikalisierende Männer
Als die junge Krankenschwester Nell verschwindet, rechnet ihre Mutter mit dem Schlimmsten - doch wie schlimm es wirklich wird, ahnt sie nicht. Kurz darauf tauchen merkwürdige Videos in den Sozialen Medien auf. Auf einem davon ist zu sehen, wie Nell von einem Mann verfolgt wird. Die Polizei stößt so auf eine Gruppe radikalisierter Männer, die für ihren Hass auf Frauen ein verstörendes Ventil gefunden haben: Sie filmen sich dabei, wie sie Frauen ohne Begleitung auf ihrem Heimweg Angst machen. Ist einer von ihnen noch weitergegangen und hat Nell entführt? Nur ein junger Polizist kann ihn offenbar noch aufhalten: Aber wird er seine Karriere, seine Beziehung und seine Freiheit dafür opfern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Einleitung
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Kapitel einundvierzig
Kapitel zweiundvierzig
Kapitel dreiundvierzig
Kapitel vierundvierzig
Kapitel fünfundvierzig
Kapitel sechsundvierzig
Kapitel siebenundvierzig
Kapitel achtundvierzig
Kapitel neunundvierzig
Epilog
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Über das Buch
Ein mitreißender Thriller mit brandaktuellen Themen um die wachsende Bedrohung durch sich im Internet radikalisierende Männer.
Als die junge Krankenschwester Nell verschwindet, rechnet ihre Mutter mit dem Schlimmsten – doch wie schlimm es wirklich wird, ahnt sie nicht. Kurz darauf tauchen merkwürdige Videos in den Sozialen Medien auf. Auf einem davon ist zu sehen, wie Nell von einem Mann verfolgt wird. Die Polizei stößt so auf eine Gruppe radikalisierter Männer, die für ihren Hass auf Frauen ein verstörendes Ventil gefunden haben: Sie filmen sich dabei, wie sie Frauen ohne Begleitung auf ihrem Heimweg Angst machen. Ist einer von ihnen noch weitergegangen und hat Nell entführt? Nur ein junger Polizist kann ihn offenbar noch aufhalten: Aber wird er seine Karriere, seine Beziehung und seine Freiheit dafür opfern?
Über die Autorin
Claire Allan ist eine Nordirische Schriftstellerin aus Derry. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit arbeitete sie 17 Jahre lang als Reporterin für das Derry Journal. Zwischen ihrem dreißigsten und vierzigsten Lebensjahr schrieb sie romantische Komödien, die mitunter Bestseller wurden. Doch mit dem neuen Lebensjahrzehnt kam 2016 auch der Genrewechsel in die Spannungsliteratur, wo sie seitdem in den englischsprachigen Ländern einen Bestsellererfolg nach dem anderen verbuchen kann. Heute ist Claire Allan Vollzeit am Schreiben und lebt noch immer in Derry mit ihrem Mann, zwei Kindern, zwei Katzen und einem sehr verwöhnten Hundewelpen. Dies ist ihr erster Roman, der auf Deutsch erscheint.
CLAIRE ALLAN
VERFOLGT
Kein Heimweg ist sicher
Thriller
Übersetzung aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe: Copyright © 2022 by Claire Allan Titel der Originalausgabe: »The Nurse« Originalverlag: Avon, a division of HarperCollinsPublishers Ltd1 London Bridge Street, London SE19GF Published by arrangement with Rights People, London Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln Textredaktion: Heike Rosbach Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde Covermotiv: © Silas Manhood/Trevillion Images; © Shutterstock.com Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7517-4207-8
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
Für meine Schwestern, meine Seelenschwestern, mein jüngstes Kind, meine Nichten und alle Frauen, die nicht mehr nach Hause gekommen sind.
Einleitung
»… dieses Gefühl, wenn du einem Mädchen folgst und es dich bemerkt und versucht, dich abzuschütteln (sic) oder schneller zu gehen. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Du wirst ihm wichtig. Du bist nicht mehr eines von vielen bedeutungslosen Gesichtern in der Menge.
Ich weiß, es ist irgendwie billig, aber ich genieße es. Ich fahre in eine andere Stadt, suche nach einem Mädchen, das alleine unterwegs ist, und folge ihm. Nach einer Weile bemerken sie dich. Im Dunkeln kann es schon reichen, einfach in dieselbe Richtung zu gehen. Die werden paranoid.
Ich rate euch einsamen Incels, es mal auszuprobieren. Macht ihr einfach nur Angst. Wenn ihr eure Grenzen kennt und sie nicht richtig belästigt – geschweige denn vergewaltigt –, ist es ein harmloser Psycho-Spaß.«
Ein realer Post aus einem Incel-Forum
14. Februar 2018
Prolog
Das Blütenblatt schwebt auf den kalten Steinfußboden und landet auf dem Polster aus seinen Brüdern und Schwestern, die bereits hinabgefallen sind, als sich das Spiel dem Höhepunkt nähert. Das Ende wechselt mit jedem Blütenblatt. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie lebt. Sie stirbt.
Er hört sie oben im Bad umhergehen. Die Dielen knarren unter ihren Schritten. Es rumort in den Rohren und rauscht, als sie die Wasserhähne am Waschbecken aufdreht.
Sie denkt, dass es ein schöner Abend war. Dessen ist er sich sicher. Er hat ihnen zum Abendessen Filetsteak mit Kroketten, grünen Bohnen und Spargel gemacht. Dem Himmel sei Dank für die fertig vorbereiteten, idiotensicheren Gerichte von Marks & Spencer. Er hatte eine Flasche Châteauneuf-du-Pape geöffnet. Zwar würde er sich nicht als Weinkenner bezeichnen, aber die Flasche hat über 20 Pfund gekostet, also muss der Wein gut sein. Es ist mehr, als sie verdient, doch er will es richtig spielen.
Das Ziel ist Angst. Und die ist immer am besten, wenn sie überraschend kommt. In einem Moment, in dem seine Spielfigur entspannt ist. Glücklich. Hoffnungsvoll.
Das Gefühl, wenn seiner Beute klar wird, was läuft, ist unübertroffen. Wenn sie begreift, dass sie nicht unbesiegbar ist. Dass sie nicht so sicher ist, wie sie gedacht hat.
Doch es hängt alles von den Blütenblättern ab. Sobald er die Regeln festlegt, hält er sich an sie. Er zupft noch ein Blütenblatt ab, versucht, nicht zu raten, wie viele übrig sind. Geduld, denkt er. Das Warten macht den Moment umso süßer.
Oben knarzt ein Dielenbrett, und er sieht hinauf. Sie ist schon eine Weile weg, und er wird langsam nervös. Adrenalin pulsiert bereits in seinen Adern, macht ihn zappelig. Der Kampf-oder-Flucht-Reflex setzt ein. Er denkt, wenn die Blüten es verlangen, wird es diesmal einen Kampf geben. Sie kommt ihm wie eine Kämpferin vor.
Die Rohre verstummen, und obgleich er unsicher ist, wenn er richtig hinhorcht, glaubt er, er könnte sie reden hören. Das bringt ihn für einen Augenblick aus dem Konzept, bis er zu dem leeren Stuhl ihm gegenüber blickt. Die Handtasche, die sie über die Lehne gehängt hatte – die Tasche mit ihrem Handy. Nein. Nein, das soll sie nicht machen! Es verstößt gegen die Regeln. Wenn sie zusammen sind, erwartet er ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist eine Frage des Anstands. Des Respekts.
Er umklammert den Rosenstängel fester, sodass sich die Dornen in seine Haut bohren. Es sind noch drei Blütenblätter dran. Er weiß, wie es ausgegangen wäre. Aber sie hat die Regeln gebrochen. Das hat sie sich selbst zuzuschreiben. Ihm bleibt keine Wahl.
Er steht auf und geht nach oben, wo er sich an der Tür des Badezimmers scheinheilig erkundigt, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Sie sagt drinnen irgendwas Beruhigendes. Als er wieder unten ist, geht er zu dem Bücherregal mit dem Holzkästchen. Dort nimmt er eine Tablette heraus, bricht sie in der Mitte durch und schüttet das Pulver aus der kleinen Drageekapsel in ihr Glas mit dem teuren Wein. Er rührt mit dem Finger um, als er hört, wie die Badezimmertür geöffnet wird, gefolgt von ihren Schritten auf der Treppe. Und dann setzt er ein Lächeln auf.
Kapitel eins
Marian
Montag, 1. November Seit vier Tagen vermisst
Am Donnerstag ist Nell nicht von der Arbeit nach Hause gekommen. Das war vor vier Tagen. Vier Tage. Und jetzt höre ich zum ersten Mal davon.
Ich packe die Einkäufe aus und fluche über eine geplatzte Joghurtpackung, als mein Telefon klingelt und mich die Mitbewohnerin meiner Tochter – eine extrem schüchterne Krankenschwester namens Clodagh – fragt, ob ich wisse, wo Nell sei.
Ich sehe zur Uhr. Es ist Viertel nach sieben abends. Nell arbeitet normalerweise bis sieben. Manchmal länger. Jedenfalls ist es eine komische Zeit für Clodagh, sich um Nells Verbleib zu sorgen.
Es ist überhaupt komisch, dass Clodagh mich anruft. Ich bin wahrlich keine Helikopter-Mutter, und Nell ist ausgesprochen eigenständig, seit sie vor Jahren von zu Hause auszog. Es kommt häufig vor, dass wir eine Woche oder länger nichts voneinander hören.
»Ich nehme an, sie arbeitet länger oder kauft noch kurz bei Tesco ein«, sage ich, greife mir ein Stück Küchenpapier und wische einen Klecks von dem griechischen Joghurt von Marks & Spencer auf, bevor er auf meiner Arbeitsplatte fest wird oder Harry Styles – der flauschige, dreifarbige Kater, den Nell nach ihrem Teenagerschwarm benannte – ihn aufschlecken kann.
Ich bin genervt, weil ich mir jetzt etwas anderes fürs Frühstück morgen überlegen muss. Da sind all die frischen Beeren, die gegessen werden wollen …
Mir wird bewusst, dass Clodagh stammelnd antwortet, und etwas an ihrem Tonfall lässt mich aufmerken. Ich blinzle, als könnte ich so die nicht gehörten Worte zurückholen.
Hat sie gesagt, dass Nell nicht bei der Arbeit war? Ich scheuche Harry Styles weg, lege das Küchenpapier hin und drehe mich mit dem Rücken zur Arbeitsplatte. Als ich zur Wanduhr schaue, sehe ich, dass es dreizehn Minuten vor acht ist.
»Ist sie krank?«, frage ich. Bei meinem letzten Gespräch mit Nell hatte sie erzählt, dass sie das häufigste aller Leiden plagte: Dauermüdigkeit. Ich hatte ihr gesagt, dass sie mal zu ihrem Arzt gehen soll. In meinem Alter permanent erschöpft zu sein, ist eine Sache, aber so sollte es keiner Zweiundzwanzigjährigen gehen.
Sie hatte gelacht. »Mum, bei der Arbeit sehe ich den ganzen Tag Ärzte. Alles gut, ich bin nur müde. Es ist Winter! Wir haben unglaublich viel zu tun, und es fällt ständig jemand wegen Krankheit aus. Aber mir geht es gut, ehrlich. Oder zumindest so gut wie allen Krankenschwestern dieser Tage. Ich brauche eine Woche in der Sonne, weiter nichts.«
»Nein. Nein. Na ja, ich weiß nicht«, unterbricht Clodagh meine Gedanken, und ihr Ton scheint noch dringlicher zu werden. »Also haben Sie sie heute nicht gesehen?«
»Nein«, antworte ich. »Ich habe sie nicht mehr gesehen seit … heute vor einer Woche? Da war sie hier, um irgendwas aus ihrem Zimmer zu holen. Schuhe oder so.«
Jetzt fällt es mir wieder ein. Es waren diese entsetzlichen klobigen Plateaustiefel. Irgendwann bricht sie sich in denen noch die Knöchel, da bin ich mir sicher.
»Aber haben Sie mit ihr gesprochen? Oder von ihr gehört? Eine Textnachricht oder eine WhatsApp?«
Ich schüttle den Kopf, als könnte sie mich sehen. »Nein. Seit einigen Tagen nicht mehr. Warum?«
»Wie viele Tage sind einige?«, fragt Clodagh, und mir wird klar, dass etwas nicht stimmt.
»Weiß ich nicht. Ich kann nicht klar denken. Ich glaube nicht, dass ich sie gesprochen habe, seit sie hier war. Was ist los, Clodagh?« Mir entgeht nicht, dass mein Tonfall zu schroff ist. Hinreichend schroff, dass Harry Styles einen Buckel macht und mich angewidert ansieht.
»Dann haben Sie sie seit Donnerstag nicht gesehen? Oh, Mist!«
»Clodagh«, entgegne ich, als versuchte ich, zu einem Kleinkind durchzudringen, »sagen Sie mir, was los ist.«
Ich fühle, wie sich meine Nackenhaare aufstellen und mir Kälte den Rücken hinaufkriecht.
»Sie, na ja, sie ist am Donnerstag nicht von der Arbeit nach Hause gekommen, und ich habe gedacht, dass sie, ähm, vielleicht noch bei Rob ist.«
»Wer ist Rob?«, frage ich und komme mir schlagartig wie die schlimmste Mutter aller Zeiten vor, weil ich keine Ahnung habe, wer dieser Mensch im Leben meiner Tochter ist.
»Rob. Sie hat ihn vor einigen Wochen kennengelernt. Auf Tinder. Es lief gut zwischen ihnen. Deshalb dachte ich, sie ist vielleicht, Sie wissen schon, bei ihm. Sie wissen doch, wie das ist, wenn man frisch zusammen ist.«
Es ist sehr, sehr lange her, seit ich frisch mit jemandem zusammen war, aber ich erinnere mich gut genug, um zu verstehen, was sie meint. Und ich denke ungern an meine Tochter in dieser Situation. Vollkommen lustgesteuert. Diesen Gedanken schüttle ich gleich wieder ab, und mir ist kalt. Ich sollte die Heizung anstellen. Es kühlt rapide ab. In der Nacht wird es wohl wieder Frost geben.
Ist meine Tochter irgendwo da draußen in der Kälte?
»Aber sie ist nicht bei diesem Rob?«, frage ich, was dämlich ist. Clodagh würde mich wohl kaum anrufen, wenn sie es wäre.
»Nein, oder ich denke nicht, denn Jenny von der Arbeit hatte am Samstagabend ein Date mit ihm, und da hat er bei ihr übernachtet«, sagt Clodagh, und ich frage mich, ob ich ein Schluchzen höre. »Ich habe jeden angerufen, der mir einfällt, und keiner hat sie gesehen oder von ihr gehört. Und sie ist heute nicht zur Arbeit gekommen, hat sich aber auch nicht krankgemeldet …«
Mir beginnt der Kopf zu schwirren. Ich klammere mich mit einer Hand an der Arbeitsplatte fest, um etwas Reales zu halten. Greifbares. Und ich hoffe, dass meine Hand direkt hindurchschwimmt, weil dies alles Teil eines Traums ist.
Aber ich fühle den kalten Granit an meiner Haut.
Dies ist real.
»Seit Donnerstag?«, platze ich heraus. Meine Kehle ist eng.
»Und sie ist auch nicht auf ihren Seiten in den Social Media gewesen«, sagt Clodagh. Jetzt ist deutlich zu hören, dass sie weint.
Ich blicke zu meinen Schlüsseln, zu meiner Tasche, die ich auf die Arbeitsplatte geworfen hatte, und zu den halb leeren Einkaufstaschen. Dem abgelegten Küchenpapier. Alles schaue ich an, ohne hinzuhören, was Clodagh noch sagt. Stattdessen sage ich zu ihr, sie solle die Polizei rufen und ich sei gleich da.
Harry Styles maunzt laut, als ich gehe, ohne ihm vorher sein Abendessen hinzustellen. Er kann den blöden griechischen Joghurt haben. Alles andere muss warten. Ich fluche, als ich warte, dass sich mein Handy mit dem Bluetooth meines Wagens verbindet. Normalerweise dauert es nie so lange, aber heute natürlich schon.
Schließlich tippe ich die Sprachsteuerung an und befehle dem Wagen, Nell anzurufen. Lausche der Automatenstimme, die mir sagt, dass sie angerufen wird. Ich will schreien, dass sie still sein soll, weil ich die Stimme meiner Tochter hören will. Nein. Ich muss ihre Stimme hören. Und da ist sie, das »Hallo«, das ich hören muss, und ich atme auf, bis sofort folgt: »Sorry, ich kann gerade nicht rangehen.«
Ich unterdrücke ein Schluchzen, knalle den Rückwärtsgang rein, und mein Bein zittert, als ich die Kupplung kommen lasse.
Ich rufe meinen Mann an. Vielleicht hat er mit ihr gesprochen. Er müsste auf der Rückfahrt von der Arbeit sein. Ich frage mich, wie viel ich sagen soll, denn er muss von Belfast herfahren, und das bei heikler werdenden Straßenverhältnissen. Ich will nicht, dass er vor lauter Panik einen dummen Fehler macht.
»Stephen«, sage ich und zwinge mich, ruhig zu sprechen, »ich wollte nur fragen, ob du heute oder am Wochenende etwas von Nell gehört hast.«
»Am Wochenende?« Ich höre das Ticken seines Blinkers und das Schaben und Stocken seiner Scheibenwischer.
»Ja«, sage ich und bemühe mich, nicht ungeduldig zu sein, obwohl ich schreien möchte.
»Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Mal überlegen. Ich würde auf meinem Handy nachsehen, aber ich sitze im Auto. Warum? Ist alles okay?«
Ich beschließe, ihn zu belügen. Meinen Mann. Meinen Partner seit siebenundzwanzig Jahren. Es wird ihm nicht gefallen. Genau genommen wird er es hassen, aber ich denke an ihn am Steuer seines Wagens. Seine müden Augen. Sein grau meliertes Haar, das weniger meliert als grau ist. Die Falten in seinen Augenwinkeln. Das Pendeln fällt ihm zusehends schwerer, aber er will es nicht zugeben. Nell nennt ihn einen sturen alten Bock.
»Ja«, sage ich. »War nur eine Frage. Nichts Dringendes. Ich fahre bei ihr vorbei. Einfach mal nach ihr sehen. Wie wäre es, wenn du auch hinkommst?«
Es ist eine lächerliche, nein, eine grausame Lüge, denke ich, als ich ihn mir vorstelle, wie er bei ihr ankommt und sie nicht da ist. Vielleicht wird stattdessen die Polizei dort sein. Aber so schlimm, wie die Dinge stehen, brauche ich ihn bei mir. Nell ist ebenso sehr Teil von ihm wie von mir. Sie ist das Bindeglied zwischen uns.
»Herrgott, Marian, ich bin müde, und es wird eine höllische Fahrt. Ich will bloß noch nach Hause.«
»Bitte«, sage ich, und mir ist schleierhaft, wie ich verhindere, dass meine Stimme kippt.
»Himmelherrgott.« Er seufzt. »Wenn du mich dann zufriedenlässt, na gut, ich komme vorbei. Aber nur ganz kurz.«
Mein Magen verkrampft sich bei seinem Ton, und ich spüre, wie hinter meinen Augen pochende Kopfschmerzen einsetzen.
»Danke«, sage ich und dass wir ihn bald sehen. Wir. Als wäre ich sicher, dass Nell dort sein würde, was ich selbstverständlich nicht bin.
Zu meiner Überraschung bin ich den Tränen nahe. Ich bin keine Heulsuse. So eine Frau bin ich nicht. Ich bin keine Mutter, die sich bei Schulaufführungen vor Stolz die Tränen wegtupfen musste oder weint, wenn sie Babyfotos betrachtet. Ich kann konzentriert bleiben und logisch an Dinge herangehen. So musste ich sein, als Nell klein war.
Aber jetzt? Es ist, als würde ich tief in meinem Innern wissen, dass etwas nicht stimmt.
Die emotionale Nabelschnur, von der ich glaubte, ich hätte sie gar nicht, verbindet mich doch mit meinem Kind und flutet mich jetzt mit all den Gefühlen, all den Momenten, die heute lediglich Erinnerungen sind. Ein Gefühl, dass es vielleicht keine weiteren Erinnerungen geben wird – jedenfalls keine guten.
Ich lege eine Hand auf meinen Bauch. Warum, weiß ich nicht. Es ist, als hoffte ich, dort eine Bewegung zu spüren. Einen Tritt. Ein Lebenszeichen. Aber natürlich ist das absurd, denke ich kopfschüttelnd und versuche, mich auf die Fahrt vor mir zu konzentrieren. Es wird nicht passieren. Wird es nie.
Ich befehle meinem logischen Ich, wieder zu übernehmen. An das zu denken, was ich tun kann. Was ich ändern kann. Gefühle helfen mir jetzt nicht. Vorerst muss ich so schnell wie möglich zu Nell und mit Clodagh und der Polizei reden.
So liebenswert Clodagh auch sein mag, man kann sich nicht auf sie verlassen, selbst eine Suche einzuleiten. Sie ist ein reizendes Mädchen, neigt jedoch zur Hysterie. Könnte es nur Hysterie sein? Wird ihr wieder einfallen, dass sie gestern erst mit Nell gesprochen, und sie sich mit einer »Ich Dussel«-Geste an die Stirn geschlagen hat?
Nein. Ich greife nach Strohhalmen. Und das tue ich grundsätzlich nicht. Aber dies hier ist anders. Es ist mein Kind. Mein Magen verkrampft sich wieder.
Noch einmal rufe ich Nells Nummer an. Höre ihre Stimme, die mir sagt, dass sie mich zurückruft. Ihre jugendliche, vielversprechende Singsangstimme. Ich überlege, eine Nachricht zu hinterlassen. Sie anzuflehen, sich zu melden. Ihr zu befehlen, dass sie tut, was ihr gesagt wird.
Aber ich flehe oder weine nicht. Ich beende das Gespräch und konzentriere mich aufs Fahren, das Schalten, das Bremsen und das Beschleunigen, was mühsamer als sonst ist. Das hier darf nicht passieren.
Kapitel zwei
Marian
Montag, 1. November Seit vier Tagen vermisst
Es scheint so unglaublich bizarr, vor der Doppelhaushälfte mit den drei Schlafzimmern oben anzukommen, in der meine Tochter wohnt, und hier alles wie immer vorzufinden. Nichts ist anders. Nichts deutet darauf hin, dass alles verkehrt ist. Das Pampasgras in der Vorgartenecke ist immer noch das wuchernde Monstrum, von dem ich will, dass ihr Vermieter es rausreißt. Eine der Glasscheiben in der Lampe vor der Haustür ist immer noch kaputt.
Doch es gibt Anzeichen, dass dies das Zuhause ist, auf das Nell stolz ist. Der Winterkranz an der Tür. Die glasierten Tontöpfe auf der Eingangsstufe, die gut gepflegten und gestutzten Pflanzen, damit sie den Frost überstehen. Für Topfpflanzen hat sie ein Händchen; für große Pampasgrasungetüme nicht.
Ich will klingeln und erschrecke, als die Tür vor mir aufgeht, noch ehe ich dazu komme. Clodagh ist in ihrer Schwesternkleidung und hat eine dicke cremeweiße Strickjacke eng um sich gewickelt. Ihre Augen sind gerötet, und sie hält ein Taschentuch in der Hand.
»Es tut mir ehrlich leid, Mrs Sweeney. Ich dachte nur … Ich habe das ganze Wochenende gearbeitet, und Sie wissen ja, manchmal begegnen wir uns hier fast nie. Aber ich fand es seltsam, dass noch Milch im Kühlschrank ist. Und ich habe in ihr Zimmer geschaut, aber da sieht alles wie am Donnerstagmorgen aus. Daran erinnere ich mich, weil ich auf ihrem Bett gesessen hatte, als sie sich für die Arbeit zurechtgemacht hat, und sie hatte sich mein schwarzes Kleid geliehen, um es anzuprobieren. Das liegt da noch auf dem Bett. Und ich habe versucht, sie anzurufen, so fünf- oder sechsmal. Dann habe ich ihre Freunde angerufen und in der Arbeit. Und danach Sie.«
Ich gehe ins Haus und blicke mich um, als könnte Nell aus dem Nichts auftauchen und uns beide überraschen.
»Haben Sie die Polizei angerufen?«, frage ich, während ich mich weiter umschaue. Ich spähe durch die Tür ins Wohnzimmer. Es ist ordentlich. Und warm. Von zwei Lampen zu beiden Seiten erhellt. Nells übergroßer Stricküberwurf liegt zusammengefaltet über dem Sofa. Ich widerstehe dem Impuls, ihn hochzuheben, um ein Gespür für sie zu bekommen. Ihren Duft zu riechen. Ich schließe die Augen, und ein Dutzend unterschiedlicher Düfte fallen mir ein. Babypuder. Der Geruch von Kindershampoo in ihrem Haar, als sie klein war. Die zu starke Deonote an der Teenager-Nell. Der zarte Duft ihres Lieblingsparfüms heute – Wood Sage and Sea Salt von Jo Malone. Ich habe ihr gerade erst einen neuen Flakon für Weihnachten bestellt.
»Habe ich«, sagt Clodagh, und ich blinzle, weil ich nicht richtig hinhöre. »Sie haben gesagt, dass sie jemanden schicken. Aber weil sie erwachsen ist und …«
»Sie ist erwachsen, und seit Donnerstag hat keiner sie gesehen oder von ihr gehört«, falle ich ihr barsch ins Wort und bereue es sofort. Es ist nicht Clodaghs Schuld. Sie ist nur die Überbringerin der Nachricht.
»Das habe ich ihnen auch gesagt«, antwortet sie kleinlaut.
»Und dieser Rob? Was wissen Sie über ihn?«
»Ähm, nicht viel. Sie kennt ihn erst seit wenigen Wochen, und wir beide hatten verrückte Schichten, sodass wir uns eigentlich nicht richtig unterhalten haben.«
»Sie muss Ihnen doch irgendwas erzählt haben«, flehe ich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es etwas in Nells Leben gibt, von dem sie ihrer besten Freundin nicht erzählen würde.
»Ja, na ja, er ist älter, so Ende zwanzig. Er arbeitet bei einer dieser neuen Firmen unten in dem Bürokomplex bei Fort George. Sie wissen schon, dieser Neubau? Ich weiß nicht, was genau er macht. Neue Medien oder so.«
»Und wissen Sie seinen Nachnamen? Oder wie er aussieht?«
»Ich sehe mal auf ihrer Freundesliste nach, ob ich ihn finde«, sagt Clodagh, zieht ihr Handy aus der Tasche und scrollt. Nachdem sie ein paarmal darauf getippt hat, flucht sie. »Verdammt. Sie hat die Liste nur für die Freunde selbst zugänglich gemacht.«
»Jenny!«, rufe ich, und Clodagh sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren.
»Sie haben gesagt, dass Ihre Freundin Jenny von der Arbeit ein Date mit ihm hatte. Rufen Sie sie an. Fragen Sie sie, was sie über ihn weiß. Ich nehme an, sie wird seine Nummer haben oder wenigstens wissen, wie er mit Nachnamen heißt.«
Clodagh nickt, scrollt wieder auf ihrem Handy und lauscht, als ein Klingelton kommt. Sie hinterlässt Jenny eine Nachricht, sie möge sie so bald wie möglich zurückrufen und dass es sehr, sehr wichtig sei. Danach sieht sie mich an, als erwartete sie, dass ich die Antworten auf alles hätte. Ich schätze, ich bin die Mutterfigur. Ich soll wissen, was als Nächstes zu tun ist. Mit wem wir reden müssen. Sie hat keinen Schimmer, dass ich mit jeder Faser vor Angst schlottere. Dass ich, wenn ich könnte, zu meiner eigenen Mutter rennen würde. Dass es mich all meine Kraft kostet, weiterzuatmen. Vom Formulieren irgendeiner Strategie oder auch nur beruhigender Worte für Clodagh kann gar keine Rede sein.
Ich brauche Raum, deshalb entschuldige ich mich und gehe in Nells Zimmer. Es hat einen körperlich spürbaren Effekt auf mich. Dies mag nicht das Zimmer sein, in dem sie aufgewachsen ist. Nicht das, das ich sie dauernd aufzuräumen bat oder bei dem wir uns wegen der Farbgestaltung stritten. Die Kommode ist nicht die, in deren Unterwäscheschublade ich eine Tabakdose mit einem perfekt gedrehten Joint fand. Es gibt keine Kerben im Türrahmen, die ihr Alter und ihre Größe markieren. Dennoch ist sie da. Es riecht nach ihr. Ihrem Parfüm. Ihrem Haarspray. Ich sehe ihre Po-Puppe vom Kleiderschrank oben grinsen, deren Stoff rissig und fadenscheinig ist. Ein Andenken an ihre frühe Kindheit, als sie völlig verrückt nach den Teletubbies war. Ich sehe Kleidung in ihrer Größe. Die blöden, verfluchten Plateaustiefel. Und wieder verkrampft sich mein Magen so sehr, dass ich es kaum noch aushalte. Ich würde mich übergeben, hätte ich etwas im Magen. Aber da ist nichts, also krümme ich mich nur.
In meinem ganzen Leben habe ich noch nie solche Angst gehabt. Mir ist klar, dass ich ihr nicht nachgeben darf. Noch nicht. Es gibt viel zu tun, und vielleicht, ganz vielleicht, ist dies eine wechseljahresbedingte Überreaktion auf etwas, für das es eine vollkommen vernünftige Erklärung gibt.
Blinkendes Blaulicht von einem Streifenwagen erhellt das Zimmer meiner Tochter durch die offenen Vorhänge und sagt mir, dass meine Furcht berechtigt ist.
Eine zierliche blonde Frau in einem maßgeschneiderten grauen Hosenanzug reicht mir die Hand und stellt sich als Detective Sergeant Eve King vor. Ihre Anwesenheit macht mir erst recht Angst. Mir erscheint es seltsam, dass eine leitende Beamtin geschickt wird, wenn die Polizei denkt, dass an sich kein Grund zur Sorge besteht.
Ich stelle mich und Clodagh vor, als ein großer, schlaksiger Mann in einem schlecht sitzenden Anzug an der Tür erscheint, bei dessen Anblick ich zusammenzucke.
»Mein Kollege, Detective Constable Mark Black«, erklärt DS King. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn er auch reinkommt?«
Ich schüttle den Kopf, obwohl es nicht mein Haus ist und ich kein Recht habe, jemandem hier den Zutritt zu erlauben oder zu verbieten.
»Natürlich nicht. Kommen Sie rein«, sagt Clodagh mit zittriger Stimme. »Kann ich Ihnen einen Tee oder Kaffee oder Wasser oder etwas anderes anbieten?«
»Nichts, vielen Dank«, antwortet DS King. »Vielleicht können wir uns setzen und uns über Ihre Mitbewohnerin unterhalten. Nell Sweeney?«
Clodagh nickt, scheint jedoch ansonsten starr vor Schock, Angst oder irgendwas an der Situation, mit der sie konfrontiert ist. Ich warte, dass sie die Officers ins Wohnzimmer bittet, aber da sie sich nicht rührt, übernehme ich und führe sie zum Sofa, während Clodagh und ich in den Sesseln gegenüber Platz nehmen, unsere Rücken gerade und die Gesichter angespannt.
»Okay«, beginnt DS King und holt einen Notizblock und einen Kuli aus ihren Taschen. Das obere Ende des Kulis ist sichtlich zerkaut. Ich bemerke solche Kleinigkeiten. Deshalb sagt Nell dauernd, ich soll mich entspannen. »Clodagh, Sie haben der Zentrale gesagt, dass Nell seit Donnerstag nicht mehr gesehen wurde. Ist das richtig?«
Clodagh nickt. Ich bemerke, dass ihre Unterlippe bebt, und will sie schütteln. Sie muss sich zusammenreißen, denn wir brauchen so viele Informationen wie möglich, so schnell wie möglich, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, Nell zu finden. Heißt es nicht, dass bei einem Vermisstenfall die ersten achtundvierzig Stunden entscheidend sind?
Aber natürlich wird Nell schon viel länger als achtundvierzig Stunden vermisst, wird mir klar. Und meine eigene Unterlippe beginnt zu zittern.
»Ich habe sie am Donnerstagmorgen vor der Arbeit gesehen. Wir sind beide Krankenschwestern im Altnagelvin, müssen Sie wissen. Aber wir arbeiten auf verschiedenen Stationen. Ich bin in der Pädiatrie und Nell in der Chirurgie. Ich weiß, dass sie an dem Tag bei der Arbeit war. Am Freitag und am Wochenende hatte sie frei, deshalb hatte ich sie vor heute nicht erwartet. Aber sie ist nicht gekommen.«
»Und Sie haben sie das ganze Wochenende nicht gesehen oder bemerkt, dass sie nicht da war?«, fragt DS King.
Clodagh schnieft. »Ich hatte richtig viel zu tun. Ich habe Nachtdienst gehabt, und danach bin ich immer leicht verblödet. Außerdem sind wir unterbesetzt, deshalb musste ich einige Überstunden machen. Nell trifft sich mit diesem Typen, Rob, den Nachnamen weiß ich nicht, aber den finde ich heraus. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass sie wahrscheinlich bei ihm ist. Sie wissen schon, über ein verlängertes Wochenende.«
DS King hakt nach und erfährt von Jenny und deren Tinder-Date mit Rob. Sie fragt nach Nells mentaler Verfassung.
»Sie war nicht depressiv oder so«, sage ich unweigerlich defensiv. »Denken Sie ja nicht, dass sie irgendwo hin ist und sich etwas angetan hat, denn das passt nicht zu ihr. Nell ist nicht depressiv. Wäre sie es, hätte sie mit mir darüber geredet. Da bin ich mir sicher.«
»Stehen Sie beide sich sehr nahe?«, fragt DS King und starrt mich mit ihren strahlend blauen Augen an. Sie sieht wie die Art Polizistin aus, die keinen Lügendetektor braucht, um zu erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht.
»Sie ist meine Tochter. Mein einziges Kind, um genau zu sein. Wir hocken nicht ständig aufeinander, falls Sie das meinen, aber wir stehen uns nahe. Sie weiß, dass ich für sie da bin, wenn sie mich braucht.«
»Ähm … Mrs Sweeney hat recht«, sagt Clodagh zaghaft. »Nell ist nicht depressiv. Oder falls doch, kann sie es richtig gut überspielen.«
»Ist sie sehr kontaktfreudig?«, fragt DS King.
»Ja, ich schätze schon. Sie ist zweiundzwanzig und so kontaktfreudig wie alle jungen Frauen in dem Alter, um ehrlich zu sein«, antworte ich. DS Kings Blick wandert zu Clodagh, als könnte man meinen Antworten nur bedingt Glauben schenken. Sie denkt eindeutig, dass ich meine Tochter gar nicht kenne.
Clodagh zuckt mit den Schultern. »Na ja, ich meine, sie ist vielleicht ein paarmal die Woche abends ausgegangen. Aber sie war auch gerne hier, um zu chillen. Sie wissen schon, Pyjama an und einen Film oder eine Serie gucken. Wir mögen Krimis.«
»Ist sie das?«, fragt der Mann, Mark Black, und nickt zu einem gerahmten Foto auf der Anrichte. Es ist ein Selfie von Nell und Clodagh – beide grinsen in die Kamera. Wie es aussieht, wurde es letztes Jahr in ihrem Urlaub aufgenommen. Das Meer im Hintergrund ist blauer, als man es an der Küste von Donegal kennt. Sie haben leicht gerötete Gesichter, als hätten sie zu viel Sonne abbekommen. Nell sieht so jung aus. So voller Leben. Ich bringe keinen Ton heraus.
»Ja«, antwortet Clodagh. »Das sind wir, im Sommer auf Kos.«
»Ist es in Ordnung, wenn ich das mitnehme?«, fragt er, steht auf und langt bereits nach dem Rahmen. Ich muss an mich halten, ihm nicht zu sagen, er solle das Foto nicht anrühren. Ich weiß, wofür er es braucht. Um es online zu stellen, auf Plakate zu drucken und in den Nachrichten zu zeigen. Er verwandelt meine Tochter in Nell, das Opfer, und ich will nicht, dass irgendetwas davon geschieht. Für einen Moment schließe ich die Augen, damit ich nicht sehe, wie er das Foto aus dem Zimmer bringt.
Dann blicke ich auf meine Uhr und frage mich, wann Stephen endlich hier ist. Ich zerbreche innerlich und brauche ihn, damit er mir sagt, dass alles gut wird.
Als DC Black das Foto nach draußen zu ihrem Zivilfahrzeug bringt, wage ich nicht zu fragen, was los ist. Erst jetzt erkenne ich, dass sie nicht in dem Streifenwagen mit dem Blaulicht gekommen sind. Der ist noch draußen, und an dem Wagen lehnt ein Uniformierter, der aussieht, als wäre er überall lieber als hier.
»Fährt Nell Auto?«, fragt DS King.
Ich schüttle den Kopf. »Nein. Sie nimmt Fahrstunden, aber nein. Ich kann Ihnen den Namen ihres Fahrlehrers geben, wenn Sie wollen.«
»Das könnte hilfreich sein, aber darf ich fragen, wenn sie nicht Auto fährt, wie kommt sie dann gewöhnlich zur Arbeit? Nimmt sie ein Taxi, den Bus, fährt mit dem Rad oder …«
»Sie geht immer zu Fuß«, sage ich. »Sie meint, so bekommt sie einen klaren Kopf, bevor der Tag losgeht, und auch abends, wenn er vorbei ist. Und da sie so nah beim Krankenhaus wohnt … ist es einfach für sie.«
DS King nickt. »Ah, okay. Und wissen Sie, welchen Weg sie normalerweise geht?«
»Ähm, nicht genau. Ich denke, sie wird an dem großen Tesco vorbei und dann die Rossdowney Road langgehen. Das ist ziemlich gut beleuchtet.«
Clodagh sagt: »Mrs Sweeney hat recht. Und sie nimmt immer die Unterführung, um nicht bei dem dichten Verkehr über die Straße zu müssen.«
Die Unterführung. Die hatte ich verdrängt. Ich habe es gehasst, dass sie auf diesem Weg nach Hause geht, aber sie hat immer dagegengehalten, dass es sicherer ist, als eine vierspurige Straße zu überqueren. Und so nah am Einkaufszentrum könnte nichts Fieses passieren.
»Und den Weg läuft sie jeden Abend?«
Clodagh bejaht stumm.
Plötzlich habe ich ein Bild meiner Tochter im Kopf, die verletzt in der Unterführung liegt oder, oh Gott, ich kann das nicht mal denken! Sicher nicht. Da ist viel los. Sie wäre gefunden worden. Jeder hätte inzwischen davon gehört.
»Es ist wichtig, dass wir so viel wissen, wie es nur geht«, sagt DS King. »Also falls Ihnen noch ein anderer Weg einfällt, den sie genommen haben könnte, oder dass sie manchmal bei jemandem mitfährt – irgendwelche Details –, lassen Sie es uns bitte wissen.«
In diesem Augenblick kommt Stephen, der vollkommen verwirrt aussieht. Ich beobachte, wie er sich in Nells kleinem Wohnzimmer umschaut: zu der Fremden in dem grauen Hosenanzug, die sich Notizen macht, zu Clodagh mit den geröteten Augen. Zu mir. Ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie ich aussehen muss. Angespannt. Blass. Verängstigt.
»Marian«, sagt er. »Was ist los? Wo ist Nell?«
Ich kann nicht sprechen, bekomme kaum Luft. Wie sage ich ihm das? Wie erzähle ich ihm, dass seine Tochter – unser Kind – vermisst wird? Wie kann ich ihn in denselben Albtraum stürzen, in dem ich mich befinde?
»Hallo. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Mr Sweeney sind?«, fragt DS King und steht auf.
»Ja, ich bin Stephen Sweeney, Nells Vater. Wer sind Sie, und was zum Teufel geht hier vor? Wo ist Nell?« Er ist gereizt, verärgert. Ich ahne schon, dass er wütend auf mich sein wird, weil ich ihn nicht vorgewarnt habe. Aber ich musste ihn heil hierherbekommen. Das muss er einsehen.
»Ich bin Detective Sergeant Eve King. Wir sind gerufen worden, weil Ihre Tochter anscheinend vermisst wird.«
Er sieht sie an, als würde sie in einer Fremdsprache reden. »Vermisst?«, wiederholt er.
»Gemäß Miss Clarke ist Ihre Tochter seit Donnerstag von niemandem mehr gesehen worden und hat auch niemand von ihr gehört.«
»Donnerstag?« Er blinzelt, versucht, das alles zu verarbeiten. Ich beobachte, wie er einknickt, sich vorbeugt und aufs Sofa sinkt, als hätte ihn das Gewicht dessen, was er eben gehört hat, nach unten gedrückt. Ich möchte seine Hand nehmen, aber er ist zu weit weg. Er ist immer zu weit weg.
DS King fasst für ihn zusammen, was sie bisher weiß, während Stephen mich anstarrt, als wäre dies alles meine Schuld.
»Und was machen wir jetzt? Was werden Sie unternehmen, um sie zu finden?«, fragt er. Mir fällt auf, dass er seine Autoschlüssel fest umklammert. Könnten wir doch einfach ins Auto springen und losfahren, sie im Park mit ihren Freunden finden, wo sie so viel Spaß haben, dass sie die Zeit aus dem Blick verloren haben. Aber jene Tage sind längst vorbei.
»Wir müssen mit ihren Freunden reden. Mit diesem Rob, mit dem sie einige Male aus war. Ihren Kollegen. Versuchen, etwas über ihre Verfassung zu erfahren, als sie am Donnerstagabend das Krankenhaus verlassen hat. Leute verschwinden aus allen möglichen Gründen. Es ist wichtig, dass wir uns im gegenwärtigen Stadium nicht allzu große Sorgen machen.«
Stephen lacht matt, und das versetzt mir einen Stich. Wir beide sind seit Langem über das »Nicht zu große Sorgen machen«-Stadium hinaus.
Er sieht mich hilflos an. Als sollte ich dies hier wieder hinbekommen, weil ich das nun einmal tue. Ich regle Dinge. Ich öle Rädchen, stecke Geld in die Parkuhr und halte alles am Laufen. Vor allem, wenn es um Nell geht. Sie ist eher »mein Job«, als es die Arbeit im Büro und das Arrangieren von Hausbesichtigungen jemals waren.
Es zerreißt mich, dass ich diesen Job jetzt nicht machen kann. Ich kann es nicht wieder hinbekommen, nicht diese eine Sache, die ich dringender regeln müsste als irgendetwas zuvor.
Die Stille wird durch die Rückkehr des großen Polizisten, DC Black, gebrochen. Er hat das Foto in der Hand, und instinktiv lange ich hin, um es ihm abzunehmen. Dabei sehe ich etwas in seinen Zügen. Mitgefühl vielleicht. Eventuell weiß er, wie so etwas läuft. Wahrscheinlich ist er schon länger dabei. Er hat solche Gespräche mit anderen Eltern geführt. Hat Fotos von lächelnden Gesichtern, eingefroren in der Zeit, genommen und sie verteilt. Vielleicht wenige Tage später eine traurige Nachricht überbracht. Plötzlich ist mir alles zu viel. Ich sehe ihr Foto an. Ihr Lächeln. Das Gesicht, das ich mehr als alles andere in meinem Leben liebe.
Ich kämpfe gegen die Panik, die mich zu vernichten droht. Konzentriere mich darauf zu atmen, auf das Geräusch meines Herzschlags, das durch meinen Körper hallt. Ich denke an ihren Herzschlag, der einst ein Echo von meinem war.
Bitte, flehe ich, bitte sei okay.
Kapitel drei
Er
Zwei Monate zuvor
Das erste Mal ist ein Unfall. Ihm ist nicht einmal klar, was geschieht, bis ihre Atmung angestrengter wird und ihr Körper sich versteift. Bis er die Angst fühlt, die in Wellen von ihr abstrahlt. Bis das Stakkato ihrer Absätze auf den kalten Pflastersteinen schneller wird und das Klackern in ein unnatürliches Tempo verfällt.
Fast ruft er. Fast sagt er ihr, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Es ist ja nicht so, dass er ihr etwas tun will. Er ist kein Vergewaltiger oder so. Scham nagt an ihm. Die kollektive Scham, die alle Männer teilen. Das Wissen, dass sie alle potenzielle Sexualstraftäter sind. Das Potenzial haben, sie zu überwältigen. Und zu kontrollieren. Und zu verletzen.
Ihm ist schnell klar, dass sein Rufen sie wahrscheinlich noch mehr ängstigen würde. Er stellt sich vor, wie ihre Hand die Autoschlüssel fest umklammert, schlagbereit, ihre Furcht in sein Gesicht zu knallen und gleichzeitig das Knie nach oben in seinen Schritt zu rammen.
An der Geschwindigkeit ihrer Schritte, der Entschlossenheit ihres Gangs erkennt er, dass sie ihn schon für eine Gefahr hält. Ohne ihn überhaupt zu kennen. Er ist eine Bedrohung, weil er ein Mann ist, der nachts dieselbe Straße langgeht wie sie.
Und da wird er wütend. Er hat einen Scheißtag auf der Arbeit gehabt. Seine Chefin hing ihm die ganze Zeit im Nacken und hat ihn behandelt, als wäre er blöd. Sie ist nicht viel länger in dem Job als er, aber ihre Beförderung ist ihr zu Kopf gestiegen. Sie macht so ein großes Ding daraus, »sich in einer männlich dominierten Branche so gut zu halten«. Manchmal fühlt es sich an, als gäbe sie ihm persönlich die Schuld am Patriarchat.
Und sie ist nicht allein. Wo er auch hinsieht, beschuldigen Feministinnen Männer des »Mansplaining« oder bezeichnen das, was früher Flirten hieß, als eine Form von sexueller Belästigung. Was für ein Unsinn. Und diese Frau, die vor ihm schneller wird – ihn für einen potenziellen Vergewaltiger hält, obwohl nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte –, ist nur noch ein Beispiel dafür, wie irre die Welt geworden ist. Wann hat es angefangen, dass Männer nachts keine Straßen mehr entlanggehen können, ohne vorschnell als notgeile Böcke abgestempelt zu werden? Seit wann ist es ein Verbrechen, einen Penis zu haben?
Seine wachsende Wut und sein Frust über die ungerechte Welt lassen ihn schneller gehen, bis er mit ihrem Tempo mithält. Natürlich bleibt er ein Stück hinter ihr. Er will ihr nichts tun, und es ist nicht seine Schuld, wenn er ihr Angst macht, bloß weil er denselben Weg geht. Das liegt an ihr. An ihrem Urteil über ihn und alle Männer. Ihm wird bewusst, dass sein Herz schneller schlägt, und das nicht nur, weil er seine Schritte beschleunigt hat. Etwas treibt ihn an. Etwas, das einen primitiven Teil in ihm anspricht. Das den Frust eines weiteren Tages, an dem Aufgaben, für die er mehr als qualifiziert ist, stattdessen einer Kollegin übertragen wurden, in neue Bahnen lenkt. Ja, an all dem ist quasi die positive Diskriminierung schuld.
Die Frau geht über die Straße, ohne vorher zu schauen, ob Autos kommen, und er folgt ihr. Sein Frust und seine Wut verwandeln sich in etwas anderes. Ein Gefühl von Macht. Von Kontrolle.
Je schneller er geht, desto schneller wird sie. Er kann ein kaum wahrnehmbares Zittern in ihrem Ausatmen hören. Ihre Angst, stellt er fest, ist berauschend. Er saugt sie in sich auf, ertappt sich dabei, wie er lächelt, wie er froh ist zu wissen, dass er zwar keine Gefahr für sie ist – jedenfalls jetzt nicht –, aber sie das ja nicht weiß. Sie hat einfach Angst. Vor ihm. Einem Mann, den noch nie jemand richtig ernst genommen hat.
Es braucht nicht viel, sie zu erreichen. Ein klein wenig größere Schritte, eine leichte Beschleunigung. Ohne groß nachzudenken, streckt er einen Arm aus und kann beinahe spüren, wie ihr Körper ihm ausweicht. Sie kann seine Energie in der Luft um sie herum fühlen. Seine Finger streifen ihr langes dunkles Haar an den Spitzen; seine Sinne sind so geschärft, dass es sich anfühlt, als würde jede Strähne seine Nervenenden streicheln. Die Luft knistert davon. Er ist geschockt, als sich etwas in seinem Schritt regt. Eine Erinnerung an seine Biologie.
Plötzlich bleibt sie stehen und dreht sich zu ihm um, ihr Gesicht weiß vor Zorn und Furcht. Ihm gefällt es zu sehen, welche Wirkung er auf sie hat. Er erkennt es in dem Weiß ihrer Augen und an ihrem angespannten Kinn.
»Hören Sie sofort damit auf, oder ich schreie so laut, wie ich kann«, sagt sie so schnell, dass sie sich ein bisschen verhaspelt.
Er hebt beide Hände, als würde er sich ergeben, und sein Mut schwindet. »Womit aufhören? Ich gehe nur nach Hause.«
»Sie verfolgen mich«, sagt sie. Er blickt zu ihrer geschlossenen Faust, die nun erhoben ist, und kann das Funkeln eines Schlüssels zwischen ihren Fingern sehen. »Sie verdammtes Schwein. Noch ein Schritt und ich …«
»Oh, Mann, tut mir leid«, antwortet er automatisch. Immer entschuldigt er sich. Immer weicht er zurück. Er ist verwundert, dass er es nicht so meint. Überhaupt nicht. Es tut ihm nicht leid. Er ist noch wütend, jetzt vielleicht sogar noch mehr, weil sie ihn beschimpft. Doch er weiß, dass es dumm wäre, ihr zu verraten, was er wirklich empfindet. »Mir war nicht klar, dass ich Ihnen Angst gemacht habe. Tut mir leid. Warum gehen Sie nicht weiter? Ich bleibe hier. Oder gehe auf die andere Straßenseite.« Dann tritt er einen Schritt zurück. Und noch einen. Er setzt eine beschämte Miene auf und schaut zu, wie sie zurückweicht, zu ängstlich ist, um ihm schon den Rücken zuzukehren.
Also bleibt er stehen und beobachtet sie. Seine Hände sind immer noch erhoben, bis sie sich endlich umdreht und die Straße entlangeilt. Schließlich ist sie nicht mehr zu sehen.
Garantiert wird sie ihren Freundinnen von dem Perversen erzählen, der ihr nach Hause gefolgt ist, denkt er. Ihn erstaunt, dass ihm das einen Kick gibt. Ja, er genießt den Gedanken. Ihm gefällt, dass er so eine Wirkung hat.
Als er zu Hause ist, kribbelt es in ihm. Er fühlt sich elektrisiert, befeuert. Während er sich ein Bier aus dem Kühlschrank nimmt, befiehlt er Alexa, seine Lieblingsplaylist zu spielen, und die ersten Akkorde von »Mr Brightside« von The Killers füllen die Küche. Er weist Alexa an, lauter zu stellen, und sucht in seinem Tiefkühler nach etwas zum Abendessen.
Nein, er beschließt, nicht zu kochen. Er wird sich indisches Essen gönnen. Und einige Biere. Nach eben hat er gute Laune. Das Adrenalin von seinem Heimweg und das Machtgefühl, das mit ihm einherging, sind erhebend. Fluten seine Adern. Er lässt Alexa noch lauter stellen und ordert sein Essen über eine App auf seinem Handy.
Die erste Flasche Bier leert er innerhalb von Sekunden, knallt sie auf die Arbeitsplatte und öffnet eine zweite.
Er spielt ein bisschen Luftgitarre, wartet auf das Crescendo des Songs, als er es hört. Das Pochen von oben. Selbst über die Musik und sein lautes Mitsingen des Textes hinweg hört er es. Dasselbe nervige Muster von drei Schlägen, das Kontrolle signalisiert. Es bedeutet ihm, dass er nicht so frei ist, wie er denkt. Doch heute Abend fühlt er sich aufgedreht. Rebellisch. Er brüllt lauter, ignoriert das Klopfen von oben.
Er zahlt genauso Miete wie die anderen. Das ist sein Zuhause. Wenn er nach der Arbeit nach Hause kommen, ein paar verdammte Biere trinken und verdammt noch mal Musik hören will, hat er jedes Recht dazu.
Die Schritte sind über den Lärm hinweg nicht zu hören, ebenso wenig wie sein Name, der gerufen wird. Und selbst wenn er es hören könnte, wäre es ihm egal. Er hat schon entschieden, dass er die Musik nicht leiser stellt. Auf keinen Fall, ehe sein Essen da ist und er sein zweites Bier getrunken hat. Oder sein drittes. Er merkt schon, wie sich die Chemie in seinem Blut verändert – der Anfang eines herrlichen Rausches. Er nimmt sich einen Teller, knallt die Schranktür wieder zu und kramt in der oberen Schublade nach Besteck, als er mitbekommt, dass Cormac übernächtigt in der Küchentür steht – sichtlich aufgebracht.
»Scheiße, Mann, kannst du das vielleicht leiser machen?«, fragt Cormac.
Er kann seinen Mitbewohner gerade so noch verstehen, was ihn jedoch nicht davon abhält, ihm übertrieben gestikulierend zu bedeuten, dass er ihn nicht hört. »Was war das?«, fragt er, und er spürt Cormacs Anspannung sogar auf diese Distanz. In anderen Momenten hätte er sich vielleicht unwohl gefühlt und sich umgehend entschuldigt. Aber nicht jetzt. Nicht heute Abend. Heute ist es, als würde er sich von dem Erlebnis eben nähren. Er hat die Macht, diesen einen Meter fünfundachtzig großen Sportlehrer vor Wut zum Zittern zu bringen. Aber er weiß, dass er sicher ist, denn Cormac ist kein Typ, der handgreiflich wird, nicht mal im Zorn.
»Sei kein Arsch«, sagt Cormac.
»Tut mir leid«, entgegnet er grinsend. »Ich kann dich nicht hören. Kannst du lauter sprechen?«
»Alexa! Sei verdammt noch mal still!«, schreit Cormac, und natürlich tut Alexa, was von ihr erwartet wird, und verstummt sofort. »Du weißt, dass ich Tag und Nacht an den Zeugnissen sitze und Jade für ihre Mündlichen büffelt. Du musst doch kein Arschloch sein. Echt jetzt!«
»Ich arbeite auch viel und muss mal Dampf ablassen«, erklärt er Cormac und unterdrückt den Wunsch, ihm zu sagen, er soll sich verpissen.
»Dann geh laufen. Oder ins Fitness-Center. Du musst ja nicht alle anderen hier stören, indem du Bier kippst und dröhnende Musik hörst.«
»Nicht jeder will laufen. Nicht jeder will seine Zeit mit Posen in der Muckibude verbringen. Es ist nichts verkehrt daran, ein paar Biere zu trinken. Vielleicht solltest du das mal versuchen. Vielleicht bist du dann nicht mehr so ein Arsch.«
Er sagt Alexa, dass sie seine Musik weiterspielen soll, und kehrt Cormac den Rücken zu. Er fühlt sich unantastbar. Er braucht Cormac mit seinen Zeugnissen oder Jade mit ihrer mündlichen Prüfung nicht, die ihm Schuldgefühle einreden. Die haben keinen Schimmer, wie sein Tag war. Unter welchem Druck er steht. Sie kennen ihn nicht und interessieren sich auch nicht für ihn.
Er bekommt zu spät mit, dass Cormac an ihm vorbei zum Streaming-Gerät greift und den Stecker rausreißt. Seine Courage verebbt, als er zusieht, wie Cormac die Arme hebt und den Apparat mit Schwung auf den Fliesenboden schmettert. Das Ding zerspringt in lauter Einzelteile.
Er starrt Cormac an, begreift nicht so recht, was er gerade gesehen hat.
»Werd gefälligst erwachsen«, brüllt Cormac. »Oder such dir eine andere Wohnung.«
Mit diesen Worten verlässt sein Mitbewohner die Küche. Er ist zwischen Wut und Schock gefangen. Seine Stimmung rauscht genauso schnell nach unten, wie sie sich gehoben hatte. Das halb leere Bier in seiner Hand hat seinen Reiz verloren. Auch das indische Essen, das er bestellt hat. Vor Anspannung und Nervosität hat er einen Knoten im Bauch. Seine Muskeln verhärten sich. Der Stress ist wieder auf dem Level, wo er war, als er sich auf den Heimweg machte. Vielleicht noch stärker.
Eindeutig stärker.
So kann er nicht weitermachen. Hier. Bei Leuten, die ihn nicht respektieren. Die ihm nicht erlauben, er selbst zu sein.
Er setzt die Flasche wieder an, aber das Bier schmeckt bitter. Warm wie die Galle in seinem Magen. Beim Anblick des zerbrochenen Echos auf dem Fußboden kommt er zu dem Schluss, dass er genauso zum Schweigen gebracht wurde wie Alexa. Er flucht leise und überlegt, die Bierflasche auch auf den Boden zu donnern.
Aber seine Courage ist fort. Sein Gefühl, jemand Wichtiges, Mächtiges zu sein, ist fort. Er schüttet das Bier in den Ausguss und entsorgt die Flasche in der Recyclingtonne. Dann fegt er die Plastikteile vom Boden auf und steckt sie in eine Plastiktüte. Er bezweifelt, dass das Gerät repariert werden kann, doch er wird es versuchen.
Die Türklingel schrillt, und er weiß, dass sein Essen da ist, aber ihm ist der Appetit vergangen. Er nimmt das Essen entgegen und bringt es in die Küche. Dann greift er nach einem Stift und schreibt eine Notiz: »Bedient euch«, bevor er alles in der von Kondenswasser feuchten Plastiktüte stehen lässt.
Er ist fertig. Besiegt. Und er geht in sein Zimmer, enttäuscht von sich und wütend auf das Leben.
Kapitel vier
Er
Zwei Monate zuvor
Er fährt seinen Computer hoch und verplempert eine Stunde auf YouTube. Weitere vierunddreißig Minuten auf Reddit. Siebenundzwanzig Minuten auf Pornhub. Nicht mal seine Lieblingspornos können seine Stimmung heben – oder seinen Schwanz. Verflucht seien Cormac und Jade. Die glauben, sie hätten ein Recht, alles in seinem Haus zu kontrollieren. In seiner Umgebung.
Kurz nachdem er in sein Zimmer gegangen war, hatte Jade an seine Tür geklopft. Sie stand in ihrem Pyjama mit der kurzen Hose da – die genau ein bisschen zu wenig von ihren blassen, weichen Oberschenkeln freigaben –, das blonde Haar zu einem unordentlichen Knoten aufgesteckt. Und das Pyjamatop hing über eine Schulter, sodass ein blassrosa BH-Träger zu sehen war. Sie nannte es ihre »Wohlfühlklamotten«, wenn sie so im Haus herumstolzierte. Hin und wieder lieh sie sich einen seiner großen Pullover, wenn ihr »ein bisschen kalt« war.
Das tat Jade gern. Provozierend gekleidet herumlaufen, auf prüde machen, aber eindeutig schlampig. Doch wehe, es machte irgendwer eine Bemerkung, die als sexistisch aufgefasst werden konnte. Sie durfte aussehen, als käme sie eben aus dem Bett, ihn mit diesem »Fick mich«-Lächeln anschauen, aber trotzdem bestand sie darauf, dass sie für ihren Verstand bewundert wurde, nicht für den Körper, den sie so schamlos zur Schau stellte.
Und er war weniger ein Freund denn ein Mitbewohner, was schlimmer, viel schlimmer war. Eigentlich noch übler als das. Er war das fünfte Rad am Wagen. Für ihn stand fest, dass Cormac und Jade es trieben. Oder es irgendwann würden. Er sah ja, wie lässig sie miteinander umgingen. Da war eine Intimität, die es nur gibt, wenn man sich intim, sexuell kennt.
Es macht ihn wahnsinnig.
Und er war schon wütend genug, als Jade sich mit einem Teller indischem Essen in der Hand in seinen Türrahmen lehnte und ihm dankte, dass er so aufmerksam war. »Du bist so ein Schatz«, seufzte sie. »Genau das habe ich gebraucht, um beim Pauken durchzuhalten.«
»Soll ich dir helfen?«, hatte er gefragt. Der Gedanke, ihr in dieser spärlichen Bekleidung nahe zu sein, vielleicht in ihrem Zimmer, löste ein Kribbeln in ihm aus, das direkt in seinen Schwanz fuhr. »Ich kann einige Fragen mit dir durchgehen, wenn du willst.«
Sie lächelte und neigte amüsiert den Kopf zur Seite. »Wie süß von dir, aber Cormac hilft mir schon. Und Wissenschaft ist eher sein Ding. Du würdest dich zu Tode langweilen. Und du hast dich vorhin gestresst angehört. Erhol dich lieber.«
Ihn hat es nicht überrascht zu hören, dass Cormac ihr »half«. Er verkniff sich die Frage, sie möge »helfen« definieren. Könnte er ihr doch schlicht sagen, dass Cormac kein Engel ist. Der will ihr genauso an die Wäsche wie jeder andere Kerl. Cormac interessiert sich ungefähr so brennend für ihr Studium wie fürs Häkeln. Er will bloß zum Stich kommen.
Als sie ging, hatte Jade ihm einen Luftkuss zugepustet, bevor sie mit ihrem Hintern in den engen Shorts davonwackelte.
An die Shorts hatte er gedacht, als er sich den Porno ansah, aber es brachte nichts. Doch jetzt … jetzt ist es anders. Er denkt weniger an ihre Shorts als an das, was auf seinem Heimweg war. Er stellt sich vor, die Frau, die Angst vor ihm hatte, ist Jade und nicht die geheimnisvolle Frau, deren Gesicht schon wieder aus seinem Gedächtnis verschwindet.
Er denkt daran, wie sie schneller geht, ihr Atem flacher wird, ihr Schweißperlen auf die perfekt geschminkte Stirn treten. Darüber zu fantasieren lohnt sich. Die Tatsache, dass es komplett tabu ist – sich seinen Endorphin-Kick zu verschaffen, indem man Frauen Angst einjagt –, macht es nur noch schärfer.
Das ist ein neues High. Ein süchtig machendes. Eines, dem er wieder nachjagen wird. Vielleicht mit Jade oder auch mit einer anderen unbekannten Frau auf der Straße. All diese Frauen, die so wie seine Mitbewohnerin sind. Sie sind alle gleich. Wild entschlossen, Männern ihre Männlichkeit zu rauben. Guten, anständigen, hart arbeitenden Männern, über die sich Frauen gerne lustig machen. Sie verspotten und mit ihnen spielen. Die holde Maid in Not mimen, sich dann umdrehen und lachen oder mit ihren Schlüsseln nach ihnen schlagen wollen, sie pervers nennen oder Schweine und behaupten, sie würden schon durch die bloße Existenz eines Mannes eingeschüchtert.
Es wäre anders, denkt er, wäre er muskulös und durchtrainiert wie Cormac. Wäre er nicht so unbeholfen im Umgang mit anderen. Könnte er Kleidung finden, die gut an ihm aussieht, anstatt lose an ihm herunterzuhängen, als wartete er noch darauf, in sie hineinzuwachsen. Hätte er Haar, das sich benimmt, statt in alle Richtungen abzustehen, egal, was er macht. Es ist kein Gerücht, dass Frauen von Besitz und Aussehen angezogen werden. Trotz all dem dämlichen »Schönheit kommt von innen«-Schwachsinn haben die wenigsten Frauen jemals erwogen, ihn gut genug kennenzulernen, um seine innere Schönheit zu sehen.
Er wird wieder wütend, will Dampf ablassen. Es soll jemand bestätigen, wie unfair das ist. Er will, dass ihm jemand sagt, er versteht ihn.
Aber mit wem kann er reden? Er scrollt wieder durch sein Handy, sucht nach dem Chatroom, über den er vor ein oder zwei Wochen gestolpert ist. Nur Männer. Ein Ort, von dem er fürchtete, er wäre voller toxischer Maskulinität, Schwanzmaßen, Prahlerei von Fitness-Freaks und so. Wo er sich nie und nimmer wohlfühlen würde.