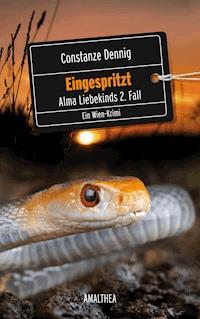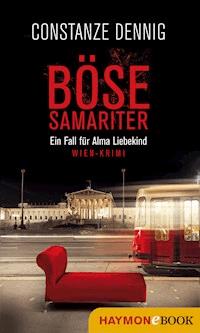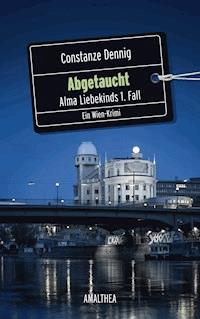Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Während eines Krankenhausaufenthalts beobachtet Alma Liebekind, von Beruf Psychiaterin, dass ein Todesfall in der Klinik anscheinend vertuscht wird. Die Hobbykriminalistin kann es nicht lassen und macht sich daran, das Geheimnis zu lüften. Ihre neugierige Mutter steht ihr dabei tatkräftig zur Seite. Schon bald gibt es eine heiße Spur zu einem Flüchtlingsheim. Alma und ihre Mutter beginnen ihre verdeckten Ermittlungen. Das Wissen über die Abgründe der menschlichen Seele hilft Alma, Licht in die mysteriösen Vorfälle zu bringen. Doch da nimmt der Fall eine gefährliche Wendung ….
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Während eines Krankenhausaufenthalts beobachtet Alma Liebekind, von Beruf Psychiaterin, dass ein Todesfall in der Klinik anscheinend vertuscht wird.
Die Hobbykriminalistin kann es nicht lassen und macht sich daran, das Geheimnis zu lüften. Ihre neugierige Mutter steht ihr dabei tatkräftig zur Seite. Schon bald gibt es eine heiße Spur zu einem Flüchtlingsheim. Alma und ihre Mutter beginnen ihre verdeckten Ermittlungen.
Das Wissen über die Abgründe der menschlichen Seele hilft Alma, Licht in die mysteriösen Vorfälle zu bringen.
Doch da nimmt der Fall eine gefährliche Wendung …
Dank
Ich danke meiner Freundin Friederike Lenart für ihre wertvolle Mitarbeit.Ihre intelligenten Hinweise waren das Salz in der Krimisuppe!
Steckbrieflich bekannt
Alma Liebekind-Spanneck
Alma ist Nervenärztin in Wien, schreibt auch Gerichtsgutachten und ist außerdem eine „Ermittlerin im Pfusch“, wie sie von ihrer Freundin Frau Oberinspektor Sacherl bezeichnet wird. Sie zeichnet sich durch eine überbordende Fantasie und skeptische Neugierde aus, was ihr zwar bei ihren Recherchen zugutekommt, aber auch regelmäßig Komplikationen verursacht.
Alma ist eine auffallend attraktive Mitvierzigerin, die sich aber wenig aus ihrem Äußeren macht. Das liegt auch daran, dass sie immer unter Termindruck leidet und ihre Zeit lieber dem sportiven Spionieren widmet. Zur Entspannung und fürs Herz leistet sie sich Michelangelo – ihren jugendlichen Liebhaber. Sie ist ihrer Mutter Martha in inniger Konfliktliebe verbunden.
Summa summarum: Eine Frau, hin und her gerissen zwischen pragmatischem Verantwortungsbewusstsein und ungehemmter Lebenslust.
Martha Liebekind-Spanneck
Martha, Almas Mutter, schaukelt die Ordination ihrer Tochter und ist sich ihrer Wichtigkeit bewusst. Als bestimmende 85-jährige Rezeptionistin weiß sie selbstverständlich alles besser als die Frau Doktor. Sie hockt auf ihrer Tochter wie eine liebevolle Krake. Keinesfalls deshalb, weil sie sonst einsam wäre und schon gar nicht, weil sie ihren Ex-Mann Kajetan von Spanneck frühzeitig entsorgt hat – nein, sondern weil sie ihre Tochter abgöttisch liebt und überzeugt ist, dass Alma ohne ihre überragende Intelligenz und ihre überirdischen Kochkenntnisse elendiglich zugrunde gehen würde. Wer sonst ist so klug, dass er als Hobby Witze ins Lateinische übersetzt und diese ins Netz stellt? Dem Herrn von Spanneck, der lange verschollen war, gestattet sie gelegentlich einen Besuch in ihrem Bett, sonst möchte sie aber nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Summa summarum: Ein Golden Girl der Grauen Panther mit dem Motto: Quod licet Iovi, non licet bovi.
Michael Mikulina
Wird in liebevollen Zeiten von Alma auch „Michelangelo“ genannt. Er performt umwerfend als Liebhaber, als Partner agiert er lebensfern. Seine lässige Art, mit den Pflichten des Alltags umzugehen, ist einerseits seinem jugendlichen Alter, andererseits seiner jovialen Lebenseinstellung zuzuschreiben. Glaubt von sich, ein Literat zu sein, schafft es aber nicht, mehr als zehn Seiten eines Romans zu schreiben.
Summa summarum: Almas Lebenskünstler und großer Luxus!
Erika Sacherl
Almas Busenfreundin seit gymnasialen Zeiten. Erika hat, statt zu studieren, die Polizeischule gemacht, was immer wieder zu Konflikten mit Alma führt. Einerseits ist sie wegen des verabsäumten Studiums ein wenig eifersüchtig auf Alma, andererseits nerven sie deren Einmischungen in ihre polizeiliche Kompetenz. Sie huldigt trotz ihres herausfordernden Berufs den Freuden des Lebens, wie Affären, Zigaretten und außer Dienst auch dem einen oder anderen alkoholischen Getränk.
Summa summarum: Untypische, aber sehr tüchtige Frau Oberinspektor.
Manfred Marchel
Seit Studienzeiten ist er Alma in hoffnungsloser Liebe verfallen. Hofft noch immer, irgendwann von ihr erhört zu werden. Außergewöhnlich intelligenter und gebildeter Professor für Gerichtsmedizin, der den lukullischen Freuden einiges abgewinnen kann. Das sieht man ihm auch an. Momentan mit Erika Sacherl konfliktbehaftet liiert.
Summa summarum: Wäre für Mutter Martha der perfekte Schwiegersohn!
Kajetan von Spanneck
Almas Vater und Marthas Ex-Mann, der plötzlich aus der jahrelangen Versenkung auftaucht. Mögliche Ursache dafür ist sein Geldmangel und die Sehnsucht nach einer geriatrischen Begleitung. Ein Leben lang ein Hallodri, der sich dank seines Charmes und mithilfe kleiner Gaunereien seinen Unterhalt stets von anderen Menschen finanzieren ließ, was als Altersversorgung aber nicht mehr ganz so funktioniert. Wer will schon einen gealterten Eintänzer?
Summa summarum: Fitter Mitachtziger mit einem Hang zum Laissez-faire.
Joschi Ameling
Gewichtiger Obduktionsgehilfe bei Prof. Marchel mit schlichtem Gemüt. Liebenswert, aber unter dem Einfluss von Bier nicht sehr zuverlässig.
Summa summarum: Almas naiver Informant hinter Prof. Marchels Rücken.
Ferdinand Fluger
Junger Polizist im Anlernstatus; deshalb und nicht nur wegen seiner Akne unsicher. Mitarbeiter von Erika Sacherl.
Summa summarum: Aus ihm wird noch ein hohes Tier in der Polizei werden.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
1. Kapitel
„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen …“, singt der Engelschor aus Faust II.
„Erlöst?“, wieso „erlöst?“ und wenn schon, dann: von wem erlöst, wovon erlöst?
Man schiebt mich auf einer Bahre, von Kopf bis Fuß mit einem Tuch bedeckt, durch einen weißen Gang. Offenbar bin ich soeben von meinem Leben erlöst worden. Aber ich möchte doch gar nicht von meinem Leben erlöst werden. Ich will doch gar nicht tot sein und schon gar nicht will ich diese deprimierenden, von Engelszungen bigott wiedergegebenen klerikalen Chorgesänge hören. Man erlöse mich von diesem einschläfernden Singsang! Mein Begräbnis habe ich mir jedenfalls anders vorgestellt.
Wenn der Dank für „sich immer strebend zu bemühen“ der ist, vom Leben erlöst zu werden, dann hat sich Goethe aber einen massiven Denkfehler geleistet!
Als sich meine Augenlider mühsam einen winzigen Spalt öffnen, blicke ich auf eine runzlige Hand, die eine bleiche Hand drückt. Die runzlige erkenne ich sofort an ihrem protzigen Aquamarinring, die bleiche scheint mir unbekannt. Erst als ich versuche mich aufzusetzen und dabei die blassen Finger aus den faltigen gleiten, erkenne ich sie als meine Hand. Verzweifelt versuche ich, die Gedanken zu ordnen: Wo bin ich? Was ist geschehen? Ich öffne den Mund, um mich zu verständigen, meine Lippen gehorchen nicht.
„Alma … Alma … bist du wach?“
Die runzlige Hand schlägt mir unsanft auf die Wange.
„Kind, wach auf!“
Das klingt wie ein harscher Befehl und auf diese Art des Kommandos reagiert mein Kopf sofort. Wie wenn man einen Computer hochfährt, funktioniert meine Orientierung plötzlich wieder. Mutter hat mich gestartet. Ich rapple mich hoch, stütze mich auf meine Ellenbogen, reiße meine Augenlider auf und finde mich in einem typischen Krankenzimmer mit den unsäglichen Nachdrucken – vorzugsweise von Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Claude Monet – an der Wand. Experten der Krankenhausgestaltung wissen anscheinend, dass diese Künstler einen Stil haben, der baldige Heilung verspricht und die Seelen der Kranken erquickt. Mich erquicken sie nicht, ganz im Gegenteil, sie versetzen mich in einen Zustand der Weinerlichkeit. Ohne mich dagegen wehren zu können, schießen mir Tränen aus den Augen. Weine ich vor Glück, weil ich doch nicht erlöst bin, oder weil ich sterbenskrank erlöst werden soll, oder nur wegen des Van Goghs an der Wand? So ganz bekomme ich mein Hirn doch noch nicht auf die Reihe.
Mutter schnappt sich wieder meine schon etwas weniger bleiche Hand und tätschelt sie: „Aber geh, das war doch noch gar kein richtiger Mensch. Dritter Monat, da gehen sie eben oft ab. Früher hätte man das gar nicht bemerkt. Da hätte man eben stark geblutet und das war’s dann auch schon. Also kein Grund zum Weinen.“
Aha, darum bin ich da. Narkose nach einer Curettage nach einem Frühabort – ich erinnere mich. Und die Heulerei: ein Durchgangssyndrom1 wegen der Narkose!
„Ich weine doch gar nicht wegen dem Baby, einfach nur so …“, schluchze ich.
Mutter lässt meine Hand los, greift mir auf die Stirn: „Fieber hast keines. Morgen bist du schon wieder auf dem Damm. Wahrscheinlich die Narkose.“
Ich nicke, kann aber meinen Tränenfluss trotzdem nicht beherrschen.
„Ich … ich …“, stoße ich hervor, „… ich … ich … jedenfalls habe ich drastisch erlebt, wie es ist, tot zu sein. Ein Engelschor – mit diesem schrecklichen Singsang der gregorianischen Choräle –, … der hat gesungen: ‚Wer iiim … mer streeebend sich bemühhühüt, den können wir erlöööösen‘ oder so irgendwie.“
„Wenn mich so ein Choral beschallt hätte, dann wäre mir auch zum Heulen.“
Mutter nimmt mein Handy aus der Lade des Nachtkästchens, schiebt mir die Kopfhörer ins Ohr und scrollt am Display. Meine Tränen versiegen sofort, denn ich lausche dem Ensemble „Pink Martini“ mit „Que sera, sera“ – ein Lied, bei dem man einfach nur happy sein kann.
„Stell dir vor, ich hab mich selbst gesehen, wie ich auf einer Bahre komplett zugedeckt irgendwohin geschoben wurde. Ein Nahtoderlebnis?“
„Ein Durchgangssyndrom, kein Nahtoderlebnis, aber …“, Mutter tippt sich an die Stirn, „… aber da fällt mir was ein. Vielleicht hast du das wirklich, noch im Koma der Aufwachphase, beobachtet?“
Mit dem „Pink-Martini“-Doping sind meine Lebensgeister erwacht: „Was das?“
„Als ich auf dich gewartet habe, bin ich zuerst ein wenig im Haus hin und her spaziert. Dann aufs Klo gegangen und da hab ich beim Händewaschen durchs Fenster im Vorraum gesehen, wie man im Hof jemanden auf einer Bahre abgedeckt in einen Lieferwagen geschoben hat. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann wundere ich mich: Wieso ein Lieferwagen? Wenn die Person verstorben ist, dann ein Leichenwagen, und wenn sie lebt, dann wohl ein Krankenwagen. Eigenartig!“
„Ich war auch mit einem blauen Tuch abgedeckt …“
„Du warst mit keinem blauen Tuch abgedeckt, aber die Person auf der Bahre, die war’s. Die haben sie wahrscheinlich an dir vorbeigeschoben und dein halbkomatöses Hirn hat dich darunter gelegt. Eine Sinnestäuschung im Rahmen des Durchgangssyndroms.
Leider hat die Wirkung von „Que sera, sera“ schon wieder nachgelassen, denn ich muss mich beherrschen, um nicht wieder zu heulen: „Aber … ich hätte es auch sein können.“
„Auch wenn ich deinen Zustand durch das Propofol2 entschuldigen kann, es ist genug des Selbstmitleids. Bleib am Boden, du hattest eine Curettage und morgen gehst du wieder arbeiten. Ita est3, aus. Frag lieber deine Gynäkologin, ob sie hier zufällig jemanden ins Jenseits befördert haben!“
Ich unterdrücke meine Tränen, denn verstandesmäßig weiß ich, dass Mutter recht hat. So eine Curettage ist eine Lappalie. Immerhin hat mir dieser Abortus die Entscheidung, Mutter zu werden oder nicht, abgenommen. Darum sollte ich eigentlich erleichtert und froh sein. Aber der postnarkotische Zustand meines Gehirns ist durch die Überflutung mit Gammaaminobuttersäure (GABA)4 erheblich gestört. Bis die überflüssige GABA abgebaut ist, werde ich wohl weiterheulen müssen.
„Also, was sollst du fragen, wenn Visite ist?“
Gehorsam wiederhole ich: „Ich soll die Frau Dr. Altenfelder fragen, ob hier ein Patient verstorben ist …“
„Wenn schon, dann Patientin! Ich glaube nicht, dass in diesem Sanatorium mittels Sonden in einem männlichen Uterus herumgestochert wird, bevor er dann sowieso entfernt wird, oder männliche Eierstöcke begutachtet werden, bevor sie künstlich befruchtet werden und dann zu guter Letzt diese Herren auch noch entbinden.“
„… Patientin verstorben ist.“
„Genau! Das fragst du sie bei der Visite. Dann schlafst deinen Narkosekater aus und morgen bist wieder auf dem Damm. Somno vulnera sanat omnia5.“
Dann küsst sie mich zuerst auf die Stirn, dann auf die rechte, dann auf die linke Backe und zum Schluss mit einem Schmatz auf den Mund. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hat, fühle ich mich einsam und verlassen.
Meine Einsamkeit wird jäh unterbrochen, als Michelangelo erscheint. Mit ehrlicher Trauermiene schlurft er auf mein Bett zu, wirft sich auf mich und umarmt mich. Bisher habe ich seine Umarmungen immer als entspannend und oder – oh, là, là – befriedigend empfunden, seine jetzige Rolle als klagender Beinahe-Vater sagt mir aber gar nicht zu. Ich stoße ihn unwirsch von mir weg, was bei ihm ein erstauntes „Was ist?“ hervorruft.
„Ich bin gerade aus der Narkose aufgewacht. Kannst du für mich ein aufheiterndes Lächeln aufsetzen? Mir ist gar nicht nach Begräbnis.“
„Aber“, stottert er, „aber … unser Kind?“
„Was für ein Kind?“
Immerhin hat er es geschafft, mich wütend zu machen, was meine Weinerlichkeit schlagartig beendet.
„Unser Baby!“, antwortet er mit Tränen in den Augen.
„Du sprichst von undefinierten, nicht lebensfähigen Zellen, das ist kein ‚Baby‘. Außerdem haben wir gar nichts davon gewusst. Und jetzt hör bitte auf, eine Tragödie zu konstruieren. Sei lieb und hol mir einen Kaffee, damit mein Kreislauf wieder anspringt.“
Mein Liebhaber ist gekränkt. Er ändert deshalb seine Mimik von „traurig“ auf „beleidigt“, was bei mir auch nicht besser ankommt. Was für ein Glück, dass er mir als Kindesvater erspart geblieben ist!
„Wir … ich … ich habe für uns eine Psychotherapeutin bestellt. Um die Trauer gemeinsam aufzuarbeiten, sie muss gleich da sein.“
Wenn meine Beine nicht noch so schlaff wären, dann wäre ich stante pede aufgesprungen, hätte ihm den picksüßen Tee, der auf meinem Nachtkastl steht, ins Gesicht geschüttet und wäre trotz unvorteilhaftem, weil hinten offenem Krankenhauskittel abgehauen.
„Was hast du? Bist du völlig übergeschnappt? Spinnst du?“
Man sieht ihm an, dass er meine Reaktion nicht nachvollziehen kann. Wieso tappen Männer immer in die Klischeefalle, wenn sie etwas besonders gut machen wollen? Wie er da so betropetzt6 dasitzt, tut er mir beinahe leid. Darum tätschle ich versöhnlich seine Hand und zwinge mich zu einem Lächeln:
„Du hast es gut gemeint! Aber ich habe kein Trauma. Ganz im Gegenteil, ich bin bis auf den Hangover der Narkose erleichtert, dass es vorbei ist und ich nicht am OP-Tisch liegen geblieben bin.“ Ich hüte mich, das näher auszuführen, denn ich möchte keine Psychodebatte anzetteln. „Und, kann ich einen Kaffee haben?“
Gerade als er aufsteht, um mir meinen Wunsch zu erfüllen, öffnet sich die Tür und eine Dame im weißen Mantel kommt rein, anscheinend die Psychotherapeutin. Mit mitfühlendem Gesichtsausdruck kommt sie auf mich zu, um meine rechte Hand zu fassen und sie zwischen ihren Händen einzupacken.
„Guten Morgen, Frau Doktor Liebekind, wie geht es Ihnen?“
„Blendend“, antworte ich patzig.
Zu ihrem mitfühlenden Gesichtsausdruck gesellt sich noch ein Hauch von verzeihendem Verständnis. Langsam beginnt mich die Situation zu amüsieren und ich finde Vergnügen daran, die Psychotante zu provozieren:
„Wie ist Ihr Name? Ich weiß immer gern, mit wem ich es zu tun habe?“
Das ist ihr jetzt peinlich, denn sie blickt Hilfe suchend zu Michael, der sich in der Zwischenzeit verlegen in einen tiefen Lehnstuhl verzogen hat.
„Ich dachte … ich dachte …, dass Ihr Mann mit Ihnen über unseren Termin gesprochen hat. So ein Verlust geht nicht spurlos an der Seele vorbei, deshalb …“
„Und was ist, wenn man keine Seele hat?“
Das macht sie vorerst einmal maulstad7 und sie lässt endlich meine Hand los. Ich hake nach:
„Was kostet mich das Vergnügen Ihrer Trauerbegleitung?“
Nach mehrmaligem betretenem Schlucken drückt sie „Ein Service des Sanatoriums … bei Totgeburt“ heraus.
„Ich hatte einen Frühabort, keine Totgeburt! Dann einen herzlichen Dank für dieses Service an die Krankenhausverwaltung, aber ich …“, und ich deute auch auf Michael, „… wir sind schon ausreichend getröstet. Auf Wiedersehen.“
Offensichtlich erleichtert, diese unkooperative Patientin verlassen zu dürfen, verabsäumt sie es sogar, mir neuerlich das Vergnügen ihres Händedrucks zukommen zu lassen, und dreht sich auf der Stelle um, um sich dafür von Michael zu verabschieden. Der hat anscheinend seine Trauer auch schon überwunden, denn er findet es nicht einmal mehr der Mühe wert, zum Gruß aufzustehen.
Bevor sie das Zimmer verlässt, rufe ich sie noch mal zurück: „Und wie ist eigentlich Ihr Name?“
Sie dreht sich eilig um und wirft mir ihren Namen kurz angebunden hin: „Mag. Schieferer.“
„Entschuldigung, nur kurz. Ich habe noch eine Frage, von wegen Trauer. Als ich aus dem Operationssaal in mein Zimmer gebracht wurde, kam mir vor, als ob ich an einer Bahre mit einer Verstorbenen – ich vermute jedenfalls, dass sie tot war, da die Person auch am Kopfende abgedeckt war – vorbeigeschoben wurde. Das ist ja schrecklich, das bereitet mir tatsächlich Kopfzerbrechen … das hätte auch ich sein können. Narkosezwischenfall?“
Die Frau Magister reißt ihre Augen auf, die mich entsetzt anstarren. Es verschlägt ihr die Sprache.
Ich blicke sie versöhnlich, flehentlich an: „Es wäre mir eine große Beruhigung, wenn ich wüsste, dass die Frau – hier muss es ja wohl eine Frau sein –, dass die nicht an einer OP oder an der Behandlung, sondern an einer unheilbaren Krankheit … Krebs? Jedenfalls wegen meines Vertrauens in das Haus. Ich empfehle Ihr Haus ja auch meinen Patientinnen. Es wäre mir eine Beruhigung.“
Die Psychotherapeutin schluckt, versucht sich wieder auf die Reihe zu bringen und antwortet mit zirpender Stimme: „Das muss ein Irrtum sein, hier ist niemand verstorben. Sie müssen sich getäuscht haben. Tut mir leid.“ Und draußen ist sie.
Als sie weg ist, rappelt sich mein Liebhaber aus seinem Polstersessel halb hoch und kommentiert: „Wieso tot? Wer?“
Ich beruhige ihn, um mir lange, ermüdende Erklärungen zu ersparen: „Nichts! Wir sind in einem Krankenhaus, da sterben eben Menschen. Kann ich jetzt einen Kaffee …?“
Michael rappelt sich seufzend aus seinem bequemen Stuhl hoch: „Mit Zucker?“
Ich verdrehe die Augen. Wir sind seit über vier Jahren zusammen und er weiß noch immer nicht, dass ich Kaffee nur mit Milch trinke. Wenn ich diese Ignoranz ernst nehmen würde, dann müsste ich ihn jetzt hochkant aus meinem Leben werfen. Da ich aber ein östrogenbestimmtes Gehirn habe, toleriere ich verständnisvoll den testosteronbedingten blinden Fleck in seinem Kopf. Gerade als er zum zweiten Mal ansetzt, mir den Kaffee zu besorgen, kommt meine Studienkollegin Frau Dr. Altenfelder zur Visite bei der Tür herein.
„Schau, schau! Ich sehe, dir geht’s schon wieder gut. Sehr fein. Warst sowieso nie wehleidig. Eine erfreuliche Abwechslung an so einem schmerzenden Vormittag.“
„Magst auch einen Kaffee? Der Michael holt mir gerade einen.“
„Warum nicht? Dann trinke ich meinen Vormittagskaffee eben mit dir statt mit den Stationsschwestern“ und zu Michael: „Espresso schwarz, ohne was.“
Dann setzt sie sich amikal auf meine Bettkante, klopft seicht auf die Decke über meinem Bauch und meint: „Alles wunderbar, morgen kannst wieder heim.“
„Ich dachte an heute.“
Sie schüttelt den Kopf. „Heute geht gar nicht, wegen der Versicherung. Du musst zumindest eine Nacht bei uns bleiben. Außerdem schadet es dir nicht, wenn du morgen nicht in der Ordination sitzt. Ein Tag Ruhe wird wohl drin sein.“
Noch vor vierundzwanzig Stunden hätte ich mich heftig gegen eine Übernachtung in diesem Sanatorium gewehrt, aber jetzt kommt mir der längere Aufenthalt sehr gelegen, da er mir die Möglichkeit gibt, mich mit diesem obskuren Todesfall (denn ich bin überzeugt, eine Tote gesehen zu haben) zu beschäftigen. Um die Zeit zu nützen, bevor mein Liebhaber mit den Kaffees erscheint, gehe ich bei Moni sofort in medias res:
„Sag mal, wer ist denn da heute bei euch verstorben und an was? Ich hab mitgekriegt, dass man eine Leiche abtransportiert hat. Kommt hoffentlich nicht allzu oft vor.“
„Wieso Leiche? Habe nichts davon gehört. Eine von meinen Patientinnen war’s jedenfalls nicht.“
„Oh doch, als ich aus dem OP geschoben wurde, habe ich beobachtet, wie eine Bahre …“
Meine Kollegin unterbricht mich: „Liebe Frau Doktor Liebekind-Spanneck! Wir sind hier immerhin in einem Spital, auch wenn es ‚nur‘“ – das „nur“ setzt sie gestisch unter Anführungszeichen – „… wenn es ‚nur‘ ein Wohlfühlsanatorium für gut situierte Damen der Wiener Oberschicht zu sein scheint. Auch hier wird unerlaubterweise gestorben. Auch wenn du das nicht für möglich hältst.“
„Ich dachte hier gibt’s hauptsächlich IVF8 und Geburten?“
„Na, hier und da verirrt sich schon auch mal was Gröberes hierher“, und leicht gekränkt: „Stell dir vor, meine Kollegen und ich können auch ein Karzinom behandeln.“
Ich verdrehe die Augen und bemerke entschuldigend: „So hab ich es doch nicht gemeint. Ich zweifle doch nicht an eurer Kompetenz. Würd’ ich sonst da liegen?“
Das versöhnt sie und nachdenklich bemerkt sie: „Das täte mich aber auch interessieren, ob da was passiert ist?“
„Wenn du was erfährst, dann sagst es mir bitte … nur aus Neugierde. Eure Hauspsychotherapeutin behauptet jedenfalls, es gäbe keinen Todesfall.“
„Der Trampel! Wieso war die bei dir? Bei meinen Patienten hat die Hausverbot.“
„Das Verbot scheint aber nicht eingehalten zu werden. Bei mir war sie soeben, um mit mir den Abschied von den Zellen, die du herausgeschabt hast, zu verarbeiten.“
„Das kann nicht sein! Da musst du sie angefordert haben.“
„Ich nicht, aber ich denke, der Kindesvater.“
Gerade als die Rede auf Michael kommt, wackelt er, drei Kaffees im Pappbecher aus dem Automaten balancierend, bei der Tür herein. Ich merke ihm an, dass er erleichtert ist, nicht weiter über unseren verlorenen Embryo trauern und mir deshalb auch noch hilflos tröstend bei meiner „Trauerarbeit“ zur Seite stehen zu müssen.
Es gibt schwangere Frauen, die ab dem Ausbleiben der Mensis eine mütterliche Bindung zu diesem Baby in statu nascendi aufbauen. Meiner Meinung nach ist diese „Beziehung“ wohl eher die Zuneigung zu einem Wunschgedanken, nämlich dem des Erschaffens eines halbgöttlichen Kindes. Eine echte Bindung zu einem Lebewesen bedarf des realen Vorhandenseins desselben – zumindest am Foto im Ultraschall.
Mein Liebhaber schafft es, meiner Kollegin und mir, ohne uns anzukleckern, den Pappbecher zu überreichen. Frau Dr. Altenfelder schenkt ihm dafür ein aufreizendes Lächeln, dessen Bedeutung – nämlich: „Du bist aber ein attraktiver Mann“ –, er aber nicht kapiert.
Das liebe ich an meinem Michael: seine Naivität, sein leutseliges Wesen, seine Unschuld. Kaum zu glauben, dass man mit Ende zwanzig noch immer so wie ein Traummännlein ohne jegliche Antenne für Zweideutigkeiten durchs Leben gehen kann. Immerhin fasse ich ihr Flirtangebot an ihn als Kompliment für mich auf, denn er ist mein Freund und Liebhaber. Das eigene Ansehen steigt ja durch einen attraktiven Partner ebenfalls!
Monika ist, soweit mir bekannt, momentan unbemannt und wie andere erfolgreiche, fesche Frauen damit in der tragischen Situation, dass das Angebot an adäquaten Bettgenossen verdammt dünn ist. Da nützen alle Dating-Portale nichts, die eine Elite an Akademikern oder sonst wie gehobenen Gentlemen anbieten. Männer Mitte vierzig sind entweder vergeben oder haben ein Bindungsproblem. Darum fühle ich mich mit meinem über ein Jahrzehnt jüngeren Modell plötzlich wieder sehr gut bedient.
Mit Michael in unserer Runde blüht meine Kollegin, trotz Kaffee mit (!) Milch, auf.
„Und was machen Sie beruflich?“, zirpt sie ihn mit zur Seite gelegtem Köpfchen an.
Erstaunlich, wie schnell sich taffe, selbstbewusste Frauen angesichts eines begehrenswerten Männchens in dümmlich unterwürfige Weibchen verwandeln. Eine archaische Verhaltensweise, die noch aus unseren evolutionären Urzeiten stammt, als bei der Wahl des Sexualpartners das schmiegsame Geschlechterverhalten einen Benefit gebracht hatte.
„Ich bin Schriftsteller …“
Schriftsteller ist ein herrlicher Beruf, denn man muss nie beweisen, dass man auch wirklich was zustande bringt. Zumindest ist es bei meinem Liebhaber so. Er befindet sich ständig in einer schöpferischen Phase, die aber so schöpferisch zu sein scheint, dass er dabei nichts oder kaum etwas zu Papier bringen kann. Zurzeit arbeitet er an einem Krimi. Mir kommt aber vor, dass sich der Mord noch lange hinziehen wird. Soviel ich weiß, erfreut sich seine Leiche noch immer ihres Lebens und wartet auf den Mörder. Tja, sich gleichzeitig gedanklich auf Vaterfreuden vorzubereiten und dann noch Platz im Kopf für eine Geschichte zu haben, geht anscheinend gar nicht.
Frau Dr. Altenfelder ist aber beeindruckt. Mit derselben Hochtonstimme wie zuvor flötet sie: „So wirken Sie auch auf mich. Ich hätte sofort vermutet, dass Sie ein kreativer Mensch sind.“
Ich werfe ein, auch um noch wahrgenommen zu werden: „Woran siehst du das?“, immerhin bin ich hier ihre Patientin.
Sie blickt mich verständnislos an: „Was?“
„Na, du hast doch gerade behauptet, dass du …“, dabei ahme ich ihre flötende Stimme nach, „… dass du erkennst, dass Michael kreativ ist.“ Sie schüttelt mitleidig den Kopf: „Ein Gefühl für Menschen, liebe Alma. Das Gefühl für Menschen.“
Ich hüte mich davor, weiter zu bohren, was es mit so einem Gefühl auf sich hat, sondern versuche, das Thema wieder auf die verborgene Leiche zu bringen. Ich bin mir sicher, dass da was nicht stimmt: der Lieferwagen, die konsternierte Psychotherapeutin.
„Erkundigst du dich? Weißt, es interessiert mich einfach! Schon deshalb, weil ich ja auch Patienten schicke und da hat man sonst so ein Geefüüühl der Unsicherheit, man füühlt sich ja verantwortlich für die Patientinnen.“
Zum Glück ist mein beinahe Kindesvater nicht weiter an unserer Konversation interessiert, sondern blättert gelangweilt in einer Frauenzeitschrift, die zur Aufheiterung der Leidenden unentgeltlich aufliegt. Da Michael sich offensichtlich nicht als Kandidat für ein erotisches Abenteuer anbietet, steht meine Kollegin abrupt auf, zielt mit ihrem Pappbecher in den Mistkübel, trifft exakt, stemmt sich dann auf mein Bettgitter, nimmt pro forma mein Patientenblatt in die Hand, um ihre medizinische Funktion zu demonstrieren und verabschiedet sich dann: „Bei dir ist alles ok. Wenn was ist, ruf mich an. Meine Handynummer hast ja. Und … du, ja, ich werde mich erkundigen, was da passiert ist.“
Dann gibt sie mir noch einen flüchtigen Luftkuss auf jede Wange. Michael winkt sie jetzt teilnahmslos zu: „Viel Erfolg! Wiedersehen.“
Als sie draußen ist, wird mir schlagartig bewusst, dass ich entgegen meiner Ansicht, dass ich nie eifersüchtig bin, gerade jetzt ein abscheuliches Beispiel von Zickenkrieg abgegeben habe. Dafür verachte ich mich! Das muss die Nachwirkung der Narkose sein, tröste ich mich, oder hat die Tatsache, diesen Embryo nicht austragen zu können, an meinem weiblichen Selbstbewusstsein geknabbert? Ist ja auch ein Hinweis auf mein biologisches Alter. Und vor mir im Stuhl knotzt9 ein jugendliches Exemplar von erwiesen strotzender männlicher Potenz.
„Komm her“, locke ich ihn, um mich zu vergewissern, dass er nur mich, ausschließlich mich liebt. Michael erhebt sich gehorsam aus seinem Sessel und nimmt an der Stelle auf meiner Bettkante Platz, die ich mit einem Klopfen markiere. Ich strecke ihm meine Hand hin, die er behutsam mit seiner umschließt.
„Du hättest dir das Baby gewünscht, oder?“
Er nickt: „Ja, ein Mädchen, rothaarig, mit Locken. Du doch auch?“
War ich noch vor einer Stunde erleichtert, dass mir die Mutterrolle erspart geblieben ist, so merke ich, dass sich doch ein paar Tränen im Augenwinkel nicht zurückhalten lassen.
„Hm, ja und nein.“
Er entzieht mir seine Hand. Erbost steht er von der Bettkante auf. Seine bisher friedliche Stimme wechselt in einen strengen Ton: „Du bist selber schuld. Als du eine Schwangerschaft vermutet hast, hättest du dich sofort schonen müssen. Aber nein, zu wenig Schlaf, Stress – eben Ignoranz. Mir hast du deinen Zustand ja verschwiegen. Ich wäre nie mit dir auf die Kanalinseln geflogen, wenn ich gewusst hätte, wie es um dich steht. Es war auch mein Kind!“
Immerhin hat er es mit seinen Vorwürfen geschafft, meine Sentimentalität in Zorn umzuwandeln: „Wie kommst du dazu, mir Vorwürfe zu machen? Dein sogenanntes Kind war kein Baby, sondern nur die Idee eines Kindes. Wenn du Vater werden willst, dann werde doch selber schwanger. Mir reicht’s. Apropos, hast du dir eigentlich überlegt, dass zum Vatersein auch eine gesicherte Existenz gehört, dass es nicht damit abgetan ist, romantische Vorstellungen zu haben? Typisch du, bringst nichts auf die Reihe, aber mir Vorwürfe machen.“
Das war zu viel. Er dreht sich um und haut ab. Nachdem er die Tür lautstark zugeworfen hat, bekomme ich einen hysterischen Heulkrampf – sicher vom Propofol.
Nachdem die erste Welle an idiotischer Verzweiflung abgeebbt ist (ich weiß eigentlich gar nicht, weshalb ich heule), beschließe ich aufzustehen und eine kleine Runde im und um das Krankenhaus zu machen. Bewegung hilft mir immer, mich zu erden.
Zum Glück hat mir Mutter meinen dicken Frotteebademantel mitgebracht, denn sonst wäre ich mit meinem nach rückwärts offenherzigen OP-Kostüm ans Bett gefesselt. Warm eingewickelt, mit den Stützstrümpfen gegen eine eventuelle Thrombose an den Beinen, schlurfe ich unsicher in den hauseigenen Pantoffeln den Gang entlang, bis ich zur Stiege komme, die zur Cafeteria im Parterre führt. Mangels Bargelds kann ich mir dort zwar kein Getränk leisten, aber der Anblick von ein paar fremden Leuten wird mich meiner Krankenhausdepression oder -psychose entledigen. Außerdem dürfte da auch die Toilette sein, von der aus Mutter den Lieferwagen beobachtet hat. Ich setze mich an einen leeren Tisch nahe beim WC. Im Lokal ist außer mir nur noch ein Pärchen, das lustlos an seinem Apfelsaft gespritzt nuckelt. Da sonst bis auf das Gläserklappern der Frau an der Schank kein Geräusch die trostlose Idylle stört, schnappe ich die gedehnte Kommunikation der beiden auf.
Er seufzt: „Tut mir leid, aber ich kann nicht.“
Sie öffnet ihre Handtasche und steckt ihm verschämt eine Zeitschrift zu: „Mit dem wird’s schon gehen. Kannst dir Zeit lassen. Weißt eh, ist halt so weit.“
Oh je, ein IVF-Pärchen! Das Ejakulieren auf Befehl bekommt dem Liebesleben dieser Paare meist gar nicht gut. Da helfen oft alle unterstützenden Animationsmaterialien nichts.
Er schiebt ihr die Illustrierte wieder über den Tisch zurück: „Behalte es, ich werde es schon schaffen. Vor den Fotos graust’s mir schon.“
Die junge Frau hängt wie ein Häufchen Elend über der Tischplatte, als ihr die Tränen hervorschießen: „Ich schwör’s. Es ist das letzte Mal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lassen wir’s. Versprochen!“
Der Samenspender hebt die Hand, um der Kellnerin zu winken.
Die blickt von ihrem Tresen auf: „Bitte?“
„Einen Cognac.“
Die prospektive Kindesmutter blickt ihn mit roten Augen strafend an: „Bitte nicht, du weißt doch, schlecht für die Samen …“
Daraufhin schreit er durch die Cafeteria: „Zwei Cognacs“ und sie schluchzt laut auf.
Das scheint für mich endgültig der richtige Zeitpunkt zu sein, diesen aufheiternden Ort Richtung Toilette zu verlassen.
Und tatsächlich: Vom Fenster im Vorraum aus sieht man auf den Hof.
Und tatsächlich: Da parkt ein Lieferwagen, beschriftet mit „Hygieneputz“.
Und tatsächlich: Der Wagen scheint kurz zuvor gefahren worden zu sein, da weder Schnee noch Eis auf der Windschutzscheibe klebt.
Und da bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig, als tatsächlich den Tatsachen nachzugehen.
Also überprüfe ich, ob die Tür, die anschließend an den WC-Block nach draußen zu führen scheint, offen ist. Ist sie. Trotz eisiger Kälte, es ist ja gerade erst Ende Jänner, schlurfe ich mit meinen Frotteepantoffeln in den Hof. Der ist gerade so groß, dass zwei Lieferwagen darin parken können. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bettentrakts steht das Versorgungsgebäude des Sanatoriums mit Küche, Labor etc. Das erkenne ich daran, dass es keineswegs so repräsentativ hergerichtet ist wie der Gebäudeteil mit den Krankenzimmern. An manchen Stellen bröckelt sogar der Verputz ab. Außer der Tür, durch die ich in den Hof gelangt bin, gibt es keinen Ausgang vom Bettentrakt, während ins Werksgebäude drei Eingänge führen. Ich blicke hoch, um zu sehen, ob man mich von oben beobachten kann. Aber die Fenster des Krankentrakts im ersten Stock sind aus undurchsichtigem Glas und scheinen zum Operationssaal zu gehören. Die Versorgungseinheit ist ein Flachbau, der sich anscheinend weit in den Garten nach hinten erstreckt. Sicher gibt es zu diesem noch eine Zufahrt von hinten, denn die Einfahrt des Hofs zur Straße ist zu schmal für einen LKW.
Auf Zehenspitzen (der Boden ist verdammt kalt) schleiche ich zur ersten Tür. Verschlossen. Die zweite ist offen, führt aber nur zur Küche, was ich dem Geruch und dem Geräusch von Geschirrspülern entnehmen kann. Die dritte führt zum Labor, leicht erkennbar, da an der Tür ein Schild mit „Eintritt nur für Laboranten“ aufgeklebt ist. Ich sehe davon ab hineinzuschauen, da ich nicht gern entdeckt werden möchte. Eigentlich interessiert mich nur das, was hinter der ersten, der verschlossenen Tür steckt. Da meine Zehen schon eingefroren sind, verschiebe ich meine weiteren Nachforschungen auf die kommende Nacht. Da kann ich mir vorsorglich auch Socken und Stiefel anziehen.
Nach meinem kalten Spaziergang erfreut mich mein warmes Krankenbett und ich gönne mir einen Nachmittagsschlaf, der, unterstützt von den Nachwirkungen der Narkosemedikamente, lang und erquicklich ausfällt. Als ich aufwache, ist es draußen finster und die Schwester bringt mir bereits mein Abendessen. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es fünf ist. In einem Krankenhaus wechseln um diese Zeit Tag- und Nachtdienst. Im Spital gehen die Uhren vor: Frühstück um halb sechs, Mittagessen um elf und Abendessen eben um fünf.
Ich nippe an dem scheußlich übersüßen Tee und lasse das restliche Mahl unberührt stehen, da ich noch einen flauen Magen habe. Als der Abenddienst hereinkommt, um abzuservieren und mir eine Schlaftablette anzubieten, nehme ich diese dankend an. Die Nachtschwester soll sich sicher sein, dass sie in mir eine wunderbar eingestellte Patientin haben wird, die sie nicht weiter kontrollieren muss. Ich unterstreiche meine Absicht, tief zu schlummern, indem ich die Pille sogleich in den Mund stecke: „Gute Nacht! Ich freue mich, mal richtig ausschlafen zu können! Sonst geht sich das sowieso nie aus!“
Befriedigt verlässt die Pflegerin mein Zimmer: „Wenn S’ was brauchen, läuten’S, gute Nacht.“
Die schaut sicher nicht mehr nach mir, denke ich, während ich die Tablette in den Mistkübel spucke. Jetzt muss ich nur noch warten, bis sie sich in ihr Dienstzimmer zurückzieht. Erfahrungsgemäß dauert es auf so einer Station bis neun, bis endgültig Ruhe eingekehrt ist und ich ungesehen Richtung Innenhof schleichen kann. Damit ich, falls ich entdecke werde, keinen Argwohn errege, verstecke ich meine Stiefel unter meinem Schlafrock und fixiere sie mit dem Gürtel so, dass es wie ein Babybauch ausschaut. Die Schuhe werde ich erst im Hof anziehen.
Vorsichtig kontrolliere ich beim Verlassen meines Zimmers, ob die Luft rein ist. Ja, der Nachtdienst sitzt im Dienstzimmer und schaut auf den Bildschirm. Zum Glück liegt der Stiegenabgang so, dass er von der Schwester nicht eingesehen werden kann. Alles ruhig, ich steige leise die Treppe hinunter, öffne die Tür zur Cafeteria, die unversperrt ist, und erreiche unbehelligt das Tor, das nach draußen führt, leider verschlossen. Vielleicht kann ich durchs WC in den Hof gelangen? Immerhin liegt es ja im Parterre.
Als ich in der Toilette im Dunkeln versuche, das Fenster zu öffnen, höre ich, wie ein Auto in den Hof fährt. Da ich mich nicht direkt vor die Scheibe stellen kann, muss ich, meinen Nacken verrenkend, versuchen, den Hof im Visier zu behalten. Leider versperrt mir der Wagen – ebenfalls mit der Aufschrift „Hygieneputz“ – einen Teil der Sicht. Trotzdem kann ich beobachten, wie zwei Männer eine Bahre mit einer Frau aus dem Wagen heben. Die Patientin trägt ein Kopftuch und ist hochschwanger, denn unter der Decke wölbt sich ein voluminöser Bauch, den sie mit beiden Händen hält. Anscheinend hat sie Wehen, denn sie jammert laut, bis ihr einer der Männer den Mund zuhält und ihr in einer Sprache, die ich nicht verstehe – vermutlich Arabisch –, herrisch verständlich macht, dass sie ruhig sein soll. Daraufhin höre ich nur mehr stoßartige Atemstöße, wie man sie von sich gibt, wenn man schluchzt. Die Herren mitsamt der Gebärenden werden anscheinend schon erwartet, denn die verschlossene Tür, deren Geheimnis dahinter ich erkunden wollte, öffnet sich und ein distinguierter mittelalterlicher Mann – wohl ein Arzt – nimmt die drei in Empfang. Als sich das Tor hinter den Herrschaften geschlossen hat, ist der Hof wieder finster und ruhig, dafür geht im Labor das Licht an und ich kann hinter der Milchglasscheibe schemenhafte Umrisse von Menschen erkennen.
Ich habe genug beobachtet und ziehe mich mitsamt meinem Stiefelbauch wieder aus dem Klo und der Cafeteria zurück. Gerade als ich über die Stiege wieder in mein Zimmer schleichen möchte, überholt mich meine Nachtschwester, die ihrer Ausdünstung nach zu schließen gerade vor dem Haus geraucht hat.
„Hab nur schnell was geholt“, meint sie verlegen und bemerkt erst jetzt meinen Bauch: „… ich dachte … Sie sind doch die mit dem Abortus?“ Ich streiche über meinen Schlafmantel: „Hat sich noch nicht zurückgebildet … und … muss abnehmen.“
Mit diesen Erklärungen lassen wir es bewenden, denn sie fürchtet eine Beschwerde meinerseits wegen ihres unerlaubten Verlassens der Station und ich lege keinen Wert auf Fragen darüber, was ich im Untergeschoss zu schaffen habe. Während dieses kurzen Intermezzos fällt mein Blick zufällig auf das Schild, auf dem unter dem Namen des Betreibers des Sanatoriums, der Femcura GesmbH, die Inhaber der leitenden Funktionen aufgelistet sind. Die waren mir bisher nicht bekannt und ich habe mich auch nicht für sie interessiert.
Ärztliche Leitung: Univ.-Prof. Prim. Dr. Walter Ehrenschweizer
Pflegedienst Leitung: OSR Waltraud Weiser
Psychiatrischer Konsiliardienst: Hofrat Dr. Werner Würzl10
Dann noch die Auflistung aller Belegsärzte und Anästhesisten.
Das gibt es doch nicht! Der Würzl! Wenn ich schon bisher beinahe überzeugt war, dass in diesem Krankenhaus dubiose Dinge geschehen, so bin ich nun gewiss. Überall, wo der Würzl seine Finger im Spiel hat, geht es nicht ehrlich zu. Und wozu einen polizeiärztlichen Psychiater in einer Gebärklinik? Was für Machenschaften ermöglicht er als Hofrat?
Den Rest der Nacht schlafe ich, wie der Schwester versprochen, tief und fest, auch ohne Tablette. Monika kommt schon um sieben und weckt mich: „Hoppauf, kannst heimgehen.“
Noch völlig verschlafen zwinge ich mich, meine Lider zu öffnen und mich zu orientieren. Klar: Curettage, Dr. Altenfelder, Sanatorium … und dann fällt mir sogleich die Leiche ein und ich bin sofort putzmunter. Ich setze mich auf, strecke meine Beine querbett hinaus, straffe meinen Rücken und tue so, als ob ich schon ewig auf meine Entlassung gewartet hätte.
„Gott sei Dank, nur weg!“, kommentiere ich mit nachtschlafen rauer Stimme. Dann hüpfe ich aus dem Bett, ohne auf mein nicht gesellschaftsfähiges Kostüm zu achten. Als mir dieser Anblick bewusst wird, raffe ich die zwei Enden des Nachthemds zusammen und setze mich auf die Bettkante darauf.
„Vor mir brauchst dich nicht genieren, das ist mein täglicher Anblick. Der weibliche Unterleib ist mein Revier.“
Ich nicke: „Trotzdem.“
Moni reicht mir meinen Bademantel: „Da!“
„Danke! Hast was wegen der Toten erfahren?“
Meine Kollegin schüttelt den Kopf: „Nichts, da ist niemand gestorben. Vielleicht hast das nur halluziniert?“
Ich traue mich nicht, ihr von Mutters Beobachtungen zu erzählen, schon gar nicht von meinen nächtlichen Forschungen. Wer weiß, lässt sie mich dann nicht nach Hause, bevor sie einen psychiatrischen Konsiliarbefund vom Würzl hat? Möglicherweise vermutet sie dann, dass ich ein persistierendes Durchgangssyndrom habe. Besser den Mund halten.
„Vielleicht. Egal, jetzt bin ich wieder auf dem Damm.“
„Gut! Die Schwester bringt dir gleich die Entlassungspapiere. Sonst … bitte kein Sport für vierzehn Tage und …“, sie lächelt vielsagend und hebt dabei drohend ihren Zeigefinger, „… keinen Geschlechtsverkehr für, sagen wir, einen Monat.“
Ich schüttle den Kopf: „Das meinst nicht ernst? Vierzehn Tage ist Standard, soweit ich mich erinnern kann.“
Monika zuckt mit der Schulter: „In deinem Fall ein Monat. Das hängt von den Umständen ab. Und weil ich deinen Liebhaber kennengelernt hab, braucht dein Unterleib einen Monat Schonung.“
„Möchtest ihn dir leicht für die Zeit ausborgen … hm?“
„Wenn’s nicht der deine wäre, würde ich das Angebot annehmen.“
„Gut, dann drei Wochen!“
Dr. Altenfelder lacht: „Schmäh ohne11! Bitte pass auf, Nachblutungen gibt’s immer.“
„Danke! Du hast die OP gut gemacht. Bekommst von mir fünf Punkte auf der Ärztebewertungsseite.“
„Bitte nicht. Ich hasse diese Kommentare.“
„Ich auch, war nur Spaß. Trotzdem, darf ich dich auf ein Abendessen einladen? Meldest dich, wenn du Zeit und keine Geburt hast, hm?“
Moni küsst mich auf die linke und die rechte Wange, diesmal ehrlich.
Während ich auf die Entlassungspapiere warte, kleide ich mich an. Soll ich den Manfred wegen der Leiche anrufen? Oder die Erika? Keine gute Idee, von denen erfahre ich sicher nichts. Also fällt mir ein, dass ich mich ja bei Joschi Ameling erkundigen könnte, ob er eine Frauenleiche zu Gesicht bekommen hat oder ihm von der Pathologie etwas darüber zu Ohren gekommen ist.
Also ruf ich ihn an: „Hallo, da ist die Alma. Wie geht’s dir?“
„Die Alma? Lang nichts von dir gehört. Du rufst auch nur an, wenn du was brauchst.“
„Stimmt nicht. Ich wollte dich gerade fragen, ob du auf ein Bier mit mir gehst?“
Joschi ist ein exzessiver Biertrinker, der wohl keine Gelegenheit auf ein legitimes Seidel auslassen wird. Genauso ist es: „Na ja, wenn ich’s mir so überlege, bald ist Mittag. Die Arbeit rennt nicht davon … ha, ha, ha und du, mit dir ist es so quasi eine Besprechung. Also wenn ich mir’s so überlege, dann geht sich das aus.“
„Das passt! Fein! Treffen wir uns wieder im ‚Colloseum‘12?“
„Da geh ich nicht mehr hin. Die Franzi spinnt.“
„Hm? Wer ist die Franzi?“
„Geh, du kennst doch die Franzi, die Wirtin.“
Ich hüte mich, noch weitere Fragen bezüglich der „Franzi“ zu stellen, denn die Schwester mit den Entlassungspapieren steht ungeduldig auf den Zehenspitzen tänzelnd da und möchte mich loswerden. Also kürze ich unser Gespräch insofern ab, als ich diktatorisch ins Telefon schreie: „Um eins im ‚Landsknecht‘! Weißt, wo das ist?“
„Klar, da geh ich jetzt auch oft hin.“
„Servus, baba …“ und ich lege auf.
Verlegen lächelnd zucke ich mit der Schulter und entschuldige mich bei der Schwester: „Ein Patient!“
Die erwidert mit einem ungläubigen Blick: „Aha!“ und drückt mir die Papiere in die Hand. „Die Frau Doktor wird Ihnen ja schon gesagt haben, wie man sich zu verhalten hat nach einer Curettage …“
Ich nicke: „Ich weiß alles, Schonung etc.“
Dann gibt sie mir die Hand und verlässt das Zimmer. In diesem Augenblick fällt mir ein, dass ich kein Trinkgeld geben kann – Kaffeekasse heißt das bei den Schwestern –, weil ich nichts Bares dabei habe. Die werden sich schön das Maul über die geizige, arrogante Frau Doktor zerreißen. Hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Deshalb mache ich noch einen Sidestep vorbei am Schwesternzimmer und deponiere meine Absicht, ein anderes Mal „was für die Kaffeekasse“ vorbeizubringen. Ich vermute, dass ich in naher Zukunft noch einmal in diesem Sanatorium vorbeischauen muss.
Mangels Bargelds kann ich mir nicht einmal ein Taxi leisten und beehre meine Lieblingsstraßenbahnlinie, den D-Wagen. Das Sanatorium liegt nämlich in der Sickenberggasse im 19. Bezirk, nicht weit von der Heiligenstädterstraße, wo der D-Wagen fährt. Ich steige am Schlickplatz aus, von wo es nur ein paar Schritte die Porzellangasse hinauf zum „Landsknecht“ ist. Gegenüber dem Lokal gibt es zum Glück einen Bankomaten, sonst hätte mich womöglich noch der Joschi einladen müssen.
Im Gasthaus lehnt der Joschi schon an der Schank, ein Krügel in der Hand. Als er mich sieht, umarmt er mich und drückt mir ein biergeschwängertes Busserl auf die Wange. Pfui, Teufel! Und das bei meinem noch etwas empfindlichen Magen.
Der Ameling ist ein herzensguter, wenn auch geistig etwas minderbemittelter Mensch. Dass der Alkohol seine Hirnkapazitäten nicht verbessert, sondern leider noch zusätzlich reduziert, stört den Joschi nicht. Als pragmatisierter Beamter kann ihm auch niemand deswegen auf die Zehen steigen. Soviel ich weiß, versuchte jeder seiner Vorgesetzten ihn zu einem anderen Kollegen wegzuloben. Das ist aber nun nicht mehr weiter möglich, da er alle Abteilungen durch hat. Mein Freund Manfred Marchel hatte das Pech, der Letzte in der Reihe der möglichen Chefs zu sein. Auf der Gerichtsmedizin ist auch für einen Ameling Endstation.
„Gut schaust aus“, lobe ich ihn. Das Kompliment ist nicht geschwindelt, denn Joschi hat seine über hundert Kilo tapfer erhalten und anscheinend sogar vermehrt. Die Zweideutigkeit meiner Ansage kriegt er nicht mit, denn er klopft sich auf den Bauch und meint zufrieden: „Tja, es soll mir nie schlechter gehen“, dann wiegt er seinen Kopf und mustert mich unzufrieden von oben bis unten: „Du aber nicht … Blass bist und ungesund. Ich tät dir schon ein paar Kilo überlassen.“
„Danke, aber mir geht’s gut. Ehrlich, nur zu wenig Schlaf. Aber was anderes, was macht dein Job?“ Der Ameling nickt nachdenklich: „Passt alles, der Marchel ist der Beste bisher. Der hetzt wenigstens nicht. Außerdem sind unsere Leichen meistens sowieso schon länger abgelegen und da macht ein Tag auf oder ab, bis sie aufgemacht werden, auch nichts. Mir gefällt’s da.“
„Dann hast viel Freizeit? Und die Liebe?“ Ehrlich gesagt interessiert mich Joschis Privatleben gar nicht, aber um ihn um den Finger zu wickeln, muss ich wohl Anteilnahme heucheln.
In der Zwischenzeit bestelle ich mir einen Tee mit Milch, was meinen Gesprächspartner darin bestätigt, dass mit mir etwas nicht stimmt.
„Hab ich doch gewusst, dass du krank bist.“ Und dann mitfühlend: „Du brauchst jemanden, der sich um dich kümmert. Ich tät mich anbieten.“
Ich lege meine Hand beruhigend auf seinen Arm: „Alles bestens. Keine Sorge. Aber du, ein Bier schon zu Mittag? Habt ihr keine Kundschaft?“
„Oh ja, doch. So ein armes Mäderl, erstochen. Die kommt aber erst um vier dran. Vorher hat er keine Zeit.“
„Wer er?“
„Der Chef. Außerdem ist eh alles klar. Ehrenmord. Der Bruder hat sie erstochen. Stell dir vor, während der Entbindung. Weil … das Kind war ledig. Diese … diese … na, diese Migranten! Ich tät die Männer von denen alle heimschicken oder, noch besser, erst gar nicht reinlassen. Nur die Frauen und Kinder. Und dann tät ich den Frauen gleich das Kopftuch wegnehmen und …“
Ich unterbreche ihn, bevor er ausufernd seine rechte, wenn auch in einigen Punkten sicher ganz vernünftige Meinung verbreitet: „Das ist ja entsetzlich. Und das Kind?“
„Das Kind lebt. War zufällig ein Gynäkologe im Flüchtlingsheim, der hat rechtzeitig einen Kaiserschnitt gemacht, bevor das Mädel abgekratzt ist.“
1kurzzeitige organische oder symptomatische psychische Störung nach einer Narkose
2Kurznarkosemedikament
3So ist es.
4Botenstoff im Gehirn
5Schlaf heilt alles.
6konsterniert, betreten
7sprachlos
8künstliche Befruchtung
9lümmelt
10Dr. Werner Würzl: Polizeiarzt und Almas Feind
11ernsthaft
12Gasthaus auf der Nußdorferstraße in Wien
2. Kapitel
Ehrenmord in einem Flüchtlingsheim, nicht in meinem eleganten Sanatorium! Also umsonst mit Joschi an der Theke lehnen, statt gemütlich bei mir zu Hause im Bett eine Zeitung lesen, wie es sich für eine Rekonvaleszente gehört. Aber wenn ich schon da bin, dann möchte ich auch etwas über die Tote erfahren. Vielleicht gibt es doch eine Verbindung zur Leiche im Krankenhaus? Hatte nicht die gebärende Frau, die ich in der Nacht beobachtet habe, auch ein Kopftuch auf? Und was sollte die in so einem teuren Sanatorium, noch dazu eingeliefert mit einem Klein-LKW über den Hintereingang statt durch das repräsentative Hauptportal? Haben das Heim und die IVF-Klinik etwas miteinander zu tun – „geschäftlich“, mit dem Würzl als „Geschäftsführer“?
„Was für ein Heim ist das?“, frage ich den Ameling, mäßig interessiert tuend, obwohl mich die Neugierde schon heftig quält.
„Keine Ahnung, wie das heißt, ist irgendwo auf der Heiligenstädterstraße, da beim Karl-Marx-Hof.“
„Und weißt auch, wie das arme Mädel geheißen hat?“
Der Joschi wiegt bedächtig seinen Kopf und kneift seine Lippen zusammen: „Also ehrlich, so einen Namen kann sich doch keiner merken,“ Dann beginnt er plötzlich laut zu lachen: „Also, Mohamed heißt sie nicht, ha, ha, ha.“
„Vielleicht kannst, wenn du wieder im Institut bist, nachschauen und mir dann ein SMS schicken?“
Der Ameling senkt seinen Kopf und blickt mich von unten misstrauisch an: „Ich bin nicht so blöd, wie du denkst. Da ist doch was … du wolltest doch gar nicht … Ich meine, dass du mich angerufen hast, das war doch nur, weil du was von mir wissen willst.“
Ich lege ihm meine Hand beruhigend auf die Schulter: „Das stimmt nicht! Ich wollte dich wiedersehen. Aber wenn du solche aufregenden Sachen erzählst, dann bin ich eben neugierig. Ist ja spannend, wenn einer, der unmittelbar mit einem Ehrenmord zu tun hat, erzählt. Sonst liest man so was nur in der Zeitung. Und du … du kennst so einen Fall in echt.“
Das schmeichelt ihm und er ist wieder versöhnt.
„SMS kann ich nicht, aber telefonieren. Trinkst jetzt auch ein Bier mit? Ich lade dich ein.“
„Nein, das ist sehr lieb, aber ich darf nicht“, dabei greife ich mir auf den Magen, „Gastritis.“
Joschi mustert mich von oben bis unten: „Sag ich‘s ja, du schaust schlecht aus.“ Dabei zwickt er mich mit seinen Würstelfingern sanft in beide Wangen: „Bei mir tät’st schnell zulegen. Ich tät dich schon auffüttern.“
Vor meinen Augen erscheint ein Bild: Ich mampfend13, während mir der Joschi mit einer Hand eine Käsekrainer in den Mund schiebt, mit der anderen ein Krügel Bier zum Nachtrinken an die Lippen führt. Tja, es gibt auch eine gut gemeinte Art der Folter!
Die stickige Luft und das Blut, das durch das lange Stehen in meine Beine versackt, verursachen in meinem Kopf eine Blutleere und ich merke, dass ich einer Ohnmacht nahe bin. Deshalb klammere ich mich mit einer Hand am Tresen fest, mit der anderen an Amelings Winterjacke. Das empfindet er als reizvollen Annäherungsversuch und umarmt mich, was immerhin verhindert, dass ich umkippe.
„Ich muss an die frische Luft“, flüstere ich und lehne mich noch fester an ihn, was zur Folge hat, dass er mir seinen Bieratem direkt in meine Nase bläst.
„Wirklich …“, flehe ich.
„Was ist?“
„Mir ist schlecht, bitte bring mich raus.“