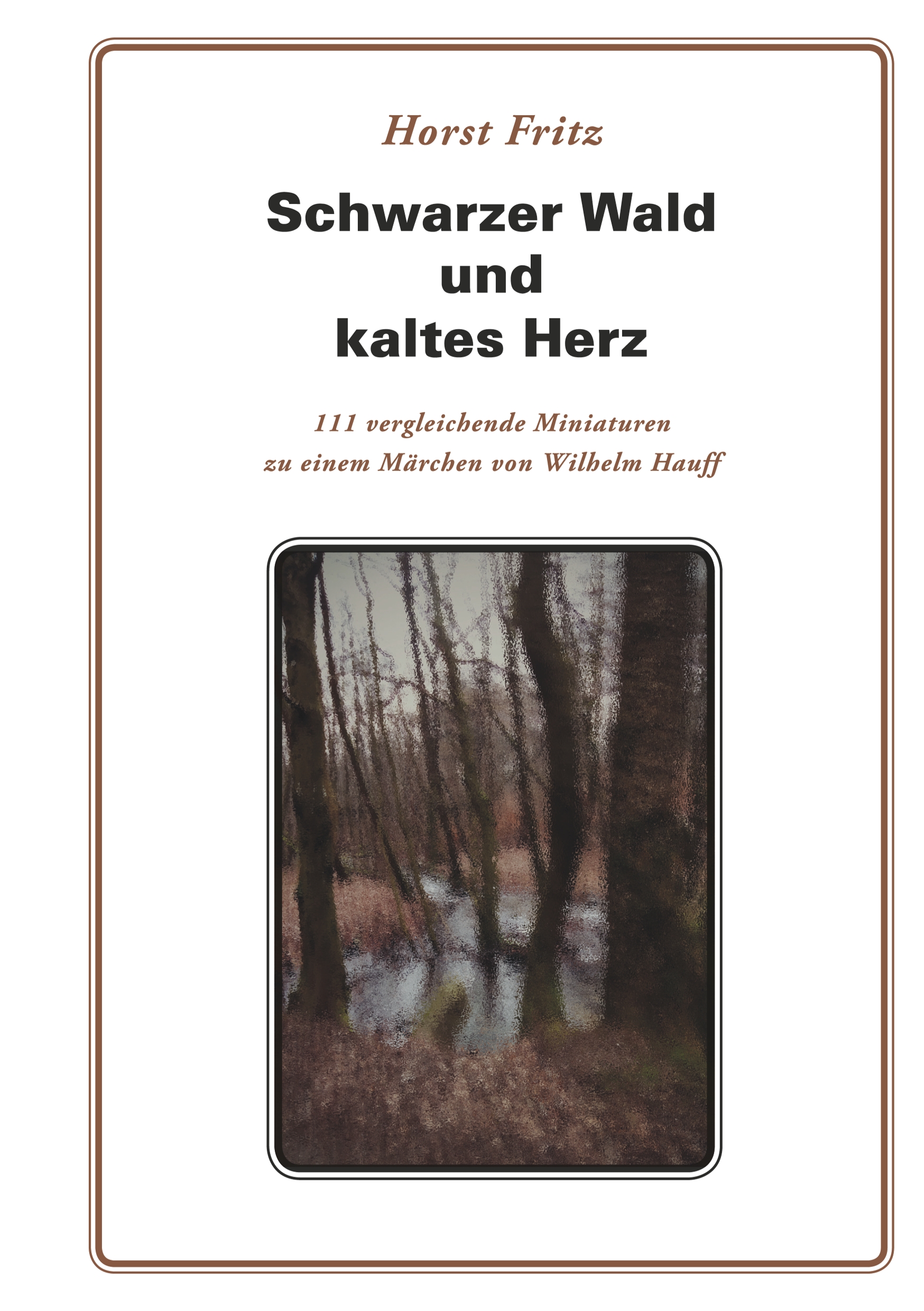Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer sich aufs Geld versteht,
Versteht sich auf die Zeit,
Sehr auf die Zeit!
Goethe, Zahme Xenien
Das E-Book Versteckt - Verbrannt - Verschenkt wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Komparatistik, Kapitalismus, Geldwirtschaft, Moderne, Kritik
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Entfesselung des Geldes. Eine Art Einleitung
Ludwig Bechstein:
Der beherzte Flötenspieler
Erlösung dem Erlös
Friedrich Hebbel:
Die Kuh
Das Gespenst der Talerscheine
Gebrüder Grimm:
Das quellende Silber
Die Weisheit des Kindes
Gebrüder Grimm:
Der gestohlene Heller
Unfinished business
Johann Peter Hebel:
Der Wasserträger
Verpraßtes Geld
Friedrich Hebbel:
Der Heideknabe
Tatort Heide
Gustav Schwab:
Ein Fund in der Opferbüchse
Weltgeschichte in kleiner Münze
Peter Rosegger:
Als wir das Geld haben fortgetragen
Die schwere Last des Geldes
Charles Baudelaire:
Die falsche Münze
Lob des Konjunktivs
Friedrich Rückert:
Der vermauerte Schatz
Die Wandlung des Geldes
Eduard Mörike:
Einem kunstliebenden Kaufmann
Der schöne Profit
Friedrich Schiller:
Der Kaufmann
Ein Traum vom guten Handel
Justinus Kerner:
Im Grase
Dämonische Luftfracht
Karl Henckell:
Café de la Bourse (Brüssel)
Schöne neue Börsenwelt
Detlev von Liliencron:
Trutz, Blanke Hans
Geldflut und Sturmflut
Die Entfesselung des Geldes. Eine Art Einleitung
In der Mummenschanz-Szene des „Faust II“, einer farbenprächtigen Revue phantastischer Masken, erscheint Plutus, „des Reichtums Gott“, thronend auf einem vierspännigen Prunkwagen. Das imposante Gefährt wird gesteuert vom Knaben Wagenlenker, dem Genius der Poesie. Zuschauer und Zuschauerinnen erhalten Gelegenheit, das einträchtige Miteinander von Kunst und Reichtum zu bestaunen. Doch wenige Augenblicke später endet die harmonische Beziehung. Plutus entläßt den Knaben aus seinen Diensten: „Bist frei und frank, nun frisch zu deiner Sphäre“. Fortan soll die Poesie sich ihre eigene Welt erschaffen, befreit von der „allzulästigen Schwere“ der prosaischen Wirklichkeit. Goethe antizipiert hier in knapper bilderstarker Skizze einen folgenreichen historischen Moment. Kunst tritt ein ins Stadium der Autonomie, in den Zustand zunehmender Selbstreferenz, in dem sie dann zur modernen Kunst werden kann. Doch die Emanzipation des Ästhetischen hat ihre Tücken. Zwar gewährt Plutus dem Genius der Poesie die Freiheit, freilich vertreibt er damit auch den „Lenker“ des Wagens, auf dem er selbst sich künftig fortbewegen wird. Nicht nur die Kunst, auch der Reichtum wird autonom und kann sich je nach Bedarf von externen Vorgaben freimachen. Entkoppelt vom humanen Telos der Poesie findet er nun Gelegenheit, eigensinnig und rücksichtsloser als zuvor eigene Ziele zu verfolgen. Die fatalen Folgen der Trennung von Plutus und Lenker treten sogleich zutage. Nach den Abschiedsworten des Knaben macht der Gott des Reichtums sich über eine auf dem Prunkwagen mitgeführte Truhe her, eine Schatzkiste, angefüllt mit goldenen Pokalen und wertvollem Geschmeide: „Nun ist es Zeit die Schätze zu entfesseln!“ Mag Plutus vielleicht noch glauben, er könne sich nach dem Öffnen der Truhe an seinen Schätzen erfreuen, so wird er bald eines Schlechteren belehrt. Mephistopheles, in der Maske des Geizes fast unbemerkt auf dem Prunkwagen mitgereist, ergreift das Heft des Handelns und sorgt kraft diabolischer Magie für eine folgenreiche Verwandlung. Kaum hat Plutus die Truhe geöffnet, so schmelzen die goldenen Pokale, Kronen, Ketten und Ringe wie in einem Rennofen dahin und verwandeln sich in simple Geldstücke: „Gemünzte Rollen wälzen sich.- / Dukaten hüpfen wie geprägt“. Die exquisiten Erzeugnisse der Goldschmiedekunst, ästhetische Gebilde von hohem Erinnerungswert und starker religiöser wie weltlicher Symbolkraft, verwandeln sich in gleichförmiges Münzgeld. Aus ihnen verschwanden die individuellen Merkmale, denen die Schmuckstücke ihr künstlerisches Gepräge verdanken. Die erstaunten Höflinge und Hofdamen werden Zeugen einer fundamentalen gesellschaftlichen Metamorphose, die schon am nächsten Tag ihren Gipfel erreicht, als Mephistopheles den Goldwert ins Fiktive verbannt und das Papiergeld als neue Währung inauguriert. Die Entfesselung der Schätze, von Plutus großspurig und zukunftstrunken verkündet, gebiert im „Papiergespenst der Gulden“ ein modernes Geldwesen, das sich mit der Zeit so mancher sittlichen und humanen Fesseln entledigen wird.
Ludwig BechsteinDer beherzte Flötenspieler
Es war einmal ein lustiger Musikant, der die Flöte meisterhaft spielte; er reiste daher in der Welt herum, spielte auf seiner Flöte in Dörfern und Städten und erwarb sich dadurch seinen Unterhalt. So kam er auch eines Abends auf einen Pachterhof und übernachtete da, weil er das nächste Dorf vor einbrechender Nacht nicht erreichen konnte. Er wurde von dem Pachter freundlich aufgenommen, mußte mit ihm speisen und nach geendigter Mahlzeit einige Stücklein auf seiner Flöte vorspielen. Als dieses der Musikant getan hatte, schaute er zum Fenster hinaus und gewahrte in kurzer Entfernung bei dem Scheine des Mondes eine alte Burg, die teilweise in Trümmern zu liegen schien. „Was ist das für ein altes Schloß?“ fragte er den Pachter, „und wem hat es gehört?“ Der Pachter erzählte, daß vor vielen, vielen Jahren ein Graf da gewohnt hätte, der sehr reich, aber auch sehr geizig gewesen wäre. Er hätte seine Untertanen sehr geplagt, keinem armen Menschen ein Almosen gegeben und sei endlich ohne Erben (weil er aus Geiz sich nicht einmal verheiratet habe) gestorben. Darauf hätten seine nächsten Anverwandten die Erbschaft in Besitz nehmen wollen, hätten aber nicht das geringste Geld gefunden. Man behauptete daher, er müsse den Schatz vergraben haben und dieser möge heute noch in dem alten Schloß verborgen liegen. Schon viele Menschen wären des Schatzes wegen in die alte Burg gegangen, aber keiner wäre wieder zum Vorschein gekommen. Daher habe die Obrigkeit den Eintritt in dies alte Schloß untersagt und alle Menschen im ganzen Lande ernstlich davor gewarnt. – Der Musikant hatte aufmerksam zugehört und als der Pachter seinen Bericht geendigt hatte, äußerte er, daß er großes Verlangen habe, auch einmal hinein zu gehen, denn er sei beherzt und kenne keine Furcht. Der Pachter bat ihn aufs dringenste und endlich schier fußfällig, doch ja sein junges Leben zu schonen und nicht in das Schloß zu gehen. Aber es half kein Bitten und Flehen, der Musikant war unerschütterlich.
Zwei Knechte des Pachters mußten ein Paar Laternen anzünden und den beherzten Musikanten bis an das alte schaurige Schloß begleiten. Dann schickte er sie mit einer Laterne wieder zurück, er aber nahm die zweite in die Hand und stieg mutig eine hohe Treppe hinan. Als er diese erstiegen hatte, kam er in einen großen Saal, um den ringsherum Türen waren. Er öffnete die erste und ging hinein, setzte sich an einen darin befindlichen altväterlichen Tisch, stellte sein Licht darauf und spielte Flöte. Der Pachter aber konnte die ganze Nacht vor lauter Sorgen nicht schlafen und sah öfters zum Fenster hinaus. Er freute sich jedesmal unaussprechlich, wenn er drüben den Gast noch musizieren hörte. Doch als seine Wanduhr elf schlug und das Flötenspiel verstummte, erschrak er heftig und glaubte nun nicht anders, als der Geist und der Teufel, oder wer sonst in diesem Schlosse hauste, habe dem schönen Burschen nun ganz gewiß den Hals umgedreht. Doch der Musikant hatte ohne Furcht sein Flötenspiel abgewartet und gepflegt; als aber sich endlich Hunger bei ihm regte, weil er nicht viel bei dem Pachter gegessen hatte, so ging er in dem Zimmer auf und nieder und sah sich um. Da erblickte er einen Topf voll ungekochter Linsen stehen, auf einem anderen Tische stand ein Gefäß voll Wasser, eines voll Salz und eine Flasche Wein. Er goß geschwind Wasser über die Linsen, tat Salz daran, machte Feuer in dem Ofen an, weil auch Holz dabei lag, und kochte sich eine Linsensuppe. Während die Linsen kochten, trank er die Flasche Wein leer und dann spielte er wieder Flöte. Als die Linsen gekocht waren, rückte er sie vom Feuer, schüttete sie in die auf dem Tische schon bereit stehende Schüssel und aß frisch darauf los. Jetzt sah er nach seiner Uhr und es war um die zwölfte Stunde. Da ging plötzlich die Türe auf, zwei lange schwarze Männer traten herein und trugen eine Totenbahre, auf der ein Sarg stand. Diesen stellten sie, ohne ein Wort zu sagen, vor den Musikanten, der sich keineswegs im Essen stören ließ, und gingen ebenso lautlos, wie sie gekommen waren, wieder zur Türe hinaus. Als sie sich nun entfernt hatten, stand der Musikant hastig auf und öffnete den Sarg. Ein altes Männchen, klein und verhutzelt, mit grauen Haaren und grauem Barte lag darinnen; aber der Bursche fürchtete sich nicht, nahm es heraus, setzte es an den Ofen und kaum schien es erwärmt zu sein, als sich schon Leben in ihm regte. Er gab ihm hierauf Linsen zu essen und war ganz mit dem Männchen beschäftigt, ja fütterte es wie eine Mutter ihr Kind. Da wurde das Männchen ganz lebhaft und sprach zu ihm:„Folge mir!“ Das Männchen ging voraus, der Bursche aber nahm seine Laterne und folgte ihm sonder Zagen. Es führte ihn nun eine hohe verfallene Treppe hinab und so gelangten endlich beide in ein tiefes schauerliches Gewölbe.
Hier lag ein großer Haufen Geld. Da gebot das Männchen dem Burschen: „Diesen Haufen teile mir in zwei ganz gleiche Teile, aber daß nichts übrig bleibt, sonst bringe ich dich ums Leben!“ Der Bursche lächelte bloß, fing sogleich an zu zählen auf zwei große Tische herüber und hinüber und brachte so das Geld in kurzer Zeit in zwei gleiche Teile, doch zuletzt – war nur noch ein Kreuzer übrig. Der Musikant aber besann sich kurz, nahm sein Taschenmesser heraus, setzte es auf den Kreuzer mit der Schneide und schlug ihn mit einem dabei liegenden Hammer entzwei. Als er nun die eine Hälfte auf diesen, die andere auf jenen Haufen warf, wurde das Männlein ganz heiter und sprach: „Du himmlischer Mann, du hast mich erlöst! Schon hundert Jahre muß ich meinen Schatz bewachen, den ich aus Geiz zusammengescharrt habe, bis einem gelingen würde, das Geld in zwei gleiche Teile zu teilen. Noch nie ist es einem gelungen und ich habe sie alle erwürgen müssen. Der eine Haufe Geld ist nun dein, den andern aber teile unter die Armen. Göttlicher Mensch, du hast mich erlöst!“ Darauf verschwand das Männchen. Der Bursche aber stieg die Treppe hinan und spielte in seinem vorigen Zimmer lustige Stücklein auf seiner Flöte.
Da freute sich der Pachter, daß er ihn wieder spielen hörte und mit dem frühesten Morgen ging er auf das Schloß (denn am Tage durfte man hinein) und empfing den Burschen voller Freude. Dieser erzählte ihm die Geschichte, dann ging er hinunter zu seinem Schatz, tat wie ihm das Männchen befohlen hatte und verteilte die eine Hälfte unter die Armen. Das alte Schloß aber ließ er niederreißen und bald stand an der vorigen Stelle ein neues, wo nun der Musikant als reicher Mann wohnte.
Erlösung dem Erlös
Der Held dieses Geldmärchens ist Musiker, ein virtuoser Flötenspieler, der sein Instrument meisterhaft beherrscht. Ein fahrender Geselle, der öffentlich auftritt und damit seinen Unterhalt sicherstellt. Man kann vermuten, daß es sich bei dem eingespielten Erlös zumeist um Geld handelt. Und doch mag es zuweilen geschehen, daß künstlerische Darbietungen auf eine Resonanz stoßen, bei der Monetäres keine Rolle spielt. Der abendliche Aufenthalt im Pachterhof stellt einen solch exponierten Moment vor Augen. Der für die Nacht vom Pachter freundlich aufgenommene und beköstigte Musiker begleicht die ihm erwiesene Wohltat mit einigen Stücklein auf seiner Flöte. Man zögert, hier von einem Bezahlvorgang zu sprechen. Zwar erfolgt ein entgeltähnlicher Tausch, doch dieser hat noch das Gepräge freiwilligen Gebens und Nehmens. Er erfüllt die Bedingungen dessen, was Aristoteles den „gerechten Tausch“ nennt: Ein wechselseitiger Transfer, der frei bleibt von pekuniären Interessen. Kunst wird zum Medium des Entgelts, ohne daß dabei ihre Integrität Schaden nähme. Ein zwangloses do ut des, dessen Unbefangenheit noch nicht durchs Geldprinzip angetastet wurde. Der Anfang des Märchens berichtet von einem Gabentausch, der gleichsam im Stande der Unschuld verharrt, weil er noch nicht dem latenten Egoismus monetär begründeter Transaktionen gehorcht. Die Musikstücke, die der Flöter dem Pachter zu Ohren bringt, bedürfen nicht des ökonomischen Äquivalents der Geldstücke.
Der Flötenspieler tritt ans Fenster und schaut in die Nacht hinaus. Seine Blickgebärde stellt sich in eine zentrale Motivtradition der Romantik. Der Fensterblick, der aus der Enge der bürgerlichen Stube hinausschweift ins Weite und Offene einer unendlichen Landschaft, die verheißungsvoll lockt und Sehnsüchte weckt nach abenteuerlichen Schauplätzen und Begebenheiten. Dessen schönste Ausprägung bietet wohl Eichendorffs Gedicht „Sehnsucht“: Der aus dem offenen Fenster in die sternenklare Sommernacht Hinausschauende, den das Fernweh ergreift, der sich hinausträumt in magische Gefilde einer südlichen Phantasiewelt. Auch dem Flötenspieler bietet sich das charakteristische Setting des romantischen Blicks. Zunächst der Schein des Mondes, bei fast allen romantischen Malern und Dichtern ein zentrales Bildmotiv, wenn es darum geht, nächtliche Szenerien mit der Aura magischer Verzauberung zu versehen. Nicht weniger bedeutsam das teilweise in Trümmern liegende Schloß, eine jener vielen Ruinen, die, zumeist beschienen vom Mondenschein, in der Romantik allenthalben begegnen. Fensterblick, Mondnacht und Ruinenzauber, eine gewichtige Motivballung, die energisch all die Vorstellungen beschwört, in denen der Sehnsuchtskult der Romantiker sich künstlerisch manifestiert. Doch die romantische Aura scheint im vorliegenden Geldmärchen bereits nachhaltig eingetrübt. Eichendorff erzählt noch von Helden, die traumversunken oder neugierig zu mondbeschienenen Schlössern aufschauen. Dort verschlägt es die Jünglinge in verwirrende Abenteuer, bei denen es um schöne Schloßherrinnen geht, um Liebesfreud und Liebesleid, um geheimnisvolle Besucher sowie um dunkle, vorerst noch ungeklärte Verwandtschaftsverhältnisse. Hier jedoch, kaum daß die romantische Ruine ins Blickfeld gerät, ist sogleich vom Geld die Rede, vom verstorbenen steinreichen Grafen, einem Geizhals, der nicht einmal bereit war, den Armen ein Almosen zu geben. Unversehens kollidiert die mondbeglänzte Zaubernacht mit einem höchst unromantischen Aspekt bürgerlicher Wirklichkeit, dem Primat des Geldes, jener Realabstraktion, deren Indifferenz und Nivellierungskraft nach landläufiger Meinung geeignet sind, allem Romantischen den Garaus zu machen.
Auf den ersten Blick also ein deutlicher Gegensatz zwischen Romantik und Geldsphäre. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man freilich frappante Ähnlichkeiten zwischen beiden Bereichen. Ihr tertium comparationis ist eine Dialektik, für die Novalis die bündige romantische Formel bereithält: „Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge.“ Für die Sehnsuchtsgebärden und den Entgrenzungsdrang der Romantiker ist dies leicht einzusehen. Man sucht, wie Heinrich von Ofterdingen, die blaue Blume, und doch, unlösbar verstrickt in die Begrenzungen und Endlichkeiten der bürgerlichen Verhältnisse, kann man sie nicht finden. Doch auch das Geldprinzip unterliegt solcher Dialektik. Als wirkungsvolle Wunschmaschine lenkt es die Phantasie in imaginäre Zonen des Begehrens. Was könnte ich mir für noch mehr Geld nicht alles kaufen! Für Schopenhauer ist das Geld ein Proteus, der sich in nahezu jeden Gegenstand unseres Wünschens verwandeln kann. Wie die blaue Blume der Romantik weckt auch das Kapital Sehnsüchte, die nicht ans Ziel gelangen. Die Spannung von Bedingtem und Unbedingtem gilt vor allem für die psychodynamischen Wirkungen des Geldes. Sie stimuliert ein Begehren, das immer mehr will und sich doch stets mit Knappheit, mit begrenzten Mitteln konfrontiert sieht. Johann Nestroy blieb es vorbehalten, den monetären Unendlichkeitsdrang in eines der witzigsten Bonmots des 19. Jahrhunderts zu kleiden: „Die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig?“ Der Verdacht drängt sich auf, daß hinter dem Sehnsuchtskult der Romantiker sich gesellschaftliche Erfahrungen verbergen, die es ohne die allmächtige Wunschmaschine des Kapitals gar nicht gäbe. Im Lichte dieser Überlegungen erscheint es äußerst folgerichtig, daß die Informationen des Pachters den romantischen Blick des Musikers, der noch auf der mondbeglänzten Ruine verweilt, sofort auf das Geld und seine Wirkungen lenken. Eine Art Switching von romantischer Entgrenzung hin zum durchaus verwandten Unendlichkeitspotential des Kapitals, das nicht zuletzt dort seine Wirkungen entfaltet, wo man es hortet, wo man wie der verstorbene Schloßherr zum Geizhals entartet. Diesem Typus des Schatzbildners widmet Karl Marx im „Kapital“ ein eigenes Kapitel, in welchem er Schatzbildung als endlosen Prozess ohne „immanente Grenze“ bestimmt. Das unermüdliche Horten entzünde sich am „Widerspruch zwischen der quantitativen Schranke und der qualitativen Schrankenlosigkeit des Geldes“, es entarte zur „Sisyphusarbeit der Akkumulation“. Ohne große Umschweife ließe sich solche Terminologie auf den romantischen Unendlichkeitsdrang anwenden. Kein Wunder, daß Marx sich nicht scheut, dem Schatzbildner das romantische Flair eines Abenteurers zu verleihen, der ins Unbedingte strebt und doch immer nur auf Bedingtes trifft: „Es geht ihm wie dem Welteroberer, der mit jedem neuen Land nur eine neue Grenze erobert.“ Und noch ein weiteres Kriterium des Schatzbildners erfüllt der gräfliche Knauser. Von ihm heißt es, er habe aus Geiz sich nicht einmal verheiratet und sei schließlich ohne Erben gestorben. Eine innerweltliche Askese, die vermuten läßt, daß es diesem Leben nicht nur an Empathie, sondern auch an den Freuden der Sinnenlust mangelte. Auch hierfür liefert Marx die griffige Formel: Der Schatzbildner opfert „dem Goldfetisch seine Fleischeslust. Er macht Ernst mit dem Evangelium der Entsagung.“ Der gastfreundliche Pachter beendet seine Ausführungen zur Burg und zum Schicksal des gräflichen Geizhalses mit dem Hinweis, der Zugang zur Ruine sei von der Obrigkeit untersagt worden, weil bislang keiner der bisherigen Schatzsucher wieder zurückkehrte. Das Märchenmotiv des unzugänglichen verwunschenen Schlosses scheint wiederzukehren, doch hier waltet nicht der magische Zauberbann von Dornröschens Dornenhecke, sondern das Abstraktum einer behördlichen Verfügung, der es darum geht, die Menschen vor sich selbst zu schützen. Schon viele waren des Schatzes wegen in die alte Burg gegangen und dann verschollen. Die phantasmagorischen Sehnsuchtsziele der romantischen Helden haben ihren Zauber verloren. Allzu mächtig war der verführerische Lockruf des Geldes, dem die Suchenden folgten, und sei es um den Preis des eigenen Untergangs. Beim Flöter hingegen scheint die Motivlage weniger eindeutig. Wo der Beherzte seinen Wunsch artikuliert, auch einmal hinein zu gehen, erwähnt er mit keinem Wort den Schatz. Er scheint sein Unterfangen vielmehr als eine Art Mutprobe zu begreifen, schließlich sei er beherzt und kenne keine Furcht. Er rückt hier eher in die Nähe jenes grimmschen Märchenhelden, der auszog, das Fürchten zu lernen, und dem Bechstein im Märchen „Das Gruseln“ einen zweiten Auftritt ermöglicht. Der Wunsch, das alte Schloß zu betreten, gründet demgemäß im Mut, im Beherztsein des Flöters und weniger in der Fixierung aufs Geld. Gerade hier wird man die Metapher des Herzens ernst nehmen müssen. Sie steht für ein personales Zentrum, dessen emotionale und seelische Integrität sich noch nicht aufs Pekuniäre verengt hat. Der Flöter verfügt mithin über eine mentale Disposition, die für das Abenteuer auf dem Schloß Erfolg und für das gesamte Märchen ein glückliches Ende erwarten läßt.
Bei den vielen Menschen, die zuvor des Schatzes wegen in die alte Burg eindrangen, wird man vermuten können, daß sie, ihr pekuniäres Ziel fest vor Augen, sich sogleich auf die Suche nach dem Geldversteck machten. Nicht so der Flöter, der sich eher in einer fast schon häuslichen Gemütlichkeit einzurichten scheint. Im großen Saal wecken nicht, wie man erwarten könnte, die geheimnisvollen Türen seine Neugier, stattdessen setzt sich der Musikant schon nach Durchschreiten der ersten Tür an den altväterlichen Tisch und beginnt zu musizieren. Selbst nach beendetem Flötenspiel treibt nicht Geldgier ihn zu weiteren Aktionen, sondern Hunger. Leibliches Wohlergehen hat Vorrang, ein Begehren weit entfernt vom Evangelium der Entsagung. Das Kochen der Linsensuppe gerät zur lebenspraktischen Verrichtung, in der eine Urszene menschlicher Bedürfnisbefriedigung aufscheint, das Zubereiten der Nahrung an der Feuerstelle, hier noch ergänzt durch den Weingenuß, womöglich der Hinweis auf bereits verfeinerte Zustände menschlicher Kultur und Zivilisation. Dem Motiv der Linsen kommt dabei erhebliche Bedeutung zu. Im Volksglauben symbolisieren Linsen oftmals Geldmünzen, eine beim Blick auf ihre äußere Form durchaus naheliegende Assoziation. Das Thema Geld wird motivisch präludiert, freilich in einer sehr spezifischen Akzentuierung. Als Lebensmittel, im unmittelbaren wie auch im weitesten Verständnis, bleibt Monetäres eingebunden in sinnvolle menschliche Praxis. Es hat sich noch nicht von leiblichen Bedürfnissen abgelöst, es steht alternativ zum gräflichen Geizhals, dem asketischen Schatzbildner, der zwanghaft dem Geldfetisch seine leiblichen Bedürfnisse opferte. Der weitere Verlauf des Märchens läßt sich nun erahnen. Es geht um die Aufhebung der Entfremdung des Geldes, um eine restitutio in integrum, die das Geldprinzip wieder in den Dienst menschlicher Bedürfnisse und humaner Praxis stellt.
Die zwölfte Stunde ist bekanntlich die Zeit der Geister und Gespenster. Um Mitternacht dringt das Andere der taghellen Vernunft in die vermeintlichen Sicherheiten der bürgerlichen Ordnung. Unzählige Belege aus Dichtung und bildender Kunst ließen sich nennen. Als wahrhaft klassisches Exempel mag hier die Mitternachtsszene aus Goethes „Faust II“ gelten, jener Moment, da gegen Ende des Dramas die graue Gestalt der Sorge durchs Schlüsselloch eindringt und den alten Faust in seinem Palast heimsucht. In einem bilderstarken Katalog, dunkel-raunend vorgetragen, stellt die ungebetene gespenstische Besucherin dem Hausherrn die seelischen „Finsternisse“ eines sorgenvollen Daseins vor Augen, darunter eine Befindlichkeit, die auch den gräflichen Geizhals heimsucht: „Und er weiß von allen Schätzen / Sich nicht in Besitz zu setzen.“ Natürlich hat Goethe hier ein breiteres Spektrum moderner conditio humana vor Augen. Doch die Diagnose der Sorge mag auch für den Schatzbildner gelten, der hortet und hortet, aber nicht in der Lage ist, sein Vermögen auf einen geldexternen Mehrwert auszurichten, der ein sinnvolles und lebenswertes Leben gewährleisten könnte. Gerade auf solche Möglichkeiten verweist die emphatische Bedeutung, die Goethe dem Wort Besitz verleiht. Sie ist geeignet, das existenzielle Defizit des knausrigen Grafen kenntlich zu machen. Auch für Kapitalvermögen mag gelten, was Goethe allen Erben mit Blick aufs Ererbte ins Stammbuch schreibt: „Erwirb es, um es zu besitzen.“ Es geht um ein tätiges Sich-Mühen in der Welt, das aus dem Besitz weit mehr macht als pure Kapitalhortung, weit mehr als jenes Schatzbilden, mit dem etwa Richard Wagners Fafner sich zufrieden gibt: „Ich lieg und besitz – (gähnend) / laßt mich schlafen!“ Goethe begreift Besitz als Resultat eines gelingenden Aneignungsprozesses, der das Ererbte in sinnvoller, weltbezogener Tätigkeit für die eigene Lebensbildung nutzt und damit auf humane Ziele ausrichtet. Wer diese Möglichkeiten nicht wahrzunehmen weiß, der gerät in einen Zustand, den die Sorge mit kathartischer Wucht dem wenig später erblindenden Faust zur Kenntnis gibt: „Er verhungert in der Fülle“. Unschwer könnte man diese Diagnose auch dem gräflichen Geizhals des Märchens stellen, dem einsamen knausrigen Asketen, der im tiefen Kellergewölbe sein großes Vermögen verwahrt.
Die zur Geisterstunde von den schwarzen Männern im Saale abgestellte Totenbahre scheint den Beginn einer Schreckensnacht anzukündigen. Doch die beherzten Aktionen des Flöters, durchgeführt mit der Selbstverständlichkeit alltäglicher Verrichtungen, lenken das Geschehen recht bald ins Versöhnliche. Das Öffnen des Sarges gibt den Blick frei auf die Leiche des Schloßherrn. Diese präsentiert sich klein und verhutzelt, in einem Zustand, den man freilich nicht nur als Resultat des Vermoderns deuten mag. Der Gedanke liegt nahe, daß hier die leibfeindliche Askese des Grafen sich zum letalen Bildsymbol formte. Um dessen Kontrafaktur geht es bei den weiteren fürsorglichen Aktionen des Flöters. Die Todesstarre löst sich am wärmenden Ofen, sogar ins Leben kehrt der Alte zurück. Nachgerade hingebungsvoll, ganz mit dem Männchen beschäftigt, sorgt der Musiker sich um den wiedererstandenen Grafen. Wo er sogar den Alten füttert, wie eine Mutter ihr Kind, dort steigert sich das Gebärdenspiel zeichenhaft zur Pathosformel, die das Urbild der Alma Mater, den Inbegriff des Umsorgens und Beschützens aufruft. Dem leibfeindlichen Wesen des Grafen, auch seiner Unfähigkeit zum Mitgefühl, ersteht in der wie selbstverständlich gewährten Fürsorge ein markantes humanes Gegenbild.
Der Gang in die Kellerräume des Schlosses, eingefordert vom wiedererstandenen, ganz lebhaft gewordenen Alten, scheint nun doch Schlimmes zu verheißen. Die hohe verfallene Treppe signalisiert eine Katabasis in bedrohliche Tiefen, den Abstieg in ein tiefes schauerliches Gewölbe. Als habe man sich in die Schlösser der Schauerromane verirrt, in deren Verliesen mit schöner Regelmäßigkeit grausamste Verbrechen der unterschiedlichsten Art begangen werden. Auch an die bedrohlichen labyrinthischen Carceri eines Piranesi ließe sich denken. Hier jedoch dient der schauerliche Raum als Versteck einer beträchtlichen Geldsumme. Der Schluß liegt nahe, daß es sich dabei um Gold- und Silbermünzen handelt, die der Graf vor vielen, vielen Jahren, noch vor dem Aufkommen des Papiergeldes, dort unten im Gewölbe hortete. Damit gerät die Katabasis zur Erinnerungsspur jener kollektiven bergbaulichen Anstrengung, mittels derer die Menschen seit ältesten Zeiten in die Gesteinstiefen der Erde eindrangen, dort nach Gold und Silber suchten, in der Hoffnung, so der antike Autor Athenaios in seinem „Sophistenmahl“, den „Pluton selbst aus dem Innern der Erde zu ziehen.“ Es verwundert kaum, daß Karl Marx im erwähnten Kapitel über Schatzbildung diese Stelle fast genüßlich zitiert. Er wertet sie als frühe Vorahnung einer modernen bürgerlichen Gesellschaft, die, wie er hinzufügt, „im Goldgral die glänzende Inkarnation ihres eigensten Lebensprinzips“ begrüßt.
Vor dem Hintergrund der Kollektivgeschichte des Goldschürfens gewinnt die erfolgreiche Geldteilung des Flöters ihr Profil. Sie stellt sich dar als strikte Alternative zur Verdinglichung des Geldprinzips, in deren Verlauf aus dem bloßen Mittel Geld ein fataler Endzweck wurde: Profit lediglich um des Profits willen. Die vom Alten gestellte Aufgabe gemahnt, wenn auch im Kleinformat, an die Arbeiten des Herakles, bei deren Nichtbewältigung Untergang und Verderben drohen. Und wie beim antiken Halbgott ist es auch hier der geniale rettende Einfall, der den Erfolg bringt. Doch nun ist kein Augiasstall mehr da, den es durch den herkulischen Kraftakt einer Flußdurchleitung auszumisten gilt. Der dem Flöter gestellte Aufgabenbereich hat sich verlagert in die Bezirke des Rechenhaften, auf die abstrakte Ebene präziser Zahlenverhältnisse. Doch der Geldhaufen läßt sich partout nicht in der erwünschten Genauigkeit teilen. Eine Kreuzermünze bleibt übrig, gleichsam ein winziger Störenfried, der die anbefohlene mathematische Symmetrie vereitelt. Alle bisherigen Schatzsucher waren an dieser Asymmetrie gescheitert. Dies vor allem, weil ihr Denken im Bereich abstrakter mathematischer Proportionen verblieb. Sie waren unfähig, den magischen Bann des Rechenhaften zu zerschlagen. Der Musiker hingegen, sobald er, den Kreuzer vor Augen, die heikle Asymmetrie bemerkt, ist in der Lage, aus dem Systemzwang des bloß Rechnerischen herauszutreten und das Problem lebenspraktisch anzugehen. Das nachgerade handwerkliche Zerteilen der Münze, der Schmiedearbeit weit näher als allem Berechnen, gibt praktischem Handeln den Vorrang vor der Realabstraktion des Geldes. Das Entzweischlagen mit dem Hammer beschädigt massiv den numerischen Geldwert der Münze, doch zugleich öffnet es zukünftige Spielräume für einen sinnvolleren Status des Geldes in der Welt.
Du himmlischer Mann, du hast mich erlöst! Das Pathos dieser Danksagung lenkt den Blick ins Feld theologischer und mythischer Bedeutungen. Der Flöter, versehen mit den Attributen des Himmlischen, wird erhöht zum Erlöser, zum Soter, dem es aufgegeben ist, die Sündhaftigkeit der Welt zu heilen. Die letzten Worte des nun glücklichen Alten bekräftigen fast schon hymnisch dieses Denkbild: Göttlicher Mensch, du hast mich erlöst!