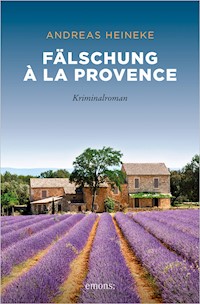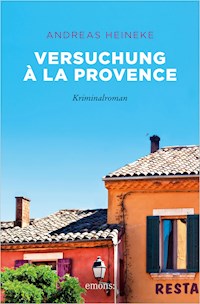
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pascal Chevrier
- Sprache: Deutsch
Endlich Frühjahr in der Provence. In den malerischen Orten im Luberon bereiten sich die Restaurants auf die Touristenströme vor, da macht eine Schreckensmeldung die Runde: Fünf abgetrennte Finger wurden an Köche verschickt, die allesamt einer Gourmet-Bruderschaft angehören und barbarisch zubereitete Menüs für die Oberschicht kochen. Die örtlichen Tierschützer kämpfen seit Jahren gegen die Männer, doch morden sie auch für ihre Überzeugung? Dorfgendarm Pascal Chevrier muss in einem Fall ermitteln, der bis weit in die Anfänge der Gourmetküche zurückreicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Der Hamburger Journalist und Buchautor Andreas Heineke war Radiomoderator, Musikmanager und Dot-Com-Firmengründer, ist Autor hauptsächlich für den NDR, Filmemacher und Regisseur. Der Erfolg seines ersten Krimis »Tod à la Provence« überraschte ihn so sehr, dass er gleich einen zweiten Provence-Krimi schrieb. Seit Jahren verbringt er so viel Zeit wie möglich in der Provence, Tendenz steigend.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Auch die Gourmet-Bruderschaft »Confrérie des Cuisiniers du Feu« und deren Machenschaften sind komplett fiktiv und entsprechen in keiner Weise den ehrenvollen französischen Gourmet-Bruderschaften. Einer der schönsten Buchläden, die ich in meinem Leben betreten habe, die »Librairie Le Bleuet« in Banon, hat mich in Teilen zu dieser Geschichte inspiriert. Die Handlung rund um diesen Buchladen ist frei erfunden. Er dient nur als Kulisse. Jede Übereinstimmung mit der realen Buchhandlung ist rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: iStockphoto.com/xavierarnau
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-453-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Für meine Familie undmeinen Freund Christian Löwendorf
Kitchen aromas aren’t very homelyIt’s not comforting, cheery or kindIt’s sizzling blood and the unholy stenchof MURDER.
»Meat is Murder«, The Smiths (1985)
Kein Genuss ist vorübergehend;denn der Eindruck, den er zurücklässt,ist bleibend.
Goethe
Prolog
Seine langen knochigen Finger zitterten, als er das Buch mit dem schwarz-weißen Einband auf den kleinen runden Tisch vor sich legte. Nur matt beschien eine Leselampe die Fläche inmitten der Regalreihen. Es war ihm nicht möglich, die Person mit dem schwarzen Schal und den Handschuhen hinter den Buchwänden zu erkennen. Er konnte die flackernden Augen nicht sehen, nicht die Entschlossenheit im Blick seines Beobachters.
An diesen Ort vorzudringen hatte immer als unmöglich gegolten. Es war der Raum ohne Eingang.
Die extradicken Wände verliehen ihm Sicherheit, zu viel Sicherheit, sodass er mit fortschreitendem Alter, im immer gleichen Rhythmus der Jahre, unvorsichtig geworden war. Sonst hätte er sich in Deckung bringen können.
Doch die goldenen, geschwungenen Buchstaben, die per Hand gezogenen Schnörkel, all das zog ihn in den Bann, ließ ihn in eine Welt eintreten, in der es nichts Böses gab.
Zu lange hatte er auf diesen Augenblick gewartet. Für dieses Buch, dieses Standardwerk der französischen Küche, wäre er bis ans Ende der Welt gegangen. Kein heutiger Starkoch, der nicht davon gehört hatte. Aber auch kein Starkoch, der es jemals in seinen Händen gehalten hatte.
»Die Küchenkunst des Vaucluse«. Viele Hände hatten ihre erbarmungslosen Spuren auf dem Buchcover hinterlassen. Fettflecke zeugten von gierigen Berührungen. Die Seiten waren gelb, teilweise eingerissen, bei jedem Umblättern bestand die Gefahr, sie herauszureißen. Nur Reste des verkrusteten Leims hielten sie noch mühsam zusammen.
Fotos oder zumindest Zeichnungen gab es nicht. Die Zeilen waren nüchtern untereinandergeschrieben, eng, gedrungen, dem modernen menschlichen Auge und der Aufmerksamkeit des 21. Jahrhunderts nicht mehr zumutbar.
Die Rezepte beschränkten sich auf die Aufführung der Zutaten ohne jede Mengenangabe. Bei einigen Seiten waren mit Bleistift Anmerkungen oder weitere Tipps hinzugeschrieben worden.
Andächtig wie ein Pastor, der kurz vor seiner Predigt noch einmal die Bibel berührt, schwebten seine Fingerspitzen über das Buch. Behutsam betasteten sie die eingestanzten Vertiefungen in der Pappe, befühlten die vielen Jahre, die über das Werk gerichtet hatten. Von der ganzen Gourmet-Welt gesucht und vor Jahren endgültig für verschollen erklärt.
»Jetzt fügt sich alles zusammen«, flüsterte er mit bebenden Lippen.
Die Suche hatte ihn Jahrzehnte gekostet, die nicht spurlos an ihm vorübergegangen waren. Im letzten Jahr war er dürr geworden. Er hatte einen fast muskellosen Körper. Sehnen wie Drahtgeflechte, aus denen man Zäune hätte herstellen können, waren an seinen Armen hervorgetreten. Seine Brille wie aus einer anderen Epoche, seine Pupillen groß wie die einer Eule, die er stundenlang auf ein und dieselbe Buchseite richten konnte, ohne dass sie sich erschöpften.
Seit er davon gehört hatte, seit er wusste, dass die Küchenkunst in Wahrheit viel älter war, als die meisten Köche, Gourmets und Tierzüchter es jemals für möglich gehalten hätten, fühlte er sich bestätigt. Er hatte es immer gewusst, geahnt, dass es Aufzeichnungen der frühen Köche geben musste, und sie gesucht, unermüdlich, Tag und Nacht. Auf seinen Instinkt war immer Verlass.
Später, nach der Huldigung dieses Werkes vor ihm, würde er seine Listen durchsuchen – die Notizbücher mit den Karomustern waren das Protokoll seines Lebenswerks. Sie umfassten fünfhundertsechsundsiebzig Seiten, alle eng mit Bleistift beschrieben. Spuren von Radierungen, Streichungen und kleine Sternchen, Querverweise mit Fußnoten, Häkchen, Kreuze und Striche wiesen darauf hin, ob eines der Bücher sich bereits in seinem Besitz befand oder noch »abwesend« war, wie sein Chef sich auszudrücken pflegte.
Außer ihnen beiden kannte niemand diese Aufzeichnungen, in denen alle vergriffenen Kochbücher der Welt erfasst waren. Allein das Zusammentragen der Werke kostete ein halbes Menschenleben. Oft wusste er genau, wo sich das gesuchte Buch befand, zumindest hatte er eine Vermutung, er musste nur einen Weg finden, heranzukommen. Diesen entdeckte er immer, es war eine seiner herausragenden Eigenschaften. Niemals lockerlassen, niemals aufgeben und seiner Nase und seinem Bauch vertrauen. Hatte er einmal Witterung aufgenommen, folgte er seinem Instinkt so lange, bis er sein Ziel erreicht hatte.
Schaute man nur flüchtig hinein, waren seine Bemühungen von einer gewissen Irrationalität geprägt. Sein Chef schüttelte oft den Kopf ob der Umwege, die er in Kauf genommen hatte, doch die Jahre hatten diesen gelehrt, »dem Mann im Raum ohne Eingang«, wie sein Vorgesetzter ihn vor anderen Mitgliedern nannte, zu vertrauen, ihm sogar blind zu vertrauen. Warum sollte er es auch nicht tun? Sein Angestellter war genauso besessen wie er selbst. Das hatte der Leiter bereits vor dreißig Jahren erkannt, als er noch ein kleines, unbedeutendes Rädchen in der Gourmet-Gilde gewesen war. Aber aus diesem kleinen Rädchen, das dem sogenannten Rechercheteam angehörte, dessen einzige Aufgabe zunächst darin bestanden hatte, moderne Rezepte mit traditionellen zu vergleichen und diese später in Listen zu verwalten, war er zum Verwalter eines Schatzes geworden. Er hatte sich hochgearbeitet.
Nur die wenigen Eingeweihten, die Männer mit Orden und Abzeichen an den Sakkos und Trachtenjacken, waren sich immer sicher gewesen, wussten sie doch ihr Geheimnis in guten Händen an einem Platz, der niemals zu finden sein würde. Ein fremder Mann an diesem Ort? Undenkbar.
Er konnte nicht sehen, dass sich sein Beobachter bis auf wenige Meter genähert hatte. Dass er seine Hand fest um die Spritze gelegt, die Plastikhülle bereits von der feinen Nadel gezogen hatte.
Später sollte er sich über den Zufall wundern, dass er in dieser alles entscheidenden Sekunde in die Innenseite des Löffels geschaut hatte, der neben dem Buch auf dem Tisch gelegen und mit dem er noch vor einer Stunde seine Suppe gelöffelt hatte.
Er sah etwas Schwarzes neben seinem Spiegelbild, da war ein Mann mit einer Kapuze hinter ihm.
Es ging ihm nicht um sich selbst, es war das Buch, das ihn so reagieren ließ. Er drehte sich um, seine Augen aufgerissen, die riesigen Pupillen auf den Eindringling gerichtet. Wie bei einer Eule, die eine Maus packte, sprang er in die Höhe, ergriff den Mann hinter sich an dessen Kapuzenjacke, verfehlte ihn kurz mit seinen langen knochigen Fingern, die solche Bewegungen nicht gewohnt waren, riss ihn aber trotzdem zu Boden.
Der Mann schlug beim Fallen mit seinem Kopf auf die Tischkante, sodass sein Nacken für eine Millisekunde in die Senkrechte gerissen wurde, während der Körper bereits waagerecht zu Boden fiel. Neben ihm die Spritze.
War es das Eselsohr, das ihn zu dieser grausamen Entscheidung veranlasste, die Spritze aufzuheben, sie ein paar Sekunden in der Hand zu wiegen und schließlich an den Arm des am Boden liegenden Mannes zu führen? Im Chaos der Gefühle konnte er das nicht mehr analysieren. Er war nur überrascht, dabei nichts zu empfinden, beim Einführen der Nadel gar nichts zu fühlen.
Er sah, wie der Mann am Boden unbeweglich wurde, wie sein Bein zur Seite abknickte, die Spannung aus dem Körper wich, und hörte, wie schließlich der laute, nach dem Sturz röchelnde Atem verstummte.
Mit der Stille kehrte auch das Leben für einen Moment zurück. Er setzte sich wieder an den Schreibtisch, das Buch hatte er vor sich gelegt. Er horchte in sich hinein. Da war kein Zittern, da waren keine weichen Knie, nicht die Spur von Empathie. Er war gerade dem Tod entkommen, knapp und dank einer glücklichen Fügung, doch er konnte diesem Gedanken, diesem Gefühl nicht nachspüren.
Jetzt war er selbst zum Mörder geworden, innerhalb von Sekunden. Es machte ihm nichts aus. Nur das Buch war entscheidend, über das er wieder und wieder streichelte wie zum Trost, als würde er ihm erklären, dass dieses eine kleine Eselsohr keinen bleibenden Schaden verursachen würde, dass jetzt alles gut, die Gefahr gebannt war, für immer.
Zärtlich wie eine Mutter, deren Kind sich gestoßen hatte, sah er sich die Seiten mit den Rezepten an, bevor er das Buch behutsam schloss und gleich danach wieder aufschlug. Er wollte noch das Vorwort lesen.
1
Pascal Chevrier ließ seinen Blick durch die Lücke zweier windschiefer Häuser in das Tal des Luberon schweifen. Friedlich lag es da, einige Straßen zogen sich kurvig durch die Weinberge, wie zufällig in die Landschaft geworfen.
Die Autos verschwanden in den Hügeln und tauchten hinter dem nächsten Weinberg wieder auf. Ihr Geräusch war auf diese Entfernung nicht zu hören. Kein Motor, kein Hupen, es war still.
Selbst die Vögel haben Mittagspause, dachte Pascal zufrieden und lehnte sich so weit wie möglich an die unbequeme eiserne Lehne seines Stuhls zurück. Weinreben rankten über der Terrasse und dienten als Sonnenschutz. Vor ihm auf dem Tisch ein Espresso, der ihm von Madame Savagne gebracht worden war.
Er mochte diesen Platz, dieses kleine Örtchen Saignon, gut vier Kilometer von der turbulenten Kleinstadt Apt entfernt. Nur den Berg hinauf, dort, wo der Lavendel die Landschaft in ein tiefes Lila verwandelte und jedem Menschen ein Staunen über die Schönheit der Welt abrang. Hier oben war es ruhig. Um diesen Ort schien der Provence-Tourismus einen Bogen gemacht zu haben. Keine schicken Boutiquen, nur ein kleines Hotel, ein paar Galerien, einige wenige Bars und zwei Restaurants.
Das Hotel im Ort, die »Auberge du Presbytère«, betrieben von einem deutschen Ehepaar, hatte schon seit Jahren für immer die Pforten geschlossen. Der Brunnen, aus dem die Gäste damals zur Blütezeit des Hauses ihre Carafe d’eau bekommen hatten, war inzwischen grün, mit Algen durchtränkt. Moosbewachsen waren die Engel, die aus Krügen unermüdlich das Wasser in das prunkvolle Becken gossen. Ein rostiges Schild wies die wenigen Besucher des Dorfes darauf hin, dass das Brunnenwasser nicht mehr kontrolliert werde und nicht zum Trinken geeignet sei. »Pas d’eau potable«.
Die wenigen Touristen, die noch kamen, waren meist Radfahrer, die sich von Apt aus den Berg hochgequält hatten und in dem Glücksgefühl, etwas erreicht zu haben, eine Rast einlegten. Mit Mineralwasserflaschen saßen sie am Straßenrand oder auf abgewetzten Bänken im Ort und schwiegen bei zweiunddreißig Grad Hitze vor sich hin. Ein Schauspiel, das sich Tag für Tag wiederholte.
Die enge Gasse, die durch das Dorf führte, wurde von den Autos kaum genutzt – und doch war sie die Hauptattraktion in Saignon. Ein alter Mann saß auf seinem Campingstuhl vor dem Haus, da saß er immer, das war sein Platz. Vor sich hatte er eine alte Blechdose gestellt, in die die Touristen ein paar Euros werfen sollten, wenn sie ein Foto von ihm und seinem auf einem zweiten Campingstuhl dicht neben ihm schlafenden Hund machen wollten. Unzählige Besucher hatten es schon getan. Auf Tausenden Handys und Digitalkameras gab es ein Foto mit einem Mann und einem Hund auf einem Campingstuhl vor einem alten Haus. War es dieses Bild, das die Leute von Saignon behielten? War das das Bild der Provence, wenn alle Lavendelfelder, die Boulangerien und Dorfgassen fotografiert waren?
Komische Welt, dachte Pascal und nahm einen Schluck seines Espressos.
Der Mittagstisch war bei Madame Savagne schon lange abgeschafft worden, es gab zu wenig Gäste. Seitdem der Weg auf den höchsten Berg des Ortes als »Privé« erklärt worden war, war Saignon die letzte Attraktion genommen worden. Jemand hatte den ganzen Berg gekauft und damit den Besuchern aus aller Welt den spektakulären Blick auf den Luberon geraubt.
Vielleicht führte jede Abwesenheit von Tourismusattraktionen genau dazu, dass Pascal immer wieder hierher zurückkam. Er mochte die kleine Straße, die aus Apt auf den Berg hinaufführte und an der Kirche mit dem Friedhof endete. Den meist leer stehenden Bouleplatz unter den Platanen, die Schule, in die nie jemand zu gehen schien – egal, zu welcher Jahreszeit –, und das alte Waschhaus, an dem die Dorfbewohnerinnen sich noch vor achtzig Jahren getroffen und die Wäsche ihrer Männer gewaschen hatten, die die Tage in den Weinbergen, auf den Apfelplantagen oder den Melonenfeldern verbracht hatten und mit Erde übersät und gebeugtem Rücken nach Hause gekommen waren. Ihre Gesichter von der gnadenlosen Sonne zerfurcht und staubig, saßen sie in den wenigen Cafés von Saignon und tranken schweigend ihren Pastis, während die Frauen sich am Wasserbassin trafen und beim regelmäßigen Eintauchen der Wäsche die neuesten Nachrichten austauschten.
Saignon, fand Pascal, atmete mehr Geschichte aus als die provenzalischen Showrooms wie Lourmarin, Bonnieux oder Gordes.
Es war sein erster Sommer in der Provence, der nun kommen sollte, die erste Hauptsaison in seiner neuen Heimat. Er hatte sich noch nicht vollständig an das südfranzösische Leben gewöhnt. Den hektischen Lebensrhythmus aus seinem Pariser Gendarmenleben konnte er nach so kurzer Zeit noch nicht ablegen. Es gab keinen Tag, an dem er es bereut hatte, einen Strich gezogen zu haben.
Nach dem Auszug seiner Tochter Lillie nach Lyon, der Trennung von seiner Frau Catherine und der Einsamkeit in der Pariser Wohnung, die für ihn allein viel zu groß gewesen war, atmete er auch nach sechs Monaten als Dorfgendarm nur langsam wieder ruhiger und regelmäßiger.
Er schaute noch einmal hinunter ins Tal, dann nahm er die »Le Luberon« vom Tisch und schlug sie auf. Ein Kajakfahrer war in der Schlucht von Verdon ertrunken, die Fußballmannschaft von AC Arles-Avignon hatte unglücklich verloren, und die Wettervorhersage versprach siebenundzwanzig Grad. Kein Wölkchen und die dritte Woche in Folge ohne Regen. Die Waldbrandgefahr hatte inzwischen die höchste Stufe erreicht.
Schließlich schlug Pascal seine Lieblingsrubrik auf. Eine Serie über das Kochen. Rezepte und Zutaten aus der Region, Küchentipps von Köchen aus dem Luberon, manchmal auch Interviews mit Küchenchefs.
Er hatte noch immer den Traum, eines Tages ein eigenes Restaurant zu eröffnen, sein großes Hobby, das Kochen, zu seinem Beruf zu machen, aber er hatte es nicht eilig damit. Er wollte sich hier in der Region weiterbilden, Kontakt zu Erzeugern aufnehmen, mehr über die lokale Küche der Provence erfahren und deren von ihm so geschätzte Einfachheit studieren. Das riet ihm auch seine Tochter Lillie, seine liebste Kritikerin, die mit Claude, einem Sternekoch aus Lyon, verlobt war und gerade den dritten Termin für eine Hochzeit verschoben hatte. Es gab in Claudes neu eröffnetem Restaurant »L’estragot« zu viel zu tun. Die Romantik musste der Arbeit weichen. Die Gastrogesellschaft aus der Stadt mit den meisten Sternerestaurants der Welt überrannte das kleine Bistro. Schon wenige Wochen nach der Eröffnung war es als Favorit für den nächsten Michelin-Stern gehandelt worden. »L’estragot« hatte es bereits auf das Titelbild namhafter Gourmet-Magazine geschafft.
Lillie, das war sein Eindruck, arbeitete Tag und Nacht an der Seite ihres zukünftigen Mannes. Sie war seine einzige Tochter, und noch immer gab es keinen Tag, an dem er sich nicht irgendwelche Sorgen um sie machte.
»Verschollene Rezepte«, stand in großen Lettern über der Rubrik, die die wichtigste Tageszeitung der Provence seit Wochen als Sensation feierte. Aus einer ungenannten Quelle waren Rezepte aufgetaucht, die auf die Ursprünge der Haute Cuisine zurückzuführen waren und die dem modernen Kochen eine neue Tradition, wie der Gourmet-Journalist es in dem Artikel immer wieder betonte, zurückgaben.
In der Tat waren die Rezepte interessant, schon allein deshalb, weil Gemüse verwendet wurde, das von den Speisekarten und aus den Supermärkten verschwunden war. Selbst Vogelarten wie die Wandertaube tauchten in der modernen Küche nicht mehr auf, die Zucht von einigen Schafrassen war über die Jahrhunderte eingestellt worden oder wurde nur noch von vereinzelten Schäfern betrieben. Die Herausforderung, die Gerichte nach diesen Rezepten zu kochen, bestand darin, zunächst einmal die Zutaten zu bekommen.
Pascal war sich sicher, dass kaum ein Leser bereit war, die Zeit zu investieren, die nötigen Lebensmittel zu besorgen. Er war eine Ausnahme, und das wusste er. Er hatte die Zeitungsartikel gesammelt und nahm sich Woche für Woche ein neues Rezept vor, das er nachkochte. Der Ansturm auf die Wochenmärkte in der Hauptsaison erschwerte ihm die Suche nach den vergessenen Gemüsesorten. Erdbeerspinat wurde längst nur noch als Dekoration auf dem Tisch oder im Garten verwendet, Rübstiel war über die Jahre sogar gänzlich aus den Gemüsegärten verschwunden.
In den Touristenströmen gab es in den Sommermonaten auf den Märkten kein Vor und Zurück mehr. Eingeklemmt zwischen Korbtaschen, Käsesorten und Seifenauslagen stand Pascal schon in den ersten Frühjahrswochen oft eine knappe Stunde in sengender Hitze auf den Dorfplätzen und gab die Suche am Ende schweißüberströmt auf. Er nahm sich vor, es im Herbst, wenn die Sommerferien vorbei waren, erneut zu probieren.
Er musste lernen, zu verstehen, dass er Zeit hatte, dass er nicht alles sofort und jetzt zu tun brauchte. Nicht wie in Paris, wo dauernde Verpflichtungen über sein Leben bestimmt hatten.
Nachdem seine Tochter ausgezogen war und sich seine Frau Arm in Arm mit einem Pariser Immobilienmakler aus seinem Leben verabschiedet hatte, war Pascal zunächst in ein Loch gefallen. In ein sehr tiefes Loch, in dem er erst wieder Licht sah, als er die Entscheidung gefällt hatte, ein neues Leben in der Provence zu beginnen.
Er hatte noch keine Freunde in seiner neuen Heimat gefunden, nur einige gute Bekannte, darunter natürlich vor allem Audrey, die Assistentin der Police nationale aus Apt. Ein paarmal war er mit ihr essen gegangen – und hatte das Gefühl der Funken, die über die Weingläser flackerten, genossen, aber etwas Ernstes hatte sich zwischen ihnen noch nicht entwickelt.
So blieb ihm viel Zeit, wenn er die Mairie in Lucasson abends abschloss, über den Dorfplatz zu seinem Renault Mégane schlenderte und die kurze Fahrt zu seinem alten Mas vor den Toren von Lucasson antrat. Jedes Mal wenn er die Tür seines kleinen Hauses aufschloss, durchströmte ihn eine Art von Glück, das er bisher im Leben nicht gekannt hatte. Es war nicht das Gefühl von Urlaub allein, das ihm diese Wohligkeit gab, sondern vielmehr ein Gefühl des Angekommenseins. Jeden Tag öffnete er die kleine Terrassentür, sog die warme Abendluft in seine Lungen und lauschte in die Hügel der Provence.
Der Bürgermeister von Lucasson, Jean-Paul Betrix, hatte ihm zum Einzug ein paar Hühner geschenkt, sodass er jeden Abend zunächst die Eier einsammeln musste, bevor er sich ans Kochen machte.
Was für ein Leben, dachte er oft, wenn er vor seinem Trüffelomelett oder seinem Lammbraten saß.
Aber von Argenteuil-Spargel, von dem in den Zeitungsartikeln die Rede war, hatte er noch nie etwas gehört. Eine vergessene Spargelart, die laut dem französischen Bauernverband eigentlich gar nicht angebaut werden durfte. Siebzehntausend Euro Strafe musste man als Gemüsebauer allein dafür zahlen, den Samen zu besitzen. Den Bauern, die für die vergessenen Gemüsesorten kämpften, war das egal, es ging ihnen um den Genuss. »Gemüseschmuggler«, stand als Zwischenüberschrift in dem Artikel. An die seltene Spargelsorte heranzukommen kostete selbst einen passionierten Koch wie ihn mindestens den Besuch von drei Wochenmärkten.
Ihm als aufmerksamem Leser der Rubrik war aufgefallen, dass die Gerichte immer einen Zusammenhang zur Gesundheit hatten. Dem Argenteuil-Spargel wurde die Gabe einer kompletten Körperentgiftung nachgesagt. Früher seien die Rezepte meist von Apothekern verfasst worden, stand dort. Ein kleiner Nebensatz wies Pascal darauf hin, dass es sich heute um den letzten Artikel dieser Art handele und er sich in der nächsten Woche schon auf die Soßenrezepte freuen dürfe.
Er legte zwei Euro auf den Tisch, schob die Zeitung in seine Aktentasche und grüßte zwei kleine Jungs, die ihn ehrfürchtig anschauten. Die Faszination einer Polizeiuniform war Kindern in dem Alter anzusehen.
Als er am Waschhaus vorbeiging, klingelte sein Handy. »Chevrier.«
Obwohl er die Nummer aus Apt erkannte, wusste er nie genau, wer dran war. Sein Kollege Frédéric Dubprée persönlich oder seine höchst attraktive Assistentin Audrey. Er spürte die Wärme, die in seine Wangen fuhr, den angenehmen Schauer, der über seinen Rücken lief, als er ihre Stimme hörte.
»Hier ist Audrey.« Sie klang jung, jünger, als sie in Wahrheit war. Auch ihr Wortschatz (das war Pascal schon oft aufgefallen) hatte etwas Jugendliches, etwas Forsches und manchmal Provokantes. »Viel zu tun?«, fragte sie, und diesmal lag Spott in ihrer Stimme.
Sie konnte nicht ahnen, dass die wenige Arbeit, abgesehen von einem Mordfall, den er gleich in den ersten Wochen in seiner neuen Heimat aufzuklären hatte, genau das war, wonach Pascal gesucht hatte. Er scheute sich nicht vor Arbeit, aber je länger er in dem Beruf des Gendarmen arbeitete, desto mehr trennte er wichtige von unwichtigen Tätigkeiten. Es gab die Unverbesserlichen, die Kleinkriminellen, die immer wieder Fahrräder klauen, Autos knacken oder der Drogenkriminalität verfallen würden und die er immer wieder festnehmen musste, um sie danach wieder laufen zu lassen, weil sie entweder zu jung waren oder unter Alkoholeinfluss standen. Aber es gab auch die komplizierten Fälle, die Morde aus Liebe, Rache oder Gier. Sie waren weitaus komplexer, erforderten Konzentration, Psychologie und genaues Hinschauen – und das waren die wahren Stärken von Pascal Chevrier.
Audreys nächster Satz klang vielversprechend. »Lust auf ein Abendessen?«
»Ein Rendezvous«, sagte Pascal und lächelte in sein Handy.
»Ach, was soll ich nur mit dir machen?« Auch in Audreys Tonfall lag ein Lächeln. »Frédéric Dubprée hat mich gebeten, mit dir zu sprechen.«
»Unromantischer geht es wohl nicht.«
»Kommt darauf an, wie lange wir für das Thema brauchen«, konterte Audrey.
»Wann passt es?«
»Neunzehn Uhr in Lourmarin in der ›L’insolette‹?«
»Ich dachte, wir wollen essen gehen.« Pascal bemühte sich, entrüstet zu klingen. »Ich führe dich heute aus. Mit allem, was dazugehört.« Er wertete Audreys Schweigen als Einverständnis.
Als er wenig später die Serpentinenstraße nach Apt hinunterfuhr, um dann Richtung Lucasson abzubiegen, schien bereits die Nachmittagssonne auf seine Windschutzscheibe. Er kurbelte die Scheiben herunter, legte seinen inzwischen braun gebrannten Arm auf die Fensterkante und schaltete das Radio ein.
»Non, je ne regrette rien«, sang Édith Piaf.
2
Audrey trug ein ärmelloses schwarzes Kleid, das über den Knien endete, dazu flache, ebenfalls schwarze Schuhe. Um den Hals eine schlichte silberne Kette. Ihr dunkles halblanges Haar hatte sie zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Ihre Halsmuskeln waren deutlich zu sehen. Sie hatte bereits eine Menge Sonne getankt, ihre braune Haut war makellos.
Der Geruch von Sommer umwehte Pascal, als er ihr die üblichen drei Küsschen auf die Wange gab, die ein wenig länger dauerten, als es sich gehörte. Sie hatte dezenten, fast farblosen Lippenstift aufgetragen. Alles an ihrer Erscheinung war von einer zurückhaltenden Klasse. Die wenigen Sommersprossen auf der Nase verliehen ihr etwas Mädchenhaftes.
Ein Kellner fing sie vor dem Restaurant ab und geleitete sie zu einem der Tische auf dem Gehsteig vor dem Restaurant.
»Zwei Champagner«, antwortete Audrey auf die Frage nach einem Aperitif.
Pascal lächelte und schob die kleine Vase mit einer Rose ein Stück zur Seite, um Audrey betrachten zu können. Eine kurze Pause entstand, in der jeder seinen Gedanken nachhing. Pascal hatte plötzlich das Gefühl, etwas sagen zu müssen. »Worum geht es?«
Doch Audrey legte einen Finger auf die Lippen. »Hörst du die Stille?«
Pascal schwieg.
»Obwohl ich von hier komme, hier aufgewachsen bin und meine Kindheit hier verbracht habe, genieße ich sie immer wieder. Bald kommen die Touristen und werden diesen Ort in ein nicht enden wollendes Stimmengewirr tauchen.«
Der Champagner wurde auf den Tisch gestellt, die Bläschen trieben im Abendlicht nach oben und zerplatzten. Pascal erhob sein Glas, ein leises Klirren, ein wohliger Schauer, als der kalte Champagner über seine Zunge lief.
»Das Getränk ist irgendwie sexy, oder?«, bemerkte Audrey verschmitzt lächelnd, als sie beide zur Speisekarte griffen, die neben einem kleinen Pizza- und Pasta-Angebot vor allem traditionell zubereitete Gerichte aus der Gegend bereithielt. Lammkarree in Kräuterkruste oder Artischocken à la barigoule.
Um besser lesen zu können, setzte Audrey eine der dunklen Hornbrillen auf, die seit einiger Zeit wieder en vogue waren, und ließ ihren Finger langsam über die Seiten der Speisekarte laufen. Dabei bewegte sie ihren Mund, als würde sie jemandem die Gerichte vorlesen.
Pascal musste sie immerfort anschauen. Als sich ihre Blicke trafen, fühlte er sich ertappt.
»Ich nehme die gegrillte Dorade mit Spinat und Rosmarinkartoffeln«, sagte Audrey, »und als Vorspeise Salade niçoise.« Sie hatte sich für das Plat du jour, das Tagesgericht, entschieden.
Als der Kellner schließlich aus dem Restaurant über die kleine Kopfsteinpflasterstraße zurück an ihren Tisch kam, hatte Pascal noch nicht einmal die Speisekarte aufgeklappt. So bestellte er einfach das Gleiche. Er hatte schon immer ein Faible für Frauen gehabt, die gutes Essen und guten Wein schätzten. Audrey brachte beide Eigenschaften mit – und wahrscheinlich noch viele andere mehr, die ihn dahinschmelzen lassen würden. Vielleicht würden sie sich eines Tages vollkommen privat treffen. Vielleicht würde er ihr eines Tages sein Haus zeigen, das er noch renovieren musste, um Besuch zu empfangen. Außer dem Bürgermeister Jean-Paul Betrix, der gleichzeitig auch sein Vorgesetzter war, so wie es in Dorfgemeinschaften üblich war, hatte kaum jemand die Schwelle seines Hauses übertreten – und Betrix auch nur, um ihm die Hühner zu bringen. Wahrscheinlich waren sie ein Vorwand gewesen, um seine krankhafte Neugier zu stillen. Was kostete schon ein Huhn?
»Also«, begann Audrey und faltete ihre Hände über dem Tisch zusammen, sodass sich die Haut über ihren zarten Gelenken spannte. »Frédéric Dubprée hat mich gebeten, es nicht zu hoch zu hängen, und er bat ebenfalls um Vertraulichkeit. Ich schätze, das wird dich nicht wundern, wenn ich dir diese Geschichte erzählt habe.«
Pascal nickte erwartungsvoll.
»Frédéric Dubprée hat gesagt, dass vielleicht gar nichts daran sei. Dass es sich um einen makabren Scherz eines Geistesgestörten handeln könnte. Aber wenn nicht, dann haben wir es mit einem Fall zu tun, der uns lange beschäftigen könnte.« Audrey kräuselte ihre Stirn, ließ die Falten aber sofort wieder verschwinden, als die Vorspeise kam. »Bon appétit«, wünschte sie, bevor sie mit der Gabel kunstvoll ein Salatblatt zusammenlegte und es in ihrem Mund verschwinden ließ.
Auch Pascal probierte seinen Salat und versuchte wie üblich, die Zusammensetzung des Dressings zu analysieren. Die Bemerkung, dass der Koch zu viel Essig benutzt hatte, verkniff er sich.
»Gestern«, sagte Audrey zwischen zwei Salatblättern, »ist ein Souschef aus Bonnieux zu uns in die Gendarmerie gekommen und hat uns etwas erzählt, das Frédéric Dubprée seitdem nicht mehr loslässt.«
Pascal lehnte sich gespannt über den Tisch. »Du weißt wirklich, wie man Geschichten aufbaut«, bemerkte er kauend.
»Merci. Der Souschef war ziemlich durcheinander, so als hätte er ein Gespenst gesehen. Du weißt, wie jemand aussieht, der gerade ein Gespenst gesehen hat?«
»Natürlich, wer nicht?«
Sie kicherten wie Teenager.
»Jedenfalls«, fuhr Audrey fort, »hat seine Stimme gezittert, und seine Augen waren geweitet. Er hat uns erzählt, dass er in der ›Brasserie Le Fleur de Bonnieux‹ arbeite, einem beliebten Treffpunkt der Geschäftsleute nach Feierabend, nur knapp hundert Meter den Berg vom Markt hinunter. Das Restaurant ist für seine feine Küche bekannt.«
Der Kellner hielt Pascal die geöffnete Weinkarte hin.
»Nicht nötig, wir nehmen den Rosé des Hauses.« Pascal kannte den Winzer bereits, er hatte sein Weingut, das »Château Constantin«, direkt vor den Toren von Lucasson. Ein Weingut, das auf groß angelegte Touristenverkostungen verzichtete, denn die geringen Mengen, die produziert wurden, reichten gerade, um die Stammkunden und die Restaurants zu beliefern, die seit Jahren auf den Wein schworen.
»Eine gute Wahl, Monsieur«, sagte der Kellner anerkennend, ging über das Kopfsteinpflaster zurück in das Restaurant und kam kurz darauf mit dem Rosé wieder.
Eine Pause entstand, zwei deutsche Touristen hatten sich an den Nachbartisch gesetzt und versuchten mit Hilfe eines Wörterbuchs, die Speisekarte zu verstehen. Zwischen ihnen lag ein Prospekt des Schlosses von Lourmarin, auf dem am Abend ein lang angekündigtes Franz-Liszt-Konzert stattfinden sollte. Plakate wiesen seit Wochen auf dieses Event hin. Die Touristen waren bereits in Abendgarderobe und schwitzten in der untergehenden Sonne, als sie mit Hilfe skurriler Gesten das Kaninchen bestellten. Der Mann im Smoking ließ es sich nicht nehmen, seine vorgeschobenen Vorderzähne zu präsentieren und hoppelnde Bewegungen mit dem Oberkörper nachzuahmen, bis der Kellner sich freundlich, aber leicht verschämt vom Tisch entfernte. »Oui, le lièvre.«
»Pascal?«
Pascal fuhr herum, er war abgetaucht in die Szenerie am Nebentisch. »Oui, pardon, erzähl weiter.«
»Ich will es gar nicht zu spannend machen«, fuhr Audrey fort, »jedenfalls hat der Souschef wie üblich morgens die Ware der örtlichen Boucherie angenommen. Das Fleisch kommt ausschließlich aus der Region. Die Stammkunden schätzen das. Der Souschef und der Lieferant kennen sich seit Jahren, und wie üblich hat er die Lieferung nicht überprüft. Die Männer vertrauen einander. Sie haben noch ein paar Minuten den neuesten Dorfklatsch ausgetauscht und sich schließlich verabschiedet. Dann hat der Souschef die Ware wie immer zum Kühlraum geschoben und ausgepackt.«
Der Kellner erschien und schob ihnen die gegrillten Doraden auf den Tisch. Pascal bedankte sich, der Kellner verschwand wieder.
»Bon appétit«, wünschte diesmal Pascal.
»Die Geschichte ist gleich zu Ende.« Audrey machte keine Anstalten, ihr Besteck in die Hand zu nehmen. »Das, was ich dir jetzt erzähle, darf niemand erfahren. Beim Auspacken hat der Souschef ein ungewohnt kleines Stückchen Fleisch vorgefunden, das er zunächst nicht zuordnen konnte. Es war unbeweglich und kalt, hat er gesagt, weil es gefroren war, kälter als der Rest der Lieferung. Er wusste nicht, um was es sich handelte. Und dann plötzlich hat er es erkannt, denn das harte Ende des Stücks war eindeutig ein Fingernagel … Es war ein menschlicher Daumen.«
Audrey schüttelte sich. Ihre Augen waren geweitet, die Belustigung über die Skurrilität, die sonst ihrem Naturell entsprach, war Fassungslosigkeit gewichen.
»Ein Finger!«, sagte sie, als wollte sie sichergehen, dass Pascal auch verstand.
Noch immer hatte sie das Besteck nicht angerührt, und auch Pascal hatte Messer und Gabel wieder neben seinen Teller gelegt.
»Der Souschef habe, wie er sagte, unter Schock gestanden, als er das Stück Fleisch identifiziert hat. Er sei ins Bad gelaufen, habe sich sogar übergeben müssen, dann sei er vor die Tür gegangen, habe sich mit zitternden Fingern eine Zigarette angezündet und überlegt, was er tun solle. Er hat uns erzählt, dass er eine halbe Stunde lang das Restaurant und das Kühlhaus nicht mehr habe betreten können, ihm graute vor dem Anblick. Wer kann es ihm verdenken?«
Pascal erwischte sich dabei, wie er auf seinen Teller schaute, um zu prüfen, ob auch nur Dinge darauf zu finden waren, die er bestellt hatte. »Niemand«, murmelte er schließlich.
»Dann wollte er sich ein zweites Mal von seinem unheimlichen Fund überzeugen«, fuhr Audrey fort, »und ist wieder zurück zu der Fleischkiste gegangen. Und jetzt, Pascal, wird die Geschichte komisch und surreal. Der Finger war weg. Der Souschef hat die Kiste mehrmals durchwühlt, jedes einsortierte Fleischstück ein zweites Mal aus dem Kühlraum genommen und es überprüft. Der Finger war nicht zu finden. Jemand musste ihn bereits herausgenommen haben. Wer auch immer. Vor lauter Aufregung ist er nicht wie üblich durch den Hintereingang in den Hof des Restaurants gegangen, sondern durch den Vordereingang. Das Restaurant war noch geschlossen, nur das Personal ist nach und nach eingetroffen. Aber an niemandem war eine Veränderung zu bemerken. Keiner hat sich komisch oder unsicher verhalten. Es sei alles wie immer gewesen, hat der Souschef beteuert. Niemand außer ihm schien etwas bemerkt zu haben, niemand hat den Finger gesehen, geschweige denn ihn aus dem Weg geräumt.«
Endlich machte Audrey eine Pause und nahm das erste Stück Fisch auf ihre Gabel. »Alles wie immer«, wiederholte sie.
Pascal war nicht der Typ, der Dinge herunterspielte. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass, auch wenn die Geschichte noch so verrückt klang, ein Funken Wahrheit darin verborgen sein könnte. Eine Eigenschaft, die er mit den Pariser Polizisten nie gemein hatte. Sie versuchten, einen Fall nach dem anderen abzuhaken, obwohl das kleinste letzte Indiz noch nicht geklärt war – und so sagte er nur: »Dieser Sache müssen wir auf den Grund gehen.«
Jetzt lächelte Audrey wieder und winkte ab. »Vielleicht wirklich nur die Spinnerei eines Verrückten, der sich wichtigmachen wollte. Vielleicht ein Schlachter, der sich den Finger abgetrennt und es nicht öffentlich gemacht hat.«
Überzeugt klang sie nicht, fand Pascal.
Schweigend aßen sie ihre Dorade. Mit geübten Fingern filetierte Audrey den Fisch, nahm das Gerippe zwischen Gabel und Messer und legte es auf den Grätenteller in der Mitte des Tisches. Mit einem kleinen Schnitt an der Oberseite des Fisches entfernte sie die letzten Seitengräten, dann nahm sie die Zitronenscheibe und gab einige Spritzer über das weiße Doradenfleisch. Während sie Pascal über den Tisch hinweg anlächelte, wischte sie ihre Finger an der Serviette ab und schaute noch einmal zufrieden auf ihren Teller.
Pascal schenkte den Rest aus der Flasche des »Château Constantin« erst Audrey und dann sich selbst ein. Er prostete ihr zu. Ein angenehmes, nicht angestrengtes Schweigen lag über dem kleinen Tisch.
Pascal empfand die Stille zwischen zwei Menschen als ein zutiefst befriedigendes Gefühl. Ein geradezu mächtiges Kommunikationsmittel, bei dem die Kunst darin bestand, dass niemand sich verpflichtet fühlte, das Schweigen zu brechen, sondern sich dem wortlosen Austausch hingab.
Schließlich war es Audrey, die das Wort ergriff. »Dass Frédéric Dubprée von der Police nationale dich ein zweites Mal um Hilfe bittet, dürftest du als Ehrerbietung auffassen.«
Pascal nickte nur, während er mit der Zunge nachspürte, ob es ihm genauso kunstvoll gelungen war, die Gräten komplett aus der Dorade zu entfernen. Er war zufrieden, nicht aber mit Audreys Bemerkung. Für ihn war es keine besondere Ehre, schließlich war er es aus Paris gewohnt, für die Police nationale tätig zu sein und nicht für die Gendarmerie, was noch immer neu für ihn war.
Es war ein freiwilliger Schritt gewesen, die Arbeit als Polizist in einer Großstadt gegen das beschauliche Leben eines Dorfgendarmen im Luberon einzutauschen. Dennoch empfand er es als angenehm, mit dem scharfsinnigen, ruhigen Commissaire der Police nationale, die dem Innenministerium unterstellt war, zu arbeiten und nicht nur für den cholerischen, machtbewussten Bürgermeister Jean-Paul Betrix, der wie in den meisten Orten in der Provence auch der Gendarmerie übergeordnet und somit sein direkter Vorgesetzter war. Man konnte die Gendarmen in ganz Frankreich an einem Finger abzählen, die für die Police nationale arbeiteten. Seit Jahren versuchte man in Frankreich eine engere Zusammenarbeit, aber in den meisten Regionen vergebens. In der Regel hatte man nur Hohn und Spott füreinander übrig.
Noch immer schien Audrey auf eine Antwort zu warten, doch Pascal wollte das Gespräch in eine andere Richtung lenken. Der Wein in den frühen Abendstunden entspannte ihn nicht nur, er machte ihn auch euphorisch und für seine Verhältnisse forsch. »Ich würde gern für dich kochen, Audrey.«
Geheimnisvoll lächelnd legte Audrey das Besteck auf ihren leeren Teller. »Ist das eine Einladung in dein Mas?«
Pascal nickte und spürte, wie ihn eine angenehme Aufregung durchströmte. »Ich muss es nur noch ein wenig herrichten, es ist noch näher an einer Baustelle als an einem Heim, in dem ich mich wohlfühle. Aber die Küche ist bereits in einem einsatzfähigen Zustand.« Er sah Audrey erwartungsvoll über sein Glas hinweg an.
Sie sagte nichts, nickte nur, während ihre dunklen Augen in seinen ruhten. Schließlich setzte sie ihr Glas mit dem Rosé an ihre Lippen.
3
Auch nach einem halben Jahr als Gendarm im Luberon hatte für Pascal die Landschaft nichts von ihrer Faszination verloren. Im Gegenteil. Immer wieder entdeckte er neue Details, immer wieder entfuhr ihm ein »Ist das schön!«, wenn er seinen Renault Mégane durch die Weinberge steuerte, vorbei an den Gewächshäusern, in denen die Tomaten bereits rot geworden waren, den Melonenfeldern, den Obst- und Gemüsehändlern, die ihre Ware in beeindruckenden Stapeln auf den Markttischen präsentierten, und den Dörfern, die sich in die Bergmassive hineingefressen hatten. Und immer wieder die leuchtenden Lavendelfelder, die sich in der letzten Woche wie aus dem Nichts durch die Landschaft entrollt hatten und signalisierten, wie bereit sie für das Leben waren.
Der Weg von Lucasson führte vorbei an Lourmarin, mitten hinein in das Bergmassiv mit den sich immer höher aufbauenden weißen Felsen, fünfzehn Kilometer über den einzigen Durchgang, den man durch den Petit Luberon nehmen konnte. Eine Serpentinenstraße, die sich durch die Schlucht nach oben und unten schlängelte. Ein ausgetrocknetes Flussbett begleitete die Strecke eine Weile, andere Gebirgsbäche bahnten sich ihren Weg durch die Landschaft, auf den ersten Blick fast unsichtbar.
Die wenigen Kilometer zu fahren bedeutete höchste Konzentration. Nur eine kleine Steinmauer trennte die Straße von den abfallenden Bergen. Manchmal waren es lediglich Pfeiler, die das Ende der Straße kennzeichneten, gefolgt von Warnschildern, die auf besonders scharfe Kurven hinwiesen.
Immer wieder nutzten Motorradfahrer die wenigen Geraden des Passes, um Pascal mit laut röhrenden Motoren zu überholen. Ebenso einheimische Autofahrer, die einen Gang herunterschalteten, um schnell an dem schleichenden Polizisten vorbeizukommen, und ihre Motoren ebenfalls aufheulen ließen, während sie den Mégane mit einem halb vorwurfsvollen, halb mitleidigen Blick straften, bevor sie sich vor ihm wieder einfädelten.
Pascal war ständig darauf gefasst, hinter der nächsten Ecke auf eine Gruppe von Radfahrern zu treffen, die in ihren Profitrikots zwar gut zu erkennen waren, sich aber wenig um die Autos scherten, die in letzter Sekunde das Lenkrad herumreißen mussten, um der Trainingseinheit kein plötzliches Ende zu bereiten.
Nach knapp dreißig Minuten erreichte Pascal das hoch gelegene Bonnieux, das am Nordeingang zum Erosionstal thronte. Seinen Wagen parkte er direkt vor der kleinen »Brasserie Le Fleur de Bonnieux«, die noch weit über der Hauptstraße am Berghang lag und in den Sommermonaten von wohlhabenden Touristen und Einheimischen aufgesucht wurde, die bereit waren, auch für einen Mittagstisch über zwanzig Euro zu berappen. Die Küche hatte einen guten Ruf, die Sicht über den Petit Luberon war legendär. Ein Glas oder eine Karaffe Rosé in den Mittagsstunden und der Nachmittag schrie nach Müßiggang oder einem Schläfchen im Schatten der Platanen.
Als Pascal die Brasserie betrat, konnte er nur mit Mühe einer Kellnerin ausweichen, die ihr Tablett mit mehreren Gläsern Champagner an ihm vorbei- und durch die Tür zur Terrasse hinausbalancierte.
»Pardon«, blieb ihm nur noch zu sagen, während er ihr nachschaute.
Der Blick über den Petit Luberon ergriff ihn mit einer Macht, die ihn plötzlich Demut vor der Natur spüren ließ. Schließlich riss er sich von dem Anblick der blühenden Lavendelfelder und der Weinreben los und ging zur Bar im Restaurant.
»Pascal Chevrier, Chef de police Lucasson«, stellte er sich der jungen Frau vor, die inzwischen wieder an ihm vorbei hinter den Tresen gegangen war und versuchte, ein Bier zu zapfen. Ihre Bewegungen waren hektisch. Pascal beobachtete sie einen Moment, wie sie mit einem Handtuch den ständig überlaufenden Schaum wegwischte.
»Merde«, sagte sie, ehe sie sich Pascal zuwandte. »Haben Sie das schon einmal probiert?«
Unbeschwerte Bilder seiner späten Schuljahre tauchten vor seinem inneren Auge auf, als er sich sein Taschengeld in einer Studentenkneipe verdient hatte. »Oui, lassen Sie mich mal.« Ohne zu fragen, ging er hinter den Tresen, hielt ein Glas schräg unter den Zapfhahn und ließ das Bier behutsam hineinlaufen. Die Krone reichte genau bis zum Glasrand. »Voilà«, sagte er zufrieden.
Die Frau lächelte anerkennend.
»Ich würde gern Ihren Chef sprechen«, sagte Pascal.
Die Kellnerin musterte ihn prüfend und begutachtete seine Uniform. »Deux minutes«, sagte sie schließlich und verschwand nach einem kurzen, kritischen Blick auf das Glas durch eine kleine Tür hinter der Bar.
Für eine Weile war Pascal allein im Gastraum, das Bier sackte müde in sich zusammen, sodass er nicht anders konnte, als es mit einem weiteren Zapfvorgang wieder in Form zu bringen. Dann setzte er sich auf die Seite der Bar, an der die Gäste normalerweise Platz nahmen.
Nach fünf weiteren Minuten kam die Kellnerin wieder aus der Küche, dicht gefolgt von einem schwergewichtigen Mann in einer weißen Kochuniform und mit einer hohen Mütze. Die Schwingtür ächzte, als er sich auf die Türkante stützte. Seine Kleidung war so makellos, als hätte sie noch nie Kontakt zu einer Soße oder einem Fleischspieß aufgenommen. Frisch gebügelt und nach Waschmittel duftend wirkte sie wie ein feiner Anzug, zugegeben, mit etwas zu vielen Knopfreihen.
»Elias Martin«, stellte sich der Mann kaum verständlich vor. Missbilligung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Mit einer zögernden Bewegung reichte er Pascal seine fleischige Hand, ohne ihm ein Getränk anzubieten. Offensichtlich spürte er, dass der Gendarm nicht wegen der Küchensauberkeit gekommen war, an den Auflagen des Gesundheitsamtes nicht interessiert schien und auch keine Kaffeepause einlegen wollte.
Mit einem lauten Schnauben fiel er auf einen Barhocker hinter dem Tresen, sodass er seinem Besuch gegenübersaß. »Ich habe keine Zeit, was wollen Sie von mir? Sie sehen, was hier los ist.«
Pascal ließ seinen Blick durch das leere Restaurant schweifen, sah aus dem großen Bodenfenster über die kleine Kopfsteinpflasterstraße auf die andere Seite zur Terrasse, wo sich vier Gäste an einem der Tische mit Champagner zuprosteten. Nur ein zweiter Tisch war noch besetzt. Er nickte. »Ja, ich sehe, was hier los ist.«
Als er Elias Martin wieder anschaute, bemerkte er einen Schweißfilm auf dessen Stirn. Er hatte die Statur eines Mannes, der oft schwitzte, weißfleischig, mit Falten, in denen sich das Salzwasser sammelte.
»Wir haben eine Nachricht von Ihrem Souschef erhalten. Er hat gestern die Ware angenommen, das wissen Sie sicher. Er hat einen abgetrennten Finger in der Lieferung gefunden.«
Elias Martin blickte zur Seite und lächelte unbeholfen seine Kellnerin an, die Champagner einschenkte und die Gläser auf ein Tablett stellte, um zu dem einzigen weiteren Tisch zu gehen, der besetzt war. Erst als sie das Restaurant verlassen hatte, setzte er mit unbeholfener Stimme an. »Dann haben Sie mehr als ich erfahren. Er hat heute Morgen gekündigt. Per SMS. Nach neun Jahren. Einfach nur eine Nachricht. Wollen Sie sie sehen?« Er griff unter seine Schürze in seine Hosentasche, zog sein Handy hervor, hielt das Display wenige Zentimeter vor seine Augen und scrollte mit seinem dicken Daumen durch eine Reihe von Nachrichten. »Hier ist sie«, stellte er schließlich fest und reichte Pascal sein Telefon. »Ein Finger also.« In seiner Stimme lag keinerlei Verunsicherung.
»›Das, was passiert ist, kann ich nicht vergessen‹«, las Pascal. »›Wie soll ich jemals wieder in einer Küche arbeiten? Behalte meinen Lohn, ich komme nicht wieder. Rufe mich nicht an, es ist zwecklos.‹« Er prüfte auch weitere Mitteilungen, die der Souschef dem Koch in den letzten Wochen geschickt hatte. Es handelte sich vor allem um Details zu Bestellungen und eine Reihe von Uhrzeiten, die sein Eintreffen ankündigten.
Pascal nahm sein Notizbuch aus der Innentasche seines Jacketts und schrieb den Namen des Absenders auf: Henry Terrault. Außerdem notierte er sich die Nachricht vom Display, in der Hoffnung, später irgendwelche Hinweise aus den Zeilen herauslesen zu können, vielleicht das zu verstehen, was dazwischen stand. Zunächst war es nur eine schnell heruntergetippte Kündigung, die auf eine Kurzschlusshandlung schließen ließ.
»Was genau ist passiert?«, fragte er, als er das Telefon über den Tresen schob.
Elias Martin schnaufte verächtlich. »Ihr elenden Flics, ihr Nervensägen, als ob Sie es nicht wüssten. Glauben Sie, ich habe auf dieses Katz-und-Maus-Spiel Lust? Ich weiß von nichts. Alles, was ich erfahren habe, weiß ich aus dieser Nachricht hier.« Er klopfte auf seine Hosentasche, in die er das Handy zurückgesteckt hatte. »Dass ein Finger gefunden wurde, von dem ich nichts weiß, ist auch für mich als Koch eine Katastrophe. Nicht auszudenken, wenn das publik wird.« Er hatte seine Stimme bedrohlich angehoben. Aus dem Schweißfilm waren Schweißtropfen geworden. Auf seinen Wangen bildeten sich kleine rote Stressflecken in unterschiedlichen Größen und Formen.
Wieder öffnete sich die Tür zur Terrasse. Erst jetzt bemerkte Pascal einen Hund mit einem ebenso beeindruckenden Körperumfang wie der seines Herrchens. »Ihr Hund?«
Elias Martins Augen flackerten, für den Bruchteil einer Sekunde hellte sich sein ganzes Gesicht auf. Dann nickte er kräftig, während sich seine Falten am Hals bedrohlich nach vorn wölbten.
»Also, Monsieur Martin, was genau ist gestern in Ihrem Restaurant passiert?«
Elias Martin wies auf seine Kellnerin und bedeutete Pascal, zu warten, bis sie das Restaurant wieder verlassen hatte. Sie tat ihm den Gefallen und öffnete erneut die Glastür. Der Hund ließ sich mit einem ähnlichen Laut, wie ihn sein Herrchen vor wenigen Minuten ausgestoßen hatte, unter einen der Tische fallen. Ein kurzes Grunzen, ein Kratzen der Pfoten auf den Fliesen im Restaurant, dann war es wieder still.
»Ihr elenden Flics«, wiederholte Elias Martin.
Flics. Pascal hatte das Wort eine lange Zeit nicht mehr gehört, diese abfällige Bezeichnung für einen Polizisten in Großstädten. Er beschloss, die Beleidigung zu ignorieren, in dem Wissen, dass es jetzt schon eine Kleinigkeit gab, die er gegen den zutiefst unsympathischen Mann in der Hand hatte. Auch wenn eine banale Amtsbeleidigung nicht gerade das war, was er sich von dem Gespräch erhofft hatte. Eine weitere Frage, eine geschickte Formulierung, ein weiterer Trick der Kommunikation war nicht nötig.
»In Ihrem Restaurant wurde ein abgetrennter Finger gefunden, der ebenso schnell wieder verschwand. Wo, glauben Sie, könnte der jetzt sein, Monsieur Martin?«
»Das wüsste ich auch gern«, sagte der Koch in einer Beiläufigkeit, die Pascal erschrecken ließ. Als hätte er ihn gefragt, ob er einen Regenschirm gefunden habe, den er am letzten Tag hier vergessen hatte. Seine Reaktion zeugte von stoischer Gelassenheit.
»Wie Sie sich sicher denken können, handelt es sich bei dem Finger um ein wichtiges Beweisstück.« In Pascals Stimme lag inzwischen Ungeduld.
»Ich weiß es nicht«, beharrte Elias Martin. »Aber glauben Sie, ich hätte Sie nicht verständigt, wenn ich Genaueres mitbekommen hätte? Und woher wissen Sie denn, ob das überhaupt stimmt? Haben Sie mit meinem Souschef gesprochen?«
»Oui, Monsieur, das haben wir.«
Elias Martin schnaufte erneut, seine Augen blinzelten. Die Flecken in seinem Gesicht hatten sich zusammengetan, bildeten jetzt ein sattes Rot. »Hören Sie, ich kann Ihnen nicht mehr sagen als das. Ich habe weder den Finger gesehen, noch war ich bei der Lieferung dabei. Und Sie haben ja gelesen, dass ich meinen Mitarbeiter nicht einmal mehr anrufen darf. Vergessen wir das also alles.«
Pascal wartete noch einen Moment, musterte den Koch, beobachtete ihn, ob Unsicherheit in ihm aufstieg, doch da war nichts. Nur das rote Gesicht.
»Wer sagt denn, dass es so war?«, setzte Elias Martin schließlich fast versöhnlich nach, so als wolle er die Dramatik aus der Situation nehmen. Seine Frage ging direkt in die nächste über. »Möchten Sie etwas trinken, Monsieur Chef de police?«
Pascal gefiel die Art und Weise nicht, wie Elias Martin die Worte »Chef de police« überbetonte, wie er sie zum Spott in die Länge zog, wieder diese Ruhe vorgaukelnd. Dass er den Begriff »Flic« gegen die eigentliche Amtsbezeichnung ausgetauscht hatte, stimmte ihn nicht milder.
Mühsam richtete Elias Martin seinen massigen Körper auf und holte aus dem Kühlschrank eine bereits geöffnete Champagnerflasche, verschlossen mit einem Plastikkorken, den man in der Gastronomie verwendete.
Pascal hob dankend die Hand. »Bin im Dienst.«
»Augen auf bei der Berufswahl«, grunzte Elias Martin, goss nur sich Champagner ein, trank einen Schluck und stellte das Glas auf den Tresen.
»Also bitte, Monsieur Martin. Sie werden mir jetzt genau sagen, was passiert ist. Ich habe Zeit, und ich glaube nicht, dass Sie mich hier als Stammgast haben möchten. Immer dieser Flic in der Uniform, der hier ein und aus geht. Ob die Gäste das mögen?«
Elias Martin hob das Glas und führte es zu den Lippen, dann sah er Pascal an wie ein kleiner Junge, als hätte man ihn gerade bei einem Streich erwischt. »Es hilft nichts, Sie werden es ohnehin erfahren.« Jetzt schien er sich Mut anzutrinken.
»Es war vorgestern alles wie immer. Um elf Uhr kam François, der Lieferant der Boucherie aus Aix-en-Provence, bestens aufgelegt. Ich war gerade hier im Gastraum. Hinten fuhr der Wagen heran, wie jeden Tag. Mein Souschef«, er räusperte sich, »oder sagen wir lieber, mein Ex-Souschef Henry Terrault nahm das Fleisch entgegen. Dann quatschten sie noch ein bisschen, wie sie es immer machen. Die beiden sind ja in einem Alter, beide Anfang dreißig. Da hat man ähnliche Themen, Frauen und so.«
Mit wässrigen Augen starrte Elias Martin aus der großen Glastür auf seine Kellnerin, die neben dem Eingang stand und ihre Finger liebevoll über das Display ihres Smartphones wischte. Ein Lächeln umspielte ihre Lippen.
Pascal wollte sich nicht in die Gedankengänge des Mannes versetzen. »Was ist dann passiert, Monsieur Martin?«
Mit einer ruhigen Bewegung setzte der Koch das Champagnerglas wieder an die Lippen. »Als der Lieferant schon eine ganze Weile verschwunden war, hörte ich die Tür am Hinterausgang der Küche ins Schloss fallen. Als hätte sie jemand zugeknallt, es klang wütend. Das Fleisch hatte Henry bereits aus der gekühlten Styroporkiste genommen. Es lag teilweise auf der Anrichte, teilweise aber auch auf dem Boden der Küche. Das ist untypisch für ihn. Henry Terrault ist ein ordentlicher Mann, einer, bei dem man vom Boden essen kann.« Er zögerte. »Ich werde ihn, glaube ich, vermissen.« Mit einer letzten schnellen Bewegung leerte er das Glas. Dann drehte er sich wieder zurück zum Kühlschrank und schenkte sich nach. Er winkte mit der Flasche. »Sicher nichts?«
Pascal schüttelte den Kopf. Auch wenn ihm jetzt selbst nach einem Champagner zumute war, wollte er seine Prinzipien nicht über Bord werfen, sich dem provenzalischen Koch gegenüber nicht verführen lassen.
»Ich stand also in der Küche zwischen all dem halb ausgepackten Fleisch«, fuhr Elias Martin fort. »Gerade wollte ich nach Henry rufen, was ihm einfiel, auf diese Weise unsere Ware zu behandeln, da sah ich es selbst. Neben einer Gänsekeule, die auf dem Boden lag, als hätte man sie weggeworfen, war ein kleines Stück Fleisch. Es sah aus, als hätte man es aus einem Huhn herausgeschnitten. Ich bückte mich und betrachtete es. Der Daumen war mit einem sauberen Schnitt am Gelenk abgetrennt. Offensichtlich ist eine Geflügelschere benutzt worden. Ich mochte das Ding nicht aufheben, ich ekelte mich plötzlich. Ich wollte gerade einen Bratenwender holen, um den Finger vorsichtig zu untersuchen, doch als ich zur Schublade ging, um ihn zu holen, war es bereits zu spät.«
»Was war zu spät?« Pascal war die Anspannung in der Stimme anzuhören.
Elias Martin sagte nichts, er nickte nur in den Raum hinein.
Pascal beobachtete ihn gespannt.
Wieder nickte der Koch, diesmal deutete er in Richtung Tisch.
Dann sah auch Pascal ihn – den Hund. Den dicken Hund.
4
In nur wenigen Wochen war Lucasson zum Leben erwacht. Viele der optimistischen Café- und Restaurantbesitzer hatten im Winter ihre Stühle und Tische auf den Gehsteigen und dem Marktplatz, der Place de la Fontaine, stehen lassen, sodass sie schon ab März besetzt wurden.
Noch nie zuvor hatte Pascal Menschen gesehen, die dem Winter, den Wolken und den wenigen Regentagen mit einer solch tiefen Abneigung begegneten wie die Südfranzosen. Auch in den kältesten Monaten Januar und Februar hatten sich die Einheimischen in dicken Jacken und Schals in die Sonne gesetzt und mit Hilfe von Heizstrahlern eine Form des Frühjahrs simuliert.
»Der Provenzale isst im Freien«, hatte ihm vor Kurzem Jacques, der Besitzer des »Café Tabac«, erklärt, an dessen Tischen auch Pascal schon oft gesessen hatte. Der mürrische Zigarettenladenbetreiber und Zeitungshändler bot vor allem den Einheimischen ein Petit-déjeuner an, das rein preislich nicht einmal die Kosten einer Zeitung überschritt.
Wie der Mann, in dessen Mundwinkel stets ein Zigarettenstummel hing und der immer dasselbe Hemd trug, diesen Preis für Croissants und Kaffee halten konnte, war Pascal ein Rätsel. Daher gab er ihm auch heute ein großzügiges Trinkgeld.
Man hatte sich aneinander gewöhnt. In der »Kennenlernphase« hatte es gewisse Schwierigkeiten zwischen ihnen gegeben, die jedoch nach dem gewaltsamen Tod eines Amerikaners im Örtchen beigelegt werden konnten. Damals hatte ein Multimillionär aus Pennsylvania es gewagt, eine Golfanlage zu planen, für die der berühmte Trüffelwald am Ortsrand dem Erdboden hätte gleichgemacht werden sollen. Den Einwohnern von Lucasson hätte die Anlage zwar einen gewissen Wohlstand gebracht – die Grundstückspreise im Umland wären explodiert –, aber die traditionelle Lebensweise der Menschen im Petit Luberon wäre in Gefahr geraten. Ein Traditionalist wie Jacques hätte sich niemals an die Protzerei der russischen und amerikanischen Touristen in seinem Heimatdorf gewöhnen können, sodass er erleichtert gewesen war, als der alte Maurice Perieux noch den amerikanischen Immobilienhai beseitigt hatte, bevor er selbst für immer die Augen geschlossen hatte.
Ob Jacques den doppelten Preis, den Pascal für das Frühstück gezahlt hatte, überhaupt registrierte, war seiner Miene nicht anzusehen.