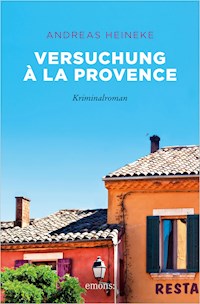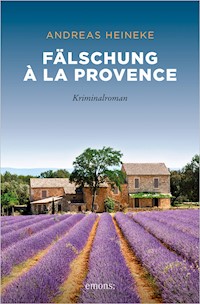Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pascal Chevrier
- Sprache: Deutsch
Pascal Chevrier hat das Großstadtleben in Paris satt und nimmt die Stelle eines Dorfgendarms im Luberon in der Provence an. Doch statt Rosé und Baguette auf alten Steinmauern im Sonnenuntergang steht der Mord an einem amerikanischen Immobilienmogul auf dem Speiseplan. Die Spur führt tief in die Trüffelhändler-Szene, die vor nichts haltzumachen scheint – und Pascal in eine höchst brenzlige Situation bringt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Andreas Heineke ist Journalist, Regisseur und Filmemacher. Er arbeitet seit fast dreißig Jahren in den Medien, unter anderem für den NDR, die ARD, das ZDF und das Schweizer Fernsehen. Außerdem arbeitete er viele Jahre für ein Kochformat im ZDF. 2012 veröffentlichte er seinen ersten Provence-Roman und in den folgenden Jahren mehrere Sachbücher zu unterschiedlichen Themen. »Tod à la Provence« ist sein erster Krimi. Wenn er nicht gerade auf ausgedehnter Recherchereise in einem provenzalischen Restaurant sitzt, lebt er mit seiner Tochter und seiner Frau in der Nähe von Hamburg.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: iStockphoto.com/Tree4Two Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-187-1 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für meine geliebte Familie, insbesondere für meine Frau Marga und meine Tochter Lucie, sowie für meinen Freund Christian. Jeder hat mich auf seine Weise unterstützt und inspiriert.
Prolog
Bill legte seine braun gebrannte Hand auf den Gasknüppel seiner Yacht und schob ihn behutsam nach vorn. Der Motor wurde für ein paar Sekunden lauter, eine fast senkrecht aufsteigende, kaum sichtbare Rauchfahne zog über den Hafen von Saint-Tropez.
Angel und Victoria lächelten sich an und prosteten sich auf der schneeweißen Lederrückbank mit Dom Pérignon zu. Vor ihnen auf dem weißen Tisch stand ein Weinkühler, der die Magnum-Flasche kalt halten sollte. Die Gläser waren beschlagen, Bläschen stiegen auf und zerplatzten an der Oberfläche.
Die Sonne hatte den Mädchen eine gesunde Bräune verliehen, in ihre durchtrainierten Körper hatten sie viel Geld und Arbeit investiert. Vor allem unter den BHs und an den flachen Bäuchen sah man das Ergebnis. Angel trug einen blauen Bikini mit weißen Sternen, Victoria einen rot-weiß gestreiften. Wenn sie ihre Hintern aneinander hielten, war die amerikanische Flagge in Apfelform zu erkennen. Beim Ablegemanöver drückten sie ihre Rücken durch, ihre Brüste kamen dann noch besser zur Geltung. Eine antrainierte Bewegung, die ihre Wirkung noch nie verfehlt hatte.
Der ältere Herr mit dem grauen Haar und der weißen Leinenhose stand am Hafen und winkte der kleinen Reisegruppe freundlich zu. Er lächelte, und seine Lippen formten die Worte »Bon Voyage«. Gerade eben war er selbst noch auf der Yacht gewesen und hatte in den Augen von Angel und Victoria ein viel zu langes, unglaublich langweiliges Gespräch mit Bill über Immobilien geführt. Am Ende war die Atmosphäre gelöst gewesen, Bill war in Hochstimmung geraten und hatte mit dem Mann noch ein Glas Rotwein getrunken, irgendeinen Lafite-Rothschild– bei der Hitze.
Angel und Victoria wussten, dass die Fahrt nicht lange dauern würde, nur raus aufs Meer, in Sichtweite des Hafens von Saint-Tropez. Der Anblick der schönen Häuser und der Yachten der Konkurrenz versetzte Bill in Bestlaune. Es ging ihm nie ums Fahren, der Auftritt war entscheidend, man musste gut aussehen, wenn man etwas Spektakuläres tat, das war schon immer sein Motto gewesen, und damit war er weit gekommen und sehr reich geworden.
Er war doppelt so alt wie die beiden jungen Damen, die in gekonnter Pose ihren Kopf in den Nacken gelegt hatten und um die Wette kicherten, aber er war in bester körperlicher Verfassung. Das betonte er stets gern, wenn er mit geschickten Händen ihre BHs öffnete und mit einem Lächeln seine Finger unter ihre Röcke schob. Dann rochen sie sein teures Parfüm. Seine trainierten braunen Arme fassten um ihre Taillen, und es endete dort, wo es immer endete– in der mit Tropenholz getäfelten Kajüte, im extra ausladenden Designerbett. Nachts feierten sie ihre kleinen Tête-à-Têtes an Deck, ebenfalls gut sichtbar für die anderen Yachtbesitzer mit ganz ähnlichen Interessen.
Heute befand sich noch eine weitere Frau an Bord, Valencia. Ihr Job war es, auf das Kind aufzupassen. Jack. Er war gerade drei Jahre alt. Schon jetzt liebte er die Geschwindigkeit der Yacht, das Gefühl, wie sich sein Polohemd aufblähte, wenn Papa den Hebel nach vorn drückte, bis er am Anschlag war, und ihm seine langen blonden Haare ins Gesicht flogen. Er lachte dann immer.
Mit seiner orangen Schwimmweste saß er eng neben Valencia, während die Yacht aus der Hafenanlage auf das blaue Mittelmeer hinaussteuerte. Eine Brise wehte, in der Ferne bildeten sich Schaumkronen.
Dann kam der schönste Moment. Bill drückte den Hebel noch weiter herunter, und der Motor katapultierte den Bug des Bootes aus dem Meer. Ein lautes Brummen machte Gespräche jetzt unmöglich.
Ein Lächeln umspielte Bills Lippen. Er rückte seine Gucci-Sonnenbrille zurecht. Nach zehn Minuten hatten sie die Bucht von Saint-Tropez verlassen, die anderen Yachten fuhren Richtung Nizza oder lagen träge vor Anker, die Badeleitern ausgeklappt.
Bill nickte Valencia zu, die mit dem kleinen Jack zum Bug des Bootes gegangen war. Jacks Lieblingsplatz, hier konnte er stundenlang sitzen, die Beine über die Reling hängen lassen, Fische beobachten, ins Meer spucken und »Ich sehe was, was du nicht siehst« mit Valencia spielen. Sein Vater war in der Kajüte verschwunden, er hatte die beiden kieksenden Mädchen an der Hand hinuntergeführt. Das Kind freute sich darüber. Papa ging es gut, das wollte er auch Mama sagen, wenn sie mal wieder anrief.
Auf dem weißen Bett hatte Bill es sich gemütlich gemacht. Große Spiegel an den Wänden, überall Leder, ein Fernseher stand auf der Kommode. Hier konnte er sich auf dem Sportkanal die spektakulärsten Golfspiele der Welt ansehen.
Er leerte sein Glas, woraufhin Victoria ihm den Champagner direkt aus der Flasche in den Mund laufen ließ. Die Hälfte ging daneben und landete auf dem Laken. Angel ließ lasziv ihr Bikini-Oberteil zu Boden gleiten, doch Bill sah zwei Angels, beide nackt, die stöhnten, ohne dass er sie berührt hatte. Er wirkte plötzlich hilflos, wie er seine Hand ins Nichts streckte. Die Perspektive hatte sich in Sekundenschnelle vor seinen Augen verschoben. Bill rieb sie sich zunächst, fast belustigt über die Wirkung des Champagners.
»Bill«, sagte Victoria und stellte die Flasche auf den silbernen Nachtschrank. Sie schien jetzt irgendwo ganz weit hinten zu stehen, draußen auf dem Meer, da wo Meer und Himmel aufeinandertreffen.
»Komm her«, sagte er, während er seine Hose auszog. »Gib mir mehr Champagner«, raunte er Angel zu, »mein Mund ist so trocken.«
Victoria lächelte, nein, sie lachte.
»Mein Job. Es gibt aber etwas, was ich noch besser kann.« Während sie das sagte, öffnete Angel ihrenBH. Victoria schüttelte sich vor Lachen, die strohblonden Haare fielen ihr über ihre nackten Brüste.
Nahtlos braun, wollte Bill sagen, aber es drang nur ein trockener Husten aus ihm heraus.
»Alles okay mit dir? Fühlt sich jedenfalls alles richtig an.« Angel kicherte, während sie sich von ihrer Feststellung mit den Fingern überzeugte.
»Was sind das für Wellen?« Bill hielt sich am Bett fest, seine Pupillen waren geweitet. Er starrte die Mädchen wie ein Fisch aus dem Aquarium an. Das Meer war vollkommen ruhig.
»Wasser«, stöhnte er. »Und was macht Jack hier?«
Angel blickte sich verwirrt um. »Jack? Bill, dein Sohn ist an Deck. Was ist los?«
»Mein Herz.« Bill spürte, wie der Schlag seines Herzens immer mehr an Tempo zunahm. Immer schneller, immer schneller, wie der Geschwindigkeitsanzeiger auf seiner Motoryacht. Er hob ab. Von oben sah er, wie Victoria und Angel nackt umschlungen zu ihm aufschauten, wollte nur diesen Kloß im Mund herunterschlucken, glaubte, es war Speichel, doch es fühlte sich wie Watte an, die seine Kehle verschloss.
Er würgte, es war ein trockenes, ein abgehacktes Würgen, und versuchte, den Kopf zu heben, doch eine Art Lähmung im Halswirbel machte jede Bewegung unmöglich. Bin ich auf dem Weg, ein Pflegefall zu werden?
Bill begann, sich über seine eigenen Gedanken zu wundern, die sich zu verselbstständigen schienen. Er sah ein Schloss mit einer gigantisch großen Eingangstür, versuchte sie zu öffnen, doch die Klinke ließ sich nicht bewegen, also drehte er sich wieder um und schaute in die Richtung, in der der Vorgarten des Schlosses gewesen war. Dort befand sich aber jetzt ein Golfplatz.
Bill kämpfte gegen die Müdigkeit an, die seine Gedanken immer langsamer werden ließ, denn er wollte noch sehen, was als Nächstes Verrücktes passierte. Er hatte sein Leben lang Angst gehabt, irgendetwas zu verpassen, und so war es auch in dieser Minute. Er wollte noch zu Ende schauen, was seine Phantasie für ihn bereithielt.
Und es lohnte sich. Er sah sich selbst, wie er mit einem Jahrhundertschlag einen Golfball mit seinem Schläger traf, wie er mit seinem gesamten Körper elegant nachfederte und der weiße Ball in den blauen Himmel tauchte und schließlich verschwand. Dann ließ er die Müdigkeit zu. Einen Moment die Augen zumachen, das wär’s, dachte er.
Sein Herzschlag hatte noch weiter an Geschwindigkeit zugenommen. Aus dem Augenwinkel sah er alles doppelt. Die Mädchen, den Golfball, den Champagner.
Ein letzter Moment der Klarheit, sein Sohn, seine Ex-Frau, irgendetwas Lilafarbenes, dann stolperte ihn sein Herz in die ewige Dunkelheit.
Dreißig Jahre später
1
Pascal schloss den Reißverschluss seiner Jacke, als er an einem der drei kleinen Bistrotische auf dem holprigen Bürgersteig vor dem »Café Tabac« Platz nahm. Er atmete tief ein und spürte die klare, kalte Luft in seiner Lunge. Es roch nach feuchtem Moos. Der Mistral war in den letzten Tagen durch das Tal gefegt, hatte die Luft gereinigt und die Wolken aus Südfrankreich vertrieben. Dies ist also einer der dreihundert statistischen Sonnentage im Jahr, dachte er.
Noch vor einem Monat hatte er in den trüben Pariser Nachthimmel geblickt und ein letztes Mal den Raketen des öffentlichen Silvesterfeuerwerks am Eiffelturm nachgeschaut, die nach wenigen Sekunden vom tief hängenden Nebel verschluckt worden waren.
Pascal hörte die Kaffeemaschine aus dem »Café Tabac« zischen und ächzen, während sie ihrer täglichen Arbeit nachging.
Wenn Alexandre mich jetzt hier sitzen sehen würde, dachte er, streckte die Füße so weit es ging unter dem kleinen Bistrotisch aus und beobachtete auf der anderen Straßenseite eine Frau, die einen argwöhnischen Blick auf den Unbekannten warf. Wahrscheinlich erregte er die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner, da er sich trotzig der Kälte stellte und bei unzumutbaren zwölf Grad einen Platz im Freien gewählt hatte. Genau so aber sollte sein erster Tag in der Provence aussehen, das hatte er sich in seiner Pariser Wohnung all die Monate wieder und wieder vorgestellt, als er sein neues Leben plante.
Die Frau sah aus, als würde sie zum Wintersport fahren, mit ihrer Thermojacke, dem dicken Schal und den Skihandschuhen, mit denen sie eine Plastiktüte mit Lauchstangen umklammerte.
Pascal grüßte sie, deutete ein Nicken an. Einfach, weil ihm danach war. Lässig verschränkte er die Arme hinter dem Kopf. Das tat er gern, wenn er sich wohlfühlte.
Die Frau deutete ebenfalls einen Gruß an, indem sie kaum merklich die grüne Plastiktüte mit den Lauchstangen anhob. Angestrengt setzte sie ihren Weg auf der ansteigenden Straße fort, bog um die Ecke des gegenüberliegenden Hauses und verschwand aus Pascals Blickfeld.
Im Sommer würde die Mittagshitze den Weg durch diesen Teil Lucassons äußerst beschwerlich machen. Wie eine Glocke wird sie über den engen Gassen des Dorfes liegen, stellte Pascal sich vor.
Die Türen im Ort waren auch heute verrammelt, die blauen und roten Fensterläden geschlossen. Der letzte Regen konnte noch nicht lange her sein. Die drei kleinen Tische im Schatten der Markise waren noch feucht, ebenso wie der Boden darunter. Die Sonne würde die Pflastersteine schnell trocknen.
Seit fünfzehn Minuten saß Pascal nun schon an dem kleinen Tisch. Außer der Frau auf der anderen Seite der Straße war bislang niemand vorbeigekommen. Auch kein Kellner. Pascal störte sich nicht daran, vielleicht würde er ihm sagen, wie schön es hier war und dass er sich bloß Zeit lassen solle, schließlich waren sie in der Provence. Die Uhren schlichen hier manchmal ein bisschen, und das war nur einer der vielen Gründe, warum er jetzt hier an diesem Tisch saß.
Interessiert betrachtete er die heruntergekommene Eingangstür, das Leuchtschild »Café Tabac– Chez Jacques«– was für ein lustiger Reim, dachte er–, die Markise, die nur noch auf einer Seite in der Verankerung hing, den verrosteten Fahrradständer, die runden Tische, mühsam mit durchweichten Bierdeckeln abgestützt, damit sie nicht zu sehr kippelten. Sie standen so auf dem Fußgängerweg, wie sie auch zu Tausenden vor Pariser Cafés standen. An diesen Tischen wurde tagtäglich Zeitung gelesen, Kaffee getrunken, beobachtet, gestritten, geliebt, gelogen und geschworen.
Gerade als er der Ruhe lauschte, kam ein Mann an seinen Tisch. Zunächst hielt Pascal ihn für einen jener Obdachlosen, die ihm eine Zeitung verkaufen wollten. In seiner alten Heimat hatte es zwei Arten von Bettlern gegeben. Die einen standen in den Metrostationen und spielten komplizierten Jazz, die anderen verkauften Zeitungen, die sie selbst geschrieben und gedruckt hatten. Was Pascal schlimmer fand, wusste er gerade auch nicht.
»Bonjour, Monsieur.« Auf seinen Gruß erntete Pascal ein Kopfnicken, das nur als solches zu erkennen war, wenn man genau hinschaute. Er sah genau hin, konnte aber kein Lächeln, kein Wohlwollen im Gesicht des Mannes entdecken, nur eine fast vollkommen heruntergebrannte Zigarette im Mundwinkel.
Natürlich, es ist sieste, dachte Pascal. Die Mittagspause war hier im Süden heilig, egal, wie warm oder wie kalt es war. Wahrscheinlich ist es Jacques und kein Obdachloser, dachte er und beobachtete, wie der Kellner den feuchten Tisch betrachtete, an dem er saß.
Für einen Moment war es ein Stillleben, und Pascal fürchtete, es würde nichts passieren, aber er täuschte sich. Der Mann zog wie ein Magier, mit einer Geste, nach der man hätte applaudieren müssen, einen feuchten Lappen aus seiner Hosentasche und wischte damit über den Tisch. Als ihm Zigarettenasche auf die gerade gesäuberte Marmorplatte fiel, nahm er seine mit schwerer Hornhaut überzogene Hand und schnippte sie mit dem kleinen Finger von der Oberfläche. Der Lappen wurde kein zweites Mal bemüht, er verschwand wie ein weißes Kaninchen nach seiner Darbietung wieder in der Hosentasche.
»Voilà.« Jetzt war der Mann bereit, die Bestellung entgegenzunehmen, das spürte Pascal.
Er nutzte seine Chance und sagte mit fester Stimme: »Un pastis, Monsieur.«
Keine Regung in dem bärtigen Gesicht. Hätte man den Mann auf den Pariser Straßen durchsuchen müssen, hätte zumindest sein ehemaliger Partner Alexandre es nicht ohne seine weißen Plastikhandschuhe getan. Das cremefarbene Oberhemd, das wohl einmal weiß gewesen war, wurde nur noch von der Hälfte der Knöpfe zusammengehalten. Die heutige sieste hatte der Mann vermutlich in genau diesem Hemd verbracht– und die der letzten Woche genauso.
Rasch steckte er es noch ein Stück tiefer in die Hose. Vielleicht eine Art Ritual, denn das Hemd musste wohl auch diese dezente Prozedur nicht zum ersten Mal über sich ergehen lassen. Dunkle Spuren führten von der Mitte des Stoffes bis zu dem unteren Teil, der in der Hose verschwand.
Pascals Blick blieb an dem Gürtel hängen, der auf dem letzten Loch, halb herunterhängend, nur noch mit letzter Mühe seinem Job nachkam. Die Kniepartie der Anzughose wirkte, als hätte sie schon häufig Bekanntschaft mit dem Fußboden der Bar gemacht. Möglich, dass Jacques den Boden damit gewischt hatte. In den Hosentaschen schien sich ein ganzer Werkzeugkasten zu befinden, so tief hingen sie am Oberschenkel.
Pascal erwartete von dem Mann inzwischen kein Kopfnicken mehr, keine Regung, die ihm zeigte, dass es ihn überhaupt gab. Sosehr er sich mehr Ruhe im Leben wünschte, so sehr mehr zweifelte er in diesem Moment, ob er jemals auch nur eine einzige so langsame Bewegung hinbekommen konnte wie dieser Jacques. Erst nach einer halben Ewigkeit drehte er sich behäbig um und verschwand wieder in seinem Café.
Pascal reckte seine Arme so weit nach oben, wie es seine über vierzigjährigen Knochen und Muskeln gerade noch zuließen. Es knackte laut. Die Autofahrt war lang gewesen, und der Weg von der weit unten liegenden Stadtmauer hatte ihn angestrengt. Über viele Treppen, über sehr viele Treppen und über Steigungen. Immer wenn er geglaubt hatte, es geschafft zu haben, kam die nächste Steigung und die nächste und die nächste.
Er sah sich in seiner neuen Heimat um. Tausendvierhundert Einwohner lebten großzügig verteilt auf einundfünfzig Quadratkilometern. Er, Pascal Chevrier, der neue Chef de police, war der tausendvierhunderterste.
Er würde viel Zeit haben, sich dem Tempo der Menschen hier anzupassen. Er würde in den warmen Monaten auf den alten Steinmauern am Dorfrand sitzen, vielleicht ein Baguette in Olivenöl tunken, dabei eine Flasche kalten Rosé entkorken, über die Lavendelfelder blicken und den Sonnenuntergang über der Provence genießen. Außer dem gelegentlichen Summen einer Biene oder dem Zwitschern eines Vogels würde er bestenfalls mal einen Motor starten hören.
Ich hätte schon früher aus meinem Leben aussteigen sollen, dachte er und erinnerte sich mit Grauen an die Nächte in Paris.
Noch letzte Woche hatte er mit geweiteten Augen in die Mündung einer Pistole gesehen, die ein Jugendlicher auf ihn gerichtet hatte, während er mit der anderen Hand einen halb vollen Benzinkanister über die Brüstung der Pont Neuf in die Seine schmiss und dabei debil grinste. Er und sein Partner Alexandre waren zu Hilfe gerufen worden, weil mitten in der Stadt ein Auto gebrannt hatte. Ein Bild, an das sich die Bewohner der Pariser Vororte vielleicht gewöhnen konnten, nicht aber die wohlhabenden Pariser, die einen Quadratmeterpreis von bis zu sechstausendfünfhundert Euro für eine Wohnung in bester Lage, natürlich rechts der Seine, hinblätterten. Sie hatten ein Anrecht auf Ruhe und Sicherheit. Schließlich zahlten sie dafür Steuern, und Pascal war einer von denen, die davon ihren Lohn bekamen. Also musste er auch dafür sorgen, dass seine Geldgeber zufrieden waren.
Wie oft hatte er sich in all den Jahren diesen und ähnliche Sprüche von seinem Chef anhören müssen, wenn er zu spät zu einem Raub, zu einem Autounfall mit Fahrerflucht oder zu einer Schlägerei gekommen war. Er hatte das Leben als Polizist in der Großstadt so sattgehabt, dass die letzten Monate zu einer unerträglichen Tortur geworden waren. Erst als er seine Wohnung endgültig aufgelöst hatte, als er die wenigen Möbel, die ihm seine Frau Catherine nach der Scheidung noch gelassen hatte, verkauft oder verschenkt hatte, als er den obligatorischen Abschiedsdrink im Kreise seiner Kollegen kurz vor Weihnachten auf der Gendarmerie im siebten Arrondissement zu sich genommen hatte, konnte Pascal wieder durchatmen.
Egal, was passieren würde, es konnte nur aufwärtsgehen. Bei diesem Gedanken fühlte er sich so gut wie seit Jahren nicht mehr.
Jacques brachte den milchig aussehenden Pastis an den kleinen Tisch. Der Kellner brummte etwas Unverständliches an seiner wieder fast vollkommen abgebrannten Zigarette vorbei und entfernte sich in dem gleichen, von Ruhe durchdrungenen Tempo.
Pascal spürte den Alkohol schon nach dem ersten Schluck. Er war es nicht gewohnt, um diese Uhrzeit zu trinken, und natürlich war das auch eine Ausnahme, denn als Dorfgendarm im Dienst war Alkohol verboten, sofern man überhaupt von Dienst würde sprechen können.
Ein träumerisches Lächeln huschte über seine Lippen. Er würde sich um Hühnerdiebe kümmern, um entlaufene Katzen, und im Sommer müsste er vielleicht Touristen erklären, dass in dieser Kulisse aus dem 12.Jahrhundert tatsächlich noch Menschen lebten, die ein Anrecht auf Ruhe hatten.
Er hatte kürzlich in einem Reiseartikel gelesen, dass Napoleon 1815 auf seinem Weg von Cannes nach Grenoble kurz in Volonne haltmachen musste. Heute würde man den kurzen Halt wohl »Pinkelpause« nennen. Dort, wo sich der kleine Kaiser erleichtert hatte, war heute eine Steintafel angebracht, auf der man den Weg seines Urins in den Straßenasphalt nachverfolgen konnte.
Es waren vor allem Japaner, die sich dort kniend, mit lachendem Gesicht, von anderen Japanern mit japanischen Kameras ablichten ließen. Vielleicht würden er und seine Kollegen dort mal vorbeischauen müssen, um nach dem Rechten zu sehen.
Pascal lief ein angenehmer Schauer über den Rücken, als er an die überschaubaren Aufgaben dachte, die vor ihm lagen. Ohnehin waren seine Tage als Gendarm gezählt, schon bald würde er sich auf die Suche nach einer Bar machen, die er als begeisterter Hobbykoch zu einem kleinen Bistro umbauen wollte. Ob sein Traum von einem eigenen Restaurant schon in diesem oder erst im nächsten Jahr umgesetzt werden würde, war ihm egal. Es kümmerte ihn auch nicht, ob sein Restaurant direkt in Lucasson oder in einem der Nachbarorte Lacoste, Roussillon, Bonnieux oder gar in dem vollkommen überteuerten Gordes sein würde. Das gesamte Département Vaucluse kam in Frage, solange er nur hierbleiben konnte, an seinem ganz persönlichen Sehnsuchtsplatz.
Mit einem letzten schnellen Schluck ließ er den Pastis die Kehle hinunterlaufen, setzte das Glas schwungvoll zurück auf den Tisch und ging in das Bistro, um zu zahlen.
Zwei Männer saßen bei einem Glas Rotwein an der Bar, als Pascal freundlich grüßend nach dem Kellner Ausschau hielt. Er war überrascht, noch mehr Gäste zu sehen. Mit einem Nicken wurde sein Kommen zur Kenntnis genommen.
Jacques lehnte so an der Bar, dass die Männer sich auch im Flüsterton gut verständigen konnten. Sie unterbrachen das Gespräch, als Pascal einen Fünf-Euro-Schein auf die Theke legte. Jacques suchte sehr umständlich nach seinem Portemonnaie, doch Pascal winkte ab, nickte freundlich in die Runde und machte sich schließlich zurück auf den Weg zum Parkplatz. Einen Moment blieb er noch neben der Kirche auf dem Dorfplatz stehen, um die klare Luft einzuatmen und den Blick über seine neue Heimat schweifen zu lassen.
Sein Renault Mégane war bis unter das Dach bepackt. In dem geliehenen Anhänger befanden sich die paar Habseligkeiten, die ihn in sein neues Leben begleiten sollten. Pascal stieg ein, startete den Motor und fuhr einen weiten Bogen über den Parkplatz. Er schaltete das Navigationssystem ein, in das er schon in Paris die Adresse des Bauernhofs von Madame Perieux eingegeben hatte. Sie hatte am Telefon einen netten Eindruck gemacht.
Die kleine Einliegerwohnung auf ihrem Bauernhof und Weingut lag am Dorfrand von Lourmarin. Seinen Weg zur Arbeit würde Pascal in Zukunft nicht mehr in halb gebeugter Haltung in der überfüllten Metro verbringen, sondern inmitten der provenzalischen Hügellandschaft auf der einzigen Nord-Süd-Passage, die der Luberon vorzuweisen hatte.
Die Straße, ein kleiner kurviger Bergpass, führte direkt durch die Berge an der Grenze des Petit Luberon und des Grand Luberon entlang. Für die vierzehn Kilometer brauchte man laut Google Maps gut und gern eine halbe Stunde. Wieder und wieder hatte er sich diese Strecke im Netz angeschaut, ihm war, als wäre er sie schon zigmal gefahren.
Er stellte sich vor, wie er im Sommer bei geöffnetem Fenster den Lavendel- und Thymiangeruch noch in der Nase haben würde, wenn er an seinem neuen Arbeitsplatz in Lucasson eintraf.
Das Weingut hatte auf den Fotos im Internet ansprechend ausgesehen. Das Leben auf einem bewirtschafteten Anwesen war genau das Richtige für ihn. Endlich musste er nicht mehr jeden Abend allein in der Küche essen. Fortan würde er an einem langen Tisch im Freien zu Abend speisen. Um ihn herum die Wein- und Viehbauern, die sich nach harter Arbeit auf dem Feld eine Extraportion aus dem großen Topf in der Mitte auffüllten, sich dann mit dem Rosé zuprosteten und den Sonnenuntergang über den Hügeln der Provence genossen. Pascal würde zu einem Teil von alledem werden. Irgendwann wollte er seinen eigenen Gemüsegarten anlegen, seine eigenen Kartoffeln anbauen, Zucchini und Tomaten. Vor allem die coeur de boeuf hatten es ihm angetan. Jahr für Jahr würde er die Samen aus den Tomaten trocknen und sie im nächsten Jahr wieder einpflanzen.
2
»Monsieur Chevrier«, rief Madame Perieux aus, als Pascal mit seinem Renault auf den Hof einfuhr. Ihr Lächeln war herzlich, ihr Alter schwer zu schätzen, vielleicht um die fünfzig. Pascal fand es immer schwierig, das Alter der Menschen zu schätzen– gerade bei den Südeuropäern altert die Haut durch die viele Sonne schneller.
Madame Perieux hatte einen aufrechten Gang und kleine, tippelnde Schritte. Ihr dunkles, mit einigen grauen Strähnen durchzogenes Haar war schulterlang und wurde von einer silbernen Spange zusammengehalten. Bevor sie Pascal auf die linke und rechte Wange küsste, klassisch, ohne ihn zu berühren, wischte sie ihre Hände an einer eleganten roten Schürze ab, die sie um ihre schmale Hüfte gebunden hatte.
»Chloé Perieux, und das«, sie machte eine ausladende Geste, »ist Château Sept. Vielleicht ist das Wort ›Château‹ ein bisschen übertrieben, aber schon vor dreihundert Jahren hieß dieses Haus Château Sept, und warum sollten wir es umbenennen? Endlich kennen die Leute auch unseren Wein, da macht sich ›Château‹ auf dem Etikett besser als ›Domaine‹.« Sie lachte herzlich und wiegte den Kopf von einer auf die andere Seite, dabei ließ sie ihren neuen Mieter nicht aus den Augen.
»Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Wohnung«, sagte sie und verschwand im Haus.
Pascal betrat eine große Diele. Es roch nach Braten, Knoblauch und Thymian, aus der Küche waren Stimmen zu hören. Die Tür stand einen breiten Spalt offen. Pascal lugte vorsichtig hindurch. Das Personal fachsimpelte offenkundig über die richtige Zubereitung.
Die Küche erinnerte in ihrem Ausmaß eher an eine Restaurantküche als an einen Ort, an dem die Familie sich das Abendessen zubereitete. Der große Gasherd in der Mitte, das Herzstück, hatte acht Platten, zwei große kupferfarbene Töpfe standen darauf, darüber eine große Abzugshaube. Die Wand über der großen Arbeitsplatte war mit bunten, sehr alten Kacheln verziert. Zwei Männer schnitten etwas, sie hatten Pascal den Rücken zugewandt.
Große Fenster ließen so viel Abendsonne herein, dass die Küche in rötliches Licht getaucht war. Auf den Fensterbänken standen Kräuter. In Paris wären es Hanfplantagen gewesen, hier im Luberon waren es Kräuter.
Schon durch den Türspalt erkannte Pascal die ungeheure Menge von Kräutern, einige sahen aus wie Unkraut, sie schienen ungenießbar zu sein. Möglich, dass er hier in der Provence seinen Kochstil ändern würde, wenn er die Vielfalt und die Möglichkeiten der südfranzösischen Natur in seine Gerichte integrierte.
»Abendessen um achtzehn Uhr«, sagte Madame Perieux. »In unserer Diele.« Sie zeigte auf den langen Tisch. »Von Frühjahr bis Herbst sitzen wir dort draußen, an dem langen Steintisch unter den Platanen.« Sie hob ihre Hand wie eine Fürstin Richtung Fenster, als würde sie einen Schlossgarten präsentieren. Ihre Bewegung hatte etwas Stolzes.
Die Bäume sahen gewaltig aus, wie sie ihre kahlen Äste in den Abendhimmel streckten. Das Nachmittagslicht ließ sie Schatten werfen, die wie lange Finger über den Steinboden im Hof liefen.
»Sie müssen uralt sein«, merkte Pascal an.
»Ja, so wie vieles hier«, entgegnete Madame Perieux. »Wir pflegen und lieben das Alte und Schöne, wir schätzen unsere Natur und was sie uns schenkt. Wir leben mit ihr.« Für einen Moment waren ihre Gesichtszüge härter, kantiger.
Pascal nickte eifrig. Der Blick in die Natur, das Haus, der Geruch, all das war schon fast unerträglich schön.
»Sie sind heute Abend eingeladen.«
»Merci, Madame, merci.«
Eine schmale Steintreppe führte in die erste Etage zu der Einliegerwohnung. Es gab kein Fenster in dem Flur, das einzige Licht kam von einer viel zu kleinen Lampe am oberen Ende der Treppe. Die Steinstufen waren bereits abgetreten, an einigen Stellen war der graue Stein gesprungen, als hätten schon Ritter mit schwerer Rüstung den Weg über diese Treppe in die erste Etage genommen, als wäre sie schon immer da gewesen.
Als Madame Perieux die alte, schwere Holztür oberhalb der Treppe aufgeschlossen hatte, betraten sie einen kleinen Flur, von dem zwei Zimmer abgingen. Der Holzboden schien ebenfalls uralt und jahrelang nicht behandelt worden zu sein. Pascal nahm sich vor, ihn abzuschleifen und neu zu ölen.
Der Boden in der Küche war mit unterschiedlich großen Terrakotta-Fliesen ausgelegt. Ein alter Schrank, wahrscheinlich Kiefer, Biedermeier-Zeit, schätzte Pascal, stand an der Wand. Durch die Schrankfenster konnte er Weingläser, Teller und Tassen sehen. Im Zentrum ein alter Gasherd, genau wie in der großen Küche der Familie unten im Haus, ein Gasherd– der Traum für einen Hobbykoch wie ihn. Die Anrichte war weiß gefliest, die Küchenutensilien hingen an einer langen Stange über dem Herd. Darüber ein Regal für Gewürze und Kräuter.
Die Zimmer gingen jeweils zu einer anderen Seite des Hofs hinaus, sie hatten kleine, niedrige Fenster. Alle Räume waren liebevoll möbliert. Kleine Holzschränke, wie man sie auf Antikmärkten in Orten wie L’Isle-sur-la-Sorgue findet. Ebenfalls ein Ort, den Pascal sich vorgenommen hatte zu besuchen, an einem der Sonntage, wenn sich der Markt durch die ganze Stadt ergoss.
Auf der Rückseite des Hauses befand sich ein kleiner Balkon.
»Es ist wunderschön«, sagte Pascal, während er die Balkontür öffnete, hinaustrat und die Hände auf das verzierte Eisengeländer legte. Es fühlte sich wie Urlaub an.
»Vollkommene Ruhe. Der nächste Nachbar ist fast einen Kilometer entfernt«, sagte Chloé Perieux, die neben Pascal auf den Balkon getreten war wie eine Schlossherrin, die ihrem Staatsbesuch etwas Besonderes präsentierte.
Ein Waldstück lag zwischen dem Château Sept und der nächsten Anhöhe. Ein prächtiges Haus mit zwei für die Provence typischen Türmen thronte auf dem kleinen Berg gegenüber. Pascals Blick blieb einen Moment an dem gewaltigen Gebäude hängen.
»Eine Burg? Der Kaiser von Lourmarin? Ein Mini-Schloss, das Napoleon im Vorbeigehen errichten ließ, vielleicht für Josephine?« Für den Fall, dass er noch mal eine Pinkelpause einlegen musste? Den letzten Zusatz ließ er aus Rücksicht lieber weg. Pascal lächelte, er war mit seinem Scherz zufrieden.
Madame Perieux lächelte zum ersten Mal nicht. »Es wurde von einem Amerikaner gekauft, quelle merde«, sagte sie und wendete sich ab.
»Was haben Sie gegen Amerikaner?«
»Sie machen alles kaputt. Alles. Vor allem dieser Mann. Er denkt, er kann alles kaufen mit seinen Scheißdollars.«
Damit war das kurze Gespräch beendet, denn Madame Perieux drehte sich um und ging die Treppen hinunter zurück in die Diele.
Pascal blieb noch einen Moment am Fenster stehen. Das Haus auf der kleinen Anhöhe sah dunkel aus– als sich die Konturen gegen den Abendhimmel abzeichneten, sogar ein bisschen mystisch. Es brannte kein Licht. Pascal ließ den Blick über die typische Hügellandschaft Südfrankreichs wandern. Rechts von ihm lag das Dorf Lourmarin. Stolz thronte dort das Renaissance-Schloss aus dem 12.Jahrhundert. Sobald er Zeit hatte, wollte er es besichtigen.
Noch einmal sog er die ständig kälter werdende Luft in sich ein, holte seine Koffer und begann, sich in seinem neuen Heim einzurichten. Die wenigen Bücher, die er mitgenommen hatte, stellte er in ein altes dunkles Regal, das eine ganze Wand in Anspruch nahm. Offensichtlich hatte hier vor ihm jemand gelebt, der eine große Bibliothek besaß.
Damit es nicht ganz so leer aussah, stellte Pascal noch seine Kochbuch-Sammlung dazu, die er in Paris in seiner Küche aufbewahrt hatte. Eine Leidenschaft, der er schon lange nachging.
Er liebte gerade Kochbücher aus vergangenen Zeiten oder Epochen. Interessiert beobachtete er, wie sich die Trends in der Küche veränderten. Einigen Strömungen folgte er, andere ließ er links liegen. Vegetarier betrachtete er skeptisch, und der neuen Vegan-Bewegung in der Hauptstadt konnte er nur mit schwer zu unterdrückendem Spott begegnen.
Ausgerechnet im Mekka der besten Küchen der Welt verzichtete man plötzlich auf Austern, Steak Tatar und Lammfleisch. Zum Frühstück gab es nicht mal mehr Honig, dafür Agavendicksaft. Was ist bloß passiert?, fragte sich Pascal jedes Mal, wenn auf der Straße die Tafeln mit dem Hinweis »vegane Küche« aufgestellt wurden oder er im Supermarkt vor Würsten aus Soja und Tofu stand. Würste, die aussahen wie Würste, aber keine waren. Wer kauft diese Produkte? Wer isst so etwas?
Über die Jahre hatten sich auch selbstverfasste Schreibhefte mit eigenen Rezepten angesammelt, die neben einigen ihm ans Herz gewachsenen Kochutensilien, die er später in der Küche verstauen wollte, ebenfalls einen Platz in dem großen Regal fanden.
Pascal war froh, eine möblierte Wohnung ausgesucht zu haben, denn der Umzug sollte ein Neuanfang auf allen Ebenen für ihn werden. Die alten Möbel der Perieux, die in seinem neuen Heim standen, gefielen ihm. Er hatte schon immer ein Faible für das Alte und Schöne. Ihm lagen Dinge am Herzen, die etwas erlebt hatten und ihm Geschichten erzählen konnten. Er hatte das Gefühl, dieses Haus würde ihm noch viele Geschichten erzählen, so wie die gesamte Landschaft im Luberon.
Er schaute noch einmal auf das Waldstück hinter dem Haus. Es ergoss sich wie ein prunkvoller Garten durch das Tal. Ihm war beim ersten Anblick aufgefallen, wie gepflegt es war, wie die Bäume gestutzt waren, wie die unnützen Äste wahrscheinlich schon im Herbst abgeschnitten und vielleicht zu Feuerholz verarbeitet worden waren. Hier wurde geerntet, nicht abgeholzt. Pascal konnte spüren, wie die Natur auf den Frühling wartete, um zu explodieren. Auf den Anblick, diesen Wald voller Leben zu sehen, freute er sich.
Langsam zog die Dunkelheit über die Bäume. Auch in Südfrankreich ging es Anfang Februar schnell, wenn die Sonne sich einmal entschieden hatte unterzugehen. Als sie verschwunden war, konnte Pascal das Haus hinter dem Wald, in dem der unbeliebte Amerikaner lebte, nur noch schemenhaft erkennen. Der Wald wirkte wie ein blinder Fleck, wie ein schwarzes Loch.
Pascal hatte gar nicht gemerkt, dass er die Balkontür, nachdem er sie mit Madame Perieux geöffnet hatte, um herauszutreten, nicht wieder geschlossen hatte. Die kalte, feuchte Waldluft kroch an ihm hoch, ließ ihn frösteln.
Das Läuten einer großen Glocke in der Diele erschreckte ihn.
»Kommen Sie, Monsieur Chevrier. Kommen Sie essen. Dîner.« Die Stimme von Chloé Perieux schallte zu ihm hinauf.
Das ließ er sich nicht zweimal sagen, er hatte einen Riesenhunger.
Um den Tisch herum saßen acht Erwachsene und drei Kinder. Jetzt begann das Händeschütteln, Küsschenverteilen, Sich-Beäugen. Am Kopf des Tisches saß Monsieur Perieux, ein stattlicher Mann mit einem Bauchansatz. Der Herr im Haus.
»David Perieux«, sagte er, und sein Händedruck ließ keinen Zweifel daran, dass er die Weinfässer auch ohne fremde Hilfe über den Hof hätte rollen können. »Das ist mein Vater, Maurice Perieux. Er hat hier alles am Leben erhalten. Es sind seine Reben, sein Land, sein Wein.« Er deutete auf den steinalten Mann auf der anderen Seite des Tisches.
Maurice Perieux trug eine schwere dunkle Hornbrille. Seine Nase schien sich vom vielen Riechen an den hauseigenen Weinen zu einem praktischen Werkzeug entwickelt zu haben. Ohne Mühe hätte er seinen riesigen Zinken auf den Boden eines Weinglases drücken können. Die Evolution hatte hier ganze Arbeit geleistet.
Jetzt steckte er seine Nase in eines der Kräuterbüschel, die zur Dekoration auf dem Tisch standen. Die grünen Blätter erinnerten an Brennnesseln. Sie hatten kleine weiße Stacheln, die über die Wangen des alten Mannes streichelten. Er zuckte nicht. Entweder waren es keine Brennnesseln, oder er hatte sich jedes Schmerzgefühl abtrainiert.
Maurice Perieux schien nicht mehr besonders gut sehen zu können, denn er tastete kurz nach Pascals Hand, bis er sie fest in die seine nahm. Den Topf mit dem Kräuterstrauch hatte er neben sich gestellt.
»Sie sind der neue Gendarm aus unserem Dorf?«, fragte er. Seine Stimme klang wie die eines Märchenvorlesers, und doch schwang eine gewisse Skepsis mit, die Pascal nicht entging. Er musste sich konzentrieren, denn Maurice Perieux sprach provençal, diesen unergründlichen Dialekt, der sich durch zusätzliche und vollkommen sinnlose Buchstaben am Ende eines Wortes auszeichnet.
»Oui, Monsieur.«
»Aus Paris?«, fügte Maurice Perieux hinzu.
»Oui, Monsieur.«
Pascal konnte nicht deuten, ob das Wort Paris dem Mann nur so schwer über die Lippen kam, da ihn das Sprechen in seinem Alter anstrengte, oder ob er den Hauptstädtern grundsätzlich mit Skepsis begegnete. Er hätte es verstanden. Selbst als geborener Pariser war ihm die Hochnäsigkeit der Bewohner seiner Heimatstadt zuwider. Daher klang sein »Oui, Monsieur« irgendwie entschuldigend.
Pascal hatte nicht viel Zeit, über die Wirkung seines Auftritts nachzudenken, denn ein gepflegter älterer Herr betrat gemeinsam mit einer jungen Frau die Diele, die in der Abendsonne in ein trübes Licht getaucht war. Der Kräuterduft oder die Schönheit an der Seite des Mannes– eines von beidem raubte Pascal für einen Moment die Sinne.
David Perieux ergriff wieder das Wort. »Darf ich Ihnen meinen Önologen vorstellen.«
Da es nicht nach einer Frage klang, schwieg Pascal und schüttelte dem Mann, der sich als Patrick Dumont vorstellte, freundlich die Hand. Doch sein Blick schweifte ab. Wieder sah er zu der jungen Frau, wie sie sich von den um den Tisch herumsitzenden Menschen einen Eindruck verschaffte.
»Meine Tochter.«
Mit unruhigem, skeptischem Blick musterte sie die Gäste, als würde sie in ihren Gesichtern nach etwas suchen. Pascal schien sie zunächst kaum wahrzunehmen.
Sie trug schwarze Stiefel über der Jeans, die ihr fast bis zum Knie reichten. In ihrem karierten Hemd sah sie aus wie eines der Models, die für Landmode warben. Sie hätte an einer glänzend sauberen Schubkarre im Fotostudio stehen und so verführerisch in die Kamera sehen können, dass man die Harke an ihrer Seite und die Gartenhandschuhe an ihren Händen sofort gekauft hätte.
Pascal war sich sicher, dass sie sich ihrer Wirkung vollkommen bewusst war, als sie ihr schulterlanges Haar aus der Stirn wischte und sich einfach nur als Elaine vorstellte. Von ihrer Schönheit war er für einen Moment gefangen und gewarnt zugleich. Nicht noch einmal, dachte er.
»Champagner?«, fragte Madame Perieux, als sie Elaine mit drei Küsschen begrüßte.
»Oui«, sagte Elaine mit ernster Miene. Ihre Stimme war kälter, als Pascal es erwartet hatte.
»Sie auch, Monsieur Chevrier?«
»Sehr gern, in dieser Gesellschaft.« Pascal war das Flirten nicht mehr gewohnt, seit seine Frau Catherine ihm vor drei Jahren eines Abends eröffnet hatte, sie habe einen Architekten kennengelernt. Es war zu lange her. Während er sein Leben auf den Straßen von Paris riskiert hatte, traf sie sich mit dem Architekten, der sie erst zu einem Essen in ein Sternerestaurant entführte und später in sein Bett irgendwo im ersten Arrondissement mit Blick auf die Seine.
Wahrscheinlich hatte sie nackt mit einem Glas Dom Pérignon an dem großen Fenster gestanden und dabei zugesehen, wie Pascal und Alexandre mit ihrer Hand an der Waffe über die Straßen schlichen. Ohne Frage, der Mann hatte ihr mindestens das Dreifache zu bieten gehabt, und Catherine war schon immer eine Frau gewesen, die eigentlich nicht zu Pascal passte. Sie hatte andere Interessen, andere Ziele im Leben. Vielleicht hätte er ihr bei einer Beförderung irgendwann das Leben bieten können, das sie sich wünschte, doch zu dieser Beförderung war es nie gekommen, und Pascal hatte auch nie um einen beruflichen Aufstieg gekämpft.
Einmal war er kurz vor einem Karriereschritt nach oben gewesen– seine Sternstunde bei der Pariser Polizei. Eine filmreife Szene, wie aus einem Louis-de-Funès-Film. Geradezu Slapstick:
Unweit des Police Départements war ein Bankraub gemeldet worden. Alexandre war hineingegangen und hatte den Bankräuber eigentlich schon gestellt, während Pascal im Auto vor der Bank wartete. Oft wartete er im Auto, wenn in irgendeinem Gebäude etwas Gefährliches geschah. Ihm war es recht gewesen, denn in Wahrheit hatte er noch nie viel Wert darauf gelegt, sich für irgendjemanden– und schon gar nicht für einen Bankkonzern– in Gefahr zu begeben. Manchmal war genau das der Grund dafür, warum er bei der Polizei falsch aufgehoben war. Pascal mochte das Nachdenken, das Kombinieren, nicht den blutigen Straßenkampf.
An jenem Tag aber war es anders gewesen. Er hörte im Inneren der Bank Schüsse und wollte seinem Kollegen zu Hilfe kommen. Pascal war noch nie feige gewesen. Er wog nur stets ab, wann es lohnte, sich in Gefahr zu begeben, und wenn sein Kollege Alexandre in Schwierigkeiten steckte, dann brauchte er nicht lange zu überlegen. Für ihn hätte er alles getan.
So griff er nach seiner Dienstwaffe, die in seinem Gürtel steckte. Da er nicht herankam, musste er die Wagentür öffnen. Just in dem Moment lief der Bankräuber mit der Sporttasche direkt in die Autotür hinein. Die Franc-Scheine, da sieht man mal, wie lange das her ist, dachte er, flogen über den Bürgersteig und der Bankräuber blieb bewusstlos mit einer Kopfverletzung auf der Straße liegen.
Pascal hatte für einen Moment dieses Gefühl genossen, einmal seine Körperlichkeit eingesetzt zu haben, Gewalt statt Gedankenwelt, und damit war er weit gekommen, es erfüllte ihn mit einem gewissen Stolz. Es hätte nur noch gefehlt, dass er für ein Foto stolz seinen Fuß auf den Mann gestellt hätte, als Alexandre unverletzt aus der Bank stürmte.
Für ein paar Tage war Pascal der Held gewesen. Ihm wurde tatsächlich eine Beförderung in Aussicht gestellt. Am Abend jenes Vorfalls gab es in Catherines Lieblingsrestaurant Austern und Champagner satt. Einen halben Monatslohn kostete ihn das Dinner, eigentlich gingen sie nur in dieses Restaurant, wenn es wirklich etwas zum Feiern gab. Als Catherine ihm vor fast zwanzig Jahren eröffnet hatte, sie sei schwanger, oder als er die Polizeiprüfung bestanden hatte– da wurde nie gespart.
Die Beförderung aber blieb aus, denn andere Kollegen spielten sich mit ihren Heldentaten in den Vordergrund. Plötzlich gab es viele Bewerber auf die wenigen Positionen im gehobenen Dienst. Nach einem Gespräch mit seinem Chef, der um Verständnis warb, weil er anderen Kollegen den Vortritt gegeben hatte, einfach weil sie schon länger dabei waren und »dieses eine Prozent besser waren«, wofür Pascal dann tatsächlich Verständnis hatte, wurde er kein zweites Mal in Betracht gezogen, einen höheren Posten zu bekommen.
Pascal war eben noch nie der Typ gewesen, der Karriere machen wollte. Er zog immer an den verkehrten Hebeln, hatte zu wenig Ehrgeiz. Er mochte es, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Als Polizist war das oft die falsche Herangehensweise, und offensichtlich auch in seiner Beziehung zu Catherine.
Instinktiv hatte er immer auf den Moment gewartet, an dem seine Ex-Frau ihm eröffnete, dass sie ihn verlassen würde. Jedes Mal, wenn sie ihm am Telefon ankündigte, dass sie miteinander reden müssten, ging er bereits in Gedanken den gesamten Freundeskreis durch und überlegte, mit wem sie etwas gehabt haben könnte, damit der Schock bei der Aussprache nicht zu groß wurde. Doch die Schockmeldung war ausgeblieben. Sie hatten es gemeinsam geschafft, ihre Tochter Lillie in einigermaßen geordneten Familienverhältnissen großzuziehen. Es war kein Zufall, dass Catherine ihm die Trennung genau zu dem Zeitpunkt mitteilte, als Lillie gerade eine Woche mit ihrem Freund, einem Koch aus Lyon, zusammengezogen war.
Später war Pascal sich gar nicht mehr sicher gewesen, ob der Architekt in all den Jahren Catherines einziger Liebhaber gewesen war, aber nachgefragt hatte er nie. Ihm war nichts anderes übrig geblieben, als sich mit der Trennung abzufinden und sein Leben neu zu planen.
Die letzten drei Jahre hatte er meistens allein in seiner Wohnung verbracht. Er fühlte sich einsam, und in einer Stadt wie Paris war man sehr einsam, wenn man keine Frau hatte.
Halbherzig war er immer wieder in angesagte Bars gegangen, um eine Frau kennenzulernen, doch er spürte schnell, dass das der falsche Ort für ihn war. So begann er zu kochen. Ganz allein, für sich in seiner Wohnung. Er legte sich seine ersten Kochbücher zu, lernte sie auswendig, kaufte weitere, alte und neue, und studierte Warenkunde. Schließlich begann er, selbst Salzbutter herzustellen, kreierte eigene Desserts und Dressings. Er beschäftigte sich mit der Konsistenz von Soßen, unterschiedlichen Garweisen und Olivenölen.
Pascal war zu einem exzellenten Koch geworden, es gab nur niemanden, der das wusste. Nie hatte er in den drei Jahren für irgendjemanden gekocht. Nie hatte er jemanden zu sich eingeladen, nie hatte er über seine Leidenschaft gesprochen. Kochen war zu seiner ganz persönlichen Passion geworden, die er mit niemandem teilte. Erst jetzt, hier in der Provence, trug er sich mit dem Gedanken, etwas aus seiner Kunst zu machen. Aber er würde noch vieles lernen müssen.
Für einen kurzen Moment kamen ihm die Kräuter und das Unkraut in den Sinn, die er in der Küche gesehen hatte und die ihm teilweise vollkommen unbekannt waren. Würde er eines Tages hier im Luberon ein Restaurant eröffnen, müsste er diese Kräuter erkennen.
Ja, ein eigenes Restaurant, das wär’s, dachte Pascal. Doch am Anfang stand der Schritt zurück in ein gesellschaftliches Leben, und diese Frau, die jetzt mit dem Champagnerglas vor ihm stand, diese Elaine, die war ein ziemlicher Anreiz für den ersten Schritt. Pascal schätzte sie auf fünfunddreißig Jahre, also deutlich jünger als er selbst, und ihren Vater, Patrick Dumont, auf knapp sechzig. So genau kann man das hier nicht sagen, dachte er.
»Sie sind der neue Dorfgendarm.« Elaine stellte zwar eine Frage, aber ihre Stimme blieb unten, als handle es sich um eine Feststellung, als würde sie keine Antwort erwarten, auch sah sie Pascal nicht direkt an. Sie betrachtete stattdessen wie beiläufig die aufsteigenden Bläschen in ihrem Champagnerglas.
»Das spricht sich hier ja schnell herum.«
Elaine verzog das Gesicht. Nicht zu sehr, sodass sie noch immer attraktiv blieb. Dann wurde sie plötzlich verbindlich.
»Was glauben Sie? Wir sind in Lourmarin, wir lieben Neuigkeiten. Dass der alte Max doch noch irgendwann in Rente gehen würde, war ja klar, aber die meisten von uns dachten immer, dass man fortan aus Apt, Carpentras, Salon-de-Provence oder sonst woher ein Auge auf uns werfen würde.«
Sie trank einen Schluck.
»Wir sind so gefährlich hier in Lourmarin und Lucasson.« Elaine deutete ein Lächeln an und warf ihren Kopf leicht in den Nacken.
»Oh ja, wir sind gefährlich«, sagte der offensichtlich doch besser hörende Maurice Perieux in seinem Dialekt. »Hüte dich vor alten Männern, sie haben nichts mehr zu verlieren.« Sein Satz ging in ein Husten über. Nicht laut, eher in sich hineinkeuchend, den Blick nicht von Pascal abwendend.
Madame Perieux trug einen dampfenden Topf nach dem anderen aus der Küche in die Diele, eine Geruchsexplosion lag über der Gesellschaft, hing tief unter der Decke.
Pascal hatte inzwischen eine geübte Nase. Frischer Knoblauch, Thymian, die leichte Note von Wein und Dijon-Senf, und schließlich der Lammbraten, in einer Kräuterhülle.
Zufrieden lehnte er sich zurück. Er kannte das Gericht und konnte es kaum abwarten zu erfahren, wie ein Lammbraten von echten Provenzalen zubereitet wohl schmeckte. Unzählige Male hatte er selbst einen aus dem Ofen in seiner kleinen Pariser Wohnung geholt und jedes Mal eine neue Idee entwickelt, das Gericht weiter zu verbessern.
Für einen Moment war es still, fast andächtig still. Die Ruhe vor dem Essen, vor dem Besteckklappern, vor dem Sich-Zuprosten.
Pascal schaute sich um. Durch das große Fenster in der Diele konnten die Gäste nichts mehr sehen. Es war inzwischen stockdunkel geworden. Eine Dunkelheit, an die Pascal sich als Städter erst gewöhnen musste. Dort vor dem Fenster lag der Weinberg. Schon als er auf das Grundstück gefahren war, hatte er bemerkt, wie die Reben fast bis an das Château Sept heranreichten. Auf dem Feld daneben würde im Juni der Lavendel blühen, daran gab es für Pascal keinen Zweifel. Wenn er sich noch länger seiner Träumerei hingab, würde er ihn riechen können.
Das war schon immer seine Stärke gewesen. Schon als Schüler vermochte er sich an andere Orte zu träumen. An bessere Orte. Es war eine geradezu meditative Gabe, die ihn die langen, harten Jahre auf den Straßen von Paris und das Leben eines Gendarmen hatte ertragen lassen. Es war auch seine Träumerei gewesen, die ihn so lange an der Seite seiner Frau Catherine hatte aushalten lassen, das wusste er, denn wie sonst hätte er es ertragen, für sie nie gut genug gewesen zu sein?
Nach ihrer Trennung schöpfte er aus der Träumerei von einem besseren Leben Kraft. Seine geliebte Tochter Lillie im fernen Lyon an der Seite ihres zukünftigen Ehemannes, seine Frau in den Armen eines Mannes in einem Haus mit Seine-Blick, all das ließ Pascal irgendwann nur noch träumen. Es war sein Kollege und guter Freund Alexandre, der ihn schließlich darauf brachte, seinem bisherigen Leben den Rücken zu kehren.
Ein Gefühl von Stolz erfüllte Pascal, als er sich in der typisch provenzalischen Diele mit verzierten Möbeln und rustikalen Holzstühlen umschaute und realisierte, dass er tatsächlich den Schritt aufs Land gewagt hatte.
»Greifen Sie zu, Pascal Chevrier«, sagte Chloé Perieux und lächelte ihn aufmunternd an.
»Merci, Madame.«
»Ja, greifen Sie zu, nehmen Sie von dem Lamm in Kräuterhülle. Haben Sie schon die Artischocken probiert?«
Pascal hatte bereits herausgeschmeckt, dass das Lamm vor seinem Ableben eine Extraportion Kräuter verzehrt haben musste.
»Ich habe den Dip selbst hergestellt«, sagte Chloé, während sie Wein nachschenkte. »Essen Sie sich satt, Sie müssen morgen kräftig und stark sein, bei Ihrer Vereidigung.«
Ach ja, die Vereidigung, dachte Pascal.