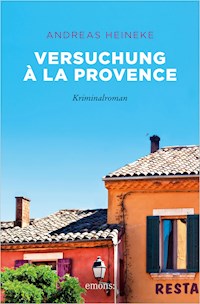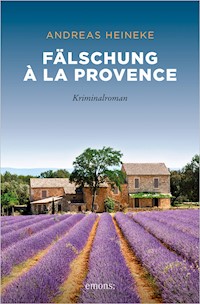Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pascal Chevrier
- Sprache: Deutsch
Fesselnde Krimispannung in einer Welt der Mode, Macht und Moral. Die Modewelt blickt gespannt auf Lacoste, einen kleinen Ort im Luberon, wo die letzte Kollektion eines kürzlich verstorbenen berühmten Designers enthüllt werden soll. Doch kurz vor der Premiere verschwindet eines der Topmodels spurlos. Dorfgendarm Pascal Chevrier und seine Kollegin Audrey ermitteln in der Fast-Fashion-Industrie und stoßen auf ein tödliches Netz aus Gier und Intrigen, das sich zwischen Modeschöpfern, Models und den Dorfbewohnern spannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Andreas Heineke war Radiomoderator, Musikmanager u.a. für MTV und Dotcom-Firmengründer. Seit über zwanzig Jahren lebt er in Dithmarschen, arbeitet als Filmemacher und Drehbuchautor für u.a. das ZDF und den NDR, schreibt Sachbücher und Kriminalromane, die in der Provence spielen. Andreas Heineke ist fast dauerhaft auf Lesetour und hat 2020 den Bücher-Podcast »2MannBuch« ins Leben gerufen.
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind einige erwähnte Personen authentisch und existieren oder existierten wirklich. Ihre Handlungen sind jedoch frei erfunden.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung der Motive von mauritius images/BTWImages/Alamy/Alamy Stock Photos, Shutterstock/Honza Krej
Lektorat: Dr.Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-272-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §
Mir hat es immer gefallen, durch meine Arbeit zu existieren, und es hat mich noch nie amüsiert, mich zu amüsieren.
Pierre Cardin
Der Lebenskünstler und der Feinschmecker wissen, dass man ein Schwein sein muss, um Trüffel zu finden.
Marquis de Sade
Jezebel wasn’t born with a silver spoon in her mouth
She probably had less than every one of us
But when she knew how to walk she knew
How to bring the house down
Jezebel, Jezebel
Won’t try to deny where she came from
Sade, 1985
Prolog
Es war immer die Stille nach dem Applaus, die Jezebels Gefühlswelt aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Eben noch die Ovationen, der Glanz in den Augen, die Gier der Masse. Wie sie ihre Hülle beklatschten, die Hände fordernd nach vorn stießen, den Stoff berühren wollten. Applaus, Applaus, bravo, mehr davon, gib uns mehr. In den ersten Reihen die Fotografen, die wie ausgehungerte Tiere nach ihr schnappten, ihre Objektive ausfuhren, auf alles, was sie ihnen bot. Und dann ihre Füße, in den zu knappen Schuhen, mit Blasen überzogen, immerhin gelangte sie über den Laufsteg zurück hinter den Vorhang.
Es vergingen nur Sekunden, schon riss jemand an ihr, der Reißverschluss an ihrem Rücken machte ein surrendes Geräusch, als er sich öffnete, sie spürte den Windhauch auf dem nackten Rücken. Im selben Moment wurde ihr der Pullover übergestreift. Jemand zupfte an den Bündchen, eine enge Hose wurde gereicht. »Magnificent.« Sie hatte nur Sekunden, zwang sich hinein, ein Dritter zog sie ein Stück nach unten, der Saum jetzt dicht über den Schuhen, dann hörte sie schon das Klatschen. »Go, Jezebel, go.«
Diese Schuhe trugen sie besser über den unebenen Boden als die zuvor, aber das Licht von vorn machte sie fast blind. Geblendet verfiel sie in ihren Gang, die Hüften konnte sie bewegen wie keine andere. Immer geradeaus, die Drehung am Ende, die Sekunde des Verharrens, der Blick unnahbar und zugleich fordernd auf die leeren Ränge hinter den akkreditierten Fotografen gerichtet. Ihre dunkle Haut, im Scheinwerferlicht glänzend, reflektierend, und schon hörte sie wieder das Klicken der Kameras zu dumpfen Housemusic-Beats. Das Spiel begann von Neuem.
»Mehr davon«, rief ein Mann mit Hornbrille und Lippenstift in der ersten Reihe, seine großen Pupillen auf sie gerichtet wie ein Uhu. Dann die Wende am Ende des Laufstegs, heiß wurde ihr, der Rollkragenpullover in der Abendhitze des Provence-Sommers. Keine Schweißperlen, das war unprofessionell. Schwitzen sollte sie woanders, schwitzen sollten die anderen. Jedes menschliche Gefühl galt es zu unterdrücken, niemand wollte das sehen. Mannequins schwitzten nicht. Sie waren keine Menschen, so hatte man es ihr eingetrichtert, damals in Paris, vor sechs Jahren. Du bist außerirdisch, hatte Jean Paul Gaultier ihr gesagt. Unerreichbar und einsam. Wie recht er hatte.
Seitdem war sie dabei, New York, Mailand, Los Angeles und jetzt Lacoste. Lacoste? Echt jetzt? Sie wusste nicht einmal, wie sie hierhergekommen war. Welche Rolle spielte das schon? Sie drehte sich, trat den Rückweg an, die Augen auf ihrem Rücken, auf ihrem Hintern, dafür sollte sie geboren sein? Alles geben, in diesen Sekunden. Der letzte Gang, die Schweinwerfer tasteten lautlos an ihren Traversen über den Laufsteg, die Ränge waren leer, bis auf wenige Stühle in der ersten Reihe, dort saßen die geladenen Preview-Gäste ebenso wie einige Fotografen. Wie bewegt und berührt sie waren von ihrer eigenen Bedeutung, schon Tage vor der großen Prêt-à-porter-Show durften sie in das alte Gemäuer, sie gehörten zum erlauchten Zirkel, fast kamen ihnen die Tränen vor lauter Glück.
Der letzte Probelauf. Ein Designer, dem großen Pierre Cardin nicht unähnlich, betrat von hinten den Laufsteg. In vier Tagen würden mehrere junge, hungrige Modeschöpfer an seiner Stelle sein, die Kreativen, mit dem erdrückenden Erbe des Meisters auf ihren Schultern. Der Designer nahm Jezebel an die Hand, reckte ihren Arm ungelenk in die Höhe, Applaus aus den Lautsprechern brandete auf wie eine Welle, alles war perfekt inszeniert. Das Licht in kaltem Blau, ihre dunkle Haut, ihre Schuhe, ihr Pullover, alles änderte die Farbe. Wieder das Klicken, ein Ruf aus der ersten Reihe: »Merci, das war’s für heute. Übermorgen ist die Generalprobe. Geht schlafen, vermeidet alles, was Körper und Geist ruiniert.« Ein kurzes Lachen, dann erloschen die Schweinwerfer. Im Arbeitslicht, kalt und jeden Makel offenlegend, stoben die Models auseinander, drängten sich an den Bühnenarbeitern vorbei in den Backstagebereich. Das Auskleiden dauerte lange. Wie Porzellan wurden die Kleider auf Bügel und Stangen gehängt, dann war sie vorbei, die vorletzte Probe.
Jezebel zog ihre Jogginghose über, einen schwarzen Hoodie, ein Geschenk von Louanne, dann ein letzter Gruß in die Runde, und schon öffnete sie die Holztür. Ächzend fiel sie hinter ihr ins Schloss. Sie hörte das schwere Knarren, wie schon Generationen vor ihr. Ein Schauder überlief sie, als sie den Blick zurückwandte. Das Schloss, wie es sich marode gegen den Himmel reckte, die Sterne darüber, die Dunkelheit. Matt beleuchtete gelbes Licht aus antiken Laternen den steilen Weg vor ihr über das Kopfsteinpflaster nach unten. Die mittelalterlichen Steine blank, rutschig wie eine Eisschicht. Jetzt sich bloß nicht verletzen, nicht stürzen. Ihre Hand suchte die Hauswand, die Steinmauer hinterließ rote Spuren auf den Innenflächen, die Haut gereizt. Im fahlen Licht tastete sie sich weiter, den Hang hinunter, vorbei an den leer stehenden Häusern, nur die Laterne an der nächsten Biegung wies ihr den Weg zu ihrem Appartement unten im Ort.
Jezebel schätzte die Entfernung auf zweihundert Meter. Autos konnten hier nicht fahren, die Limousinen holten die anderen Models oben am Schloss ab, von wo sie in die Hotels außerhalb des Dorfes gebracht wurden. Sie, Jezebel, war der Star des Abends, sie durfte im Ort bleiben. Was sollte sie mit einem Fahrer? Schon während der Probe hatte sie ihn in den Feierabend geschickt. Mein Gott. Zweihundert Meter.
Ihr frisch renoviertes Luxusappartement. Sie wusste, was ihr blühte, wenn die Tür ins Schloss fiel und die Stille sich über ihr Gemüt senkte. Dann war sie wieder da, die Einsamkeit, die Stille nach dem Applaus, die sie auseinanderbrechen ließ wie eine Muschel. In den letzten Monaten aber war es besser geworden. Das Ziel hatte sie verändert. Je klarer es wurde, je greifbarer der Sinn von alledem wurde. Im Bett wird sie alles noch einmal durchgehen. Danach wird es vorbei sein, und die Wahrheit kommt ans Licht. Die Modewelt wird nach diesem Abend eine andere sein. Sie wird ihre Mutter vor sich sehen, ihre Schwestern, ihren Vater, die Näherinnen, die Shops. Für sie tat sie es. Das war sie ihrer Familie schuldig. Sie wird ihnen eine Stimme geben. Endlich.
Noch hundert Meter den Abhang hinunter. Das gelbe Licht kam näher, beschien schwach die Steine und die verlassenen dunklen Häuser. Kein Laut tönte durch das Dorf, nur ihre Schritte, wie sie sich behutsam über das Kopfsteinpflaster schoben. Doch etwas mischte sich darunter, ein kaum wahrnehmbarer Hall von links hinter ihr – oder neben ihr?
Ein leichtfüßiges Trippeln? Sie drehte sich um, doch da war nichts. Nichts zu sehen, nichts zu hören, kein Laut mehr. Jezebel spürte, wie sich eine Gänsehaut über ihre Arme legte, über ihren Rücken kroch. Ihr Herz schlug schneller, stolperte. Plötzlich fühlte sie sich so wahnsinnig allein, so einsam. Und so fühlte es sich fast erlösend an, als sich das weiche Tuch über ihr Gesicht legte, Druck ausübte und sie das Bewusstsein verlor. Sanft, so sanft, als fiele sie in den Schlaf, und das tat sie dann. Wie schnell es ging. Schon wenige Minuten später würde sie über den Markt ihrer Heimat laufen, den Flohmarkt, den entsetzlichen Flohmarkt, an der Hand ihrer Mutter, rau, aufgerissen, kaputt.
Warum dieses Bild im Schlaf? Diese Frage hätte sie sich gestellt, wäre genug Zeit dafür gewesen. Doch die gab es nicht. Sie tickte erst weiter voran, als Jezebel sich in einem Raum wiederfand, einem großen Raum, die Decken hoch, alles weiß, ein Atelier vielleicht. Der Geruch des Tuchs hatte ihr das Bewusstsein geraubt, den Blick getrübt. Sie sah Buntes vor sich, Stoffe, Kleiderhaken, Schmuck. Nichts Genaues, nur Diffuses. Von hinten wurde ihr das Hemd über den Kopf gezogen, jemand griff nach ihrer Jogginghose, seine Finger an ihrer nackten Taille.
»Nein!«, schrie sie. »Nein, dazu wird es nicht kommen.«
Der Gegner war hinter ihr, sie konnte nichts sehen, es war zu dunkel, noch dunkler als gerade in den Gassen. Etwas wurde ihr auf den Kopf gesetzt, es roch nach Meer, und es fühlte sich weich an, wie ein Vogel. »Mach das Foto!«, schrie jemand von irgendwo. Wie betäubt stand sie dort, mitten im Raum, bewegungslos für einen Moment, dann riss sie sich das Etwas vom Kopf …
Vor ihr ein Tisch, darauf eine Rolle aus Holz. Sie griff danach und schleuderte sie herum, traf dabei hinter sich den Mann. Er stürzte, schlug zu Boden, dann schrie er auf. Sie holte aus, wollte die Holzstange ein zweites Mal auf den Mann fallen lassen, ihn zertrümmern, wie von Sinnen, doch sie wurde gehalten. Ihre schmalen Finger waren auf die Berührung nicht vorbereitet, und so ließ sie das Holz los. Es fiel nicht zu Boden, jemand riss es ihr aus der Hand, ein Schlag auf die Brust, auf die inzwischen nackte Brust. Sie hörte Stimmen, mehrere Stimmen, Schreie, undeutlich und doch laut.
Und dann wechselte der Geruch, als sei sie in einer Wäscherei. Wie damals in Ghana am Strand, mit all den Farben und dem bunten Meer. Diesem unnatürlichen Meer. Warum hatte es nach Meer gerochen? Gerade begannen sich ihre Augen an das Licht zu gewöhnen, doch waren da nur noch Dampf und Hitze, Nebel. Wie ein zu großer Vogel stand sie im Raum, dann wurde sie gepackt, ein schwarzes Kleid wurde ihr über den Kopf gezogen, nur diesmal verdeckte der Stoff ihre Augen bis in alle Unendlichkeit.
1
»Meine Ware riecht nicht. Hat sie nie. Wird sie nie. Verstanden?« Die Augen groß wie die seiner Fische hatte Louis auf den Kunden vor Pascal in der Schlange gerichtet.
»Wenn ich es doch sage, Monsieur. Der Racasse für die Bouillabaisse roch in der letzten Woche nach Fisch. Meine Frau dachte, ich habe ihn im Supermarkt gekauft. Ich wäre fast rausgeflogen, quelle catastrophe.« Die Worte betonten nur Amerikaner so ungelenk, so unfranzösisch. Dazu die Baseballmütze, niemand brauchte die Nationalität des Kunden zu hinterfragen.
»Monsieur.« Und jetzt sprach auch Louis lauter, sodass die umliegenden Stände und die Kunden weiter hinten in der Reihe ihn hören konnten, er wusste, noch ein paar Beschwerden in der Lautstärke, und er bräuchte auf dem Wochenmarkt von Lourmarin nicht wiederzukommen. Er musste sich wehren, hier und jetzt ging es um alles. »Ich bin jeden Morgen am Hafen von Marseille und kaufe meine Fische frisch von den Booten. Ich prüfe sie, ich drücke in die Haut, ich gucke ihnen in die Augen. C’est impossible.«
Louis war der Fischhändler seines Vertrauens. Noch nie hatte Pascal in den vier Jahren, in denen er in der Provence lebte, schlechte Ware von ihm bekommen. Doch auch er wusste, nur eine einzige Beschwerde reichte aus, um die Markthändler in Verlegenheit zu bringen. Die provenzalischen Märkte waren seit fast fünfhundert Jahren eine Meile des Vertrauens. Wer hier einkaufte, wollte die besten Lebensmittel der Region bekommen. Auch für Pascal gehörte das Schlendern – und hier schlenderte jeder, noch nie hatte er jemanden mit hektischen Schritten über den Markt gehen sehen – zur lieb gewonnenen Gewohnheit. Der Einkauf war ein Ritual und kam einem Glaubensbekenntnis gleich. Der Anspruch war entsprechend hoch.
»Wo kommen Sie eigentlich her?«, fragte Louis, der inzwischen die Farbe einer Rotbarbe angenommen hatte. Außer sich war er. »Ich habe Sie hier noch nie gesehen, und jetzt kommen Sie und beschweren sich?«
Pascal erkannte den Fehler sofort. Louis wurde plötzlich persönlich, er verlor seine Contenance und geriet dadurch in die Defensive. Der Kunde vor der Auslage verlor jetzt ebenfalls die Nerven.
»Was geht Sie das an? Verkaufen Sie gute Ware ausschließlich an Stammkunden?« Seine Augen funkelten, mit stechendem Blick musterte er die Fische vor sich, die auf Eis gebettet auf die Pfanne warteten. Dann überprüfte er mit einem Seitenblick auf die ständig anwachsende Schlange hinter ihm, ob ihm auch alle zuhörten. »Ich bin Amerikaner, von der Westküste. Ich weiß, wie ein guter Fisch zu schmecken hat. You know?«
Ist ja gut, dachte Pascal. Ja, wir wissen es, wir verstehen es. Warum müssen die Amerikaner immer nachfragen, ob wir das wissen?
Als Louis jetzt sein mit Schuppen überzogenes Messer zückte, befürchtete er einen Moment, eingreifen zu müssen, doch der Fischhändler griff mit der anderen Hand nach einer Dorade, entschuppte sie mit rasender Geschwindigkeit und zischte dabei undeutliche Worte auf Provençale, während er eine Seite filetierte. Der Kunde hatte seine Hände in die Hüften gestemmt und beobachtete teils fasziniert, teils verunsichert das Schauspiel. Dann hielt Louis das Fischfilet über den Tresen direkt vor sein Gesicht, in Höhe der Nase. »Und, Monsieur beziehungsweise Sir, riecht er?«
Der Kunde schob seine Nase vorsichtig noch ein Stück nach vorn, sodass sie kurz vor dem Fisch verweilte. Louis gab dem Fisch einen kleinen Stoß, sodass das halb geöffnete Maul die Lippen des Amerikaners berührte.
»Un baiser«, rief eine begeisterte Stammkundin in der Reihe hinter Pascal, sie war kurz davor, zu applaudieren.
»Pardon«, sagte Louis mit seiner größtmöglichen Unschuldsmiene.
Schwer zu sagen, ob der Amerikaner dem Fischhändler traute. Doch schließlich sagte er so gefasst wie möglich: »Non, Monsieur, er riecht nicht, so einen hätte ich gestern gern bekommen.«
Ein kollektives Ausatmen in der Reihe der wartenden Kunden. Dann ein zufriedenes Nicken und Beobachten, wie Louis jetzt ein Stück Zeitung über die Auslage in Richtung des Amerikaners hielt.
»Und die Zeitung? Riecht sie?«
Der Amerikaner rümpfte die Nase. »Oui, sie stinkt, smells like hell.«
Louis erhob die Stimme, war sich bewusst, dass jetzt alle in seinem Umkreis zuhörten. »Da haben wir also das Problem. Es ist die Zeitung, die stinkt. Kein Wunder, denn sie liegt bei den Fischresten, dort, wo ich sie seit Tagen liegen habe.«
Pascal kam die kleine Inszenierung wie eine Theateraufführung vor, er vermisste den Applaus.
Louis nahm eine neue Seite aus der Zeitung, schlug darin das Doradenfilet ein und reichte es dem Kunden. »Für Sie«, sagte er gönnerhaft. Er genoss diesen Moment, kostete aus, wie der Kunde den Fisch nahm, in die Runde nickte, ein »Merci« murmelte und seines Weges ging.
Louis und Pascal schauten sich in die Augen.
»Sie werden immer mehr«, schimpfte Louis. »Sie kaufen mit ihren Scheißdollars das ganze Dorf. Meine Tochter bekommt in Bonnieux keine Wohnung mehr. Sie kann nur noch über Airbnb buchen.« Louis’ Augen funkelten. »Und jetzt ist Lourmarin dran. Sie renovieren dort ein Hotel, wusstest du das, Pascal?«
Pascal hatte davon gehört, außerdem war es zu sehen. Ein großes Plakat, wie es sonst an amerikanischen Highways steht, um auf XXXL-Burger oder Popcorn-Eimer aufmerksam zu machen, verschandelte seit Wochen das Straßenbild.
»Ja, Louis, das habe ich.« Schließlich kam man nicht nur wegen der Lebensmittel auf den Wochenmarkt, ebenso wichtig war der Austausch über Neuigkeiten im Ort.
»Sie nehmen uns unsere Kultur. Bald fordern sie auf dem Markt ihr XXXL-Toastbrot und ihren Heinz-Ketchup. Das ist unser Ende.«
Pascal bemerkte, wie die Kunden hinter ihm in der Reihe ungeduldig wurden.
»Genau«, sagte eine weitere Frau, die ihren Korb voll mit Früchten hatte, »und jetzt sollen wir alle Englisch lernen. Einen Teufel werde ich tun. Wenn ich dieses ›How are you?‹ schon höre. Und wieso ist alles so ›cute‹?«
»Und ›amazing‹ und ›fucking great‹«, mischte sich ein dritter Mann in der Reihe ein, der lauter sprach als die anderen, weil er weiter hinten stand. »Sie nehmen uns auch die Sprache. Ich möchte nicht nur in Superlativen sprechen, damit die mich verstehen. Und warum soll ich jetzt kein Rendezvous mehr haben, sondern ein Date? Kann mir das mal jemand erklären? Ich will ein Rendezvous!«
»Als hättest du jemals eines gehabt«, ärgerte die Frau ihn. Hier kannte jeder jeden, wie Pascal das genoss! Einige Kunden lachten, dann nahm ein weiterer Mann das Gespräch wieder auf.
»Sollen sie doch versuchen, Französisch zu lernen«, befeuerte er das Wortgefecht weiter. »Mal schauen, wie sie klarkommen mit ihren Kaugummis im Mund.«
Die Frau mit dem Korb voller Obst erhob die Stimme. »Die halten Gershwin für einen Klassiker.«
Der Mann nickte. »Geht es mal weiter da vorne?«, fragte er Louis und Pascal, der auf dem Eis nach einem Saint-Pierre suchte und erleichtert ausatmete, als er den seltenen Fisch entdeckte. Er brauchte nichts zu sagen.
Stattdessen griff Louis nach dem St. Petersfisch. »Voilà, ein Poule de Mer, für dich heute nur dreißig Euro das Stück.« Pascal war bewusst, dass fangfrischer St. Petersfisch, der als willkommener Beifang der Mittelmeerfischer galt, seinen Preis hatte, aber am Wochenende bekam er Besuch. Und was für ein Besuch das war. Seine Tochter Lillie und ihr Mann Claude würden zu ihm kommen und einen neuen Erdenbürger mitbringen. Die einen Monat alte Olivienne, seine Enkeltochter. Das Essen für den Abend wollte er gemeinsam mit Claude zubereiten, der richtig heiß aufs Kochen war, denn was bleibt einem Sternekoch wie ihm schon als Hobby, wenn er den ganzen Tag ein Baby wickelt, obwohl es eigentlich nur zu Mama will?
Pascal reichte Louis seine Kreditkarte. »Gut, dass ich das Gemüse aus dem Garten holen kann«, bemerkte er.
Louis zog die Karte durch den Kartenleser. »Bei dir würde sich ein Teich oder ein Aquarium lohnen.«
Beide mussten lachten.
Bevor Louis den Fisch in Zeitungspapier einrollte, zeigte er Pascal einen schwarzen Punkt auf der Flanke des Fisches. »Weißt du, woher der Petersfisch diesen Punkt hat?« Louis sprach jetzt ein wenig lauter, weitere Kunden in der Schlange rückten näher an den Verkaufsstand heran, Louis rühmte sich seines manchmal absurden, aber immer unterhaltsamen Wissens über Fische. »Das ist der Fingerabdruck des heiligen Petrus«, verkündete er geheimnisvoll. »Der Apostel hat dem Petersfisch ein Goldstück aus dem Maul gezogen, das zuvor in den See Genezareth gefallen war.«
»Daher der Preis«, bemerkte Pascal, als er den heiligen Fisch über den Ladentisch gereicht bekam.
»Wie bereitest du ihn zu?«, wollte Louis noch wissen.
»Einfach. Ich werde damit wenig machen, wir werden ihn grillen, wie eine Dorade. Wenn Claude es zulässt«, fügte Pascal an.
»Claude kommt?«, fragte Louis.
Jeder hier auf dem Markt in Lourmarin kannte ihn. Schon an vielen Freitagen hatte er Pascal begleitet. Gelassen, freundlich, aber anspruchsvoll in der Auswahl, war er ein gern gesehener Gast. Für Pascal waren viele der Kochabende mit seinem Schwiegersohn prägende Erlebnisse gewesen. Pascal, der Hobbykoch, konnte eine Menge von einem Sternekoch aus Lyon lernen. Vor seiner Kunst am Herd hatte Pascal größten Respekt. Und so freute er sich schon auf das gemeinsame Wochenende.
Der Gedanke, das erste Mal in seinem Leben seine Enkelin zu sehen, würde ihn hier auf dem Markt emotional überfordern, daher blendete er ihn aus.
Der Weg zurück in den Ort dauerte lange. Jetzt in den Sommermonaten waren alle provenzalischen Märkte überfüllt. Die ganze Welt, so schien es, war auf diesem Quadratkilometer zusammengekommen, um über die Qualität von Lebensmitteln zu diskutieren. Deutsche, Belgier, Holländer, Engländer, Amerikaner, Japaner, Skandinavier, manchmal machte Pascal sich einen Spaß daraus, Sprachen zuzuordnen und darüber nachzudenken, aus welchem Winkel der Welt die Marktbesucher kamen. Doch heute, bei über dreißig Grad im Schatten, war ihm nicht danach, er brauchte eine Pause, bevor er den Weg in sein Heimatdorf Lucasson antrat.
Auf dem Weg zum Auto machte er einen kurzen Stopp im »Café Gaby«. Ein Salat Gaby, eine der vielen Spezialitäten von Marc, dazu ein Wasser, ein Rosé und zum Abschluss ein Kaffee, das würde seine Lebensgeister wieder wecken. Wie alle anderen Gäste musste er sich in der prallen Sonne auf der Straße anstellen, um auf einen Tisch zu warten. Nach fünfzehn Minuten bekam er sogar einen Schattenplatz. Den Fisch, sicher zwischen Kühlpads verstaut, stellte er zu seinen Füßen. Endlich hatte er Zeit, in die »La Provence« zu gucken. Das morgendliche Ritual hatte er heute zugunsten des Marktes hintangestellt. Er wusste, er musste früh dort sein, um den Hauch einer Chance zu haben, ein so seltenes Exemplar zu erwerben. Das war gelungen, und so lehnte er sich entspannt zurück, als Marc ihm das Wasser und den Rosé brachte.
Jede Menge Innenpolitik füllte die ersten Seiten der Zeitung, innere Sicherheit und drohende Streiks im öffentlichen Nahverkehr waren die Themen. Paris könnte in den nächsten Tagen lahmgelegt werden. Mit Grauen erinnerte er sich zurück an die Zeit, als er noch bei der Police nationale in der Hauptstadt arbeiten musste. Die Auseinandersetzungen mit den Junkies, mit den jungen Gangstern mit ihren Klappmessern in den Taschen und den in die Innenseiten der Handflächen gedrehten Joints, als würde ein erfahrener Polizist das tatsächlich nicht sehen, wie satt er das alles gehabt hatte. Dann der Auszug seiner Tochter Lillie zu ihrem Freund Claude in Lyon und Catherine, seine damalige Frau, die ihm eröffnete, der Architekt mit seinem durchtrainierten Körper sei inzwischen interessanter als er. Sie hatte zunächst den Reichtum des Mannes verschwiegen. Die Wohnung war aufgelöst, die Beziehung zu seiner Ex hatte sich zwischen schlecht und mittelmäßig eingependelt, und die Gewissheit, dieses eine Mal im Leben alles richtig gemacht zu haben, in den Süden gegangen zu sein, beflügelte ihn. Catherine hatte ihren Waschbrettbauch-Architekten rausgeschmissen. Und so lebten sie beide allein, jeder aber an seinem Sehnsuchtsort, und das war gut so, fand Pascal.
Der Salat Gaby wurde gebracht. Chicorée mit Balsamicospritzern, Karotten, Äpfeln, einer Menge in Honig gerösteter Walnüsse und als Krönung auf dem Salat ein Toast zur Foie gras.
Pascal blätterte weiter in der »La Provence« und sah eine ganze Seite voll mit Prominenten, die sich derzeit im Luberon befanden. Gérard Depardieu, Mireille Mathieu, der deutsche Tenor Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli, die Bilder mit den Unterzeilen nahmen kein Ende. Pascals Interesse am Starruhm hielt sich in Grenzen, die Kunst vieler Musiker, Maler und Schriftsteller bewunderte er, das Privatleben dagegen war ihm egal, und so überblätterte er die Seiten, nicht ahnend, welche Rolle sie noch spielen würden.
Den Sportergebnissen und den Nachrichten aus aller Welt schenkte er mehr Aufmerksamkeit. Nachdem er sich einen umfassenden Überblick verschafft hatte, ging er zur Bar und beglich seine Rechnung. Niemals kam im »Café Gaby« jemand an den Tisch, um abzukassieren, gezahlt wurde ausschließlich an der Bar, ach was, an dem kleinen Tisch neben der Tür. Noch während er zahlte, spürte er, wie sein Handy in der Tasche vibrierte.
Als er schließlich zurück in den brennenden Sonnenschein trat, schaute er, welchen Anruf er verpasst hatte. Jean-Paul Betrix. Sein Chef, der Bürgermeister, der gleich eine SMS hinterhergeschickt hatte, er erwarte ihn zeitnah im Büro. »Zeitnah«, das war auch so eine Betrix-Vokabel, die er in irgendeiner Großstadt aufgeschnappt hatte. Neulich hatte er »asap« unter eine Mail geschrieben, Pascal musste googeln, was das überhaupt bedeuten sollte. Warum schrieb er nicht »so schnell wie möglich«? Betrix würde sich bestens mit den Amis verstehen, die bald den Ort überlaufen würden.
Betrix war ein cholerischer, konservativer Machtmensch. Pascal war es ein Rätsel, wie die Dorfbewohner von Lucasson ihn alle vier Jahre wiederwählen konnten. Die Sympathie für rechtskonservative Bürgermeister war in den kleinen Orten des Luberon zu seinem Leidwesen ausgeprägt. Jean-Paul Betrix war einer der übelsten seiner Art. Mit ihm war er nie warm geworden. Ein Mann wie Jean-Paul Betrix würde niemals verstehen, wie ein Kommissar der Police nationale aus Paris einen so großen Schritt zurück in die Bedeutungslosigkeit gehen konnte, um sich als Dorfgendarm um kleine Delikte, entlaufene Hunde, Hühnerdiebe und Nachbarschaftsstreitigkeiten zu kümmern. Betrix kannte nur den Weg nach oben, und da passte Pascal schlicht und einfach nicht in sein Bild.
Zu Anfang seiner Laufbahn als Dorfgendarm hatte Pascal noch versucht, ihm seine Beweggründe zu erklären, es ging ihm nicht um eine Karriere, es ging ihm nicht um die großen Fälle, es war das Glück, die Chance auf ein neues Leben, die ihn hierhergetrieben hatte. Schon damals bereute er seine Erklärungsversuche, denn auf Jean-Paul Betrix hatte es gewirkt, als hätte er keinen Ehrgeiz. Als sei er gar nicht interessiert, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, doch das stimmte nicht. Gerechtigkeit war Pascals Motor, und doch war er immer wieder daran verzweifelt, dass es sie nicht gab.
Kaum wahrnehmbar aufgestiegen in der Gunst des Bürgermeisters war Pascal erst, als der Chef der Police nationale, Frédéric Dubprée, ihn immer wieder bat, ihn bei der Aufklärung von Mordfällen zu unterstützen. Ein Novum in der französischen Polizeigeschichte, denn in der Regel waren diese Polizeiorganisationen auf eine geradezu groteske Art und Weise miteinander verfeindet.
»Bonjour, Monsieur Chef de Police Lucasson«, begrüßte der Bürgermeister Pascal mit polternder Stimme, als dieser das Rathaus betrat. »Ich hoffe, Sie hatten ein paar entspannte Stunden auf dem Markt?« Die Stimme lauernd.
Egal, was Pascal vorbringen würde, Jean-Paul Betrix war vorbereitet, er holte zum Schlag aus, doch Pascal reagierte kaum. Nicht nur das war es, was den schwergewichtigen Mann auf die Palme trieb. Mit langsamen Schritten schleppte er seine hundertdreißig Kilo über den Flur, atmete schwer, keuchte.
»In Lacoste ist die Hölle los«, prustete er.
»Was verstehen Sie unter ›In Lacoste ist die Hölle los‹?«
»Ja, da staunen Sie, was?« Er wartete nicht ab, er war zu aufgeregt. »Da ist doch nie was los, denken Sie sicher, Chevrier, geben Sie es zu!«
»Na ja, um ehrlich zu sein, ist da nie was los, da haben Sie recht. Viel kann es also nicht sein.«
»Woher nehmen Sie eigentlich diese Pariser Überheblichkeit? Hä?«
»Monsieur –« Weiter kam er nicht.
»Wir hier auf dem Land greifen ein, bevor es zu spät ist, bevor die Situation vor Ort eskaliert, und das ist verdammt noch mal Ihre Aufgabe.«
»Monsieur le Maire, das ist mir bewusst. Lacoste gehörte nur bisher nicht zu unserem Bereich.«
Das Lachen von Jean-Paul Betrix wirkte wie eine Befreiung, eine Genugtuung, es kam aus dem tiefsten Winkel seines gewaltigen Bauchs.
»Sie kommen aber nicht klar ohne …« Er machte eine Pause, weil er wusste, dass er selbst gar nicht gefordert war, sich das aber schwer eingestehen konnte, und so presste er ein »uns« heraus. »Sie kommen ohne uns nicht klar – in Lacoste.«
Pascal schaute ihn überrascht an. »Wie meinen Sie das? Was ist da los?«
»Die Hölle, Chevrier, die Hölle.« Er genoss offensichtlich den Moment von Pascals Unsicherheit.
Doch Pascal sagte nichts, er geduldete sich einfach.
»Eine Demonstration am Schloss von diesem Pierre Cardin.«
»Dem Modeschöpfer? Aber der ist doch tot«, fügte Pascal hinzu.
Er hatte gelesen, dass Cardin schon vor vielen Jahren das ehemalige Schloss des Marquis de Sade gekauft und es vor dem Verfall gerettet hatte. Viel mehr wusste er über den Modezaren nicht.
»Da ist das Pierre-Cardin-Festival, das führen sie weiter, die Erben oder wer auch immer, und seit ein paar Stunden steht das ganze Dorf vor der Eingangstür und demonstriert. Der Mob tobt.«
»Worum geht es?«
»Das ist mal wieder typisch, diese Frage, von einem, der immer auf der Seite der Gewerkschaft steht. Ich kann es nicht mehr hören.«
»Worum geht es?«, versuchte Pascal es erneut.
»Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Da ist Randale, und Sie müssen sich dazwischenstellen, so haben Sie es doch gewollt. Zurück in den Straßenkampf. Mit einem Schild oder was Sie als Polizist sonst noch so zur Verfügung haben, Gummiknüppel, Tränengas, Wasserwerfer, Elektroschocker, aber warten Sie, so was haben wir ja gar nicht.«
»Mal langsam, Monsieur. Handelt es sich um eine gewalttätige Auseinandersetzung?«
»Was weiß ich. Lucas, der Bürgermeister aus Lacoste, hat mich angerufen und um Hilfe gebeten. Die kommen mit diesem Pöbel nicht klar. Merken Sie sich einfach eines: Sie sollen schlichten, wenn es darauf ankommt, keine Fragen zur Politik stellen, das lassen Sie mal meine Sorge sein.«
Ohne Frage hatte Betrix die Politik verstanden, vor allem seitdem sie weltweit auf Parolen zusammengeschrumpft wurde, sodass jede Entscheidung auf ein Handydisplay passte.
»Bon«, sagte Pascal nur knapp, griff nach seiner Uniformjacke und rückte das Képi zurecht. »Voilà, dann werde ich mal schauen, was da los ist.«
Einfache Worte, einfache Sprache, das war es, was Jean-Paul Betrix verstand, keine weiteren Nachfragen, kein Warum. Pascal hatte gelernt, mit seinem Chef umzugehen. Die Dialoge nicht zu kompliziert, eher ein »Ich gucke mal, was da los ist«. Besonders von den einfachen Leuten vom Land, von den Bauern und den Männern und Frauen, die in den Weinbergen schufteten, wurde er gewählt, diese Leute liebten ihn, weil sie ihn verstanden.
Pascal ging über den Parkplatz zu seinem Auto, schaltete die Sirene ein, extra für Jean-Paul Betrix, er wusste, ihm würde das gefallen, und bog dann auf die D36Richtung Bonnieux und Lacoste. Als Pascale das Ortsschild hinter sich gelassen hatte, schaltete er die Sirene wieder aus, öffnete das Fenster und lauschte dem Sound der Provence. Den Zikaden.
2
Eine Autofahrt bedeutete für Pascal, seine Wahlheimat mit den Augen eines staunenden Kindes zu betrachten, sich der Schönheit hinzugeben, einzutauchen in die Landschaft. Die Kalkfelsen, wie sie die Landschaft leuchten ließen, wie sie den sich ausrollenden Lavendelfeldern eine Kulisse gaben, dazwischen die Dörfer, festgekrallt an den Felsen, in Ocker und Beige, die Fensterläden hellblau. Alles hier war hell.
Fünfzehn Minuten dauerte die Fahrt über den Bergpass mit dem blauen Renault der Gendarmerie. Pascal hatte sich inzwischen dasselbe Auto angeschafft, für einen Dorfbewohner mit eigenem Gemüseanbau und Hund eine gute Entscheidung. Ein Kastenwagen war das einzig Wahre auf dem Lande.
Das Gebirge betrachteten viele Autofahrer, die hier täglich fuhren, als störendes Hindernis, das nur Zeit kostete, es zu umrunden und sich über die Serpentinenpässe zu quälen. Pascal lächelte in sich hinein, wenn er diese Geschichten hörte. Diesen einzigen Weg durch die Berge hatte sich in Millionen von Jahren ein kleiner Fluss, der Aigue Brun, erkämpft, der im Süden in die Durance mündete. Nicht ansehnlich mit seinem braunen Wasser und dem durch den Klimawandel in den Sommermonaten fast ausgetrockneten Flussbett. Das Gebirge hatte selbst in all den Epochen den Fluss nicht stoppen können, die Menschen hatten das in nicht einmal einhundert Jahren geschafft.
Pascal steuerte den Kastenwagen im Schneckentempo durch die enge Straße von Bonnieux. Die Touristen vor ihm schienen den Ort im Auto erkunden zu wollen. Immer wieder öffneten sie die Fenster und machten Fotos von den alten Gebäuden, dazu hielten sie an, der Anblick, wie sie verziert dalagen, mit den rankenden Blumen an den Häusern, schien sie zu verzaubern. Ein Meer von Oleander. Pascal hatte Verständnis, ihm war es bei seinem ersten Besuch in Bonnieux ähnlich gegangen. Nachdem die Autokolonne sich durch die enge Gasse geschoben hatte, deren Verkehr nur durch eine neu angebrachte Ampelanlage zu regeln war, ahnte Pascal, was auf ihn zukam. Auf der linken Seite öffnete sich der Blick ins Tal des Luberon. Eine Aussicht, die niemanden kaltließ, die jeden Menschen durchrüttelte, und jetzt packte dieser Anblick auch die Touristen vor ihm. Zur großen Freude der nachfolgenden Autofahrer brachten sie ihren Wagen endgültig zum Stehen, die Köpfe nach links geneigt.
Das Wesen der Südfranzosen war in der Regel von einer gewissen Gelassenheit geprägt, Savoir-vivre, doch änderte sich ihr gesamtes Dasein, sobald sie hinter dem Steuer eines Autos Platz nahmen. Im geschützten Raum eines Fahrzeugs wurde jeder Fahrer vor ihnen zum Cretin, absolut unfähig, einen Wagen zu lenken. Ausnahmslos, denn niemand außer einem Südfranzosen konnte fahren. Selbst als Geisterfahrer auf einer Autobahn würden sie den Gegenverkehr beschimpfen, hatte Pascals Freund, der Gerichtsmediziner Leblanc, einst scherzhaft zu Pascal gesagt, als dieser mit verkrampftem Gesicht auf seinem Beifahrersitz kauerte, sein Testament im Kopf durchgehend.
In der Autoschlange vor ihm, hinter ihm und neben ihm begann ein Hupkonzert in allen verfügbaren Tonlagen. Schließlich schienen die Urlauber im Auto vor Pascal ihn anhand seines Polizeiwagens als Gendarmen zu identifizieren. Ihre Reaktion war so verständlich wie dumm. Plötzlich gaben sie Gas, bemerkten aber zu spät den Hügel auf der Straße, der den Verkehr beruhigen sollte und dies auch erfolgreich schaffte. Der BMW vor Pascal vollführte eine für einen Pkw sehr untypische Bewegung. Er sprang wie ein Kaninchen, das sich in der Höhe eines Hügels verschätzt hatte, unsanft, nein brutal auf. Pascal konnte den harten, ungebremsten Aufschlag der Stoßdämpfer durch das geöffnete Fenster hören. Gestoppt wurde die Fahrt des Wagens erst durch eine beherzte Lenkbewegung in Richtung Parkplatz. Die Touristen mussten verschnaufen, zu viele Eindrücke in zu wenigen Sekunden.
Pascal nutzte die freie Strecke vor sich, um die verlorene Zeit wieder reinzuholen. Eine scharfe Linkskurve, dann schnell durch Bonnieux Richtung Lacoste, das Dorf, das unter Tausenden von Dörfern sofort zu identifizieren war. Das Schloss auf dem dreihundert Meter hohen Gipfel war schon aus einer Entfernung von mindestens zehn Kilometern deutlich erkennbar. Nicht zu fassen, dass in diesem Ort, den Pascal nur verlassen und ausgestorben kannte, etwas passiert sein sollte und offensichtlich gerade passierte.
Über Lacoste lag von jeher ein Geheimnis und ein gewisser Grusel. Der Marquis de Sade sollte in seinen Jahren im Schloss sein Skandalbuch »Die 120 Tage von Sodom« geschrieben haben. Was der Lüstling dort mit den vor allem jungen Frauen getrieben haben musste, war in seinen Büchern nachzulesen. Siebenmal verbrachte der Marquis de Sade lange Zeit hinter Gittern, er wurde zum Tode verurteilt, durch einen vermeintlich glücklichen Zustand verschont, schrieb weiter, landete wieder im Gefängnis, kam schließlich frei und verbrachte im Alter von vierundsiebzig Jahren den letzten Tag seines Lebens mit einer Orgie. Er war der literarische Schöpfer des Sadismus und lebte ihn privat aus, viel mehr musste man nicht wissen.
Diese Geschichten aber lagen lange zurück. Die letzten Jahre gehörte das Schloss bis zu seinem Tode 2020 dem Modeschöpfer Pierre Cardin, der das alte Gemäuer offensichtlich wieder zum Leben erweckt hatte.
Pascal nahm die Strecke um den Ort herum, um ohne Umweg direkt nach oben zum Schloss zu gelangen. Doch weit kam er nicht. Derart viele Menschen auf einmal hatte Pascal in Lacoste noch nie gesehen. Es schien, als hätte sich das ganze Dorf vor dem einzigen Zugang versammelt.
Pascal hörte eine hysterische Stimme durch ein Megafon: »Hände weg von unserem Dorf!«, »Wir leben hier« und »Wir sind keine petites gens«.
Offensichtlich hatten die Bürger aus dem Dorf eilig Plakate zusammengebastelt: »Wir wollen nicht das Saint-Tropez de la culture werden. Wir sind Lacoste.«
Einige der Protestanten hatten Pfeifen mitgebracht. Pascal fuhr auf den vollkommen überdimensionierten Parkplatz vor dem Schloss. Die Skulptur der sich ausbreitenden Arme war in vielen Reiseführern verewigt. Pascal parkte sein Einsatzfahrzeug hinter dem der Gendarmerie aus Bonnieux, die bereits vor Ort war. Oben am Schloss nickte Roussillons Bürgermeister Arthur ihm freundlich zu. Pascal ging zu ihm, um ihn zu begrüßen.
»Vier Gendarmerien für die paar Demonstranten?« Pascal musterte die Menge, die zwar aufgebracht war, aber nicht den Eindruck machte, die Situation würde außer Kontrolle geraten. Dies war nicht das Oval Office, es war ein halb renoviertes, halb verfallenes Schloss im Luberon.
»Der Eindruck könnte täuschen.« Arthur sprach, ohne seinen Blick von den Demonstrierenden zu wenden.
»Sie meinen, unter den Demonstranten gibt es Gewaltbereitschaft?«
»Non, aber das kann trotzdem passieren, denn diese Demonstration ist weder angemeldet noch genehmigt. Es ist eine spontane Aktion. Wenn alles friedlich bleibt, greifen wir nicht ein.« Er schaute auf die Menschenmenge und fügte hinzu: »Aber sie sind verdammt wütend.«
Pascal beobachtete eine Frau, die ein Gemälde hochhielt: »Wir sind die Künstler.«
»Worum geht es ihnen?«
»Pierre Cardin hat hier alles weggekauft, den ganzen Berg. Es gibt hier keinen freien Wohnraum mehr für die Leute aus dem Dorf, und es sind nur vierhundert Menschen, die hier leben. Viele mussten Lacoste verlassen, sie wohnen jetzt auf dem Plateau, dem flachen Hügelgipfel jenseits des Schlosses. Sie sind vom Ortskern abgeschnitten. Vor ein paar Jahren haben sie unten am Hang dreizehn Sozialwohnungen bauen lassen, die sind inzwischen alle belegt. Außerdem steigen hier die Preise, für alles, und das da unten«, er nickte in Richtung Tal, das sich zwischen Bonnieux und Lacoste erstreckte, »gehörte ihm auch. Da sollte ein Golfplatz hin, stell dir das vor, dort, wo die Winzer ihre Weinberge haben. Die sollten alle weg. Jetzt reicht es den Bürgern von Lacoste. Und um ehrlich zu sein, Monsieur Chevrier, ich kann sie verstehen.«
»Aber Pierre Cardin ist doch gestorben.«
»Das ist es ja. Darin sehen die Bewohner aus Lacoste ihre Chance. Sie wollen Aufmerksamkeit, gerade jetzt, wo ihr Dorf für ein paar Tage zum Mode-Mekka wird. Sie wollen ihr Leben zurück, ihr Dorf, ihre Wohnungen zurückkaufen, doch die Lage ist kompliziert. Es gibt keinen Erben, nur irgendeinen Großneffen und jede Menge Verwalter und Leute, die sein Werk fortführen. Das bedeutet Chaos. Der Horrorbegriff für jeden Bürgermeister, fragen Sie Jean-Paul Betrix.«
Pascal hörte plötzlich Motorengeräusche hinter sich. Mehrere Autos kamen den Berg hinauf, sie fuhren in Kolonne und hupten.
»Mon Dieu, jetzt kommen auch noch die Bewohner aus Bonnieux.«
Wenige Sekunden später sprangen sie aus den Autos, auch sie hatten Plakate dabei, holten sie aus ihren Autos und hielten sie hoch. Ein Jubelschrei erklang aus den Kehlen der Demonstranten, als sie sich ihnen anschlossen. Inzwischen waren es gut einhundert. Der Zug setzte sich in Bewegung, in Richtung Schloss.
»Wir wollen jetzt reden«, riefen sie. »Kommt raus.«
Pascal lief über die linke Seite an den Demonstranten vorbei zu der schmalen Holzbrücke, die der einzige Zugang war. Über dem Portal die Silhouette des Marquis de Sade, in Silber, modern.
Das Eindringen der immer lauter werdenden Menschen musste er verhindern.
»Stopp, arrêtez!«, rief er. »Das Gebäude ist Privatbesitz. Hier geht es nicht weiter.«
Aus dem Augenwinkel sah er, wie die Kollegen der Gendarmerie aus Lacoste, die er bislang nicht kannte, weitere Hilfe anforderten. Sie würden die Lage mit drei Gendarmen vor Ort vielleicht nicht allein meistern können.
»Wir gehen da jetzt rein!«, rief eine Frau und versuchte an Pascal vorbeizukommen.
Er hielt sie fest, sofort kamen zwei Kollegen der Gendarmerie aus Lacoste und stellten sich hinter ihn.
»Sie werden da nicht reingehen«, ermahnte Pascal sie.
Gustave aus Goult kam ebenfalls zu Hilfe.
Ein weiterer Demonstrant stürmte Richtung Schlossportal. An einem Selfiestick hielt er sein Handy über die Leute. »Attention!«, rief er. »Jetzt soll Frankreich sehen, was sie von ihrem ungebremsten Kapitalismus haben. Wir sind live bei Insta.«
Die Demonstranten johlten. Von hinten begannen die Neuankömmlinge zu drängeln, sie drückten nach vorn.
Pascal wusste, dass sie zu viert die Position nicht lange würden halten können. Er rief noch einmal laut: »Arrêtez. Was wollt ihr? Worum geht es?«
Er musste Zeit gewinnen, zwei Fahrzeuge der Police municipale waren unterwegs. Zwölf Kollegen zusätzlich, hoffentlich ausgerüstet mit Schutzschilden und Knüppeln, die sie zur Not einsetzen konnten, dürften ausreichen. »Worum geht es euch?«
»Pierre Cardin hat hier alles gekauft, da unten, die ganze Straße, alle Häuser, und jetzt stehen sie leer«, rief ein Mann in der ersten Reihe, der ein Schild mit der Aufschrift »Wir wollen unser Dorf zurück« in Händen hielt.
»Genau, der hat sich hier nie blicken lassen. Der hat die ganze Straße unten gekauft, da lebt jetzt keiner mehr. Die Appartements stehen leer, da sollen nur seine reichen Freunde aus Paris wohnen.«
»Alles wegen des Festivals«, rief ein weiterer Mann aus der zweiten Reihe. »Vier Wochen sind sie hier, diese ganzen Künstler, Gérard Depardieu, Andrea Bocelli, Jonas Kaufmann, die eben alle, und dann verschwinden sie wieder. Und die Zeitungen schreiben nur, wie toll es ist, dass sie alle hier sind. Ist es aber nicht. Denen ist es egal, was hier aus uns wird, aber wir leben hier.«
»Wir haben hier nicht einmal eine Einkaufsmöglichkeit, wir haben keinen Arzt, nur diese leeren Häuser, alle entrümpelt, alle aus grauem Beton, kaum ein Haus ist fertig.«
»Schluss damit!«, schrie die Frau vor ihm und stürmte an Pascal vorbei über die Brücke.
Die Menge johlte. Zwei Einsatzfahrzeuge der Police municipale kamen den Berg hinaufgefahren, sie hatten die Sirenen eingeschaltet. Auseinandersetzungen dieser Art waren die Demonstranten nicht gewohnt. Für viele musste es die erste Demo ihres Lebens sein, Bilder wie diese kannten sie nur aus Marseille und Paris. Einige blickten sich unsicher um, als die Einsatzkräfte der Police municipale mit ihren Schilden und Gummiknüppeln aus den Autos auf sie zugerannt kamen, ihre Pistolen in den Halftern.
»Film das«, schrie eine Frau dem Mann mit dem Selfiestick zu. »Das sollen die ruhig alle sehen, wie wir hier behandelt werden.«
»Wir tun ihnen nichts«, rief Pascal. »Sie dürfen nur nicht über die Brücke in das Schloss, das ist in Privatbesitz.«
Arthur blickte sich unsicher um. Hinter ihm hatte einer der Kollegen aus Bonnieux die Frau eingefangen, gerade noch rechtzeitig, bevor sie die zweite Tür in den Innenbereich erreicht hatte. Der Kollege der Gendarmerie hatte ihr sogar Handschellen angelegt. Der Stress schien ihr zuzusetzen.
»Polizeigewalt!«, schrie sie. »Blinde Wut gegen uns Bürger.«
Ihr Blick war verzerrt, doch dann johlten die Demonstranten erneut und feierten ihren Durchbruch. Eine von ihnen hatte es geschafft, das wurde als Erfolg verbucht. Sie lächelte schwach und verunsichert, als sie zum Polizeiwagen gebracht wurde.
Inzwischen hatten die zwölf Kollegen der Police municipale die Demonstranten umstellt. Sie hatten die Situation im Griff. Pascal entspannte sich ein bisschen, bis er plötzlich in der Menge Frédéric Dubprée und Audrey von der Police nationale erblickte. Sie standen gut zwanzig Meter abseits der Demonstranten und winkten ihm zu. Audrey gab ihm ein Zeichen, er solle doch bitte zu ihnen kommen. Er nickte Arthur zu, der noch immer neben ihm stand.
»Ich gehe dann mal«, sagte er zu Arthur, »denke nicht, dass ich noch gebraucht werde.«
Die Demonstranten waren nach der Festnahme ruhiger geworden, ganz offensichtlich waren sie eingeschüchtert. Die Frau saß inzwischen im Polizeiwagen, keine weitere Person schien einen Durchbruch zu versuchen. Die Provenzalen kannten es nicht, von der Polizei abgeführt zu werden. Die Aktion veränderte die Lage.
Langsam ging Pascal auf Frédéric Dubprée und Audrey zu. Der Chef der Police nationale in seiner maßgeschneiderten Uniform und mit seinem sorgfältig zurückgekämmten Haar sah aus, als käme er gerade von einem Modelshooting. Seine Augen wie immer ernst, die Lage abscannend. Audrey daneben, ihre dunklen Pupillen auf ihn gerichtet. Ihr Haar trug sie länger als bei ihrer letzten Begegnung. Es stand ihr, nein, sie sah umwerfend aus. Es wurde ihm von innen warm, als sich ihre Blicke begegneten.
Er hatte gehofft, sie erst einmal nicht wiederzusehen, sich endlich von ihr befreit zu haben, doch diese Sekunden reichten aus, und die undefinierbare Anziehungskraft war zurück. Er hatte gehört, sie hatte eine Partnerin gefunden, sie überlegten sogar, zusammenzuziehen, für sie die einzig mögliche Lebensgemeinschaft, hatte sie ihm einst eröffnet. Nur eine Frau an ihrer Seite würde es aushalten, würde sie dauerhaft verstehen. Jetzt stand sie hier, und Pascal hätte sie am liebsten sofort an sich gedrückt.
Ihre Liebesbeziehung war von der ersten Sekunde an schwierig gewesen. Sie hatte aus ihrer Bisexualität nie einen Hehl gemacht, und doch hatte Pascal gemeint, ihre Affäre, die für ihn so viel mehr war, in ein gemeinsames Leben führen zu können. Mein Gott, war er verliebt in sie gewesen. Wie ein Teenager hatte er sich verhalten, und dann war die nächste Frau in Audreys Leben getreten, die nächste Liebe.
Frédéric Dubprée, seine Sensoren immer ausgefahren, registrierte die Situation sofort. Er hatte schon von Beginn an die Flammen zwischen seiner Polizistin und dem Dorfgendarmen spüren können. Überlegen, wie es seiner Natur entsprach, ergriff er schließlich das Wort.
»Wir wussten, dass wir Sie hier treffen.«
»Natürlich«, entgegnete Pascal, »das ist mein Job. Ich bin Dorfgendarm.« Er schaute die beiden Beamten der Police nationale vor sich an. »Nur, was macht ihr hier? Wegen der Demo werdet ihr nicht hier sein?«
Audrey lächelte. »Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Unten im Dorf?«
Pascal nickte.
»Wir denken, da kommt etwas auf uns zu.« Frédéric Dubprée setzte sich in Bewegung. »Kommen Sie. Audrey hat recht, gehen wir runter, ins ›Café de Sade‹.«
»Die haben sogar ein Café nach ihm benannt?«
»Nicht nur das«, entgegnete Audrey.
3
Der Abstieg über die sich durch das Dorf schlängelnde Rue Saint-Trophime mit dem rutschigen Kopfsteinpflaster erforderte Konzentration. Schon um den kleinen Seitenweg neben dem Schloss, hinunter über zerfallene Steinstufen und jede Menge Geröll, schien sich niemand gekümmert zu haben. Schon zweimal hatte Pascal fast den Halt verloren, war dann wieder bemüht, den Anschluss an seine beiden Kollegen nicht zu verlieren. Schwer vorstellbar, wie es gerade älteren Menschen mit Einkaufstaschen gelingen sollte, sich durch diesen Ort zu bewegen.
Pascal musterte die Häuser zur rechten und linken Seite der Gasse. Sie schienen tatsächlich unbewohnt, nichts deutete auf Leben hin, ganz genau so, wie die Demonstranten am Schloss es beschrieben hatten. Steile Kurven, Privateingänge, vorgehängte Schlösser, verrammelte Türen. Ein Geisterort, aber zugleich auch faszinierend und betörend. Eine Mittelalter-Kulisse wie aus einem Historienfilm. Pascal ließ sich ein Stück zurückfallen. Audrey und Frédéric Dubprée, selbst mit dem steilen Abstieg beschäftigt, schenkten ihm keine Aufmerksamkeit, und so konnte er durch die Fensterscheiben in das Innere eines Hauses schauen. Auf dem Boden grauer Estrich, ein Betonmischer und mehrere Eimer. Niemand arbeitete. Pascal ging ein paar Schritte den steilen Weg abwärts hinunter zum nächsten Haus, stützte sich an einer Mauer ab, um nicht abzurutschen, schaute durch ein milchiges Fenster. Auch hier ein ähnliches Bild. Die Wände leer, kahl, grau, die Decke ungestrichen, der Boden ebenfalls grauer Estrich. So auch das nächste und übernächste Haus. Baustellen. Niemand schien hier zu leben, alles schien Renovierungsarbeiten zu unterliegen.
In der Mitte des Abstiegs befand sich ein schmaler Pfad, der hinter zwei Häusern verschwand. »Résidence du SCAD«, stand in geschwungenen Lettern auf einem Schild, das einer Ritterrüstung glich. Beim weiteren Abstieg hinunter ins »Café de Sade« entdeckte Pascal weitere Schilder mit den Buchstaben SCAD auf Hauswänden. Museen, Kunsträume, Schaufenster mit Installationen. Ein in Stein eingeschlagenes Straßenschild »Rue Bernard Pfriem«. In der Provence ein bekannter Name, wusste Pascal. Er hatte in Lacoste eine Kunstschule gegründet.
Nur die Häuser der SCAD schienen bewohnt zu sein, alle anderen waren verwaist. Pascal hatte viele Fragen, als er Frédéric Dubprée und Audrey in das »Café de Sade« folgte. Als Logo wie schon oben am Schloss das Profil des Dichters und der Hinweis, das Café sei ein Restaurant und eine Pizzeria mit einer Tageskarte und einem breiten Angebot von Speisen.
Pascal, Frédéric Dubprée und Audrey nahmen auf einer kleinen Terrasse Platz, über ihnen ein beiger Sonnenschutz, der sich wie ein großes Segel schützend über die Gäste spannte.
Die drei wurden zu einem der hinteren Tische auf der Terrasse geführt. Ohne Nachfrage bestellte Frédéric Dubprée drei Kaffee und eine Karaffe Wasser. Die Hitze forderte ihren Tribut, der Abstieg in der Sonne hatte sie schwitzen lassen, zufrieden ließen sie sich in die Gartenstühle sinken.
Noch bevor die Kellnerin im Inneren des Restaurants verschwunden war, räusperte Frédéric Dubprée sich und bewegte seinen Oberkörper kaum sichtbar ein Stück nach vorn über den Tisch in Pascals Richtung. Sein Blick wanderte von Audrey zu Pascal und zurück, für einen Moment schwieg er.
»Da sind wir also wieder«, sagte er leise.
Pascal hatte den Chef der Police nationale aus Apt fast nie lachen sehen, sodass der kaum wahrnehmbare Anflug eines Lächelns schon als Gelöstheit zu verstehen war. Noch konnte Pascal sich keinen Reim auf dieses Treffen machen, jetzt war er begierig, zu erfahren, warum zwei hohe Beamte und sogar der Chef der Police nationale zu einer kleinen Demonstration in Lacoste gekommen waren. Im Vorfeld nicht angekündigte Demonstrationen aufzulösen war die Aufgabe der Police municipale oder der Gendarmerie, sie waren für Ordnungswidrigkeiten und die Ruhe im Dorf verantwortlich. Als einfacher Gendarm aus Lucasson verstand selbst Pascal seinen heutigen Einsatz lediglich als Nachbarschaftshilfe.
»Wir haben heute Vormittag eine Vermisstenmeldung bekommen. Ein Mannequin ist heute Mittag nicht im Schloss erschienen, obwohl dort für eine große Modenschau geprobt wird, die in zwei Tagen stattfinden soll. Gestern war sie noch da«, setzte Frédéric Dubprée nach einer kurzen Pause hinzu.
Er sagte Mannequin, nicht Model, das passte zu ihm, das Wort trug eine Wertschätzung in sich und erinnerte zugleich an das Ursprungsland dieses Berufs. Er war ein stolzer Franzose, der sich seiner Tradition bewusst war. So saß er da und trank seinen Kaffee aus, dann blickte er in die Runde.
»Es wäre kein Grund zur Beunruhigung, aber sie hält sich offenbar auch nicht in ihrer Unterkunft hier unten im Ort auf. Es hieß, sie hätte auch die Nacht nicht dort verbracht.«
Audrey ergriff das Wort. »Natürlich, sie ist jung, sie ist hübsch, sehr hübsch sogar, hier gibt es sicher Partys und Veranstaltungen rund um das Event.« Audreys Augen leuchteten, wie immer, wenn es um ein aufregendes Nachtleben und schöne Menschen, insbesondere um hübsche Frauen, ging.
»Vielleicht ist sie versackt«, merkte Pascal an.
»Das ist das Problem, Pascal«, antwortete Frédéric Dubprée. »Sie scheint, nach dem wenigen, was wir wissen, nicht der Typ dafür zu sein. Sie hat auch einen Fahrer, den sie die ganze Nacht über nicht benötigt hat. Er steht ihr vierundzwanzig Stunden zur Verfügung, doch sie hat ihn in den Feierabend geschickt. Niemand hat sie also gesehen, und wenn du dich umschaust, Pascal, hier kommst du ohne Auto nicht weit. Ist doch komisch.«
»Um wen handelt es sich?«, wollte Pascal wissen.
»Sie heißt Jezebel Umajulu, wobei niemand ihren Nachnamen nutzt. Designer und Veranstalter kennen sie nur unter dem Namen Jezebel.«
»Von ihr habe ich gerade heute Morgen gelesen.« Vor Pascals innerem Auge tauchte der Artikel von heute Vormittag aus der »La Provence« auf. Dort war sie abgebildet gewesen.
»Ja, Pascal, sie ist ein Superstar, ein Supermodel. Noch weiß die Öffentlichkeit nichts von ihrem Verschwinden, aber wenn diese Geschichte publik wird«, Audrey schaute Frédéric Dubprée und Pascal bedeutungsvoll an, »dann haben wir hier im stillen Luberon einen echten Skandal.«
»Wer hat sie zuletzt gesehen?«, fragte Pascal.
»Eine gewisse Tracy, eine amerikanische Garderobiere. Sie hat sich gestern um zweiundzwanzig Uhr oben am Schloss von Jezebel verabschiedet. Sie soll ebenso die Rue Saint-Trophime genommen haben, ist aber auch möglich, dass sie später in die Rue de Basse eingebogen ist, auch da stehen Häuser, sie geht nach einem steilen Abstieg wieder ein Stück den Berg hinauf. Es gibt nur diese beiden Straßen und ein paar Sackgassen, wie die Impasse de Bouffe Tourtoune, die aber ein schnelles Ende findet, da sich einige Abzweigungen in Privatbesitz befinden, meist gehören die Häuser entweder SCAD oder Pierre Cardin, das wissen wir bereits.« Ein einvernehmliches Nicken, Audrey strich sich über ihre nackten Fußknöchel.
»Über Jezebel gibt es eine Menge im Netz. Aber vieles davon ist widersprüchlich. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir am Ende nicht viel. Sie kommt wohl aus Afrika, aus Ghana. Auch über ihre Familie wissen wir nichts, weder über ihre Eltern noch über ihr Liebesleben. Nur dass die Designer der Welt sich um sie reißen. Sie gehört zu den bestbezahlten Models der Welt.«
Audrey griff in ihre Tasche und zog ein Modemagazin hervor. Es war die Vogue. Pascal hatte sie das letzte Mal bei seiner Ex-Frau Catherine in Paris gesehen, und da sich sein Interesse für Mode in Grenzen hielt, hatte er Zeitschriften wie diese nie wieder gelesen beziehungsweise angeschaut. Zu lesen gab es schließlich auch nicht viel.
»Alles, was wir derzeit wissen«, übernahm Frédéric Dubprée wieder das Wort, »sie gilt als extrem professionell und ehrgeizig. Der Veranstalter Danielle Deontré ist äußerst besorgt. Auch wenn es nur eine Nacht ist, aber sie hat wohl noch nie eine Probe verpasst. Schwer zu sagen, ob er sich Sorgen um sie oder um die Modenschau macht. Er war aufgebracht, als er sich heute Morgen bei der Police nationale gemeldet hat, richtig besorgt. Es sei untypisch für sie, sagte er, das betonte er immer wieder, untypisch.«
Audrey lächelte. »Danielle Deontré ist eine Dramaqueen, so wie wir es aus der Modewelt erwarten. Ein wandelndes Klischee.«
»Wir müssen der Sache nachgehen«, sagte Frédéric Dubprée, »dazu die Demo, die aufgebrachten Menschen hier im Ort, wir sollten ein Verbrechen ausschließen können.«
Pascal blickte Frédéric Dubprée für einen Moment direkt in die Augen, er wusste, was jetzt kommen würde.
»Ja, Monsieur Chevrier«, sagte er schließlich, »wir hätten Sie gern an unserer Seite. Die Formalitäten kläre ich mit Jean-Paul Betrix.« Frédéric Dubprée lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Die Nachmittagssonne beschien sein Gesicht.
Pascal kannte das Prozedere. Die Gendarmerie unterstand direkt dem Bürgermeister und hatte eigentlich andere Aufgaben, als in möglichen Verbrechen zu ermitteln. Pascal musste offiziell von seinen Aufgaben als Dorfgendarm freigestellt werden, und damit tat Jean-Paul Betrix sich in der Regel schwer. Immer wieder wies er darauf hin, dass die Police nationale und die Gendarmerie im ganzen Land verfeindet seien und dass es dafür tausend Gründe gäbe, gute Gründe, und dass er gar nicht verstehe, dass man sich hier in seinem Dorf über diese Art von Feindschaften hinwegsetzte. Nur hatte sich in der Vergangenheit das Prinzip, einen ruhigen, scharfsinnigen Mann wie Pascal Chevrier abzuberufen, ausgezahlt, und dagegen gab es keine Argumente.
»Natürlich, Monsieur Dubprée«, sagte Pascal förmlich.
»Sprechen Sie mit den Veranstaltern, mit Danielle Deontré. Vielleicht kennt er Jezebels Gewohnheiten, hat doch eine Idee, wohin sie gegangen sein könnte. Vielleicht weiß er etwas über die Familie, über ihr Leben, ob sie liiert ist. Bislang scheint niemand außer ihm sie zu vermissen.«
»Sie ist erst seit einer Nacht weg«, merkte Pascal an, »normalerweise würde da nicht einmal die Gendarmerie eingreifen. Auch Touristen verschwinden mal für eine Nacht.«
»Nur ist sie keine Touristin, sondern ein Supermodel, ein Super-Mannequin«, sagte Frédéric Dubprée.
Pascal nickte langsam und sah zu Audrey.
»Ja, Monsieur«, setzte der Chef der Police nationale noch hinzu. »Audrey wird an Ihrer Seite sein.«
»Bon«, antwortete Pascal knapp. Eine weitere Zusammenarbeit mit Audrey würde ihn fordern, seine Gefühlswelt strapazieren, es würde anstrengend werden. Nur eine Nacht, sagte er sich, vielleicht löst sich schon am Nachmittag alles auf. Zumindest hatte er diese leise Hoffnung, war aber alarmiert.
4
»Das Problem sind die Beine«, sagte Pascal und lachte dabei, während er versuchte, sie sanft in eine angewinkelte Position zu bekommen.
»Olivienne ist eben gut drauf, wenn Opa versucht, die Windeln zu wechseln.«
Pascal warf seiner Tochter Lillie einen bitterbösen Blick zu. Bei dem Wort »Opa« zuckte er noch immer zusammen. Der Weg in die neue Lebensphase war noch weit, wusste er.
»Es ist eben schon ein bisschen her«, grummelte Pascal, als Oliviennes Beine wie kleine Schlagzeugstöcke in die Luft flogen und sie dabei einen komplizierten Drumbreak vollführte, dazu ein Quietschen, pure Freude.
»Warte es ab, ich bekomme dich«, sagte Pascal, griff sich einen der nach oben gestreckten Füße und küsste ihn. »Das habe ich mit dir auch immer so gemacht«, sagte Pascal zu seiner Tochter.
»Schön, dass du dir wenigstens das abgewöhnt hast.« Lillie beobachtete ihren Vater mit einer Mischung aus Strenge und Vergnügen, immer bereit, wie eine Löwin dazwischenzuspringen, wenn er sich zu blöd anstellte, die Schrankkante im Blick.
»Jetzt die Windel«, rief Pascal wie ein Chirurg im OP. »Schnell«, fügte er noch hinzu.
Er hatte jetzt beide Beine seiner Enkeltochter so weit nach oben gestreckt, dass sie nur noch mit den Schulterblättern und dem Kopf auf der zur Wickelkommode umgebauten Anrichte lag. Er war zufrieden mit sich, Olivienne nicht. Die Stellung, auf Kopf und Schultern zu ruhen, gefiel ihr nicht. Aus dem fröhlichen Jauchzen wurden nun laute Töne des Unwohlseins, die ihm aus dem zahnlosen aufgerissenen Mund entgegengeschmettert wurden. Er sah das Zungenzäpfchen, wie es vibrierte, Kraft sammelte und sich dann im Rhythmus des Schreis bewegte.
»Es gibt nur Freude oder Leid, nichts dazwischen«, bemerkte Lillie und übernahm wieder die Beine, die Pascal ihr dankbar überließ. »Mach dir nichts daraus … Opa.« Lillie stupste ihren Vater leicht in die Seite, um sich entweder zu entschuldigen oder dem Wort »Opa« eine Dringlichkeit zu verleihen. Mit einer routinierten Bewegung wickelte sie die Windel um die Taille ihrer Tochter, dann beugte sie sich nach vorn, dicht über das Kind, und flüsterte: »Geschafft«, und dabei übersäte sie Olivienne mit Küssen. Wie Lillie dort stand, ihre Tochter küssend, sollte sich in Pascals Gedächtnis einbrennen.
Bei jedem lebensverändernden Ereignis kommt der Moment, in dem alle Beteiligten begreifen, es gibt ein Gestern und ein Heute, und das Gestern hat mit dem Heute nichts mehr zu tun. Das Leben verändert sich jetzt von Grund auf. War bisher Lillies Nachricht aus dem Krankenhaus – alles sei gut gegangen, Claude sei die ganze Zeit bei ihr gewesen, es habe zwölf Stunden gedauert, sein Enkelkind heiße Olivienne, nein, sie heiße wirklich so, immerhin sei ihr Mann ja Koch, und jetzt sei sie erschöpft, aber so glücklich wie nie im Leben – nur eine Nachricht gewesen, wenn auch die schönste überhaupt, konnte er es jetzt das erste Mal mit eigenen Augen erleben, dieses Wunder.