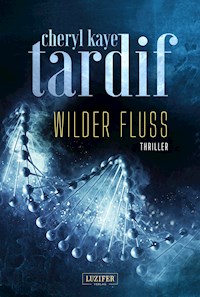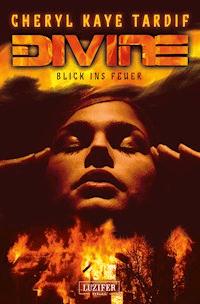Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"VERSUNKEN liest sich wie ein herannahender Sturm, voller Dunkelheit, Schrecken und Elektrizität. Bereiten Sie sich auf eine Gänsehaut vor." [Andrew Gross, New York Times Bestseller-Autor von 15 Seconds] "Und wieder einmal hat Tardif ein spannendes Meisterstück abgeliefert." [Scott Nicholson, internationaler Bestsellerautor von The Home] "Mit Versunken nimmt Cheryl Kaye Tardif den Leser von der ersten Seite an gefangen: Es ist eine unwiderstehliche Geschichte der Qual und Erlösung." [Rick Mofina, Bestsellerautor von Into the Dark] "Cheryl Kaye Tardifs neuestes Buch Versunken wird Sie ebenso wenig loslassen wie die Figuren darin." [Joshua Corin, Bestsellerautor von Before Cain Strikes] Inhalt: Zwei Fremde, zwei Schicksale, eine Angst. Kummer und Verlust sind Marcus Taylors tägliche Begleiter geworden. Erst verlor er durch einen tragischen Autounfall seine Frau und seinen Sohn, wenig später durch Depressionen und Tablettensucht auch noch seine vielversprechende Karriere als Rettungssanitäter. Nun arbeitet er als Telefonist in der Notfallzentrale – für ihn der einzige Weg, etwas von seiner Schuld zurückzuzahlen. Bis er einen Anruf bekommt. Von einer Frau, die in ihrem Auto eingeschlossen ist … Rebecca Kingston sehnt sich nach diesem Wochenendausflug, an dem sie in Ruhe über die drohende Scheidung von ihrem gewalttätigen Ehemann nachdenken will. Doch als sie ein mysteriöser Lastwagen von der Straße und in einen Fluß abdrängt, findet sie sich eingeklemmt hinter dem Lenkrad ihres Wagens wieder. Weder kann sie sich befreien, noch ihren beiden Kindern auf der Rückbank helfen. Ihr einziger Rettungsanker ist ihr Handy, dessen Batterie zur Neige geht, und die beruhigende Stimme eines Fremden, der ihr verspricht, dass alles gut werden wird …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VERSUNKEN
Cheryl Kaye Tardif
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Nicole Lischewski
Copyright © 2013 by Cheryl Kaye Tardif All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
Meinungen zu VERSUNKEN
»Versunken liest sich wie ein herannahender Sturm - mit Dunkelheit, Grauen und knisternder Spannung. Erwarten Sie eine Gänsehaut.« [Andrew Gross, New York Times Bestsellerautor von 15 Seconds]
»Gleich von der ersten Seite an merkt man, dass man sich in die Hände einer erfahrenen und gewieften Erzählerin begeben hat, die einem mit diesem Pageturner schlaflose Nächte bescheren wird. Tardif versteht sich auf ihr Metier. Ihre Bücher verkaufen sich aus gutem Grund wie wild, denn ihre Wörter brennen geradezu auf den Seiten. Sie ist eine herrlich angsterregende, den Pulsschlag in die Höhe treibende Autorin.« [M.J. Rose, internationale Bestsellerautorin von Seduction]
»Und wieder einmal hat Tardif ein spannendes Meisterstück abgeliefert.« [Scott Nicholson, internationaler Bestsellerautor von The Home]
»Mit Versunken nimmt Cheryl Kaye Tardif den Leser von der ersten Seite an gefangen: Es ist eine unwiderstehliche Geschichte der Qual und Erlösung.« [Rick Mofina, Bestsellerautor von Into the Dark]
»Cheryl Kaye Tardifs neuestes Buch Versunken wird Sie ebenso wenig loslassen wie die Figuren darin.« [Joshua Corin, Bestsellerautor von Before Cain Strikes]
»Versunken raubt den Lesern den Atem – eine übersinnliche Fahrt ins Grauen, bei der man gebannt auf der Stuhlkante sitzt.« [Jeff Bennington, Bestsellerautor von Twisted Vengeance]
Für meinen Vater, der mich immer unterstützt hat.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: SUBMERGED Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Nicole Lischewski
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-147-9
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Danksagung
Ein ganz besonderes Dankeschön an meinen langjährigen Freund Mike, ohne den dieser Roman gar nicht entstanden wäre. Mike, danke, dass du deine eigene Geschichte über das Süchtigsein erzählt hast, und wie es sich auf dein Leben, deine Ehe, deine Karriere und auf die Menschen in deinem Umfeld ausgewirkt hat. Dein ruhiger Mut ist inspirierend. Und dein jetziges Leben ist der beste Beweis, dass es die Möglichkeit der Wiedergutmachung gibt, wenn man sein Verhalten ändert, sich an die Hoffnung klammert und damit an die Oberfläche schwebt.
Danke auch an Sharon DeVries vom Yellowhead Regional Emergency Communications Centre für die unschätzbar wichtigen Informationen über die Notrufzentrale und die Vorgehensweisen in Hinton und Edson. In Romanen muss man die Wahrheit manchmal in die Zwangsjacke des Plots stecken und die Geschwindigkeit der Erzählung anstacheln. Wenn etwas falsch dargestellt ist, liegt das allein an mir; auch wenn ich mich immer bemühe, glaubhafte Szenen und Charaktere zu entwickeln.
Vielen Dank auch an Laurent Colasse, den Präsidenten von ResQMe, und Melissa Christensen, dass ich ihr Produkt und ihren Markennamen in meinem Roman verwenden durfte. Ich hoffe, dass diese wichtige Notfallhilfe dadurch bekannter wird. Meine höchste Anerkennung gilt auch ihrer Spende von einem Dutzend ResQMe-Schlüsselanhängern, die im Rahmen der Erstveröffentlichung dieses Buches verschenkt werden. Mehr Informationen über das Produkt finden sich unter www.resqme.com
Danke auch an Christopher Bain, Senior Manager of Product Planning and Development bei BioWare ULC, einer Abteilung von Electronic Arts Inc., dass mir gestattet wurde, den Namen der Gesellschaft in diesem Roman zu verwenden. www.bioware.com
Ich danke John Zur, einem geschätzten Leser und Fan meiner Romane, dass ich ihn zu einer Romanfigur machen durfte – und zwar zu einer guten. Mir schwebt für Detective John Zur noch allerlei vor und ich glaube, dass er auch noch in einem zukünftigen Buch wieder auftauchen wird.
Ein großes Dankeschön auch an einen ganz besonderen Fan aus der Teenagerfraktion. Gabbie Gros hat mir erlaubt, sie auf diesen Seiten zu verewigen. Gabbie, ich hoffe sehr, du weißt, dass du sein und werden kannst, was immer du willst. Deine Zukunft liegt in DEINEN Händen. Du bist ein Geschenk für die Welt! Vergiss das niemals.
Prolog
In der Nähe von Cadomin, Alberta – Samstag, den 15. Juni 2013 – 00:36 Uhr
An den Gestank des Todes gewöhnt man sich nie. Marcus Taylor kannte den Geruch nur zu gut. Er hatte schon die Ausdünstungen von verbranntem Fleisch, verrottetem Fleisch sowie krankem Fleisch eingeatmet. Lange, nachdem man ihn von der Leiche weggeholt hatte, roch er immer noch danach.
Die Erinnerung an die grauen Gesichter und blauen Lippen seiner Frau und seines Sohns schwappten wieder über ihn.
Jane … Ryan.
Zum Glück gab es an diesem Abend keine Leichen. Der einzige Geruch, den er identifizieren konnte, war der, der nassen Prärie und der dumpfen Atmosphäre nach dem Gewitter und dem Geruch des Flusses.
»Also, was ist passiert, Marcus?«
Die Frage kam von Detective John Zur, einem Polizisten, den Marcus noch von früher kannte. Von damals, bevor er sein sicheres Einkommen und seine angesehene Karriere für etwas eingetauscht hatte, das ihn geistig und körperlich kaputtmachte.
»Komm schon«, drängte ihn Zur. »Sag etwas. Und zwar die Wahrheit.«
Marcus war äußerst gut darin, manche Dinge nicht ans Licht kommen zu lassen. Das war schon immer so gewesen. Aber es war unmöglich zu verheimlichen, warum er gerade nass bis auf die Knochen war und am Ufer eines Flusses im Nirgendwo stand.
Er warf einen kurzen Blick auf den Fluss und versuchte zu erkennen, wo das Auto genau untergegangen war. Auf der Wasseroberfläche waren nur kleine Wellen zu sehen. »Du siehst doch, was passiert ist, John.«
»Du bist einfach so vom Schreibtisch weg. Angesichts deiner Vergangenheit nicht gerade eine rationale Entscheidung.«
Marcus schüttelte den Kopf. Er hatte immer noch den Geschmack des Flusses im Mund. »Nur, weil ich mal etwas Unerwartetes mache, falle ich doch nicht gleich in alte Gewohnheiten zurück.«
Zur musterte ihn eingehend, sagte aber nichts.
»Ich musste einfach etwas tun, John. Ich musste versuchen, sie zu retten.«
»Dafür gibt es doch den Notruf. Du bist kein Sanitäter mehr.«
Marcus' Blick wanderte wieder über den Fluss. »Das weiß ich. Aber ihr ward überall unterwegs und irgendwer musste doch nach ihnen suchen. Es war schließlich nicht mehr viel Zeit.«
Über ihnen zersplitterte ein Blitz den Himmel und Donner krachte laut.
»Verdammt noch mal, Marcus, das war gegen die Vorschriften!«, rief Zur. »Du weißt ganz genau, wie gefährlich so eine Aktion ist. Wir hätten jetzt auch genauso gut vor vier Leichen stehen können!«
Marcus schaute ihn finster an. »Statt nur drei, oder was?«
»Du weißt doch, wie das funktioniert. Schließlich gibt es einen Grund, warum wir immer als Team arbeiten. Jeder von uns braucht Unterstützung. Selbst du.«
»Alle Rettungsteams waren woanders unterwegs. Mir blieb keine andere Wahl.«
Zur seufzte. »Wir kennen uns jetzt schon so lange. Ich weiß, dass du getan hast, was du für richtig hältst. Aber das hätte sie alle das Leben kosten können. Und dich wird es vermutlich deinen Job kosten. Warum riskierst du so viel für eine Wildfremde?«
»Sie war keine Fremde.«
Marcus wurde sich in den Moment, als er es sagte, bewusst darüber, wie wahr diese Behauptung war. Er wusste mehr über Rebecca Kingston als über alle anderen Frauen. Abgesehen von Jane.
»Du kennst sie?«, fragte Zur überrascht und runzelte die Stirn.
»Sie hat mir alles Mögliche erzählt und ich ihr auch. Von daher – ja, ich kenne sie.«
»Ich kapiere immer noch nicht, warum du nicht einfach in der Zentrale geblieben bist und uns das erledigen hast lassen.«
»Sie hat mich angerufen.« Marcus schaute seinem Freund in die Augen. »Mich. Nicht dich.«
»Das verstehe ich ja, aber das ist doch schließlich auch dein Job. Zuzuhören und die Informationen weiterzugeben.«
»Du verstehst überhaupt nichts. Rebecca war völlig außer sich. Sie hatte panische Angst um sich und um ihre Kinder. Niemand wusste genau, wo sie waren, und ihr blieb nicht mehr viel Zeit. Wenn ich es nicht zumindest versucht hätte – was für ein Mensch wäre ich dann, John?« Er biss die Zähne zusammen. »Damit hätte ich nicht leben können. Nicht noch einmal.«
Zur atmete langsam aus. »Manchmal kommen wir einfach zu spät. Das passiert.«
»Aber ich wollte nicht, dass es dieses Mal passiert.« Marcus dachte an die Vision, in der er Jane mitten auf der Straße hatte stehen sehen. »Ich hatte ein … Gefühl, das ich nah dran war. Und als Rebecca sagte, dass Colton gerade fliegende Schweine gesehen hatte, fiel mir dieser Platz wieder ein. Jane und ich haben hier früher von dem Besitzer Rippchen und Koteletts gekauft. Vor sieben Jahren haben sie dann aber dichtgemacht.«
»Und dadurch hast du also die Farm gefunden.« Zurs Stimme wurde sanfter. »Gut, dass dein Gefühl gestimmt hat. Dieses Mal. Aber nächstes Mal hast du vielleicht nicht so viel Glück.«
»Es wird kein nächstes Mal geben, John.«
In Zurs Mundwinkeln zuckte ein Grinsen. »Mhm.«
»Wird's nicht geben.«
Zur zuckte nur mit den Achseln und ging zum Rettungswagen.
Marcus stand unter dem wilden Himmel am Ufer des Flusses. Tränen strömten über sein Gesicht. Die Ereignisse der Nacht hatten ihn wie ein Schlag in den Magen getroffen. Eine Welle von Erinnerungen schwappte plötzlich über ihn. Der erste Anruf, Rebeccas panische Stimme, das Weinen von Colton im Hintergrund. Er kannte diese Art von Angst. Er hatte sie auch schon gespürt. Aber das letzte Mal war es auf einer anderen Straße mit einer anderen Frau und einem anderen Kind gewesen.
Er schüttelte den Kopf. Er durfte jetzt nicht an Jane denken oder an Ryan. Er durfte nicht darüber nachdenken, was er alles verloren hatte. Er musste sich auf das konzentrieren, was er gefunden hatte, und was er in der gesichtslosen Stimme entdeckt hatte, die ihn getröstet und ihm gesagt hatte, dass es in Ordnung war, loszulassen.
Er warf einen Blick auf die Armbanduhr. Es war bereits nach Mitternacht, 00:39 Uhr, um ganz genau zu sein. Er konnte fast nicht glauben, wie sehr sich sein Leben in kaum mehr als zwei Tagen verändert hatte.
»Marcus!«
Er drehte sich um …
Kapitel 1
Edson, Alberta – Donnerstag, 13. Juni 2013 – 10:15 Uhr
Marcus Taylor saß auf dem abgenutzten Teppich im Wohnzimmer vor dem offenen Kamin und strich sich mit einer 9-mm-Browning, einer Militärpistole, über das Bein. Das Magazin mit den dreizehn Patronen hielt er in der anderen Hand. Kurz überlegte er, die Waffe zu laden – und sie dann abzufeuern.
»Aber wer würde dich dann füttern?«, fragte er seine Gefährtin.
Arizona, eine fünf Jahre alte Irish Setter Hündin, sah ihn fragend an, dann rollte sie sich auf der Couch zusammen und schlief wieder ein. Er hatte sie ungefähr ein Jahr nach Ryans und Janes Tod aus dem Tierheim gerettet. Es war im Haus so verdammt still gewesen. So leblos.
»Toll zu wissen, dass du auch eine Meinung dazu hast.«
Marcus legte die Pistole und das Magazin auf den Boden, nahm ein Fotoalbum auf den Schoß und atmete tief ein.Das Fotoalbum vom Tod. Nur drei Mal pro Jahr kam das Album ans Licht. Die anderen dreihundertzweiundsechzig Tage lang lag es in dem kleinen Stahlspind versteckt, den er als Beistelltisch benutzte.
Heute war Pauls sechsundvierzigster Geburtstag. Oder besser gesagt, er wäre es gewesen – denn Paul war tot.
Wieder holte Marcus tief Luft. Er tastete nach dem Kettchen, das wie ein Lesezeichen eine bestimmte Seite markierte, und schlug dann das Album auf. »Hey, Bro.«
Auf dem Foto stand Corporal Paul Taylor neben einer verlassenen Straße am Rande einer nichtssagenden afghanischen Stadt. Er hielt ein Scharfschützengewehr vor der Brust und hatte die Browning in der anderen Hand. Bereits am selben Tag war er umgekommen. Eine Landmine neben der Straße hatte ihm die Glieder abgerissen. Die selbst gemachte Bombe hatte unter zwanzig Zentimeter Schotter und Dreck gelegen, bis Paul, der gerade durch ein weinendes Kind abgelenkt gewesen war, unwissentlich darauf getreten war.
Eine dumme Unachtsamkeit konnte dort schnell den Tod bringen und einen Sohn von seinen Eltern und einen Bruder von seinem Bruder trennen. Aber Geschwister konnten auch durch Groll gegeneinander getrennt sein.
»Wenn ich dir nur sagen könnte, wie leid es mir tut«, sagte Marcus. Er kämpfte mit den Tränen. »Wir haben so viel Zeit damit verschwendet, aufeinander sauer zu sein.«
Als er noch klein gewesen war, hatte er immer die Spielzeugsoldaten seines älteren Bruders versteckt, um damit spielen zu können, wenn Paul in der Schule war. In der Highschool hatte Marcus sich nicht anmerken lassen, wie clever er war. Um als der coole kleine Bruder der Hockeylegende Paul Taylor durchgehen zu können, hatte er seine Intelligenz stets versteckt. Auch seine Eifersucht hatte Marcus gelernt zu verstecken.
Bis sein Bruder umkam.
Er starrte auf die verbogene Erkennungsmarke am Ende des Kettchens. Das war alles, was noch von seinem Bruder übrig geblieben war. Jetzt gab es nichts mehr, auf das er eifersüchtig sein konnte.
Er warf abermals einen Blick auf die Pistole. Na gut, die hatte er auch. Ein Erbstück von Paul. Einer der Freunde seines Bruders aus der Armee hatte sie ihm persönlich gebracht. »Dein Bruder hat gesagt, dass du sein Spielzeug jetzt haben kannst«, hatte der Typ gesagt.
Paul hatte schon immer einen seltsamen Sinn für Humor gehabt.
Marcus wusste, dass seine Eltern heute auf ihrer Kreuzfahrt im Mittelmeer Paul zu Ehren miteinander anstoßen würden. Er tat es ihnen gleich. »Du fehlst mir, Bro.«
Dann ließ er die Marke los und blätterte zu den nächsten Fotos weiter. Eine Brünette mit kurzem, welligen Haar und leuchtend grünen Augen lächelte ihn an.
Jane!
»Hallo, kleine Fee.«
Er fuhr mit dem Finger über ihr Gesicht, erinnerte sich daran, wie ihr linker Mundwinkel immer leicht nach oben gezeigt und wie sie sentimentale Chickflicks geguckt hatte, bei denen sie gar nicht gemerkt hatte, wie ihr die Tränen über das Gesicht geronnen waren.
Marcus blätterte weiter und atmete scharf ein. Ein hübscher kleiner Bengel strahlte dort und winkte ihm zu.
»Hey, Kumpel.«
Er erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem sie dieses Foto geschossen hatten. Sein Sohn Ryan, der neue Torhüter seines Junior High Eishockeyteams, hatte keinen einzigen Schuss ins Tor gelassen und seinem Team dadurch einen 3:0 Vorsprung verschafft. Jane hatte das Bild in genau dem Moment gemacht, als Ryan seinen Vater unter den Zuschauern entdeckt hatte.
»Ich hab dich lieb.« Marcus' Stimme brach. »Und du fehlst mir so schrecklich.«
Das war etwas, das er nicht verstecken konnte. Niemals.
Und dann war da noch etwas, das er ebenfalls nicht verbergen konnte.
Er hatte Jane getötet. Und Ryan.
Seit sechs Jahren erschienen ihm seine tote Frau und sein Sohn im Schlaf, verhöhnten ihn durch ihre geisterhafte Erscheinung, quälten ihn mit vertrauten Sprüchen, verwirrten seine Gedanken und Sinne zu einem stinkenden Matsch aus Schuldgefühlen. Er konnte sich von ihren anschuldigenden Blicken und dem boshaften Grinsen nur befreien, indem er aufwachte. Oder gar nicht erst einschlief. Der Schlaf war mittlerweile sein Feind geworden. Deshalb tat er sein Möglichstes, um ihn zu vermeiden.
Marcus warf einen Blick auf die antike Uhr, die auf dem Kaminsims stand. 11:26 Uhr.
Noch vierundzwanzig Minuten, dann würde er sich auf den Weg ins Yellowhead County Emergency Centre machen müssen, wo er als Notrufdispatcher arbeitete. Seit fast sechs Monaten war er schon dort. Jetzt hatte er die Hälfte von fünf 12-Stunden-Schichten rum, die jeweils von mittags bis Mitternacht gingen. Er arbeitete mit seinem besten Freund Leo zusammen, der zweifelsohne wieder guter Laune sein würde. Leo schlief gern lange und es gefiel ihm, seinen Tag erst um die Mittagszeit herum zu beginnen, während Marcus die Mitternachtsschicht vorzog, die bis mittags ging – die Schicht, die alle anderen hassten. Ihm aber gab sie nachts etwas zu tun, denn das Einschlafen fiel ihm ebenfalls schwer.
Er klappte das Fotoalbum zu, stand langsam auf und streckte dann seine verkrampften Muskeln. Als er das Album, die Pistole und das Magazin wieder zurück in den Spind legte, fiel sein Blick auf eine kleine Schachtel aus Zedernholz, deren Deckel mit einem Arztabzeichen verziert war. Er bemühte sich, sie einfach zu ignorieren.
Selbst Arizona wusste, dass die Schachtel nichts Gutes verhieß. Die Hündin erstarrte sofort. Ihr Nackenfell sträubte sich.
»Ich weiß«, sagte Marcus. »Aber ich kann der Versuchung widerstehen.«
Die Schachtel hatte ihm mehr als nur einmal Ärger bereitet. Sie stand für seine Vergangenheit, die er nur zu gerne ungeschehen machen würde. Aber in den Müll werfen konnte er das Ding auch nicht. Es hielt ihn irgendwie in seinem Bann. Selbst jetzt ging ein Lockruf davon aus.
»Marcus …«
»Nein!«
Er schlug den Spind mit der Faust zu. Der Lärm hallte durch das Zimmer wie das Zuschlagen einer Gefängnistür: die seines eigenen Kerkers.
Hinter ihm winselte Arizona ängstlich.
»Sorry, Mädchen.«
Irgendwann würde er die Schachtel mit dem Deckelabzeichen wegwerfen und dieses Kapitel seines Lebens abschließen.
Aber noch nicht.
Er schüttelte den Anfall von Schuldgefühlen ab und rannte die Treppe ins obere Stockwerk hoch, dabei nahm er immer direkt zwei Stufen auf einmal. Im großen Schlafzimmer des gemieteten Zweifamilienhauses gab es nichts Weibliches mehr. Es war bis auf das Notwendigste ausgeräumt worden: ein Bett, ein Nachttisch und ein hoher Schrank. Die Jalousien waren aus Metall; keine geblümten Vorhänge wie die in dem Haus, das er und Jane in Edmonton gekauft hatten. Die Bettdecke war in einer Mischung aus Brauntönen gehalten und über das einsame Kopfkissen gezogen. Dekorative Kissen, wie Jane sie geliebt hatte, gab es hier nicht. Auf der Kommode stand kein Strauß Seidenblumen. In der Luft lag kein Hauch von Weichspüler mit Zitrusaroma. Nichts deutete noch auf Jane hin.
Auch sie hielt er sorgsam versteckt.
Marcus betrat das ans Schlafzimmer anschließende Bad und starrte in den Spiegel. Er betrachtete den wild wuchernden Bart, der langsam drohte, sein Gesicht zu verschlingen. Er lehnte sich nach vorne und musterte seine mehr grauen als blauen Augen. Dann wandte er sein Gesicht der Sonne zu. »Ich bin nicht müde.«
Die dunklen Ringe unter seinen Augen straften ihn allerdings Lügen.
Er ignorierte Arizonas wachen Blick, öffnete die Hausapotheke und nahm eine Tube Hämorridensalbe heraus – ein Trick, den er von seiner Frau Jane gelernt hatte. Bevor er sie getötet hatte. Nur ein kleiner Tupfer unter die Augen, nicht lächeln oder die Stirn runzeln, und in Sekundenschnelle hatten sich die Furchen in seinem Gesicht geglättet. Dann noch etwas von Janes »Tipp-Ex«, wie sie ihre Abdeckcreme genannt hatte, und schon waren die Augenringe komplett weg.
»Nun bin ich getarnt«, sagte er zu seinem Spiegelbild.
Eine Erinnerung an Jane stieg nun plötzlich in ihm hoch.
Es war der Abend vor neunzehn Jahren, beim Bankett der BioWare Preisverleihungen. Jane saß in einem rosa Morgenmantel mit dem Lockenstab vor der Spiegelkommode im Badezimmer, während Marcus mit seiner Krawatte kämpfte.
Er fluchte. »Nie kriege ich diesen Knoten hin.«
»Lass mich mal versuchen.« Bevor er protestieren konnte, hatte Jane einen Stuhl hinter ihn geschoben und war darauf geklettert. Sie fing seinen Blick im Spiegel über dem Waschbecken ein und griff dann über seine Schultern. Ihre Augen wanderten zu dem verdrehten Klumpen, der eigentlich ein Windsorknoten hatte werden sollen. »Du musst nicht immer gleich so ungeduldig sein.«
»Und du solltest nicht auf Stühlen herumklettern.«
»Ist doch nichts dabei, Marcus.«
»Du bist schwanger, das ist dabei.«
»Aha. Du findest du mich wohl fett, was?«
Jane hatte noch nie so schön ausgesehen wie jetzt, wo sie im fünften Monat mit Ryan schwanger war.
»Ich würde dich nie fett finden«, gab er zurück.
Sie legte den Kopf schief und zog eine Augenbraue hoch. »Nie? Und wie wirst du das in vier Monaten sehen, wenn ich die Treppe zum Schlafzimmer nicht mehr hochkomme?«
»Dann trage ich dich eben.«
»Und was, wenn ich meine Füße nicht mehr sehen kann und mir nicht mehr die Zehennägel lackieren kann?«
»Dann mach ich das für dich.«
»Und was, wenn …«
Er drehte den Kopf und küsste sie. Da gab sie endlich Ruhe.
Lachend schubste sie ihn weg, zog kurz an der Krawatte und schob dann den Knoten gekonnt an die richtige Stelle.
Er stöhnte. »Warum kann ich das nur nicht?«
»Weil du mich dafür hast. Und jetzt hör auf, mich abzulenken. Ich muss noch mein Kleid anziehen und mich schminken.«
Marcus saß auf der Bettkante und wartete. Jane schaffte es immer, dass sich das Warten lohnte, und auch an diesem Abend enttäuschte sie ihn nicht. Als sie aus dem Badezimmer kam, wirkte sie in ihrem Designerkleid aus der West Edmonton Mall wie eine Erotikgöttin. Der kleine Babybauch war kaum zu sehen.
»Wie sehe ich aus?«, fragte sie und befühlte nervös die neuen goldblonden Haarsträhnchen.
»Wahnsinnig sexy.«
Langsam drehte sie sich im Kreis, um das elegante schwarze Kleid mit dem tiefen Rückenausschnitt richtig zur Geltung kommen zu lassen. Sie warf einen Blick über ihre mit Glitter gepuderte Schulter. »Also gefällt dir mein neues Kleid?«
»Mir würde es noch besser gefallen, wenn es sich auf dem Boden befinden würde«, sagte er leise.
Minuten später lagen sie außer Atem und lachend wie Teenager auf den zerknitterten Bettlaken. Sex mit Jane war immer so aufregend, jung und vor allem spaßig.
Nachdem sie sich wieder angezogen hatte, ging Jane ins Badezimmer zurück, um ihre Frisur und ihr Make-up zu richten. »Ich bin jetzt getarnt«, sagte sie, als sie wieder raus kam. »Lass uns gehen.«
»Yes, Ma'am.«
Er hörte sie wispern: »Sechs plus acht plus zwei …«
»Machst du schon wieder dieses Zahlenlehrezeugs?«, fragte er sie grinsend.
Als Jane gemerkt hatte, dass sie schwanger war, war sie zu einem Esoterikkongress gegangen, wo ihr ein Numerologist etwas über das Addieren von Daten beigebracht hatte. Seitdem rechnete sie die Zahlen immer wieder durch, wenn ein wichtiger Termin anstand, um herauszufinden, ob es ein guter Tag sein würde oder nicht. Sie hatte Marcus sogar dazu gebracht, Lottozettel an Tagen mit einer Drei im Datum zu kaufen, denn das bedeutete laut ihr, dass sich Geld anbahnte. Bisher hatten sie jedoch noch nichts gewonnen, aber er machte es ihr zuliebe trotzdem.
»Was ist heute?«
Sie lächelte. »Eine Sieben.«
»Aha, die glücksbringende Sieben.« Er sah sie mit hochgezogener Augenbraue an. »Das heißt wohl, dass ich Glück haben werde?«
»Hattest du doch wohl gerade schon, Mister.«
Sie waren zu spät beim Preisverleihungsbankett erschienen, womit sie sich nicht gerade beliebt gemacht hatten. Jane war als Ehrengast geladen gewesen, da sie für ihr neuestes Videospiel für BioWare den Preis als ›beste Programmiererin‹ erhalten hatte. Als Jane auf die Bühne trat, um ihren Preis entgegenzunehmen, hätte Marcus sich nicht vorstellen können, jemals stolzer auf sie zu sein. Bis die Nacht kam, in der Ryan geboren wurde.
Ryan … mein Sohn, den ich getötet habe!
Marcus schüttelte den Kopf und zwang die Erinnerungen zurück in die Dunkelheit, wo sie hingehörten. Er nahm eine Dose Rasierschaum in die Hand und starrte auf das Etikett, ohne es wirklich zu sehen.
Rasieren oder nicht rasieren? Das war hier die Frage.
»Ach was, heute nicht«, brummte er.
Seit Wochen hatte er sich schon nicht mehr rasiert. Ein Haarschnitt war auch längst überfällig. Zum Glück waren sie auf seiner Arbeitsstelle nicht allzu streng, was die äußere Erscheinung anging. Aber sein Vorgesetzter würde vermutlich trotzdem einen Kommentar dazu abgeben.
Der Weckton an seiner Armbanduhr piepste nun.
Ihm blieben also noch zwanzig Minuten, um die Notrufzentrale zu erreichen. Dann konnte er sich wieder hinter der Anonymität verstecken, nur eine gesichtslose Stimme am Telefon zu sein.
***
Yellowhead County Emergency Services in Edson, Alberta, beherbergte im zweiten Stock des geräumigen Gebäudes in der 1st Avenue eine kleine, aber kompetente Notrufzentrale. Im gleichen Stockwerk befanden sich auch vier Räume, die als Lehrzimmer für Erstehilfe, Wiederbelebungs- und Sanitäterkurse vermietet wurden. Die Notrufzentrale hatte eine Vollzeitbesetzung von vier Telefonvermittlern mit zwei Vorgesetzten – eine Tagschicht und eine Nachtschicht. Außerdem gab es eine Handvoll gutausgebildeter, aber schlecht bezahlter Zusatzkräfte und drei regelmäßige ehrenamtliche Helfer.
Als Marcus das Gebäude betrat, erwartete ihn Leonardo Lombardo bereits am Fahrstuhl. Doch Leo wirkte alles andere als glücklich, ihn zu sehen.
»Du siehst aus, als wäre gerade dein Hund gestorben«, meinte Marcus.
»Ich habe doch gar keinen.«
»Wie wär's dann mit einer warmen, fröhlichen Begrüßung? Oder hat die Mafia dich angeheuert, mich aus dem Weg zu räumen?«
Leo, ein durchschnittlich großer Mann Ende vierzig, trug am Bauch um die dreißig Pfund zu viel mit sich herum. Sein dunkles italienisches Aussehen ließ ihn auf Fremde geheimnisvoll und gefährlich wirken. Im Ort tratschte man, dass Leo ein Amerikaner mit Verbindungen zur Mafia war. Aber Marcus wusste ganz genau, wer die Gerüchte in Umlauf gebracht hatte. Leo hatte einen wirklich kranken Sinn für Humor.
Doch jetzt grinste sein Freund nicht.
»Du musst wirklich mal sehen, dass du Schlaf nachholst.«
Marcus zuckte die Achseln und bestieg den Fahrstuhl. »Schlaf wird total überbewertet.«
»Du siehst scheiße aus.«
»Danke.«
»Bitte.« Leo drückte den Knopf fürs zweite Stockwerk und holte dann zögernd Luft. »Pass auf, Mann …«
Marcus wusste, dass es nichts Gutes verhieß, wenn Leo einen Satz mit diesen drei Worten anfing.
»Du bist nicht mehr bei der Sache«, sagte Leo. »Du fängst an, Fehler zu machen.«
»Was soll das denn heißen? Ich mache doch meine Arbeit.«
»Du hast eine Massenkarambolage von gestern Abend falsch abgeheftet. Shipley hat den halben Morgen lang danach gesucht. Ich hab versucht, dir Rückendeckung zu geben, aber er ist trotzdem ziemlich sauer.«
»Shipley ist immer sauer.«
Pete Shipley machte ein wahres Ritual daraus, Marcus das Leben schwer zu machen, wann immer es möglich war – und es war anscheinend oft möglich. Shipley, der Boss der Tagschicht, regierte die Notrufdispatcher mit eiserner Hand und so viel Arroganz, dass er damit allen auf die Nerven ging.
Die Fahrstuhltür öffnete sich. Marcus stieg als Erster aus.
»Ich finde den Report schon wieder, Leo.«
»Wie viel Schlaf hast du heute gehabt, Marcus?«
»Vier Stunden.« Das war gelogen, und beide wussten es.
Marcus machte sich auf den Weg zu seinem Schreibtisch, der durch einen Raumteiler von Leos getrennt war. Hinter ihnen saßen die anderen Vollzeitangestellten. Er winkte Parminder und Wyatt zu, als sie sich auf den Weg nach Hause machten. Da sie die Nachtschicht machten, traf er sie immer nur beim Kommen und Gehen. Jetzt wurden ihre Schreibtische zur Unterstützung von freien Mitarbeitern bemannt.
»Sieh zu, dass du in Zukunft mehr schlafen kannst«, brummte Leo.
»Mit dem Schlafen ist es komisch, Leo. Nicht lachhaft komisch, sondern seltsam komisch. Wenn man erst mal einige Zeit lang ohne Schlaf oder nur mit einem kurzen Nickerchen auskommt, ist er einem auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Mir geht's gut. Ehrlich.«
»Was für ein Schwachsinn.«
Im Flur wurde nun eine Tür zugeknallt und schnitt ihnen damit das Wort ab.
Pete Shipley erschien und füllte den Flur mit Wut und seiner massiven Statur vollkommen aus. Er ragte über alle in die Höhe, auch über Marcus, der mehr als einen Meter achtzig groß war. Shipley, der früher in der Armee als Captain gedient hatte, war wie die Titanic gebaut – und das war auch sein Spitzname unter den Angestellten. Wovon er allerdings nichts wusste.
»Taylor!«, brüllte Shipley. »In mein Büro!«
Leo packte Marcus am Arm. »Sag ihm, du hättest sechs Stunden geschlafen.«
»Du willst, dass ich den Boss anlüge?«
»Sichere dich einfach ab. Und stachele ihn um Gottes willen nicht auf.«
Marcus grinste. »Warum sollte ich das auch tun?«
Leo starrte ihn an. »Weil dir Chaos gefällt.«
»Selbst im Chaos gibt es Ordnung.«
Leo schnaubte. »Du liest eindeutig zu viele Selbsthilfebücher. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.« Er machte auf dem Absatz kehrt und ging an seinen Schreibtisch.
Marcus schaute ihm hinterher. Mach dir keine Sorgen, Leo. Mit Pete Shipley komme ich schon klar.
Vor Shipleys Tür hielt er kurz inne, holte tief Luft, klopfte an und trat dann ein. Sein Vorgesetzter saß hinter einem Schreibtisch aus Metall. Die dicken Brillengläser thronten auf der Spitze seiner Knollennase. Er musterte gerade einen Berg Formulare. Obwohl Shipley Marcus in sein Büro beordert hatte, reagierte er nun in keiner Weise auf dessen Anwesenheit.
Marcus hatte nichts dagegen. So konnte er sich ausgiebig in dem vollgestopften, fensterlosen Büro umsehen und den recycelten Mief, der Luft sein sollte, einatmen. Es war kein Büro, um das man Shipley beneidete. Niemand wollte es – und auch nicht seine Position und die damit verbundene Verantwortung. Selbst Shipley wollte sie nicht. Es wurde gemunkelt, dass er versuchte, in eins der Eckbüros mit bis auf den Boden reichenden Fenstern umzuziehen und eine Stelle als Notrufkoordinator zu ergattern. Marcus hatte allerdings seine Zweifel, dass das je geschehen würde. Shipley war schließlich nicht gerade das, was man sich unter einem Manager vorstellte.
Marcus stand hinter dem pseudoledernen Stuhl ohne Armlehnen, den Shipley für die wenigen Glücklichen bereithielt, denen er erlaubte, in seiner Gegenwart zu sitzen, und legte die Hände auf die Rückenlehne. Zu den wenigen Glücklichen gehörte Marcus offensichtlich nicht.
Er bereitete sich innerlich auf eine ernste Rüge vor und dachte an die letzte Nachtschicht. Ein betrunkener Autofahrer hatte an einer viel befahrenen Kreuzung in Hinton einen anderen Wagen seitlich gerammt und so einen Auffahrunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen verursacht. Einer der Wagen, ein Minivan mit einem älteren Pärchen und zwei kleinen Jungs, war durch die Wucht des Aufpralls zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt gewesen. Der Unfall hatte zu zahllosen panikerfüllten Anrufen in der Notrufzentrale geführt. Die Emergency Medical Services (EMS), inklusive Feuerwehr und Ambulanz, waren innerhalb von sechs Minuten an der Unfallstelle erschienen. Mit dem Rettungsspreizer war das zerdrückte Metall von zwei der Autos auseinandergebogen worden. Aber nur drei der Insassen konnten lebendig geborgen werden, und einer starb bei der Ankunft im Krankenhaus. Dann entdeckten die Rettungssanitäter noch eine Limousine mit drei Teenagern. Alle waren tot.
Die werden noch wochenlang Albträume haben.
Marcus wusste, was für ein Gefühl das war. Früher war er ebenfalls Einsätze gefahren. Früher, in einem anderen Leben.
Er drückte das Kreuz durch. Er war bereit, sich Shipleys Wut zu stellen. Zumindest geschah es dieses Mal hinter geschlossenen Türen. Und wenn er ganz ehrlich war, er hatte ja auch wirklich etwas verbockt. Den Unfallreport falsch abzulegen war nur einer von einer ganzen Reihe dummer Fehler gewesen, die er in der letzten Woche gemacht hatte. Die meisten davon waren ihm aber zum Glück selbst aufgefallen, und er hatte sie behoben.
»Bevor Sie etwas sagen«, begann Marcus, »ich weiß, dass ich …«
»Was denn?«, fuhr Shipley ihn an. »Sie wissen also, dass Sie ein Idiot sind?«
»Nö. Das ist mir neu.«
Langsam erhob sich Pete Shipley mit seinen gesamten zweihundertachtzig Pfund zu seiner Länge von zwei Meter und zehn. Er stemmte seine fleischigen Fäuste auf die Tischplatte und beugte sich vor. »Ich habe drei Stunden lang nach dem Unfallbericht gesucht, Taylor. Drei Stunden! Und wissen Sie, wo ich ihn gefunden habe?« Eine Nanosekunde lang war er still. »Unter den Anrufberichten von vermissten Personen. Was haben Sie dazu zu sagen?«
»Ich finde, es hat doch eine gewisse Ironie, dass ich einen verschwundenen Bericht unter verschwundenen Menschen abgelegt habe.«
»Reden Sie doch keinen Unsinn!« Shipley starrte ihn finster an. Seine Augenbrauen zogen sich zu einer einzigen langen Linie zusammen. »Lombardo hat gesagt, dass Sie jetzt wieder besser schlafen, aber das nehme ich ihm nicht ab. Was sagen Sie dazu?«
»Leo hat recht. Letzte Nacht hab ich wie ein Baby geschlafen.«
Shipley zog erneut eine Augenbraue hoch. »Für ein Baby sehen Sie aber ziemlich scheiße aus. Sie müssen sich mal wieder die Haare schneiden lassen und sich rasieren.« Er rümpfte die Nase. »Haben Sie diese Woche überhaupt schon mal geduscht?«
»Ich dusche jeden Tag. Nicht, dass Sie das was angehen würde. Was meine Haarlänge und den Bart angeht, grenzt das sogar schon an Diskriminierung.«
»Ich diskriminiere Sie nicht. Ich mag Sie ganz einfach nicht. Sie sind ein gottverdammter Junkie, Taylor.«
Alle in der Zentrale wussten über Marcus' Vergangenheit Bescheid.
»Nett, dass Sie das so offen klargestellt haben, Peter.«
Shipley zuckte zusammen. »Nur noch ein weiterer Fehler - wir beobachten Sie. Wenn Sie sich noch einmal so etwas leisten, sind Sie gefeuert!« Seine Schultern entspannten sich nun und er sank wieder in seinen Chefsessel. »Wenn es nach mir ginge, hätte ich Sie schon vor Monaten gefeuert.«
»Schön, dass es nicht nach Ihnen geht.«
Marcus wusste, dass er den Mann immer mehr reizte, aber das passierte sowieso leicht. Shipley war ein Idiot. Ein Schleimer, der laut Leo seinen Arsch nicht von seinem Schwanz unterscheiden konnte.
»Das war jetzt Ihre letzte Verwarnung«, presste Shipley zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Wir sind hier für Leben und Tod verantwortlich. Fehler können wir uns einfach nicht leisten.«
»Es war doch nur ein falsch abgelegter Bericht. Der Notruf war korrekt und ist schnell weitergeleitet worden.«
»Ja, immerhin haben Sie den Krankenwagen nicht in die falsche Richtung geschickt.« Ein selbstzufriedenes Lächeln breitete sich auf Shipleys Gesicht aus. »Das war's, was Ihrem arroganten Getue als Rettungssanitäter ein Ende gesetzt hat. Weshalb EMS Sie gefeuert hat.«
Marcus fielen dazu unzählige Antworten ein, jedoch keine höfliche. »Ich denke, wir sind mit unserer kleinen Konferenz hier fertig.«
»Ich bin noch lange nicht fertig«, brüllte Shipley.
»Bist du doch, Pete.«
Und damit verließ Marcus das Büro. Er ließ Shipleys Tür halb offen, da er wusste, dass sich sein Vorgesetzter darüber noch mehr, als über seine Aufsässigkeit ärgern würde.
Er versuchte, Shipleys Worte zu verdrängen, aber der Mann hatte ihn damit getroffen. Vor sechs Jahren war Marcus in aller Öffentlichkeit bloß gestellt worden, als die Wahrheit über seine Sucht bekannt geworden war. Seine Zukunft als Rettungssanitäter hatte in dem Moment geendet, als er mit der Ambulanz in den falschen Stadtteil gefahren war, weil er zu high gewesen war, um sich zu merken, wohin er eigentlich unterwegs war.
Damals hatte er sich für eine Weile zurückgezogen. Von der Arbeit … von Jane … von allem. Er war nach Cadomin gefahren, um den Kopf wieder klar zubekommen und um etwas angeln zu gehen. Zumindest hatte er das Jane erzählt. Dabei hatte er seine Drogen heimlich in das Holzkästchen gepackt. Sechs Tage später, als sich sein von Morphium benebeltes Hirn mit den Gestalten von geisterhaften Kindern füllte, klingelte plötzlich sein Handy. Mit bedrückter Stimme hatte Detective John Zur ihm erzählt, dass Jane und Ryan in einen Autounfall verwickelt worden waren, gar nicht weit entfernt von der Stelle, wo sich Marcus vergraben hatte.
Das war der Anfang vom Ende für Marcus gewesen.
Seitdem arbeitete er als alles Mögliche, um über die Runden zu kommen. Es war nicht so, dass er den Karrieresprung vom Superstar-Rettungssanitäter zum unsichtbaren Notrufdispatcher nicht verkraften konnte. Das war nicht das Problem, sondern Shipley war es. Der hatte es schon auf ihn abgesehen, seit Leo Marcus angeschleppt hatte, um einen Posten zu besetzen, der nach dem Nervenzusammenbruch eines Mitarbeiters frei geworden war.
»Und, was hat die Titanic zu sagen gehabt?«, fragte Leo, als Marcus um die Trennwand herumging.
»Er will nicht mit dem Schiff untergehen.«
»Er hält dich also für den Eisberg?«
Marcus nickte kurz.
»Ich hab dich abgesichert.« Leo hatte Beziehungen auf der Arbeit. Er kannte den Leiter der Zentrale, Nate Downey, äußerst gut, denn er war mit Nates Tochter Valerie verheiratet.
»Ich weiß, Leo.«
Marcus atmete tief ein, setzte sich hinter seinen Schreibtisch und nahm dann die Kopfhörer. Anschließend atmete er langsam wieder aus. Die kleinen Spielchen zwischen ihm und Shipley fanden inzwischen viel zu häufig statt. Sie brachten ihn durcheinander und erschöpften ihn.
Weil Shipley es mich niemals vergessen lässt.
Die Uhr auf dem Computerbildschirm zeigte erst 12:20 Uhr an. Es würde ein sehr langer Tag werden.
In dem schläfrigen Örtchen Edson gab es allerdings zum Glück nur selten viel Aufregung. Die Zentrale war außerdem noch für umliegende Orte zuständig. An manchen Tagen klingelten die Telefone nur ein halbes dutzend Mal. Das waren die guten Tage.
Er blätterte durch die Aktenmappen auf seinem Tisch und fand dort die Liste mit den Arbeitsanweisungen. Es konnte nicht schaden, zu Anfang der Schicht noch mal drüber zu lesen. So blieb er wachsam und konzentriert.
Doch seine Gedanken wanderten abermals zu dem falsch abgelegten Bericht.
Versagte er langsam aber sicher? Gefährdete er die Leben anderer Menschen mit seinem Handeln? Er hatte sich selbst und Leo versprochen, dass er das nie wieder tun würde.
Denk an Jane und Ryan.
Was sonst? Sie hatten ihm schließlich alles bedeutet.
Das Telefon klingelte und er zuckte erschrocken zusammen.
»911. Brauchen Sie die Feuerwehr, die Polizei oder einen Rettungswagen?«
Die nächsten zehn Minuten verbrachte Marcus damit, der 89-jährigen Mrs. Mortimer, die häufiger anrief, zu erklären, dass niemand Zeit hatte, ihre Katze aus dem Baum des Nachbarn zu retten.
Dann wartete er weiter auf einen echten Notfall.
Kapitel 2
Edmonton, Alberta – Donnerstag, 13. Juni 2013 – 16:37 Uhr
Rebecca Kingston verschränkte die Arme über ihrer Daunenjacke und kämpfte gegen das Zittern an. Obwohl der Mai mit einer Hitzewelle zu Ende gegangen war, hatte die erste Juniwoche niedrige Temperaturen gebracht. Die ersten fünf Tage lang hatte es geregnet und eine arktische Kaltfront war über die Stadt hereingebrochen. Der Fernsehmeteorologe hatte der globalen Klimaerwärmung und der kalten Luft aus Alaska die Schuld für das launenhafte Wetter gegeben. Die Einheimischen fanden, dass wie so vieles auch die Witterung allein die Schuld ihres Erzrivalen Calgary sein musste.
»Können wir ein Eis haben, Mommy?«, fragte die vierjährige Ella und bewegte beim Reden kaum die Lippen – das Resultat ihres letzten Obolus an die Zahnfee.
Rebecca lachte. »Man kommt sich wie im Winter vor, und du willst ein Eis?«
»Ja, bitte.«
»Na, Zeit haben wir ja.«
Sie liefen über die Straße zum Eckladen.
»Dieses Mal bitte Erdbeere«, sagte Ella. Ihre blauen Augen schauten bittend.
Rebecca seufzte. »Aber schön langsam essen. Hast du an deinen Inhalator gedacht?«
Ihre Tochter nickte. »Ist in meiner Tasche.«
»Prima.« Rebecca warf einen Blick auf die Uhr. »Es ist kurz vor fünf. Lass uns gehen.«
Ihr Handy klingelte. Es war Carter Billingsley, ihr Anwalt.
»Mr. Billingsley«, sagte sie. »Ich bin froh, dass Sie meine Nachricht bekommen haben.«
»Sie haben also beschlossen, wegzufahren«, sagte er. »Das ist eine sehr gute Idee.«
»Ich brauche etwas Erholung.« Sie warf einen Blick auf Ella. »Es wird bald ziemlich übel hergehen, oder?«
»Leider ja. Scheidungen sind nie etwas Angenehmes, aber Sie schaffen das schon.«
»Danke, Mr. Billingsley.«
»Passen Sie auf sich auf, Rebecca.«
Carter war früher der Anwalt ihres Großvaters gewesen und Grandpa Bob hatte ihn Rebecca wärmstens für den Fall empfohlen, wenn sie mal jemanden brauchen sollte, um sich um ihre Scheidung zu kümmern. Carter war Ende sechzig und füllte die leere Stelle einer Vaterfigur aus, die der Tod ihres Vaters bei ihr hinterlassen hatte.
Sie dachte an ihren zwölfjährigen Sohn. Coltons Mannschaft hatte ein Spiel gegen eins der besten Junior High Eishockeyteams aus Regina vor sich. Als Torhüter für Edmonton war Colton dem meisten Druck ausgesetzt. Aber er war ein tapferer Junge.
Sie biss sich auf die Unterlippe und wünschte sich, auch so tapfer sein zu können.
Du bist ein Feigling, Rebecca.
»Du machst dich von anderen Menschen immer viel zu abhängig«, hatte ihre Mutter stets gesagt.
Rebecca fand, dass das im Grunde gar nicht ihre Schuld war. Sie hatte das Glück gehabt, starke männliche Vorbilder in ihrem Leben zu besitzen. Männer, die Firmen mit eiserner Hand leiteten und über alle Entscheidungen genau nachdachten. Oder, die zumindest hart arbeiteten, um für ihre Familien sorgen zu können. Männer wie Grandpa Bob und ihr Vater. Männer, denen man vertrauen konnte, dass sie die richtigen Entscheidungen trafen.
Nicht wie Wesley.
Selbst ihr Großvater hatte ihn nicht gemocht. Als Grandpa Bob vor zwei Jahren gestorben war, hatte er vorher alle wissen lassen, dass Wesley nicht zu trauen war. Grandpa Bob hatte das typische Leben eines Geizkragens geführt. Niemand wusste, wie viel Geld er für »schlechte Zeiten« gespart hatte – bis er starb und Colton und Ella über $800.000 vom Verkauf seines Hauses und seiner Firma erbten.
In seiner großen Weisheit hatte Grandpa Bob das Erbe an zwei wichtige Konditionen geknüpft. Geld vom Konto durfte nur für Ella oder Colton abgehoben werden, und Rebecca war die einzige Person, die Zugang zu dem Konto hatte.
Als Wesley von den Konditionen gehört hatte, war er tagelang mit einer Leichenbittermiene durch das Haus gelaufen. Jedes Mal, wenn sie den Kindern neue Anziehsachen gekauft hatte, hatte er das Gesicht verzogen und gesagt: »Hoffentlich hast du die mit dem Geld von deinem Grandpa bezahlt.«
Einmal, als er mal wieder das meiste seines Monatsgehalts verspielt hatte, hatte er sie um einen »Kredit« angebettelt, und als sie ihm gesagt hatte, dass sie so viel Geld nicht habe, hatte er sie geschlagen. »Verlogene Nutte! Du sitzt auf einer knappen Million. Ich brauche doch nur dreitausendfünfhundert Dollar. Ich zahle es dir ja auch zurück.«
Sie hatte sich geweigert und dafür mit blauen Flecken bezahlt.
Rebecca wollte, dass er für immer aus ihrem Leben verschwand, aber um der Kinder willen musste sie einen Weg finden, Wesley zu vergeben und sich mit der Tatsache abfinden, dass er der Vater ihrer Kinder war. Er würde zwangsläufig immer ein Teil ihres Lebens sein.
Jedes Mal, wenn sie Colton anschaute, wurde sie an Wesley erinnert. Im Gegensatz zu Ellas blondem Haar und den blauen Augen, die ihren glichen, hatten Vater und Sohn dunkelbraune Haare, hellbraune Augen, eine mit Sommersprossen gesprenkelte Nase und das gleiche Grübchen am Kinn.
Sie hatte Wesley bei einer Weihnachtsfeier ihrer Firma kennengelernt; gar nicht lange, nachdem sie im Kundendienst von Alberta Cable angefangen hatte. Wesley, dessen Eltern aus gehobenen Verhältnissen stammten, hatte sich von seiner Familie unabhängig gemacht, indem er nicht wie erwartet der elterlichen Anwaltskanzlei beigetreten war. Stattdessen hatte er begonnen, bei Alberta Cable als Kabelverleger zu arbeiten. Auf der Party hatte er an Rebeccas Tisch gesessen. Als Wesley herausgefunden hatte, dass sie Single war, hatte er seinen Charme voll aufgedreht und darin war er wirklich gut.
Am nächsten Morgen hatte sie Wesley in ihrem Bett gefunden.
Sie waren schon fast vier Jahre lang zusammen, als er ihr endlich einen Heiratsantrag gemacht hatte – per SMS! Sie war gerade auf der Arbeit, als ihr Handy auf dem Schreibtisch zu vibrieren begann. Als sie einen Blick darauf warf, sah sie nur sechs Wörter.
»Rebecca Kingston, willst du mich heiraten?«
Erschreckt hatte sie aufgeschrien. »Wesley hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht!«
Das gesamte Büro war zu einem einzigen Chaos aus rauschendem Applaus und Glückwünschen geworden. Der Rest von Rebeccas Arbeitstag war danach in einem Gewirr von Gefühlen verflogen.
»Kommt Daddy auch zu dem Spiel?«, fragte Ella und unterbrach damit ihre Erinnerungen.
»Nein, Honey. Er muss arbeiten.«
Zumindest hoffte Rebecca das.
Vor sechs Monaten hatte Wesley Alberta Cable verlassen. Man hatte ihn gefeuert und ihn sogar aus dem Gebäude eskortiert, nachdem er eine Kundin in ihrem eigenen Haus angeschrien und sie gegen die Wand geschubst hatte. Es war vor allem nicht die erste Beschwerde gewesen, die gegen ihn eingegangen war. Seitdem hatte er immer wieder verschiedene Jobs angenommen, doch niemand wollte einen Angestellten, der seinen Jähzorn nicht unter Kontrolle hatte.
Auf Rebeccas Frage, was passiert war, hatte er etwas von einem Unfall gemurmelt und behauptet, dass ihn keinerlei Schuld traf. »Egal, was dieses Arschloch von einem Vorgesetzten dazu sagt«, hatte er gemeint.
Ungläubig hatte sie ihn angeschaut. Dafür hatte sie bezahlen müssen. Das blaue Auge, das er ihr verpasst hatte, hatte sie fast eine Woche lang im Haus festgehalten. Danach hatte sie die Scheidung eingereicht.
Seit er von der Firma weg war, hatte Wesley einen Gelegenheitsjob nach dem anderen angenommen. In den letzten zwei Monaten hatte er fast gar nicht mehr gearbeitet. Sie hoffte nur, dass er nicht gerade in seiner Wohnung saß und sich die Zeit mit Internetpornos vertrieb.
Als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, hatte Wesley seine Arbeitslosigkeit auf die Rezession geschoben, die auch tatsächlich viele Menschen in Schwierigkeiten gestürzt und einige etablierte Firmen ins Aus getrieben hatte. Aber die Wirtschaftskrise war nicht Wesleys wahres Problem. Sein Problem war sein Mangel an Motivation und die Unfähigkeit, seine blinde Eifersucht und Wut unter Kontrolle zu halten.
Vielleicht steckte Wesley ja auch in der Midlife-Crisis.
Und sie selbst vielleicht auch.
Denn es wurde immer schwieriger, nicht die Geduld mit ihm zu verlieren. Aber sie tat es für die Kinder. Außerdem hatte sie im Zusammenleben mit Wesley schon weitaus schlimmere Zeiten der Ungewissheit durchgemacht – viel schlimmere.
Rebecca sah ihre Tochter aufmerksam an. Ella war ein zierliches Kind, das zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen war. Dafür hatte Wesley gesorgt.
Sie schüttelte den Kopf.Nein. Was damals passiert ist, war nicht nur seine Schuld, sondern auch meine. Ich bin bei ihm geblieben, obwohl ich ihn hätte, verlassen müssen.
»Schnell, Mommy!«, sagte Ella und zog sie an der Hand.
Die Eishockeyarena lag nur fünf Minuten zu Fuß vom Parkplatz ihres Hyundai Accent entfernt, aber da sie noch für das Eis haltgemacht hatten, war Rebecca froh, dass sie rechtzeitig losgefahren waren.
»Glaubst du, dass Coltons Team heute gewinnt, Ella?«
Ihre Tochter verdrehte die Augen. »Na logo. Colton ist schließlich der Größte!«
»Der Größte«, stimmte Rebecca zu. Sie konnte nun die Tamarack Hockey Arena sehen, vor deren Eingangstüren sich schon viele Eishockeyfans drängten.
Rebecca nahm Ella an die Hand und zog sie näher zu sich heran.
Die Eishockeyfans von Edmonton waren schon fast Fanatiker. Es wäre nicht das erste Mal, wenn sich die Väter der gegnerischen Teams eine Schlägerei liefern würden. Im vorigen Jahr war sogar ein Kleinkind in einer Eishockeyarena im nördlichen Edmonton niedergetrampelt worden. Zum Glück hatte es überlebt.
»Bleib hier bei mir, Ella.«
»Hast du Colton schon gesehen?«
»Noch nicht.«
»Becca!«
Sie drehte sich in Richtung der Stimme um und ließ ihren Blick über die Zuschauerränge schweifen. Dann entdeckte sie Wesley nahe der Seite des heimischen Teams. Er hätte gar nicht hier sein sollen. Das Abkommen ihrer Trennung legte fest, dass er die Kinder nur zu festgelegten Besuchszeiten sehen durfte. Wenn die Scheidung endlich durch war, würden diese Besuche auch nur noch im Beisein eines Sozialarbeiters stattfinden – sofern Carter Billingsley, ihr Anwalt, sich durchsetzen könnte. Davon hatte sie Wesley wohlweislich noch nichts erzählt.
»Ich hab euch Plätze freigehalten«, rief Wesley. Sein Blick legte ihr nahe, keine große Szene daraus zu machen – denn sonst …
Rebecca seufzte verhalten. Fantastisch. Ganz toll.
»Setzen wir uns zu Daddy?«, fragte Ella.
»Ja, Honey. Oder willst du lieber woanders sitzen?« Irgendwo, überall, flehte sie innerlich.
Trotz Rebeccas unausgesprochener Bitte drückte sich Ella an den Knien vorbei, die in den Gang hineinragten, und lief auf Wesley zu. Rebecca setzte sich neben sie und wehrte sich gegen die Schuldgefühle, weil sie ihre Tochter zwischen sich und ihrem Mann platzierte.
»Hier neben mir ist auch noch einer frei«, sagte Wesley.
Sie schaute auf den leeren Platz neben ihm und verzog das Gesicht. »Ist schon okay. Danke, dass du uns was freigehalten hast.«
Wesley lächelte. Er sah immer noch so gut aus wie an dem Tag, an dem sie ihn geheiratet hatte. »Du siehst hübsch aus. Eine neue Frisur?«, fragte er.
Sie berührte ihre schulterlangen Haare. »Die Spitzen mussten geschnitten werden.«
»Sieht gut aus. Aber das tust du ja immer.«
Sie starrte ihn an. Er trug die Komplimente etwas zu stark auf. Meist bedeutete das, dass er etwas wollte.
Wesley stupste Ella unter dem Kinn an. »Und, Ella-Bella, wie läuft's im Kindergarten?«
»Gestern waren wir im Zoo.«
»Hast du auch die Affen gesehen?«, fragte er. Sein Arm lag über Ellas Rückenlehne.
»Ja. Die waren so was von süß.«
»Aber nicht so süß wie du, oder?« Er fing Rebeccas Blick auf und zwinkerte ihr zu. »Du bist das süßeste Mädchen hier. Obwohl du keine Zähne hast.«
»Hab ich wohl!« Ella sperrte den Mund auf, um sie ihm zu zeigen.
Nachdem Rebecca dem Geplänkel noch ein paar Minuten lang zugehört hatte, ließ sie das Lachen der beiden einfach an sich vorbeirauschen. Sie wurde plötzlich von Traurigkeit und dann von Bedauern ergriffen. Wenn sich alles anders entwickelt hätte, würden sie noch immer eine Familie sein und die Kinder hätten ihren Vater noch. Aber Rebecca konnte einfach nicht in einer Beziehung bleiben, in der sie misshandelt wurde. Ihre Seele und ihr Körper konnten nicht noch mehr Traumata ertragen. Und sie hatte außerdem schreckliche Angst davor, dass er eines Tages auch die Kinder schlagen würde.
Daher hatte sie einen Entschluss gefasst und eines sonnigen Freitagnachmittags den Mut zusammengekratzt, Wesley auf seiner aktuellen Arbeitsstelle aufzusuchen.
»Wir müssen reden«, hatte sie ihm gesagt.
»Jetzt ist kein guter Zeitpunkt.«
»Es ist nie ein guter Zeitpunkt.« Sie atmete tief ein und aus. »Ich will, dass du ausziehst, Wesley.«
Er lachte. »Sehr witzig. Was ist die Pointe?«
»Ich mache keine Witze.«
Sein Lachen verflog. »Du meinst das also ernst?«
»Todernst. Das kann dich wohl kaum überraschen. Ich will, dass wir uns trennen! Du weißt, dass ich mich in unserer Ehe nicht … glücklich fühle.«
»Ich werde mir Mühe geben, in Zukunft mehr Zeit für dich zu haben.«
»Ich will nicht mehr Zeit, Wesley. Wir können beide nicht so leben. Deine Wutanfälle sind völlig außer Kontrolle geraten. Du kannst dich absolut nicht beherrschen.«
»Ach, es ist also alles meine Schuld?«, fragte Wesley hämisch.
»Letzte Woche hast du mich fast krankenhausreif geschlagen.«
»Vielleicht gehörst du da auch hin.«
Sie biss die Zähne zusammen. »Deine Drohungen ziehen bei mir nicht mehr. Ich habe mich entschieden. Heute Abend verlasse ich dich, und die Kinder nehme ich mit.«
Es entstand eine unangenehme Pause.
»Mir scheint, dass du nur an dich denkst und an das, was du willst. Hast du auch mal daran gedacht, was das bei den Kindern anrichten wird?«
»Natürlich habe ich das«, fuhr sie ihn an. »Ich denke an nichts anderes. Kannst du das von dir auch behaupten?«
»Du willst sie also gegen mich aufhetzen? Genau, wie deine Mutter es mit dir und deinem Vater immer gemacht hat.« Seine Stimme triefte nur so vor Abscheu.
»Lass meine Eltern gefälligst aus dem Spiel. Das hier hat nichts mit ihnen zu tun, sondern einzig und allein mit der Tatsache, dass du deine Wut nicht in den Griff bekommst und dich weigerst, professionelle Hilfe zu suchen.«
»Und was willst du den Kindern erzählen?«
Sie zuckte die Achseln. »Ella wird es nicht verstehen, dafür ist sie noch zu jung. Und Colton wird langsam zu alt, als dass ich mir noch weiter Entschuldigungen für dich ausdenken kann. Er ist schließlich schon fast ein Teenager.«
Wesley äußerte sich dazu nicht.
»Weißt du, was er letzte Nacht zu mir gesagt hat, Wesley? Er sagte, dass du anscheinend lieber wütend bist, als dass du mit uns zusammen bist. Und er hat recht, oder?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, stürmte sie aus seinem Büro. Denn sie kannte die Antwort bereits.
Am Abend packte Wesley zwei Koffer.
»Ich gehe ins Fairmont McDonald. Ich liebe dich immer noch, Becca.«
Das überwältigte sie. Sie war darauf vorbereitet gewesen, mit den Kindern zu Kelly zu ziehen. Sie hatte sogar erwartet, dass Wesley versuchen würde, sie wieder zu schlagen. Einen einfachen Rückzieher hatte sie allerdings von ihm nicht erwartet, auch nicht, dass er sich zur Abwechslung mal wie ein Gentleman benehmen würde.
»Du gehst?«, fragte sie schockiert.
»Das wolltest du doch«, sagte er mit einem Schulterzucken. »Dann sollst du das auch haben.«
Einen Sekundenbruchteil lang wollte sie ihm sagen, dass sie sich geirrt hatte, dass sie keine Trennung wollte. Dass sie ihm eine bessere Frau sein wollte, mehr Geduld an den Tag legen und lernen würde, mit seinen Wutanfällen umzugehen.
Doch dann erinnerte sie sich an all die Prellungen und Wunden. »Dann mach's gut Wesley.«
»Aber nur fürs Erste.«
Sie beobachtete, wie er in sein Auto stieg, und wartete dann, bis die Rücklichter angingen und schließlich die Straße hinunter verschwanden. Dann atmete sie langsam aus und ging den Flur entlang ins Badezimmer und versuchte, an die guten Zeiten zu denken. Aber davon gab es nicht allzu viele.
Sie starrte ihr Spiegelbild an und fuhr mit dem Finger über die kleine Narbe am Kinn. Ebenfalls ein Geschenk von Wesley zum Valentinstag vor zwei Jahren. Er hatte ihr vorgeworfen, mit dem Paketdienstboten geflirtet zu haben.
»Du hast was Besseres verdient«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu. »Und die Kinder auch.«
Jetzt, wo sie nur zwei Sitze von ihm entfernt in der Eishockeyhalle saß, wurde Rebecca klar, dass ihr Mann immer noch alles in seiner Kraft liegende tat, um sie unter Kontrolle zu halten.
»Ein Königreich für deine Gedanken«, sagte er jetzt.
»So viel sind die nicht wert.«
»Wozu auch, du hast ja schließlich mehr als genug Geld.«
»Das gehört den Kindern, Wesley, und das weißt du auch.«
Ihre Fingernägel gruben sich tief in ihre Handflächen. Fang nicht an, mit ihm zu streiten. Nicht hier. Nicht vor Ella.
Sie fing seinen Blick auf. »Wenn Colton das nächste Mal spielt, brauchst du dir nicht extra die Mühe zu machen, zu kommen.«