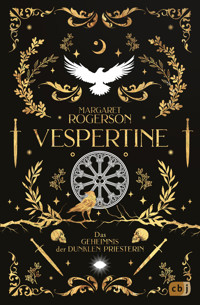
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Geister der Toten von Loraille ruhen nicht
Artemisias einziges Ziel im Leben ist es, eine Graue Schwester zu werden. Diese Nonnen sorgen dafür, dass die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits übergehen können. Als ihr Konvent von einer Armee besessener Soldaten angegriffen wird, erweckt Artemisia aus Versehen den uralten und bösartigen Geist eines Wiedergängers, was sie fast umbringt. Zugleich hat der Tod in Loraille Einzug gehalten und nur eine Vespertine hat eine Chance, ihn aufzuhalten. Das Wissen über die Vespertinen ist jedoch über die Jahrhunderte verloren gegangen. Und so bleibt Artemisia nichts anderes übrig, als sich an den letzten verbliebenen Experten zu wenden: den Wiedergänger selbst. Während Artemisia ein düsteres Rätsel aus Heiligen, Geheimnissen und dunkler Magie lüftet, entdeckt sie, dass sie im Kampf gegen das verborgene Böse vielleicht alles verraten muss, woran sie je geglaubt hat – wenn der Wiedergänger sie nicht zuerst verrät …
Der neue Dark-Fantasy-Roman von New-York-Times-Bestsellerautorin Margaret Rogerson über ein Mädchen mit mythischen Fähigkeiten, das ihre Welt vor den ruhelosen Geistern der Toten bewahren muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MARGARET ROGERSON
Das GEHEIMNIS der DUNKLEN PRIESTERIN
Aus dem Englischen von Claudia Max
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Text © 2021 by Margaret Rogerson
Published by arrangement with Margaret Rogerson
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Vespertine« bei MARGARET K. McELDERRYBOOKS,
an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York
Aus dem Englischen von Claudia Max
Lektorat: Carola Henke
Umschlaggestaltung: © Marie Graßhoff unter Verwendung mehrerer Bilder von © Adobe Stock (Hawk, CreativeMind, TWINSDESIGNSTUDIO, Buch&Bee, 397HOUSE, KR Studio, Feodora_21, DESIGNBOX (2x), denisik11, theseamuss)
sh · Herstellung: AnG
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31540-5V002
www.cbj-verlag.de
Für alle, die bei einer Party lieber in einer Ecke den Hund streicheln, als sich zu unterhalten: Dieses Buch ist für euch.
1
Den silbrigen Schimmer des Weihrauchfasses am Fuße eines Grabsteins bemerkte ich nur, weil ich auf den Friedhof gegangen war, um allein zu sein. Zur Verteidigung gegen die Toten trugen alle Novizinnen und Schwestern ein Thuribulum an einer Kette. Dieses hier gehörte Sophia, einer der jüngsten Novizinnen, die erst im letzten Winter ins Kloster gekommen war; ich erkannte es an seiner Form und weil es schwarz angelaufen war. Als ich mich danach bückte, war das Metall noch warm. Um wirklich sicher zu sein, musste ich mein Handgelenk dagegendrücken, meine vernarbten Hände konnten Temperaturen nur schwer einschätzen.
Sophia hatte das Weihrauchfass bestimmt nicht verloren, weil sie auf Bäume geklettert oder zwischen den Grabsteinen gespielt hatte. Sie musste Angst gehabt haben, sonst hätte sie keinen Weihrauch verbrannt; selbst Kinder wussten, dass er zu kostbar war, um ihn zu vergeuden.
Ich richtete mich auf und blickte zur Kapelle. Ein bitterkalter Wind peitschte mir Haarsträhnen ins Gesicht, die sich aus meinem Zopf gelöst hatten. Weil meine Augen tränten, brauchte ich einen Moment, bis ich die Raben bemerkte, die sich unter dem Dachvorsprung gegen den moosbedeckten grauen Stein kauerten. Bis auf einen waren alle schwarz. Er saß abseits und putzte nervös sein schneeweißes Gefieder, das der Wind immer wieder in die falsche Richtung blies.
»Stunk«, rief ich. Ich tastete in meiner Manteltasche nach einer Brotkruste. Kaum hielt ich sie in der Hand, stürzte sich der weiße Rabe in einem Windstoß vom Dach und landete auf meinem Arm, seine Krallen bohrten sich durch meinen Ärmel. Er riss das Brot in Stücke, dann beäugte er mich, ob ich vielleicht noch mehr hatte.
Er hätte nicht allein sein sollen. Er hatte kahle Stellen, wo ihm andere Vögel brutal Federn ausgerissen hatten. Als er das erste Mal ins Kloster gekommen war, hatten sie ihn als blutigen Haufen im Kreuzgang zurückgelassen. Selbst nachdem ich ihn in meine Zelle im Dormitorium gebracht und ihm alle paar Stunden den Schnabel geöffnet und ihm Wasser und Brot gegeben hatte, war er beinahe gestorben. Als ältere Novizin mit schon zu vielen Aufgaben hatte ich ihn nach seiner Genesung Sophia übergeben, damit sie sich um ihn kümmerte. Und nun folgte ihr Stunk überallhin, vor allem in die Häuser, wo sie die Schwestern zu ärgern pflegte, indem sie ihn in ihrem Habit versteckte.
»Ich bin auf der Suche nach Sophia«, erklärte ich ihm. »Ich glaube, sie ist in Gefahr.«
Er plusterte sein Halsgefieder und schnalzte und brummte vor sich hin, als denke er nach. Dann antwortete er mit der Stimme eines kleinen Mädchens: »Braver Vogel. Hübscher Vogel. Krümel!«
»Stimmt. Kannst du mich zu Sophia bringen?«
Er musterte mich mit einem hellen wachen Auge. Raben waren kluge Tiere und der Grauen Herrin heilig, und dank Sophia beherrschte er die Sprache der Menschen besser als die meisten anderen. Zumindest schien er sie zu verstehen. Er breitete die Flügel aus und flatterte zu dem Erd- und Steinhaufen, der die Rückwand der Kirche stützte, hüpfte über eine Platte und spähte in das dunkle Loch darunter.
Der Sturm der letzten Nacht musste das Fundament der Kapelle unterhöhlt und einen alten Zugang zur Gruft freigelegt haben.
Er blickte zu mir zurück. »Tote«, krächzte er.
Mir gefror das Blut in den Adern. Dieses Wort hatte er nicht von Sophia gelernt.
»Tote«, beharrte Stunk und plusterte das Gefieder. Die anderen Raben wurden unruhig, schlugen aber keinen Alarm.
Er musste sich irren. Jeder Stein der Klostermauern war durch einen Segen verstärkt. Unser überdachtes Friedhofstor hatten die heiligen Schwestern in Chantclere geschmiedet. Und trotzdem …
Unter herunterhängenden Wurzeln gähnte ein Gang. Ohne nachzudenken, war ich darauf zugegangen, dabei wusste ich eigentlich, was zu tun war – ich hätte zurückrennen und Mutter Katherine warnen sollen. Doch Sophia war zu jung, um einen Dolch mit sich zu führen, außerdem hatte sie ihr Weihrauchfass verloren.
Ich hakte mein Weihrauchfass von der Chatelaine. Mit zusammengebissenen Zähnen zwang ich meine ungeschickten Finger, den winzigen Deckel anzuheben, und hantierte mit Feuerstein und Weihrauch. Die Narben auf meiner linken Hand waren die schlimmsten, das glänzende rote Gewebe auf meiner Handfläche hatte sich über die Zeit zusammengezogen und meine Finger dauerhaft zu Klauen gekrümmt. Ich konnte sie zu einer lockeren Faust schließen, aber nicht spreizen. Beim Herumhantieren musste ich an Schwester Lucinde denken, die einen Ring mit einem alten gesprungenen Rubin trug. Der Ring enthielt die Reliquie einer Heiligen, deren Macht es der Schwester ermöglichte, Kerzen durch eine bloße Handbewegung anzuzünden.
Endlich sprang der Funke über. Ich blies in den Weihrauch, bis Glut aufflammte. Danach stieg ich in Rauch gehüllt in die Dunkelheit hinunter.
Schwärze verschluckte mich. Der Geruch nasser Erde ringsum war so erstickend, als würde mir ein nasser Lappen auf die Nase gepresst. Das durch die Öffnung hereinfallende dünne wässrige Licht verblasste beinahe auf der Stelle, doch wie alle Mädchen, die von den Grauen Schwestern aufgenommen wurden, besaß ich den Allblick.
Lichtfäden wirbelten wie Spinnweben um mich herum, ihre gespenstischen Formen klärten sich zu einem verzerrten Gesicht, einer ausgestreckten Hand. Schattengeister. Sie versammelten sich an Orten wie diesem, Gräber und Ruinen zogen sie an. Sie gehörten zu den Geistern erster Ordnung und waren zerbrechlich und beinahe gestaltlos. Ihre Finger zwickten meine Haut, als suchten sie nach einem losen Faden, den sie aufziehen konnten, doch sie stellten keine wirkliche Gefahr dar. Als ich vorbeieilte, vermischte sich der Rauch meines Gefäßes mit ihren durchscheinenden Gestalten und sie lösten sich seufzend im Weihrauch auf.
Schattengeister waren so alltäglich, dass Stunk sie normalerweise nicht weiter beachtet hätte. Nur etwas Gefährlicheres, ein Geist zweiter Ordnung oder höher, hätte seine Aufmerksamkeit erregt.
»Sophia?«, rief ich.
Als Antwort kam nur das Echo meiner eigenen Stimme.
Das wabernde gespenstische Licht ließ Nischen mit vergilbten Knochen und modrigen Tuchfetzen sichtbar werden. Nonnen wurden traditionell in den Tunneln um die Gruft beigesetzt, doch das Alter dieser sterblichen Überreste überraschte mich. Sie schienen jahrhundertealt zu sein, porös und von Spinnweben überzogen – aus der Zeit vor dem Großen Leid, als sich die Toten das erste Mal erhoben, um die Lebenden zu quälen. Wenn dieser Teil der Tunnel irgendwann in der Vergangenheit des Klosters abgesperrt worden war, konnte es gut sein, dass sich ein Geist aus den Knochenbergen erhoben und jahrelang in diesen Katakomben herumgespukt hatte, ohne dass es jemand mitbekommen hatte.
Ein Laut zitterte durch die tiefe unterirdische Stille des Gangs, fast zu leise, um sagen zu können, was es war. Das Schluchzen eines Kindes.
Ich rannte los.
Die Schattengeister peitschten durch mich hindurch, jede Berührung war ein plötzlicher Kälteschock. Mein Weihrauchfass schwang klirrend gegen mein Habit. Nachdem ich seine Kette fest um meine Hand gewickelt hatte, hielt ich es schützend vors Gesicht, so wie es mir Schwester Iris, die Kampfmeisterin des Klosters, beigebracht hatte.
In einer Tunnelbiegung vor mir war Licht zu sehen. Als ich um die Ecke bog, verwandelte sich mein Magen in Stein. Sophia hatte sich in einer Nische versteckt, ihr Gesicht war zwischen den Knien vergraben. Vor ihr schwebte eine schaurige Gestalt mit einem kahlen Schädel auf der gekrümmten knorrigen Wirbelsäule und spähte zu ihr hinein. Um den verwesten Körper flatterte schwerelos ein gespenstisch silbrig leuchtendes Leichentuch.
Einen Augenblick stand ich starr da. Die letzten sieben Jahre waren bedeutungslos und ich war wieder ein Kind. Ich roch heiße Asche und brennendes Fleisch, in meinen Händen pochten Phantomschmerzen.
So war es gewesen, bevor mich die Grauen Schwestern gefunden und gerettet – und mir beigebracht hatten, dass ich mich wehren konnte.
Ich zog meinen Dolch aus der Scheide. Der Geist schnellte herum, das Reiben des Stahls am Leder hatte ihn aufgeschreckt. Er hatte das eingefallene Gesicht einer ausgezehrten Leiche, die Lippen konnten das überdimensionale, die Hälfte des Schädels einnehmende Gebiss nicht bedecken, das zu einer Grimasse gefletscht war. Darüber waren keine Augen, nur leere Höhlen.
Sophia hob den Kopf. Durch den Schmutz auf ihren Wangen schimmerten Tränen. »Artemisia«, schrie sie.
Die Gestalt des Geistes löste sich auf und verschwand. Instinkt rettete mir das Leben. Ich drehte mich herum und schwang das Weihrauchfass. Als der Geist erneut vor meinem Gesicht auftauchte, hielt ihn der Weihrauch zurück. Ein Stöhnen entfuhr seinem Kiefer. Wieder verlosch er flackernd.
Bevor er erneut Gestalt annehmen konnte, warf ich mich vor Sophias Nische und schwang geübt mein Weihrauchgefäß. Nur die mächtigsten Geister konnten eine Barriere aus Weihrauchschwaden durchdringen. Um zu Sophia zu gelangen, musste er zuerst gegen mich kämpfen.
Nun wusste ich, was er war. Ein gewöhnlicher Geist zweiter Ordnung, ein Knochiger, die entstellte Seele von jemandem, der verhungert war. Die Knochigen waren zwar für ihre Schnelligkeit bekannt, doch sie waren schwach. Ein einziger wohlgezielter Schlag konnte sie vernichten.
Ich erhob meinen Dolch. Die Grauen Schwestern schwangen Misericordien: lange, dünne Klingen, gemacht für einen Hieb wie diesen. »Sophia, bist du verletzt?«
Sie schniefte laut, doch dann antwortete sie: »Ich glaube nicht.«
»Gut. Siehst du meinen Dolch? Falls mir etwas zustoßen sollte, versprich mir, dass du ihn an dich nimmst. Ich hoffe, es wird nicht nötig sein, aber du musst es mir versprechen. Sophia?«
Sie hatte keine Antwort gegeben. Der Knochige tauchte erneut in der Tunnelbiegung auf und flackerte im Zickzack auf uns zu.
»Ich verspreche es«, flüsterte Sophia.
Sie war sich der Gefahr bewusst, dass der Geist Besitz von ihr ergreifen konnte. Gelang es einem Geist, Macht über den Körper eines Menschen zu gewinnen, konnte er die Barrieren durchbrechen, die seinesgleichen abwehren sollten, und sogar eine Zeit lang unerkannt unter Menschen leben. Zum Glück für die meisten waren nur Menschen mit Allblick gefährdet. Ansonsten hätten die Toten Loraille längst überrannt.
Wieder ein Flackern. Als der Geist vor mir Gestalt annahm und die knochigen Hände ausstreckte, ließ ich meinen Dolch durch die Luft zischen. Die geweihte Klinge brannte eine Linie goldenen Feuers in das Leichentuch des Geistes. Als sich der Stoff in Dampf auflöste und die unverletzten Sehnen darunter sichtbar wurden, hielt ich die Luft an. Ich hatte bloß seinen Ärmel erwischt.
Die Hand des Knochigen umklammerte mein Handgelenk. Kälte zuckte durch die Nerven meines Arms und entlockte meiner Kehle einen Schrei. Ich versuchte, mich zu befreien, doch er ließ nicht los. Hinter seinen klauenähnlichen Nägeln wurde sein Gesicht sichtbar: Es kam näher, der kräftige Kiefer öffnete sich, als atme er meinen Schmerz ein und koste seinen Geschmack. Nicht mehr lange und meine tauben Finger würden den Schaft des Dolches nicht mehr halten können.
Ich ließ ihn bewusst los. Sophia schrie auf. Als sich die Aufmerksamkeit des Knochigen auf das Funkeln des herabfallenden Stahls richtete, packte ich mit meiner verletzten Hand das Weihrauchgefäß und drückte es gegen den Oberkörper des Geistes.
Er sah mich überrascht an. Dann hustete er Rauch aus. Ich schob das Weihrauchfass höher, die Hitze des Metalls spürte ich kaum. Der Knochige kreischte, es war ein unheimlicher widerhallender Laut, der eine kalte Schockwelle durch den Tunnel sandte und die morschen Knochen in den Nischen beben ließ. Er krümmte die Wirbelsäule und umklammerte seine Brust, seine Gestalt verschwamm in jede Richtung und wurde gewaltsam zerrissen, bis er schließlich in leuchtenden Nebelfetzen explodierte.
Als es dunkel wurde im Tunnel, waren nur noch Sophias unregelmäßige Atemzüge zu hören. Mir war bewusst, dass ich sie beruhigen musste, aber ich konnte mich wegen meines eiskalten Handgelenks kaum rühren. Plötzlich erwachte es mit einem Stechen wieder zum Leben, aber an der Stelle, wo die Berührung des Knochigen Kältebrand hinterlassen hatte, zeigten sich violette blutergussähnliche Linien.
»Artemisia?«, krächzte Sophias Stimme, es klang, als würde eine Maus an der Wand kratzen.
»Mir geht’s gut«, sagte ich. Blieb nur zu hoffen, dass es stimmte, falls ich noch einmal kämpfen musste. Doch ich bezweifelte, dass es der Fall sein würde. Ein einzelner Knochiger mochte Mutter Katherines Aufmerksamkeit entgehen, die Anwesenheit von mehreren würde sie spüren. Ich wandte mich zu Sophia und fing sie in meinen Armen auf. »Kannst du stehen?«
»Ich bin doch kein Baby«, protestierte sie, nun mutig, da die Gefahr vorbei war. Als ich sie auf den Boden stellte, hielt sie sich an meinem Habit fest, und Schmerz zuckte durch mein Handgelenk. »Schau mal!«
Das Licht vor uns im Tunnel warf einen schiefen Schatten an die Wand, ein heiseres undeutliches Murmeln war zu hören. Erleichterung überkam mich. Es gab nur eine Person, die allein hier unten herumwanderte und Selbstgespräche führte.
»Keine Angst. Das ist kein Geist, sondern bloß Schwester Julienne.«
Sophia klammerte sich fester an mich. »Das ist noch schlimmer«, flüsterte sie.
Schwester Julienne kam in Sichtweite, sie brabbelte immer noch vor sich hin, ihr Gesicht wurde von wirren Haaren verdeckt, die ihr bis zur Hüfte reichten und im Licht der Laterne weiß schimmerten. Ich musste Sophia recht geben.
Julienne war die Heilige Frau des Klosters. Sie hauste als Einsiedlerin in der Gruft der Kapelle und wachte über die heilige Reliquie der Heiligen Eugenia. Ihr ungewaschenes Habit stank so durchdringend nach Schafstalg, dass mir die Augen brannten.
Sophia starrte sie mit großen Augen an, dann bückte sie sich nach meinem Dolch und drückte ihn mir stumm in die Hand.
Schwester Julienne schien es nicht zu bemerken. Wir hätten ebenso gut unsichtbar sein können. Sie schlurfte so nah an uns vorbei, dass ihr Saum über unsere Schuhe schleifte, und steuerte auf die Nische zu, die Sophia gerade verlassen hatte. Ich versuchte zu verstehen, was sie vor sich hin brummte, während sie die durcheinandergeworfenen Knochen wieder an ihren Platz zurücklegte.
»Hab es jahrelang hier unten stöhnen und jammern gehört … endlich ist Ruhe … es war Schwester Rosemary, oder? Ja, ja. Ein hartes Jahr, eine entsetzliche Hungersnot, so viele Tote …«
Meine Haut kribbelte. Ich kannte niemanden namens Schwester Rosemary. Doch vermutlich würde ich sie finden, wenn ich die ältesten Aufzeichnungen des Klosters durchging.
Sophia zupfte an meinem Habit und flüsterte, ohne den Blick von Schwester Julienne abzuwenden, in mein Ohr: »Ist es wahr, dass sie Novizinnen verspeist?«
»Ha!«, rief Schwester Julienne und drehte sich zu uns um. Sophia fuhr zusammen. »Das erzählen sie jetzt also über mich? Gut! Es geht nämlich nichts über eine hübsche, schmackhafte Novizin. Nun kommt, Mädchen, kommt mit.« Sie drehte sich wieder um und begann, die Laterne in der runzligen Hand schwenkend, den Weg zurückzugehen, den sie gekommen war.
»Wohin bringt sie uns?«, wollte Sophia wissen, als sie zögerlich folgte. Sie klammerte sich noch immer an mein Gewand.
»Wir gehen bestimmt durch die Gruft. Es ist der sicherste Weg zurück in die Kapelle.«
Ehrlich gesagt war es bloß eine Vermutung, doch als Schwester Julienne uns durch mehrere Türen in den grob behauenen Tunneln führte, schien es immer wahrscheinlicher. Schließlich erreichten wir die letzte Tür, ein schweres schwarzes Monstrum aus geweihtem Stahl, und ich war sicher. Als Julienne sie aufstieß und uns hineinführte, fiel das Licht der Laterne auf die Beschläge.
Die Luft war zum Schneiden, die wabernden Weihrauchschwaden ließen meine Augen brennen und Sophia in ihren Ärmel husten. Wir waren in eine Steinkammer mit Säulen und Gewölbedecke eingetreten. In den Bögen zwischen den Säulen standen in Gewänder gehüllte Statuen, die Gesichter unter den Kapuzen lagen trotz der Kerzen, die zu ihren Füßen zu Wachspfützen zerrannen, im Schatten. Sophia blickte sich misstrauisch um – als suche sie einen versteckten Kessel in einer der Ecken oder die auf dem Boden verstreuten abgenagten Knochen ehemaliger Novizinnen. Doch auf den Bodenplatten waren nur hier und da eingemeißelte heilige Symbole, deren Formen im Laufe der Zeit beinahe unsichtbar geworden waren.
Schwester Julienne ließ uns einen Augenblick gaffen, dann winkte sie uns ungeduldig weiter. »Und nun berührt den Schrein, um den Segen der Heiligen Eugenia zu erhalten. Macht schnell.«
Der Schrein nahm die Mitte der Gruft ein: ein weißes Marmorpodest mit einem lebensgroßen Bildnis der Heiligen Eugenia auf dem Deckel des Sarkophags, ihr schönes steinernes Gesicht strahlte Ruhe im Tod aus. Die rings um ihren Körper aufgestellten Kerzen warfen ein ständig wechselndes Licht auf ihre Züge und verliehen ihm ein schwaches, rätselhaftes Lächeln. Sie hatte sich mit vierzehn Jahren geopfert und einen Geist fünfter Ordnung an ihre Knochen gebunden und war als Märtyrerin gestorben. Der Geist war angeblich so stark gewesen, dass er außer einem Fingerglied ihren gesamten Körper verbrannt hatte, eine Reliquie, die nun in unsichtbarem Prunk im Inneren des Sarkophags ruhte. Sie war keine niedere Reliquie wie die in Schwester Lucindes Ring, mit der man gelegentlich eine Kerze anzünden konnte, diese war eine hohe Reliquie, die nur in höchster Not eingesetzt wurde.
Sophia trat mit ernster Miene vor, um die gefalteten Hände des steinernen Abbildes zu berühren. Der Marmor dort glänzte stärker, in den letzten drei Jahrhunderten hatten ihn zahllose Pilgerinnen und Pilger berührt.
Schwester Julienne schenkte Sophia keine Beachtung. Sie beobachtete mich, ihre Augen funkelten durch den wirren Haarvorhang. »Nun du. Tritt vor.«
Die Hitze der Kerzen ließ den Schweiß unter meinem Habit jucken, doch als ich mich dem Schrein näherte, wurde die schmerzhaft im Gleichklang mit meinem Herzen pochende Kälte in meinem Handgelenk intensiver. Merkwürdigerweise wollte ich das Bildnis nicht berühren. Je näher ich kam, umso mehr versuchte mein Körper, sich ohne meine Erlaubnis zurückzuziehen, selbst meine Haare fühlten sich an, als wollten sie sich aufstellen. Vermutlich ging es den meisten Leuten so bei der Vorstellung, eine riesige haarige Spinne oder eine Leiche anzufassen – ich erlebte es bei der Vorstellung, einen heiligen Schrein zu berühren. Vielleicht stimmte ja doch etwas nicht mit mir.
Der Gedanke trieb mich vorwärts wie das strafende Brennen einer Peitsche. Ich stieg auf das Podest und legte meine Hand auf den Marmor.
Und bereute es auf der Stelle. Der Stein packte meine Hand, als wäre er mit Vogelleim bestrichen. Mir wurde flau im Magen und die Gruft versank in Dunkelheit. Ich sah nichts, hörte nichts, aber ich wusste, dass ich nicht allein war. Ich war von etwas umgeben, etwas Riesigem und Uraltem und Hungrigem. Ich meinte, die Bewegung von Federn in der Dunkelheit wahrzunehmen, es war weniger ein Geräusch als ein Gefühl – das erdrückende Gewicht von Gefangenschaft und eine verzehrende qualvolle Wut.
Ich wusste, was diese übernatürliche Anwesenheit war, was sie sein musste: der Geist fünfter Ordnung, der an die Reliquie der Heiligen Eugenia gebunden war. Ein Wiedergänger, einer der sieben, die es gab. Durch die lange zurückliegenden Opfer der hohen Heiligen waren sie mittlerweile alle vernichtet oder gefangen.
Ich spürte, wie sich sein Blick – einem Leuchtfeuer ähnlich, das die Dunkelheit absucht – langsam in meine Richtung drehte. Todesangst schnürte mir die Kehle zu. Ich riss meine Hand zurück und stolperte blind vom Sarkophag weg, um Haaresbreite hätte ich mir den Ärmel an den Kerzen versengt. Licht und Geräusche kehrten zurück. Hätte mich nicht eine knochige Hand an der Schulter festgehalten, wäre ich gestürzt.
»Du spürst ihn«, krächzte Schwester Juliennes Stimme heiser in mein Ohr und blies ihren säuerlichen Atem gegen meine Wange. »Du spürst ihn, nicht wahr?« Sie klang erwartungsvoll.
Ich holte keuchend Luft. Die Kerzen in der Gruft brannten unbeirrt weiter. Sophia beobachtete mich verwirrt, allmählich sah sie besorgt aus. Sie schien nichts gespürt zu haben, als sie den Schrein berührte. Ich hatte es schon lange vermutet, doch nun war ich sicher – was mir als Kind zugestoßen war, hatte etwas in mir beschädigt und eine Leere hinterlassen. Kein Wunder, fühlte ich mich den Geistern verbunden. In mir befand sich ein Hohlraum, der nur darauf wartete, in Besitz genommen zu werden.
Ich starrte finster zu Boden, bis Schwester Julienne mich losließ. »Ich weiß nicht, wovon Ihr redet«, gab ich zur Antwort, es war so eindeutig gelogen, dass mir beim Sprechen eine dumpfe Hitze ins Gesicht stieg. Ich wandte mich ab und ergriff Sophias Hand. Sie sah mittlerweile wirklich verängstigt aus, doch als sie den Druck meiner Hand erwiderte, wurde mir mit einem Anflug von Dankbarkeit bewusst, dass ihr die Schwester Angst einjagte, nicht ich.
»Wie du meinst«, brummte Schwester Julienne und schlurfte an uns vorbei, um eine weitere Tür zu öffnen, hinter der sich die Wendeltreppe hinauf zur Kapelle befand. »Aber du kannst nicht ewig davonlaufen, Mädchen. Die Herrin wird mit dir machen, was Sie will. Das tut Sie letzten Endes immer.«
2
Die Nachricht über den Knochigen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Am nächsten Tag starrten mich alle an und versuchten, einen Blick auf mein von Kältebrand gezeichnetes Handgelenk zu erhaschen. Als Sophia und ich in die Kapelle kamen, hatte uns Mutter Katherine auf die Krankenstation geschickt, aber gegen Kältebrand konnte man nicht viel ausrichten, er heilte mit der Zeit von selbst und verblasste wie ein Bluterguss zu Gelb. Man gab mir einige Tinkturen gegen die Schmerzen, die ich aber nicht nahm. Was in der Gruft geschehen war, erzählte ich niemandem.
Bis auf die neugierigen Blicke, die ich zwar hasste, aber gewohnt war, ging das Leben wie gewohnt weiter. Ich wich ihnen aus, indem ich den schmalen gepflasterten Pfaden zwischen den Klostergebäuden im Zickzackkurs folgte, wenn ich meine Pflichten erledigte. Manchmal schrien die anderen Novizinnen auf, wenn ich auftauchte, als würde ich bloß herumschleichen, um sie zu erschrecken – auch daran war ich gewöhnt.
Doch ich konnte ihnen nicht dauerhaft aus dem Weg gehen. Dreimal die Woche trainierten wir im abgeschlossenen Hof des Klosters, und Schwester Iris beobachtete uns mit Habichtsaugen, wenn wir mit unseren Weihrauchfässern und Dolchen übten, dazu kamen die täglichen Gebete in der Kapelle. Und jeden Morgen öffnete sich das Friedhofstor und ließ Leichenwagen in den Haupthof.
Seit dreihundert Jahren übernahmen die Grauen Schwestern die heilige Pflicht, sich um die Toten zu kümmern – wurden die Seelen nicht mit den nötigen Riten verabschiedet, verwandelten sie sich in Geister, statt auf natürliche Weise ins Jenseits hinüberzugleiten, wie sie es vor dem Großen Leid getan hatten. Wenn die Leichenwagen eintrafen, wurden die am stärksten verwesten Körper eilig in die Ritualkammern der Kapelle gebracht, wo sie hinter einer geweihten Tür verschwanden, durch die Rauch quoll. Weniger dringende Fälle kamen zur Reinigung ins Fumatorium und warteten, bis sie an der Reihe waren.
Das Fumatorium trug seinen Namen wegen des ununterbrochenen Weihrauchnebels, der den Verwandlungsprozess von Seelen in Geister verlangsamte. Das Untergeschoss, in dem die Leichen aufbewahrt wurden, befand sich wie ein Keller unter der Erde, trocken und kühl und dunkel. Auf der oberirdischen Ebene strömte durch große Oberfenster Licht in die helle weiß getünchte Halle, in der unser wöchentlicher Unterricht stattfand. In einem langen Raum standen Tische, die sehr an das Refektorium erinnerten, in dem wir unsere Mahlzeiten einnahmen. Den Vergleich behielt ich lieber für mich, denn auf den Tischen lagen Leichen.
Ich hatte diese Woche einen jungen Mann bekommen, ungefähr achtzehn oder neunzehn, nur wenig älter als ich selbst. Unter dem durch die Bodendielen quellenden Weihrauchgeruch war ein schwacher Verwesungsgeruch wahrzunehmen. Die anderen Novizinnen rings um mich rümpften die Nase und versuchten, ihre Partnerinnen zu überreden, die abstoßenderen Aspekte der Leichenuntersuchung zu übernehmen. Mir machte es nichts aus. Ich mochte die Gesellschaft der Toten lieber als die der Lebenden. Unter anderem tratschten sie nicht über mich.
»Glaubst du, sie wird die Prüfung bestehen?«, flüsterte Marguerite, zumindest bildete sie sich das ein. Ich konnte sie noch zwei Tische weiter hören.
»Natürlich wird sie bestehen, es hängt eher davon ab, ob sie teilnehmen darf«, flüsterte jemand zurück. Francine.
»Warum sollte sie nicht teilnehmen dürfen?«
Ich öffnete den Mund des toten Mannes und schaute hinein. Hinter mir senkte Francine noch weiter die Stimme. »Mathilde hat sich letzte Woche in die Kanzlei geschlichen und im Buch von Mutter Katherine gelesen. Artemisia war tatsächlich besessen, bevor sie herkam.«
Auf ihre Äußerung hin wurde mehrmals nach Luft geschnappt. Marguerite quietschte: »Wovon war sie besessen? Steht dort, ob sie jemanden umgebracht hat?« Mehrere Mädchen bedeuteten ihr, leiser zu reden.
»Ich weiß es nicht«, sagte Francine, sobald das Getuschel nachgelassen hatte, »aber es würde mich nicht wundern.«
»Ich wette, dass sie jemanden umgebracht hat«, erklärte Marguerite im Brustton der Überzeugung. »Was, wenn sie deshalb nie Besuch bekommt? Vielleicht hat sie ihre ganze Familie abgemurkst. Ich wette, dass sie viele Leute getötet hat.«
Mittlerweile hatte ich die Leiche umgedreht – schwierig ohne Partnerin – und untersuchte das Gesäß des jungen Mannes. Ich hatte keine Lust, mir das anzuhören, und überlegte, wie ich sie zum Schweigen bringen könnte. Schließlich sagte ich in die Stille, die auf Marguerites Spekulation folgte: »Ich würde euch erzählen, wie viele es gewesen sind, aber ich habe nicht mitgezählt.«
Hinter mir brach mehrstimmiges Kreischen aus.
»Mädchen!«
Alle hörten augenblicklich zu schreien auf – außer Marguerite, die noch ein letztes unschlüssiges Blöken ausstieß, bevor ihr Francine die Hand auf den Mund presste. Ich sah es, weil ich aufgeblickt hatte, als Schwester Iris von der anderen Seite des Saals auf uns zustürzte. Ihr schlichtes graues Habit, das bis auf einen silbernen Oculus-Anhänger um ihren Hals und einen kleinen Mondsteinring, der auf der dunkelbraunen Haut ihrer Hand schimmerte, völlig schmucklos war, ließ sie aufrecht und streng wirken. Schwester Iris war unter den Novizinnen allseits gefürchtet, auch wenn die Angst in unserem Alter eher aufgesetzt war. Den meisten von uns war klar, dass sie trotz ihres strengen Auftretens und ihres vernichtenden Blickes eine wohlwollende Kraft war. Einmal, als Mathilde schwer an der Schwitzkrankheit erkrankt war, hatte sie die ganze Nacht auf der Krankenstation gewacht, ihr die Stirn abgetupft und ihr vermutlich gedroht, dass sie nicht sterben durfte.
Nun musterte sie uns mit diesem Blick, auf mir ließ sie ihn noch ein wenig länger ruhen. Sie mochte mich, aber sie wusste, dass ich für das Kreischen verantwortlich war. Das war ich fast immer.
»Darf ich euch daran erinnern, dass in einem Monat ein Priester aus Bonsaint kommen wird, um jede von euch für die Aufnahme in den Klerus zu prüfen. Ihr solltet eure Zeit besser nutzen«, sagte sie spitz, »denn ihr werdet keine zweite Chance bekommen, Naimes zu verlassen.«
Die Mädchen wechselten Blicke. Niemand wollte in Naimes bleiben und sich für den Rest seines Lebens um Leichen kümmern. Ich war die Ausnahme.
Wurde ich vom Klerus für eine höhere Ausbildung ausgewählt, würde ich mit Menschen reden müssen. Wenn ich dann nach Beendigung meiner Ausbildung zur Priesterin geweiht würde, müsste ich mit noch mehr Menschen sprechen und außerdem ihre Glaubensprobleme lösen, was furchterregend klang – vermutlich würde ich sie zum Weinen bringen.
Für das Leben einer Grauen Schwester war ich zweifellos besser geeignet. Die Sterberiten durchzuführen war eine wichtige Arbeit, wichtiger, als mein Leben in einem vergoldeten Büro in Bonsaint oder Chantclere zu vertun und Menschen vor den Kopf zu stoßen. Außerdem gab es da noch die andere Pflicht der Grauen Schwestern, auf die ich mich am meisten freute. Sie waren auch dafür verantwortlich, Berichte über Kinder zu überprüfen, die den Allblick besaßen.
Ich rieb das Narbengewebe auf meinen Händen, an vielen Stellen war die Haut taub und fühlte sich an, als würde ich Leder berühren oder die Haut eines anderen. Hätte sich jemand gekümmert und ich wäre früher gefunden worden …
Bei der Prüfung bewusst durchzufallen, war bestimmt nicht weiter schwer. Der Priester würde mich wohl kaum mit Gewalt aus Naimes wegbringen.
Schwester Iris beobachtete mich, als wüsste sie genau, was ich dachte. »Wie ich sehe, bist du mit der Untersuchung der Leiche fertig. Artemisia. Erzähle mir, zu welchen Schlussfolgerungen du gekommen bist.«
Ich sah zu Boden. »Er ist an Fieber gestorben.«
»Wie kommst du darauf?«
»Sein Körper weist keine Spuren auf, die auf einen Tod durch eine Verletzung oder Gewalteinwirkung schließen lassen.« Mir war bewusst, dass mich die anderen Mädchen beobachteten, einige beugten sich vor, um Bemerkungen auszutauschen. Ich konnte mir denken, was sie sagten. Sie würden Kommentare über meinen versteinerten, mürrischen Gesichtsausdruck ablassen, meine völlig gefühllose Stimme.
»Und?« Schwester Iris warf den Novizinnen einen Blick zu, der sie augenblicklich zum Schweigen brachte.
»Er ist jung«, fuhr ich fort. »Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass er einen Herzinfarkt erlitten hat. Wäre er an einer auszehrenden Krankheit oder der Ruhr gestorben, wäre er dünner. Seine Zunge und seine Fingernägel weisen keine Verfärbungen auf, insoweit ist eine Vergiftung mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. In seinen Augen sind Äderchen geplatzt und seine Drüsen sind geschwollen, was auf ein Fieber hinweist.«
»Sehr gut. Und wie sieht es mit dem Zustand seiner Seele aus?« Das Geflüster hatte wieder angefangen. Schwester Iris drehte sich abrupt um. »Marguerite, würdest du geruhen zu antworten?«
Marguerites Wangen färbten sich knallrot. Sie war nicht so blass wie ich, dafür konnte ihre helle Haut eine sensationelle Vielfalt von Farben annehmen – normalerweise Rosaschattierungen, manchmal aber auch eine beeindruckend purpurne Färbung, und gelegentlich bekam sie einen interessanten Grünstich, wenn sie sich nach einem Kommentar von mir fast übergeben musste. »Könntet Ihr die Frage noch einmal wiederholen, Schwester Iris?«
»Welche Art Geist würde die Seele dieses Mannes werden«, erwiderte Schwester Iris knapp, »wenn die Schwestern sie nicht reinigen und vor dem Verderben retten würden?«
»Ein Schattengeist«, platzte Marguerite heraus. »Die meisten Seelen verwandeln sich unabhängig von der Todesursache in Geister erster Ordnung. Und wenn nicht in einen Schattengeist, dann …« Sie warf Francine einen panischen Blick zu, dem diese jedoch auswich. Sie hatte ebenfalls nicht zugehört.
Die Zelle, die ich mir mit Marguerite im Dormitorium teilte, war so eng, dass sich unsere harten, schmalen Betten fast berührten. Jeden Abend vor dem Einschlafen schlug sie das Zeichen gegen das Böse und beäugte mich dabei vielsagend. Ehrlich gesagt konnte ich es ihr nicht verübeln. Meistens tat sie mir leid. Ich hätte auch keine Zelle mit mir teilen wollen.
In letzter Zeit bedauerte ich sie sogar noch mehr als sonst, denn sie würde die Prüfung sicher nicht bestehen. Ich konnte sie mir nicht als Nonne vorstellen, ebenso wenig sah ich sie allerdings als Laienschwester, die die nie endende Last des Waschens, Kochens, Gärtnerns und Nähens im Kloster übernahm. Andere Möglichkeiten blieben ihr allerdings nicht, wenn sie durchfiel. Die Herrin hatte ihr den Allblick geschenkt, das bedeutete, dass sie ihr Leben in Ihrem Dienst verbringen musste. Ohne den Schutz des klösterlichen Friedhofstores, des Weihrauches und der geweihten Dolche des Klerus konnte keine von uns überleben. Die Gefahr, dass ein Geist von uns Besitz ergriff, war zu groß.
Schwester Iris stand mit dem Rücken zu mir. Als Marguerites verzweifelter Blick in meine Richtung wanderte, legte ich eine Hand an die Stirn und tat, als würde ich die Temperatur messen. Sie sah mich mit großen Augen an.
»Ein Fieberling«, rief sie.
Schwester Iris’ Lippen wurden schmal. »Und welcher Ordnung gehört ein Fieberling an, Artemisia?«, fragte sie mich mit misstrauischem Blick.
»Der dritten Ordnung«, gab ich pflichtschuldig zur Antwort. »Der Ordnung von Seelen, die an Seuchen und andere Krankheiten verloren wurden.«
Meine Antwort wurde mit einem kurzen Nicken quittiert, anschließend befragte Schwester Iris die anderen Novizinnen. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, wie sie die Todesursachen beschrieben: Unterkühlung, Hunger, Ruhr, ein Fall von Ertrinken. Keine der Leichen, die man uns zur Verfügung gestellt hatte, war durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Da diese Seelen sich in Geister vierter Ordnung verwandeln konnten, wurden sie sofort in die Kapelle geschafft.
Es war schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der Geister vierter Ordnung nicht die größte Bedrohung in Loraille dargestellt hatten. Doch die Geister fünfter Ordnung waren noch um ein Vielfaches zerstörerischer gewesen. Während des Märtyrerkrieges waren die sieben Wiedergänger wie Stürme über das Land gefegt und hatten ganze Städte verwüstet. Von Kältebrand befallene Ernten waren wie Asche vom Wind davongeweht worden. Es gab einen Gobelin im Skriptorium, auf dem die Heilige Eugenia dem Wiedergänger gegenübersteht, den sie an sich gebunden hatte. Ihre Rüstung funkelt in der Sonne, ihr weißes Pferd bäumt sich auf. Der Wandteppich war so alt und verblichen, dass der Wiedergänger wie eine verschwommene Wolke über einem Hügel aussieht, ihre Ränder sind mit ausgefranstem Silberfaden hervorgehoben.
Noch immer konnte ich seinen Hunger und seine Wut spüren, seine Verzweiflung darüber, an eine Reliquie gebunden zu sein. Ich musste nur genau genug auf die Stille lauschen, die unter der alltäglichen Betriebsamkeit im Kloster gähnte, durch die dämpfende Stille der düsteren Gänge und uralten Steine hindurch – um seine Verzweiflung in der Dunkelheit seines Gefängnisses zu spüren.
»Gibt es noch Fragen?«
Die Stimme von Schwester Iris holte mich in die Gegenwart zurück. Gleich würden wir entlassen werden. Während alle anderen erwartungsvoll zur Tür gingen und miteinander zu tuscheln begannen, hörte ich mich fragen: »Was veranlasst eine Seele, ein Geist fünfter Ordnung zu werden?«
Die Stille sauste wie eine Axt herunter. Alle drehten sich um und sahen erst mich, dann Schwester Iris an. In all den Jahren, die wir als Novizinnen verbracht hatten, hatte noch nie jemand gewagt, diese Frage zu stellen.
Schwester Iris schürzte die Lippen. »Das ist eine berechtigte Frage, Artemisia, vor allem, wenn man bedenkt, dass unser Kloster zu den wenigen Häusern gehört, die eine hohe Reliquie beherbergen. Doch sie lässt sich nicht leicht beantworten. Die Wahrheit lautet, dass wir es nicht mit Sicherheit sagen können.«
Von Neuem wurde geflüstert. Die Novizinnen tauschten unsichere Blicke aus.
Schwester Iris beachtete sie nicht. Sie musterte mich mit leicht gerunzelter Stirn, als wüsste sie wieder, was mir durch den Kopf ging. Ob Schwester Julienne jemandem erzählt hatte, was in der Gruft vorgefallen war?
Schwester Iris’ Miene gab keinen Hinweis, als sie weiterredete. »Aber es steht zweifelsfrei fest, dass sich seit dem Großen Leid keine weiteren Wiedergänger erhoben haben, die Göttin sei uns gnädig.« Sie schlug das Vier-Punkte-Zeichen des Oculus auf ihrer Stirn, ein drittes Auge, das die Herrin darstellte und Ihr Geschenk des Allblicks. »Die Gelehrte Josephine von Bissalart glaubte, dass die Entstehung der Wiedergänger mit der Katastrophe zu tun hatte, die das Große Leid ausgelöst hat – dem Ritual der Alten Magie, das der Rabenkönig praktiziert hatte.«
Alle hielten die Luft an. Jede von uns wusste, wie das Große Leid ausgelöst worden war, doch es war ein Thema, über das selten gesprochen wurde und das deshalb etwas Verbotenes an sich hatte. Als wir jünger gewesen waren, hatte eine beliebte Mutprobe darin bestanden, ein Geschichtsbuch aus dem Skriptorium zu stibitzen und die Passage über den Rabenkönig im Dunkeln bei Kerzenlicht vorzulesen. Eine Zeit lang hatte Francine Marguerite eingeredet, das dreimalige Aussprechen seines Namens um Mitternacht würde ihn herbeirufen.
Bestimmt wusste Schwester Iris darüber Bescheid. Sie beendete ihre Erklärung über das erneute Flüstern hinweg. »Das Ritual ließ die Pforten des Todes bersten und ordnete die Gesetze der natürlichen Welt neu. Möglicherweise wurden einige Seelen dabei auf einzigartige Weise verdorben und führten zur Entstehung der Wiedergänger. Josephine hatte in so vielen anderen Punkten recht« – an dieser Stelle durchbohrte sie die tuschelnden Novizinnen mit ihrem Blick –, »daher vertraue ich darauf, dass wir keine Wiederkehr fürchten brauchen, vor allem nicht, wenn ihr alle pünktlich euren Nachmittagsaufgaben nachgeht.«
Wochen später beobachtete ich im Kreuzgang meine weißen Atemwolken und spürte durch mein Habit die Kälte der Steinbank in den Oberschenkeln. Rings um mich waren Dutzende andere Novizinnen in meinem Alter, ihr nervöses Geplapper erfüllte die Morgendämmerung wie frühmorgendliches Vogelgezwitscher. Einige waren sogar aus dem fernen Montprestre für die Prüfung angereist, ihnen hing noch das Stroh der Karrenbetten in den Haaren. Sie bestaunten den Kreuzgang und starrten auf den Rubin an Schwester Lucindes Finger; bestimmt fragten sie sich, ob es sich tatsächlich um eine Reliquie handelte, wie es eine Nachbarin behauptet hatte. Die meisten Klöster im Norden waren so klein, dass nur die Äbtissinnen eine Reliquie trugen, und selbst dann nur eine. Mutter Katherine hingegen trug drei.
Marguerite saß zusammengekauert und fröstelnd neben mir und fiel fast von der Bank, weil sie mir nicht zu nahe kommen wollte. Ich war schon zur Seite gerückt und hatte ihr Platz gemacht, aber das war ihr anscheinend entgangen.
»Ich habe niemanden umgebracht«, versicherte ich ihr. Ausgesprochen klang es weniger beruhigend als in meinem Kopf, deshalb fügte ich hinzu: »Und auch nicht ernsthaft verletzt. Zumindest nicht dauerhaft. Inzwischen haben sie sich bestimmt alle wieder erholt.«
Als sie aufblickte, fürchtete ich einen schrecklichen Moment lang, dass sie tatsächlich mit mir reden würde. Darauf war ich nicht vorbereitet. Doch zu meiner Erleichterung traf in diesem Moment der Priester ein, zügige Schritte hallten auf dem Stein wider. Wir reckten die Köpfe, als seine beeindruckende Gestalt den Gang hinunterkam. Ich erhaschte einen Blick auf ein imposant schwingendes schwarzes Gewand und goldene Haare, bevor er in aufwirbelndem Stoff im Prüfungsraum verschwand.
Sobald sich die Tür geschlossen hatte, löste sich die ehrfürchtige Stille, die den Kreuzgang ergriffen hatte, in Gekicher auf. »Mädchen«, mahnte Schwester Lucinde beschwichtigend, doch auch als die erste Novizin in den Raum gerufen wurde, ging das gedämpfte Kichern weiter.
Es hörte erst auf, als das Mädchen bereits nach ein oder zwei Minuten weiß und fassungslos wieder herauskam. Schwester Lucinde musste sie an den Schultern fassen und Richtung Refektorium schieben, wo Strohlager für die Besucherinnen bereitstanden. Sie vergrub das Gesicht in den Händen, als sie schwankend davonging, und begann zu weinen.
Alle sahen ihr bestürzt hinterher. Marguerite beugte sich zu Francine vor, die auf der Bank gegenübersaß. »Das ging schnell, oder?«
Es war tatsächlich schnell gegangen. Das Mädchen war nicht einmal lange genug in dem Raum gewesen, um ein paar oberflächliche Fragen zu beantworten, geschweige denn, um eine Prüfung abzulegen. Offenbar hatte der Priester auf den ersten Blick beurteilen können, ob sie geeignet war. Meine Hände ballten sich in den Taschen meines Habits zu Fäusten.
Während sich die Bänke rasch leerten, kroch die Morgendämmerung in den Kreuzgang, der rosafarbene Schimmer sickerte die Steinwände des Innenhofs hinunter, blitzte in den Fenstern auf und blendete mich. Als das Licht schließlich über das niedergetretene Gras flutete, wo wir übten, war nur noch knapp ein Viertel von uns übrig. Die letzten Novizinnen kamen eine nach der anderen heraus, bis nur noch Marguerite und ich auf der Bank saßen. Als Schwester Lucinde Marguerites Namen aufrief, überlegte ich, was ich ihr Aufmunterndes sagen könnte, doch mir wollte beim besten Willen nichts einfallen. Als die Tür weniger als eine Minute später aufgestoßen wurde und sie mit rotem tränenüberströmtem Gesicht an mir vorbeihuschte, war ich immer noch am Überlegen.
Schwester Lucinde blickte ihr seufzend hinterher, dann nickte sie mir zu. Als ich die Türschwelle überschritt, hatten meine Augen Schwierigkeiten, sich an den Raum dahinter zu gewöhnen. Nachdem die Sonne aufgegangen war, wirkten die Innenräume trotz des knisternden Feuers im Kamin dunkel und waren drückend warm. Die wenigen flackernden Fackeln ringsum spiegelten sich in den Spiegeln und dem polierten Holz.
»Ist das das Mädchen?«, fragte eine Silhouette vor dem Feuer.
»Jawohl, Euer Gnaden.«
Der Türriegel wurde vorgeschoben. Schwester Lucinde hatte mich eingeschlossen.
Nun konnte ich den Priester besser erkennen. Sein blasses ernstes Gesicht schwebte über dem hohen Kragen seines strengen schwarzen Gewandes. Er war hochgewachsen, seine Haltung tadellos, die markanten Wangenknochen warfen Schatten auf seine Wangen. Er hatte den Blick schon wieder auf das Buch von Mutter Katherine gerichtet, dessen abgegriffene Seiten eng mit Einträgen zu jedem Mädchen im Kloster beschrieben waren. Ohne aufzublicken, deutete er mit einer förmlichen Geste auf den leeren Stuhl vor dem Tisch. Ein Ring mit einem großen Onyx blitzte an seiner Hand auf.
»Setz dich, mein Kind.«
Ich gehorchte und war dankbar für meine wie immer ausdruckslose Miene. Von Mutter Katherine war ich es gewohnt, »Kind« genannt zu werden, doch der Priester konnte nicht älter als zwanzig sein, er war fast genauso alt wie wir Novizinnen. Es erklärte das Gekicher.
Er blickte auf. »Stimmt etwas nicht?«, fragte er in kaltem, herrischem Ton.
»Verzeiht, Vater. Ihr seid der erste Mann, den ich seit sieben Jahren sehe.« Als er mich stumm anstarrte, erklärte ich: »Der erste lebendige Mann. Tote habe ich jede Menge gesehen.«
Seine Augen wurden schmal und betrachteten mich von Neuem, als sei ich etwas Undefinierbares, das er gerade von seiner Schuhsohle abgekratzt hatte. »Die korrekte Anrede lautet ›Gnaden‹. Ich bin Beichtvater, nicht Abt.« Das Buch wurde mit einem Schlag zugeklappt und ließ Staubflocken durch die Luft wirbeln. »Artemisia«, sagte er, die Missbilligung in seiner Stimme war nicht zu überhören.
»Das ist nicht mein Geburtsname, Euer Gnaden. Mutter Katherine hat ihn für mich gewählt, als ich ins Kloster kam. Es ist der Name einer …«
»Einer legendären Kriegerin«, unterbrach er mich leicht verärgert. »Ja, das ist mir bewusst. Warum hast du deinen Geburtsnamen nicht angegeben?«
Ich wollte nicht antworten. Es traf mich unvorbereitet, einem Fremden erklären zu müssen, dass ich meinen Namen nicht haben wollte, weil die Menschen, die ihn mir gegeben hatten, mich nicht gewollt hatten. »Ich konnte nicht«, antwortete ich schließlich. »Als ich herkam, habe ich über ein Jahr nicht gesprochen.«
Der Priester lehnte sich zurück und musterte mich mit undurchdringlicher Miene – stellte jedoch zu meiner Erleichterung keine weiteren Fragen, stattdessen wählte er von einem Stapel an der Seite des Schreibtischs eine kleine kunstvoll geschnitzte Holzschatulle, die er brüsk zwischen uns schob, als wolle er es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ich sah mein Spiegelbild über die verspiegelte Einlegearbeit auf dem Deckel flirren: totenbleich, mit einem zerzausten schwarzen Zopf über einer Schulter.
»Du magst den Prüfungsablauf zunächst seltsam finden, doch ich versichere dir, es ist eine sehr einfache Prozedur.« Seine Stimme klang gelangweilt und etwas gereizt. »Du brauchst bloß deine Hand über die Schatulle zu halten, ungefähr so.« Er führte es mir vor, dann zog er die Hand zurück und beobachtete mich.
Ich verstand nicht, wie das eine Prüfung sein sollte, vielleicht machte er sich über mich lustig. Misstrauisch streckte ich die linke Hand aus und kümmerte mich nicht darum, dass sein Blick schärfer wurde, als er meine Narben bemerkte. Sobald sich meine Finger der Schatulle näherten, wurde die Luft kälter, bis plötzlich …
Ich tauchte in kaltes Wasser ein, mit einem stummen Schrei schossen Blasen aus meiner Kehle. Der stinkende Flussschlamm ließ mich würgen, und ich rang verzweifelt nach Luft, konnte jedoch nicht atmen. Glitschige Wasserpflanzen wickelten sich um meine Knöchel und zogen mich nach unten, als ich in die Tiefe sank, pochte mein Herzschlag in den Ohren und wurde langsamer und langsamer …
Ich zog hastig die Hand zurück. Die Flut von Empfindungen verblasste sofort und wich dem fröhlichen Knistern des Feuers und der Wärme meines trockenen Habits. Ich konzentrierte mich auf den Schreibtisch und strengte mich an, mir nichts anmerken zu lassen. Die Schatulle enthielt die Reliquie einer Heiligen. Ich konnte mir das Innere ungefähr vorstellen: ein alter schimmelnder Knochen auf einem Samtpolster, vor geisterhafter Energie brodelnd. Ich vermutete, dass es sich bei dem an die Reliquie gebundenen Wesen um eine Undine handelte, einen Geist zweiter Ordnung von jemandem, der ertrunken war.
Nun verstand ich, was er gemeint hatte. Wir wurden auf unsere Fähigkeit geprüft, Reliquien zu erspüren. Der Priester hatte die anderen Mädchen so schnell ausschließen können, weil ihnen die Schatulle völlig gewöhnlich erschien, genau wie die meisten Menschen nur leblosen Marmor spürten, wenn sie den Schrein der Heiligen Eugenia berührten. Kein Wunder, hatte die erste Novizin so verwirrt ausgesehen.
»Du brauchst keine Angst zu haben. Sie kann dir nichts anhaben.« Er beugte sich vor. »Halte einfach nur deine Hand darüber und schildere mir, was du spürst. Und zwar so detailliert wie möglich.«
Nun wirkte er angespannt, weil er das Feuer in sich unterdrückte, er ähnelte einem edlen Windhund, der seine Aufregung über ein aufgespürtes Eichhörnchen nicht zeigen möchte. Beim Gedanken an seinen Wortwechsel mit Schwester Lucinde hatte ich eine leise Vorahnung. Mittlerweile schien er ziemlich sicher zu sein, dass ich seine Zeit wert war. Als ich mich hingesetzt hatte, war das nicht der Fall gewesen.
Ich hielt meine Hand wieder langsam über die Schatulle. Als die Todesqualen der Undine beim Ertrinken dieses Mal gegen meine Sinne schwappten, war ich in der Lage, mich auf den Raum zu konzentrieren. »Ich spüre nichts«, log ich.
»Nichts? Bist du sicher?« Aus dem Augenwinkel sah ich ihn mit den Fingern über den Onyxring reiben. »Du kannst ehrlich zu mir sein, Kind.«
»Ich …« Mehr brachte ich nicht heraus, bevor ich den Rest herunterschluckte. Fast hätte ich ihm die Wahrheit erzählt.
Noch schlimmer, ich hätte es genossen, ihm die Wahrheit zu erzählen. Beim Gedanken, seiner Forderung nachzukommen, tugendhaft und gut zu sein – was mir ganz und gar nicht entsprach –, floss eine beruhigende Wärme durch meinen Körper.
Im Kerzenschein glänzte der Stein seines Ringes wie der Panzer eines Käfers. Der polierte schwarze Edelstein ließ selbst Mutter Katherines großen Bernstein mit Cabochonschliff kümmerlich wirken. Er hatte sich am Anfang als Beichtvater bezeichnet. Der Rang von Geistlichen wurde durch die Art Reliquie bestimmt, die sie trugen. Je nachdem, welche Art Geist sie an sich band, gewährte jede Reliquie ihrem Träger eine andere Fähigkeit. Es war nicht weiter schwierig zu erraten, über welche Macht seine verfügte.
Sorgfältig darauf bedacht, meine Erkenntnis nicht zu zeigen, sah ich dem Priester in die Augen. Jemanden anzusehen hatte ich noch nie gemocht, es fiel mir nicht leicht. Ich hasste es, die unausgesprochenen Regeln herauszufinden, wie lange man hinsehen und wie oft man blinzeln sollte. Ich machte es immer falsch. Laut Marguerite übertrieb ich es jedes Mal, indem ich Menschen zu direkt anstarrte und in Bedrängnis brachte – auch wenn sie nicht genau diesen Wortlaut benutzt hatte. Damals hatte sie viel geweint.
»Ich bin sicher«, wiederholte ich.
Beeindruckenderweise reagierte der Priester nicht. Falls er überrascht oder enttäuscht war, war es ihm nicht anzumerken. »Nun gut. Lass uns weitermachen«, war alles, was er erwiderte. Er zog die erste Schatulle beiseite und schob eine andere über den Tisch.
Als ich dieses Mal die Hand ausstreckte, umhüllte mich eine Übelkeit erregende Wolke: der Gestank von abgestandenem Schweiß, säuerlichem Atem und unsauberer Wäsche. Mein Atem ging rasselnd in meiner Brust, auf meiner Zunge lag ein fauliger Geschmack. Meine Gliedmaßen fühlten sich schwach an, wie morsche Stöcke unter einer schweren Bettdecke.
Dritte Ordnung, dachte ich. Höchstwahrscheinlich ein Verdorrter – die Seele von jemandem, der an einer auszehrenden Krankheit gestorben war.
Anders als der Wiedergänger in der Gruft schien sich dieser seiner Gefangenschaft nicht bewusst zu sein. Ebenso wenig wie die Undine. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass es eine nützliche Beobachtung war, die ich dem Priester mitteilen könnte; mein Scharfblick, meine Fähigkeit, einen Geist fünfter Ordnung zu erkennen, würde ihn sicher beeindrucken …
Ich zwickte mich in den Oberschenkel. »Nichts«, erklärte ich mit ausdrucksloser Stimme.
Er lächelte, als würde ihm mein widerspenstiges Verhalten gefallen. Als er mir die dritte Schatulle entgegenschob, hielt ich schnell die Hand darüber – und bezahlte für meinen Fehler.
Rings um mich züngelten auflodernde Flammen über meine Haut. Glut wirbelte durch die erdrückende, von Rauch erfüllte Dunkelheit. Und da war die vertraute Hitze, der Schmerz, der Gestank von brennendem Fleisch – die blinde Todesangst, durch Feuer zu sterben.
Ich stieß mich vom Schreibtisch ab. Als ich wieder klar sehen konnte, stellte ich fest, dass mein Stuhl über den Boden gerutscht war und meine Fingernägel sich in das Holz der Armlehnen krallten.
»Ein Aschegrimm.« Er erhob sich von seinem Stuhl, seine Augen funkelten triumphierend. »Die gleiche Art Geist, die von dir Besitz ergriffen hat, als du ein Kind warst.«
Ich hatte noch immer den Gestank von versengtem Fleisch in der Nase. Ich biss die Zähne zusammen und saß stumm und verstockt da, mein Atem ging stoßweise. Solange ich leugnete, etwas gespürt zu haben, konnte er nicht behaupten, dass ich die Prüfung bestanden hatte.
»Es gibt keinen Grund, etwas zurückzuhalten, Artemisia. Ich weiß alles über dich. Es steht hier im Buch.« Er kam um den Schreibtisch herum und stellte sich, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, vor mich. »Ich räume ein, anfänglich hatte ich meine Zweifel an deiner Geschichte. Die meisten Kinder überleben es nicht, von einem Geist besessen zu sein, vor allem nicht über einen so langen Zeitraum, wie er in deinem Eintrag erwähnt ist. Diejenigen allerdings, die überleben, zeigen häufig eine außergewöhnliche Begabung im Umgang mit Reliquien. So schrecklich es ist, in so jungem Alter gezwungen zu sein – sich gegen den Willen eines Geistes zu wehren, erhöht die Sensibilität.«
Als ich seinem Blick auswich, ging er in die Hocke, sodass unsere Gesichter auf Augenhöhe waren. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass seine Augen intensiv smaragdgrün waren, sie ähnelten angeleuchtetem Buntglas. »Du hast gespürt, dass der Geist Angst vor Feuer hatte, oder?«, fragte er leise. »Deshalb hast du dich verbrannt. Es war deine Methode, ihn zu unterwerfen und zu verhindern, dass er anderen Schaden zufügte.«
Zuvor hatte ich dem Priester misstraut. Nun verabscheute ich ihn: sein schönes Gesicht, seine weichen gepflegten Hände, kein Zentimeter von ihm war von Elend gezeichnet – er war genau die Sorte Mensch, die ich niemals werden wollte.
Doch er schien meinen brennenden Hass nicht zu spüren. Und er würde ihn auch nicht spüren; ich hatte immer wieder zu hören bekommen, dass meine Miene mehr oder weniger stets dieselbe war. Als ich weiter stumm blieb, erhob er sich würdevoll und ging wieder hinter den Schreibtisch, seine schwarzgewandete Gestalt war gerade aufgerichtet, als er anfing, die Reliquienschatullen in eine Tasche zu packen.
»Fast jeder kann eine Reliquie beherrschen, die einen gewöhnlichen Geist erster oder zweiter Ordnung bindet. Die Schwestern sind ein hinlänglicher Beweis dafür. Deine Begabung hingegen bewegt sich in einer völlig anderen Dimension. Du bist ohne jeden Zweifel für Großes bestimmt. In Bonsaint wirst du darin ausgebildet werden …«
»Ich werde nicht nach Bonsaint gehen«, unterbrach ich ihn. »Ich werde in Naimes bleiben und Nonne werden.«
Er hielt inne und starrte mich an, als hätte ich Unsinn geredet. Schließlich breitete sich ein Ausdruck erstaunter Abscheu auf seinen Gesichtszügen aus. »Warum in aller Welt solltest du das wollen?«
Ich machte keinen Versuch, es ihm zu erklären. Er würde es sowieso nicht verstehen. Stattdessen fragte ich: »Hätte ich nicht die Prüfung bestehen müssen, um in den Klerus aufgenommen zu werden?«
Er musterte mich noch einen Moment, dann verzog er den Mund zu einem herablassenden, beinahe bitteren Lächeln. »Die Schwestern haben mich vorgewarnt, dass du versuchen könntest, absichtlich durchzufallen. Die wahre Prüfung bestand nicht darin, deine Fähigkeit, die Reliquien zu erkennen, auszutesten. Sondern, ob du stark genug bist, meiner Reliquie zu trotzen.« Meine Augen wanderten zu seinem Ring. »Eine Reliquie der Heiligen Liliane«, erklärte er, wieder mit einem knappen, unangenehmen Lächeln. »Sie bindet einen Geist vierter Ordnung, Büßer genannt, und verleiht mir die Macht, Unwilligen die Wahrheit aus dem Munde zu ziehen, unter … unter anderem.« Er schloss energisch die Schnallen der Tasche und wandte sich zum Gehen. »Glücklicherweise liegt die Angelegenheit nicht in deiner Hand. Der Klerus muss so schnell wie möglich darauf aufmerksam gemacht werden. Ich werde veranlassen, dass die Schwestern deine Habseligkeiten zusammenpacken. Wir müssen noch heute Nacht nach Bonsaint aufbrechen.«
»Nein.« Ich beobachtete, wie er mit der Hand auf der Türklinke innehielt. »Wenn ich Eurer Reliquie widerstehen kann, könnt Ihr mich nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen. Wie wollt Ihr beweisen, dass ich bestanden habe?«
Er stand reglos da. Seine Antwort kam leise und mit tödlicher Ruhe. »Mein Wort stünde gegen deines. Ich denke, du wirst noch herausfinden, dass mein Wort sehr viel gilt.«
»In diesem Fall wäre es vermutlich höchst peinlich, wenn Ihr mich den ganzen Weg nach Bonsaint schleppen würdet, nur damit der Klerus herausfindet, dass ich völlig verrückt bin«, erwiderte ich.
Er wandte sich langsam um. »Die Schwestern werden bestätigen, dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist. Wenn nötig, auch schriftlich.«
»Nicht, wenn es eine neue Entwicklung ist. Es ist allseits bekannt, dass etwas mit mir nicht stimmt. Es wäre nicht weiter schwer, so zu tun, als hätte mir die Gegenüberstellung mit einem Aschegrimm während Eurer Prüfung den Rest gegeben.« Ich hob den Blick und sah ihn an. »Leider war die Erinnerung an meine Vergangenheit wohl zu viel für mich.«
Wie lange es wohl her war, dass ihm jemand getrotzt hatte? Er schleuderte die Tasche beiseite und kam in großen Schritten auf mich zu, seine Augen sprühten Gift. Ich erwartete, dass er mich schlagen würde. Doch dann gewann er die Selbstbeherrschung zurück.
»Das hier bereitet mir kein Vergnügen«, sagte er, »doch du lässt mir keine andere Wahl. Aber es ist zu deinem Besten, Kind.« Er legte die Hand über seinen Ring.
Zunächst spürte ich nichts. Dann rang ich nach Luft. Ein vernichtender Druck presste auf mein Herz, meine Lungen. Nach einem Moment der Benommenheit wurde mir bewusst, dass es keine körperliche Kraft war, sondern eine emotionale – ein verzweifeltes, vernichtendes Schuldgefühl. Ich wollte in meinem Elend auf den Boden sinken, weinen und den Priester um Verzeihung bitten, auch wenn ich wusste, dass ich keine Erlösung verdient hatte – dass ich nicht einmal das Erbarmen der Herrin verdiente.
Der Büßer.
Ich biss die Zähne zusammen. Ich hatte mich seiner Reliquie zuvor widersetzt und ich konnte es wieder tun. Wenn er wollte, dass ich, auf dem Boden kriechend, bereute, würde ich genau das Gegenteil tun. Ich erhob mich mühsam und gegen jedes Gelenk ankämpfend und sah ihm in die Augen.
Die Wirkung der Reliquie verflog. Er taumelte einen Schritt zurück und klammerte sich an den Tisch, um das Gleichgewicht zu bewahren. Er keuchte und betrachtete mich mit einem Blick, den ich nicht zu deuten wusste. Eine goldene Haarlocke fiel ihm ins Gesicht.
Es wurde laut an die Tür gehämmert. Bevor einer von uns reagieren konnte, flog die Tür auf und Tageslicht strömte in den Raum. Auf der Türschwelle stand nicht Schwester Lucinde, sondern ein eher erschrocken aussehender junger Diener, der ein gefaltetes Schriftstück an sich drückte.
»Beichtvater Leander«, stammelte er. »Dringende Neuigkeiten, Euer Gnaden. In Roischal wurden von Geistern besessene Soldaten gesichtet. Man verlangt nach Eurer Hilfe …«
Der Priester fing sich so weit, um dem Pagen das Pergament aus den Händen zu reißen. Er entfaltete den Brief und überflog den Inhalt, dann legte er ihn wieder zusammen, als hätte ihn der Inhalt verbrannt.
Dass Geister von Soldaten des Klerus Besitz ergreifen konnten, hatte ich noch nie gehört. Das Gesicht des Priesters war blutleer und weiß, aber nicht aus Überraschung oder vor Schreck, die Nachricht schien ihn eher wütend zu machen. Er atmete ein und aus und blickte starr geradeaus.
»Mit dir bin ich noch nicht fertig«, erklärte er mir. Er strich sich mit zitternden Händen die Haare glatt. Anschließend stolzierte er mit schwingendem schwarzem Gewand zur Tür hinaus.
3
Keine der Schwestern sagte etwas, dabei mussten sie wissen, dass ich etwas getan hatte – wenn auch nicht genau, was. Benommen von Schlafmangel hielt ich mich ein paar quälend lange Tage bedeckt. Es grauste mir davor, ins Dormitorium zurückzukehren.
Marguerite hatte eine reiche Tante in Chantclere, die ihr Briefe und Zeichnungen mit den neuesten Moden der Stadt schickte, vielmehr hatte sie dies getan – nach einer Weile waren die Briefe in immer größeren Abständen gekommen und schließlich ohne jede Erklärung überhaupt nicht mehr. Marguerite hatte sie jahrelang aufbewahrt und an die Wand über ihrem Bett gehängt, wo sie sie jede Nacht anschaute. Doch als ich nach der Prüfung in unsere Zelle zurückkehrte, hatte sie die Briefe heruntergerissen. Mit roten Augen stand sie auf einem Haufen zerknülltem Pergament und sah mich vorwurfsvoll an. »Ich würde lieber sterben, als den Rest meines Lebens in Naimes zu verbringen«, erklärte sie.
In den darauffolgenden Nächten hielt mich ihr Weinen wach, bis die Glocke für das Morgengebet läutete. Mein Versuch, mit ihr zu reden, erwies sich als schreckliche Idee; das Ergebnis war so erschütternd, dass ich die Nacht im Stall verbrachte und dankbar war, dass ich den Ziegen und Pferden keine seelischen Verletzungen zufügen konnte – zumindest bisher nicht.
Dann trafen weitere Nachrichten aus Roischal ein, und niemand dachte mehr an die Prüfung, nicht einmal Marguerite. Als der erste kalte Winterregen in die Steine des Klosters einsickerte, erfüllte Geflüster die Gänge wie Schattengeister.
Den einen Moment wirkte alles ganz normal, doch dann hörte ich im nächsten etwas, das mich aus der Bahn warf: Im Refektorium steckten Novizinnen die Köpfe zusammen und tuschelten ängstlich darüber, dass ein Geist vierter Ordnung gesichtet worden war – ein Spalter, der in Loraille das letzte Mal vor unserer Geburt gesehen worden war. Als ich am nächsten Tag den Garten durchquerte, wo die Laienschwestern das letzte verschrumpelte Herbstgemüse ausrissen, hörte ich im Vorbeigehen, dass die Stadt Bonsaint ihre große Zugbrücke über die Sevre hochgezogen hatte, eine Schutzmaßnahme, die seit hundert Jahren nicht mehr ergriffen worden war.
»Wenn die Göttliche Angst hat, sollten wir uns dann nicht auch fürchten?«, flüsterte eine der Schwestern.
Die Göttliche von Bonsaint regierte die nördlichen Provinzen von ihrem Sitz in Roischal, dessen Grenze nur wenige Tagesreisen im Süden lag. Einst hatten Könige und Königinnen über Loraille regiert, doch ihre verderbte Linie hatte mit dem Rabenkönig geendet. Danach hatte sich der Klerus aus der Asche des Großen Leids erhoben und ihren Platz eingenommen. Nun herrschten an ihrer Stelle die Göttlichen. Das mächtigste Amt war das der Erzgöttlichen in Chantclere, allerdings war sie Gerüchten zufolge beinahe hundert Jahre alt und hatte außerhalb der Stadt wenig Einfluss.
Die jetzige Göttliche von Bonsaint hatte kurz nach ihrer Priesterinnenweihe eine Pilgerfahrt zum Schrein der Heiligen Eugenia in unserem Kloster unternommen. Ich war damals dreizehn gewesen. Die Einheimischen waren in erstaunlicher Zahl herbeigeströmt, um sie zu sehen, hatten wilde Frühlingsblumen auf die Straße gestreut und waren vor den Klostermauern auf Bäume geklettert, um einen besseren Blick zu erhaschen. Den größten Eindruck hatte jedoch bei mir hinterlassen, wie jung die Göttliche aussah und wie traurig. Als ihre Diener auf dem Weg zur Gruft ihre Schleppe anhoben und sie am Ellbogen hielten, als sei sie aus Glas, war sie ausgesprochen still gewesen – eine einsame, in ihrem Prunk verlorene Gestalt.
Wie es ihr jetzt wohl ging? Soweit ich es beurteilen konnte, war das Schlimmste an der Situation in Roischal, dass niemand die Ursache kannte. Es war mehr als ein Jahrhundert her, dass die Geister in solcher Zahl angegriffen hatten, in der Vergangenheit war es immer nach Ereignissen wie Seuchen oder Hungersnöten passiert oder nachdem eine Stadt von einem Brand verwüstet worden war. Dieses Mal hingegen gab es keinen eindeutigen Grund und selbst der Klerus schien keine Erklärung parat zu haben.
An dem Tag, als die Katastrophe schließlich Naimes erreichte, kam ich gerade mit einem leeren Futtereimer vom Scheunenhof. Nach einem Vorfall in der Waschküche, als ich elf war, vertrauten mir die Schwestern keine Aufgaben mehr an, bei denen ich mir die Hände verletzen konnte. An jenem Tag hatte ich mich mit Lauge verbrüht und niemandem davon erzählt – zunächst, weil ich es nicht spürte, und dann, weil ich keinen Grund sah. Ich erinnerte mich noch daran, wie alle verstummt waren, als es schließlich jemandem auffiel. Die Schwestern hatten mir entsetzte Blicke zugeworfen, die ich nicht verstand. Schließlich hatte eine von ihnen nach Mutter Katherine gerufen, die mich sanft am Arm nahm und auf die Krankenstation brachte. Seitdem hatte man mir immer Arbeit mit den Tieren zugewiesen.
Neben dem Beet, in dem wir unser Gemüse zogen, besaß das Kloster auch einen kleinen Ziergarten. Im Sommer blühten dort Rosen, deren üppige Blütenpracht die halb zerfallene Statue der Heiligen Eugenia beinahe unter sich begrub. Um diese Jahreszeit färbte sich die sie umgebende Hecke jedoch braun und verlor ihre Blätter, sodass ich im Vorübergehen jemanden dort sitzen sah. Es war keine Pilgerin, sondern Mutter Katherine, ihr Haupt mit den weichen weißen Haaren war zum Gebet gesenkt.
Sie sah gebrechlich aus. Die Beobachtung traf mich ohne Vorwarnung. Mir war nicht bewusst gewesen, wie sehr sie gealtert war – es kam mir vor, als hätte ich den Staub von einem Gemälde gewischt und würde es zum ersten Mal seit Jahren klar und deutlich sehen, nachdem ich jahrelang schlicht vergessen hatte, es anzuschauen.
»Artemisia, mein Kind«, sagte sie geduldig. »Spionierst du mir etwa hinterher? Komm her und setz dich zu mir.«


















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










