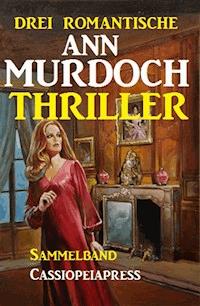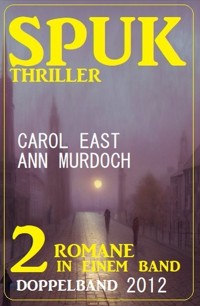4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vier dramatische Romantic Thriller in einem Band: Dunkle Geheimnisse, übernatürkliche Bedrohungen, mysteriöse Begebenheiten - und eine Liebe, die sich dem Grauen widersetzt. Darum geht in den packenden romantischen Spannungsromanen von Ann Murdoch.
Dieses E-Book enthält folgende, auch einzeln lieferbare Romane:
Der Tod lebt ewig
Dunkles Teufelsspiel
Schwarzer Engel
Das verhängnisvolle Tagebuch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Vier Romantic Thriller: Sammelband Nr. 1
Cassiopeiapress
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVier Romantic Thriller
von Ann Murdoch
Nur der Tod lebt ewig
von Ann Murdoch
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Teil 1
„So, geschafft!“ Zufrieden betrachtete Sophie Cochrane die Schindeln auf dem Dach.
Nie zuvor hatte sie ein Dach reparieren müssen, aber diese Tatsache reihte sich ein die lange Reihe von Dingen, die sie nie zuvor getan hatte. Seit mehr als einem Jahr jedoch fand sie sich immer wieder in der Situation, das Unmögliche zu meistern. Denn genau solange war sie Besitzerin von Spensers Lodge, einem etwas in die Jahre gekommenen Hotel am Hafen von Clydesdale an der irischen Ostküste. Ihr Vater hatte dieses Hotel mitsamt einem großzügigen Grundstück und einer ausgedehnten Hafeneinfahrt geerbt. Dann hatte er alles Geld, das er besaß und auftreiben konnte, hineingesteckt und war dann überraschend gestorben. Sophies erster Gedanke war damals gewesen, dieses unerwünschte Erbe so schnell wie möglich zu verkaufen. Auch ihre eigenen Ersparnisse steckten schon darin, und die bildhübsche rothaarige Werbegrafikerin hatte nie vorgehabt, den Beruf zu wechseln.
Doch obwohl allein das Grundstück viel Geld wert war, hatte sich bislang kein Käufer gefunden. Das mochte mit daran liegen, dass es in Spensers Lodge spukte – zumindest behaupteten das die Bewohner von Clydesdale. Sophie selbst hatte nie etwas mit einem Geist zu tun gehabt.
Gideon Spenser war ein Pirat gewesen und hatte vor mehr als 300 Jahren gelebt, aber noch immer ging sein ruheloser Geist um. So zumindest erzählten die Leute, und es war schon schwierig gewesen, jemanden zu finden, der ihr zur Hand ging, bis sie an Francis O’Donnell geraten war, dem das Gerede nichts auszumachen schien. Sophie glaubte nicht an Geister. Die öfter auftretenden Geräusche schrieb sie dem alten Gemäuer zu, zerbrochenes Geschirr wurde ihrer Meinung nach von Mäusen, Ratten oder Katzen verursacht, und der Rest musste einfach eine Sinnestäuschung sein. So hatte sie bislang argumentiert, auch wenn die freundlichen Nachbarn - Patrick Fitzmoran, Seamus Finnegan, Marylou O’Brien und all die anderen – sie vor dem Jähzorn und dem skurrilen Humor des Geistes gewarnt hatten. Mit einem nachsichtigen Lächeln war die 29jährige bislang über alle Warnungen hinweggegangen.
Jedenfalls bis vor drei Tagen. Da war sie mitten in der Nacht aufgewacht und hatte sich urplötzlich dem verleugneten Geist gegenübergesehen. Im ersten Moment hatte sie an einen Traum gedacht. Gideon Spenser sah aus wie auf dem Bild, das unten in der Schankstube hing. Hochgewachsen, breit in den Schultern, mit einem dichten roten Bart und schulterlangen Haaren, auf denen ein Dreispitz thronte. Seine Kleidung wirkte zusammengewürfelt und vernachlässigt, aber der Säbel an seiner Seite schien absolut intakt. Irritierend war jedoch der Strick, der um seinen Hals hing und am Rücken herabbaumelte.
Das alles konnte Sophie gut erkennen, obwohl die ganze Erscheinung irgendwie durchsichtig war.
Schlaftrunken rieb sich die junge Frau über die Augen, verbot sich selbst in Panik auszubrechen und tastete nach dem Lichtschalter.
„Nicht, lass das“, grollte die Bassstimme des Geistes. „Im Licht muss ich wieder verschwinden. Aber ich will, dass du mich siehst.“
„O Gott, ja, ich sehe, aber ich träume“, murmelte Sophie. Sie schrak zusammen, als Spenser die Hand ausstreckte und ihr die Bettdecke wegzog. Kälte breitete sich in seiner Umgebung aus, und sie begann zu frieren.
„He, was soll das?“, protestierte sie empört und raffte die Decke wieder an sich. „Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Und wie kommen Sie überhaupt in mein Zimmer?“
Dröhnendes Gelächter klang auf und machte ihr endgültig klar, dass sie nicht träumte.
„Stell dich nicht dümmer, als du wirklich bist, Weib. Du weißt recht gut, wer ich bin. Und was ich will, ist in wenigen Worten gesagt. Ich will, dass du Spensers Lodge nicht verkaufst. Du hast hier viel Geld und auch eine Menge Arbeit investiert. In Francis O'Donnell hast du einen fleißigen und ehrlichen Helfer gefunden, und selbst die Leute hier respektieren dich. Außerdem bist du meine leibliche Nachfahrin. Das sind Gründe genug, um hierzubleiben.“
Sophie hatte ihre Fassung wiedergefunden und versuchte, diese absurde Situation als ganz normal anzusehen. Sie saß hier mitten in der Nacht in ihrem Bett und unterhielt sich mit einem Geist. Klar, warum auch nicht? Andere Leute hatten noch ganz andere Wahnvorstellungen.
„Ich müsste ja verrückt sein, wenn ich das täte“, gab sie zurück. „Ich habe eine gute Ausbildung, einen ordentlichen Beruf und bin wahrhaft nicht dazu geboren, in einer heruntergekommenen Kneipe die Wirtin zu spielen. Ich will zurück nach Dublin und mein eigenes Leben wieder aufnehmen.“
„Quatsch, du bist Blut von meinem Blut, es steckt in dir drin. Allerdings wirst du noch ein bisschen tun müssen, um die Lodge wieder ansprechend aussehen zu lassen. Es ist eine Schande, was in den letzten Jahren, also in der Zeit vor deinem Vater, hier passiert ist.“
Sophie machte sich nichts mehr daraus, dass sie nur mit einem einfachen Pyjama bekleidet im Bett saß. Sie stand auf, stemmte die Hände in die Hüften und funkelte mit ihren wundervollen grünen Augen den Geist des Piraten an.
„Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Mr. Spenser...“
„Käpt’n Spenser, bitte, soviel Zeit muss sein.“
„Okay, Käpt’n Spenser. Ich sage es noch einmal. Diese Lodge wird nicht auf Dauer mein neues Zuhause sein. Sobald ich einen Käufer gefunden habe, werde ich drei Kreuze machen und diesen Ort voller Freude verlassen. Bis dahin muss ich das Notwendigste tun, damit mir nicht das Dach über dem Kopf zusammenfällt. Aber nicht mehr. Und kein Gespenst wird mir hier vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe – ist das klar?“
„Ganz und gar nicht“, donnerte Spenser, der nicht damit gerechnet hatte, sich mit einer jungen starrköpfigen Frau auseinandersetzen zu müssen. Er war überrumpelt von ihrer Hartnäckigkeit. Doch schon zu Lebzeiten hatte er niemals nachgegeben, wenn er seinen Willen durchsetzen wollte. Irgendwie machte ihm die Sache sogar Spaß. Sophie schlotterte nicht vor Angst, und sie gab auch nicht klein bei. Aber lange würde er sich das nicht bieten lassen.
„Ich habe deine Worte gehört, Mädchen, aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du mit dieser dummen Ansicht bei mir durchkommst. Du gehörst hierher, und alles andere ist unwichtig.“
„He, rede ich eigentlich gegen eine Wand“, fauchte Sophie. „Ein für allemal, sobald ich einen Käufer gefunden habe, bin ich weg. Ich wüsste nicht, wie ausgerechnet ein Geist mich daran hindern sollte. Aber bis dahin muss ich bleiben, weil ich nämlich kein anderes Zuhause mehr habe.“
„Das hier ist dein Zuhause.“
„Für eine begrenzte Zeit“, erwiderte sie spöttisch. „Und nun wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich allein lassen. Ich möchte nämlich noch etwas schlafen.“
„Du hast einen ganz ordentlichen Charakter, Mädchen, aber auch einen ziemlichen Dickschädel. Doch du wirst schon sehen, wer einmal hier in der Lodge zuhause ist, geht nicht wieder. Solltest du Probleme haben, gib mir Bescheid. Ich will dir gern unter die Arme greifen.“
„Sie sind ein Geist.“
„Ja, und?“
Sophie seufzte. „Das einzige Problem, das mich quält, ist das fehlende Geld, um hier alles zu reparieren, damit ich einen Käufer finden kann.“
„Wenn es weiter nichts ist“, brummte der Geist. „Geld ist genug vorhanden, und das darf nicht der Grund sein, warum du verkaufen willst. Ich habe auf dem Grundstück einen Schatz vergraben, als ich noch lebte. Das ist mehr als genug...“
„Ich nehme doch kein Geld, an dem Blut klebt“, fuhr sie auf. „Vergessen Sie es, Käpt’n. Wenn ich Ihren Ruf bedenke, sollte ich mich schon hüten, nur mit Ihnen zu reden.“
Er lachte dröhnend auf. „Heroische Worte aus dem Mund eines Weibes, das bis vor einer Viertelstunde nicht einmal an Geister glaubte. Mach dich nicht lächerlich, Mädchen. Du wirst jeden Penny brauchen, um Spensers Lodge wieder herzurichten. Sei also keine Närrin.“
„Raus jetzt hier“, forderte Sophie kühn.
Er lachte wieder auf. „Ich werde dich im Auge behalten, Sophie Cochrane. Außerdem solltest du dich darum kümmern, dass diese lächerliche Brücke zur Halbinsel hinaus nicht gebaut wird. Erstens grenzt die Straße dafür direkt an mein Land, und zweitens braucht niemand dieses Ding wirklich.“ Die bislang fast greifbar erscheinende Gestalt wurde völlig durchsichtig und verschwand ganz. „Überlege es dir gut, und gib mir Bescheid, wann du den Schatz ausgraben willst. Du musst nur meinen Namen rufen, ich werde in der Nähe sein – meistens jedenfalls.“
„Den Teufel werde ich tun“, murmelte Sophie zornig. „Ich will Ihr Blutgeld nicht“, setzte sie lautstark hinzu und ließ sich dann kopfschüttelnd wieder auf ihr Bett fallen. Hatte sie gerade tatsächlich eine Unterhaltung mit einem Geist geführt? Verrückt, total verrückt! Oder doch nicht ganz. Sie wusste zumindest, dass sie nicht träumte.
An diese Begegnung musste Sophie denken, als sie jetzt auf dem Dach stand. Eigentlich hätte das ganze Dach neu gedeckt werden müssen, aber auch dafür fehlte es am notwendigen Geld. Das wenige, das sie im Augenblick mit der Lodge und auch durch ein paar kleine Werbeaufträge verdiente, verschlang dieser Moloch mühelos. Sollte sie nicht doch das Angebot von Spenser annehmen? Um was für einen Schatz mochte es sich wohl handeln? Hatte der Pirat tatsächlich im Laufe seines Lebens Gold und Edelsteine zusammengeraubt? So viel, dass es reichen würde? Dann gehörten all diese Dinge aber doch sicher den Erben? Nur, wie wollte man nach mehr als 300 Jahren noch die Besitzer ausfindig machen? Nein, am besten blieb der Schatz einfach dort, wo er sich befand – wo auch immer das sein mochte.
Eine Bewegung drüben bei der Landzunge, die weit ins Meer ragte und nur bei Flut die Insel vom Festland trennte, erregte ihre Aufmerksamkeit.
Baumaschinen!
Alle Proteste waren also wirklich erfolglos geblieben?
Die Landzunge sollte mit einer Brücke endgültig mit der Insel verbunden werden. Bisher war der Verkehr über die kleinen Fährschiffe der Einwohner abgewickelt worden. Doch seit ein reicher Unternehmer dort ein Hotel bauen wollte, genügte diese Verbindung nicht mehr. Hätte dieser Mann denn nicht ihre Lodge kaufen können, dachte Sophie nicht zum erstenmal. Aber egal. Lord Preston hatte seine eigenen Pläne, und die riefen bei den Einwohnern von Clydesdale nicht gerade Begeisterung hervor. Niemand wollte diese Neuerung, und niemand wollte das neue Hotel. Zusätzlich zu der Brücke sollte auch die Straße verbreitert und besser angebunden werden. Unruhe würde das neue Hotel bringen, viele fremde Menschen und eine neue Art von Fortschritt, den keiner hier wollte – auch Sophie nicht. Eingaben bei der übergeordneten Baubehörde hatten nichts genutzt, und selbst ein Gespräch mit dem Abgeordneten war zwecklos gewesen.
Was blieb jetzt noch zu tun, um diese Brücke, die neue Straße und damit auch das unerwünschte neue Hotel zu verhindern?
Pat Killarney hatte den Vorschlag gemacht, mit einem Sitzstreik die Baumaßnahmen zu sabotieren. Da sich das Recht jedoch auf Seiten des Unternehmers befand, würde Constable O'Brien diese Protestler letztendlich vertreiben müssen. Eine Möglichkeit war es aber allemal. Sobald es Verzögerungen gab, stieg der Preis für die Baumaßnahmen, dann bestand eine geringe Hoffnung, dass das Vorhaben abgesagt wurde.
Sophie kletterte wieder vom Dach und stand plötzlich vor einem Fremden. Ein bewundernder Blick aus leuchtend blauen Augen traf sie, und sie spürte die sympathische Ausstrahlung des Mannes.
„Die Gastwirtschaft hat noch nicht geöffnet“, sagte sie.
„Nun, dann werde ich eben später auf ein Bier kommen. Aber wie ist das mit der Lodge als Hotel? Ist das auch geschlossen?“
Schon seit Wochen hatte es keinen Gast in den Zimmern gegeben, aber das durfte sich Sophie nicht anmerken lassen.
„Sie können selbstverständlich ein Zimmer bekommen, Mister...?"
„Marc Kennedy. Ich bin der Architekt und Bauleiter...“
Ihr Gesicht verdüsterte sich abrupt, als sie das hörte. Er spürte ihre Verstimmung.
„Stimmt etwas nicht?“
„Sie werden hier nicht sehr willkommen sein, Mr. Kennedy. Niemand hier aus dem Ort will die Brücke und die Straße.“
„Ist das auch für Sie ein Problem?“, fragte er sanft. Marc Kennedy hatte diesen Ort erst einmal besucht, als er sich für die Planung mit dem Gelände vertraut machen musste. Schon damals war ihm aufgefallen, dass hier keine große Begeisterung herrschte über diesen Neubau, der doch eigentlich Fortschritt und Wohlstand bringen sollte. Warum nur war ihm damals diese bildschöne Frau nicht aufgefallen?
„Ich habe auch ein Problem mit dem Neubau, aber das muss für Sie keine Rolle spielen. Außerdem werde ich mir in Ihrem Beisein sicher keine Gedanken darüber machen. Sie wollen ein Zimmer? Sie werden eines bekommen. Aber viel Luxus dürfen Sie nicht erwarten.“
Das war Marc völlig egal, Hauptsache, er konnte in der Nähe dieser bezaubernden jungen Frau bleiben und mehr über sie erfahren. Er war schon viel lange auf der Suche nach der Frau seines Lebens, und diese junge Lady sah aus wie die Erfüllung seiner Wunschträume.
Sophie hatte für einen Augenblick erwogen, ihm das Zimmer zu verweigern. Aber sie brauchte das Geld, da gab es kein langes Zögern.
„Francis“, rief sie so laut, dass O’Donnell im Innern es hören konnte. Gleich darauf kam der bärenstarke gutmütige Helfer heraus. „Das ist Mr. Kennedy, er bekommt das Kapitänszimmer. Bitte kümmern Sie sich um sein Gepäck und seine Anmeldung.“
„Das Kapitänszimmer?“, stieß der hochgewachsene ältere Mann hervor und bekam große Augen.
„Ja. Und Spenser soll es nicht wagen... ach, was soll's? Sie haben mich gehört, Francis? Ich habe noch zu tun.“ Sie ging zum Schuppen hinüber, in dem Werkzeug und Baumaterial aufbewahrt wurden – und in einem kleinen Anbau eine Segeljolle, mit der Sophie ab und an einen Ausflug unternahm.
Die beiden Männer blickten der schlanken Gestalt hinterher, Francis kopfschüttelnd, Kennedy bewundernd.
„Eine tolle Frau“, stellte er beeindruckt fest. „Hat sie denn keinen Mann, der ihr helfen könnte?“
„Sie hat den Kapitän, der muss schon reichen“, erklärte der Hausdiener rätselhaft und ging mit schweren Schritten voran.
*
„Wie kannst du es wagen, einen wildfremden Menschen in meinem Zimmer einzuquartieren?“, fragte Käpt’n Spenser dröhnend, so dass Sophie aus dem leichten Schlaf erwachte, in den sie gerade erst gefallen war.
„Und wie können Sie es wagen, sich schon wieder ungefragt in meine wohlverdiente Nachtruhe einzudrängen?“, knurrte sie schlaftrunken.
„Ich gehe, wohin ich will und wann ich will.“
„Na fein, dann tu ich, was ich will und wie ich es will. Das Kapitänszimmer ist das einzige, das noch so gut in Ordnung ist, dass ich dafür einen ordentlichen Preis verlangen kann. Wenn Ihnen das nicht passt, ist mir das auch egal. Verschwinden Sie, ich will endlich schlafen.“
„Du weißt, wer dieser Mann ist? Er baut die neue Brücke. Er wird das Land verwüsten und keine Rücksicht nehmen auf die Menschen, die hier seit Jahrhunderten wohnen.“
„Dann passen Sie beide ja hervorragend zusammen. Sie nehmen schließlich auch keine Rücksicht. Der Mann macht seine Arbeit. Wenn nicht er, dann ein anderer, im Prinzip macht das keinen großen Unterschied.“
„Du bist ganz schön halsstarrig. Warum nimmst du mein Angebot nicht an? Du wärst nicht darauf angewiesen, solche Leute aufzunehmen.“
„Ich werde kein Blutgeld anfassen.“
„Der Tag wird kommen, an dem du anders darüber denkst.“ Der Kapitän verschwand, und Sophie knuffte wütend ihr Kopfkissen. Warum musste ausgerechnet sie mit einem Geist gestraft sein, der sich so aufdringlich in ihr Leben mischte? Sie hatte genug damit zu tun, um ihr tägliches Leben zu kämpfen, da brauchte sie das real gewordene Gespenst nicht auch noch. Zur Hölle mit dem Kapitän, wo er vermutlich auch hingehörte. Die junge Frau kuschelte sich in ihre Decken, schloss die Augen und versuchte wieder einzuschlafen, was jedoch gar nicht so einfach war.
Gideon Spenser hingegen hatte noch längst nicht vor sich zurückzuziehen. Er tauchte unvermittelt in seinem Zimmer auf - dem Kapitänszimmer, in dem Marc Kennedy über seinem Laptop brütete. Er bemerkte die Anwesenheit des Geistes zunächst gar nicht. Doch plötzlich blickte er auf und sah die wilde bärtige Gestalt vor sich stehen. Erschreckt sprang er auf, nestelte aus seiner Hosentasche ein Taschenmesser hervor und versuchte die Klinge aufzuklappen. Dröhnendes Gelächter ließ ihn zusammenzucken.
„Was willst du denn mit diesem Spielzeug, Junge? Wenn du wirklich kämpfen möchtest, empfehle ich dir einen ordentlichen Säbel.“ Mit einem leisen Zischen glitt die scharfe Klinge aus der Scheide.
Marc fühlte sein Herz bis zum Halse schlagen. Das Taschenmesser fiel aus seiner Hand, und er wurde kreidebleich.
„Ich habe nicht vor zu kämpfen, Sir“, sagte er leise. „Aber ich wäre Ihnen doch sehr verbunden, wenn Sie mir sagen, wie Sie in mein Zimmer kommen und was Sie von mir wollen?“
„Dein Zimmer?“, lachte Spenser. „Mein Junge, dies hier war schon mein Zimmer, bevor deine Ururururgroßmutter geboren wurde.“
„Wie soll ich das verstehen?“
„Bist du taub oder dumm?“, grollte der Kapitän. „Na gut, zum mitschreiben für Minderbemittelte. Ich bin Kapitän Gideon Spenser, oder vielmehr das, was seit ein paar Jahrhunderten von ihm übrig ist und hier herumspukt. Es liegt mir eine Menge daran, Spensers Lodge zu erhalten, was die kleine Sophie aber auch noch nicht erkannt hat. Um dieses Ziel erreichen, bin ich bereit, eine Menge zu tun.“
„Sie sind also ein Geist?“, fragte Marc völlig entgeistert.
„Bei Neptuns Bart, ist das wirklich so schwer zu begreifen?“
„Verzeihung, Sir, aber ich hatte noch nie mit einem Gespenst zu tun.“ In diesem Augenblick huschten einige Bilder über den Monitor des Laptops, und eine weibliche Stimme verkündete: „Sie haben Post.“
Es war bemerkenswert den Piraten zu beobachten. Er zuckte sichtbar zusammen, schaute sich wild im Raum um, als wollte er sich im nächsten Moment auf einen imaginären Angreifer stürzen, und hielt dann verblüfft inne.
„Das war nur mein Computer“, versuchte Marc zu erklären, erntete jedoch nur einen wilden aggressiven Blick.
„Hier ist niemand. Und du willst mir erzählen, du hast noch nie mit den Geistern zu tun gehabt? Wer ist es, der hier sonst noch herumspukt?“
„Das ist ein Computer, ein technisches Gerät. Haben Sie noch nie erlebt, dass ein Telefon klingelt und jemand am anderen Ende spricht?“
„Telefon? Dieses abscheuliche Ding, in das Sophie hineinredet, ohne dass jemand antwortet?“
Auf dem Gesicht des jungen Mannes erschien ein Lächeln. Er begann widerwillig die Tatsache zu akzeptieren, dass er hier einem Geist gegenüberstand, so verrückt das auch sein mochte. „So etwas ähnliches. Sie müssen keine Angst vor der Technik...“
„Gideon Spenser hat vor nichts und niemand Angst“, donnerte der Kapitän.
„Ja, gut, ich verstehe, so habe ich das auch nicht gemeint. Doch die Welt hat sich weiterentwickelt in der Zeit, seit Sie - nun ja - tot sind. Aber was wollen Sie nun von mir?“ Marc entspannte sich ein wenig.
„Ich will, dass dieser ganze Unsinn aufhört. Dieses neue Hotel, die Straße und die Brücke. Überflüssiger Mumpitz ist das.“
„Und Sie glauben, ich könnte den Bau verhindern? Nein, ganz bestimmt nicht“, erklärte der Architekt mit Entschiedenheit.
„Aber du bist der Bauherr.“
„Nein, ich bin der Bauleiter und Architekt. Der Bauherr hat mich beauftragt. Und glauben Sie mir, sollte ich mich weigern, wird schon einen Tag später jemand anders meine Stelle einnehmen. Dieses Bauvorhaben ist nicht zu verhindern.“
Der Pirat wurde nachdenklich. „Ist das wirklich so? Dann werde ich einen anderen Weg finden müssen, um Sophie zu helfen, die Lodge zu erhalten.“
„Ich bin erstaunt, Mr. Spenser...“
„Käpt’n.“
„Käpt’n Spenser. Wenn ich Miss Cochrane richtig verstanden habe, dann will sie Spensers Lodge verkaufen. Warum sollte sie es erhalten wollen?“
„Unsinn, das Mädchen weiß nur noch nicht, was gut für sie ist. Sie wird selbstverständlich hierbleiben.“
„Die junge Lady machte auf mich einen energischen und selbstbewussten Eindruck. Ich glaube nicht, dass sie Ihrer Ansicht folgen wird.“
Spenser starrte den jungen Mann nachdenklich an. „Da hast du nicht ganz unrecht, sie ist ziemlich halsstarrig. Aber ein Weib wird immer dann vernünftig, wenn der richtige Mann kommt. Sie tut also gut daran, möglichst schnell zu heiraten. Du hast nicht zufällig Interesse an ihr?“
Das verschlug Marc nun doch die Sprache. Er hatte nichts dagegen, die schöne Frau näher kennenzulernen. Aber dieses direkte Verkuppeln gefiel ihm nun ganz und gar nicht.
„Ich finde Miss Cochrane ausgesprochen anziehend, doch Gefühle müssen auf Gegenseitigkeit beruhen.“
„Quatsch! Sophie ist ein prachtvolles Mädchen, aber sie weiß absolut nicht, was sie wirklich will. Heiratete sie, und ich werde dafür sorgen, dass es euch beiden niemals an Geld mangelt.“
„Sie sind ausgesprochen großzügig, Käpt’n. Aber ich möchte gerne noch darüber nachdenken. Und selbstverständlich ist es mir auch wichtig, dass Miss Sophie...“
„Sie ist eine Frau, du legst doch nicht wirklich Wert auf ihre Meinung?“ Spenser machte eine wegwerfende Handbewegung, und Marc lachte auf.
„Die Zeiten haben sich in der Tat geändert. Auch Frauen dürfen eine Meinung haben“, bemerkte er süffisant.
„Das lassen wir besser im Raum stehen. Sage mir lieber, was du gegen den Bau zu tun gedenkst.“
„Wie bitte? Käpt’n, ich habe Ihnen gerade schon erklärt, dass ich nur der Bauleiter bin. Es ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass alles so schnell wie möglich fertig ist.“
„Du nimmst deinen Auftrag sehr ernst, mein Junge.“
„Natürlich. Oder muss ich ausgerechnet einem Kapitän erklären, was Loyalität bedeutet?“
„Nein. Aber gut zu wissen, wie du denkst. Ich werde schon noch andere Wege finden. Ach ja, du solltest vielleicht besser niemandem erzählen, dass ich dich besucht habe.“
„Das würde mir ohnehin niemand glauben“, gab Marc lakonisch zurück. „Ich gelte als nüchtern und praktisch. Ein Geist passt nicht mir. - Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?“
Spenser lachte noch einmal auf. „Du machst mir Spaß, Junge. Vielleicht besuche ich dich bald mal wieder. Kümmere dich um Sophie, sie ist es, verdammt noch mal, wert.“
Das hatte Marc auch schon festgestellt, auch wenn er nicht unbedingt derart handfeste Worte benutzen würde, um seine Meinung auszudrücken.
Draußen heulte unvermittelt ein Windstoß um das Haus, gefolgt von einem heftigen Donnerschlag.
„Das Wetter ist auch gegen dich, Junge. Halte die Ohren steif.“ Die Gestalt flimmerte und verschwand. Marc ließ sich wieder auf seinen Stuhl sinken und atmete tief durch. Er ließ die letzten Minuten noch einmal Revue passieren und schüttelte schließlich den Kopf. In seiner Fantasie hatte er in der Kindheit öfter davon geträumt, mit einer wunderschönen Geisterfrau Abenteuer zu erleben und sie schließlich zu erlösen. Das war aber lange her, und im Laufe der Zeit hatte er natürlich über diese kindischen Einfälle gelacht. Doch Kapitän Gideon Spenser erschien durchaus real und nicht zum Lachen. Real? Nun ja, nicht wirklich. Himmel, es war total verrückt! Aber was er über Sophie Cochrane gesagt hatte, war nicht wirklich falsch. Die schöne junge Frau hatte schon auf den ersten Blick das Interesse des Architekten geweckt. Aber sie war in der Tat eine selbstbewusste energische Lady, die ihren eigenen Kopf besaß. Trotzdem, wäre es denn nicht schön, diese Frau an seiner Seite haben?
Mit diesen durchaus angenehmen Gedanken ging Marc endlich zu Bett und verfiel in wirre Träume.
Der folgende Morgen brachte tatsächlich schlechtes Wetter. Regen peitschte um das Haus, Wind heulte durch die Ritzen, und im großen Kamin in der Schankstube flackerte das Feuer unruhig.
Francis und Sophie waren längst auf den Beinen. Neben Marc gab es noch zwei weitere Gäste, ebenfalls Bauarbeiter, die sich vom Bauleiter aber betont fernhielten. Es handelte sich um Vorarbeiter, einfache derbe Männer, die sich mit dem klugen Architekten nicht auf eine Stufe stellen wollten, obwohl er keine Anstalten zeigte, eine Kluft zwischen sich und diesen Männern aufzubauen. Ein respektvoller flüchtiger Gruß, mehr gab als zwischen ihnen nicht.
Als Sophie Marc Kennedy sah, glitt ein fröhliches Strahlen auf ihr Gesicht, und trotz des ungemütlichen Wetters schien die Sonne aufzugehen. Die Frau stellte ihm das Tablett mit dem Frühstück auf den Tisch.
„Falls Sie noch etwas benötigen, dann wenden Sie sich bitte an Francis. Ich bin gleich weg.“
„Müssen Sie zu einer Verabredung?“, erkundigte er sich mutig.
Erstaunen spiegelte sich in ihren Augen. „Ja, wissen Sie es denn nicht? Heute ist eine Demonstration angesagt gegen den Bau. Und da werde ich natürlich dabei sein.“
„Eine Demonstration?“, fragte er verwundert. „Aber es ist doch schon lange beschlossene Sache, dass gebaut wird. Warum – wieso jetzt...?“
„Sie wollen wissen, warum wir jetzt demonstrieren? Weil man unsere Proteste vorher nicht ernst genommen hat. Weil man einfach über unseren Kopf hinweg entschieden hat. Auch wenn ich nicht vorhabe auf Dauer hier zu bleiben, so liegen mir doch die Menschen und auch Spensers Lodge am Herzen. Da werde ich doch jetzt weder die einen noch das andere im Stich lassen.“
Er griff blitzschnell nach ihrem Arm. „Sie werden mit Ihren Protesten nichts erreichen, Miss Cochrane. Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass die Bauarbeiter Ihre Demonstration nicht gerade freundlich aufnehmen werden.“
„Das ist mir egal - und den übrigen Bewohnern von Clydesdale auch. Niemand hat uns nach unserer Meinung gefragt. Hier wurde einfach von oben her etwas beschlossen. Das lassen wir uns nicht bieten.“
„Warum protestieren Sie dann nicht in der Stadt vor dem zuständigen Bauamt? Falls überhaupt, dann kann man dort etwas für Sie tun.“
„Ja, denken Sie denn, wir hätten das noch nicht probiert? Wir leben hier zwar auf dem Land, aber dumm sind wir deswegen noch lange nicht, Mr. Kennedy. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.“ Sie machte sich mit einem Ruck los und funkelte ihn an. Er sah das wunderbare Grün in ihren Augen, das ihn an die saftigen Weiden in seinem Landstrich erinnerte, und er hätte Sophie am liebsten in den Arme genommen. Aber dazu war es noch viel zu früh.
Die schöne junge Frau lief davon, und Marc blickte ihr wieder bewundernd hinterher. Es würde ein hartes Stück Arbeit werden, ihr Herz zu erobern, doch er hoffte, dieses Ziel eines Tages zu erreichen. In aller Ruhe beendete er sein Frühstück und dachte dabei noch einmal über die nächtliche Erscheinung nach.
Gideon Spenser!
Marc war weit davon entfernt, an Halluzinationen zu glauben, doch auch in die Existenz von den Geistern war absolut irreal. Solange es aber keine andere Erklärung gab, musste er das Gespenst als Tatsache hinnehmen. Er verdrängte die Gedanken daran, ebenso wie die an Sophie und begann sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Heute würden die ersten Erdarbeiten beginnen, und für den Nachmittag war ein Pressetermin mit dem Bauherrn vorgesehen. Marc ahnte nichts Gutes. Sollte der Protest der Dorfbewohner bis dahin nicht beendet sein, wäre das ein gefundenes Fressen für die Medien. Und er hatte nicht die geringste Lust im Brennpunkt der Öffentlichkeit zu stehen - jedenfalls nicht auf diese Art. Er wünschte sich, er könnte den Termin für den Nachmittag absagen. Aber das erschien völlig unmöglich. Lord Preston gehörte zu den Kunden, die darauf beharrten, dass jeder Buchstabe des geschlossenen Vertrages eingehalten wurde. Und die Presse gehörte nun einmal dazu.
Als Marc auf der Baustelle ankam, die bereits durch einen Drahtgitterzaun abgesperrt war, lief der erste Vorarbeiter sichtlich nervös und aufgebracht auf ihn zu. Henry Simpson gehörte zu den Leuten, die allein durch ihre Erfahrung Ruhe in die Hektik einer Großbaustelle bringen konnten. Hier war er aber scheinbar überfordert.
„Die Leute aus Clydesdale blockieren den Weg“, berichtete er. „Wir können jetzt nicht mit dem schweren Gerät anfangen, dann gibt es Verletzte.“
„Die Leute werden schon beiseite gehen, die sind doch nicht verrückt“, gab Marc zu bedenken.
Der ältere gutmütige Mann kratzte sich am Kopf. „Verrückt vielleicht nicht, aber zu allem entschlossen.“
Kennedy seufzte. „Versuchen Sie es trotzdem, Henry. Und beten Sie, dass nichts weiter geschieht. Aber ich werde versuchen mit den Einwohnern zu reden.“
Henry Simpson atmete erleichtert auf. Er stammte selbst aus einem kleinen Ort und wusste um in die Beharrlichkeit der Menschen, wenn etwas Altvertrautes verändert oder gar zerstört werden sollte.
Marc legte seine Unterlagen auf den Tisch und ging aus dem Bauwagen hinaus, in dem das Gespräch stattgefunden hatte. Der Wind peitschte ihm den Regen von der See her ins Gesicht, er fühlte die salzige Luft auf den Lippen.
Die Einwohner von Clydesdale hatten sich fast vollständig versammelt, und sie bildeten eine beachtliche Gruppe. Ganz vorne stand Sophie Cochrane inmitten von Männern mit wettergegerbten Gesichtern, Frauen in dunkler abgetragener Kleidung und Kindern, für die das Ganze wohl eher ein Abenteuer war.
Ein Mann trat vor, in seinem Blick lagen Verachtung und kalte Wut. „Sie werden hier nicht bauen“, sagte er.
Marc holte tief Luft und wappnete sich mit viel Geduld. „Sie werden den Bau auch nicht mit diesem Protest verhindern, Sir. Ich muss Sie bitten, sich sofort zu entfernen, sonst...“
„ Sonst was?“, grollte der Mann. „Lassen Sie Ihre Maschinen dann über uns hinweg rollen?“
„Nein, Sir. Aber ich werde dann die Polizei rufen müssen, und die wird Ihnen eine Menge Probleme machen. Ist es wirklich das, was Sie wollen, Sir? Das hat doch keinen Zweck. Gehen Sie nach Hause, Sir, und nehmen Sie die Tatsachen zur Kenntnis.“
„Den Teufel werde ich tun.“ Wie eine Mauer standen die Menschen da, und Marc fühlte ihre Abneigung wie eine körperliche Berührung. Ein kalter Hauch strich über seinen Nacken.
„Und was willst du jetzt tun, Junge?“ Gideon Spenser, der Pirat, befand sich hier draußen, und seiner bissigen Stimme, die nur für Marc hörbar war, merkte man an, wie sehr er sich amüsierte. Der Architekt bekam einen Schreck. Was machte der Geist hier? Offenbar war ihm nicht nur möglich, auch tagsüber aktiv zu sein, sondern auch seinen angestammten Platz zu verlassen. Unglaublich!
Trotzdem wollte sich der Architekt jetzt nicht mit Spenser beschäftigen, auch wenn ihn das leise Gelächter störte, das gerade an seinen Ohren erklang. Er stand noch immer diesem äußerst aggressiven Dorfbewohner gegenüber und wusste nicht so recht, wie er sich nun verhalten sollte. Er fing einen Blick von Sophie auf. Spott lag darin, und das konnte er gar nicht ertragen. Nicht von der Frau, die er seit dem ersten Blick liebte. Unwillkürlich straffte er seinen Rücken.
„Sagen Sie mir Ihren Namen, Sir?“
„Angus O’Leary“, kam es stolz zurück. „Meine Familie lebt seit mehr als sechs Generationen hier. Und ich will verdammt sein, wenn ich es zulasse, dass ein junger Schnösel aus dem Nichts kommt und mein gewohntes Zuhause in das Chaos stürzt.“
Wieder erklang das amüsierte Gelächter von Spenser, unhörbar für die anderen. Aber nun hatte O’Leary den Stolz von Kennedy getroffen. Angriffslustig reckte er sein Kinn.
„Ich, Sir, stamme nicht aus dem Nichts. Meine Heimat sind die saftigen Wiesen und sanften Hügel rund um Sligo“, erwiderte Marc stolz und bekam plötzlich einen Blick von Sophie, in dem Anerkennung lag.
„Wenigstens kennt er seine Heimat“, sagte O’Leary zu den Umstehenden. „Aber das ändert nichts daran, dass unsere Heimat ist. Und die lassen wir uns nicht zerstören.“
„Mr. O’Leary, ich verstehe Ihre Aufregung. Aber hier liegen alle behördlichen Genehmigungen vor. Wir haben das Recht die Bauarbeiten beginnen, und genau das werden wir auch.“ Der Mann war Marc unsympathisch, rein aus einem Gefühl heraus. Aber er trug hier die Verantwortung, also musste er sich auch mit solchen Leuten auseinandersetzen.
Angus O’Leary schüttelte dicht vor Marcs Gesicht die Faust. „Nicht, solange ich es verhindern kann.“
Der Architekt wich nicht zurück, er durfte und wollte keine Schwäche zeigen.
„Dann tut es mir leid, Sir.“ In aller Seelenruhe griff Marc nach seinem Handy und wählte die Nummer der Polizei. O’Leary konnte nicht mehr an sich halten. Seine geballte Faust schoss vor und traf den jungen Mann mitten ins Gesicht. Benommen stand Marc etwas taumelnd da, doch dann flammte auch in seinen Augen unbändiger Zorn auf.
„Henry, rufen Sie die Polizei“, brüllte er seinem Vorarbeiter zu, dann schlug er zurück.
„Bravo, mein Junge. Lass dir nur nichts gefallen“, dröhnte die Stimme von Spenser in seinem Ohr. Gleich darauf gab es ein wüstes Durcheinander, bei dem die Dorfbewohner und die Bauarbeiter aufeinander losgingen.
Marc stand irgendwann mit hämmerndem Schädel völlig hilflos an der Seite und betrachtete die Prügelei voller Entsetzen. Wie hatte er sich nur so hinreißen lassen können? Inmitten des Getümmels war nicht mehr zu unterscheiden, wer gegen wen kämpfte.
„Das hast du wirklich gut hingekriegt, Junge“, lobte der Pirat sarkastisch. „Eine richtig gute Schlägerei war schon lange mal fällig. Sowas bereinigt die Luft.“
„Sie sind ja verrückt. Verschwinden Sie!“
„Um mir den ganzen Spaß entgehen zu lassen? Nein, ganz bestimmt nicht.“
In diesem Augenblick hielt ein Wagen der Polizeiwache, und drei Beamte sprangen heraus. Doch angesichts der entfesselten Übermacht waren ihre Bemühungen den Streit zu schlichten zunächst zwecklos. Lautes Pfeifen gellte schließlich durch die Luft, kräftige Fäuste zerrten die Prügelnden auseinander, doch nun mischten sich auch die Frauen ein, um die Männer zu trennen. Obwohl sich das Gewimmel langsam auflöste, wurde Marc noch einmal heftig von einem Stein getroffen, der aus einer dichten Gruppe herausgeworfen wurde. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen, etwas benommen wischte er sich durch das Gesicht und bemerkte mit Erstaunen Blut an seinen Fingern.
„Einen Arzt und einen Krankenwagen, schnell“, brüllte einer der Constabler, als er die heftig blutende Verletzung bemerkte. Auch einige andere Leute hatten größere und kleinere Blessuren, der Doktor würde einiges zu tun haben. Aber Marc winkte ab.
„Nicht nötig“, ertönte nun plötzlich eine tiefe Bassstimme. „Wir brauchen keinen Krankenwagen, so schlimm ist es nicht. Ich bin Arzt und kümmere mich darum.“
„In Ordnung, Doktor.“
Es war den Polizisten endlich gelungen die Streithähne zu trennen und in zwei Gruppen auseinander zu bringen. Dazwischen liefen die Frauen und Kinder aufgeregt umher, bis ein gellender Schrei die ganze Szene erstarren ließ.
„Da liegt Angus, und er rührt sich nicht. Der ist tot.“
*
Jeglicher Streit war für den Augenblick beendet. Die Polizisten besaßen genug Verstand und Autorität, um den gesamten Bereich erst einmal abzusperren und alle Anwesenden als Zeugen in Spensers Lodge zu verfrachten. Der Chef der hiesigen Wache sorgte auch dafür, dass der geplante Pressetermin am Nachmittag abgesagt wurde, indem er die Bauarbeiten kurzerhand für nicht angefangen erklärte. Die Reporter hatten ohnehin keine große Lust gehabt nach Clydesdale zu kommen, dieser Termin war ihnen äußerst unwichtig erschienen. Daher gab es nur wenige Reporter, die sich überhaupt eingefunden hatten.
In der Lodge waren nun fast alle Einwohner anwesend, und der Schankraum war völlig überfüllt. Aber niemand machte Anstalten sich zu entfernen. Endlich passierte hier einmal etwas, und niemand wollte auch nur einen Augenblick davon versäumen. Außerdem hatte es einen der ihren getroffen, mochte man O’Leary nun gern gehabt haben oder nicht. Die Polizisten kannten die meisten Leute hier, doch es war wichtig, von jedem einzelnen die Personalien aufzunehmen; dazu gehörten natürlich auch die Bauarbeiter, die eigentlich draußen auf dem Gelände in Containern wohnten. Auch sie hatten sich hier versammelt und vertrugen sich plötzlich recht gut mit den Einwohnern, was darauf hindeutete, dass es sich um keine persönliche Angelegenheit handelte.
Da hier ein Gewaltverbrechen geschehen war, musste sich die hiesige Abteilung von Scotland Yard darum kümmern. Ein missgelaunter Chief-Inspector tauchte auch schon kurz darauf auf, musterte ungläubig die Menschenansammlung und ließ sich dann auf einen Stuhl sinken.
Sophie hatte die Vorfälle mit Entsetzen und Angst miterlebt. Wie hatte die Situation nur so eskalieren können? Natürlich hätte Angus in keinem Fall handgreiflich werden dürfen, aber auch Marc hätte nicht einfach zurückschlagen sollen. Und dann? Lieber Himmel, plötzlich hatte jeder auf jeden eingeschlagen.
Die Leute drängten sich jetzt hier weiterhin zusammen, eigentlich war gar nicht genug Platz für alle, aber das sah nun auch die Polizei ein. Die Beamten beeilten sich die Personalien festzustellen und schickten die Leute dann erst einmal nach Hause. Schließlich befanden sich nur noch die Bauarbeiter, Sophie, Marc und der Chief-Inspector mit seinen Leuten hier.
Der Kriminalbeamte schaute die Arbeiter nachdenklich an. „Gehen Sie an ihre Arbeit. Jeder von Ihnen ist doch sicherlich hier registriert? Meine Leute werden jeden einzelnen von Ihnen noch befragen. Wir brauchen möglichst genaue Aussagen.“
Chief-Inspector Dominic Clarke wusste recht gut, was ihm und seinen Mitarbeitern bevorstand. Zeugenaussagen waren nur selten wirklich wertvoll, denn jeder glaubte, etwas anderes gesehen zu haben. Es glich einem Puzzlespiel, diejenigen herauszufiltern, deren Beobachtung wirklich wertvoll und wichtig war. Er hoffte nur, dass wenigstens zwei Leute das Gleiche gesehen hatten, dann würde die Arbeit sicher leichter werden. Aber halt, einen Anhaltspunkt besaß er bereits. Wie der Constable ihm berichtet hatte, war direkt vor dem Ausbruch ein Streit zwischen dem Toten und diesem Architekten vorausgegangen. Vielleicht war die Wut mit dem jungen Mann durchgegangen?
Clarke überflog die ersten Notizen und wandte sich an Marc, der geschockt in einer Ecke saß.
„Fangen wir gleich bei Ihnen an“, verkündete der Polizist. Sophie warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. Er wollte doch nicht wirklich Marc Kennedy verdächtigen? Der würde nicht einmal im Zorn jemandem etwas Ernstes antun können. Er schämte sich schon jetzt zutiefst für seinen Ausbruch. Aber Clarke schien anderer Meinung. Seine Fragen kamen knapp und scharf, und Marc wirkte völlig verwirrt.
Nein, er hatte nach der ersten kurzen Handgreiflichkeit nichts weiter bemerkt. Und durch den Treffer mit dem Stein war er so benommen gewesen, dass ihm auch nichts aufgefallen war, was jetzt weiter helfen könnte.
„Das werden wir ärztlich überprüfen lassen“, brummte Clarke. „Sie behaupten also, dass Sie den Toten nicht mehr gesehen und ihn auch nicht mehr angegriffen haben?“
Marc fuhr empört auf, als er begriff, was der Inspektor ihm gerade unterstellte. Stöhnend sank er zurück und griff sich an den Kopf. Aber nun hatte Sophie genug.
„Der Mann ist verletzt, sehen Sie das nicht? Er hat den armen alten Angus bestimmt nicht umgebracht. Das Ganze war sicherlich nicht mehr als ein Unglücksfall. Ich weiß gar nicht, wie Sie überhaupt auf einen Mord kommen“, fauchte sie.
Clarke wandte sich langsam um. „Zu Ihnen komme ich später, Miss Cochrane. Sie müssen es schon mir überlassen, wie ich meine Befragungen durchführe. Und dass Angus O’Leary umgebracht wurde, steht einwandfrei fest. Man holt sich nicht durch einen puren Zufall einen Messerstich mitten ins Herz.“
„Aber ich besitze doch nur ein kleines Taschenmesser, damit kann man niemanden töten“, beteuerte Marc verzweifelt.
„Die Mordwaffe muss ihnen ja schließlich nicht gehören“, kam die lakonische Antwort.
„Aber das ist doch Unsinn. Warum sollte ich...?“ Marc brach ab und schaute hilfesuchend zu Sophie. Schon fast demonstrativ trat sie neben ihn und funkelte den Polizisten an.
„Ich würde vorschlagen, Sir, dass Sie erst einmal die anderen Zeugen befragen, bevor Sie derart voreilig Verdächtigungen aussprechen.“
„Sie müssen mir nun wirklich nicht erklären, wie ich meine Arbeit zu tun habe“, erwiderte er mürrisch.
„So war das auch nicht gemeint, Sir“, sagte sie rasch. „Aber Sie sollten bei Ihren Nachforschungen überdenken, dass Angus bei niemandem im Ort besonders beliebt war. Ich will nun nicht behaupten, dass überhaupt einer von uns etwas so Schreckliches getan haben könnte. Aber es könnte sich doch trotzdem um ein schreckliches Unglück handeln.“
„Ihre Ansicht in allen Ehren, junge Lady, aber ich habe in meinem langen Berufsleben gelernt, dass es so etwas wie Zufälle nur äußerst selten gibt, wenn eine Waffe im Spiel ist.“
„Wahrscheinlich müssen sie so zynisch denken, Chief-Inspector. Halten Sie sich trotzdem auch an etwas anderes.“
Er musste widerwillig die Beharrlichkeit der jungen Frau bewundern. „Ich werfe selbstverständlich keine Möglichkeit außer Acht lassen, Miss Cochrane.“ Er sah ein, dass er hier im Augenblick nicht weiterkam, und er musste sich in der Tat auch noch um die anderen Zeugen kümmern.
„Kann ich davon ausgehen, dass Sie Clydesdale nicht verlassen?“, fragte er schroff an Marc gewandt.
Der wirkte resigniert und nickte. „Ich habe hier meine Arbeit, und die werde ich ganz bestimmt nicht im Stich lassen.“
Der Polizist ging hinaus, und die beiden jungen Menschen blieben zurück. Marc starrte vor sich auf die Tischplatte, während seine Hände nervös mit einem Bierdeckel spielten.
„Danke, Miss Sophie. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie meine Unschuld so vehement verteidigen. Schließlich gibt es keinen Beweis dafür. Aber nochmals - vielen Dank.“
Sie lachte kurz und freudlos auf. „Ich nehme es als Beweis Ihrer Unschuld, dass sie kein Blut an den Händen haben - jedenfalls keines, das nicht von Ihnen selbst stammt. Auch wenn das vielleicht etwas blauäugig scheint. Aber dieser Inspector ist manchmal ein Dummkopf. Ich habe gesehen, wie Sie sich selbst ihre Wunden abgewischt haben. Jemand, der einen anderen mit dem Messer tötet, hat Blutspritzer an der Kleidung und sieht aus wie ein Schlachter. Schauen Sie sich nur selbst an.“
Er verzog den Mund zu einem halbherzigen Lächeln. „Das ist eine kühne Argumentation, Miss Cochrane - Sophie. Unter Umständen hat der Täter gar keine Spuren vorzuweisen. Warum also glauben Sie an meine Unschuld? Sie haben doch gar keinen Grund, mir freundlich gesonnen zu sein.“
„Ich kann es nun einmal nicht leiden, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Und nun sollten Sie sich waschen und etwas ausruhen. Für einen Tag war das mehr als genug Aufregung, finden Sie nicht? Später bringe ich Ihnen das Essen auf Ihr Zimmer.“
Diese Fürsorge trat Marc gut, und er hätte Sophie gern in die Arme genommen, aber er war sich nicht sicher, wie sie eine solche Vertraulichkeit aufnehmen würde. Also reichte er ihr nur die Hand, ohne zu ahnen, dass auch sie sich nach einer Umarmung von ihm sehnte.
„Du bist ein Trottel, Junge. Willst du diese Gelegenheit wirklich ungenutzt verstreichen lassen?“, klang die Stimme von Spenser an seinen Ohren.
„Halten Sie endlich den Mund“, knurrte Marc.
„Wie bitte?“, fragte Sophie irritiert.
„Ach, verzeihen Sie. Ich habe nicht Sie gemeint, meine innere Stimme redet mit mir.“
Sophie schüttelte den Kopf. „Ich glaube, Sie haben ganz gehörig was auf den Kopf bekommen. Nun gehen Sie schon auf Ihr Zimmer.“
Marc hatte mittlerweile gar keinen anderen Wunsch mehr. Wenn ihn jetzt auch noch der Pirat in Ruhe ließe, ginge es ihm fast gut. Er schleppte sich in sein Zimmer und ließ sich schwer in einen Sessel fallen. Dann führte er ein äußerst unangenehmes Gespräch mit seinem Auftraggeber und fühlte sich danach womöglich noch elender. Außerdem störte ihn noch etwas. Seine Kleidung war verschmutzt und roch unangenehm. Das Blut aus seiner Kopfwunde hatte sein Gesicht und seine Hände verschmiert. Aber er war, verdammt noch mal, sicher, dass er niemanden mit einem Messer umgebracht hatte.
„Du bist wirklich ein ziemlicher Dummkopf, Junge. An deiner Stelle hätte ich die kleine Sophie längst in den Armen gehalten.“
„Deswegen sind Sie ein Pirat, und ich bin ein ehrbarer Bürger. Den Rest lassen Sie mal ruhig meine Sorge sein. Im Übrigen hasse ich es, Junge genannt zu werden. Mein Name ist Marc.“
„Oho, haben wir hier etwa ein kleines Sensibelchen?“, lachte Spenser.
„Nennen Sie es, wie Sie wollen. Lassen Sie mich jetzt einfach allein. Ich empfinde Ihre Anwesenheit im Augenblick mehr als störend.“
Noch einmal klang das dröhnende Gelächter des Geistes auf, dann fühlte sich Marc tatsächlich allein. Spenser war also wirklich verschwunden. Ein Klopfen an der Tür zeigte an, dass Sophie ihm etwas zu essen brachte. Er ging ins Bad und rief über die Schulter: „Stellen Sie bitte alles auf dem Tisch ab.“
„Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Marc? Das war bis jetzt ein ziemlich aufregender Tag. Ich würde Ihnen so gerne helfen.“
Kennedy blickte über die Schulter und sah die junge Frau irgendwie verloren dastehen. Unbeholfen machte er einen Schritt auf sie zu und blieb dann wieder stehen. Er kam schließlich mutig in den Raum und streckte die Hand aus. „Sie haben schon so viel für mich getan, Sophie. Das kann ich kaum wieder gutmachen.“
„Aber nicht doch, das war doch nichts“, murmelte sie.
Keiner von beiden hätte zu sagen gewusst, wie es geschah, doch plötzlich lagen sie sich in den Armen und küssten sich wie Ertrinkende. Marcs Herz schlug wie rasend. Er spürte den schlanken Körper in seinen Armen und wollte ihn am liebsten nie wieder loslassen.
Sophie roch den herben männlichen Duft, spürte die kräftigen Muskeln und sehnte sich nach mehr. Doch Marc blieb vernünftig. Er ahnte, dass dieser Augenblick nicht der richtige war, um mehr als einen Kuss zuzulassen. Bedauernd löste er sich von ihren wunderbaren Lippen und zog sich etwas zurück.
„Entschuldigen Sie bitte, das war ungehörig von mir.“ Rasch ging er ins Bad, um nicht sehen zu müssen, dass sie ihn ärgerlich anschaute. Aber in ihrem Blick lag Sehnsucht, doch sie schwieg, ebenfalls aus Angst ihn zu verletzen.
„Wenn Sie noch einen Wunsch haben, melden Sie sich bitte“, sagte sie spröde und ging hinaus.
„Du bist wirklich ein gottverdammter Trottel, der Kapitän hat recht“, beschimpfte Marc sich selbst und drehte das kalte Wasser an der Dusche auf.
*
Der Wind heulte auch weiterhin um das Haus, peitschte die See auf und ließ die losen Dachpfannen auf Spensers Lodge unruhig klappern. Einer der Fensterläden hing nicht fest in seinem Scharnier und gab immer wieder ächzende Geräusche von sich, wenn der Sturm dagegen drückte. Im Kamin staubte die Asche hoch auf, und die glimmenden Torfstücke, die über Nacht die Glut halten sollten, ließen rote Funken durch die Dunkelheit tanzen. Niemand in Clydesdale schlief in dieser Nacht ruhig und fest. Es war nicht nur der Sturm, der die Gemüter der Menschen bewegte, auch der Tod von Angus O’Leary bot Stoff zum reden und nachdenken.
Marc Kennedy hatte am Nachmittag noch weitere Gespräche mit seinem Auftraggeber und verschiedenen anderen Leuten geführt, danach war er vor Erschöpfung tatsächlich eingeschlafen. Doch als die große Standuhr unten in der Schankstube 2:00 Uhr schlug, wachte er schlagartig auf. Sein Kopf schmerzte höllisch, und in seiner Brust machte sich Beklemmung breit. Die Erinnerung an den vergangenen Tag kehrte zurück, und er dachte niedergeschlagen daran, dass er unter Mordverdacht stand. Noch nie zuvor in seinem Leben hatte er Gewalt angewendet, und er schämte sich schrecklich dafür, dass er sich von der aufgeheizten Stimmung hatte hinreißen lassen, um O’Leary tatsächlich einen einzelnen Schlag zurückzugeben. Er hätte jetzt gern jemanden gehabt, mit dem er reden konnte, selbst Kapitän Spenser wäre ihm willkommen gewesen. Aber der Geist ließ sich nicht blicken. Vielleicht schlief er ja auch. Schliefen Geister überhaupt?
Der Mann schalt sich einen Dummkopf, überhaupt darüber nachzudenken. Er stand auf und starrte versonnen aus dem Fenster, gegen den der Regen prasselte. Dort drüben auf der Insel brannten irgendwo ein paar Lichter. Das kleine Eiland, das so unverhofft zum Streitpunkt geworden war, wirkte still und friedlich. Nur der Leuchtturm war aktiv und schickte seine Warnzeichen durch die Nacht. Marc hatte plötzlich das Bedürfnis nach einem heißen Tee. Ob Sophie wohl etwas dagegen hätte, wenn er sich unten in der Küche Wasser heiß machte? Egal, er brauchte wirklich einen Tee. Möglichst leise schlich er die Treppe hinunter und hoffte, dass niemand durch das verräterische Knarren geweckt wurde.
Aber auch Sophie schlief nicht. Sie hatte, um sich abzulenken, die längst fällige Abrechnung für das Finanzamt angefangen. Doch ihre Gedanken schweiften immer wieder ab, und sie ertappte sich dabei, wie sie ins Leere starrte und an Marc Kennedy dachte. Es war nicht seine Schuld, dass ausgerechnet er als Bauleiter für diese unerwünschte Aufgabe engagiert worden war. Er selbst war sympathisch, höflich und liebenswert, kurzum, ein Mann, von dem sie geträumt hatte. Und ganz bestimmt war er kein Mörder, egal, was der Chief-Inspector jetzt noch behauptete.
Der Kuss hatte eine Welle von Empfindungen in ihr ausgelöst, und sie war ganz sicher nicht böse über diese plötzliche Vertraulichkeit. Ganz im Gegenteil.
Ihr Blick kehrte zurück in die Wirklichkeit. Kapitän Spenser hockte auf dem Fensterbrett und blickte sie grinsend an.
„Da hat wohl der Blitz eingeschlagen“, stellte er süffisant fest.
„Ich wüsste nicht, was Sie das angeht“, erklärte sie ruhig und beugte sich über das Formular.
„Tu nur nicht so unbeteiligt. Dieser Junge hat dir den Kopf verdreht, und ich glaube, ich finde das ausgesprochen gut.“
„Dieser Junge, wie Sie ihn nennen, steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Ausgerechnet er soll Angus erstochen haben. Aber das kann und will ich nicht glauben. Er war es sicher nicht.“
„Natürlich war er es nicht.“
Ihr Kopf ruckte hoch, Hoffnung lag in ihrem Blick. „Und wer hat es dann getan?“
„Das weiß ich nicht. Ich bin nur ein Geist, nicht allwissend. Aber ich bin sicher, dass der Junge unschuldig ist.“
„Dann sagen Sie das dem Inspector“, forderte Sophie kühn.
Der Pirat lachte auf. „Nicht einmal du kannst so naiv sein anzunehmen, dass jemand mir glaubt. Die Existenz von Geistern wird in eurer so genannten aufgeklärten Zeit geleugnet. Als ob es nicht mehr als genug von uns geben würde.“
„Ach, wirklich? Sind hier noch mehr anwesend, die ich nicht sehen kann? Oder wo finde ich sonst noch ein paar Gespenster? Wenn sie sich als anständige Poltergeister erweisen, könnte ich sie engagieren und so wenigstens ein bisschen Geld damit verdienen.“
Er grollte und schlug mit der Faust auf den Tisch. „Ich habe dir gesagt, dass du ausreichend Geld bekommen kannst. Im Übrigen ist das Thema Geister nichts, worüber ein Mensch wie du scherzen sollte.“
„Oh, ich bitte um Verzeihung, wenn ich Ihre Gefühle verletzt haben sollte. Im Übrigen habe ich Ihnen erklärt, warum ich Ihr Geld nicht annehmen kann. Es klebt Blut daran.“
„Zeige mir heutzutage ein Wirtschaftsunternehmen, das auf ganz legale Weise arbeitet. Das Finanzsystem lädt doch förmlich dazu ein, die bestehenden Gesetze zu umgehen, wenn nicht gar zu brechen. Nur solche ehrlichen Dummköpfe wie du haben moralische Bedenken.“
„Aber das ist doch etwas völlig anderes“, beteuerte sie.
„Wirklich?“, kam es höhnisch. „Sobald jemand durch einen unglücklichen Zufall den Schatz findet, wird er sich als rechtmäßigen Besitzer betrachten und mit Sicherheit keine Hemmungen haben, ihn auch nach Herzenslust auszugeben. Was also hindert dich daran, mein Vermögen anzunehmen, das seit ein paar hundert Jahren niemanden sonst mehr gehört? Du hast moralische Skrupel, die durch nichts zu begründen sind.“
„Das sagt ausgerechnet jemand, der selbst überhaupt keine Moral besitzt“, spottete Sophie.
Er seufzte theatralisch auf. „Dieses ganze Gerede nutzt überhaupt nichts. Du bist ein störrischer, dummer Kindskopf. Übrigens nicht nur wegen dieser finanziellen Angelegenheit. Du solltest den Jungen nicht mehr von der Angel lassen, er ist genau der Richtige für dich.“
„Jetzt reicht es aber.“ Sophie sprang auf und funkelte den Piraten zornig an. „Sie haben überhaupt kein Recht, sich in mein Privatleben einzumischen. Ich entscheide immer noch selbst, ob und wen ich...“
Spenser begann lauthals zu lachen. „Na also, es besteht ja doch noch Hoffnung. Es hat dich also doch erwischt. Nun, dann solltest du jetzt vielleicht in die Küche gehen, da könntest du deine Zeit besser verbringen als hier.“ Er verschwand wieder einmal im Nichts.
Sophie lief eine ganze Weile auf und ab, schließlich stampfte sie zornig mit dem Fuß auf und begann dann leise zu lachen. Der alte Pirat hatte längst erkannt, was sie selbst noch nicht wahrhaben wollte. Sie zog sich ihren Morgenrock über den Pyjama, den sie trug, und ging hinunter.
Jemand befand sich tatsächlich in der Küche und klapperte mit Geschirr, das Summen des Wasserkessels erfüllte den Raum.
„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte sie leise, um den Mann nicht zu erschrecken.
Marc ließ trotzdem fast die Tasse fallen, als er so unverhofft angesprochen wurde. Doch dann erkannte er Sophie, und ein Lächeln der Erleichterung malte sich in seinen sympathischen Zügen.
„Möchten Sie auch eine Tasse Tee? Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich mich hier selbstständig bediene?“
„Lassen Sie mich helfen, Marc, sonst suchen Sie morgen noch nach dem Tee, und dann ist das Wasser verdampft.“ Sie nahm ihm die Tasse aus der Hand, holte eine große geblümte Teekanne aus dem Schrank und eine Dose mit Tee. Geschickt und rasch füllte sie ihn ein und goss das dampfend heiße Wasser darüber. Augenblicklich machte sich der aromatische Duft breit.
„Ich wollte Sie nicht wecken“, murmelte Marc entschuldigend.
„Sie haben mich nicht geweckt.“
Er musterte sie aufmerksam und beschloss einen Versuch zu starten. „Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen.“
Sophie zeigte sich weniger überrascht, als er vermutet hatte.
„Da haben Sie in gewisser Weise nicht ganz unrecht.“
„Käpt’n Gideon Spenser“, schoss er ins Blaue.
„Sie kennen ihn?“ Jetzt wirkte sie doch irritiert.
„Er hat sich bei mir vorgestellt. Aber ehrlich, ich hätte auch gut darauf verzichten können. Er ist schon sehr aufdringlich.“
„Das ist einfach nicht zu glauben. Was fällt diesem Kerl eigentlich ein, meine Gäste zu belästigen? Ich werde ihm gehörig den Kopf zurechtrücken.“
„Und Sie glauben, dieser Pirat wird davon besonders beeindruckt sein?“, fragte Marc gespielt ernsthaft.
„Nicht wirklich, nein“, gab sie zu und wurde dann wieder ernst. „Auch der Käpt’n hat gesagt, dass Sie unschuldig sind, Marc. Ich bin also nicht die einzige, die so denkt.“
„Dann könnte er uns auch verraten, wer der wirkliche Täter ist?“
„Er weiß es auch nicht, behauptet er. Im Übrigen kann er schlecht zu Chief-Inspector Clarke gehen. Seine Zeugenaussage würde wohl auch kaum zugelassen.“
„Euer Ehren, ich rufe als Zeugen Gideon Spenser, geboren sechzehnhundert was auch immer, gestorben siebzehnhundert und noch etwas, von Beruf Gespenst“, imitierte Marc einen Verteidiger vor Gericht, und Sophie brach in helles Lachen aus.
„Es wäre mit Sicherheit ein denkwürdiger Auftritt“, erklang die Stimme des Piraten, und die beiden zuckten zusammen.
„Verschwinden Sie“, empfahl Marc lakonisch. „Sie stören.“
„Ach, wirklich? Ich kann mir aber doch dieses nette Tete-a-Tete nicht entgehen lassen. Es ist schließlich an der Zeit, dass die Kleine hier den Richtigen findet.“
„Vielleicht sollten wir beide das allein herausfinden. Die Betonung liegt auf allein, Kapitän. Gehen Sie und spuken Sie durch die Träume von jemand anders. Raus hier!“ Ihre energische Aufforderung zeigte Wirkung.
„Schon gut, ich weiß, wann ich wirklich unerwünscht bin“, knurrte Spenser und verschwand.
„Er ist in der Tat unmöglich. Aber Sie, Sophie, sind ein ganz besonderer Mensch.“ Dieses Mal hielt sich Marc nicht zurück. Ganz bewusst und ruhig zog er die junge Frau an sich und forschte in ihrem Blick. Doch da sah er nur sanfte Zustimmung. Seine Lippen fanden die ihren, und dieser Kuss wollte kein Ende nehmen.
*
Clydesdale lag in trügerischer Ruhe, als der Morgen graute. Vom Meer her zog nur noch eine leichte Brise über das Land, im Osten ging in einer wahren Explosion aus Rot und Gold die Sonne auf. Die Baumaschinen standen noch unberührt an ihren Plätzen, aber es war noch vor 6:00 Uhr früh, als die ersten Polizeiautos auftauchten. Aus ihr sprangen einige uniformierte Beamte und begannen das Gelände weiträumig abzusperren. Eine weitere Demonstration, so es denn eine geben sollte, würde nicht wieder zur Eskalation führen.
Die ersten Bauarbeiter tauchten auf, warfen den Beamten missmutige Blicke zu und begannen damit, die Motoren der schweren Maschinen anzuwerfen.
Auch Marc Kennedy kam bereits auf die Baustelle. Sein Schädel schmerzte heftig, doch nachdem er endlich die Liebe zu Sophie eingestanden hatte, ging es ihm, von seinem Kopf abgesehen, ausgesprochen gut. Außerdem war er um die offiziellen Feierlichkeiten herumgekommen. Er hasste Pressetermine - die aufdringlichen und meist nichtssagenden Fragen, das Blitzlichtgewitter, das gekünstelte Lächeln. Nun, das Blitzlichtgewitter war ihm dennoch nicht erspart geblieben, auch wenn sich gestern nur einige lokale Reporter die Mühe gemacht hatten, den augenscheinlich Mordverdächtigen zu fotografieren. Die jedenfalls hatten ihren Knüller, denn der Gewaltausbruch am vergangenen Tag, der mit dem bedauerlichen Tod von Angus O’Leary einen fatalen Höhepunkt gefunden hatte, war natürlich die Schlagzeile auf der Titelseite. Marc hoffte nur, dass sich heute nicht weitere aufdringliche Reporter hier einfinden würden, aber diese Hoffnung war natürlich vergebens.
Schon wenige Minuten nach seiner Ankunft tauchten gleich zwei Übertragungswagen auf, aus denen Leute heraussprangen, die sich mit Kamera und Mikrophon auf die Bauarbeiter und natürlich auch Marc stürzen wollten. Der bat jedoch die Polizisten um Unterstützung, und die drängten die aufdringlichen Leute trotz aller Proteste zurück.
Mit aufheulenden Motoren begannen nun die Erdarbeiten. Marc zog sich in den großen Bauwagen zurück, in dem auch die Besprechungen vorgenommen wurden. Der Vorarbeiter kam dazu, und die beiden Männer versuchten in einer vernünftigen klaren Sprache die Arbeit zu koordinieren. Das Handy klingelte, und Marc führte ein eher unerfreuliches Gespräch mit dem Bauherrn, Lord Preston. Es lief letztendlich darauf hinaus, dass er sich beeilen sollte, um seine Unschuld beweisen, sonst verlor er diesen Auftrag, was für seine weitere Karriere nicht gerade von Vorteil sein würde. Eigentlich war das eine Frechheit, schließlich musste die Polizei den Schuldigen finden, nicht er seine Unschuld beweisen. Und er wollte sich nicht auf diese Art unter Druck setzen lassen, er wusste immerhin, dass er unschuldig war. Genau das machte er auch deutlich, erntete am anderen Ende aber nur Verärgerung.
Ein paar Stunden vergingen, in denen der junge Architekt seine anderen Sorgen fast vergaß, während er mit der Arbeit beschäftigt war. Irgendwann, schon spät am Nachmittag, kam ihm seine prekäre Situation wieder zu Bewusstsein, als Chief-Inspector Clarke einfach die Tür aufstieß und in den Raum hinein gepoltert kam.
„Kennedy, wie oft sind Sie eigentlich schon hier in Clydesdale gewesen?“, fragte er ohne Gruß.
Marc antwortete ohne nachzudenken. „Einmal, Sir.“
„Ja, das habe ich mir gedacht. Und wie oft haben sie O’Leary vorher gesehen oder getroffen?“
„Gar nicht.“ Auch diese Antwort kam spontan.
„Haben Sie das Opfer geschlagen?“
„Ja, Sir, einmal.“ Marc schluckte, hielt aber tapfer den Blick auf den Polizisten gerichtet.
„Haben Sie Angus O’Leary getötet, egal ob vorsätzlich oder durch einen unglücklichen Zufall?“
„Nein, Sir, ganz bestimmt nicht.“
Niemand hatte je den Inspector belogen, wenn er seine speziellen Methoden einsetzte. Außerdem hatte er im Laufe vieler Jahre Polizeiarbeit einen besonderen Instinkt entwickelt, er wusste eigentlich immer genau, wann jemand die Wahrheit sagte, oder wann gelogen wurde. Und auch jetzt schüttelte er ratlos den Kopf. Marc Kennedy sprach die Wahrheit, soweit er das sagen konnte.
„Dann erzählen Sie mir ganz einfach noch einmal, was genau geschehen ist.“
Marc versuchte sich genau zu erinnern, doch es kam nichts Neues dabei heraus. Unzufrieden verabschiedete sich der Polizist, drehte sich an der Tür aber noch einmal um.
„Ach ja, bevor ich es vergesse. Sie scheinen hier in Clydesdale einen echten Feind zu haben.“
„Was? Wieso? Ich habe hier noch nie jemandem etwas getan, ja, ich kenne eigentlich niemanden außer Miss Cochrane, in deren Haus ich ein Zimmer bewohne. Wie kommen Sie denn überhaupt darauf?“
Clarke zuckte die Schultern. „Ein einziger Zeuge aus dem Ort hat eindeutig ausgesagt, dass Sie den tödlichen Messerstich geführt haben. Er hat sogar das Messer genau beschrieben, mit dem das Opfer erstochen wurde.“
„Aber - das ist doch vollkommen unmöglich“, stammelte Marc. „Ich - ich habe nie...“
„Stimmt“, bestätigte der Inspector mit einem bitteren Auflachen. „Das Messer, das der Zeuge beschrieben hat, war in keinem Fall die Mordwaffe, wie unser Gerichtsmediziner festgestellt hat. Die echte Mordwaffe lag allerdings hier irgendwo in der Gegend herum, und ich frage mich, warum jemand so gezielt den Verdacht auf Sie lenken will. Sie sehen also, dass an dieser Beschuldigung nichts Wahres ist. Das entlastete Sie natürlich noch nicht wirklich. Bemerkenswert bleibt trotzdem, dass jemand Ihnen auf diese Weise schaden will. - einen schönen Tag noch.“
Marc stand da wie vom Donner gerührt. Bevor er noch nachfragen konnte, wer solche Lügen in die Welt setzte, war Clarke bereits verschwunden. Der Vorarbeiter kam herein und wollte einige Fragen stellen, aber der Architekt war noch nicht wieder auf seine Arbeit konzentriert. Etwas fahrig deutete er auf der Karte in einen Bereich, in dem Erdarbeiten stattfinden sollten.
„Sind Sie sicher, Sir?“, erkundigte sich der andere Mann.
„Ja, natürlich“, gab Marc gereizt zurück. „Schließlich stammt die Planung von mir.“
Der Vorarbeiter zuckte die Schultern, besaß aber genug Verstand, sich die Anweisung abzeichnen lassen, denn er glaubte, dass Marc unbewusst einen Fehler gemacht hatte. Dann ließ er seine Leute mit dem schweren Gerät den Boden aufreißen. Eine Stunde später klang ein grausiger Schrei über das Baugelände.
In dem Loch, das der Bagger gerade in die Erde gefressen hatte, waren eine ganze Menge Knochen zum Vorschein gekommen. Kennedy wurde durch den Aufruhr ebenfalls alarmiert. Er rannte aus dem Bauwagen hinaus und blieb wie angewurzelt stehen. Offenbar befand er sich in größeren Schwierigkeiten, als er geahnt hatte. Nicht nur, dass diese Knochen aussahen wie menschliche Skelette - sie kamen an einer Stelle zum Vorschein, wo niemand hätte arbeiten dürfen.
*
„Wie kannst du es wagen?“, fragte Sophie voll kalter Wut. „Hast du gedacht, wenn du vollendete Tatsachen schaffst, werde ich mich nicht mehr dagegenstellen? Du hast mein Vertrauen missbraucht, Marc. Ich habe tatsächlich gedacht, du könntest deine Arbeit vom Persönlichen trennen. Stattdessen....“
Er hatte verbissen zugehört, während sein Herz von jedem Wort durchbohrt wurde. Sie ließ ihm keine Gelegenheit zu erklären, wie es geschehen konnte, dass ausgerechnet auf dem Gelände, das zur Lodge gehörte, die Arbeiten eingesetzt hatten. Es war tatsächlich ein Irrtum gewesen, den er ganz allein auf seine Kappe nehmen musste. Aber noch hatte er keine Möglichkeit, ihr das erklären. Nur, einen Vertrauensbruch wollte er sich nicht vorwerfen lassen. Er zog sie mit einem raschen Griff an sich und legte ihr sacht den Zeigefinger auf die Lippen.
„Darf ich auch mal etwas sagen - bitte?“
„Es gibt keinerlei Entschuldigung für dieses Verhalten.“
„Da gebe ich dir recht“, stimmte er zu, und sie hielt verblüfft inne.
„Ich will gar keine Entschuldigung suchen, es gibt nämlich keine“, sagte er mit fester Stimme. „Ich kann dir nur sagen, wie es zu diesem bedauerlichen Irrtum gekommen ist, an dem ich ganz allein die Schuld trage.“
„Ich höre“, erwiderte sie kühl.
Kurz und knapp berichtete er von dem Besuch des Polizisten und der ungeheuerlichen Beschuldigung, die ihn so aufgeregt hatte, dass seine Anweisungen falsch gewesen waren.
Sie seufzte. „Dann hast du aber heute einen ganz schlechten Tag erwischt. Und ich mache dir auch noch das Leben zur Hölle. Das war unnötig, aber sicher verständlich.“
„An deiner Stelle hätte ich vermutlich auch nicht anders reagiert. Das ändert aber nichts daran, dass du scheinbar ein paar Tote auf deinem Grund und Boden liegen hast. Du wirst eine gute Erklärung dafür brauchen.“
„Ich habe keine Erklärung dafür. Wie denn auch?“
„Es ist ausgesprochen amüsant, aber äußerst überflüssig, euer Geschwätz mit anzuhören“, sagte in diesem Augenblick Käpt’n Spenser.
Sophies Augen funkelten zornig, und Marc machte seinem Herzen Luft. „Das geht Sie gar nichts an.“
„Ach, kommt schon, Kinder, was gibt es Schöneres als junge Liebe. Obwohl ihr im Moment ein ziemliches Problem zu bewältigen habt. Ihr solltet aber nicht den Fehler machen, über Dinge zu streiten, die ihr sowieso nicht ändern können. Im Übrigen kann ich euch etwas über die Toten erzählen.“
„Das habe ich mir fast gedacht“, entfuhr es Sophie. „Handelt es sich um Ihre Kumpane?“
„Hüte deine Zunge, Mädchen. Die meisten von ihnen waren gute anständige Seeleute, die hart gearbeitet haben, um….“
„Um andere Schiffe aufzubringen, Leute zu töten und ihrer Wertgegenstände zu berauben“, ergänzte sie kalt.
„Du hast keine Ahnung von unserem Leben. Wenn du wirklich mehr wissen willst, dann bin ich gern bereit, euch heute Nacht unsere Geschichte zu erzählen. Trefft mich nach Mitternacht in der Schankstube am Kamin.“
Als Inspector Clarke hereinkam, verschwand der Pirat. Der Polizist kam ohne Umschweife gleich zur Sache.
„Sie haben da einen regelrechten Friedhof, Miss Cochrane“, sagte er höflich. „Aber nach dem, was unsere Experten festgestellt haben, sind die Skelette bereits mehr als zweihundert Jahre alt.“
„Mehr als dreihundert Jahre“, entfuhr es ihr ungewollt.
„Wie bitte?“
Sie seufzte. „Wir vermuten, es handelt sich um die sterblichen Überreste der Piraten, die unter Kapitän Gideon Spenser hier aufgebracht wurden.“
„Wer?“, fragte er und blickte interessiert von Marc zu Sophie. Seinen forschenden Augen entging nicht, dass die beiden jungen Menschen Gefühle füreinander entwickelt hatten.