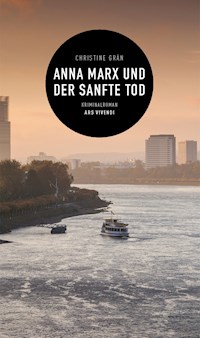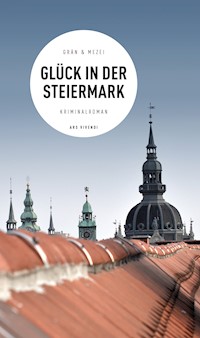2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Margaret wächst in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf und versucht schon früh, ihrer engen Umgebung zu entfliehen. Sie nimmt Gesangsstunden und zieht nach Berlin, wo sie in einem Jazzclub singt und Oscar begegnet. Sie folgt ihm nach Argentinien in eine großbürgerliche Existenz. Doch auch in Buenos Aires findet die junge Frau keine Erfüllung, und so zieht sie weiter ? bis sie erkennt, dass sie nicht vor ihrem Leben davonlaufen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christine Grän
Villa Freud
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2012 by Christine Grän
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-200-9
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
I - Margareta
Kapitel 1
III - Rita
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
III - Greta
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
IV - Margarita
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
V - Meg
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
VI - Margareta
Kapitel 20
Kapitel 21
Buch
Das Mädchen Margareta, das alle Rita rufen, wächst in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf und versucht schon früh, ihrer engen Umgebung zu entfliehen. Sie trotzt ihrer dominanten Mutter Gesangsstunden ab und übt sich an Wagner-Arien. Doch Margareta muss erkennen, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gewachsen ist. Abrupt bricht sie alle Brücken hinter sich ab und geht nach Berlin. Unter dem Namen Greta singt sie in einem zweifelhaften Jazzclub und erhebt die tägliche Improvisation zur Lebenskunst. Dann begegnet sie Oscar und folgt ihm nach Argentinien in eine großbürgerliche Existenz. Der Tango wird zur sinnlich-melancholischen Begleitmusik ihres Daseins. Doch »Villa Freud«, ein Spottname für den Stadtteil der Psychiater von Buenos Aires, ist nicht die Endstation ihrer Sehnsucht. Erfüllung findet Greta erst in Feuerland. Aber das Glück ist trügerisch, und obwohl sie sich nun Meg nennt, spürt Oscar sie auf. Und Margareta erkennt, dass sie nicht davonlaufen kann – nicht vor dem Leben und nicht vor ihrem Schicksal. Sie kehrt nach Deutschland zurück, nimmt die losen Enden ihrer Geschichte auf und komponiert daraus eine hymnische Liebeserklärung an das Leben.
I Margareta
1
Der rote Ball rollt träge über den Asphalt. Er endet seinen kurzen Weg auf der durchbrochenen weißen Linie. Nicht die Bewegung, der Stillstand führt zur Katastrophe, doch wer sollte dies wahrnehmen an einem heißen, müden Nachmittag in einer Straße verkehrsberuhigter Anwohner?
Die Straße liegt in einer gewöhnlichen Stadt, deren Bürger besteuert, verkabelt und zur Begrünung ihrer Fensterfronten aufgerufen werden. Begonienorgien und Taubenscheiße beleben die Fassaden, hinter denen Menschen versuchen, an der Monotonie aller Tage den Geschmack des Lebens zu finden.
Die Frau am offenen Fenster begießt mit altersschwacher Hand blaue Blumen, die in soldatischer Reihe in Plastiktröge gepflanzt sind. Ordnung ist das halbe Leben, auch wenn die Frau längst tot ist. Ihr leerer Blick ist auf das Mädchen gerichtet, das seinen Ball vergessen hat und den Gehweg mit bunter Kreide bemalt. Kleine Menschen sind Störenfriede, die zur Sachbeschädigung neigen. Sie mag Kinder nicht, weder die eigene Brut noch die fremden. Geburten, Hochzeiten, Todesfälle sind an ihr vorübergegangen wie die Jahreszeiten, und sie ist dabei nur alt und boshaft geworden. Sie wünscht sich, dass ein Auto dem Spuk ein Ende bereiten möge. Der rote Ball stört sie. Er gehört nicht auf ihre Straße.
Eine Familie mit vier rothaarigen Kindern, ohne Begonienbepflanzung, ist im Viertel ein Fremdkörper. Dieses Mädchen füttert die Tauben in kindlicher Tierliebe. Sie ist nicht die Einzige, und so wird Krieg geführt in dieser Straße, ein Taubenkrieg, in dem sich Tier- und Fassadenschützer in unerbittlicher Härte gegenüberstehen.
Ein Autofahrer ist dem Ball ausgewichen, er hupte und fuhr weiter. Das Kind sah nicht auf. Es malt weiter farbige Kreise auf grauen Stein, die der Regen wegwaschen wird, Gott sei Dank. Sie wendet sich ab und schlurft in die Speisekammer, wo sie ihre toxischen Vernichtungswaffen in Marmeladengläsern aufbewahrt, ein Schrein der Vergeltung für alle, die Ruhe und Ordnung stören.
Geleitet von der Schwerkraft bewegt sich der Ball in Richtung Straßenrand, nachdem der Wagen ihn passiert hat. Ein Radfahrer umfährt ihn und ruft dem Mädchen zu, es möge sein Spielzeug in Sicherheit bringen. Es sieht auf, lächelt und winkt mit Kreidehänden. Der Student versucht, sich an seinen Namen zu erinnern, als er weiterfährt. Er endet mit a, so viel steht fest. Alle Töchter dieser Familie tragen Namen, die mit diesem Buchstaben ausklingen.
Laura, die Zweitälteste, teilte mit ihm einst eine Parkbank in der Dämmerung. Als es dunkel wurde, hat er sie hingelegt, entkleidet und geliebt für ein paar Minuten. Es war eine kalte Nacht, daran erinnert er sich, und dass er sich beeilte, weil seine Hände Gänsehaut berührten. Sie sprach wenig und schien seltsam unberührt von seinen Bemühungen, eine gemeinsame Basis der Lust herzustellen. »Man sieht sich«, sagte er zum Abschied, und diese Floskel, sie wussten es beide, war das Ende.
Laura arbeitet in der Bäckerei am Ende der Straße, und immer, wenn er Mohnbrötchen kauft, erinnert er sich, wie sich ihre Haut anfühlte. Es heißt, dass sie bald heiraten wird, einen Bankangestellten mit Neigung zur Flasche. In dieser Straße leben die Menschen wie Exponate in Glasvitrinen, und sie hüten ihre letzten, bösen Geheimnisse, über die gleichwohl geflüstert wird. Er ist froh, anderswo zu studieren und diesem Terrarium kleinbürgerlicher Karikaturen entronnen zu sein. »Höhlenmenschen«, nennt er diese Leute, wenn er mit seinen Hamburger Freunden über sie spricht. Es kommt selten vor. Man schämt sich.
Margareta, so heißt die Kleine, es fällt ihm an der roten Ampel ein. Sie ist mit fünf Jahren die Jüngste der Familie, ein hässliches, dürres Kind mit großen blauen Augen und den roten Haaren, die sie und ihre Schwestern aus dem normalen Bild der Straße aussondern. Hexen werden nicht mehr verbrannt, sondern verspottet, und Laura gab ihm zu verstehen, dass auch dies sehr schmerzhaft sein kann.
Ihr Vater trägt die Post im Viertel aus, ein kleiner, rundlicher Mann, dem ein Dauerlächeln ins Gesicht gemalt ist. Ein Gehalt und fünf Frauen: Man könnte sich fragen, worauf die Heiterkeit dieses Mannes beruht, aber letztlich interessieren ihn die Leute nicht. Er hat sie hinter sich gelassen wie Übergepäck, das die Beförderungsgebühren nicht lohnt.
Der Student befestigt sein Fahrrad an einem Metallständer vor der Bäckerei, während das Mädchen Margareta sein Kreidebild bewundert und hofft, dass es nie wieder regnen möge. Sie wird Malerin werden, sehr viel Geld verdienen und an einem Ort mit Tieren leben, die nicht umgebracht werden, und mit Bäumen, die in den Himmel wachsen. An dem Leute nicht an Fenstern stehen und einander beobachten. Ein Haus mit hohen Zäunen und vielen Zimmern, in denen sie allein sein kann. Die Welt ist ein schöner Traum, aus dem sie ungern in die Wirklichkeit erwacht. Sie möchte nie erwachsen werden wie ihre Schwestern.
Der Wind treibt Blätter durch die Straße, spielt mit dem roten Ball und treibt ihn zurück zur Mittellinie. Verweht so schnell wie er kam und hinterlässt bleierne Hitze, die den Asphalt weich und verletzlich macht. Stille, die von Motorengeräusch durchbrochen wird. Der Busfahrer, der auch für Tiere bremst, weil er sie für die besseren Menschen hält, schert aus und verschont das unbekannte Objekt. Gibt es fette, rote Vögel? Egal, was zählt, ist die gute Tat, und er braucht viele von ihnen, um sich besser zu fühlen an Tagen wie diesem, oder an allen Tagen. An der Haltestelle bremst er sanft und lächelt durch den Rückspiegel, um seinen Fahrgästen zu zeigen, dass er die Macht über die Pedale so oder so nutzen kann.
Eine der Schülerinnen, die den Bus verlässt, ist Agatha. Sie hält sich für das Aschenbrödel der Familie und führt dies auf die Namensgebung zurück. Denken Eltern niemals darüber nach, was sie ihren Kinder antun? Hexenhaare und Sommersprossen würden für die Hölle auf Erden durchaus genügen. Jeden Tag in der Schule wird sie neu durchlebt, und zu Hause lauern die Schwestern als Spiegelbilder einer rothaarigen Zukunft mit Brillen und Zahnspangen. Manchmal möchte sie sterben, nur um der drangvollen Nähe dieser Familie zu entrinnen.
Glück. Ein Mutterwort und die Beschwörungsformel, mit der die Familie in einer Art Marathontalkshow zum Applaus bewegt werden soll. Glück ist ein Wort, das Agathas Haut wie Salzsäure ätzt. Der häufige Gebrauch ändert nichts an dem geldwerten Mangel. Nach eigener Einschätzung rangiert ihr Clan knapp über den Asylantenfamilien, denen ihr Vater die Post ins Haus bringt.
Eine Vierzimmerwohnung für sechs Leute. Sie teilt einen Raum mit Margareta, und wenn man das Gefühl hat, in Schachteln zu hausen, erscheint die Welt groß und uneinnehmbar. Um die Beschränkung zu überwinden, beginnt man zu hassen, zum Beispiel eine kleine Schwester, die unruhig träumt und im Schlaf spricht.
Margareta ähnelt einem sehr verunglückten Engel, wie sie auf der Haustreppe sitzt und sehnsüchtig in den Himmel starrt. Agatha zieht eine Fußspur über das Kreidegemälde, weil es Freude macht, Menschen wehzutun, die sich nicht wehren können.
»Es wird ein Gewitter geben«, sagt sie, als Margareta aufheult, und sie fugt hinzu: »Willst du nicht mit reinkommen?«
»Aber ich mag Gewitter.«
Natürlich. Sie liebt alles, was andere als störend empfinden. »Nun komm endlich. Und vergiss deinen Ball nicht. Warum liegt der überhaupt auf der Straße?« In dieser Familie darf nichts verloren gehen. Dinge sind kostbar, auch wenn man sie nicht anbeten darf. Selbst Joghurtbecher werden gesäubert und weiterverwendet. Recycling als elftes Gebot.
Agatha tippt mit ihrer Fußspitze sanft in Margaretas Seite. Die Kleine sieht hoch und lächelt. Sie verzeiht schnell und ist ein fügsames Kind, wenn es nicht um Träume oder Tauben geht. Jetzt sammelt sie vorsichtig die Kreide ein, auch die Stummel, und wirft sie in den Joghurtbecher, den ihre Schwester aufgehoben hat.
»Der Ball. Nun hol ihn endlich.« Dieses Kind vergisst vieles oder hört nicht richtig zu, eine Form von Selbstschutz, der in dieser Familie zum Überlebenstraining gehört. Agatha weist mit dem Finger auf die Straße.
Margareta weiß, dass sie nicht auf die Straße laufen darf, man hat es ihr hundertmal gesagt... und jetzt glaubt sie, dass Tagesbefehle die großen Gebote aufheben. Sie folgt der Richtung des Fingers auf Zehenspitzen, weil der Asphalt heiß, fast nachgiebig ist. Sie sieht nach oben, um den Himmel zu fragen, ob es regnen wird. Die Wolken zeichnen schemenhafte Figuren von bedrohlichen Ausmaßen, und sie meint, einen Drachen zu entdecken.
Margareta sieht himmelwärts, und so kann sie nicht sehen, was auf der Erde geschieht. Ein großes, weißes Auto fährt eine Spur zu schnell auf einer verkehrsberuhigten Straße. Die Sonne blendet. Die Fahrerin neigt ihren Kopf zum Seitenfach, um ihre Brille zu suchen. Das Kind bückt sich nach seinem Ball.
Katastrophen scheinen jenseits der Zeit abzulaufen. Agatha sieht die Szene in unendlicher Langsamkeit, durch eine winzige Öffnung rieselt feiner Sand zu Boden und bildet einen Hügel aus Sekunden. Der Schrei und die Bewegung treffen zusammen. Sie weiß, dass ihr nur noch der Sprung bleibt, um alle Schuld zu tilgen. Sie ist eine träge Masse, die Kraft der Erde ist anziehend, und doch wieder nicht. Alle für einen, das Familienmotto, und sie hat es immer gehasst. Jetzt ist sie ganz allein.
Die alte Frau verteilt Gift auf ihrer Fensterbank. Der Student kaut ein Brötchen und denkt an Gänsehaut. Das Quietschen der Bremsen ist allzu laut für die Stille dieser Straße. Die ungeheuer gewaltsame Berührung von Metall und Fleisch hingegen erscheint merkwürdig leise.
Der rote Ball rollt auf die andere Seite, überspringt die Kante zum Trottoir und schmiegt sich an einen Hydranten. Er ist unbeschädigt. Ein paar Idioten sprechen von einem kleinen Wunder, später. Es gibt bessere, aber hier, in dieser Straße, geschehen sie nicht.
II Rita
2
In dieser Familie werden Tragödien zelebriert wie Picknicks im Park oder Messen mit satanischem Einschlag. Sonntags finden Ausflüge statt, und sechs Leute wandern mit Rucksäcken und Körben sowie Klappstühlen und einem zerlegbaren Tisch in die biotopischen Reste der Natur, die als Freizeitangebot der Stadt gehandelt werden.
Die Älteste der rothaarigen Frauen schreitet voran wie eine Gänsemutter, nur graziöser. Das Ziel ist der Badesee, ein Teich am Rande der Stadt, zu dem Leute pilgern, die oftmals große Bäuche tragen, weil sie sich Sushi nicht leisten können. Denkt Rita, die diese Sonntagsvergnügungen hasst, schon deshalb, weil sie in dem zarten Alter ist, in dem alles, was Erwachsene tun, grob und unangemessen erscheint. Sie ist sechzehn, und es ist eine schwere Zeit.
Sie trägt den Korb mit den Salaten. Gott sei Dank, sagt Vater, gibt es am Tag des Herrn keine Post auszutragen. Er sagt es jeden Sonntag, denn er ist ein verbaler Wiederholungstäter. Das Publikum hält still, weil es kein Entkommen gibt aus diesem Stück, es sei denn, man wird erwachsen oder läuft in ein Auto.
»Sie ist bei den Engeln«, sagt Mutter und blickt nach oben, als gäbe es in dem kalten Blau etwas zu sehen, das diese Hypothese bestätigt. Sie hat nicht geweint, als der Sarg in die nasse Erde gesenkt wurde, obwohl die anderen es taten, sogar die alte Frau von gegenüber, die Taubenmörderin. Man muss ihre Haltung bewundern, flüsterten die Trauergäste, und unterstellten der Frau insgeheim Hartherzigkeit. Die Wahrheit ist unsterblich und wird individuell beerdigt.
Niemand sagt, was er denkt, das ist Ritas Meinung, und sie schließt die ihr Nahestehenden nicht aus; die Welt ist ein Lügengebäude, in der jeder sein Zimmer des Missvergnügens bewohnt. An Tagen wie diesen wünscht sie sich, auf der imaginären Wolke der Schwester zu wohnen, schwerelos und schuldlos.
Keiner hat es je ausgesprochen, doch alle fühlen sich auf ihre Weise schuldig. Seit dem Tag, an dem sie starb, hat die Unverletzbarkeit dieser Familie Schaden genommen, und sie begannen, Vaters ewigem Lächeln zu misstrauen. Er kann sie nicht beschützen, niemand kann es, und die Schwestern, die Überlebenden, suchen das Vergessen, während die Alten ihren ohnmächtigen Zorn durch Heiligsprechung lindern.
Jeden Abend, vor dem Tischgebet, zündet Mutter eine Kerze an. Bisweilen spricht Vater von Wiedergeburt. Vielleicht als Ameise, die Rita jetzt zertritt. Manche trifft es hart, immer wieder. Sie möchte gerne böse sein oder zumindest ein rätselhaftes Traumwesen wie Mélisande. Doch sie ist nur Rita, eingeschnürt in diesen Körper, diese Familie und ihre Mittelmäßigkeit, die alles, gut oder böse, bis zur Unkenntlichkeit einebnet. Das Wollen und das Sein sind Parallelen, die sich nie begegnen. Und so fehlt in Ritas Leben nichts – und alles.
Die Grundbedürfnisse werden gestillt, doch alles, was über Nahrung hinausgeht, ist Luxus. Man brauche ihn nicht, sagt Gregor, er verstelle nur den Blick auf das Wesentliche.
Das Wesentliche ist, dieser Kindheit unbeschädigt zu entrinnen. Im Feuerkreis der Armut harrt Ritas Brünnhilde auf Rettung, und sie kann nur in der Größe liegen. Die Opernbühne als Rettungsring, doch noch befindet sie sich auf der Titanic und sehnt Eisberge herbei.
Der rote Ball liegt in Ritas Zimmer. Eine Reliquie, niemand würde mit ihr spielen. Als sie ihn aufhob an jenem Tag, war Blut an ihren Fingern. Sie weinte. Und wurde getröstet. Und hörte in gewisser Weise nie wieder auf zu weinen. Nichts ist so schwer, wie sich nicht selbst zu betrügen.
Sie haben den sorgfältig ausgewählten Platz am See eingenommen, im Schatten eines Baumes und in angemessener Nähe zum Ufer. Über den Klapptisch wird eine Plastikdecke gebreitet. Hanna zählt die Stühle, einer fehlt.
Laura sondiert die Umgebung, denn sie sucht einen Mann, der sie von allem erlöst. Sie ist zurückgekrochen in den Schoß der Familie, geschieden und kinderlos, auch aus praktischen Erwägungen, denn Brot zu verkaufen finanziert noch keine Miete. Laura investiert ihren Lohn in Kleidung, das gepflegte Äußere ist der Köder, mit dem sie ihr Glück angeln will. Ihr erklärtes Lebensziel beim Verlassen der elterlichen Wohnung war, nie wieder Gebrauchtkleidung zu tragen. Natürlich wollte sie auch eine glückliche Ehe führen und zwei Kinder in die Welt setzen. Sie hat ihr Bestes getan, aber es war nicht gut genug für einen Mann, der »eine lockere Hand« besaß. So nannte er es, wenn er sie schlug. Es hatte mit Bier und Aggressionen und der Verfügbarkeit einer Schwächeren zu tun. Und es tat weh.
Dass es ihm Leid tat, hinterher, linderte den Schmerz nur nach den ersten Malen, so lange, bis sie begriff, dass seine lockere Hand sie ihr Leben lang begleiten würde. Und so verließ Laura die Wohnung, die sie mit so viel Liebe dekoriert hatte, und kehrte nach Hause zurück. Das Eingeständnis einer Niederlage, die ihre Mutter als Sieg deklarierte. In dieser Familie ist Gewalt ein Tabu, das man nicht berührt. Lauras Vorsatz, eine Kampfsportart zu erlernen, verflog wie alle anderen Pläne für ein neues Leben. Sie besucht einen Schminkkurs in der Volkshochschule.
Nun schlägt sie nach einer Mücke und handelt sich Vaters strafenden Blick ein. Gottes Kreaturen werden nicht ermordet und nur in jenen Fällen verzehrt, in denen ein mitfühlender Mensch sie mit schonender Hand ins Jenseits befördert hat. Hühner vom Biobauern zum Beispiel, oder die tranigen Fische, die Gregor Bronner um Verzeihung bittet, bevor er sie tötet. Er hat sich seine eigene Religion geschaffen, eine schlichte Mischung aus Buddhismus, Hinduismus und Katholizismus mit einer Prise calvinistischer Sturheit.
Sich zu fügen und sein Regelwerk heimlich zu hintergehen, gehört zum Spiel, das sie alle perfekt zu beherrschen gelernt haben. Er ist ein gütiger Diktator, ein Briefträger, der Priester werden wollte, ja es vielleicht sogar geworden wäre, hätte nicht diese schöne, rothaarige Frau seinen Weg gekreuzt. Er liebt sie, er betet sie an, er trägt Briefe aus, um sie und ihre Kinder zu ernähren, und jeden Tag dankt er allen Göttern für das Glück ihrer Gegenwart, ihrer Stimme, ihres Körpers, ihrer Zuneigung, ihres unvergleichlichen Gulaschs und ihrer gemäßigt sadistischen Neigungen, die seine sexuellen Präferenzen vortrefflich ergänzen.
Das Leben wäre perfekt, wenn es den Tod ausschließen könnte. Nach dem letzten, aus ihrer Sicht ungewollten Kind, ließ sich seine Göttin sterilisieren. Es sei genug, sagte sie, und er widersprach nicht, weil er ihre versteinerte Trauer fürchtete. Seither stellt sie ihm nur noch ihren Mund zur Verfügung, mittwochs und samstags, als ob man doppelt verhüten müsse. Kann er mit dieser Frau über Sex oder Logik diskutieren? Nein, er wartet mit Demut und Geduld, dies sind seine Stärken, und doch ahnt er, dass etwas zerbrochen ist, das nicht mehr heilen kann. Es macht ihn reizbar, gestern hat er einen Hund getreten in Notwehr und Ausübung seines Dienstes, und in der Woche zuvor hätte er beinahe seine Hand gegen Rita erhoben.
Sie war immer schon ein seltsames Kind, fügsam und widerspenstig in einem, und von allen Mitgliedern der Familie scheinen die Schuldgefühle sie am stärksten zu belasten. Was man verstehen kann, und versucht er nicht, alle und alles, was ihm widerfährt, demütig hinzunehmen? Liebe ist der Schlüssel, und Anna, die Älteste, versteht am besten, was er seinen Kindern predigt.
Anna arbeitet als Pflegerin in einem Seniorenheim, wo ihre Jugend und Rubensfigur ebenso geschätzt werden wie ihre unerschütterliche Frohnatur. Sie hat sich nie für Männer interessiert, die jünger als sechzig sind. Sie nennt es »die fette Beschränkung der Möglichkeiten«.
Es erstaunt ihn immer wieder, wie verschieden seine Frauen sind. Das Wunder der Vermehrung in unterschiedlichen Körpern und Geistern. Rita ist dürr und ein Schwergewicht an Maßlosigkeit. Sie will Wagner-Sängerin werden und wird nicht müde, diesen absurden Wunsch zu äußern und um Gesangstunden zu betteln.
Armut ist ein bescheidener Nährboden für geistige Entwicklung, doch erlaubt auch er Hoffnungen und Chancen. Aber nicht Wagner. Sie hat eine hübsche, zarte Stimme und singt im Kirchenchor, obwohl Gregor den rituellen Handlungen in barocken Prachtbauten misstraut. Er hat nichts gegen Musik, Gott behüte. Mozart, Strauß, die amerikanischen Schnulzen, die seine Frau so gerne hört. Sie singt manchmal, während sie kocht, und dieses Bild, der Klang und die Gerüche sind so maßlos schön, dass sie sein weiches Herz vollends zum Schmelzen bringen. Die Liebe und der Tod, andere Geheimnisse gibt es nicht, und anderes möchte er weder entdecken noch erforschen.
Gregor beobachtet seine Frauen vom Wasser aus. Rita gleicht einer Statue, die ein Bildhauer unvollendet ließ. Zu klein für ihre großen Ambitionen. Der Lump, so nennt er Lauras Exmann, nahm sie mit in Tristan und Isolde, und sie kam zurück wie eine, die ihren Gott gehört hat. Was hat er ihr gesungen? Rita schweigt, wenn man in sie dringen will. Töchter sind ein großes Geheimnis.
Rita beobachtet den Flug von Vögeln und wünscht sich, einer von ihnen zu sein. Ihre Schwester Laura sitzt in graziöser Haltung am Ufer und sehnt sich nach dem Märchenprinzen. Es gibt Leute, denkt Rita, die ihr Leben lang auf etwas warten. Andere grillen an Badeseen, und es riecht nach verbranntem Fett. Sie hört das Kreischen von Transistorradios und Kinder, die um die Wette plärren, und sieht hässliches Menschenfleisch, unverhüllt und ohne Scham. Wenn dies das Leben ist, sollte man nicht von seiner Schönheit sprechen.
Denken diese Leute zu Lande und zu Wasser jemals über den Mythos von Eros und Tod nach? Rita gibt sich selbst die Antwort: Nein. Außerdem hasst sie ihre fahlen, dünnen Schenkel, und nur in ihrer körperlichen Unvollkommenheit fühlt sie sich dazugehörig. Sie schreibt Gedichte, und sie sind schlecht. Sie singt, sie schreit mit allem, was ihre Stimme hergibt, und niemand hört zu. Alle Sehnsüchte sind so, als wolle man mit Netzen den Wind einfangen. Man biegt sich, den meisten fällt es leichter als ihr.
Wenn du in der Schule gut bist ... Vaters erpresserische Formel für Gesangstunden: Rita ist eine aufmerksame und angepasste Schülerin. Denken sollen die Bildungssoldaten, aber nicht zu viel, und vor allem nicht anders, denn Lehrer sind auch nur Menschen, die Macht ausüben und Macht missbrauchen. Die Schule als Biotop der Züchtung des geringsten Widerstandes: Ihre Energien sind darauf gerichtet, nicht aufzufallen. Kein Zoff mit den Lehrern, den Banden, den Cliquen. Wenn sie niemandem bedrohlich oder lächerlich erscheint, lässt man sie in Ruhe. Cool sein heißt, jegliches Gefühl nur in gefrorenem Zustand an die Außenwelt zu lassen. Vielleicht hat jeder Angst, und deshalb lügen alle. Und alle verlassen die Welt in tiefgefrorenem Zustand. Nur wenn sie Musik hört, taut Rita auf. Musik ist Schönheit und Perfektion. Die Flucht aus dem, was ist. »Ich will singen.« Eine andere Straße sieht sie nicht.
»Du hast eine hübsche Stimme«, sagte Ritas Musiklehrerin, die sich mit den Jahren der Ernüchterung oder Erbitterung der spirituellen Musik zugewandt hat, vor allem der Musik der Sufis, jene nächtlichen Endlosgesänge der Troubadoure Allahs, bei denen die Stimmen immer wieder ins Falsett kippen. Rita vermag weder das Entzücken noch die Ekstase zu teilen, die Klänge sind ihr fremd, doch sie heuchelt, um in der Gunst des einzigen Menschen zu bleiben, der eine reale Verbindung zur Musik darstellt. Der Chorleiter protegiert seine Sängerinnen nach der Größe ihres Busens. Sie hat nicht die geringste Chance, jemals ein Solo zu singen.
»Hör auf zu träumen und komm ins Wasser. Es ist ein so schöner Tag.«
Hanna boxt sie in die Schulter. Sie hat den Drang, andere zu berühren, ihnen körperlich nahe zu kommen, und Vater liebt es. Rita nicht. Sie schüttelt den Kopf und reibt sich die Stelle mütterlicher Zuneigung. Begreift Hanna nicht, wie verletzlich ihre Tochter ist? Hanna ist so unerschütterlich in allem, was sie tut, in ihrer Trauer oder Freude, und ihre erbarmungslose Zuneigung überrollt alles, was nicht ausweichen kann. Gott, sie ist perfekt, diese Frau, und vor allem darin, Mutter zu sein.
Rita weiß, dass ihre Mutter Pralinen an die Bäckerei verkauft und das Geld spart, um ihr diesen einen großen Wunsch zu erfüllen. Es macht sie wütend, weil Hanna sich für etwas einsetzt, an das sie nicht glaubt. Und dann, wenn sie die großen Bleche mit den Miniaturen aus Schokolade, Trüffeln und Marzipan sieht, und Hanna in ihrer weißen Schürze, fühlt Rita sich schuldig. Anna vergleicht den Genuss der rumgetränkten Rosinen eingebettet in Marzipan und Schokolade, mit den Klängen von La donna è mobile, die ihre Schwester in Trance versetzen.
Alle Lust will Ewigkeit. Und hinterlässt den bitteren Geschmack der Entbehrung. Anna wird fetter, und Rita verzehrt sich in ungestillter Sehnsucht.
Ein Blatt löst sich vom Baum, als Hanna zum See schreitet. Sie geht nicht wie andere Leute, sie setzt ihre Füße auf den Boden, Schritt für Schritt, als wolle sie von ihm Besitz nehmen.
Ihre Schönheit ist schwerer geworden mit den Jahren, aber sie ist immer noch präsent, und die Leute sehen ihr nach und fühlen sich gedemütigt. Sie ist Furcht einflößend, denkt Rita, vor allem deshalb, weil sie sich ihrer Wirkung auf andere nicht bewusst ist. Oder sich nicht darum kümmert. Hanna lebt ihr Leben wie einen schönen Traum. Und wenn sie aufwacht und stirbt, wird sie sagen, dass alles richtig war. Das ist eine schreckliche Vorstellung.
Rita wendet ihren Blick von dem weißen Rücken, auf dem ein roter, in der Sonne flammender Zopf aufliegt. Schönheit tut weh, weil sie so selten ist unter Menschen. Ein unverdientes Geschenk der Natur, die von allem im Überfluss besitzt, bis man sie zerstört. Wie diesen Badesee mit seinem niedergetrampelten Gras, den umgrenzenden Parkplätzen, den Getränke- und Eisbuden und grünlackierten Mülleimern. An Tagen wie diesem wühlen die Badenden den Schlamm vom Grund auf und verwandeln das Wasser in eine braune Brühe. Die Bäume zwischen Ufer und Parkplätzen scheinen zäh und langsam zu sterben. Noch spenden sie Schatten, doch die Mörder bevorzugen ohnehin die pralle Sonne. Lauras Haut färbt sich marmeladenrot, Rita kann es aus der Distanz erkennen. Sie hat die Gesetze der Weißhäutigen nie befolgt. Sie möchte so gerne glänzen, ihre Schwester, doch Hanna hat ihre Schönheit sozusagen aufgeteilt, jede bekam nur ein wenig davon. Rita schenkte sie ihre türkisen Augen. Der Rest ist kümmerlich. Dass sich alles noch »auswachsen« wird, behauptet nur Hanna. Sie hat Königinnen geboren, dies ist ihr fester Glaube. Weiß sie nicht, dass Königinnen tragische Figuren sind?
Der Wind spielt mit einer Plastiktüte. Rita beobachtet das willenlose Schweben, das so leicht und harmonisch scheint, ein sanftes Gleiten ohne Widerstand und Lärm, und dann sinkt sie doch zu Boden, weil es ihre Bestimmung ist. Das Schauspiel macht Rita traurig, sie weiß nicht, warum. Hanna wird die Plastiktüte später aufheben und in ihre große Badetasche stecken. In ihrem Leben darf nichts verloren gehen. Dies ist Mutters Plan, und er konnte nicht aufgehen.
Es ist schwer, hinter die Wirklichkeit zu sehen, wenn sie einen ständig zwingt, vordergründig zu handeln. Die Kindheit ist ein Märchen oder eine besondere Form der Hölle. Kein falsches Familienidyll kann ihr die Furcht nehmen, in dieser Hölle für ewig verloren zu sein. Denn wer die Wahrheit nicht in sich selbst zu schauen vermag, dem kann sie kein Buddha offenbaren. Würde Vater sagen. Die Wahrheit ist: Rita würde über Leichen gehen, wenn sie sich dafür den Traum der großen Sängerin erfüllen könnte.
Sie atmet tief ein und empfängt die Aura von Holzkohle und Bratwürsten. Zum Singen gehört richtiges Atmen, und zum Atmen die richtige Körperhaltung. Sie bemüht sich immer, sehr aufrecht zu gehen, das ist nicht leicht.
»Ich will Wagner singen. Ich will Gesangsunterricht.« Das ist alles, worüber Rita sprechen will. »Später«, sagt Gregor dann. Später ist der Tod, und jeder Tag verloren, an dem man nicht das tut, was man wirklich will. Und so wartet Rita auf die wild card, das unvorhergesehene, nicht berechenbare Ereignis, das die Welt verändern wird. Den Entdecker ihrer Stimme. Es wird nicht der Chorleiter sein, der sie rügt, wenn sie versucht, die anderen zu übertönen. Crescendieren bedeutet wachsen, lauter werden in der Musik, und sie will diese Kirche ausfüllen, wenn sie singt, und die Orgel besiegen und diesen Mann, der die Callas in die letzte Reihe gestellt hätte, weil ihm ihr Gesicht missfallen hätte. Schönheit geht vor Wohlklang, und ein Verlierer, der Sieger spielen darf, hat großes Talent zum Folterknecht. Rita hasst ihn mit der Intensität eines Opfers, das gerne Täter wäre. Sie würde ihn über die Balustrade ins Kirchenschiff stoßen, wenn sie den Mut dazu hätte.
Doch das Leben ist nicht kühn und gewaltig, nur feige und lächerlich. Die Mädchen mit den großen Brüsten und den kleinen Stimmen lachen über den Mann, der sie mit seinen Blicken vögelt, und sie reizen ihn mit engen T-Shirts und verheißungsvollem Lächeln. Man zieht sich selten aus für einen, dem man sich überlegen fühlt.
Rita hat es dennoch getan, dreimal mit einem Jungen aus der Schule. Er spielt Saxophon in einer Band, das war wohl der Grund, und wenn sie nicht die Augen geschlossen und Musik gehört hätte, wäre die Inszenierung zum Fiasko geraten. Er hatte vermutlich ein Buch über orale Befriedigung gelesen und verbrachte (nach Ritas und vermutlich auch seiner Meinung) endlose Zeit mit seinem Mund zwischen ihren Beinen. Sie fühlte nichts außer Langeweile und Erstaunen darüber, wie viel Aufhebens um eine Sache gemacht wird, die in Eigenregie sehr viel befriedigender und zielorientiert ist.
Sein Saxophonspiel war in seiner Unvollkommenheit eindeutig besser, nur hatte sie nicht den Mut, ihm das zu sagen. Und so hielt sie still und seufzte zu den Klängen von Jonas Gwangwa, und als die Musik zu Ende war, entfernte sie sanft seinen Kopf und lächelte in der Art von Frauen, die Männern alles verzeihen, auch die Hinrichtung von Erotik, obwohl sie von der Bedeutung dieses Wortes wirklich keine Ahnung hatte.
Dann kniete sie zwischen seinen Beinen und nahm in den Mund, was nicht schmeckte und zu umfangreich wurde, um genießbar zu sein. Auch die Vorstellung, auf einem Saxophon zu spielen, machte die Sache nicht besser. Doch er war gnädig und überschwemmte sie mit seinem Samen, bevor der Brechreiz unerträglich wurde. Das war ein Augenblick, in dem Rita glaubte, dass Frauen Männern überlegen seien, trotz allem. Vielleicht, weil bei ihnen alles nach innen gerichtet ist und viel verborgener.
Beim zweiten Mal, als er in sie eindrang, revidierte sie diese Ansicht. Es tat weh. Und wieder spürte sie nichts außer geringfügigem Schmerz und dem Gewicht, das auf ihr, in ihr war. Schweiß auf ihrer Haut. Das Geschlecht als Brennpunkt des Willens in der erotischen Konzeption einer Oper. Höchste Lust, und Isolde sinkt sanft auf Tristans Leiche. So sehr sie diese Vorstellung auch bemühte, es gab nichts, was solcher Dramatik auch nur annähernd nahe kam.
Das gefüllte Kondom erzeugte ein quatschendes Geräusch, als er es abzog. Sein Grunzen, ihr Stöhnen. Die Lautmalerei des Geschlechtsverkehrs erschien Rita als dissonant; es war, als ob ein Duett in verschiedenen, nicht zueinander passenden Stimmlagen gesungen würde.
»Bist du gekommen?«, fragte er, und Rita dachte, wohin und wozu?, doch sie nickte, weil minderjährige Saxophonspieler empfindsame Wesen sind und sie immerhin wusste, dass es so etwas wie männlichen Stolz gab, den zu verletzen auch ihre Generation nicht angetreten war. Über Sex oder was man dafür hielt, wurde in den Mädchentoiletten gesprochen oder auf dem Pausenhof. Hier wurden Noten verteilt und Orgasmen verglichen, Größe und Technik diskutiert, doch nie, niemals in Erwägung gezogen, die Mysterien des weiblichen Lustgewinns dem anderen Geschlecht mitzuteilen. Es wäre wohl Verrat an der Sache gewesen, die auch mit dem Wort Macht zu erklären war.
Das Gesetz der Trägheit und die Kräfte der Anpassung, gestülpt auf einen starken Willen, vereisen die Seele, bis sie schmilzt. Rita ahnt, dass sie all das nicht ist, was sie zu sein vorgibt. Sie ist nicht nett, dieses Bild ist so trügerisch, dass sie manchmal Angst hat, jeder könne die Fälschung erkennen. Hannas besorgte Blicke. »Du musst deinem Herzen folgen«, sagt sie ihren Töchtern, als ob das so einfach wäre. Rita ist fast überzeugt davon, in einer Gesellschaft von Gehörlosen zu leben, die sich zu Tode reden. Und gäbe es die Musik nicht, nur all die Worte, die flüssigen, überflüssigen, aggressiven, belehrenden, süßen, gemeinen, mahnenden, befehlenden, lügenden, schmeichelnden ... gäbe es nur sie und das Schweigen, so wäre sie bereit, ihr Dasein als entbehrlich zu betrachten. Es ist, so wie es ist, von trostloser Leichtigkeit. Wie ein leerer Plastiksack, den der Wind bewegt.
»Willst du gar nichts essen? Nimm doch von der Pastete!« Gregor hält ihr den Teller hin und lächelt, wie immer. Die Aufforderungen von Eltern sind verhüllte Befehle, und es wäre ein Sakrileg, Hannas Kochkunst nicht zu würdigen. Rita kommt aus ihrer Welt zurück in die Szenen ihres Lebens und spricht aus, was ihr in diesem Augenblick einfällt. Vielleicht, wenn sie darüber nachgedacht hätte, wäre sie still geblieben, doch wird andererseits zu wenig gesagt, was wahr ist, und so bleibt der freie Wille eine Chimäre, geformt aus den Nebeln der Feigheit.
»Ich esse nichts mehr, bis ihr mir erlaubt, Gesangstunden zu nehmen.«
Die Geräuschkulisse ist immer noch erheblich. Kinder toben, Mütter brüllen, Radios plärren, Motoren dröhnen, auch Lachen ist zu hören. An dem Tisch herrscht Schweigen. Gregor schiebt seinen Teller behutsam zurück. Laura betrachtet einen Fingernagel, dessen Lackschicht abbröckelt. Anna schluckt einen sehr großen Bissen hinunter. »Dann wirst du sterben.«
»Unsinn.« Hanna wirft ihrer Ältesten einen Blick zu, der besagt, dass dieses Wort im Zusammenhang mit Familie tabu ist.
Anna zündet sich eine Zigarette an. Besondere Ereignisse setzen gute Sitten außer Kraft. Laura kann die Stille nicht mehr ertragen: »Jemand, der so dürr ist wie du, sollte nicht so dumme Witze machen.«
»Es ist mein Ernst.« Rita gegen den Rest der Welt, die um einen Campingtisch mit karierter Decke versammelt ist. Das Gefühl ist überwiegend gut, auch wenn sie jetzt plötzlich Hunger verspürt, großen Hunger, als ob sie seit Ewigkeiten nichts gegessen hätte. So lange sie denken kann, wurden Familienangelegenheiten ausdiskutiert, jeder durfte etwas sagen, und am Ende entschieden die Alten, und sie nannten es Demokratie.
»Es ist eine Geldfrage«, sagt Gregor, und Hanna streichelt Ritas Arm. »Wir bitten dich doch nur um etwas Geduld.«
»Es dauert etwa dreißig Tage, bei Rita würde es vermutlich schneller gehen, weil der Körper auf keine Fettreserven zurückgreifen kann.« Anna hat, seit sie in dem Altenheim arbeitet, eine gewisse Distanz zum Tod entwickelt.
»Sei endlich still.« Hannas Hand krallt sich in den Arm ihrer Tochter. »Ich werde diesen Unfug nicht zulassen. Wie kommst du bloß darauf?«
Es war eine Eingebung, denkt Rita. Die meisten Leute misstrauen unerwarteten Gedanken und handeln deshalb so, wie es von ihnen erwartet wird. Der Kompromiss als Lebensform des geringsten Widerstandes.
»Du kränkst uns sehr.« Gregor erklärt ihr, dass das Problem des Lebens darin bestehe, über das Entweder-Oder und den Gegensatz von Ja und Nein, welche die Wahrheit verdunkeln, hinauszukommen. Er schleudert seine sanften Sätze gegen eine Mauer aus Trotz und Ablehnung.
»Vielleicht findet sich ja ein Weg«, sagt Hanna, als die anderen ratlos schweigen. Das Wort, das alle Optionen offen und der Harmonie eine Chance lässt, erschien ihr stets als Trost in schwierigen Zeiten. Die Krisen in ihrem kleinen Reich waren immer mit Vernunft gelöst worden. Und vor allem mit Liebe. Die Essensreste auf dem Tisch erscheinen ihr mit einem Mal obszön. Hanna beginnt, sie einzusammeln und in Plastikdosen zu füllen. Abends wird es ein Ragout geben, überbacken mit Schafskäse, und dazu Rosmarinkartoffeln. Die Verwertung von Resten ist eine Herausforderung, die sie immer gereizt hat. Gewisse Parallelen zum Leben sind nicht auszuschließen. Jeder kann mit den besten Zutaten große Küche zustande bringen. Die Kunst besteht darin, aus Minimalem Großes zu schaffen.
Rita war, im Gegensatz zu allen anderen, nie eine gute Esserin. Vielleicht gibt es für manche Menschen nur eine, unteilbare Leidenschaft im Leben? Gregor hat sie: Sie heißt Hanna. Hanna hat sie: Sie heißt Kochen. Und Gregor. Die Kinder. Und nichts, was darüber hinaus in der Welt geschieht, kommt ihr wirklich nahe. Draußen, das ist Kino, schön oder hässlich, mit Darstellern, die ihr fremd sind, und einem Regisseur, den Gregor früher Gott genannt hat. Heute neigt er eher zum Buddhismus, aber auch hier wäre es richtig, von einem Ragout zu sprechen, aus dem er jeweils das löffelt, was ihm gerade schmeckt. Als Priester wäre er vermutlich ein großes Ärgernis geworden.
Hanna nimmt die Plastiktüte, die am Boden liegt, und füllt sie mit abgenagten Hühnerbeinen. Später wird sie die Knorpel herauslösen und sie dem Hund des Hausmeisters geben. Die Leute werfen alles weg, und am Ende ihr Leben. Weil sie, genau genommen, auch Abfall sind, der letztendlich entsorgt werden muss. An jedem Sonntagabend im Sommer sieht das Ufer des Sees wie eine Müllkippe aus. Dann wünscht sie sich Macht und einen Lautsprecher, um die Leute zu zwingen, für Ordnung in ihrer Welt zu sorgen. Manchmal glaubt Hanna, dass sie ein guter Diktator geworden wäre.
Sie hat ihre Kinder zur Achtsamkeit erzogen, in Bezug auf Menschen und auf Dinge. Alles um sie herum scheint irgendwie zu verwahrlosen. Und jetzt probt Rita den Aufstand gegen die Armut. Hanna hat sie nie als solche empfunden. Es war immer genug zu essen da. Die wichtigsten Wünsche wurden erfüllt. Und jetzt das: Hanna kämpft gegen ein Gefühl, das sie als Wut einstuft. Der Müll und die Wut gegen die Tochter, der sie Schuld zuweist. Es ist unfair, sie will nicht so denken, aber hätte dieses verfluchte Auto nicht...
Jetzt hält sie inne. Es ist ihr immer schwer gefallen, nichts zu tun, ihre Hände nicht zu gebrauchen. Stillstand ist die Bewegung, die Hanna am meisten fürchtet. Tote sind so still. Man begreift nichts, wenn man neben ihnen steht und ganz alleine atmet. Das Zusammentreffen unglücklicher Umstände, das Schicksal, der Zufall, Gottes Beitrag, die wild card, von der Rita immer spricht, als sei sie etwas Begehrenswertes oder Gerechtes ... nein, sie kann keinen Sinn darin sehen, dass man ihr diese Karte entrissen hat, als Hanna glaubte, das Spiel des Lebens in der Hand zu haben.
Rita steht an den Baum gelehnt. Sie sieht ihre Mutter an, und Hanna denkt voller Panik, dass sie ihre Gedanken lesen könne. Rita lächelt, fast verständnisvoll. Dann senkt Hanna als erste die Augen.
»Ich weiß, dass du uns alle sehr liebst.« Rita hilft ihr, die Körbe in den Schatten zu stellen.
Sie ist so unglücklich, diese Tochter, und Hanna glaubt nur in diesem einen Augenblick, dass sie eine Schuld begleichen muss. Also stellt sie die Frage, die Zugeständnis ist: »Wie viel wird es kosten?«
Rita nimmt Hannas Hand, eine Berührung, die selten von ihr ausgeht. Die Hand, die sie ergreift, ist stark und rau, und ihre dünnen, gelenkigen Finger verschwinden fast darin. »Mindestens sechshundert im Monat. Und dafür kriegt man nicht die besten Lehrer.«
»Es ist trotzdem viel Geld. Aber wir werden es irgendwie aufbringen. Nicht wegen deiner lächerlichen Drohung. Ich denke einfach, dass du jetzt dran bist. Wir werden auf anderes verzichten müssen.«
Das Leben ist schön, auch dort, wo man es nicht erwartet. Der Tümpel verwandelt sich in einen glitzernden See. Rita möchte jetzt singen, statt dessen umarmt sie ihre Mutter mit einer Leidenschaft, die nur Musik auslösen kann. Dann nimmt sie Hannas Apfel mit der Großzügigkeit der Siegerin entgegen. Er ist klein und hässlich, und seine Haut ist verschrumpelt.
»Man muss sich durch die Schale beißen«, sagt Hanna.
3
Ich konnte nicht anders. Rita hat diesen Satz nie verstanden. Die Schläger, Vergewaltiger, Kinderschänder, Folterer, Mörder und Wegseher ... sie alle konnten nicht anders? Welche Form der Absolution soll das sein? Der Himmel für alle, die sich in die Hölle der Willenlosigkeit begeben haben? Ein bequemer Platz zum Ausruhen von dem, was fordert und dazu drängt, dem Leben eine Richtung zu geben, die einem zeigt, wer man ist?
Ein Ball, der auf die Straße rollt, kann nicht anders. Die ihm hinterherlaufen, schon. In Ritas Sicht der Welt ist der Wille eine absolute Größe. Sie ist frei. Abgesehen davon, dass sie minderjährig, geldlos und einer Familie ausgeliefert ist, in der jeder versucht, dem anderen seinen Willen aufzuzwingen.
»Ich kann nicht anders«, sagt Anna, und auch aus ihrem Mund klingt der Satz verdächtig. Anna hat sich für diese Wendung und einen Mann entschieden, der als Geburtstagsüberraschung in die Familie eingeführt wird. Ihr Geschenk an Hanna, die so fest daran geglaubt hat, dass ihre älteste Tochter die Familie nie verlassen, sie sozusagen weiterführen wird. Hanna fühlt sich betrogen, und ihre stille Wut senkt sich wie ein bleierner Vorhang über die Tischgesellschaft.
Anna liebt Justus. Also glaubt sie, nicht anders zu können. Er ist vierundsiebzig und ein Bewohner des Seniorenheims, in dem sie arbeitet. Als Geschenk betrachtet ist der Mann ein trojanisches Pferd, das Hanna als Kriegserklärung deutet. Über die Geburtstagstorte hinweg, die aus Lagen von Blätterteig, Schokolade und Himbeeren, Rum und Mascarpone aufgetürmt ist, versucht sie ihre Tochter davon zu überzeugen, dass man in der Liebe irren kann.
»Ich weiß«, erwidert Anna.
Woher wohl? Rita verfolgt den Weg des Tortenstücks vom Teller bis in Annas Mund. Er ist groß und üppig wie alles an ihr. Ungeschminkt, denn Lippenstift würde den Geschmack beeinträchtigen. Anna lässt jeden Bissen im Mund zergehen, bevor sie ihn langsam schluckt. Sie erscheint unbeteiligt an dem Sturm, den sie entfachte, obwohl sie den Eindruck erweckt, aufmerksam zuzuhören.
Gregor spricht von Fortpflanzung, dem natürlichen Kreislauf des Lebens, und während er Argumente formt, fragt er sich, ob die Endungen auf a wirklich eine so glückliche Entscheidung waren. Hanna bestand darauf, sie ist abergläubisch wie ihre irische Großmutter, die mit fünfundneunzig Jahren starb und sieben Kinder und neunzehn Enkel hinterließ. Sie hieß Elsa, und all ihre Töchter und Söhne waren unehelich, doch dieses Detail änderte nichts an Hannas Glauben, dass die Erfüllung im Buchstaben A zu finden sei. Jehova, Buddha, Allah ... was nützt es, sie anzurufen, wenn Anna eine Wahl getroffen hat? Wie ein Fels sitzt sie da, und nichts an ihr ist weich bis auf das Fleisch, das sie einem Mann offenbart, der sein Vater sein könnte.
Hanna erklärt mit ihrer demütigsten Stimme, dass sie sich nichts sehnlicher wünsche als Enkelkinder.
Laura fühlt sich schuldig. Sie betrachtet ihre gepflegten Finger, die Babys liebkosen sollten und statt dessen Brot über die Theke schieben. Sieht Rita an, die wie immer ein wenig abwesend erscheint, eine fehlbesetzte Walküre im Feuerkreis ihres Ehrgeizes. Biologisch und praktisch gesehen, wäre nun wirklich Anna an der Reihe. Hat man je ein so gebärfreudiges Becken gesehen?
Doch Justus kann kein Irrtum sein, denn Anna hält an ihm fest wie am letzten Rettungsring ihres Lebens. Sie wird ihn heiraten, das Datum steht bereits fest. »Wir haben schließlich keine Zeit zu verlieren«, sagt sie, und Rita denkt, das haben wir nie, weil es einen Anfang und ein Ende gibt, und dazwischen eine begrenzte Wirklichkeit.
Hanna weint niemals. Sie wird steinern, und nichts fürchtet Gregor so sehr wie diesen Ausdruck ihres Gesichts. »Charlie Chaplin hat mit achtzig noch ein Kind gezeugt.« Diese, seine Kapitulationserklärung, quittiert Hanna mit einem Senken der Mundwinkel, doch Anna nimmt das Stichwort dankbar auf.
»Wenn ihr es wirklich wissen wollt: Wir haben wunderbaren Sex. Justus ist nicht alt. Er sieht nur so aus. Dieser Mann hat die Seele eines Zwanzigjährigen. Im Übrigen dachte ich immer, dass wir eine besondere Familie seien.«
Sie sieht herausfordernd von einem zum anderen, bevor sie sich ein zweites Stück von der Torte abschneidet und behutsam auf ihren Teller bugsiert. Sie ist eine Fundamentalistin der Sinne: Essen und Sex als wundersame Berührungen des Körpers. Die Alten brauchen so viel Zärtlichkeit, es ist, als hätten sie in ihrem Leben nie genug davon bekommen. Und sie kann sie ihnen geben, und besonders einem, den sie mehr liebt als die anderen. Weil sie weiß, dass Geld nicht wichtig ist, aber zählt, fügt sie hinzu, dass sie die Familie weiterhin unterstützen werde, denn Justus’ Beamtenpension werde für zwei reichen.
Buddha sei Dank. Rita seufzt nach innen, denn Annas Glück oder Unglück zählt nichts im Verhältnis zu ihrer Angst, dass die Gesangstunden ausfallen könnten. Und dies zu einem Zeitpunkt, an dem sie mithilfe ihrer Musiklehrerin jemanden gefunden hat, der sie in Wagners Welt bringen wird. Ritas Herzenssache. Der Mensch, an den sie glaubt, den sie fürchtet, anbetet, liebt, hasst...
Die Ängste sind groß, und sie führen immer zur Quelle des gehätschelten und gehassten Ichs. Rita kann in Gregors Haltung die Furcht vor Hannas Zorn erkennen, denn wie ein Junkie ist er süchtig nach Harmonie, dem schönen Klang der Eintracht. Hanna fürchtet um ihr Gesamtkunstwerk, das vollkommenste all ihrer Gerichte: der von ihr erschaffene Eintopf aus Menschenfleisch. Anna hat Angst vor ihrer Entscheidung, der Veränderung von Lebensumständen, und wer wird sie so vollkommen füttern, wenn sie auszieht?
Lauras Gesicht trägt Spuren von Neid. Sie ist jünger und hübscher und auf dem Kriegspfad, seit sie denken kann. Aber die Helden, die sich ihrem Anriff in Form eines Eherings ergeben könnten, leben anderswo.
Ein Minimum an Aufrichtigkeit, und sie alle würden einander in die Arme fallen – oder aufstehen und getrennte Wege gehen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, denkt Rita, mindestens, aber die Grundlage wäre die Analyse der Wirklichkeit, in der man sich und die anderen ohne Angst oder Kalkül definiert und daraus eine Entscheidung formt. Das Risiko, dass sie falsch sein könnte, wiegt geringer als die dritte Wahl: die Umgehung aller Möglichkeiten bis hin zur Selbstauflösung.
Rita hat fast achtzehn Jahre gelebt und glaubt an die Summe ihrer begrenzten Erfahrungen: Die Substanz ist Angst, und niemand kann sie dir nehmen. Die Furchtlosen sind Mörder oder Märtyrer. Wie der Junge aus ihrer Schule, der sich weigerte, Crack zu nehmen, und aus dem zweiten Stock sprang, als sie ihn einen Feigling nannten. Jetzt ist er ein Verrückter, der humpelt, während Rita vorgab, das Zeug zu schlucken, in ihrer Mundhöhle speicherte und unauffällig ausspuckte.
Schauspielen gehört zum Leben und zur Kunst. Die Stimme allein genügt nicht, man hat es ihr oft genug gesagt. Opernsänger müssen Schauspieler, Leistungssportler und Techniker ihrer Stimme sein, sie müssen fechten – und sterben können, und alles ist hundertmal geprobt und doch ein Spiel des Zufalls.
Hanna ist nach Ritas Einschätzung eine furchtlose und begabte Selbstdarstellerin. Nun nimmt sie zu aller Überraschung ihre älteste Tochter in den Arm. Sie wird eine Hochzeitstorte kreieren, die alles übertrifft, was in diesem Viertel je gebacken wurde. Das Glück ist klein und wird schneller geschluckt, als man es vorbereiten kann.
Hanna hat es immer gewusst und ihre Entscheidungen daran gemessen, das hat sie stark gemacht.
Gregor wird nie zu fragen wagen, was Anna unter perfektem Sex versteht, obwohl das Thema ihn häufig bewegt. Vielleicht, er zieht es in Erwägung, ist es nicht der Tod, sondern das Leben, das Hanna bewogen hat, sich ihm in kleinen Dosierungen zu entziehen. Hannas vollkommener Rücken, ihm zugewandt, wenn er sich die Zähne geputzt hat und zu ihr ins Bett kommt. Die Linie ihres Halses, schöner als jeder andere Teil ihres Körpers, der nur aus Rundungen und Buchten besteht, eine Landschaft von vollendeter Sinnlichkeit. Nie wird er aufhören, sie mit jenem Schmerz zu begehren, den Hanna seine »gregorianische Hörigkeit« nennt. Sein Knoblauchduft, der sie stört. Mein Gott, sie verwendet dieses Gewürz in fast allen Gerichten. Mehr als früher? Oder hat sie früher darüber hinweggerochen? Auch dieser Frage wäre nachzugehen, wenn Gregor es nicht vorziehen würde, sich in Geduld zu flüchten.
Laura wird Anna fragen, ob Justus »ein Kunststück« kann? Eher aus oberflächlicher Neugierde als aus Wissensdurst, denn über Sex weiß sie Bescheid. Sie liest Frauenzeitschriften. Sex ist das, was Männer wollen und Frauen ihnen geben, weil sie Männer wollen. Mehr ist im Grunde nicht daran, aber es ist trotzdem sehr kompliziert. Weshalb so viel darüber geredet, geschrieben und gesendet wird, aber, und das ist Lauras Überzeugung, was all diesen Geschichten fehlt, ist die wahre Liebe, an die sie glaubt, für die sie ausgezogen ist in eine fremde und gefrorene Welt. Alles, was jenseits ihrer Straße, ihres Viertels liegt, erscheint ihr abweisend und Furcht einflößend. Junge Männer, die wie Schläger aussehen. Verkäuferinnen von schönen Kleidern, die ihre Nase rümpfen, weil Laura nach Brot riecht, nicht nach teurem Parfum. Mit dem zaghaften Mut der Verzweiflung versucht sie, sich die Welt jenseits ihrer Bedingungen zu erobern. Der Ehemann hat sich gerühmt, sie in sein soziales Milieu erhoben zu haben. Der Preis war zu hoch. Aber nein, sie will nicht glauben, dass in dieser Straße aller Anfang zum Ende führen wird. Es gibt ein Leben vor dem Tod, und sie weiß genau, wie es aussehen soll: ein netter Mann, ein hübsches Haus, reizende Kinder. Rita würde sagen, dass Lauras Problem in den Adjektiven liegt.
»Die Stimme«, so nennt sie ihre jüngere Schwester, und tatsächlich scheint sich dieses Wesen freiwillig darauf zu reduzieren. Rita mit ihren selbstgefärbten weißblonden Haaren, die sie streichholzkurz trägt, und diesem winzigen Körper, der nur aus Haut und Knochen zu bestehen scheint. Seit sie Gesangstunden nimmt, joggt sie morgens und abends eine Stunde und trainiert mit Hanteln. Sie wird achtzehn und läuft in Jeans und schlampigen Hemden auf einer Spur neben dem Leben. Sie wird scheitern, davon ist Laura überzeugt. Nein, sie möchte es sogar. Weil niemand, den sie liebt, sich über sie erheben soll.
Rita wird Anna nicht fragen, was den besonderen erotischen Reiz eines Vierundsiebzigjährigen ausmacht. Sex in seiner beliebigen Verfügbarkeit interessiert sie nicht sonderlich. Jeder kann es, tut es, und danach fühlt sich jeder irgendwie betrogen. Vielleicht muss sie so alt werden wie Anna oder Hanna, um über die Frage des »Wen kann ich kriegen?« auf das »Wie schön kann es sein?« zu kommen.
Wahr ist natürlich auch, dass Rita kein Objekt der Begierde ist, in Lauras Worten »ganz und gar nicht sexy«. Es gäbe die umnachteten Gebete schräger Typen zu erhören, doch kein Siegfried ist darunter. Romantisch? Vielleicht. Wer in Opern lebt, fühlt sich auf der Bühne der Wirklichkeit immer enttäuscht. Sex ist von Sphärenklängen weit entfernt. Sie hat alle Hoffnung und Furcht auf einen Punkt konzentriert: die Stimme. »Wenn du es wirklich willst, wirst du es schaffen«, das ist Hannas Gebet, nicht überzeugend, aber von Liebe getragen. Wenn sie diesen Satz sagt, dann glaubt Rita daran. Gott hat gesprochen, und wer, wenn nicht ihre Gesangslehrerin wäre die Instanz, in die alles Vertrauen, aller Glaube, alle Zuversicht fließt?
»Ich mache eine Wagner-Sängerin aus dir.«
Rita wird nie vergessen, wie sie ihr die Tür öffnete, beim ersten Mal, und sagte: »Ich war Astrid Stemm.«
Die Frau, die war, ist ein monumentaler Schatten ihrer Vergangenheit. Die Wände der Altbauwohnung im Hochparterre sind dekoriert mit Fotos. Opernszenen, in Hochglanzpapier gepresst, stumme Zeugen dessen, was war, und dies ist wohl der einzige Trost der Gegenwart, der ruhmlosen Einsamkeit, der Angst vor dem Tod, den sie einst so dramatisch und hinreißend interpretierte.
Mit den heutigen Produktionen steht Astrid Stemm überwiegend auf Kriegsfuß. Die Oper, das wiederholt sie oft, verkomme zum Actionfilm mit Gesangseinlagen. »Modern« ist ein Wort, das sie aus tiefstem Primadonnenherzen verabscheut. Astrid Stemm hat vierzig Jahre auf Opernbühnen gestanden, zunächst im Chor, dann in kleineren Rollen in unbedeutenden Städten, um schließlich in Bayreuth zu singen: die Elisabeth, die Ortrud ... doch nie, niemals die Brünnhilde oder Isolde.
Mild und leise, wie er lächelt, wie das Auge hold er öffnet – seht ihr’s, Freunde?