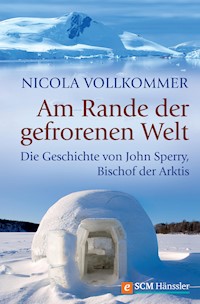Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM R. Brockhaus
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Gott flüstert in die Einsamkeit! Jeder kennt Situationen, in denen er sich allein fühlt, ausgeschlossen oder unerwünscht. Dadurch verstärkt sich oft die reale Einsamkeit, denn man zieht sich von anderen zurück, statt auf sie zuzugehen. Erfolgsautorin Nicola Vollkommer erzählt die große Geschichte: Seit Eden, der verlorenen Idylle, ist es normal, dass wir uns entwurzelt fühlen. Doch wir sind angenommen, aufgehoben! Weil Gottes Flüstern auch in der Dunkelheit zu hören ist, sind wir niemals allein. Er lädt uns in seine "warme Stube" ein und lebt uns vor, wie wir mit Ablehnung, Verletzungen, Missachtung umgehen und echte Freundschaften leben können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicola Vollkommer
Vom Wunsch,dazuzugehören
Das Ende der Einsamkeit und wie Gottsich das mit Gemeinschaft gedacht hat
SCM R. Brockhaus ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-417-22929-5 (E-Book)
ISBN 978-3-417-26867-6 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
2. Auflage 2022
© 2019 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-brockhaus.de; E-Mail: [email protected]
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der
SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
Weiter wurden verwendet:
Hoffnung für alle ® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.®
Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Fontis – Brunnen Basel. (HFA)
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. (LUT)
Lektorat: Christiane Kathmann, www.lektorat-kathmann.de
Umschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im Schönbuch
Titelbild: Joss Woodhead/unsplash.com
Satz: Christoph Möller, Hattingen
Widmung
Gewidmet den vielen lieben Menschen – in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinem Freundeskreis –, die mir durch Wort und Tat vermittelt haben: »In meinem Leben ist Platz für dich!«
Gewidmet dem Gott der Bibel, dessen Blick schon immer auf den Rand der Gesellschaft gerichtet war, wo sich die Einzelgänger und Außenseiter aufhalten. Dem Gott, dessen Verlangen es ist, auch sie in die Wärme seines Hauses hineinzuführen.
Es ist mein Gebet, dass die Impulse in diesem Buch vielen dazu verhelfen, diese Wärme und Zugehörigkeit neu zu erleben.
Inhalt
Über die Autorin
Prolog
1. Die Seele auf Wanderschaft
2. Die Stimme, die nicht schweigen will
3. Der Stammbaum, der Bände spricht
4. Der Preis, den es gekostet hat
5. Beim Namen gerufen
6. Frische Kleider, frisches Wasser – und zurück ins Leben
7. Abgelehnt, aber nicht einsam
8. Beauftragt und gesandt
9. Eine Nachricht, die größer ist als Einsamkeit
10. Die Sache mit der Nächstenliebe – Probe für das Paradies
11. Die Lieblosen lieben
12. Eden kehrt zurück
Anmerkungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
NICOLA VOLLKOMMER ist gebürtige Engländerin und lebt seit 1982 in Reutlingen. Sie gehört zum Leitungsteam der Christlichen Gemeinde Reutlingen, unterrichtet an der Freien Evangelischen Schule und ist eine gefragte Referentin. Sie ist mit Helmut verheiratet, das Paar hat vier erwachsene Kinder.
www.nicola-vollkommer-buecher.de
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Prolog
Ein Geburtstag und viel Gelächter
»Vielen Dank, liebe Geburtstagsgäste, dass ihr gekommen seid. Es ist großartig, so eine große Schar von Marys besten Freunden hier zu sehen. Und ich meine wirklich ihren besten Freunden. Denn ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass Mary buchstäblich Hunderte von Bekannten, Verehrern, Freundinnen und Freunden, Wegbegleitern, Gefolgsleuten, Fans, Junkies, Möchtegernfreundinnen und -freunden, Nachfolgerinnen und Nachahmern hat. Es war für sie ein Kraftakt, ihre ausufernde, weltweite Fangemeinde auf die erlesene Gesellschaft zu beschränken, die heute zu ihrem 80. Geburtstag versammelt ist. Sie hat die Spreu vom Weizen getrennt. Danach den guten Weizen vom schlechten Weizen. Danach den hochwertigen Edelweizen vom guten Weizen. Und ihr seid die Auserwählten, die diesen Hürdenlauf bestanden haben. Glückwunsch! Das ist so etwas wie ein Lottogewinn. Ihr seid die Crème de la Crème von Marys innerstem Freundeskreis.«1
So begann Marys Sohn seine Rede zu Ehren des 80. Geburtstags seiner Mutter. Die versammelte Gesellschaft bog sich vor Lachen. Wer unter der Rubrik »Festrede« eine Gähnnummer erwartet hatte, wurde eines Besseren gelehrt, als der schräge Humor dieser britischen Familie zur Hochform auflief. Viele Gäste baten als Andenken um die Rede in schriftlicher Form.
Eine ausgelassene Stimmung am späten Abend, gutes Essen mit gutem Wein, das Wiedersehen unter guten Freunden: Das alles gehört zu einem fröhlichen Fest dazu. Das Sahnehäubchen auf diesem Fest war aber ohne Zweifel das schmeichelhafte Gefühl, im innersten aller inneren Kreise einen Stammplatz zu haben.
Ein guter Komiker lebt von der Gabe, Dinge auf den Punkt zu bringen, die kein anderer sich trauen würde zu sagen, und Tabus zu brechen. Wir lachen, wenn wir ertappt werden. Wir lachen noch mehr, wenn andere ertappt werden. Vor allem, wenn es Menschen sind, die wir nicht mögen.
Dieser Festredner trieb ein neckisches Spiel mit der Angst, ein Außenseiter zu sein, die tief in jedem Herzen sitzt. Ein Spiel mit der Erleichterung, im Club angekommen zu sein, die Mutprobe bestanden, die Eintrittsrituale absolviert zu haben. Wenn man dort angekommen ist, hat man die Chance, mitzulachen, wenn Insiderwitze erzählt werden, und ein Mitspracherecht, wenn Urlaubsanekdoten ausgetauscht werden. Es ist die Einladung, von den Zuschauerbänken herunterzusteigen und das Spiel auf dem Feld mitzugestalten.
In seinem Artikel »Der innere Ring« schreibt der englische Schriftsteller C.S. Lewis:
Ich glaube, dass der Wunsch, innerhalb des örtlichen Ringes zu sein, und die Furcht, nicht hineinzugehören, zu gewissen Zeiten im Leben aller Menschen und im Leben vieler Menschen zu allen Zeiten zwischen Kindheit und hohem Alter eines der beherrschenden Elemente ist.2
Von der Wiege bis zur Bahre wollen wir dazugehören. Manch einer gibt mehr, als gut ist, um dieses Ziel zu erreichen. Auch ich bleibe von diesem Wunsch nicht verschont.
Der Drang, dazuzugehören
Neulich erwischte ich mich selbst eiskalt. Ich stand vor einer verschlossenen Tür, hinter der lauter mir fremde Leute versammelt waren. Ein Wirrwarr von Stimmen und das Klappern von Geschirr waren zu hören. Ich holte tief Luft und betrat den Raum.
Es wurde ruhig und die Blicke vieler junger Leute richteten sich auf mich. Da sie an Tischen saßen und beim Essen waren, drehten sich einige um, weil sie schauen wollten, wer in der Tür stand. Ich schluckte, spürte, wie mein Gesicht anfing zu glühen, räusperte mich verlegen und stammelte irgendetwas wie: »Guten Appetit.« Es fiel mir zu spät auf, dass die meisten Teller schon leer waren. Mein Blick fiel auf einen leeren Stuhl in der Ecke. Ich sank hinein und wünschte, ich könnte samt Stuhl in den Boden versinken.
Ich war jedoch nicht die Neue in der Klasse, die einen Raum voller skeptisch dreinschauender Pubertierender betritt. Ich war die Referentin bei einem vornehmen Studentenabend. Sobald die Teilnehmer wussten, wer ich war, wurde der symbolische rote Teppich für mich ausgelegt, und im Nu war ich im »inneren Ring«.
Räume voller fremder Menschen sind mein tägliches Brot, ich müsste sie gewohnt sein. Und dennoch: Das Herzklopfen, der Kloß im Hals, das beklemmende Gefühl, ein Fremdkörper in einer Runde zu sein, in der alle sich kennen, bleiben. Übersensibilität? Lampenfieber? Überbleibsel der urzeitlichen Ängste meiner Vorfahren? Man befindet sich fernab des eigenen Stammes und bangt um sein Leben? Ein verirrter Gallier, der sich plötzlich unter Römern wiederfindet? Vielleicht eine Kombination aus allem.
Ein harmloses Beispiel aus dem Alltag, mag sein. Schweißnasse Hände, nur weil ich eine Versammlung besuche, in der ich niemanden kenne. Lachhaft. So ist das Leben halt. Ich kann nicht erwarten, auf Händen ins Geschehen getragen zu werden. Ich muss mir meinen Platz in der Gruppe verdienen. Akzeptanz wird nicht geschenkt, sie wird erarbeitet. Und schließlich gibt es auch Gruppen, in denen ich nicht unbedingt akzeptiert sein will.
Trotzdem: Wir Menschen sind Herdentiere, und das Verlangen, zum Stamm zu gehören, wirkt sich bis in die kleinsten Details unseres Alltags aus, manchmal ohne dass wir es merken. Es bestimmt, wie und mit wem ich den Abend verbringe, wofür ich mein Geld ausgebe, wessen Zuwendung ich suche, über welche Einladungen ich mich freue und welche ich ablehne, welche Termine ich mit Ausrufezeichen in meinen Kalender eintrage und welche in Klammern stehen.
Ein Instinkt mit Vor- und Nachteilen
Nicht-Mitglieder eines inneren Rings sind leicht zu übersehen, weil sie meist kein Aufsehen erregen, keinen Lärm machen und sich nicht viel bewegen. Sie halten sich irgendwo am Rand auf. In den Schatten. Sie sitzen allein auf der Kirchenbank und starren auf ihr Smartphone oder blättern in ihrer Bibel, bevor der Gottesdienst beginnt. Schauen mit vorgetäuschtem Interesse auf die Kalender am Büchertisch, stehen mit verschränkten Armen vor der Pinnwand und informieren sich angeblich über den Bowlingabend. Verlassen als Letzte das Klassenzimmer, stehen mit abwesendem Blick abseits von der Menge im Pausenhof und kauen ihr Pausenbrot langsam, damit die Zeit wenigstens gefüllt ist. Sitzen am Tisch in der hintersten Ecke der Betriebscafeteria, vergraben ihren Kopf hinter einer Zeitung, als ob es ihnen nichts ausmachen würde, außerhalb der Clique zu sein.
Andere Außenseiter können und wollen nicht übersehen werden, setzen alles daran, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Kleidung, schräge Kommentare, Tabubrüche, Rebellion, Süchte: Die Mittel, die zur Verfügung stehen, um aus der Menge herauszustechen, sind endlos. Jeder Lehrer, der einer Schulklasse vorsteht, kann ein Lied davon singen. Früher nannte man manche dieser Kinder »Klassenclown« oder »verhaltensauffällig«, heutzutage heißt das »verhaltenskreativ«.
Egal, wie flüssig die Grenzen zwischen Kulturen, Sprachen und Ländern sind und wie fleißig beteuert wird, dass jeder in seiner Unterschiedlichkeit zu einer Gesellschaft oder Klasse dazugehört, der Mensch organisiert sich instinktiv immer wieder neu in Stämmen und in inneren Ringen der »Eingeweihten«. In Sportvereinen, in Hippiekommunen, in politischen Bewegungen, auf Protestmärschen, in Gemeinden, in Fraktionen innerhalb von Gemeinden, in WhatsApp-Gruppen. Sogar militante Aussteiger gründen ihre Insidergruppen, in denen sie sich mit anderen Aussteigern austauschen. Einer der neuesten Trends in amerikanischen Colleges ist die Einrichtung von »Safe Spaces« (»sicheren Räumen«), in denen Minderheiten unter ihresgleichen sind und keiner befürchten muss, sich mit jemandem auseinandersetzen zu müssen, der anders aussieht oder anders denkt als er.
Das Leben innerhalb eines inneren Rings wird von ungeschriebenen Regeln bestimmt, die andeuten, wer dazugehört und wer nicht. Jede Clique hat ihre eigene Geheimsprache mit Körpersignalen – Blicken, Hand- und Schulterbewegungen –, die den Unterschied zwischen »du« und »wir« signalisieren. Oder den Unterschied zwischen »Sie« und »du«. Wer von wem den Spitznamen kennt. Wer bei der Begrüßung umarmt wird und wer nicht.
Manchmal werden schadenfrohe kleine Fragen mitten ins Gespräch hineingestreut: »Ach, wurdest du nicht informiert?« Oder: »Bist du auch zur Hochzeit eingeladen?«, »Ach, ich dachte, du kennst das Brautpaar.« Das gehört ebenfalls zum Leben im inneren Ring: unsere Zugehörigkeit mit kleinen Andeutungen zur Schau zu stellen. Wer von uns freut sich nicht, von einem wichtigen Mitglied des inneren Rings freudig mit Vornamen und einem »Schön, dass du da bist!« begrüßt zu werden?
Eine Freundin, aus deren Gunst ich einmal gefallen war, zeigte gern ihren Unmut dadurch, dass sie alle Menschen um mich herum bei der Begrüßung euphorisch umarmte, mich aber eiskalt überging. Damit wollte sie verdeutlichen, dass ich nicht mehr zu ihrem inneren Ring gehörte. Leider habe ich, bewusst oder unbewusst, manchmal ähnliche Spielchen getrieben.
Der Herdeninstinkt ist an und für sich nicht verwerflich – immerhin hängt unser Überleben davon ab. Das Erste, was ein Säugling sucht, sobald seine Augen mehr als nur Schatten und Licht erkennen können, ist der Blickkontakt zu anderen Menschen, das Gefühl: Ich bin hier angenommen. Die Zugehörigkeit zu einem »inneren Ring« ermöglicht es den Mutter Teresas dieser Welt, Menschen mit ansteckender Begeisterung in ihren Dunstkreis zu ziehen, um Gutes zu tun und die Welt zu verändern. Doch sie verhilft genauso den Stalins und Hitlers dieser Welt dazu, grausame Machtzentralen zu errichten, alle Gegenstimmen von Außenseitern auszuschalten und letztlich die Außenseiter selbst auszulöschen. Sie ermöglicht das Heldentum, mit dem ein Mann sein Leben für seinen Bruder hingibt, genauso wie die Niedertracht, mit der ein anderer »Ausländer raus!« brüllt.
Die Bibel: Psychologie mit Tiefgang
In seinen Begegnungen mit Menschen und in seinen Erzählungen verwendet Jesus mit großem Geschick die Psychologie des »inneren Rings«. Seine Menschenkenntnis ist phänomenal. Kein Wunder, schließlich ist er Gott. Und er verbringt viel Zeit damit, in aller Gelassenheit und mit einem scharfen Auge seine Umgebung zu beobachten. Eine Frau, die ein paar Münzen in einen Opferkorb wirft. Eine aufgebrachte Menge, die eine Ehebrecherin steinigen will. Ehrgeizige Mitarbeiter, die sich um Hackordnungen streiten. Zwei Männer, die in den Tempel kommen, um zu beten.
Er baut seine Beobachtungen in seine Gleichnisse ein. Zu seinen Lieblingsthemen gehört das Verhalten von Gästen bei Hochzeiten und Festen, denn dort kommt am deutlichsten zum Ausdruck, wie sich der Herdendrang auf Menschen auswirkt. Die raffinierte Unverschämtheit, mit der Jesus Menschen durchschaut, macht seine Erzählungen zu meisterhaften soziologischen Studien.
In der geistlichen Elite im damaligen Israel fand ein giftiges Aufeinandertreffen aus Macht und Prestige statt. Die Hauptbeschäftigung der Pharisäer und Sadduzäer war es, die Grenzen ihrer Exklusivvereine mit Adleraugen zu überwachen. Ihre Geheimsprache war längst nicht mehr geheim. Sie posaunten lautstark auf den Straßen, Marktplätzen und Synagogen, wer »in« und wer »out« war, zeigten es stolz in ihrer Kleidung, ihren Gebärden, ihrer Körperhaltung, ihrer Art zu beten und ihren VIP-Logen und reservierten Plätzen bei großen Versammlungen. Ihre Lebensdevise: »Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen«(Lukas 18,11). Sie versuchten nicht einmal, den Anschein der Bescheidenheit zu wahren. Sie hatten aus den überlieferten und ihnen anvertrauten Anweisungen Gottes ein wasserdichtes Kastensystem gemacht. Ihr Hauptsponsor war Gott höchstpersönlich, davon waren sie überzeugt.
Das Faszinierende an Jesus ist: Er hätte auf Anhieb mitten in den exklusivsten Cliquen seiner Zeit einen Stammplatz haben können. Er war ein begehrter Gast bei allem, was in Israel Rang und Namen hatte, er war bei den festlichen Abenden der Schönen und Reichen gern gesehen – zumindest am Anfang seines Dienstes. Gute Verbindungen, Menschen, die man kennen sollte, um im Leben voranzukommen, eine riesige Gefolgschaft: Ihm fehlte es an nichts davon. Die Welt lag ihm zu Füßen. Aber er kümmerte sich nicht darum.
Stattdessen wurde er nicht müde, aus diesen inneren Ringen eine Lach- und Lehrnummer zu machen. Jede gute Geschichte hat unter ihren Charakteren einen arroganten Besserwisser, der sich für etwas Besonderes hält, anbiedernde Lakaien um sich sammelt und am Ende entlarvt wird. Weil die damalige Gesellschaft von solchen geradezu wimmelte, scharten sich deren Opfer um Jesus – nicht nur wegen der Zeichen und Wunder, die er tat, sondern weil er es wagte, diejenigen mit einem Augenzwinkern zu entlarven, die dem Fußvolk im Namen Gottes das Leben zur Hölle machten.
So trotzte Jesus fröhlich jedem Versuch der »inneren Ringe«, aus ihm ein Superstar zu machen und ihn mit seinem Charme und seiner Beliebtheit vor ihren Karren zu spannen. Sein Blick schweifte immer in die andere Richtung, auf diejenigen, die sich abseits, in den Schatten, aufhielten. Die Spannung zwischen den »Insidern« und den »Outsidern« ist das, was seine Erzählungen so fesselnd macht. Er bewegte sich mit demonstrativer Beharrlichkeit außerhalb der vornehmen Kreise seiner Zeitgenossen.
Seine Begegnungen mit Menschen waren so spannend wie die Geschichten, die er erzählte, und mit einer ähnlichen Klientel besetzt. Ein verlorenes Schaf, eine abhandengekommene Münze, ein abtrünniger Sohn, ein Bettler, der an den Toren einer Stadtvilla seine eitrigen Wunden kratzt, Aussätzige, Lahme, Blinde, gestrandete Frauen – verwitwet, krank, allein, missbraucht – und viele mehr, alle mit dem Stempel »nicht erwünscht, nicht eingeladen« auf ihrer Stirn. Das waren seine Helden. Das war sein »innerer Ring«.
Das heißt aber nicht, dass man erst eine gescheiterte Existenz vorweisen musste, um Zugang zu Jesus zu finden. Auch hochrangige Theologen, erfolgreiche Geschäftsmänner und Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht gehörten zu seinem Freundeskreis. Allerdings waren sie keine typischen Vertreter ihrer Art, sondern die eher seltene Ausnahme, Menschen, die trotz ihrer Errungenschaften mutig genug waren, um zu erkennen, dass selbst der Zutritt zu den feinsten Häusern dieser Welt nicht glücklich macht.
Günstige Voraussetzungen im Leben übertünchen bestenfalls unsere Einsamkeit oder lenken davon ab, doch sie lösen sie nicht. Es gibt tief in jedem menschlichen Herzen einen Schrei nach Zugehörigkeit, auf den nur Gott selbst eine Antwort hat. Gerade das war der Kern von Jesus’ Botschaft.
Einladung ins Abseits
Bei Marys Geburtstag waren nur die Eingeweihten aus ihrem innersten Zirkel zugelassen, aber bei Gottes Festen sind alle eingeladen. Keiner muss sich einschmeicheln, sich anbiedern, eine Geheimsprache beherrschen, sich beim Häuptling des Stammes um Gunst bemühen. Es gibt nur eine Bedingung: Wir müssen kommen wollen. Von ganzem Herzen. Ohne versteckte Ansprüche, Wunschlisten, Forderungen. Wir müssen kommen wollen, weil wir ihn, den Gastgeber, wollen. Zu seinen, nicht zu unseren Bedingungen.
Dieses Buch ist eine Einladung, in Gottes »inneren Ring« hineinzuschauen und dort unterwegs zu sein. Biblischen Helden nachzuspüren, die Teil dieses Ringes wurden. Vielleicht auf diesem Weg selbst eine Sehnsucht nach dieser Zugehörigkeit zu bekommen – nach dem Ort, an dem jede menschliche Einsamkeit ein Ende hat und die suchende Seele endlich zu Hause ist.
Es wird eine spannende Reise!
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1. Die Seele auf Wanderschaft
Die Suche nach uns selbstund nach dem Ort, wo wir zu Hause sind, gestaltet sich deshalbso schwierig, weil wir letztlich nichtauf das Finden aus sind – sondern auf das Gefunden-Werden.
HANS-JOACHIM ECKSTEIN3
Das »gewisse Etwas« und eine Fata Morgana
Hin und wieder, unverhofft und mitten im Alltag, überkommt mich das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt. Es gibt Tage, an denen dieses Gefühl besonders stark ist. Zum Beispiel, wenn meine Unterrichtsstunde in der Schule schiefgeht oder ich das Gefühl habe, dass mein Bemühen, etwas gut zu machen, umsonst war, oder wenn ich Kopfweh habe, etwas Dummes getan habe oder das Begräbnis von jemandem, der mir viel bedeutet, plötzlich in meinem Terminkalender unterbringen muss. An solchen Tagen ist offensichtlich, dass mir etwas fehlt.
Aber das Gefühl überkommt mich auch an sonnigen Tagen, an denen meine Schülerinnen und Schüler mich lieben, die Familie harmonisch ist, das Konto gefüllt, alle rundherum gesund sind und ich von lieben Menschen umgeben bin. Ich empfinde dieses unterschwellige Nörgeln, im Leben nicht ganz angekommen zu sein. Das Gefühl, dass um die nächste Ecke oder hinter dem Horizont irgendetwas auf mich wartet, das mir die Erfüllung aller Träume verspricht, das Erlebnis, bei dem mein Herz aufatmet und jubelt: »Endlich habe ich es gefunden! Meine Suche ist zu Ende!«
Wenn ich in solchen Momenten zu lange grübele, werde ich melancholisch. Ohne konkreten Anlass trauere ich geliebten Menschen nach, die verstorben sind und deren Tod ich eigentlich längst verarbeitet habe. Ich frage mich, wie unser fünftes Kind sich entwickelt hätte, das ich vor achtzehn Jahren durch eine Fehlgeburt verloren habe. Begriffe wie Midlife-Crisis und Lebensmüdigkeit treiben durch meinen Kopf. Ich fühle mich mit vergangenem Schmerz, der nicht ganz verschwinden will, alleingelassen, als ob irgendjemand mich in Stich gelassen hätte und ich nun verwaist in dieser Welt unterwegs wäre. Irgendwann raufe ich mich zusammen, habe ein schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich alles im Leben habe und jeden Grund hätte, dankbar zu sein, wende mich meinen Aufgaben wieder zu und das Leben geht weiter.
Die beschriebene nagende Niedergeschlagenheit der Seele lässt sich schwer definieren. Einsamkeit, aber mehr als nur Einsamkeit. Die Romantiker nahmen sie sehr ernst und versuchten, sie in Gedichten und Gemälden einzufangen. Sie hatte diffuse Namen wie Wanderlust, Fernweh, Melancholie und Nostalgie und lieferte Inspiration für üppige Bilder einer fernen Heimat, die einsame Wanderer mit verführerischen Melodien lockt.
Der Dichter Joseph von Eichendorff schrieb:
Wohin du auch in wilder Lust magst dringen, Du findest nirgends Ruh, Erreichen wird dich das geheime SingenAch, dieses Bannes zauberischen Ringen, – entfliehn wir nimmer, ich und du!4
In einem Tutorium während meines Deutschstudiums an einem Frauencollege in der Universität von Cambridge mussten wir einmal Gedanken darüber zusammentragen, was Eichendorff mit diesem Gedicht gemeint haben könnte. Ideen purzelten durcheinander. »Das geheime Singen«, »dieses Bannes zauberischen Ringe« – das Arbeiterparadies von Karl Marx? Grünende Wälder und sauberer Regen? (Greenpeace war damals gerade in die Gänge gekommen und das Waldsterben ein großes Thema.) Eine gelingende kirchliche Ökumene, das Ende des Kalten Krieges, die Abschaffung von Armut, guten Sex, eine große Liebe, Ruhm und Ansehen?
Gedichtinterpretation, die von allein läuft, der Traum jedes Pädagogen. Der Dozent lehnte sich mit einem breiten Grinsen in seinem Sessel zurück und wandte sich irgendwelchen anderen Texten zu, während seine kleine Schar von Möchtegern-Akademikerinnen um die Wette diskutierte. Er beendete die Runde mit seinem üblichen Spruch: »You make the poem mean, what you want it to mean« (»Ihr lasst das Gedicht das bedeuten, was ihr wollt, dass es bedeutet«), und verabschiedete uns.
Wahrscheinlich hatte er recht. Das »geheime Singen«, das die Seele lockt und Ruhe verspricht, kann alles Mögliche bedeuten. Dichter und Liedermacher sind nicht die Einzigen, die zu jeder Zeit der Geschichte mit der Rastlosigkeit der menschlichen Seele ihr Brot verdient haben. Machtgierige Führer haben es verstanden, sie für eigene Zwecke zu missbrauchen und in ein gemeinsames Streben nach einer Utopie zu verwandeln. Der Mensch muss nicht auf Wanderschaft gehen und sich dem Bann heimlicher Melodien ausliefern, um Heimat zu finden, flüstern sie ihrer Anhängerschaft zu. Das Paradies liegt vor der Tür – es muss nur erobert werden.
Wir umgeben uns mit unseresgleichen und gestalten die Welt so, wie wir sie gern hätten. Staatsideologen haben begriffen, dass in der Sehnsucht eines Menschen nach Zugehörigkeit eine ungeheure Kraft steckt. So entwickeln sich Kulturen und Nationen. Es werden in ihrem Namen Kriege geführt.
Diese Sehnsucht hinterlässt ihre Spuren nicht nur auf den Landkarten und in den Geschichtsbüchern dieser Welt, sondern zieht sich auch durch die Biografien einzelner Menschen. Nicht zuletzt findet sie sich in den üppigen Villen und Palästen, welche die Schönen und Reichen durch die Jahrhunderte hindurch wie für die Ewigkeit errichten. Traumfabriken, die aus der Ferne winken, Anschaffungen, die nie genug sind. Beziehungen, die wie alte Kleider weggeworfen und gegen neue ausgetauscht werden, wenn sie nicht das große Glück bringen. Auch mit allen Besitztümern, Errungenschaften und Vergnügungen, welche die Welt zu bieten hat, bleibt die Seele einsam und leer.
Eine schockierende Entdeckung
Ein Prediger im Alten Testament beschreibt seine fatale Suche nach Befriedigung so:
Alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe.
PREDIGER 2,10
»Wenn ich nur dies oder jenes hätte, dann wäre ich endlich glücklich!«, so denken wir. Die große Liebe, das Wunschkind, den Traumjob, das Haus, den Urlaub, die Freunde, die Figur, die Begabung … Dieser Mann hatte einen Zugang zu weltlichem Glück, der vermutlich die meisten Menschen gelb vor Neid werden lässt. Er verfügte über einen Reichtum, mit dem er sich jeden Wunsch erfüllen konnte. Doch er beging einen Fehler: Er fing an, nachzudenken:
Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind.
PREDIGER 2,11-12
Ein trauriges Fazit.
Der Prediger macht dieselbe schockierende Entdeckung, die manch ein millionenschwerer Superstar in Drogenorgien zu verdrängen versucht: dass man die ganze Welt besitzen und trotzdem seine Seele verlieren kann. Nachdem man alles erreicht hat, was dieses Leben zu bieten hat, steht man orientierungslos und einsam vor der gleichen Leere und Sinnlosigkeit wie davor. Das hungrige Herz bleibt hungrig. Der Traum ist ausgeträumt, es gibt keine Ziele mehr, die es zu erreichen gilt. Oben auf dem Gipfel des Erfolgs ist die Einsamkeit noch schlimmer. Eine Sache konnte der Prediger mit seinem riesigen Vermögen nicht kaufen: Zugehörigkeit, Freundschaft, Heimat.
In seine düsteren Grübeleien über den Sinn des Lebens streut er verlockende Anspielungen, dass es irgendwo eine Antwort auf sein Dilemma geben muss. Er redet davon, dass Gott »die Ewigkeit in ihr Herz« gelegt hat (Prediger 3,11) und dass »alles, was Gott tut, für ewig sein wird« (Vers 14). Keine Belehrungen, keine dramatischen Aha-Momente. Nur Feststellungen, kleine Hinweise, fast beiläufig und leicht zu übersehen. Sie klingen trocken, akademisch. Mit vier nüchternen, aber gewichtigen Worten schließt er seine Studie ab. »Denke an deinen Schöpfer« (Prediger 12,1).
Als es die Einsamkeit noch nicht gab
Die Ewigkeit im Herzen. Gedanken an den Schöpfer. Der Prediger, am Ende seines Lebens ein gebrochener Mann und eingefleischter Zyniker, lässt einen Hauch von Heimweh in seiner verkrusteten Seele zu. Mitten in der Sinnlosigkeit seines Daseins wittert er Überreste von einer Heimat, die es einmal gegeben hat. Die ferne Erinnerung an einen gemeinsamen Gang durch einen Garten in der Kühle des Abends, in der Begleitung des Schöpfers, in dessen Nähe der Begriff Einsamkeit seine Bedeutung verliert.
Wer Einsamkeit verstehen will, muss vor der Schöpfung beginnen. Die Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist war die vollkommenste Heimat, die es jemals gegeben hat: drei getrennte Persönlichkeiten, die in völliger Harmonie ineinanderflossen, miteinander, aber auch füreinander lebten, herrschten, schöpferisch handelten. Es war ein Miteinander frei von Kalkül. »Ich helfe dir – aber nur, wenn du mir hilfst« – auf solche Gedanken wären sie nie gekommen. Hin und wieder gibt uns die Bibel einen kleinen Einblick in diese Dreier-Freundschaft, vor allem in den Reden von Jesus. Aus seinen Worten sprüht immer wieder seine Verehrung für seinen Vater, eine Mischung aus Zuwendung, Faszination und Ehrerbietung.
Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist; wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen!
JOHANNES 14,11
Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott.
JOHANNES 8,54
Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn.
JOHANNES 5,19
Die Zuneigung ist gegenseitig. Der Vater ist stolz auf den Sohn und fordert dessen Nachfolger auf, auf seine Worte zu achten: »Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört!« (Lukas 9,35).
Der Heilige Geist ist mit von der Partie. Er ist es, der Jesus in die Wüste schickt. Jesus gehorcht ohne Widerrede, nennt ihn später den anderen Beistand, der in Ewigkeit bei uns ist (Johannes 14,16). Und er ergänzt:
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
JOHANNES 14,26
Es gibt nur eine Triebkraft in dieser Gemeinschaft: das Bedürfnis des einen, aktiv für den anderen Raum zu machen. Eine freiwillige Unterordnung, die mit Unterwürfigkeit nichts zu tun hat. Eine Abscheu davor, sich selbst in Szene zu setzen. Diese gegenseitige Hingabe findet ihren stärksten Ausdruck in jener schrecklichen Nacht, in der der Sohn eine verzweifelte Bitte über seine trockenen, schluchzenden Lippen bringt: »Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg« (Lukas 22,42).
Einmal hat der Sohn einen Wunsch, der mit dem Plan des Vaters nicht übereinstimmt. Jede Faser seines Wesens sträubt sich gegen die Aussicht auf die brutale Folter, die ihm bevorsteht. Einmal denkt er an sich. Panik steigt in ihm auf. Das Gebrüll der Gequälten auf dem römischen Hinrichtungsplatz, das er unzählige Male gehört haben muss, als er nach Jerusalem kam, klingt in seinen Ohren. Die Fratzen und Grimassen der Hölle, die ihre gesamte Macht gegen ihn entfesselt hat, grinsen ihn aus dem Hinterhalt unter den schattigen Bäumen an und können ihre Stunde des Sieges kaum erwarten.
Aber selbst in diesem Augenblick des Horrors fügt er sich dem Willen des geliebten Vaters: »… doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe!« (Lukas 22,42).
Es ist eine sich freiwillig und freudig schenkende Liebe in ihrer reinsten Form, frei von den Hintergedanken und geheimen Agenden, die in menschlichen Beziehungen zu endlosen Lawinen von Missverständnissen und Verletzungen führen, frei von Neid, Misstrauen, Tränen, vom unterschwelligen Drang, den eigenen Vorteil doch mehr zu suchen als den der anderen. Die Unterscheidung »eigene« und »andere« gibt es in dieser Gemeinschaft nicht. Das Glück des einen ist das Glück des anderen.
Vollständig eins mit dem anderen und dadurch umso einzigartiger als eigenständige Persönlichkeit – so stellt uns die Bibel die Dreieinigkeit Vater-Sohn-Heiliger Geist vor. Diesen drei Freunden würde es nicht im Traum einfallen, auszubrechen und sich auf die Suche nach einem Glück außerhalb dieser Gemeinschaft zu machen.
Eine Gemeinschaft mit Form und Farbe
Die Umgebung, in der diese außerordentliche Gemeinschaft gepflegt wird, ist atemberaubend. Es sind Klänge und Farben, die so überwältigend sind, dass menschliche Augen sie nicht ertragen würden.
Gelegentlich stolpern Diener Gottes in der Bibel auf kleine Risse in der Wand zwischen Himmel und Erde, durch die sie mit weit aufgerissenen Augen einen Blick in die Himmelswelt erhaschen. Vergänglichkeit wird für ein paar Sekunden von Unvergänglichkeit überrascht und derjenige, der diese flüchtigen Momente erleben darf, ist nie wieder derselbe. Solche Momente sind sorgfältig dosiert – intensiv genug, um den Beobachter in ein sprachloses Staunen zu versetzen, aber nicht so intensiv, dass er davon erschlagen würde. Biblische Seher wie der alttestamentliche Prophet Daniel und viele Jahrhunderte später der Apostel Johannes ringen um Formulierungen, um diese Momentaufnahmen in Worte zu fassen.
Die Häufung des Wortes »wie« in der Offenbarung des Johannes zeigt, wie unzulänglich menschliche Sprache ist, um den Himmel zu beschreiben. Wir lesen von einer Stimme »wie von einer Posaune« (Offenbarung 1,10), einem Thron »gleich einem Jaspisstein und einem Sarder« (Offenbarung 4,3). Vor dem Thron sieht Johannes etwas »wie ein gläsernes Meer (Offenbarung 4,6) und weiter »wie ein großer feuerflammender Berg« (Offenbarung 8,8).
Mitten in diesem Schauplatz der unvorstellbaren Herrlichkeit und in der fröhlichen Dreierschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist entsteht die Idee »Mensch«. Wahre Liebe kann nicht auf einer Insel existieren. Sie lässt sich nicht abkapseln. Sie sprudelt über ihre Grenzen hinaus, sucht automatisch nach einem Gegenüber, nach Möglichkeiten, ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, andere in die Runden ihres ansteckenden Lachens hineinzulocken. Sie muss sich multiplizieren. Es steckt in ihrem Wesen wie das Verlangen eines verliebten Paares nach einem Kind, nur viel kräftiger, unverdorbener, hartnäckiger, feuriger.
Die Erde wurde als zweiter Standort geschaffen, in den die Fülle der schöpferischen Kraft der Himmelsgemeinschaft hineinsprudeln sollte. Ein Tanzparkett, auf dem die Künstler neue Choreografien erproben wollten, ein Gemälde, in das der Maler seine Träume von Schönheit hineinzuschütten wünschte. Ein Wunderwerk nach dem anderen floss aus den Fingern Gottes. Himmelskörper, Meere und Seen, Bäume, Pflanzen und allerlei Tierwesen.
Kennst du den Garten? – Wenn sich Lenz erneut, Geht dort ein Mädchen auf den kühlen GängenStill durch die Einsamkeit, Und weckt den leisen Strom von Zauberklängen, Als ob die Blumen und die Bäume sängenRings von der alten schönen Zeit.
Das ist die zweite Strophe von Eichendorffs Gedicht »Heimat«. Während die Teilnehmerinnen meines damaligen Tutoriums aufgeregt über die Ruhestätte für wandernde Sehnsüchte diskutierten, versuchte ich, mir die Gesänge der Blumen und Bäume »von der alten schönen Zeit« vorzustellen, die der Dichter hier beschreibt. Mir kam sofort der Garten Eden in den Sinn. Vielleicht war das Eichendorffs Absicht. Der Romantiker träumte vom einzigen Ort, in dem der Blick des Menschen auf der Suche nach Glück nicht in die Ferne schweifen musste, weil er alles hatte, was er brauchte.
Das Wunderwerk Mensch
Irdische Schönheit, das Abbild himmlischer Schönheit, wurde mit einem grandiosen Meisterstück gekrönt, als Gott sprach: »Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich!« (1. Mose 1,26).
Der Mensch: ein Gegenüber für Gott, mit dem Prädikat »sehr gut«. Ein weiteres Mitglied im Gespann, mit dem der Schöpfer Freundschaft pflegen, Pläne schmieden, Tiere benennen, schöpferische Kraft entfalten konnte. Er war in keiner Weise auf uns Menschen angewiesen. Weder brauchte er uns als Arbeitskräfte noch war er einsam noch hatte er von uns irgendeinen Nutzen. Der Mensch war einfach die Vervielfachung von Glück. Sein Sonderstatus: Freund Gottes.
Es war der Reichtum einer Liebe, die aus freien Stücken geschenkt wird. Keine Unterwürfigkeit, keine Zuwendung, die mit Zwang eingefordert wird, sondern die dankbare Erwiderung einer Freundschaft, die über alles geschätzt und geachtet wurde.
Nur eine Sache wurde vom Schöpfer als »nicht gut« bezeichnet: dass der Mensch allein war. Selbst das Paradies konnte der Mensch nicht in vollen Zügen genießen, solange ihm die Gesellschaft von seinesgleichen fehlte. Einsamkeit war die einzige unerfüllte Sehnsucht, unter welcher er vor dem Sündenfall leiden musste. Als irdisches Gemeinschaftswesen hatte er noch kein irdisches Gegenüber.
So nimmt die Erschaffung von Lebensgemeinschaften ihren Lauf. Eva wird dem ersten Mann als Gefährtin gegenübergestellt.
»Als Mann und Frau schuf er sie«, lesen wir in 1. Mose 1,28. Die bunte Vielfalt, die schon in der Schöpfung der Pflanzen und Tiere als »sehr gut« bezeichnet wurde (Vers 25), sollte auch in der Erschaffung der ersten Familie ihren Ausdruck finden. Einzelstücke sollten es sein, jedes eine Klasse für sich, jedes mit einem auf es zugeschnittenen Auftrag. So wird Eva nicht als Sexpartnerin, Küchenmagd, Gebärmaschine oder Partnerin auf Zeit geschaffen, sondern als Gegenüber: »Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht« (1. Mose 2,18).
Die Wesensart der himmlischen Gemeinschaft wird in das Verhältnis von Mann und Frau hineingebaut. Ergänzung, Partnerschaft auf Augenhöhe, eine Seele verteilt auf zwei Körper. Der eine fördert aktiv die Andersartigkeit des anderen, macht ihn zum Teil der eigenen Persönlichkeit. Der Mensch, dessen Alleinsein »nicht gut« war, findet seine Vollständigkeit im Austausch mit dem zu ihm passenden Gegenüber.
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden.
1. MOSE 2,24
Aber die Entstehung des ersten Menschen war kein Selbstzweck. Sie war mit einem Auftrag verknüpft.
Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!
1. MOSE 1,28
Und Gott, der HERR, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.
1. MOSE 2,15
Eden war ein Außenposten des Himmels. Hier sollte die Herrlichkeit Gottes wuchern, gedeihen, immer mehr Raum einnehmen, immer neue Ausdrucksformen finden und unter der Regie des ersten Ehepaares mit weiteren Ebenbildern Gottes bevölkert werden.
Der Sturz
Das Risiko, das Gott dabei eingegangen ist, war von Anfang an klar. Andersartigkeit, als Ergänzung gedacht, beinhaltet auch die Möglichkeit, zu kentern und sich in Unabhängigkeit zu verwandeln. Freiwillige Hingabe bedeutet Verwundbarkeit. Wer aus freien Stücken liebt, kann aus freien Stücken Liebe vorenthalten. Die Schaltzentrale für diese inneren Prozesse ist der menschliche Wille. Gott hat ein Konzept erfunden, das wenige Herrscher dieser Welt begriffen haben: ein Verlangen, das Richtige zu tun, das von innen kommt. Ein Gesetz, das in Herzen geschrieben ist und dem Menschen nicht von außen aufgedrückt wird. Allein der Mensch verfügt über die Wege, die in seinem Herzen gebahnt werden. Dieses Konzept heißt Freiheit.
Im Klassiker »Dienstanweisung für einen Unterteufel« von C.S. Lewis begreift der höllische Unterstaatssekretär Screwtape nicht, wie Gott, den er als »Feind« bezeichnet, Geschöpfe in die Welt setzen konnte, die keine Marionetten sind:
Der Feind nimmt dieses Risiko auf sich, weil er eine wunderliche Laune hat, alle diese kleinen, ekligen Menschenwürmer zu Geschöpfen zu machen, die, wie er sagt, ihn aus »freiem Willen« lieben und ihm aus »freier Entscheidung heraus« dienen: als »Söhne«.5
Noch bevor Gott seinen Atem in Adam hineingehaucht hat, ist ein Widersacher am Werk. Es ist ein alter Konkurrent, der vom ersten Augenblick an ein gieriges Auge auf das Schmuckstück Eden geworfen hat. Von allein wären die Bewohner des Gartens nicht auf den Gedanken gekommen, dass die Spaziergänge mit ihrem Schöpfer einengend oder mangelhaft sein könnten. Doch dann bringt der Feind sie auf den Gedanken, dass Gott ihnen etwas vorenthält (1. Mose 31,5). Raffiniert, hintenrum. »Hat Gott wirklich gesagt …?« Der Feind behauptet nicht, er suggeriert nur, er weckt das Misstrauen: »Könnte es sein, …?«, »Ist euch vielleicht aufgefallen, …?« »Wäre es eventuell eine Möglichkeit, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist, dass es eine höhere Erleuchtung, eine tiefere Befriedigung, ein umfassenderes Glück gibt als das, was er bietet? Spazieren im Garten? Wie uncool ist das denn? So unmündig! So angewiesen auf die Gunst eines anderen! Muss das denn sein? Ihr seid doch erwachsene Menschen! Ihr könnt doch selbst Götter sein!«
Eva fällt sofort darauf herein und greift nach dem Leckerbissen, der mit seinem verlockenden Duft am Ast baumelt und ein besseres, überlegeneres Glück verspricht als das bisherige. Adam gibt ihren Worten nach und macht mit. Das, was die beiden sich erlauben, ist viel mehr als nur der verbotene Griff nach einer leckeren Frucht. Ihre Tat ist ein Sologang, mit dem sie ihren Schöpfer hintergehen und sich von seiner Fürsorge abkoppeln, im irrtümlichen Glauben, dass sie ihr Schicksal selbst besser schmieden können. Vermutlich haben sie keine Ahnung, was sie damit anrichten. Vermutlich wollen sie keine Ahnung haben.
Durch ihren Ungehorsam wird Gottes Schöpfung fremdbesetzt.
Das Erschütterndste an der Geschichte ist, dass Adam und Eva keine Spur von Einsicht zeigen. Vielleicht wäre etwas zu retten, wenn sie ihre Tat wenigstens sofort bereuen würden. Doch lieber ziehen sie sich von der Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zurück. Anstatt die Sache ins Reine zu bringen, verstecken sie sich und weichen der Stimme Gottes aus.
Ein Phänomen zieht ins Leben der Menschen ein, das bis dahin unbekannt war: Scham. Der angsterfüllte Blick aus den Schatten heraus, um die Ecke, um sicherzustellen, dass keiner zuschaut. Hoffen, dass das Problem von allein verschwindet, dass keinem etwas aufgefallen ist.
Nachdem Gott seine beiden Freunde endlich aus ihrem Versteck gelockt hat, fängt das Spiel mit den Sündenböcken an. Zum ersten Mal wird Sünde mit ihrer ganzen Niedertracht offenbar.
Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß.
1. MOSE 3,12
Die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich.
1. MOSE 3,13
Der gleiche Keil, der zwischen die Menschen und Gott getrieben wurde, wurde zwischen Mensch und Mensch getrieben. Adam und Eva sind zweifach verwaist – von Gott getrennt, voneinander getrennt.
Der Rest ist Geschichte, blutige Weltgeschichte.
Folgen, die nachhaltig sind
Die fatalen Auswirkungen jener Vorkommnisse im Garten Eden strecken ihre dunklen Finger bis in die Banalitäten meines Alltags hinein. Ich muss nicht lang suchen, um ein brandaktuelles Beispiel zu finden. Wer einen Beweis für die Glaubwürdigkeit der Geschichte von Adam und Eva braucht, muss nur in die eigene Seele blicken und die Leichtigkeit bestaunen, mit der er auf die Nase fliegt und die Verantwortung prompt von sich weist.
Einmal verließ ich das Haus, um zur Schule zu fahren, in der ich arbeite. Ich war zu spät aus dem Bett gekrochen und hatte es eilig. Als ich zu schnell aus der Garageneinfahrt um die Ecke fuhr, geschahen drei Dinge gleichzeitig. Meine Tasche, die auf dem Nebensitz lag, purzelte nach vorn auf den Boden. Kopfüber natürlich, sodass der halbe Inhalt sich unter dem Sitz ausbreitete. Stifte flogen in alle Richtungen, Hefte lagen aufgeschlagen mitten in Kaugummipapieren und im Staub und Unrat, der sich unter meinen Autositzen angesammelt hatte. Mit einer Reflexbewegung griff ich nach der Tasche, um zu retten, was zu retten war. Dabei riss ich das Lenkrad ungewollt nach rechts. Zu spät, um es wieder auf Kurs zu zerren. Das Auto krachte in einen der großen Steine, die unsere Zufahrtsstraße säumen.