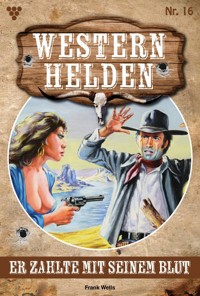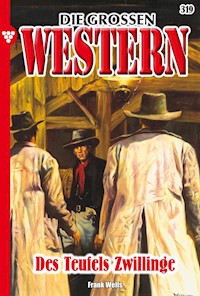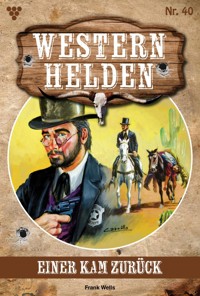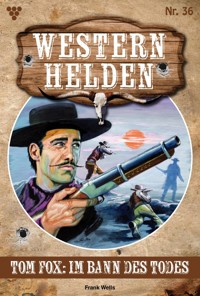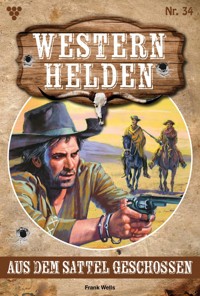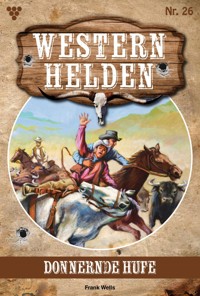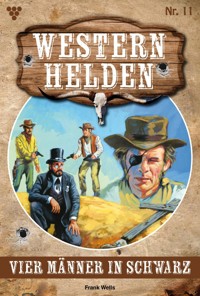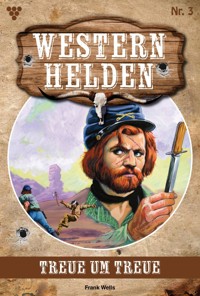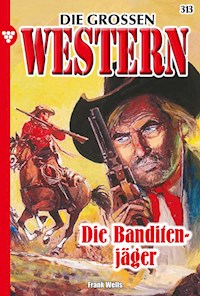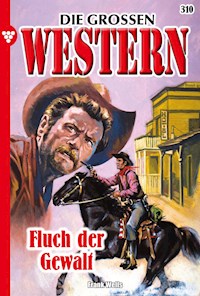Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Alan Bollyson hätte den Mord verhindern können, der vor seinen Augen geschah. Den Mord, der das County in den Strudel des Verderbens stürzte. Aber Bollyson war nicht der Mann, der in dieses raue Land passte. Gewiß, er war hier geboren und aufgewachsen, doch von Kindheit an saß Angst in seinen Gebeinen. Seit jenem Tage, als die Mutter im Pfeilhagel der Indianer starb, unmittelbar neben ihm. Manchmal, wenn er jetzt tief in den Hügeln saß und vor sich hinträumte, standen die schrecklichen Bilder der Vergangenheit auf und bedrängten ihn. Die gebrochenen Augen der Mutter, das teuflische Geheul der Indianer, das Donnern der Gewehre. Dann sah er auch das harte Gesicht des Vaters wieder, den er gefürchtet und dem er sich gebeugt hatte. Auch als der ihn zur Ehe mit der ungeliebten Calla gezwungen hatte. Sie führte das Regiment im Haus, und Alan stahl sich davon, sooft es nur anging. Das Leben lag vor ihm wie eine trostlose Wüste – deshalb flüchtete er sich in Träume, die ihn weit wegführten, über die Hügel hinweg in ein besseres Land. Die beiden Reiter nahm er erst wahr, als ihre Stimmen über den Fluss herüberwehten. Dug Carner und Red Viol. Unwillkürlich duckte sich Alan Bollyson tiefer in die Mulde hinter den duftenden Salbeibüschen. Dug Carner war der Letzte, dem er begegnen mochte. Er verkörperte jene Gewalttätigkeit, die er so hasste und der er sich wehrlos ausgeliefert fühlte. Der Cowboy Red Viol war ein schlitzohriges Subjekt, dem man nicht von hier bis da trauen konnte. Die Männer hielten am Fluss. Während Viol die Pferde saufen ließ, kletterte sein Boss Carner den Hang zum Weg hinauf. Er sah aus, als erwarte er jemanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 359 –Von Angst gehetzt
Frank Wells
Alan Bollyson hätte den Mord verhindern können, der vor seinen Augen geschah. Den Mord, der das County in den Strudel des Verderbens stürzte. Aber Bollyson war nicht der Mann, der in dieses raue Land passte. Gewiß, er war hier geboren und aufgewachsen, doch von Kindheit an saß Angst in seinen Gebeinen. Seit jenem Tage, als die Mutter im Pfeilhagel der Indianer starb, unmittelbar neben ihm. Manchmal, wenn er jetzt tief in den Hügeln saß und vor sich hinträumte, standen die schrecklichen Bilder der Vergangenheit auf und bedrängten ihn. Die gebrochenen Augen der Mutter, das teuflische Geheul der Indianer, das Donnern der Gewehre. Dann sah er auch das harte Gesicht des Vaters wieder, den er gefürchtet und dem er sich gebeugt hatte. Auch als der ihn zur Ehe mit der ungeliebten Calla gezwungen hatte. Sie führte das Regiment im Haus, und Alan stahl sich davon, sooft es nur anging. Das Leben lag vor ihm wie eine trostlose Wüste – deshalb flüchtete er sich in Träume, die ihn weit wegführten, über die Hügel hinweg in ein besseres Land.
Die beiden Reiter nahm er erst wahr, als ihre Stimmen über den Fluss herüberwehten. Dug Carner und Red Viol.
Unwillkürlich duckte sich Alan Bollyson tiefer in die Mulde hinter den duftenden Salbeibüschen. Dug Carner war der Letzte, dem er begegnen mochte. Er verkörperte jene Gewalttätigkeit, die er so hasste und der er sich wehrlos ausgeliefert fühlte.
Der Cowboy Red Viol war ein schlitzohriges Subjekt, dem man nicht von hier bis da trauen konnte.
Die Männer hielten am Fluss. Während Viol die Pferde saufen ließ, kletterte sein Boss Carner den Hang zum Weg hinauf. Er sah aus, als erwarte er jemanden.
Alan Bollyson träumte weiter. Er wurde erst wieder aufmerksam, als der dritte Mann kam. Das war eine Viertelstunde später.
*
Der Reiter kam den Weg von den Bergen herunter. Er ritt bis dicht an Dug Carner heran und sagte: »Hallo, Dug! Suchen Sie mich?«
Es war Gordon Rack, der Besitzer der Pfeil-Ranch, ein Oldtimer, der vor wenigen Wochen fünfzig Jahre alt geworden war. Das ganze County hatte den Tag festlich begangen. Er saß aufrecht im Sattel, schaute kühl auf Carner hinab und streifte Red Viol nur mit einem flüchtigen Blick. »Suchen?« sagte Carner. »Nein, Mr. Rack. Wir kommen zufällig vorbei. Haben einen langen Trail hinter uns und gönnen unseren Tieren ein bisschen Ruhe. Hier oben ist das Wasser des Creeks viel besser als bei mir unten.«
Rack nickte. »Das ist wahr. Immerhin haben Sie genug Wasser. Das kann nicht jeder Rancher von sich sagen. Kommen Sie mit?«
»Yeah. Das heißt – ich hätte eine Frage …«
»Bitte.«
Carner schickte einen schnellen Blick zu Viol, der jetzt im Sattel saß und den Uferhang hinauf zum Weg ritt und schräg hinter Gordon Rack hielt.
Carners Stimme klang plötzlich anders – angespannt, ein wenig nervös: »Mr. Rack, es handelt sich um Ihre Tochter, um Sylvia. Ich habe neulich schon versucht, mit Ihnen zu sprechen, aber …«
»Sie haben es nicht nur versucht, Dug. Ich habe Sie unterbrochen, weil meine Antwort feststand. Ich habe sie Ihnen gegeben, sie hat sich nicht geändert.«
Carner beugte den kantigen Schädel vor. Er glich einem Stier, der ein Hindernis über den Haufen rennen will. Er knurrte tief in der Kehle: »Und Ihre Begründung, Mr. Rack?«
»Genügt Ihnen nicht das klare Nein? Selbst wenn meine Tochter Sie lieben sollte, würde ich mich gegen eine Ehe wehren. Aber Sylvia denkt mit keinem Gedanken an Sie.«
»Hat sie das gesagt?«
»Ich kenne Sylvia besser als Sie, Dug. Geben Sie sich damit zufrieden.«
»Noch nicht! Was haben Sie gegen mich?«
»Sehr viel – soweit es eine Ehe mit meiner Tochter betrifft. Ihre Methoden gefallen mir nicht, Dug. Sie sind gewalttätig und maßlos. Für meine Begriffe überschreiten Sie häufig die Grenze des Anstands. Und ich fürchte, Sie werden sich darin nie ändern.«
Carner lachte plötzlich stoßweise, hart und böse. Es war ein gemeines Lachen, und es schreckte Alan Bollyson auf seinem Beobachtungsposten auf. Er begriff plötzlich, dass dieses Zusammentreffen keineswegs Zufall war …
Er wollte schreien, aber seine Kehle war zugeschnürt. Er sah, wie Viols Hand zum Gürtel glitt und sich wieder hob – und jetzt war in der Hand ein Messer. Er hörte Carner mit sich überschlagender Stimme schreien: »Sie alter Narr! Da haben Sie meine Antwort!«
Viols Hand tauchte blitzschnell hinab und senkte den Stahl bis zum Heft zwischen Gordon Racks Schulterblätter.
Alan Bollyson lag wie angewurzelt, nicht fähig, auch nur einen Finger zu rühren. Er zitterte, kalter Schweiß sickerte über seinen Rücken, über das Gesicht. Er starrte in die violetten Schatten hinab auf das grauenvolle Bild. Er würgte an Entsetzen und Qual – und Angst. Er war Zeuge eines Mordes geworden. Wenn ihn die Mörder entdeckten, wenn irgendetwas, ein Zufall nur, sie auf seine Fährte brachte …
Fliehen? Jetzt, mit diesen Teufeln im Nacken? Nein! Er musste liegen und den Atem anhalten und alles mit ansehen. Musste sehen, wie sie den Toten vom Pferd hoben und dann quer über den Sattel legten, den Kopf nach der einen, die Beine nach der anderen Seite des Tieres hinabbaumelnd. Musste sehen, wie sie ihn mit seinem eigenen Lasso festbanden und dann das zitternde Tier mit ein paar Schlägen davonjagten – den Weg hinunter, der zu Racks Ranch führte. Er musste sehen, wie die beiden Mörder sorgfältig alle Spuren löschten. Sie ließen sich viel Zeit dabei.
Endlich trieben sie die Pferde zum Fluss hinunter. Es sah ganz so aus, als wollten sie auf diesem Ufer weiterreiten – keine fünfzig Schritte von Bollyson entfernt.
Das Wasser spritzte unter den Hufen. Dann standen die Pferde mitten im Fluss still und soffen. Bollyson starrte zwischen den Zweigen des Gestrüpps hindurch und flüsterte ein Stoßgebet. Sein Magen krampfte sich zusammen.
Plötzlich prustete hinter ihm sein Pferd. Es klang wie eine Explosion. Auch die Männer unten im Fluss hatten es gehört. Viol riss den Kopf herum und zischte: »Das war ein Gaul!«
Endlose Sekunden lang lauschten Viol und Carner. Bollyson wagte nicht mehr, zu den Mördern hinabzublicken. Jetzt mussten sie ihn entdecken, mussten auch ihn stillmachen – so still wie Gordon Rock …
Bis Carner brummte: »Ich höre nichts. Los, Red, wir reiten im Fluss weiter. Dann findet kein Mensch unsere Spuren.«
Sie ritten flussaufwärts, auf die Berge zu, von denen der Crystal Creek herabkam. Alan Bollyson aber lag noch lange reglos auf dem gleichen Fleck. Bei jedem winzigen Geräusch schrak er zusammen. Stellten sie ihm eine Falle? Wollten sie ihn nur täuschen? Schlichen sie vielleicht schon hinter ihm den Hügel herauf?
Es war tiefe Nacht, als Bollyson zu seinem Pferd kroch. Er saß auf und galoppierte durch dick und dünn. Hinter ihm saß die Angst im Sattel. Noch nie hatte er sich nach seinem Haus und nach Calla gesehnt, aber als die Lichter der Ranch aus der Nacht auftauchten, als er endlich vor dem Haus aus dem Sattel rutschen konnte, da fühlte er sich geborgen.
Mit wankenden Knien schlich er die Treppe hinauf. Das Donnerwetter, mit dem ihn Calla überfiel, klang wie ein Engelchor.
*
Die Beerdigung war zwei Tage später auf elf Uhr vormittags angesetzt. Aber Ben Brent machte sich nach dem ersten Hahnenschrei fertig zum Ritt in die Stadt. Vor dem Spiegel band er sich Krawatte und Halstuch. Er hielt auf Sauberkeit, und niemand hätte seinem Hause angemerkt, dass hier, schon seit sieben Jahren die Frau fehlte. Joan war schon bald nach der Geburt des Jungen gestorben. Er hatte ihn Jo getauft.
Sieben Jahre sind eine lange Zeit, doch Ben Brent hatte das Lachen noch nicht wieder gelernt. Immer wieder zog es seine Gedanken zurück zu Joan. Sie war schon kränklich gewesen, als sie heirateten – zwei junge Menschen, kaum zwanzig Jahre alt. Joan – das war die Erinnerung an eine elfengleiche Schönheit. Er, der Riese, hatte neben ihr noch gewaltiger gewirkt. Es gab jetzt noch Menschen im County, die behaupteten, er habe Joan mit seiner Kraft zerbrochen.
Seit er wie ein Einsiedler zurückgezogen hauste und sich kaum noch unter Menschen blicken ließ, gingen Gerüchte im Land um. Bei den einen wuchs die Hochachtung vor ihm, andere ergingen sich in gehässigen Bemerkungen, die darin gipfelten, dass Ben es mit den Gesetzlosen hielt.
Das hatte wohl den Grund darin, dass kein Rinderdieb sich an seine Herden wagte, während fast alle anderen Rancher im Land hin und wieder zur Ader gelassen wurden. Und natürlich sprachen Neid und Missgunst mit.
Ben machte sich aus dem einen und dem anderen nichts. Er hatte noch nie auf das Geschwätz der Leute gehört. Auch damals nicht, als er in Capos Bar mit einem Cowboy Carners zusammengeprallt war. Einem riesigen Burschen, der Ben in nichts nachstand. Ben hatte ihn in drei Minuten von den Füßen geschlagen – und einen Tag später war der Mann tot gewesen.
Das hatte Ben hart getroffen. Er hatte den Mann nicht gekannt, ihn nie vorher gesehen. Er hatte auch den Kampf nicht gewollt. Der Bursche hatte ihn dazu gezwungen. Gordon Rack war damals der Auffassung gewesen, dass Carner dahintersteckte, aber wer wollte das beweisen? Tatsache blieb, dass der Mann tot war. Es konnte Ben auch nicht trösten, dass ihm Sheriff Dave Milon einige Zeit später einen Steckbrief mit dem Namen des Toten gebracht hatte, einem mehrfachen Mörder. Seit jener Zeit ging ihm jeder Raufbold aus dem Weg.
Das waren die Erinnerungen, die einen Mann überkamen, wenn er in den Spiegel schaute und sein Gesicht betrachtete. Nun war also auch Gordon Rack tot, einer der letzten Oldtimer, ein großartiger Mann. Das Schlimme war, dass Reck noch Stunden vor dem Mord hier im Hause gewesen war, um Wichtiges mit Ren zu besprechen.
Ben trank den Kaffee im Stehen und aß einige Biskuits dazu. Cokie, der neben dem Lassoschwingen auch den Küchendienst versah, schwirrte wie ein aufgescheuchtes Suppenhuhn hin und her. Die Boys kamen verschlafen herein. Zuerst der alte Wimpy, der nicht mehr als drei Stunden Schlaf brauchte, dann Jan Slack und Minuten später Al Crow. Er würde es nie lernen, rechtzeitig aus dem Bett zu kriechen.
Kaum hatten die Boys Platz genommen, als Jo oben im Haus zu krähen begann. Ben lächelte. »Du könntest Jo etwas von deiner Schlafsucht abgeben, Al! Jetzt ist er schon wieder aus den Federn, und dabei könnte er noch zwei Stunden liegen. Wimpy, nimmst du heute Jo mit, wenn du zur Nordweide reitest?«
Der Alte schüttelte den Kopf. »Ich? Hast du nicht versprochen, ihn in die Stadt mitzunehmen?«
»Kein Gedanke!«
»Jo hats aber gesagt. Darum ist er nämlich wach. Ich wette, er hat kein Auge zugetan diese Nacht.«
»Das ist denn doch …«
Cokie füllte Bens Tasse. »Jo hat recht. Als du letztes Mal in der Stadt warst, hast du ihm versprochen, diesmal käme er mit.«
»Aber da wusste ich doch nicht, dass es wegen einer Beerdigung sein würde!«
»Tja, wenn man sein Wort gegeben hat.«
Ben nickte. »Aber wo lasse ich ihn in Glenrock?«
»Bring ihn einfach zur Lehrerin. Bald muss sie sich doch mit ihm abbalgen. Da können die beiden heute gleich Fühlung nehmen.«
Die Boys lachten schallend. Sie konnten sich ziemlich lebhaft vorstellen, wie dieses »Fühlung nehmen« aussehen würde. Jo ließ in der Wohnung der Lehrerin garantiert keinen Stein auf dem anderen.
Da kam er schon die Treppe heruntergewirbelt – ein Cowboy in Kleinformat, von Kopf bis Fuß in Leder. Er schrie »Whoopee!« und flog in Bens Arme. Der hob ihn hoch, gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Stirn und untersuchte dann die Beule an Jos Kinn. Sie war jetzt drei Tage alt und schillerte in allen Farben. Jo hatte sie sich zugezogen, als er versucht hatte, den schwarzen Hengst zu besteigen. Er war tatsächlich in den Sattel gekommen, aber noch schneller wieder herunter. Seinem Kinn war dummerweise ein Korralpfosten im Wege gewesen.
»Tuts noch weh?« erkundigte sich Ben.
»Kein bisschen, Dad! Und das sage ich dir, diese schwarze Bestie nehme ich mir vor!«
»Aber nicht heute, Jo. Außerdem ist es keine Bestie, sondern ein prachtvoller Hengst. Unser bester, Jo. Dem gehts genau wie dir manchmal – ihm fällt das Parieren auch höllisch schwer.«
Jo schnitt eine Grimasse und stürzte sich auf das Frühstück. Gewisse Dinge hört kein Mensch gern, nicht mal, wenn’s die Wahrheit ist.
*
Sandy Gale kam aus dem Wald auf die Ranch galoppiert, als Ben gesattelt hatte. Sandy war einer der wenigen kleinen Rancher, die jenen unfruchtbaren Streifen Weide zwischen dem County-Becken und dem Indianer-Reservat bewohnten, ein wortkarger Mann, der schuften konnte wie ein Stier. Seit er Cynthia vor Jahresfrist geheiratet hatte, bekam man ihn kaum noch zu Gesicht. Er war dauernd in den Bergen auf Mustangjagd, denn er hielt nichts von Rinderzucht.
Ben hatte Sandy noch nie aufgeregt gesehen – aber jetzt war er es. Er war sozusagen außer Rand und Band und kochte wie ein Teekessel auf offenem Feuer. »Hölle und Brand!« grinste Ben. »Du siehst aus, als hätte deine Cyn zu viel Bohnen in den Kaffee getan. Wo brennt’s denn?«
»Das weißt du nicht?« Sandy stieß den Hut aus der Stirn und spie aus. »Gestern abend waren sie auf meiner Ranch und haben Tamason und Wallioka weggeschleppt.«
Ben war verblüfft. Tamason und Wallioka waren Palouse-Indianer, die Sandy Gale häufig auf seiner Ranch, vor allem bei der Jagd auf Wildpferde beschäftigte. Er fragte: »Wer hat sie weggeschleppt? Und wohin?«
»Der Sheriff mit Dug Carner und seiner Meute. Die halbe Mannschaft Gordon Racks war dabei. Um ein Haar hätten sie mich auch mitgeschleift.«
Ben dämmerte es. »Teufel! Soll das bedeuten, dass sie Tamason und Wallioka verdächtigen …«
»Genau! Sie sollen Rack umgebracht haben! Und weißt du, warum?«
»Woher?«
»Weil das Messer in Racks Rücken Tamason gehört! Und weil angeblich die Fährte der Mörder – es waren zwei – von meiner Weide hergekommen ist und im Fluss endet.«
»Tamasons Messer? Das ist schlecht! Dann kann ich Sheriff Milon verstehen. Er würde nie einen Mann ohne dringenden Tatverdacht in Haft nehmen, Sandy!«
»Das ist einfach verrückt! Ich kann beschwören, dass die beiden zur Tatzeit nicht am Crystal Creek gewesen sind.«
»Wo sonst?«
»Im Reservat. Sie hatten Sehnsucht nach den Tippis ihres Stammes.«
»Hm. Das wird das Gericht nicht glauben. Das Messer ist ein besserer Beweis, Sandy.«
»Beweis! Tamason hat das Messer schon mehrere Tage vor dem Mord vermisst. Er hats verloren. Ich wette, der Mörder hat es gefunden und die passende Verwendung dafür gehabt!«
Ben wiegte nachdenklich den Kopf. Er war kein Indianerhasser wie die meisten im County. Aber er wusste auch, dass ein Roter unberechenbar war, besonders im betrunkenen Zustand.
»Weiß Tamason denn nicht, wo er das Messer verloren hat?« fragte er. »Ein Roter verzichtet nie auf sein Skalpmesser. Wenn er es verliert, sucht er so lange, bis er es wieder hat.«
Sandy schüttelte grimmig den Kopf. »Nichts weiß er. Er war Ende letzter Woche in der Stadt, zusammen mit Wallioka. Die beiden haben sich schauderhaft die Nase begossen, obwohl sie bloß ein paar Cents in der Tasche hatten. Jemand hat sie unter Brandy gesetzt. Als Tamason wieder nüchtern war, vermisste er sein Messer.«
»Und er hats nicht wiedergefunden?«
»Nein. Ich habe das gestern dem Sheriff erzählt, aber Dug Carner hat dazwischen gebrüllt, dass ich das dem Richter erzählen könnte. Er hat auch gesagt, mir glaubte sowieso keiner ein Wort, weil ich ewig diese Rothäute um mich hätte und wahrscheinlich auch Banditen. Ich wäre ihm an die Gurgel gefahren, aber Cyn ist dazwischengesprungen – und der Sheriff. Für diese Gemeinheit greife ich mir Carner noch.«
»Tu es nicht, Sandy. Wie ich die Jury kenne, wird sie Tamason und Wallioka schuldig sprechen. Und Judge Morrow kennt bei Mord nur eine Strafe: den Galgen! Wenn die beiden wirklich unschuldig sind …«
»Sie sind unschuldig, verdammt. Muss denn ein Mann mit roter Haut schlechter sein als ein Weißer? Muss er ohne Chance vor ein Gericht treten, bei dem er sich nicht einmal verteidigen kann? Weder Tamason noch Wallioka beherrschen unsere Sprache.«
»Dem können wir abhelfen! Uns fehlt ein Entlastungsbeweis. Aber Rechtsanwalt Lesser muss die Verteidigung übernehmen. Ich habe zwar wenig Hoffnung, Sandy, aber wir werden nichts unversucht lassen. Reiten wir!«
Sie nahmen Jo in die Mitte. Der Siebenjährige ritt wie ein Alter.
*
Alle waren sie gekommen, um Gordon Rack das letzte Geleit zu geben. Niemand wunderte sich darüber, dass Dug Carner neben Sylvia Rack stand. Er trug einen neuen schwarzen Anzug, sein von der Sonne hochrot verbranntes Gesicht stach scharf von dem weißen Kragen ab. Hinter Sylvia stand die trauernde Mannschaft mit dem Vormann Jerry Roton an der Spitze.
Alan Bollyson wunderte sich über die bodenlose Frechheit Carners. Er hatte böse Tage hinter sich. Tage voller Angst und Schrecken. Nie im Leben würde er das entsetzliche Bild vergessen. Er fürchtete noch immer, die Mörder könnten seine Spur entdeckt haben und wären hinter ihm her.
Er stand in der letzten Reihe der Trauergemeinde. Er schwitzte, obwohl ein kühler Luftzug über den Friedhof strich. Es zog seinen Blick wie hypnotisiert auf den Stiernacken Carners. Die Worte des Pfarrers gingen ungehört an seinem Ohr vorüber.
Das letzte Gebet war gesprochen. Alan atmete auf. Nur schnell weg von hier! Er war froh, dass Calla nicht mit zum Friedhof gekommen war, wie sie es vorgehabt hatte. Sie ließ sich sonst nie solche Sensationen, wie Beerdigungen oder Hochzeiten und andere Festlichkeiten, entgehen. Aber weil sie Sylvia Rack nicht leiden konnte, und weil der tote Gordon Rack ihr einige Male über die spitze Zunge gefahren war, hielt sie es für unter ihrer Würde, dem Sarg zu folgen.
Plötzlich legte sich eine schwere Hand auf Alans Schulter. Er erstarrte und wagte kaum, den Kopf zu drehen, bis er Ben Brents ruhige Stimme hörte: »Hallo, Alan! Hast du’s eilig?«
Brent war in dieser Stunde der richtige Mann. Alan schaute unsicher zu dem einen Kopf größeren Mann auf und murmelte: »Nein, nein, Ben. Ich wollte nur aus dem Gedränge. Kommst du mit in die Stadt?«
»Sicher. Ich möchte nur Sylvia mein Beileid aussprechen. Schrecklich, dass das geschehen musste.«
»Ja – sehr schrecklich. Ich – ich warte auf dich, Ben!«
»Kommst du nicht mit zu Sylvia? Sie wird es nicht leicht haben allein auf der großen Ranch.«
Alan fasste hinter den Kragen, als wäre er zu eng. Er nickte und tappte unsicher neben Ben her.
Sylvia Racks verweintes Gesicht gab ihm einen Stich mitten ins Herz. Er war kaum fähig, die paar Worte des Beileids zu sprechen. Mit Gewalt zwang er sich, nicht an Sylvias Kopf vorbeizuschauen, denn dort hinter ihr stand, klobig wie ein Felsblock, Dug Carner.
Ben Brent neigte den Kopf, als er sagte: »Sylvia, es gibt keine Worte für das, was ich empfinde – und noch weniger Worte, die Sie in Ihrem Schmerz trösten könnten. Ihr Vater war mein Freund. Ich wollte, Sie könnten mich auch als Ihren Freund betrachten, der immer für sie dasein wird!«
Sylvia nahm seine Hand, ihre Lippen zuckten. »Danke, Ben. Ich weiß, was Dad von Ihnen gehalten hat. Wenn ich einen Freund brauche, nehme ich Ihre Hilfe gern an.«