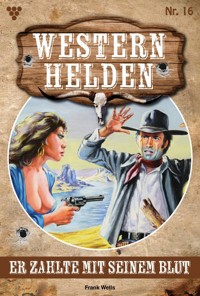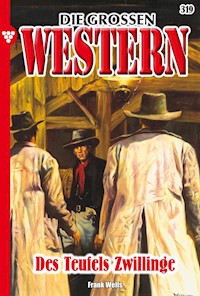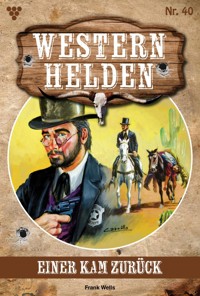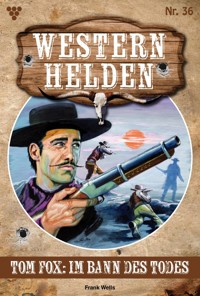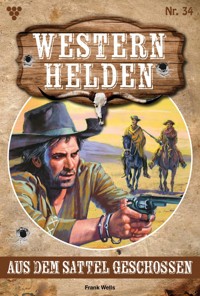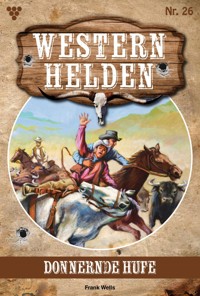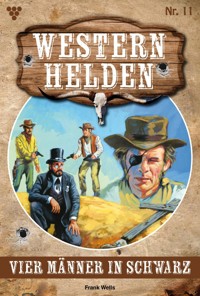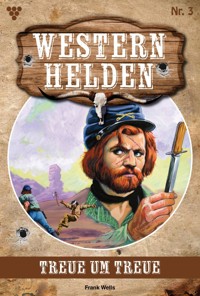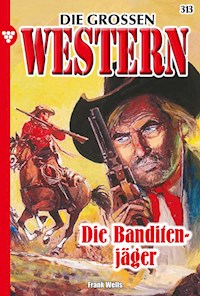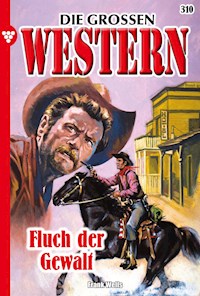Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Drei Meilen vor der Stadt traf Miranda Lennon auf die Herde. Gemächlich trotteten die Tiere unter der gelbbraunen Staubglocke dahin. Die Treibmannschaft gönnte Miranda auf ihrem Buggy keinen Blick und dachte gar nicht daran, den Weg freizugeben. Miranda fuhr den Reitern am Ende der Herde fast auf die Hacken. Nichts geschah. Mirandas Temperament ging durch: Sie zog ihren Derringer und schoss jedem der beiden Männer ein sauberes Loch in den Hut. Der linke Reiter, ein Mann von mächtigem Leibesumfang, warf beide Hände in die Höhe, brüllte laut auf und verschwand seitlich von der Bildfläche. Der zweite Reiter, der so dürr war wie sein Partner fett, nahm seinen Hut ab und machte gemächlich kehrt. Neben Mirandas Wagenschlag hielt er – und wenn sie eben noch vor Zorn aus der Haut fahren wollte, so musste sie jetzt lachen. Die tieftraurigen Augen des Mannes über einer riesigen Nase schauten vorwurfsvoll und anklagend und gleichzeitig sehr komisch. »Snuffy ist mein Name«, murmelte der Mann. »Traurig, traurig, nun schießen schon junge Girls auf erwachsene Männer. Nicht zu fassen!« Er zog seinen Gaul herum und stob der Herde nach. Raue Männerstimmen schallten herüber, Flüche übertönten das Brüllen der Tiere, Pferde wieherten, Schüsse knallten. Eine schwingende Stimme erteilte Befehle. Trotz des ruhigen Tons trug die Stimme weit und brachte die anderen Reiter zum Schweigen. Fünf Männer zählte Miranda, die alle Hände voll zu tun hatten, um die Herde an der Stampede zu hindern. Den langen Dürren und den kurzen Dicken sah sie – und dann den Mann, dem die sanfte, schwingende Stimme gehören musste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 364 –Einsam wie der graue Wolf
Frank Wells
Drei Meilen vor der Stadt traf Miranda Lennon auf die Herde. Gemächlich trotteten die Tiere unter der gelbbraunen Staubglocke dahin. Die Treibmannschaft gönnte Miranda auf ihrem Buggy keinen Blick und dachte gar nicht daran, den Weg freizugeben. Miranda fuhr den Reitern am Ende der Herde fast auf die Hacken. Nichts geschah. Mirandas Temperament ging durch: Sie zog ihren Derringer und schoss jedem der beiden Männer ein sauberes Loch in den Hut.
Der linke Reiter, ein Mann von mächtigem Leibesumfang, warf beide Hände in die Höhe, brüllte laut auf und verschwand seitlich von der Bildfläche.
Die Rinder nahmen die Schüsse übel, stellten die Schwänze auf und begannen zu galoppieren …
Der zweite Reiter, der so dürr war wie sein Partner fett, nahm seinen Hut ab und machte gemächlich kehrt. Neben Mirandas Wagenschlag hielt er – und wenn sie eben noch vor Zorn aus der Haut fahren wollte, so musste sie jetzt lachen. Die tieftraurigen Augen des Mannes über einer riesigen Nase schauten vorwurfsvoll und anklagend und gleichzeitig sehr komisch.
»Snuffy ist mein Name«, murmelte der Mann. »Traurig, traurig, nun schießen schon junge Girls auf erwachsene Männer. Nicht zu fassen!«
Er zog seinen Gaul herum und stob der Herde nach. Raue Männerstimmen schallten herüber, Flüche übertönten das Brüllen der Tiere, Pferde wieherten, Schüsse knallten.
Eine schwingende Stimme erteilte Befehle. Trotz des ruhigen Tons trug die Stimme weit und brachte die anderen Reiter zum Schweigen.
Fünf Männer zählte Miranda, die alle Hände voll zu tun hatten, um die Herde an der Stampede zu hindern. Den langen Dürren und den kurzen Dicken sah sie – und dann den Mann, dem die sanfte, schwingende Stimme gehören musste. Wie ein Wirbelwind fegte er hierhin und dorthin, stand wieder, rief einen Befehl und war gleich darauf hinter einem ausbrechenden Stier her.
»Ein Pfeil zu Pferde!«, murmelte Miranda.
In bewundernswerter Schnelligkeit brachten die eingespielten Männer die Herde zur Vernunft – jetzt stob sie schon im Galopp auf der Straße dahin, der Stadt zu.
Miranda fuhr an. Der Wagen ruckelte über den aufgewühlten Boden. Die Sandwolke wurde dichter und dichter – und dann zog Miranda die Zügel scharf an. Vor ihr hielt, den Weg versperrend, der »Pfeil zu Pferd«.
Eine athletische Figur, knapp sechs Fuß groß, aber mit unnatürlich breiten Schultern. Ein kantiges Gesicht, bis zu den Augen verdeckt durch das hochgezogene Halstuch. Hände mit langen schlanken Fingern in dünnen Lederhandschuhen – das alles sah Miranda auf den ersten Blick.
Der Mann ritt langsam neben den Buggy. Seine Stimme klang nicht mehr so ruhig wie vorhin, sondern spröde und sehr kühl: »Wenn Ihnen mit einem guten Rat gedient ist, Miranda Lennon: Man geht hierzulande mit seinem Blei sparsam um.«
Sie spürte eine Welle von Scham, doch dann erfasste sie der Zorn.
»Bringen Sie Ihren lausigen Satteltramps gefälligst bessere Manieren bei!«, rief sie. »Ich bin es gewohnt, mit Achtung behandelt zu werden …«.
»Yeah, die Lennons werfen einen großen Schatten. Aber nicht jeder geht ihnen aus dem Wege.«
»Wer sind Sie? Eine Kinderstube haben Sie wohl nicht genossen?«
Seine Augen wurden zu schmalen Schlitzen. »Jedes Kind weiß, dass eine Herde wandernder Stiere ein empfindliches Instrument ist. Ihr Vater hätte Ihnen lieber etwas von Rinderzucht beibringen sollen, statt Sie im Osten verziehen zu lassen. Zierpflanzen gedeihen auf diesem Boden nicht.«
Er wandte das Pferd und stob davon. Eine Weile noch sah Miranda rot in blindem Zorn. »So ein – ein …« Sie suchte nach einem passenden Wort, aber es schien keins zu geben, es sei denn, sie bediente sich der vulgären Ausdrucksweise ihres Vormanns. Sie, Miranda Lennon, eine verzogene Stadtpflanze!
Wütend trieb sie die Pferde an und war bald in der Stadt.
Gewöhnlich schlief diese Stadt über Mittag. Um so erstaunlicher war die Tatsache, dass in dieser frühen Mittagsstunde die Main Street einem aufgescheuchten Ameisenhaufen glich.
Als Mirandas Wagen ausrollte, brüllte ein verschwitzter Mann ihr etwas von »Pleite« und »Lynchen« ins Ohr und rannte die Straße entlang. Es war das erste Mal, dass Miranda einen Bewohner Golden Hills laufen sah – und das kam ihr sehr bedenklich vor.
Sie stieg aus und eilte schnell zum Kontor ihres Rechtsanwaltes hinauf. Die ältliche Sekretärin nickte ihr nur grämlich zu und deutete auf die Tür zum Büro Fergus Hiltons.
»Soll ich mich nun freuen oder in Tränen ausbrechen?«, rief Hilton. In seiner längst vergessenen Jugend war er einer der wildesten Reiter des Landes gewesen. Jetzt wog er mehr als 250 Pfund.
Miranda ließ sich in einen Sessel fallen: »Was ist los? Heute Morgen war der Sheriff auf unserer Ranch und machte geheimnisvolle Andeutungen. Und draußen auf der Straße …«
Fergus Hilton seufzte schwer. »Du weißt es also noch nicht. Ernest Watts Buchhalter ist mit der Kasse durchgebrannt.«
»Nein!«
»Doch, mein Kind! Hast du die Leute gesehen? Schlimmer, als hätte ein Irrenhaus Ausgang. Ich wette, dass die North-Nevada-Bank diesen Tag nicht überlebt.«
»Also … Pleite?«
»Ein unschöner, aber treffender Ausdruck.«
»Ich kann das gar nicht fassen! War nicht Dick Moran Buchhalter bei Watts?«
»Sicher. Ein ruhiger, verlässlicher Mann mit einem Faible für Brieftauben.«
»Daran stimmt doch was nicht! Du sagst selbst, dass Moran ein verlässlicher Mann ist – und dann soll er plötzlich mit der Kasse auf und davon sein?«
»Mit dem Inhalt der Kasse, mein Kind, um es präzise auszudrücken. Ich möchte Dick Moran nicht zu nahe treten, aber die Vermutung liegt nahe, dass seine Vorliebe für das Geld fremder Leute noch seine Brieftaubenleidenschaft übersteigt.«
»Grässlich, wie du einen armen Mann mit deiner spitzen Zunge in Grund und Boden verdammst.«
»Ich halte Dick Moran mit einer Brieftasche, deren Inhalt immerhin runde zweihunderttausend Dollar ausmachen dürfte, nicht für einen armen Mann. Es sei denn, er lässt sich fassen. Aber Sheriff Gushee sah gestern Abend nicht sehr zuversichtlich aus.«
»Er war bei uns und machte geheimnisvolle Andeutungen. Deshalb bin ich hier.«
»Hattest du den Eindruck, dass er auf der Fährte saß?«
Fergus Hilton seufzte leise.
»Was wolltest du sagen, Onkel Fergus?«
»Wie hoch ist euer Depot bei der Bank?«
»Genau kann ich es nicht sagen«, entgegnete sie langsam. »Zwischen fünfzig- und fünfundsiebzigtausend schätze ich.«
Plötzlich stand der Rechtsanwalt neben ihr. Zum ersten Mal hörte sie ernsthafte Besorgnis in seiner Stimme. »Was sagst du da? Meine Herren! Und wie viel habt ihr zu Hause?«
»Nichts – oder so gut wie nichts.«
»Aber euer Vermögen muss doch größer sein!«
»Du vergisst die stetigen Verluste durch die Viehräuber. Und dann die Dürrejahre …«
»Sicher«, murmelte der massige Mann verstört. »Sicher. Los, Miranda! Es gilt zu retten, was noch zu retten ist. Ich komme mit zu Watts.«
Miranda schaute aus dem Fenster. Immer noch rannten aufgestörte Menschen hin und her. Plötzlich sah sie die athletische Gestalt des Mannes, der sich langsam durch die brandende Menge schob. »Wer ist das?«
Hilton folgte ihrem deutenden Finger. Er lächelte ironisch. »Du kennst ihn nicht? Ach so, du warst ja so lange außer Landes. Es ist Rex Stone. Ich hörte, dass er mit einer Treibherde von Oregon heruntergekommen ist.«
Rex Stone – der Mann, dessen Herde sie durcheinandergebracht hatte. Der Mann, dessen unverschämtes Benehmen sie jetzt noch kribbelig machte. Rex Stone, der Viehdieb.
Und sie musste daran denken, was ihr Vater immer sagte: »Ein Stone ist erst gut, wenn er tot ist …«.
Wenig später sah sie ihn wieder. Er lehnte gegenüber der Bank am Schaufenster des Stores und rauchte eine Zigarette. Jetzt konnte sie auch sein Gesicht erkennen, und es war noch kantiger und verwegener, als sie es sich vorgestellt hatte. Der Mann war die verkörperte Gefahr …
Sein gleichgültiger Blick traf sich mit dem ihren und glitt unbeteiligt weiter.
Ich müsste meine Mannschaft hier haben!, dachte Miranda erbittert. Es wäre aus mit ihm, aus und vorbei!
Und dann spürte sie ein merkwürdiges Gefühl, als sie sich die Folgen überlegte, die in diesem Land nur heißen konnten: Tod!
Die Vision verblich. Der Mann stand noch immer unbeweglich da und betrachtete die johlende Menge vor der Bank. Auf der obersten Treppenstufe vor dem Eingang stand ein bleicher, hagerer Mann und versuchte vergeblich, sich Gehör zu verschaffen: Ernest Watts. Die Menge brüllte ihn nieder. Selbst auf die Entfernung von mehr als zwanzig Schritten sah Miranda die Schweißperlen auf der Stirn des Bankiers. Rechtsanwalt Hilton rannte wie ein Sturmbock in die Menge. »Ruhe! Macht Platz!«, brüllte er.
Jetzt glaubte Miranda, dass der korpulente Mann früher ein furchteinflößender Mann gewesen war. Die lautesten Schreier verstummten. Miranda segelte im Schlepptau Hiltons durch die Menge und blieb vor Ernest Watts stehen.
»Gott sei Dank!«, stöhnte der Bankier. »Mich trifft der Schlag, ich bin ruiniert. Wenn ich diesen verfluchten Moran hier hätte, ich würde ihn erwürgen, Hallo, Miss Lennon! Ich hatte mir das Wiedersehen anders ausgemalt.«
»Schwatzen können wir später!«, knurrte Fergus Hilton. »Wie wollen Sie die Forderungen der Leute erfüllen, Watts?«
Das fahle Gesicht färbte sich mit schwachem Rot. Gleich heult er wie ein kleines Kind!, musste Miranda denken und wandte sich ab.
»Ich weiß es nicht«, hörte sie den Bankier murmeln. »Ich habe an eine Quote von fünf Prozent gedacht.«
»Und Ihr Privatvermögen?«
»Das ist mein Privatvermögen, Hilton! Die Bank hat nichts mehr greifbar. Alle flüssigen Gelder hatte ich mobil gemacht, um mehrere Herden aufkaufen zu können. Zweimal hunderttausend Dollar, Hilton! Bedenken Sie, zweimal hundert …«.
»Okay. Können Sie die fünf Prozent sofort auszahlen lassen?«
»Ich denke, ja. Alle werden ja nicht gleich angestürmt kommen.«
»Sie werden sich wundern. Haben Sie schon mal einen Präriebrand erlebt? Nun, dies hier wird sich ungefähr zehnmal so schnell ausbreiten wie der schnellste Feuersturm. Wenn’s ums Geld geht, ist auch der Letzte da. Stehen Sie zu Ihrem Wort?«
»Natürlich, Hilton! Was soll ich machen? Die Leute lynchen mich ja! Dieser verdammte Moran! Hätten Sie ihm das zugetraut?«
Fergus Hilton machte knurrend kehrt und hob die Hand. »Hört mal her, Ladys und Gentlemen«, dröhnte die Stimme des Rechtsanwalts über den Platz. Er hatte die Jacke aufgeknöpft und die Daumen hinter dem Hosenbund eingehakt. Jedes seiner Worte fiel wie ein Hammerschlag in das Schweigen.
»Ich habe mit Mr. Watts gesprochen. Die Lage ist ernst, aber …« ein Raunen ging durch die Menge, »aber ich glaube nicht, dass man Watts dafür verantwortlich machen kann, wenn sein Buchhalter mit dem Geld durchgeht. Wir alle sitzen im gleichen Boot, einerlei, ob der eine nun ein paar Dollar auf der Bank hat oder der andere tausend. Haltet ihr es nicht für besser, wenn wir geduldig abwarten, bis sich die Lage geklärt hat? Vielleicht ist Sheriff Gushee schon auf dem besten Wege, den Dieb zu fassen und das Geld wiederzubringen. Außerdem hat sich Watts bereit erklärt, mit seinem gesamten Vermögen für den entstandenen Schaden zu haften. Gebt ihr euch damit zufrieden?«
»Wir wollen unser Geld!«, kreischte ein Mann im Hintergrund. Aber wenn er noch vor wenigen Minuten einen Sturm entfesselt hätte, jetzt blieb sein Schrei ohne Echo. Rechtsanwalt Hilton hatte das Steuer herumgeworfen.
»Stellt eine Abordnung zusammen!«, fuhr er fort. »Wählt die Leute eures Vertrauens aus und lasst sie mit Watts verhandeln. Watts, sind Sie damit einverstanden?«
Der Bankier nickte schwach. Er bekam langsam wieder Oberwasser, da die Gefahr gebannt schien.
»Gut«, schloss Fergus Hilton die Debatte, »beratet und kommt in einer Stunde mit euren Vorschlägen.«
Er fasste Miranda am Arm und betrat schnell das Bankgebäude. Ernest Watts schlüpfte eilig an ihnen vorbei und öffnete die Tür zu seinem Privatkontor.
Aus einem Sessel hinter der Gardine des Fensters erhob sich eine Frau. Sie hatte die Augen des Vaters, aber sonst hatte Gina Watts nichts gemeinsam mit ihrem Erzeuger. »Ich bin entzückt, dich zu sehen!«, rief Gina Watts und schloss Miranda in die Arme. Vielleicht war diese kleine rührende Szene nur Theater. Man war sich nie ganz sicher, ob sie spielte oder es ernst meinte. Jedenfalls spürte Miranda Mitleid, als sie die Tränen Ginas sah.
»Ist es nicht furchtbar, Miranda! Mein armer Daddy! Oh, dieser Schuft! Ich könnte ihn …«.
Fergus Hilton knurrte: »Kommen wir zur Sache, ehe die Bude gestürmt wird. Welche Sicherungen bieten Sie meiner Mandantin, Watts?«
Der hagere Bankier entwickelte eine lebhafte Geschäftigkeit. Er zauberte ein Tablett mit Flaschen und Gläsern herbei und bediente seine Gäste.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz. Whisky? Gin? Sie rauchen doch, Fergus. Nehmen Sie die mit der Bauchbinde. Kindchen, rück doch bitte Miss Lennon den Sessel zurecht …«.
»Die Sicherheiten, Watts!«, erinnerte er knapp.
»Wie soll ich das in wenigen Worten darlegen?«, sagte der Bankier. »Sicher haben Sie eine Vorstellung davon, wie vielseitig die Geschäfte einer Bank sind. Leider ist kein einziger Dollar sofort verfügbar. Ich musste mir sogar fünfzigtausend kurzfristig ausleihen, um flüssig zu sein für das Herdengeschäft.«
»Ausleihen?«
»Es blieb mir nichts anderes übrig! Das Viehgeschäft hätte der Bank einen Gewinn von fünfzig Prozent gebracht, ohne jedes Risiko.«
»Ich wusste nicht, dass ein Bankier gleichzeitig Viehhändler ist. Aber das geht mich nichts an. Wie hoch beläuft sich die Einlage der Lennon-Ranch?«
»Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber schätzungsweise werden es etwa achtzigtausend sein. Benötigen Sie Geld, Miss Lennon?«
»Nur für die laufenden Ausgaben … Lohnzahlungen, Wirtschaftsgeld und so weiter«, warf Miranda ein.
»Genügen fünftausend?«
Fergus Hilton hob die Hand. »Moment! So einfach liegen die Dinge nicht. Ich verlange Einsichtnahme in Ihre Bücher, Watts.«
Plötzlich wandelte sich der Gesichtsausdruck des Bankiers. Für einen Augenblick glaubte, Miranda Angst erkennen zu können. »Aber …« rief er gepresst. »Soll das heißen, dass Sie mir kein Vertrauen schenken?«
»Das soll heißen, dass ich für meinen Mandanten zu kämpfen habe!«
Ernest Watts erhob sich steif. »Dann tut es mir leid«, sagte er frostig. »Ich bin bereit, mit meinem Vermögen für die schurkische Tat eines Verbrechens einzustehen, und Sie …«.
Auch Fergus Hilton erhob sich zu ganzer Größe. »Danke«, sagte er kalt. »Mehr wollte ich nicht wissen. Sind Sie bereit, Miss Lennon zehntausend Dollar auszuzahlen?«
Ernest Watts lachte heiser.
»Und die anderen? Was soll ich den armen Bürgern dieser Stadt geben? Wenn jeder so egoistisch sein wollte …«.
»Wie viel wollen Sie freiwillig zahlen?«, knurrte der Rechtsanwalt.
»Viertausend – das entspricht der Quote von fünf Prozent, die ich vorhin versprochen habe.«
Miranda schaute ratlos von einem zum anderen.
Nur Fergus Hilton schien über der Situation zu stehen. »Okay, Watts – wir werden sehen. Komm, Miranda!«
Sie warteten eine Weile an der Kasse, bis ihnen die viertausend Dollar ausgehändigt wurden. Just wollten sie den Schalterraum verlassen, als ein Elefant in die Halle gestampft kam – anders konnte man den riesigen Mann kaum bezeichnen.
»Wie viel Geld zahlt der Boss freiwillig?«, donnerte der Bass des Mannes.
Der Schalterbeamte verkroch sich hinter seinem Pult. »Der Chef …«
»Well«, schnitt ihm der andere das Wort ab. »Werde ihn selbst fragen.«
Mehr bekam Miranda nicht mit. Sie fürchtete sehr für die Gesundheit des Bankiers, wenn sie an dessen Auseinandersetzung mit dem Riesen dachte.
»Wer ist der Mann?«, fragte sie Fergus Hilton.
Der lachte seltsam – ein böses Lachen. »Du hast Glück«, entgegnete er. »Hier scheint sich heute alle Welt ein Stelldichein zu geben. Der Mann nennt sich Lem Desforges – und ich fresse meinen Hut, dass du diesen Namen heute nicht zum letzten Male gehört hast!«
Es wurde spät, bis Miranda an die Heimfahrt denken konnte. Schnell fiel die Nacht über Wüste und Prärie. In tiefe Gedanken versunken, ließ sich Miranda von ihrem Buggy schaukeln. Noch lagen mehrere Meilen bis zur Ranch vor ihr …
Und da geschah es. Miranda sah nichts als einen huschenden Schatten, hörte schnellen Atem, dann saß neben ihr ein Mann. Sofort riss sie die Zügel hart zurück. »Weiterfahren!«, befahl eine kühle Stimme neben ihr. Sie erkannte sie sofort. »Und fix von dem Weg runter! Am besten nach rechts, dort ist die Steppe eben und nicht so sandig.«
Der Schreck ebbte ab und wich dem Zorn, der Empörung. Was wagte dieser Rex Stone? »Sind Sie plötzlich wahnsinnig geworden?«, fauchte sie. »Nicht nur, dass Sie mich zu Tode erschrecken – was wollen Sie von mir? Ihre Räubermanieren …«
»Ich bin weder Kidnapper noch Babysitter. Und glauben Sie bitte nicht, dass ich fast mein Pferd zuschanden geritten habe, um mir von Ihnen Predigten anzuhören. Ich weiß, was ich tue. Noch mehr nach rechts!«
Sie gehorchte und wusste gar nicht, warum. Selbst ihr Zorn verflog.
»Sie haben doch wohl nicht ein Schäferstündchen mit den Kojoten in der Wüste vereinbart?«, spöttelte sie. »Wenn zum Beispiel mein Revolver losgeht …«.
»Bleiben Sie mir mit Ihrem Kinderspielzeug vom Hals. Ich hab heute Ärger genug gehabt – zum Beispiel mit einer durchgehenden Herde.«
»Aha! Und nun folgt die blutige Rache.«
»Natürlich. Ich werde Sie gefesselt und geknebelt mitten in der Wüste liegen lassen. Genügt Ihnen diese Auskunft?«
»Zuzutrauen wäre es einem Stone …«.
»Eher einem Lennon.«
Sie ruckte herum und starrte sein schwarzes Profil an. »Hören Sie! Noch kein Lennon hat Vieh gestohlen! Noch kein Lennon hat einem anderen von hinten eine Kugel aufgebrannt!«
»Ein Stone schon gar nicht!«
»So?«, rief sie wütend. »Und die Kugel, die zwei Finger breit neben dem Herzen meines Vaters sitzt? Wer war denn der heimtückische Schütze – wenn nicht Sie oder einer Ihrer Banditen?«
»Sie sollten vorsichtiger sein mit Ihren Behauptungen! Sie müssen nicht glauben, dass Sie besser sind als andere, weil Ihr Geldbeutel voll ist. Ich habe Ihren Vater nicht angerührt, und keiner meiner Leute! Es ist mir gleich, ob Sie das glauben oder nicht! So – jetzt können Sie wieder in die vorige Richtung einbiegen.«
Sie gehorchte und lenkte eine Weile den Wagen in verbissenem Schweigen über die Unebenheiten des Bodens. Was bezweckte der Mann neben ihr mit diesem merkwürdigen Ausflug? Was hatte er vor? Merkwürdigerweise spürte Miranda keine Angst. Da tauchten die verschwommenen Umrisse der Platanengruppe aus der Nacht.
Rex Stone lächelte. »Ich hoffe, Sie finden den Weg zur Ranch allein? Ich fürchte nämlich, ein ungern gesehener Gast zu sein. Sehen Sie das Licht dort hinten? Das ist die Lennon-Ranch!«
»Sie sagen mir nichts Neues. Und was soll nun dieses Theater?«
»Nur ein Spaß. Aber Sie sollten in der nächsten Zeit besser nicht allein ausfahren oder – reiten, wenn Ihnen mit diesem Rat gedient ist.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»So, wie ich es sagte. Gute Nacht!«
Ehe sie stoppen konnte, hatte ihr merkwürdiger Fahrgast sich hinabgeschwungen und war in der Nacht verschwunden.
*
»Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde«, sagte Sheriff Gushee und schnitt eine Grimasse. Er sprach oft mit sich selbst – ein einsamer Mann in einem einsamen Land. Er wusste, dass viele seiner Mitbürger ihn für einen Faulpelz hielten«, der dem lieben Gott den Tag und dem Staat das Geld stahl. Aber er hielt nicht viel von der Meinung der Menschen. Und zudem kannten ihn die Alten im Lande besser. Umsonst hatte man ihn nicht wiedergewählt.
Dieser närrische Dick Moran! Am Abend, bevor er mit dem Raub verschwand, hatte er noch ein Schwätzchen mit dem Sheriff gehalten. Er hatte von seiner weißen Leghorn berichtet, die wahre Wunder im Eierlegen vollbrachten. Und dieser Mann ließ mir nichts, dir nichts sein Hab und Gut im Stich, seine Wunderleghorn und seine Brieftauben und stahl seinem Chef das Geld aus dem Schrank.
Man sollte es nicht für möglich halten! Natürlich hatte er einen Helfer gehabt. Wenn man sich so aufs Fährteriechen verstand wie Gushee, der bei einem Cherokee-Häuptling in die Lehre gegangen war, war es kein Problem, diese närrischen Diebe wieder aufzustöbern. Es war nur eine Frage der Zeit, wann er ihnen die Kanone unter die Nase halten konnte.
Als die Sonne sank, steckte der Sheriff schon tief in den Pueblo-Mounts. Die Fährte war einige Stunden alt, und das Licht reichte höchstens noch eine halbe Stunde aus, um die Spuren zu sehen. Irgendwo jenseits der nächsten Bergkette lag Fort Dorso, dieses lausige Banditennest. Aber die Flüchtlinge schienen der Grenze nach Oregon zuzureiten.
Offenbar rechneten sie nicht mit Verfolgung, denn sie hatten nicht den geringsten Versuch unternommen, die Spuren zu verwischen.
»Sie halten mich für einen Trottel«, murmelte Gushee und grinste.
Plötzlich warf sein Pferd den Kopf auf. Sofort glitt Sheriff Gushee aus dem Sattel und tauchte im Gebüsch unter.