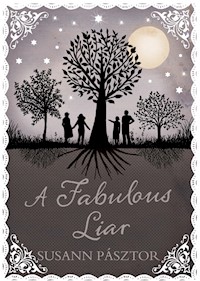19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von zweiten und dritten Chancen im Leben Nach dreißig Jahren Ehe ist Marlene plötzlich Witwe, doch statt zu trauern, ist sie vor allem wütend. Die Mitglieder ihrer angeheirateten Großfamilie wundern sich über ihr Verhalten, aber Marlene lässt niemanden an sich heran. Bis sie eines Tages einen unerwarteten Mitbewohner bekommt: Jack ist nicht nur ein begnadeter Koch, sondern stellt auch die richtigen Fragen. Und er ist nicht der Einzige, der Marlene noch mal so richtig aus dem Konzept bringt. »Susann Pásztor bringt uns dazu, im Lachen das Ernste zu sehen – und umgekehrt.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Susann Pásztor
Von hier aus weiter
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Susann Pásztor
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Susann Pásztor
Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, hat die 70er-Jahre nicht nur miterlebt, sondern kann sich auch an sie erinnern, und was sie vergessen hat, erfindet sie. Nach »Ein fabelhafter Lügner« und »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts« erschien 2017 ihr dritter Roman »Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster«, der mit dem Evangelischen Buchpreis ausgezeichnet wurde. 2022 schrieb sie in der KiWi-Musikbibliothek über die Band Genesis. Sie lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nach dreißig Jahren Ehe ist Marlene plötzlich Witwe. Einsam und perspektivlos sitzt sie in ihrem großen leeren Haus und verweigert jegliche Unterstützung, ignoriert die Anrufe ihrer Freundin und plant stattdessen ihren Suizid. Bis eines Tages ein unerwarteter Besucher vor der Tür steht – und nicht nur er bringt ihre Pläne gehörig durcheinander. Susann Pásztors neuer Roman erzählt mit feinem Witz und berührender Tiefe eine große Geschichte von einer Frau, die sich und ihr Leben neu erfinden muss.
Nach Rolfs Tod schleppt sich Marlene mithilfe von Beruhigungsmitteln durch ihren Alltag als Hinterbliebene und sieht als einzigen Ausweg ihr eigenes baldiges Abtreten. Erst als Klempner Jack, ihr ehemaliger Schüler, auftaucht und kurzerhand bei ihr einzieht, kommt Bewegung in ihr Leben: Jack entpuppt sich nicht nur als fantastischer Koch, sondern auch als einfühlsamer und aufmerksamer Mitbewohner. Aber warum Marlene nicht trauert, sondern vor allem wütend ist, kann auch er nicht so ganz begreifen. Während sich zwischen Jack und Marlenes Hausärztin Ida eine zarte Liebe anbahnt, taucht bei Marlenes Freundin Wally in Wien ein Brief von Rolf auf, der möglichweise die Antwort auf alle offenen Fragen enthält. Gemeinsam mit Jack und Ida macht Marlene sich auf eine Reise, die völlig anders verläuft als erwartet.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Edward B. Gordon Tagesbild 3947 Dutch Landscape 2 (Detail)
Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers
www.gordon.de
ISBN978-3-462-31195-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Limbo
Baustelle
Druck
Amnesie
Indisch
Dämonen
Fundsachen
Wut
In Wirklichkeit
Grüße aus Wien
Familienangelegenheiten
Nicht allein
Pralinen im Mund
Unterbrochene Kühlkette
All diese Gespenster
Das, wonach es aussieht
Keine Erstattung der Wartezeit
Singen oder sterben oder
Über die Zeit hinaus
Dank
Limbo
Der Moment, in dem Marlene begriff, dass sie die Toilettenkabine nicht auf dem üblichen Weg verlassen konnte, war der erste seit Wochen, in dem Rolfs Tod keine Rolle spielte.
Sie ließ Klinke und Drehschloss los, an denen sie drei, vier Minuten lang vergeblich gezerrt und gerüttelt hatte, und trat der Form halber ein letztes Mal gegen die Tür. Dann ließ sie sich auf die Knie nieder, redete sich gut zu, dass Frauen eher selten danebenpinkelten, und schätzte die Höhe der Lücke zwischen der unteren Türkante und dem gefliesten Boden ab. Dreißig Zentimeter? Das würde reichen. Als das Handy in ihrer Handtasche zu klingeln begann, hatte sie den Oberkörper bereits flach auf den Boden gepresst, bereit für die Passage. Weil sie den Anruf nicht im Liegen annehmen wollte, setzte sie sich wieder auf.
»Marlene, wo steckst du? Die Kinder sind gleich an der Reihe. Alle warten auf dich.«
Sie hörte Stimmen im Hintergrund, klappernde Teller, ein schreiendes Baby, jemand, der energisch an ein Glas schlug. Oben im Festsaal war die Zeit der Reden und Darbietungen noch längst nicht vorbei, und schon sank Rolf wieder bleischwer in ihre Gedankenwelt, und sie fragte sich, warum sie nicht einfach sitzen blieb hinter dieser verkanteten Toilettentür, bis irgendetwas anderes passierte, es passierte doch ständig irgendetwas anderes, oder es passierte erst mal überhaupt nichts, und auch das wäre in Ordnung.
»Marlene? Bist du noch da?«
Rolfs ältesten Sohn in ihre missliche Lage einzuweihen oder gar um Hilfe zu bitten war undenkbar. Auf keinen Fall wollte sie noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, nicht heute, und erst recht nicht hier. Es musste ihr aus eigener Kraft gelingen, sich zu befreien.
»Ich komme gleich. Gebt mir bitte noch einen Augenblick.«
Marlene wartete Olafs Antwort nicht ab, sondern beendete das Gespräch, hockte sich hin und schob das Telefon zusammen mit der Handtasche unter der Tür durch. Dann legte sie sich wieder auf den kalten Fliesenboden und versuchte sich zu konzentrieren. Die Arme angewinkelt und eng an den Körper gelegt, das Hinterteil hochgereckt, stemmte sie den rechten Fuß gegen die Toilettenschüssel und arbeitete sich bäuchlings Zentimeter für Zentimeter vor. Ihre Frisur wurde kaum gestreift, auch Schultern und Oberkörper brachte sie nahezu mühelos auf die andere Seite, denn ihre Brüste waren klein, ihr Hintern jedoch erwies sich als Problem. Sie war überzeugt, es lösen zu können, indem sie jetzt die Unterarme zum Robben benutzte und ihren Leib wie eine Schlange hin- und herwand.
Das Kind, das plötzlich vorne bei den Waschbecken stand und sie anstarrte, hatte sie nicht kommen hören. Marlene, den unteren Teil ihres Körpers noch im Inneren der Kabine, blieb nichts anderes übrig, als den Blick stumm und mit mühsam erhobenem Haupt zu erwidern. Es musste eine von Olafs Töchtern sein, wenn sie sich recht erinnerte, hieß das Mädchen Griseldis oder Wilhelmine, auf jeden Fall trug es wie alle seine Geschwister einen absurd altmodischen Namen. Etwa neun oder zehn Jahre alt, war es aus aktuellem Anlass in einen schwarz gefärbten Kittel gesteckt worden, in dem es nicht besonders froh aussah, aber wer sah schon froh aus an so einem Tag?
Weil das Kind beharrlich schwieg, beschloss Marlene, ihre Reise fortzusetzen. Das ganze Herumgewinde hatte nichts gebracht, hier war Kraft gefordert, Kraft und Entschiedenheit, und tatsächlich gelang es ihr unmittelbar nach dieser Erkenntnis, mit einem beherzten Ruck Hüften und Po aus der Klammer der Kabinentür zu befreien. Einen kleinen Laut des Triumphs konnte sie sich nicht verkneifen, und sogar das Kind wirkte verhalten erfreut. Marlene richtete sich auf und griff nach Telefon und Tasche, kam ein wenig zu schnell auf die Beine und musste gegen einen milden Schwindel ankämpfen, als sie zum Waschbecken schritt. Mit einem angefeuchteten Papiertuch rieb sie den Schmutz von ihrem Kostüm und zupfte ein haariges Gebilde vom rechten Ärmel, von dem sie lieber nicht wissen wollte, was es war. Sie wusch sich die Hände und vermied es dabei, in den Spiegel zu sehen, das war ihr schon immer leichtgefallen, und als sie sich zum Gehen wandte, setzte sich auch das Kind in Bewegung.
Die graue Terrazzotreppe, die hoch ins Erdgeschoss führte, hatte schmale Gummistreifen an den Kanten und war ebenso hässlich wie alles andere im Gasthaus Deichkrone, einem Klinkerbau aus den Sechzigerjahren, den Familie Hansen seit seiner Eröffnung für alle anfallenden Taufen, Konfirmationen oder Trauerfeiern aufsuchte, nur geheiratet wurde immer anderswo. Das Treppenhaus roch nach Reinigungsmitteln und einem Hauch Frittierfett. Oben angekommen, zögerte Marlene. Auch das Mädchen verharrte einen Moment, ging dann zur Eingangstür des Festsaals und zog sie auf.
»Wir müssen wieder rein.« Ihre Stimme ließ keinen Widerspruch zu.
»Da wirst du wohl recht haben«, sagte Marlene.
Man hatte die unberührte Suppe an ihrem Platz noch nicht abgeräumt und zusätzlich Kaffee und Butterkuchen aufgetischt, ein klassischer Leichenschmaus, so hielt man es hier in der Provinz. Es hieß, die Chefin der Deichkrone würde jeden Wunsch nach einer moderneren Menügestaltung entrüstet zurückweisen, der Trend zum Fleischverzicht in der jüngeren Generation war von der Küche mit der Anschaffung einer Fritteuse beantwortet worden, weitere Zugeständnisse kamen nicht infrage. Marlene hasste Butterkuchen. Sie war sich der teilnahmsvollen Blicke der anderen Gäste bewusst, als sie sich auf ihrem Stuhl niederließ und Tassen und Teller beiseiteschob. Der zweite Teil der Schwererträglichkeiten hatte begonnen. Nach der Episode auf der Toilette hielt sie sich für stark genug, auch ihn durchzustehen.
Es waren vielleicht sechzig Personen, die sich zur privaten Trauerfeier eingefunden hatten, fast alles Familie, knapp ein Drittel davon Kinder. An Marlenes Tisch saßen Rolfs drei Söhne mit ihren Ehefrauen, von denen gleich zwei Susanne hießen und die dritte einen komplizierten spanischen Doppelnamen trug, auf dessen vollständige und korrekte Aussprache sie großen Wert legte: Alejandra-Marisol. Sie war die Partnerin von Jasper, Rolfs Jüngstem, zu dem Marlene ebenso wenig wie zu seinen Brüdern irgendeine Form von stiefmütterlicher Beziehung aufgebaut hatte, aber wie auch, selbst Jasper war bei ihrer Heirat mit Rolf schon über achtzehn gewesen, da entwickelte man keine Gefühle mehr, sondern hielt respektvoll Abstand. Am ehesten fühlte sie sich noch Henning verbunden, dem mittleren Sohn, nicht zuletzt, weil er nach Rolfs Tod sämtliche Feierlichkeiten organisiert und Marlene von allen Aufgaben entbunden hatte, die einer Witwe zugedacht waren. Seine emotionale und warmherzige Rede in der Friedhofskapelle hatte alle Trauergäste sofort vergessen lassen, wie steif und bemüht ihre eigene Ansprache gewesen war, und für die Entlastung, die er ihr damit schenkte, nahm Marlene das Deichkronen-Ambiente nur zu gern in Kauf.
Als sich Olaf jetzt erhob, verstummten die Gespräche an den umliegenden Tischen, nur die Kinder lärmten weiter. Seit Marlene ihn kannte, hatte sich Olaf nach Kräften darum bemüht, Oberhaupt der Hansen-Sippe zu werden, ein Posten, an dem außer ihm nie jemand interessiert gewesen war. Bekommen hatte er ihn trotzdem nicht. Jetzt räusperte er sich und bedachte Marlene mit einem Blick, der wohl verhindern sollte, dass sie ein weiteres Mal ihren Platz verließ. Marlene nickte ihm zu, sie war bereit.
»Liebe Familie, liebe Freunde«, begann Olaf. »Ich habe die Ehre, euch dreizehn« – er machte eine kleine Pause, die Marlene unnötig eitel vorkam – »Enkelinnen und Enkel von Rolf anzukündigen, die uns etwas über ihren Großvater vorsingen wollen. Uns allen und natürlich ganz besonders dir, liebe Marlene.«
Alejandra-Marisol hielt ihr Jüngstes in die Höhe, das eine zermatschte Banane in der Faust hielt. »Nummer vierzehn kann noch nicht mitsingen«, rief sie. Ein paar Gäste lachten höflich.
Meine Güte, vierzehn, dachte Marlene, was hat diese Brüder nur angetrieben, sich derart entschlossen zu vermehren? Sie hatte nach jeder Geburt Glückwunschkarten verschickt, wie es sich gehörte, aber sie vermochte Rolfs Enkelinnen und Enkel kaum auseinanderzuhalten, geschweige denn, dass sie sich merken konnte, wie sie alle hießen, und das, obwohl sie in ihren vielen Dienstjahren als Grundschullehrerin nichts anderes getan hatte, als sich Namen von Kindern einzuprägen, die dann wieder aus ihrem Leben verschwanden. Sie versuchte, wenigstens ein paar der Kinder, die sich jetzt in der Saalmitte im Halbkreis aufstellten, zu identifizieren und ihren jeweiligen Eltern zuzuordnen, was zusätzlich dadurch erschwert wurde, dass alle diese entsetzlichen schwarzen Kittel trugen. Sie kam nicht über drei hinaus.
»Es ist ein Lied, von dem wir wissen, dass unser Vater es sehr geliebt hat«, sagte Olaf. »Also los, Kinder!«
Marlene hatte nicht den Hauch einer Ahnung, von welchem Lied die Rede sein könnte, Rolf war der unmusikalischste Mensch der Welt gewesen, er kannte weder Komponisten noch Interpreten und hatte zwar höflich zugehört, aber stets überfordert gewirkt, wenn Marlene ihm schöne Musik vorspielen wollte. Ob Klassik, Folklore, Jazz oder Pop, alles flog vorbei, nichts blieb ihm im Ohr. Andere Menschen waren farbenblind, Rolf Hansen war klangtaub gewesen, obwohl er nachweislich ein gut funktionierendes Gehör besessen hatte. Sie merkte, dass sie kurz davor war, in überdrehtes Gelächter auszubrechen, und riss sich zusammen. Das hier war Rolfs Party. Langsames, gleichmäßiges Atmen half ihr bei der Kontrolle ihrer Mimik, während sich eine der beiden Susannen mit umgehängter Wandergitarre zu den Kindern begab und auf ein Zeichen der anderen Susanne, die sich vor dem Chor positioniert hatte, immer wieder dieselben zwei Akkorde anzuschlagen begann. Das Vorspiel zog sich quälend lange hin, bis endlich dem Chor sein Einsatz gewährt wurde. Die schwarz gekleideten Kinder sahen aus wie junge Krähen.
»Opa Rolf
O-pa Rolf
Oo-pa Rolf
Du bist jetzt im Himmel
Du hast keine Schmerzen mehr
Du bist ganz weit weg von uns
Und wir vermissen dich so sehr
Halleluja
So-ho sehr
Halleluja.«[1]
Rolf hatte also angeblich My Sweet Lord von George Harrison geliebt, nun ja, es hätte schlimmer kommen können. Die Kinder hielten beim Singen erstaunlich gut die Melodie, auch der schlichte Text ließ sich wesentlich besser ertragen als die Anekdoten aus Rolfs Leben, die sich Marlene heute hatte anhören müssen. Sie entspannte sich ein wenig, der Drang zu lachen war fort. Auch dies hier würde vorbeigehen. Ganz am Ende des kleinen Halbkreises stand das Mädchen von vorhin und sang mit großer Ernsthaftigkeit, den Blick fest auf Marlene gerichtet. Es machte ein Gesicht, als wüsste es längst alles, was sie selbst seit ein paar Wochen vergeblich zu begreifen versuchte, und sie bemühte sich, mit freundlicher Entschiedenheit zurückzugucken: Nichts weißt du, Kind, nichts.
»Wir sind furchtbar traurig
Wir hätten dich so gern zurück
Wir denken heut ganz oft an dich
Opa Rolf, auf Wiedersehen
Halleluja.«
Wie viele Strophen das Lied wohl noch hatte? Marlene meinte sich zu erinnern, dass im Original sehr viele Hallelujas vorkamen, auch Hare Krishnas waren darunter gewesen, aber so etwas ließen die beiden Susannen ihre Kinder bestimmt nicht singen. Um den Blicken des Mädchens zu entkommen, nahm sie ihre Handtasche von der Stuhllehne und kramte darin herum, als wäre ihr plötzlich etwas eingefallen, das sie unbedingt finden musste. Das Erste, was ihr dabei in die Hände geriet, war das Döschen mit Valium. Wann hatte sie die letzte genommen? Es musste direkt vor ihrer misslungenen Rede in der Friedhofskapelle gewesen sein, war also schon eine ganze Weile her, aber sie wollte noch keine neue. Allein das Wissen, dass ihre Vorräte an Benzodiazepinen dank Rolfs Umsicht schier unerschöpflich waren, wirkte beruhigend. Sie nahm ein Papiertaschentuch aus der Packung und tupfte damit an Augen und Nase herum, was sicherlich als Rührung aufgefasst wurde, denn sie hatte richtig vermutet, die Hare Krishnas waren durch »Lieber Opa« ersetzt worden und wurden jetzt im Wechsel mit den Hallelujas gesungen. Als die Kinderstimmen endlich verstummten und der Applaus einsetzte, beeilte sich Marlene, ebenfalls mitzuklatschen, und bedachte die Enkelkinder sowie die beiden Susannen mit einem, wie sie hoffte, dankbaren Lächeln.
Bald darauf brachen die ersten Gäste auf, und Marlene gab sich nach einer Weile keine Mühe mehr, ihre Erleichterung zu verbergen, wenn sie zu ihr kamen, um sich zu verabschieden. Henning hatte sich neben sie gesetzt und versuchte sie ein weiteres Mal davon zu überzeugen, dass sie bei ihm und seiner Susanne fürs Erste besser aufgehoben wäre als in dem großen, leeren Haus, das sie mit Rolf bewohnt hatte und das jetzt ihr gehörte.
»Du meinst das Haus, in dem Rolf sich umgebracht hat«, sagte Marlene. Vielleicht sollte sie doch schon jetzt die nächste Valium nehmen.
Henning atmete geräuschvoll aus. »Es geht doch nur darum, in dieser schweren Zeit nicht allein zu sein«, sagte er dann. »Wir können alle Trost gebrauchen.«
»Danke, mein Lieber, aber Alleinsein ist jetzt genau das Richtige für mich«, sagte Marlene und versuchte, das Pillendöschen in der Handtasche zu ertasten und einhändig zu öffnen. Der Deckel ging leichter auf, als sie erwartet hatte, und die Tabletten rieselten ihr durch die Finger ins Tascheninnere. Sie zog die Hand heraus, leer.
»Wonach suchst du denn? Kann ich dir helfen?«
»Mein Telefon. Ich möchte ein Taxi rufen.«
»Jemand von uns kann dich doch nach Hause fahren, Marlene.«
»Vielleicht gehe ich auch zu Fuß«, sagte sie. »Ist ja nicht weit.«
»Nein, weit ist es nicht«, sagte Henning.
»Darf ich euch kurz stören?«
Ida Polanski war keine Frau, der man solch eine Bitte abschlug, weil fast alles, womit sie einen störte, sich als wichtig herausstellte. Sie hatte vor fünf Jahren Rolfs Arztpraxis übernommen, da war er gerade siebzig geworden und hatte sich vor dem Ruhestand gefürchtet. Ida war jung und hoch motiviert, aber vor allem war sie unerschrocken genug gewesen, als Erste das Wort »Tumor« auszusprechen und ihn zum Neurologen zu schicken, während Rolf immer noch von Migräne redete. In den Wochen vor seinem Tod hatte sie oft bei ihnen zu Hause vorbeigeschaut, meistens nur auf eine Tasse Tee und eine Runde Schweigen, dabei konnte Ida, wenn sie wollte, reden ohne Ende, das wusste jeder hier.
»Sie stören überhaupt nicht, Frau Doktor«, sagte Henning.
»Tut mir leid, aber wir wollten gerade los«, sagte Marlene und stand auf. »Der Tag war fürchterlich anstrengend. Henning fährt mich jetzt nach Hause.«
Sie griff nach ihrer Tasche. Henning machte ein verblüfftes Gesicht und erhob sich ebenfalls.
»Ich wollte mich mit dir verabreden«, sagte Ida. Falls sie Marlenes Verhalten befremdlich fand, ließ sie es sich nicht anmerken.
»Das ist eine wunderbare Idee«, sagte Henning. »Wo doch außer Olaf alle so weit weg wohnen.«
»Tja«, sagte Marlene und ließ offen, was sie damit meinte.
Ida beugte sich so weit zu ihr vor, dass sie sich zusammenreißen musste, um nicht zurückzuweichen, und pflückte etwas von ihrer Schulter. Es war das haarige Ding aus der Damentoilette.
»Dann komme ich in den nächsten Tagen einfach mal bei dir vorbei«, sagte Ida.
»O ja, machen Sie das«, sagte Henning, als Marlene nicht antwortete.
Auf dem Weg zum Ausgang wurden sie immer wieder aufgehalten, für ein stummes Händeschütteln, eine Abschiedsumarmung oder ein paar freundliche Worte. Marlene stand es durch, ließ sich von Alejandra-Marisols Nummer vierzehn auf den Ärmel sabbern und versicherte, weil sie nacheinander fragten, allen drei Brüdern, ihre Lebensmitteleinkäufe selbst erledigen zu können, während Olafs Tochter mit verschränkten Armen dastand und sie schweigend anstarrte. Die Wirtin eilte herbei und wurde von Henning vertröstet, nicht jetzt, er würde später noch einmal zurückkommen und mit ihr die Abrechnung durchgehen, und Marlene machte sich wenig Hoffnung, dass ihr Hinweis auf die kaputte Toilettentür von irgendwem gehört worden war. Die letzte Prüfung des Tages war Pastor Meyberg, der vor der Eingangstür ein Zigarillo rauchte, das er bei ihrem Anblick in die Dahlienrabatte warf, und zu einem Spontanvortrag oder einer Abschiedsrede ansetzte, das eine so schlimm wie das andere, und Marlene winkte ab, sie konnte nicht mehr. Sie hakte sich bei Henning ein und ließ sich wenige Minuten später erleichtert in die Polster des Beifahrersitzes sinken.
»Er hat mich bei der Predigt dreimal Ursula genannt. Rolfs Witwe Ursula«, sagte sie.
»Er kannte halt unsere Mutter noch«, sagte Henning. Während der zehnminütigen Fahrt bis zu ihrem Haus sprachen sie nicht mehr.
Als Henning in der Einfahrt hielt, hatte Marlene bereits die Hand am Türgriff. »Du brauchst nicht mit reinzukommen«, sagte sie. »Danke fürs Herbringen. Ich werde mich sofort hinlegen.« Sie nahm an, dass Henning sich jetzt fragte, ob sie weiterhin im selben Bett schlief, in dem Rolf gestorben war, aber solch eine Indiskretion hätte er niemals laut ausgesprochen, und sie hätte ihm die Antwort auch nicht zumuten wollen.
»Wir telefonieren«, sagte Henning und tätschelte ihr zum Abschied unbeholfen den Arm. »Und wenn was ist, ruf immer als Erstes bei Olaf an, der kann in einer halben Stunde bei dir sein.«
»Ja. Bitte grüß noch mal alle«, sagte Marlene und meinte es ernst. Mit einem Wiedersehen rechnete sie nicht.
Sie stieg aus und sah Henning zu, wie er sein Auto wendete und ihr ein letztes Mal zuwinkte. Der arme Junge. Die armen Jungen, alle drei, erst die schreckliche Diagnose und dann der Suizid des Vaters, mit dem sie klarkommen mussten, und nichts wollte Marlene weniger, als in dieser Tragödie eine weitere belastende Rolle einzunehmen.
Wie immer versuchte sie zuerst, den Garagenschlüssel ins Haustürschloss zu stecken, und bemerkte ihren Irrtum in letzter Sekunde. Im Flur schlug ihr schale, abgestandene Luft entgegen. Sie vergaß oft zu lüften, seit sie vor ein paar Jahren das Rauchen aufgegeben hatte, vielleicht sollte sie wieder damit anfangen, was interessierte sie denn noch ihre Gesundheit? Sie streifte die Schuhe von den Füßen. Das erste angenehme Gefühl des Tages hatte sie, als ihre bestrumpften Fußsohlen erst das kühle Holzparkett und dann die Keramikfliesen in der Küche berührten, das zweite, als sie den Weißwein aus dem Kühlschrank nahm und sich ein Glas einschenkte. Sie trug es zum Wohnzimmersofa, wo sie auf das dritte angenehme Gefühl wartete, aber es wollte sich nicht einstellen. Sie bemühte sich, nicht auf die ungeöffnete Post zu starren, die sich seit Rolfs Tod auf der Kommode stapelte und früher oder später als Erdrutsch über den Rand kippen würde, und versuchte es mit einem Blick in Richtung Terrassentür, aber auch dort sah es nicht erfreulicher aus, Gartenmöbel waren wie Treibgut ineinander verkeilt, dahinter ein gelber verwahrloster Rasen, der schon vor Wochen hätte gemäht werden müssen. Das Vogelhaus, von einem frühen Herbststurm umgeweht, lag wie ein gefällter Baum vor der Terrasse im Gras, eins seiner drei hölzernen Beine ragte in die Luft. Es dämmerte bereits. In einer halben Stunde würde es dunkel sein, ein weiterer Tag hatte sich erledigt, und dieser war einer der schlimmsten gewesen. Morgen würde sie vielleicht mit dem Aufräumen beginnen. Oder mit dem Nachdenken über das Aufräumen. Auf jeden Fall würde sie mit etwas beginnen, das irgendwann irgendwohin führte, vielleicht sogar schon bald.
Sie leerte das Glas. Als sie aufstand, dachte sie an ihr Erlebnis in der Toilettenkabine und strich sich dabei unwillkürlich über den Rock. Ihre Hand zuckte zurück, als sie am unteren Saum auf etwas Haariges stieß. Das Ding, das Ida vorhin auf ihrer Schulter entdeckt hatte, klebte immer noch an ihr. Eine Weile stand Marlene mit hängenden Armen da, viel zu verzweifelt, um es komisch zu finden, und zu erschöpft, um sich zu ekeln.
Oben im Schlafzimmer zog sie sich im Dunkeln bis auf die Unterwäsche aus und ließ das Kostüm auf dem Boden liegen. Das Licht im Bad war grell. Im Schränkchen über dem Waschbecken befand sich Rolfs Vermächtnis: auf der rechten Seite alles, was den körperlichen Schmerz tilgte, und auf der linken, was Geist, Herz und Seele betäubte. Die Medikamente hatte sie in seiner Schreibtischschublade gefunden und sorgfältig einsortiert, um Verwechslungen auszuschließen. Sie drückte eine Valium aus der Blisterverpackung, zerteilte sie, schluckte die eine Hälfte mit etwas Leitungswasser und presste die andere mit dem Daumen zurück in die Vertiefung. Beim Zähneputzen blickte sie starr in den Spiegel. Nachdem sie ihr Gesicht gereinigt und eingecremt hatte, stopfte sie ihre Unterwäsche in den überquellenden Wäschekorb, zog das grünseidene Nachthemd an, das sie schon seit Tagen gegen ein frisches austauschen wollte, und kehrte zurück ins Schlafzimmer.
Es dauerte nie länger als zwanzig Minuten, bis die Wirkung einsetzte, dieses wattige Rauschen, das ihre Gedanken auseinandertrieb und alles, was zuvor streng und unbarmherzig war, in breiweiche Belanglosigkeit verwandelte. Dann spürte sie, wie Rolf sich neben ihr auf die Bettkante setzte, so wie er es jede Nacht tat, seit er gestorben war, und wie immer sprach er zu ihr, als müsse er ihr etwas Wichtiges erklären, und sie sah zu, wie sein Mund sich öffnete und schloss, aber was er sagte, verstand sie nie.
Baustelle
Das Aufwachen war das Schlimmste. Seit Rolfs Tod verhöhnte sie jeder Morgen aufs Neue mit seiner gottverdammten Gegenwärtigkeit, denn er war natürlich längst da und sie leider immer noch, nur Rolf hatte sich aus dem Staub gemacht, und alles begann wieder von vorn. Ein anderer Schlafplatz war keine Lösung, sie hatte es ein einziges Mal auf der Wohnzimmercouch versucht, da war das Erwachen noch entsetzlicher gewesen, wie aus ihrer persönlichen Hölle vertrieben hatte sie sich gefühlt. Also blieb sie nachts dort liegen, wo sie seit fast dreißig Jahren lag, und suchte, sobald sie die Augen öffnete, vergebens nach einer Antwort auf die Frage, wie lange es noch dauern würde: einen weiteren Tag, eine weitere Woche, einen Monat, vielleicht noch den ganzen verfluchten Herbst lang, der gerade erst begonnen hatte?
An diesem Morgen sah Marlene beim Aufwachen ihren bleichen Unterarm vor sich, dessen Zartheit es mittlerweile mit jeder Babyhaut aufnehmen konnte, wäre da nicht jenes Waffelmuster auf seiner papierdünnen Oberfläche gewesen, das sich bei jeder Bewegung mit filigranen Verwerfungen neu ordnete. Nichts brauche man beim Älterwerden dringender als einen guten Humor, hatte Rolf immer gesagt, aber das war vor seiner Krebsdiagnose gewesen, danach waren ihm die Kalendersprüche ausgegangen. Jetzt war es an Marlene, neue Weisheiten zu erfinden, vielleicht: Nichts brauche man beim Sterben dringender als die richtige Dosis oder das richtige Seil, denn inzwischen wusste sie, dass laut Statistik die meisten Selbstmörder noch immer den Tod durch Erhängen oder Strangulieren bevorzugten, eine Methode, die sie für altmodisch und überholt gehalten hatte. Für einen Suizid durch chemische Substanzen fehlten ihr die nötigen Quellen, das war Rolfs Domäne gewesen. Einen Sturz aus großer Höhe schloss sie genauso kategorisch aus wie den Sprung vor einen herannahenden Zug, aber was blieb da noch? Erschießen? Ins Wasser gehen, wie man es früher nannte?
Sie schlug die Decke zurück und setzte sich auf, dabei stellte sie fest, dass sie Hunger hatte, großen sogar. Rolf hatte am Ende keinen mehr gehabt, aber Rolf war schwer krank gewesen im Gegensatz zu ihr. Sie war einsam. Sie war eine einsame Frau, die lebensmüde war und Hunger hatte, aber nichts zu essen im Haus. Sie beschloss, nicht mit dem Fahrrad zum Supermarkt zu fahren, sondern das Auto zu nehmen, vielleicht ergab sich unterwegs etwas. Mit Vollgas auf einen Baum zuzufahren war nicht unbedingt ihre bevorzugte Todesart, aber vielleicht erwischte sie ihn ja doch, diesen einzigartigen Moment, in dem ihr alles egal war, auch ihr Hunger, so dass sie das Steuer festhalten und nicht doch noch in allerletzter Sekunde herumreißen würde.
Als Marlene die Klingel hörte, zog sie hastig die dunkelblaue Jogginghose an, die ihr im Schrank als Erstes in die Hände fiel, es war eine von Rolf, und sie musste die Beine mehrmals hochkrempeln und wusste, dass sie darin aussah wie ein schlecht verkleidetes Kind. Sie warf sich ihren Morgenmantel über, schlich die Treppe hinunter ins Erdgeschoss und konnte bereits durch den Türspion sehen, wie entschlossen Ida war, sich nicht von ihr abwimmeln zu lassen. Sie öffnete die Tür in dem Bewusstsein, diese Entschlossenheit durch ihren kläglichen Anblick noch zu befeuern, während Ida mit ihren rosigen Wangen und den erdbeerblonden Haaren unter dem Fahrradhelm wie immer patent und unfassbar jung und gesund aussah.
»Jetzt schon?«, fragte Marlene.
»Ich habe drei Tage mit meinem Besuch gewartet«, sagte Ida. »Das war lange genug. Morgen, Marlene.« Sie schwenkte eine Tüte. »Es gibt Brötchen zum Frühstück, das passt doch, oder?«
Marlene rang sich ein Lächeln ab, trat beiseite und wies wortlos zur Küche. Ida zögerte kurz, als sie das Chaos sah, legte die Tüte auf dem Herd ab und begann als Erstes den Esstisch freizuräumen, der mit Tassen und anderem benutztem Geschirr vollgestellt war. Sie rannte geschäftig hin und her, suchte und fand zwei saubere Teller, warf einen Blick in den Kühlschrank und dann einen auf Marlene, die mit fest über dem Bauch verschränkten Armen an der Wand lehnte, um das Geräusch ihres knurrenden Magens zu dämpfen.
»Außer Butter und Marmelade hab ich nichts im Haus, Ida«, sagte sie. »Höchstens noch Weißwein.«
»So sieht es überall in den Küchen von Menschen aus, die jemanden verloren haben«, sagte Ida.
»Ach, echt?«, sagte Marlene. »Kaffee hätte ich auch noch. Aber keine Milch.«
»Kaffee ohne Milch ist okay. Wo habt ihr eure Messer?«
Marlene ging zur Anrichte und zog die Besteckschublade auf. Dann nahm sie die alte Filtertüte aus der Kaffeemaschine, die am oberen Rand angetrocknet und dunkel verfärbt war, und warf sie in den Müll. Sie setzte neuen Kaffee auf, das Pulver reichte gerade noch für einen Durchlauf. Sie musste wirklich dringend einkaufen gehen, es fehlte an fast allem.
Sie warteten beide, bis der Kaffee zum Einschenken bereit war, bevor sie sich setzten. Marlene gab jeglichen Widerstand auf, sie nahm sich die einzige Brezel aus der Tüte und riss ein Stück ab, bestrich es mit Butter und aß es, während sie so tat, als würde sie Idas erfreutes Gesicht nicht bemerken.
»Ich wusste genau, dass du was zum Frühstück brauchtest.«
»Warum bist du hier, Ida?«, fragte Marlene, als ihr Mund wieder leer war.
»War ich doch früher auch«, sagte Ida.
»Früher ist vorbei«, sagte Marlene und riss ein weiteres Stück von der Brezel ab.
Ida nickte und lehnte sich zurück, als wäre es wichtig, so viel wie möglich von Marlene sehen zu können. »Na schön«, sagte sie. »Ich bin hier, weil ich was dagegen habe, nach Rolfs demnächst auch noch deinen Totenschein zu unterschreiben. Reicht das als Grund, mal vorbeizuschauen? Ich finde, schon.«
»Ich habe keine Ahnung, worauf du hinauswillst.«
»Wollen wir nicht endlich mal Tacheles reden, Marlene?«
»Nein«, sagte sie und wandte sich wieder der Brezel zu.
»Okay«, sagte Ida. »Dann hätte ich jetzt gern mal die Butter, bitte.«
Marlene gab sie ihr. Ida verteilte sie fingerdick auf ihrem Brötchen und biss hinein. Sie redeten längere Zeit nicht.
»Mach dir bitte keine Sorgen um mich«, sagte Marlene, als nur noch der trockene Brezelknoten auf ihrem Teller lag.
»Tu ich aber«, sagte Ida. »Ich muss immer wieder an diesen Morgen denken, an dem du mich gerufen hast. Mit Rolfs Suizid hat das nichts zu tun, damit hatte ich gerechnet, und ich bin mir sicher, dass alles mit dir abgesprochen war. Es hat niemanden überrascht, auch nicht seine Söhne, oder? Und dann standst du da und warst so irrsinnig wütend. Du hast nicht nur mich, sondern auch die Polizeibeamten angeschnauzt, wir sollten endlich den Leichnam mitnehmen und abhauen. Nein warte«, sagte sie, als Marlene abwehrend die Hände erhob. »Ich will dich ja gar nicht kritisieren. Aber ich weiß auch, wie unendlich wichtig es ist, sich Zeit zum Trauern zu nehmen. Den Schmerz überhaupt erst mal zulassen. Auf der Beerdigung warst du so unglaublich gefasst. Und immer noch wütend.«
»Darf ich?«, fragte Marlene und griff nach dem Teller mit der restlichen Butter.
»Du hörst mir überhaupt nicht zu, oder?«
»Doch, natürlich höre ich dir zu, Ida. Ich soll mehr Trauer zeigen, sagst du.«
»Du darfst deinen Kummer nicht so in dich reinfressen, sage ich. Und es wäre sicher gut, wenn du Rolf seine Entscheidung nicht unnötig lange nachträgst.«
»Was meinst du damit?«
»Na, deine Wut«, sagte Ida. »Irgendwoher muss die doch kommen. Aber vor allem brauchst du Menschen, mit denen du reden kannst.«
»Ich mache das auf meine Art«, sagte Marlene.
»Möchtest du nicht lieber mal was anderes versuchen? Erst mit so einer Diagnose und dann mit einem Suizid klarzukommen, das kriegt doch kein Mensch allein auf die Reihe. Bitte, Marlene, sprich mit mir. Und wenn du das nicht willst, sprich mit anderen.«
»Mit wem denn zum Beispiel?«
Auf diese Frage war Ida bestens vorbereitet, Marlene bemerkte es zu spät.
»Es gibt Trauergruppen für Hinterbliebene, da wärst du bestimmt gut aufgehoben. Sie treffen sich regelmäßig in einem Café, ich geb dir die Adresse. Du musst nur hingehen und sagen: ›Meine Ärztin hat mich hergeschickt, aber ich hab das alles hier gar nicht nötig‹, und dann kümmern die sich schon.«
»Du bist nicht meine Ärztin«, sagte Marlene.