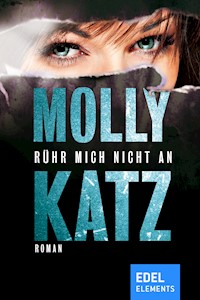1
JUNI 1997
Carol Maxx’ Hände auf der Sessellehne zitterten. Ellen musterte sie über den Schreibtisch hinweg und registrierte die Signale. Diesmal konnte sie keine blauen Flecken sehen. Offensichtlich gelang es Jeff immer besser, keine zu hinterlassen, jedenfalls nicht an auffälligen Stellen. Carol war kreidebleich im Gesicht und schluckte ununterbrochen. Sie schien nichts dagegen tun zu können.
»Die Idee mit dem eingeschränkten Umgangsverbot war nicht gut«, sagte Carol. »Das hat Jeff offensichtlich noch mehr gereizt. Gestern fiel ihm auf, dass Suzanne geschminkt war. Er hat ihr den Lippenstift weggenommen, das Gesicht voll geschmiert und gesagt, wenn sie so etwas noch einmal benutzt, würde er ihn ihr in die Nase stopfen. Er hat sie als vierzehnjähriges Flittchen bezeichnet.«
»Das hat er Suzanne ins Gesicht gesagt?«
»Ja. Dann bin ich dazwischengegangen. Da hat er mir den Arm auf den Rücken gedreht und mich an den Haaren nach hinten gerissen.«
»Hast du die Polizei geholt?«
Carol wurde rot. »Nein.«
»Aber wir hatten doch vereinbart, dass du bei der nächsten Gewaltanwendung unbedingt die Polizei holst. Er hat gegen die gerichtliche Anweisung verstoßen.«
Carol klammerte sich an ihren Sessel. »Jeff hat gesagt,
wenn ich noch einmal die Polizei einschalte, bringt er mich um.«
Ellen zwang sich innezuhalten, ehe sie antwortete. Carol tat ihr unendlich Leid, alle Carols dieser Welt, und je länger sie praktizierte, desto mehr begriff sie das ganze Ausmaß dieser Epidemie. Da draußen gab es eine ungeheure Anzahl von Männern, denen es Befriedigung verschaffte, ihre Liebsten emotional und physisch zu misshandeln – und ebenso viele Frauen, die sich nicht von ihnen trennen konnten oder es nicht wagten.
Eine Trennung war gefährlich, gefährlicher oft als das Bleiben. Dadurch verringerte sich die Liste der real existierenden Gefahren kein bisschen, im Gegenteil. Dann drohten sogar Dauerbeobachtung und Entführung. Justiz und Gesellschaft konnten nicht immer helfen. Eines war Ellen klar: Misshandelte Frauen trafen ihre Entscheidungen zu Gunsten des kleineren Übels. Angesichts des Risikos, dem ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder ausgesetzt waren, konnten sie sich nicht den Luxus leisten, zwischen richtigen und falschen Entscheidungen abzuwägen. Das Gebot der Stunde lautete: auf Nummer Sicher gehen. Und für manche misshandelten Frauen hieß diese Sicherheitsstrategie zwangsweise, dort zu bleiben, wo sie die Stimmungsschwankungen des gewalttätigen Mannes überwachen und verhindern konnten, dass er mit den Kindern allein war.
»Wie soll es jetzt weitergehen? Was wäre dir am liebsten?«, fragte sie Carol. »Was genau?«
Carol stöhnte. In ihren Augen standen Tränen. »Ich wünsche mir, dass wir wieder so sind wie früher. Ich wünsche mir, dass er ein liebevoller und respektvoller Mensch ist. Ellen, ich weiß, das ist lächerlich, aber wie könnte ich nach allem, was Suzanne mitgemacht hat, zum Schluss auch noch die Familie spalten?«
»Du bist diejenige, die die Familie spaltet.«
»Man wird es mir in die Schuhe schieben. Weißt du, was ich mir wirklich wünsche? Ich möchte so gerne – so gerne aufhören, mir wie ein Idiot vorzukommen.«
»Wieso bist du ein Idiot?«, fragte Ellen geduldig.
»Das wissen wir doch beide. Weil ich in so etwas hineingeraten bin und jetzt festsitze. Weil ich es weiter zulasse.«
»So fühlst du dich, aber…« Ihre Worte hörten sich schal an. »Carol, was werde ich jetzt wohl sagen?«
Carol hob die Augen. Auf dem tränenüberströmten Gesicht zeichnete sich trotz allem ein schmales Lächeln ab. »›Sein Handeln kannst du nicht kontrollieren, sondern nur das, was du dagegen tust.‹«
»Gut gelernt. Also?«
»Also – sollte ich vermutlich härter an dem arbeiten, was ich dagegen tue.«
Ellen setzte sich zurück, streckte ihre Beine unter dem Schreibtisch aus und massierte ihre völlig verkrampften Oberschenkel.
Carol, eine viel versprechende Immobilienmaklerin, und Jeff waren Ellens Nachbarn. Sie hatte Ellen auf das Haus aufmerksam gemacht, das jetzt ihr und Kevin gehörte.
Im Laufe der beiden letzten Jahre hatte Ellen genug mitbekommen. Nun fürchtete sie, Jeff wäre im Stande, Carol umzubringen. Er hatte sie geschlagen, getreten und mit Gläsern nach ihr geworfen. Außerdem konnte er gut mit Schusswaffen umgehen.
Aber diesmal hatte er seiner Frau tatsächlich zum ersten Mal mit Mord gedroht.
»Carol«, sagte Ellen, »du weißt, dass ich dir nie vorschreibe, was du tun sollst, aber jetzt muss ich das. Was ich da höre, macht mich extrem nervös. Du musst Suzanne nehmen und Jeff verlassen. Wir werden für euch ein totales Umgangs- und Kontaktverbot erwirken.«
»Hirn und Titten. Und Charme. Wetten, Dolly hat nie in ihrem Leben ’ne Therapie gebraucht«, sagte Olga Balin.
Ellen hatte Mühe, sich auf Olgas Wellenlänge einzustellen. Die letzte Sitzung ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie machte sich Sorgen und war nicht bei der Sache, denn Carol und Suzanne waren nicht sicher.
Ellen fragte Olga: »Würden Sie sich besser fühlen, wenn Sie herausfänden, ob das stimmt?«
Olga beugte sich vor. »Hat sie denn?«
Ellen lächelte verhalten. »Ich weiß es nicht.«
Stille. »Damit werden Sie mich nun zappeln lassen, oder?«, fragte Olga.
Ellen hatte drei berühmte Patienten. Eine davon war Olga. Allen war es unangenehm, sie in ihrer Praxis aufzusuchen, deshalb ging sie zu ihnen nach Hause.
Wenn Ellen manchmal an sich selbst zweifelte, überlegte sie, ob das der wahre Grund für ihre Beliebtheit sein könnte: nicht ihre Fähigkeiten als Therapeutin, sondern ihre Hausbesuche.
»Ich respektiere Dolly. Sie hat dem Rest von uns Türen geöffnet«, meinte Olga. »Wenn sie nur nicht so verdammt große Klasse wäre.«
Olga berührte ein Löwenmäulchen in einer Vase auf ihrem Schreibtisch. Ellen bestand bei Haussitzungen auf einer geschäftsmäßigen Umgebung. Bei Olga fanden sie immer in ihrem Büro statt, mit Blick auf einen wohl geordneten Hügelgarten. Zwischen Blumen, Notenblättern, Gitarren und anderem Zeug lag jede Menge Krimskrams aus der Countryszene herum. Typisch Olga, aufgemotzt und elegant zugleich. Nach Ellens Ansicht konnte sich Olga in jeder Hinsicht neben Dolly behaupten, aber wenn dies auch Olgas Sicht der Dinge gewesen wäre, hätte sie Ellen nicht gebraucht.
»Sie stellt ein unmögliches Ideal dar«, sagte Olga, »unerreichbar
für jeden.« Sie musterte Ellen, die wiederum sie musterte. »Okay, unerreichbar für mich.«
Ellen sagte: »Möchten Sie wirklich Ihr Geld für ein Gespräch über Dolly verschwenden? Wie waren diese Woche Ihre Quoten?«
Olgas Gesichtsausdruck wechselte. Ein Anflug von Melancholie zeichnete sich ab. Das passierte immer, sobald sie über ihre Phobie reden musste.
»Am Wochenende nicht schlecht. Sonntagabend hab ich ’ne gute Acht geschafft, da waren ein paar Leute bei mir. Wir haben uns zusammengesetzt und zum Schluss über Mariah Carey getratscht, und das hat mich abgelenkt. Dienstagabend war mies.« Olga holte tief Luft.
»Petals freier Abend.«
»Mhm. Beinahe hätte ich sie gebeten, sie soll nicht weggehen.«
»Aber Sie haben’s nicht getan?«
Olga schüttelte den Kopf.
Ellen streckte den Daumen nach oben, Olga lächelte unsicher. Wenn sie allein war, litt sie unter heftigen Angstattacken. Schuld daran war ihre Panikstörung. Als Ellen vor einem Jahr mit der Therapie angefangen hatte, konnte Olga nur dann schlafen, wenn ihre Haushälterin bei ihr im Zimmer schlief. Ohne Gesellschaft konnte sie weder essen noch fernsehen.
»Und wie schlecht waren Ihre Quoten?«
»Kaum hatte Petal die Tür zugemacht, dachte ich, ich müsste sterben. Ich bin wieder rausgegangen, weil nebenan ein Gärtner gearbeitet hat. Bis er ging, bin ich draußen geblieben.«
»Und dann? Sind Sie essen gegangen?«
»Ja, aber ich wollte nicht wieder heim. Ich hatte schon mein Handy eingeschaltet und wollte ein Hotelzimmer bestellen, aber dann hab ich mir’s anders überlegt und bin nach Hause.«
»Super, Olga!«
Nach der Sitzung begleitete Olga Ellen zur Haustür.
»Bis nächsten Donnerstag«, sagte Ellen.
»Ach, ehe ich’s vergesse, könnten wir uns eine Stunde früher treffen? Um drei viertel zehn? Ich muss zu einer Aufnahme nach New York.«
Ellen zog ihren Zeitplaner heraus. »Nein, tut mir Leid, da bin ich besetzt. Wie wär’s am selben Tag, aber später? Halb sechs?«
»In Ordnung.«
Als Ellen auf dem Rückweg in die Stadt den Sea Vista Hill hinunterfuhr, bot sich ihr der schönste Blick von ganz Eastport: Möwen sausten im Sturzflug über die Wellenkämme, die sich schäumend an den Felsklippen brachen.
Liam liebte Tiere, genau wie sie, ob mit Flügeln oder ohne. Für sein Aquarium im Kinderzimmer hatte sie ihm ein paar Seepferdchen versprochen. Die Zoohandlung in der Stadt hatte sicher welche, und danach würde sie Maiskolben fürs Abendessen einkaufen. Aber vorher musste sie erst noch mal in die Praxis, um ihre Notizen über Carols und Olgas Sitzungen auf Band zu sprechen.
Es hätte Spaß gemacht, wenn Liam die Seepferdchen selbst hätte aussuchen können, aber seine Tagesschule endete erst um fünf. Außerdem sah man es dort nicht gern, wenn die Kinder Teile des Programms verpassten.
Für Ellen spielte es keine Rolle, wenn Liam nicht das begabteste hörbehinderte Kleinkind von ganz Fairfield County wäre, ganz im Gegensatz zu Kevin, das spürte sie. Und vermutlich war es eines Tages auch für Liam wichtig.
Kevins Lieblingspatientin war Adeline Zoff, eine pensionierte Endsechzigerin, Architektin und aufgeweckt wie ein Eichhörnchen.
Sie war schon lange Witwe und genoss ihre Unabhängigkeit. Vor zwei Dingen hatte sie panische Angst: als hilflose alte Dame zu gelten und den grünen Star zu bekommen, wie ihre verstorbene Schwester Betsy.
Kevin saß mit ihr im Untersuchungszimmer. Schon an ihrem lieben entsetzten Gesicht konnte er ablesen, dass für sie bereits alles feststand. Sie hatte grünen Star. Ihre Sicht wurde immer verschwommener und nächtliches Autofahren allmählich unmöglich.
Trotzdem handelte es sich nicht um ein Glaukom, sondern um eine Maculadystrophie. Und das war noch schlimmer, denn er konnte absolut nichts für sie tun.
Kevin saß. Stehen wirkte bedrohlich. Und da die Patienten beim Arzt ohnehin schon genug eingeschüchtert waren, zog er es vor, den Kontrast nicht auch noch physisch zu betonen. Er musste Adeline die Diagnose mitteilen. Dazu musste er ihre Hand halten und es ihr mit leiser Stimme sagen.
Am liebsten hätte er seine Krankenschwester Laurie hereingebeten. Das machten nicht nur Frauenärzte, die keine Prozesse wegen sexueller Belästigung am Hals haben wollten. Wenn man bei Patienten heftige emotionale Reaktionen erwarten musste, war es vernünftig, Verstärkung zu holen.
Aber bei Adeline konnte er sich nicht drücken, das musste er selbst durchstehen, ganz allein.
Ellens Praxis in Eastport bestand aus zwei Räumen im Dachgeschoss eines gemütlichen Holzhauses, das hinter dem Bürgerhaus in einer Straße mit vielen Gärten lag. Als sie ihr Diktiergerät herauszog, hörte sie auf der Außentreppe, die nur zu ihrer Praxis führte, plötzlich Schritte. Dann klopfte es laut.
Sie schaute durch den Spion. Draußen stand Jeff Maxx. Die Linse verzerrte seine großen dunklen Augen mit den dichten Wimpern.
Ellens Magen krampfte sich zusammen.
»Ja?«, sagte sie.
»Ich bin’s, Jeff. Jeff Maxx. Ich möchte mit Ihnen reden.«
»Ich kann jetzt nicht.«
»Ellen, machen Sie die Tür auf.«
»Nein, Sie können nicht einfach hier auftauchen und erwarten, dass ich Sie hereinlasse«, sagte Ellen.
Zu ihrem Entsetzen drehte sich der Türknopf. Ihr dämmerte, dass sie vergessen hatte abzuschließen. Eigentlich hatte sie nur ein paar Minuten bleiben wollen. Hastig versuchte sie, das Versäumte nachzuholen, aber die Tür war schon offen.
Jeff Maxx stand im verwaschenen blauen Trainingsanzug und einer Red-Sox-Kappe in ihrer Praxis. Seine tiefschwarzen Haare wurden langsam schütter. Seine Arme waren dicht behaart und auch aus dem Pulliausschnitt quoll es hervor.
»Was für einen Bockmist erzählen Sie da meiner Frau?«, wollte er wissen. »Sie soll Suzanne packen und abhauen?«
Ellen sagte: »Sie befinden sich gegen meinen Willen in meiner Praxis. Sie müssen gehen.«
Er streckte ihr die Hände entgegen. Auf seinen Fingern sprossen Haarbüschel. »Ich habe Ihnen eine Frage gestellt.«
»Wenn Sie mit mir reden möchten, können Sie telefonieren oder einen Termin vereinbaren. Sie haben sich soeben mit Gewalt Zutritt verschafft. Wenn Sie nicht gehen, rufe ich die Polizei.«
»Scheiße.«
»Gehen Sie jetzt, bitte.«
Er starrte sie an. Seine schwarzen Augen wirkten stumpf. »Und wenn ich tatsächlich einen Termin ausmache? Was passiert dann? Werden Sie mit mir reden?«
»Nur so lange, bis ich Ihnen mitgeteilt habe, dass Carol meine Patientin ist und ich mich ohne ihre Zustimmung nicht mit Ihnen unterhalten kann.«
Noch immer sah er sie unverwandt an. Seine Augen zogen ihr die Haut wie Säure ab. Sie war sicher, dass er ihre Angst sehen konnte. Ihr Herz pochte wie ein Spielautomat. Ob er eine Pistole dabeihatte?
Unter ihrer Schreibtischplatte befand sich ein Alarmknopf auf der obersten rechten Schublade, der direkt mit der Polizeistation in Eastport verbunden war. Aber um ihn zu erreichen, musste sie erst einmal zu ihrem Schreibtisch gehen. Leider wagte sie keine plötzliche Bewegung.
Jeff sagte: »Wie wär’s mit meiner Version der Geschichte? Das Zeug, das Ihnen Carol nicht erzählt? Ihr ganzer Mist –«
»Jeff, ich kann verstehen, dass Sie eigene Probleme haben, aber ich bin Carols Therapeutin und kann nicht ohne ihr Wissen mit Ihnen reden.« Sie beobachtete sein Gesicht. Der Rückzug ins Psychologenkauderwelsch schien ihn etwas zu besänftigen. »Klingt, als hätten Sie selbst Probleme.«
»Ich? Ich habe kein Problem. Und auf eines kann ich garantiert verzichten: dass Sie mir welche machen.«
Er kam einen Schritt näher. Sie wich zurück. Wenn es so weiterging, käme sie doch noch an den Alarmknopf.
Sie sagte: »Jeff, ich muss darauf bestehen, dass Sie gehen.« Wieder ein Schritt, wieder einer für sie.
Sein Mund war verzerrt, er hatte die Hände geballt. Er wollte gerade sprechen, da klingelte das Telefon. Durch das Geräusch verlor er anscheinend den Faden. Beim dritten Klingeln war er schon zur Tür hinaus. Seine Arbeitsstiefel polterten die Stufen hinunter. Sie ließ den Anrufbeantworter laufen, ging zum Fenster, atmete erleichtert tief aus und schaute zu, wie er in seinen roten Landrover kletterte und davonschoss.
Nachdem Adeline fort war, wäre Kevin am liebsten spazieren gegangen, um ein wenig Sonne zu tanken.
»Sie sind fast eine Stunde im Verzug«, flüsterte Laurie.
»Ich weiß, aber ich bin wie erschlagen. In zehn Minuten bin ich wieder da.«
Er lief den Weg am Saugatuck entlang. Bewusst setzte er jeden Fuß auf den Asphalt. Nicht lange. Bald ging er in die Praxis zurück und notierte sich Adelines Nummer aus dem Rolodex.
Kevins Mutter, Barbara Stewart, lebte noch, aber vor vier Monaten war ihre Zwillingsschwester, Kevins Tante Georgia, an Lymphknotenkrebs gestorben. Barbaras Umgang mit dem Tod erinnerte Kevin an das Verhalten eines Blauhähers, den er einmal beobachtet hatte, als ein Falke seinen Partner schlug. Sie putzte weiter ihre Schuhe und ging einkaufen, als ob nichts geschehen wäre.
Nur Kevin hatte als Einziger durch Georgias Augen in den schwarzen Tunnel gesehen, der sie erwartete. Er hatte verfolgt, wie sich das Leugnen in Entsetzen und schließlich in eiskaltes Wissen verwandelte, aber nie in Akzeptanz. Angeblich erreichen Sterbende einen heiligen mentalen Zustand des Bereitseins, aber Kevin wusste, dass diese Mythen Blödsinn waren, den sich Ärzte vorsagten, um das Ganze erträglich zu machen.
Er würde sein Bestes tun, um für Adeline den Schrecken abzufedern oder sie wenigstens nicht damit allein zu lassen.
Als Ellen heimkam, war der Landrover nirgends zu sehen. Sie hatte überlegt, ob sie Kevin den Vorfall mit Jeff erzählen sollte, und sich schließlich dagegen entschieden. Letztlich betraf dieses Gedankenspiel doch nur sie als Ehefrau. So etwas wäre weder fair gegenüber ihrer Patientin noch gegenüber Kevin.
Sie war schon früher auf feindselige erboste Ehemänner und Partner gestoßen. Mehrmals hatte man ihr gedroht. Das gehörte zu ihrem Beruf. Meistens handelte es sich um Maulhelden und klassische Rüpel, viel Wind und nichts dahinter.
Wenn Carol mit Suzanne fortging, wäre ihr sehr viel wohler
zu Mute, aber das konnte sie nicht erzwingen. Die Entscheidung lag bei Carol.
Inzwischen musste sie sich vor Überreaktionen hüten, nur weil gerade dieser Rüpel ihr Nachbar war.
Solange er sich auf verbale Attacken beschränkte.
Liam besaß einen kleinen Liegestuhl, eine Miniaturausgabe von Ellens und Kevins Liegestühlen, den er am liebsten so nahe wie möglich ans Wasser setzte.
Dieses Tauziehen gab es jeden Abend nach der Arbeit. Dann trugen alle drei Stewarts ihre Stühle auf den Teil des Strandes, den sie mit fünf anderen Familien teilten. Auf dieses vorabendliche Intermezzo freute sich Ellen schon den ganzen Tag, einschließlich des Geplänkels und allem.
»Iii!«, sagte Liam bestimmt und ließ seinen Stuhl fünf Zentimeter vor der Gezeitengrenze fallen.
Ellen nickte, und Liam schaute so skeptisch, wie es nur Zweijährige können. Sie konnte seine Gedanken lesen: Hätte er doch nur um ein Stückchen näher dran gebettelt. Aber das Wasser war die Grenze, egal ob Flut oder Ebbe, und heute herrschte eben Ebbe. Doch das begriff er nicht, nicht einmal, wenn er hören könnte. Trotzdem beschlich sie ein schlechtes Gewissen, denn Widersprüche stellten nach Meinung sämtlicher Pädagogikratgeber die schlimmste Sünde dar.
Kevin, der ihre Gedanken las, sagte: »Dagegen bist du machtlos.«
Ellen lachte.
Kevin reichte ihr ein Glas Wein. Liam zog geschäftig seine Sandalen aus. Glucksend ließ er die kleinen Wellen über seine Füße spülen, ohne seine Eltern anzuschauen. Er verstand es schon jetzt meisterhaft, jede disziplinarische Maßnahme zu vermeiden.
Er hatte Ellens kupferroten üppig-glatten Haarschopf geerbt
und von seinem Vater einen langen Rumpf und lange Beine. Beides zeichnete sich trotz seines Alters schon deutlich ab. Mit seinem strahlenden Lächeln konnte er sogar die Betreuer in der Vorschule becircen, die so stolz auf ihr Gleichheitsprinzip waren. Er wusste nicht, dass er behindert war. Er war kräftig und selbstbewusst und verfügte über eine unbändige Neugier, von der sich Ellen viel für seine Zukunft erhoffte.
»Wie war dein Tag?«, wollte Kevin von ihr wissen, während er es sich in seinem Stuhl bequem machte.
»Ziemlich gut. Ich habe zwei neue Patienten, die gemeinsam kommen, Vater und Tochter. Er ist Polizist in Greenwich. Das Mädchen ist fünfzehn. Er versorgt sie und ihre jüngere Schwester. Gefühlsmäßig ist bei ihm alles in Ordung, er ist nur viel zu dominant. Korrigiert alles, was sie sagt und tut. Er muss lernen loszulassen. Sie spielt das Fräulein Tunichtgut, weil das die einzige Rolle ist, die ihr bleibt.«
»Wird er sich darauf einlassen?«
»Zuerst war ich skeptisch. Hat mich um meine Meinung gefragt, hat allem zugestimmt und ist dann abgehauen. Heute waren sie vor Gericht, weil er sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses belangen lässt. Aber dann hat er eine halbe Stunde später angerufen und gefragt: ›Glauben Sie wirklich, dass ich zu hart bin?‹«
»Gut für ihn.«
»Tja.«
Kevin war still, sein Blick ging ins Leere. »Ich hatte heute einen harten Tag«, sagte er. »Adeline Zoff. Ihr geht’s ziemlich schlecht.«
»Der prächtigen alten Dame? Was ist schief gelaufen?«
»Maculadystrophie.«
Ellen setzte ihr Glas ab. »O Gott.«
Kevin hatte die Hände verkrampft. »Ich hätte mich so gern geirrt. Es hat mich umgebracht, als ich’s ihr erzählen musste.
Und du weißt ja, wie tapfer sie ist. Heute allerdings nicht. Sie hat geweint und geweint. Ich habe versucht, sie zu überreden, noch eine Weile sitzen zu bleiben, aber sie wollte unbedingt gehen.«
»Wie lange noch, bis sie gar nichts mehr sehen kann?«
»Sechs bis acht Monate, aber der Zustand wird sich rapide verschlechtern. Jede Woche wird es schlimmer. Sie kann unmöglich länger allein leben.«
»Ach, arme Adeline.«
»Ich weiß nicht, was ich ihr raten soll. Ich lasse Laurie nach betreuten Wohnmöglichkeiten suchen.«
»So etwas kostet ungefähr dreitausend im Monat.«
»Dann kommt es nicht in Frage.«
Nach einigen Minuten meinte Ellen: »Ich kenne die Geschäftsführerin vom Easton Inn. Das ist ein hübsches Heim mit aufgeweckten selbstständigen Senioren, genau wie Adeline.«
»Teuer?«
»Ja, außerdem werden dort keine Blinden aufgenommen. Aber vielleicht macht Vela für eine charmante Person wie Adeline eine Ausnahme. Und obendrein gibt es Zuschüsse, wenn man weiß, wie man drankommt. Weißt du was? Ich werde Vela gleich mal anrufen.«
»Ich habe sie daheim erwischt«, sagte Ellen, als sie einige Minuten später wieder zum Strand kam. »Sie ist mit einem Treffen einverstanden.«
»Phantastisch.« Zum ersten Mal an diesem Abend grinste Kevin. »Das macht mir Hoffnung. Danke für den Anruf. Woher kennst du sie eigentlich?«
Ellen zuckte mit der Schulter. »Das amerikanische Frauennetz.«
Sie schauten zu, wie Liam an der Wasserkante herumhüpfte.
Die heimischen Möwen waren arrogant und wichen dem sich nähernden Kind, das sie als einen der ihren betrachteten, nur Zentimeter aus.
Kevin sagte: »Die Vögel denken, er sei einer von ihnen.«
»Er ist zu klein, um bedrohlich zu wirken. Und außerdem ist er …« Sie hielt inne. Eigentlich hatte sie nicht verbal sagen wollen, aber Kevin hasste es, wenn über Liam im Fachjargon gesprochen wurde. Außerdem wäre es auch nicht korrekt, denn erstaunlicherweise konnte Liam viele Wörter aus allen Bereichen begreifen, obwohl er die Laute nicht so wiedergab wie sie. Letzteres hatte sich, entgegen Ellens Erwartungen, als wesentlich geringere Barriere entpuppt. Kommunikation war möglich, nur auf andere Art und Weise.
»Was ist er?«, fragte Kevin.
»Respektvoll.«
»Das haben Kinder mit Jungtieren gemein, nicht wahr? Beide sind kleiner als alle, die den Ton angeben. Also müssen sie sich auf ihre Weise schützen.«
»Und sich auch so äußern.«
Kevin runzelte leicht die Stirn, um seine Mundwinkel zuckte es.
Fein, dachte Ellen, jetzt bist du trotzdem mitten hineingetappt. Hat eben nur etwas länger gedauert.
»Bu-fei!«, rief Liam mit rauer Kehlkopfstimme von seinem kleinen Stuhl herüber, drehte sich um und tippte sich an die Nase.
»Ja«, sagte Ellen, »ich kann das Brutzelfleisch auch riechen.«
»Uh?«, fragte Liam.
»Für uns, stimmt.«
Er strahlte übers ganze Gesicht. »Bu-fei! Bu-fei!«
Kevin lachte, nahm Ellens Hand und küsste sie.
Sie sagte: »Ich habe das Fleisch in die Thai-Marinade eingelegt, die du gekauft hast.«
»Nur in die Marinade?«
»Größtenteils.«
»Also, ja oder nein? Du hast noch Gewürze dazugegeben, stimmt’s?«
Sie lachte. »Ja.«
Wieder küsste er ihr die Hand. »Liam wird an seinem vierten Geburtstag keine Speiseröhre mehr haben.«
»Und wer behauptet, dass er eine braucht?«
»Eins zu null für dich.«
Mit einem verstohlenen Blick vergewisserte sich Liam, dass sie nicht zu ihm hinüberschauten, ehe er seinen Stuhl näher ans Wasser schleppte, und dann noch ein Stückchen. Eine kleine Welle strudelte ihm sanft um die Füße. Als er strampelte, beförderte er eine Muschel aus dem Sand. Er hob sie auf und hielt sie sich prüfend vors Gesicht. Zwei Möwen beobachteten ihn hungrig.
Als Liam die Muschel in den Mund stecken wollte, sprang Kevin auf. »Schatz, das ist nichts zum Essen.« Mit einem Arm hob er Liam hoch und entwand ihm sachte die Muschel.
Ellen putzte Liam den Sand von Mund und Händen. Ein bisschen war auf die Zunge gekommen. Er verzog das Gesicht und versuchte, ihn auszuspucken.
»Pfui bä, was?«, meinte Ellen, während sie ihm mit dem kleinen Finger die Zunge abrieb. »Den Vögeln ist’s egal, im Gegensatz zu uns. Aber vielleicht mögen sie auch keinen Sand im Mund, vielleicht holen ihn Mama und Papa Möwe heraus.«
Liam spuckte ein letztes Mal aus, dann verzog er wieder das Gesicht. Kevin drückte ihn an sich. »Ist ja gut, Murkel, dein Schnabel ist sauber.«
»Ich werde jetzt mal das Steak auf den Grill legen«, meinte Ellen zu Kevin.
»Das mache ich.« Er setzte Liam ab. »Möchtest du noch einen Schluck Wein?«
»Klar. Bring die Flasche mit heraus, und dreh bitte die Flamme unter dem Maistopf höher.«
Sie schaute Kevin nach, wie er den Strand hinauftrabte und über die kleine Privatstraße zu ihrem Haus lief. Es handelte sich um einen für Neuengland typischen Küstenbau aus grauen Holzschindeln mit strahlend weißen Zierleisten, der von außen täuschend traditionell wirkte. Sie hatten es vor zwei Jahren gekauft. Carol Maxx war damals ganz neu als Patientin bei Ellen gewesen und hatte ihr den Tipp gegeben, dass gleich nebenan ein erstklassiges Objekt auf den Markt käme.
Wie fast alles in Eastport ging so etwas immer schnell weg. Als charmante Küstenstadt mit vielen berühmten Einwohnern, von der man zum Arbeiten nach New York fahren konnte, war sie für viele attraktiv, für Rockstars und auch für gut verdienende erfolgreiche Spezialisten wie Ellen und Kevin.
Umgehend hatten sie sich das Haus für den geforderten Preis von 995.000 Dollar gesichert, ein echtes Schnäppchen für einen soliden Bau mit vier Schlafzimmern und Blick auf den Sund. Von den sechs Anwesen der kleinen Siedlung, die unter dem Namen Sandpiper Beach bekannt war, hatten nur die Häuser der Familien Maxx und Stewart einen direkten Meerblick. Mit Ausnahme der Anwohner benützte niemand die kleine Ringstraße, die von der Hansen Road abging und dort wieder einmündete.
Eine weitere halbe Million hatten Ellen und Kevin in die Renovierung gesteckt. Nun besaß das Gebäude eine atemberaubende Innenarchitektur mit elektronisch gesteuerten Duschen und Whirlpools und einer hohen Küche mit Glasdach. Auf den Arbeitsflächen waren Fliesen verlegt, die sie während eines Tauchurlaubs in Mexiko gesammelt hatten. In Liams Spielzimmer hatten sie aus pädagogischen Gründen ein kindersicheres Aquarium mit lebenden Skalaren, Guppys und einem winzigen Tintenfisch namens Pedro eingebaut.
Ellen trank ihr Weinglas aus und schaute Liam zu, der seinerseits eine Kanadagans beobachtete. Sie war herbeigewatschelt, nachdem die Möwen aufgeflogen waren, um nach gewagten Tauchmanövern das Pflaster mit Meeresschätzen zu bombardieren. Die Gans stieß einen Schrei aus. Liam versuchte zu antworten, aber vermutlich dachte er nur, er hätte es getan, denn es war kein Laut zu hören. Obwohl er bereits an einem Lernprogramm für hörbehinderte Babys und Kleinkinder teilnahm und nach Ansicht seiner Lehrer ein echtes Ass war, frustrierte es ihn, Laute zu bilden, wenn er nicht wissen konnte, wie sie sich anhörten.
Eine von Liams Lehrerinnen war Patientin bei Ellen, eine große feingliedrige gutmütige Frau. Ganz nervös war Martie Vasco auf Ellen zugegangen, nachdem ein Artikel in den Eastport News Ellen als Psychotherapeutin schilderte, die sich auf Gewalt in der Familie spezialisiert hatte.
»Hoffentlich macht es nichts aus, dass ich Liams Lehrerin bin«, hatte Martie gesagt, »aber ich brauche wirklich dringend Hilfe.«
Ellen hatte es nicht übers Herz gebracht, sie abzuweisen. Sie hatte blaue Flecken auf dem Bauch und am Kopf, versteckte Stellen, die erfahrene Frauenhasser bevorzugten. Sie sprach so leise, dass es nur kleine Kinder hören konnten.
Obwohl Martie inzwischen schon drei Monate bei Ellen in Behandlung war, kamen sie nicht weiter. Martie lebte von ihrem Mann getrennt, war aber enttäuscht, dass Raymond sie in Ruhe gelassen hatte, und wäre am liebsten wieder zurückgegangen. Vergeblich hatte Ellen nach einem Weg gesucht, diese Bindung zu unterbrechen.
Da kam ihr eine Idee: Was wäre, wenn sie Martie ein kleines Stückchen Leben ohne Raymond zeigen würde? Oder noch besser, wenn sie Martie helfen würde, es selbst zu tun? Was wäre, wenn sie dafür ein Rezept ausstellen würde?
Jawohl, dachte Ellen. Nur ein Taschenspielertrick, aber solche Tricks haben schon funktioniert. Sie würde auf ihrem Rezeptblock eine Dosis … eine Dosis … einen Besuch im Beardsley Zoo verschreiben. Nein, nichts so nahe Liegendes. Einen Wochenendtrip, den Martie ganz allein bewältigen musste. Etwas mit Natur und viel frischer Luft.
Provincetown. Die Bootsfahrt, um Wale zu beobachten.
2
Ellen saß auf Liams Bett in der Kinderintensivstation des St.-Markus-Krankenhauses in Stamford und massierte unentwegt ihre Hände mit einer Lotion aus einem Fläschchen, das sie immer in ihrer Handtasche trug. Offensichtlich konnte sie nicht damit aufhören. Sie hatte versucht, Liams gesunden Arm damit einzucremen, aber die Krankenschwester hatte ihr erneut klargemacht, es sei am besten, ihn ganz ruhig liegen zu lassen.
Kevin kam wieder herein. Er war draußen im Gang gewesen und hatte mit zwei Kriminalbeamten aus Eastport gesprochen. Er schaute zu seinem Sohn hinunter und sackte in die Knie.
Leise atmete das Kind stoßweise durch die verletzten Lippen, die teilweise dreimal so stark geschwollen waren wie normal. Im Mundwinkel hatte sich eine Blutkruste gebildet. Auf der ganzen rechten Seite zogen sich tiefe Schürfwunden über Stirn, Wange, Schulter, Arme und Bein. Zwischen dem Verbandsmull glänzte eine dicke Salbenschicht, während an anderen Stellen eine wässrigrote Flüssigkeit heraussuppte.
Kevin hatte einen Kinderneurologen hinzugezogen, aber das Einzige, was er ihm und Ellen nach Liams Untersuchung erzählen konnte, wussten sie bereits: Liams starre Pupillen und sein apathischer Zustand waren auf einen erhöhten Gehirndruck zurückzuführen, der erst behandelt werden konnte, nachdem sich sein Zustand stabilisiert hatte. Und das war höchst ungewiss.
Kevin tastete nach Ellens Hand. Ihre Finger verkrallten sich ineinander.
»Die Kriminalbeamten möchten dich sprechen«, sagte Kevin.
Sie schüttelte den Kopf.
»Mach schon, geh raus, trink einen Kaffee. Du brauchst ihn.«
Sie ließ Kevins Hand fallen und kämpfte gegen den Zwang an, in ihrer Tasche nach der Cremeflasche zu suchen. »Haben sie Pallas verhaftet?«
»Nein«, sagte Kevin, ohne sie anzusehen.
»Können sie ihn nicht finden?«
»Sie haben ihn gefunden. Er behauptet, er sei’s nicht gewesen.«
»Was?«, fragte Ellen laut. Die Krankenschwester, die sie daran gehindert hatte, Liam zu massieren, machte eine beschwichtigende Geste.
»Er sei nicht in der Nähe von Sandpiper gewesen, behauptet er.«
»Er lügt! Ich kenne Peter Pallas! Ich weiß, dass er es war!«
Kevin nickte. »Dann geh raus und erzähl’s den Beamten.«
»Ich will aber nicht weg.«
»Du musst.« Er drehte sich um und schaute sie mit einem Blick voller Zuneigung und Mitleid an. Sein Kummer war so tief, dass seine Augen darin versanken. »Du musst.«
Die Beamten Jason Landrin und Maggie Dolce standen draußen im Flur vor der Intensivstation. Ellen kannte beide, besonders Landrin. Er hatte Fälle bearbeitet, an denen zwei ihrer Patienten beteiligt gewesen waren.
Kaum hatte Jason sie gesehen, kam er auf sie zu und umarmte sie herzlich.
Ellen hatte keinen Funken Energie mehr, nur Jasons kräftige Arme hielten sie noch aufrecht. Er spürte ihre Erschöpfung und half ihr auf einen Stuhl.
»Es tut uns Leid«, sagte Maggie. »Ich möchte nicht behaupten, ich wüsste, wie Sie sich fühlen, denn ich weiß es nicht. Es muss schrecklich sein.«
»Ist es«, sagte Ellen, »es ist schrecklich.« Ihre Hände flatterten. »Was ist mit Peter Pallas? Warum hat man ihn nicht verhaftet?«
»Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Sie wissen doch, dass wir miteinander reden müssen«, sagte Jason leise. »Wir können die Sache nicht aufschieben, das wissen Sie.«
Ellen nickte. Sie holte so tief wie möglich Luft, atmete langsam wieder aus und massierte ihren schmerzenden Nacken. Es stach wie mit Nadeln. Durch das stundenlange starre Sitzen auf Liams Bett hatte sich alles verkrampft.
»Möchten Sie ein Wasser? Oder Kaffee?«, fragte Jason.
»Kaffee. Danke.«
»Milch und Zucker?«
»Nur Milch.«
Während Jason am Automaten vor dem Flur Kaffee holte, zog Maggie einen Stuhl heran, setzte sich neben Ellen und zog aus einer Tasche ihres schwarz-braun gestreiften Rocks ein Notizbuch mit Kugelschreiber.
»Entschuldigung, dass Sie alles noch einmal wiederholen müssen«, sagte Maggie.
»Das einzige Problem ist, dass ich mich nur ungern von Liam trenne. Außerdem habe ich doch schon alles Wissenswerte ausgesagt. Egal, was Pallas behauptet, er war es.«
»Ich verstehe.«
Jason kam mit einem Pappbecher voll Kaffee zurück. Er war groß, breitschultrig und hatte den muskulösen Hals eines Sportlers. Seine kurzen dunklen Haare lichteten sich am Oberkopf. Der Becher hatte keinen Deckel.
»Ich verschütte keinen Kaffee, schließlich bin ich Polizist«, sagte er, während er ihn Ellen reichte. Er schleppte noch einen Stuhl herüber und meinte dann: »Wie wär’s, wenn Sie uns einfach nur erzählen, was passiert ist? Fangen Sie irgendwo an, wo Sie wollen, und tun Sie so, als wüssten wir noch gar nichts.«
»Aber das stimmt doch nicht. Ich habe es den Polizisten erzählt, die gekommen sind. Jedem haben wir’s erzählt. Officer Pallas hat mein Kind überfahren.«
Unbewusst trank Ellen einen großen Schluck Kaffee und verbrannte sich den Mund. Dabei fiel ihr wieder ein, wie sie heute Abend mit Kevin über Liams Speiseröhre gewitzelt hatte. Hundert Jahre war das her. Damals, als ihr aller Leben noch nicht am seidenen Faden hing.
Tränen liefen ihr übers Gesicht auf das längst durchweichte Sweatshirt mit den angetrockneten Blutflecken. Liams Blut. Nur an den Stellen, auf die Ellens Tränen gefallen waren, schimmerte es nass.
Jason sagte: »Damit zäumen wir das Pferd von hinten auf. Sie müssen uns über alles aufklären, was vorher passiert ist.«
Ellen musterte zuerst Jason, dann Maggie. Schon wieder fühlten sich ihre pochenden Hände trocken an. Sie wollten nur eines: ihren Sohn berühren, seine beruhigende Wärme spüren. Sie musste die Geräusche hören, die er von sich gab, und sehnte sich mit jeder Faser danach, wieder auf der Intensivstation zu sein.
Jason beugte sich zu ihr. »Bitte, Ellen, wir wollen dasselbe wie Sie.«
Ellen klammerte sich an die mit Kunstleder bezogenen Stuhlarme. »Wir haben am Strand gesessen, Liam, Kevin und ich. Bei schönem Wetter machen wir das jeden Abend und manchmal sogar, wenn’s nicht so schön ist. Liam liebt den Regen. Er hat einen kleinen Schirm mit Figuren aus dem König der Löwen –«
Noch mehr Tränen. Maggie zog ein Päckchen Tempo aus der anderen Rocktasche und gab es Ellen.
Ellen nahm ein Taschentuch heraus, aber nur, um sich daran festzuhalten, während Worte und Tränen nur so aus ihr herausströmten.
»Liam war … Da war eine Gans, sie hat geschnattert, und Liam versuchte … zu antworten … aber …« Sie massierte sich den Nacken. »Strandvögel ziehen ihn magisch an. Sie …«
Ellen hielt inne. Ihr Blick wanderte nach unten, als hätte sie den Faden verloren.
Jason sagte: »Sie sind mit Liam am Strand. Wo ist Kevin?«
Sie schaute auf. Es dauerte lange, bis sie sich wieder konzentrieren konnte. »Im – im Haus. Er wollte das Steak auf den Grill legen.«
Jason nickte. »Fahren Sie fort.«
»Ich habe … über eine Patientin nachgedacht, die heute bei mir war. Ich hatte nicht gemerkt, dass Liam hinter der Gans her rannte. Und als ich’s dann doch gesehen habe, bin ich aufgesprungen und –« Sie holte tief Luft. Da lag dieser Klumpen in ihrer Brust, die unerträgliche Erinnerung an das, was dann geschah bzw. nicht geschah: das Auto und ihr Kind und sie selbst nicht nahe genug und Kevin immer noch im Haus.
»Ich habe ihn angeschrien, aber er konnte nicht hören, kann nicht hören, und ich lief und betete, dass Kevin da wäre, aber … Lieber Gott … Und dann war da das Auto, der Streifenwagen aus Eastport mit Peter Pallas am Steuer, und ich – ich konnte Liam nicht mehr sehen.«
Zwischen Schluchzen und Husten quollen die Wörter nur so aus ihr heraus. »Peter ist abgehauen, mit Vollgas. Liam war ganz voll Blut und – und voller Split und Sand, und ich habe ihn aufgehoben, obwohl ich wusste, dass ich’s nicht tun sollte, aber ich musste es einfach tun. Dann habe ich ihn wieder hingelegt, weil er so still war, und da muss man flach liegen. Und ich lag leicht über ihm, damit ich seinen Atem und seinen Puls spüren konnte, und habe geschrien und geschrien, nach Kevin …«
»Und dann?«, wollte Maggie wissen.
»Kam er herausgerannt und lief auf die Straße. Und dann
haben wir vermutlich beide geweint und versucht, Liams Zustand einzuschätzen, aber das ging nicht. Kevin ist wieder reingerannt und hat 911 gewählt. Die Polizei war sofort da und eine Minute später der Krankenwagen. Das Notfallteam hat Liam bestens versorgt, ganz korrekt und liebevoll. Sie waren auch außer sich, das arme Kind …«
Ellen schnäuzte sich und putzte ihre Wangen ab.
»War sonst noch jemand in der Nähe? Nachbarn?«, wollte Jason wissen.
»Als der Krankenwagen kam.«
»Vorher nicht? Hat man Sie denn nicht schreien gehört?«
Ellen schüttelte den Kopf. Das tat wirklich weh. Im Schmerz lag etwas Tröstliches. Liam sollte nicht allein leiden.
»Dort ist niemand in Hörweite. In der Siedlung stehen sechs Häuser, aber alle auf mindestens viertausend Quadratmeter großen Grundstücken mit vielen Bäumen. Direkt zum Meer hinaus geht nur unser Haus und das der Familie Maxx, aber die waren nicht zu Hause.«
»Und doch sind Sie ziemlich sicher«, sagte Jason, »dass Sie Officer Pallas gesehen haben.«
»Ganz sicher.«
In die dann folgende Stille hinein sagte Ellen: »Es muss ihn doch noch jemand gesehen haben.«
»Wir konnten bisher niemanden finden.«
»Den Streifenwagen –«
»Hat keiner gesehen.« Jason beugte sich zu ihr und legte eine Hand auf ihren Stuhl. »Die Familien an der Hansen Road wurden genauso befragt wie die Anwohner von Sandpiper. Bis jetzt ohne Erfolg. Wir haben mit Pallas gesprochen, er behauptet, er hätte keine Ahnung. Am Auto sind keine Spuren zu sehen.«
Ellen starrte Jason an. Langsam stieg Eiseskälte aus ihrem Bauch hoch. Das alles musste ein Albtraum sein. Jasons letzte Bemerkung war einfach nur so dahergeredet. Solche realistischen
Träume gab es manchmal, besonders nach zu viel Wein. Dann bildet man sich schreckliche Dinge ein und denkt beim Aufwachen, sie wären wirklich passiert, bis man das Ganze allmählich abschüttelt. Jede Sekunde würde sie aufwachen.
Maggie nahm Ellens Hand. »Ich muss Sie fragen: Sind Sie wirklich sicher, dass Sie Pallas gesehen haben? Ganz ehrlich?«
»Ja.«
Maggie schaute Ellen in die Augen. Trotz aller Intelligenz und Anteilnahme, die Ellen spürte, klang die Sprache fremd. Die Wörter stimmten nicht.
Ellen sagte: »Pallas kann doch nicht einfach… ein Kind überfahren und sagen, er hätte es nicht getan … und man glaubt ihm. Und er kommt frei. Das ist unmöglich, das kann es nicht geben.«
Maggie fragte: »Was hat Kevin noch im Haus gemacht, außer das Steak auf den Grill gelegt?«
»Nichts.«
»Wirklich?«
»Nun, ich weiß es nicht. Zur Toilette gegangen? Telefoniert? Woher soll ich das wissen?«
»Kevin sagt, er hätte Wein nachgeschenkt.«
»Ja, und noch etwas – ah ja, stimmt, er hat den Wassertopf mit dem Mais höher gedreht.«
Jason und Maggie musterten sie prüfend. Jason fragte: »Wie viel Wein hatten Sie getrunken?«
»Ein oder zwei Gläser, na und?«
»Also«, meinte Jason, »vielleicht waren Sie vom Wein benommen. Vielleicht dachten Sie nur, Sie hätten den Schlitten mit Pallas am Steuer gesehen.«
Wieder rieb sich Ellen den Nacken. »Ich habe es gesehen, gesehen. Holt Peter her, damit ich’s ihm ins Gesicht sagen kann.«
»Wir haben uns die Weinflasche angeschaut. Ein Sangiovese, stimmt’s? Sie war zu drei viertel leer.«
»Wir haben sie nicht erst heute Abend aufgemacht.« Ellens Blick wanderte von Maggie zu Jason. Ihre Gesichter wirkten distanziert. Ellen war gewöhnt, zum Team zu gehören. »Ich weiß nicht, warum Sie immer wieder nach dem Wein fragen. Wir haben ein, zwei Gläser getrunken, mehr nicht, ein bisschen. Mit dem Unfall hat das nichts zu tun.«
Maggie sagte: »Sie haben uns erzählt, Sie hätten nicht gemerkt, dass Liam weglief. Sie wären in Gedanken bei etwas anderem gewesen. Wäre es nicht möglich, dass der Wein an Ihrer Unaufmerksamkeit schuld gewesen ist?«
Ellen riss die Augen sperrangelweit auf. Zum ersten Mal während des Gesprächs war sie hellwach.
»Habe ich mich gerade verhört? Behaupten Sie tatsächlich, ich wäre wegen eines kleinen Schlucks Wein nicht nur unfähig gewesen, auf mein Kind aufzupassen, sondern hätte auch noch fälschlicherweise einen unschuldigen Polizisten angeklagt?«
»Ellen«, meinte Jason, »beruhigen Sie sich.« Er hielt ihre Hände, stand von seinem Stuhl auf und blieb über ihr stehen. »Ich kenne Sie, ich habe mit Ihnen vor Gericht zusammengearbeitet und die Strafsachen Ihrer Patienten erledigt. Sie sind ein sensibler kluger Profi, der offen und ehrlich agiert. Wenn alle wie Sie wären, wäre mein Job viel einfacher. Aber diese Situation ist grundverschieden von allem, womit wir – Sie und ich – uns normalerweise auseinander setzen müssen. Wir können nicht objektiv sein. Liam ist Ihr Sohn, und ich bin Ihr Freund. Weder ich noch Sie können von Ihnen Professionalität erwarten, denn schließlich dreht es sich hier um Ihr Kind. Also –«
»Sie haben Recht«, unterbrach Ellen, »aber –«
»Wenn wir alle Faktoren in Betracht ziehen«, fuhr Jason fort, »das Trauma, dass es sich um Ihr eigenes Kind handelt, dazu den Konsum einer unbestimmten Weinmenge, folgt daraus zwingend, dass wir vorsichtig vorgehen, wie es so schön heißt.«
»Das heißt«, sagte Ellen, »in Ihren Augen bin ich unglaubwürdig.«
Maggie schüttelte den Kopf. »Diese Behauptung geht zu weit.«
»Dann schwächen Sie sie ab.«
Maggie seufzte. »Ich wiederhole nur Jasons Worte. Wir müssen vorsichtig vorgehen.«
Das deckte sich nicht mit Ellens Wünschen. Ihr wäre es am liebsten gewesen, wenn sich der Polizist in den Sattel geschwungen und den Kerl, der Liam verletzt hatte, mit dem Lasso eingefangen hätte.
Als Ellen zurück in die Intensivstation ging, schauten Maggie und Jason zu, wie die Schiebetür hinter ihr zuglitt. Anschließend beobachteten sie durch die Glasscheibe, wie sich drinnen die Menschen im Zeitlupentempo um das reglose Kind bewegten.
»Wie gut kennst du sie?«, wollte Maggie von Jason wissen.
»Genauso gut wie Peter. Sie ist eine anerkannte Therapeutin. Ihre Praxis liegt hinter dem Bürgerhaus. Hat sich auf Familienthemen spezialisiert.«
»Persönlich, meine ich.«
»Persönlich fand ich sie immer großartig. Viel Herz, aber ohne Tamtam. Bei jeder Zusammenarbeit ist sie ganz Profi, unkompliziert, bodenständig. Ich sehe sie öfter mit dem kleinen Kind und ihrem Mann in der Stadt. ’ne typische Eastport-Familie von der netten Sorte. Bei denen stehen nicht der Ferrari und die Reise nach Monaco an erster Stelle. Sie interessieren sich wirklich für ihre Umgebung.«
Maggie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und streckte die Beine aus. Ihre Idealvorstellung vom Polizisten als Retter der Welt hatte sich während ihrer Zeit in Uniform so weit gemildert, dass sie inzwischen ihre Mitstreiter als menschliche Wesen
akzeptierte. Obwohl sie nach vier Jahren in Zivil noch immer an den alten Idealen festhielt, war sie nicht mehr schockiert, wenn ein Kollege Mist baute.
Allerdings hatte sie noch nie darüber nachdenken müssen, ob einer von ihnen ein Mörder war.
»Also, was denkst du?«
»Ich denke, dass ich am liebsten zehn Bierchen kippen und dann einen langen Mittagsschlaf machen möchte. Peter ist ein guter Polizist und ein prima Kerl. Kennst du einen, der ihn nicht respektiert oder mag? Wenn es darum geht, den Weihnachtsmann durch die Stadt zu kutschieren, dann ist Peter an der Reihe. Er war sogar ein Jahr lang Fußballtrainer.« Jason seufzte. »Wir werden noch mal mit ihm reden.«