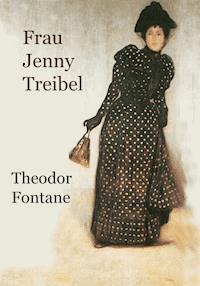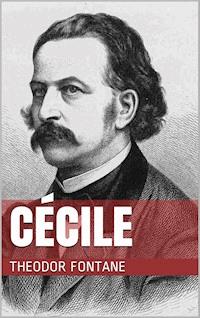Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem historischen Werk "Vor dem Sturm" beschäftigt sich der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane mit der preußischen Gesellschaft und den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf der Adelsfamilie Vitzewitz-Pudagla. Der junge Lewin Vitzewitz kehrt am Weihnachtsabend auf das Schloss Hohen-Vietz zurück, um mit seinem Vater und seiner Schwester die Feiertage zu verbringen. Der Jurastudent, der gerne seine Tage im romantischen Lesezirkel Berlins verbringt, trifft dabei auf den draufgängerischen Vater, der seinen Sohn zu den Waffen treibt. Er verlangt von Lewin im Befreiungskrieg gegen Napoleon zu kämpfen. Eine Aufgabe, die der junge Lewin mit seinem Leben bezahlen könnte...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1119
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Fontane
Vor dem Sturm
Roman aus dem Winter 1812 auf 13
Saga
Vor dem Sturm
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1812, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997507
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Erster Band
Hohen-Vietz
Erstes Kapitel
Heiligabend
Es war Weihnachten 1812, Heiliger Abend. Einzelne Schneeflocken fielen und legten sich auf die weiße Decke, die schon seit Tagen in den Straßen der Hauptstadt lag. Die Laternen, die an langausgespannten Ketten hingen, gaben nur spärliches Licht; in den Häusern aber wurde es von Minute zu Minute heller, und der »Heilige Christ«, der hier und dort schon einzuziehen begann, warf seinen Glanz auch in das draußen liegende Dunkel.
So war es auch in der Klosterstraße. Die »Singuhr« der Parochialkirche setzte eben ein, um die ersten Takte ihres Liedes zu spielen, als ein Schlitten aus dem Gasthof »Zum grünen Baum« herausfuhr und gleich darauf schräg gegenüber vor einem zweistöckigen Hause hielt, dessen hohes Dach noch eine Mansardenwohnung trug. Der Kutscher des Schlittens, in einem abgetragenen, aber mit drei Kragen ausstaffierten Mantel, beugte sich vor und sah nach den obersten Fenstern hinauf; als er jedoch wahrnahm, daß alles ruhig blieb, stieg er von seinem Sitz, strängte die Pferde ab und schritt auf das Haus zu, um durch die halb offenstehende Tür in dem dunklen Flur desselben zu verschwinden. Wer ihm dahin gefolgt wäre, hätte notwendig das stufenweise Stapfen und Stoßen hören müssen, mit dem er sich, vorsichtig und ungeschickt, die drei Treppen hinauffühlte.
Der Schlitten, eine einfache Schleife, auf der ein mit einem sogenannten »Plan« überspannter Korbwagen befestigt war, stand all die Zeit über ruhig auf dem Fahrdamm, hart an der Öffnung einer hier aufgeschütteten Schneemauer. Der Korbwagen selbst, mutmaßlich um mehr Wärme und Bequemlichkeit zu geben, war nach hinten zu, bis an die Plandecke hinauf, mit Stroh gefüllt; vorn lag ein Häckselsack, gerade breit genug, um zwei Personen Platz zu gönnen. Alles so primitiv wie möglich. Auch die Pferde waren unscheinbar genug, kleine Ponys, die gerade jetzt in ihrem winterlich rauhen Haar ungeputzt und dadurch ziemlich vernachlässigt aussahen. Aber wie immer auch, die russischen Sielen, dazu das Schellengeläut, das auf roteingefaßten, breiten Ledergurten über den Rücken der Pferde hing, ließen keinen Zweifel darüber, daß das Fuhrwerk aus einem guten Hause sei.
So waren fünf Minuten vergangen oder mehr, als es auf dem Flur hell wurde. Eine Alte in einer weißen Nachthaube, das Licht mit der Hand schützend, streckte den Kopf neugierig in die Straße hinaus; dann kam der Kutscher mit Mantelsack und Pappkarton; hinter diesem, den Schluß bildend, ein hochaufgeschossener, junger Mann von leichter, vornehmer Haltung. Er trug eine Jagdmütze, kurzen Rock und war in seiner ganzen Oberhälfte unwinterlich gekleidet. Nur seine Füße steckten in hohen Filzstiefeln. »Frohe Feiertage, Frau Hulen«, damit reichte er der Alten die Hand, stieg auf die Deichsel und nahm Platz neben dem Kutscher. »Nun vorwärts, Krist; Mitternacht sind wir in Hohen-Vietz. Das ist recht, daß Papa die Ponys geschickt hat.«
Die Pferde zogen an und versuchten es, ihrer Natur nach, in einen leichten Trab zu fallen; aber erst als sie die Königsstraße mit ihrem Weihnachtsgedränge und Waldteufelgebrumm im Rücken hatten, ging es in immer rascherem Tempo die Landsberger Straße entlang und endlich unter immer munterer werdendem Schellengeläut zum Frankfurter Tore hinaus.
Draußen umfing sie Nacht und Stille; der Himmel klärte sich, und die ersten Sterne traten hervor. Ein leiser, aber scharfer Ostwind fuhr über das Schneefeld, und der Held unserer Geschichte, Lewin von Vitzewitz, der seinem väterlichen Gute Hohen-Vietz zufuhr, um die Weihnachtsfeiertage daselbst zu verbringen, wandte sich jetzt, mit einem Anflug von märkischem Dialekt, an den neben ihm sitzenden Gefährten. »Nun, Krist, wie wär' es? Wir müssen wohl einheizen.« Dabei legte er Daumen und Zeigefinger ans Kinn und paffte mit den Lippen. Dies »wir« war nur eine Vertraulichkeitswendung; Lewin selbst rauchte nicht. Krist aber, der von dem Augenblick an, wo sie die Stadt im Rücken hatten, diese Aufforderung erwartet haben mochte, legte ohne weiteres die Leinen in die Hand seines jungen Herrn und fuhr in die Manteltasche, erst um eine kurze Pfeife mit bleiernem Abguß, dann um ein neues Paket Tabak daraus hervorzuholen. Er nahm beides zwischen die Knie, öffnete das mit braunem Lack gesiegelte Paket, stopfte und begann dann mit derselben langsamen Sorglichkeit nach Stahl und Schwamm zu suchen. Endlich brannte es; er tat, indem er wieder die Leine nahm, die ersten Züge, und während jetzt kleine Funken aus dem Drahtdeckel hervorsprühten, ging es auf Friedrichsfelde zu, dessen Lichter ihnen über das weiße Feld her entgegenschienen.
Das Dorf lag bald hinter ihnen. Lewin, der sich's inzwischen bequem gemacht und durch festeren Aufbau einiger Strohbündel eine Rückenlehne hergerichtet hatte, schien jetzt in der Stimmung, eine Unterhaltung aufzunehmen. Ehe des Kutschers Pfeife brannte, wär' es ohnehin nicht rätlich gewesen.
»Nichts Neues, Krist?« begann Lewin, indem er sich fester in die Strohpolster drückte. »Was macht Willem, mein Päth?«
»Dank schön, junger Herr, he ist ja nu wedder bi Weg.«
»Was war ihm denn?«
»He hett sich verfiert. Un noch dato an sinen Gebortsdag. Et is nu en Wochner drei; ja, up'n Dag hüt, drei Wochen. Oll Doktor Leist von Lebus hett'em aber wedder torecht bracht.«
»Er hat sich verfiert?«
»Ja, junger Herr, so glöwen wi all. Et wihr wol so um de fiefte Stunn, as mine Fru seggen däd: Willem geih un hol uns en paar Äppels, awers von de Renetten up'n Stroh, dicht bi de Bohnenstakens. Un uns' Lütt-Willem ging ooch, un ick hürt' em noch flüten un singen un dat Klapsen von sine Pantinen ümmer den Floor lang. Awer dunn hürt ick nix mihr, un as he nu an de olle wackel'sche Döör käm un in den groten Saal rinnwull, wo uns' Äppels liggen un wo de Lüt seggen, dat de oll' Matthias spöken deiht, da möt em wat passiert sinn. He käm nich un käm nich; un as ick nu nahjung un sehn wull, wo he bliwen däd, da läg he, glieks achter de Schwell, as dod up de Fliesen.«
»Das arme Kind! Und Eure Frau...«
»De käm ooch, un wi drögen em nu torügg in unse Stuv' un rewen em in. Mine Fru hätt ümmer en beten Miren-Spiritus to Huus. As he nu wedder to sich käm, biwwerte em de janze lütte Liew, un he seggte man ümmer: ›Ick hebb em sehn.‹«
Lewin hatte sich zurechtgerückt. »Es geht also wieder besser«, warf er hin, und wie um loszukommen von allerhand Bildern und Gedanken, die des Kutschers Erzählung in ihm angeregt hatte, fuhr er hin und her in Erkundigungen, worauf Krist mit so viel Ausführlichkeit antwortete, wie ihm die Raschheit der Fragen gestattete. Dem Schulzen Kniehase war einer von seinen Braunen gefallen; bei Hoppenmarieken hatte der Schornstein gebrannt; bei Witwe Gräbschen hatte Nachtwächter Pachaly einen mittelgroßen Sarg, mit einem Myrtenkranz darauf, vor der Haustür stehen sehn, »un wihl et man en mittelscher Sarg west wihr, so hedden se all an de Jüngscht, an Hanne Gräbschen' dacht. De is man kleen und piept all lang.«
Die Sterne traten immer zahlreicher hervor. Lewin lupfte die Kappe, um sich die Stirn von der frischen Winterluft anwehen zu lassen, und sah staunend und andächtig in den funkelnden Himmel hinauf. Es war ihm, als fielen alle dunklen Geschicke, das Erbteil seines Hauses, von ihm ab und als zöge es lichter und heller von oben her in seine Seele. Er atmete auf. Zwei, drei Schlitten flogen vorüber, grüßten und sangen, sichtlich Gäste, die im Nebendorf die Bescherung nicht versäumen wollten; dann, ehe fünf Minuten um waren, glitt das Gefährt unserer zwei Freunde unter den Giebelvorbau des Bohlsdorfer Kruges.
Bohlsdorf war drittel Weg. Niemand kam. An den Fenstern zeigte sich kein Licht; die Krügersleute mußten in den Hinterstuben sein und das Vorfahren des Schlittens, trotz seines Schellengeläutes, überhört haben. Krist nahm wenig Notiz davon. Er stieg ab, holte eine der Stehkrippen heran, die beschneit an dem Hofzaun entlang standen, und schüttete den Pferden ihren Hafer ein.
Auch Lewin war abgestiegen. Er stampfte ein paarmal in den Schnee, wie um das Blut wieder in Umlauf zu bringen, und trat dann in die Gaststube, um sich zu wärmen und einen Imbiß zu nehmen. Drinnen war alles leer und dunkel; hinter dem Schenktisch aber, wo drei Stufen zu einem höher gelegenen Alkoven führten, blitzte der Christbaum von Lichtern und goldenen Ketten. In diesem Weihnachtsbilde, das der enge Türrahmen einfaßte, stand die Krügersfrau in Mieder und rotem Friesrock und hatte einen Blondkopf auf dem Arm, der nach den Lichtern des Baumes langte. Der Krüger selbst stand neben ihr und sah auf das Glück, das ihm das Leben und dieser Tag beschert hatten.
Lewin war ergriffen von dem Bilde, das fast wie eine Erscheinung auf ihn wirkte. Leiser als er eingetreten war, zog er sich wieder zurück und trat auf die Dorfstraße. Gegenüber dem Kruge, von einer Feldsteinmauer eingefaßt, lag die Bohlsdorfer Kirche, ein alter Zisterzienserbau aus den Tagen der ersten Kolonisten. Es klang deutlich von drüben her, als würde die Orgel gespielt, und Lewin, während er noch aufhorchte, bemerkte zugleich, daß eines der kleinen, in halber Wandhöhe hinlaufenden Rundbogenfenster matt erleuchtet war. Neugierig, ob er sich täuschte oder nicht, stieg er über die niedrige Steinmauer fort und schritt zwischen den Gräbern hin auf die Längswand der Kirche zu. Ziemlich inmitten dieser Wand bemerkte er eine Pforte, die nur eingeklinkt war, aber nicht geschlossen war. Er öffnete leise und trat ein. Es war, wie er vermutet hatte. Ein alter Mann, mit Samtkäpsel und spärlichem weißen Haar, saß vor der Orgel, während ein Lichtstümpfchen neben ihm eine kümmerliche Beleuchtung gab. In sein Orgelspiel vertieft, bemerkte er nicht, daß jemand eingetreten war, und feierlich, aber gedämpften Tones klangen die Weihnachtsmelodien nach wie vor durch die Kirche hin.
Übte sich der Alte für den kommenden Tag, oder feierte er hier sein Christfest allein für sich mit Psalmen und Choral? Lewin hatte sich die Frage kaum gestellt, als er, der Orgel gegenüber, einen zweiten Lichtschimmer wahrnahm; auf der untersten Stufe des Altars stand eine kleine Hauslaterne. Als er nähertrat, sah er, daß Frauenhände hier eben noch beschäftigt gewesen sein mußten. Ein Handfeger lag da, daneben eine kurze Stehleiter, die beiden Seitenhölzer oben mit Tüchern umwunden. Das Licht der Laterne fiel auf zwei Grabsteine, die vor dem Altar in die Fliesen eingelegt waren; der eine zur Linken enthielt nur Namen und Datum, der andere zur Rechten aber zeigte Bild und Spruch. Zwei Lindenbäume neigten ihre Wipfel einander zu, und darunter standen Verse, zehn oder zwölf Zeilen. Nur die Zeilen der zweiten Strophe waren noch deutlich erkennbar und lauteten:
Sie sieht nun tausend Lichter;
Der Engel Angesichter
Ihr treu zu Diensten stehn;
Sie schwingt die Siegesfahne
Auf güldnem Himmelsplane
Und kann auf Sternen gehn.
Lewin las zwei-, dreimal, bis er die Strophe auswendig wußte; die letzte Zeile namentlich hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht, von dem er sich keine Rechenschaft geben konnte. Dann sah er sich noch einmal in der seltsam erleuchteten Kirche um, deren Pfeiler und Chorstühle ihn schattenhaft umstanden, und kehrte, die Türe leise wieder anlehnend, erst auf den Kirchhof, dann, mit raschem Sprung über die Mauer, auf die Dorfstraße zurück.
Der Krug hatte indessen ein verändertes Ansehen gewonnen. In der Gaststube war Licht; Krist stand am Schenktisch im eifrigen Gespräch mit dem Krüger, während die Frau, aus der Küche kommend, ein Glas Kirschpunsch auf den Tisch stellte. Sie plauderten noch eine Weile auch über den alten Küster drüben, der, seitdem er Witmann geworden, seinen Heiligen Abend mit Orgelspiel zu feiern pflegte; dann, unter Händeschütteln und Wünschen für ein frohes Fest, wurde Abschied genommen, und an den stillen Dorfhütten vorbei ging es weiter in die Nacht hinein.
Lewin sprach von den Krügersleuten; Krist war ihres Lobes voll. Weniger wollt' er vom Bohlsdorfer Amtmann wissen, am wenigsten vom Petershagener Müller, an dessen abgebrannter Bockmühle sie eben vorüberfuhren. Aus allem ging hervor, daß Krist, der allwöchentlich dieses Weges kam, den Klatsch der Bierbänke zwischen Berlin und Hohen-Vietz in treuem Gedächtnis trug. Er wußte alles und schwieg erst, als Lewin immer stiller zu werden begann. Nur kurze Ansprachen an die Ponys belebten noch den Weg. Die regelmäßige Wiederkehr dieser Anrufe, das monotone Schellenläuten, das alsbald wie von weit her zu klingen schien, legte sich mehr und mehr mit einschläfernder Gewalt um die Sinne unseres Helden. Allerhand Gestalten zogen an seinem halbgeschlossenen Auge vorüber; aber eine dieser Gestalten, die glänzendste, nahm er mit in seinen Traum. Er saß vor ihr auf einem niedrigen Tabouret; sie lachte ihn an und schlug ihn leise mit dem Fächer, als er nach ihrer Hand haschte, um sie zu küssen. Hundert Lichter, die sich in schmalen Spiegeln spiegelten, brannten um sie her, und vor ihnen lag ein großer Teppich, auf dem Göttin Venus in ihrem Taubengespann durch die Lüfte zog. Dann war es plötzlich, als löschten alle diese Lichter aus; nur zwei Stümpfchen brannten noch; es war wie eine schattendurchhuschte Kirche, und an der Stelle, wo der Teppich gelegen hatte, lag ein Grabstein, auf dem die Worte standen:
Sie schwingt die Siegesfahne
Auf güldnem Himmelsplane
Und kann auf Sternen gehn.
Süß und schmerzlich, wie kurz vorher bei wachen Sinnen ihn diese Worte berührt hatten, berührten sie ihn jetzt im Traum. Er wachte auf.
»Noch eine halbe Meile, junger Herr«, sagte Krist.
»Dann sind wir in Dolgelin?«
»Nein, in Hohen-Vietz.«
»Da hab' ich fest geschlafen.«
»Dritthalb Stunn.«
Das erste, was Lewin wahrnahm, war die Sorglichkeit, mit der sich der alte Kutscher mittlerweile um ihn bemüht hatte. Der Futtersack war ihm unter die Füße geschoben, die beiden Pferdedecken lagen ausgebreitet über seinen Knien.
Nicht lange, und der Hohen-Vietzer Kirchturm wurde sichtbar. An oberster Stelle eines Höhenzuges, der nach Osten hin die Landschaft schloß, stand die graue Masse schattenhaft im funkelnden Nachthimmel.
Dem Sohne des Hauses schlug das Herz immer höher, sooft er dieses Wahrzeichens seiner Heimat ansichtig wurde. Aber er hatte heute nicht lange Zeit, sich der Eigentümlichkeit des Bildes zu freuen. Die beschneiten Parkbäume traten zwischen ihn und die Kirche, und einige Minuten später schlugen die Hunde an, und zwischen zwei Torpfeilern hindurch beschrieb der Schlitten eine Kurve und hielt vor der portalartigen Glastüre, zu der zwei breite Sandsteinstufen hinaufführten.
Lewin, der sich schon vorher erhoben hatte, sprang hinaus und schritt auf die Stufen zu. »Guten Abend, junger Herr«, empfing ihn ein alter Diener in Gamaschen und Frackrock, an dem nur die großen blanken Knöpfe verrieten, daß es eine Livree sein sollte.
»Guten Abend, Jeetze; wie geht es?«
Aber über diesen Gruß kam Lewin nicht hinaus, denn im selben Augenblick richtete sich ein prächtiger Neufundländer vor ihm auf und überfiel ihn, die Vorderpfoten auf seine Schultern legend, mit den allerstürmischsten Liebkosungen.
»Hektor, laß gut sein, du bringst mich um.« Damit trat unser Held in die Halle seines väterlichen Hauses. Ein paar Scheite, die im Kamin verglühten, warfen ihr Licht auf die alten Bilder an der Wand gegenüber. Lewin sah sich um, nicht ohne einen Anflug freudigen Stolzes, auf der Scholle seiner Väter zu stehen.
Dann leuchtete ihm der alte Diener die schwere doppelarmige Treppe hinauf, während Hektor folgte.
Zweites Kapitel
Hohen-Vietz
In der Halle schwelen noch einige Brände; schütten wir Tannäpfel auf und plaudern wir, ein paar Sessel an den Kamin rückend, von Hohen-Vietz.
Hohen-Vietz war ursprünglich ein altes, aus den Tagen der letzten Askanier stammendes Schloß mit Wall und Graben und freiem Blick ostwärts auf die Oder. Es lag auf demselben Höhenzuge wie die Kirche, deren schattenhaftes Bild uns am Schluß des vorigen Kapitels entgegentrat, und beherrschte den breiten Strom wie nicht minder die am linken Flußufer von Frankfurt nach Küstrin führende Straße. Es galt für sehr fest, und jahrhundertelang hatten sie einen Reim im Lebusischen, der lautete:
De sitt so fest up sinen Sitz,
As de Vitzewitz' up Hohen-Vietz.
Die Pommern lagen zweimal davor; die Hussiten berannten es, als sie sengend und brennend in Lebus und Barnim vordrangen, aber die Heilige Jungfrau im Kirchenbanner schützte das Schloß, und als der damalige Vitzewitz, über dessen Vornamen die Urkunden verschiedene Angaben bringen, ein griechisches Feuer in das Lager der Hussiten warf, zogen sie ab, nachdem sie alle umhergelegenen Dörfer verwüstet hatten. Die Kunst des griechischen Feuers aber hatte der Schloßherr von Rhodus mit heimgebracht, wo er unter den Rittern an zwei Feldzügen gegen die Türken teilgenommen hatte.
Das war 1432. Ruhigere Zeiten kamen. Der hohe Ruf von Hohen-Vietz lebte fort, ohne daß er Gelegenheit gehabt hätte, sich neu zu bewähren. Erst der Dreißigjährige Krieg brachte neue und schwerere Prüfungen.
Am 29. März 1631, fast genau zweihundert Jahre nach der Hussitenüberschwemmung, erschienen von Frankfurt aus sechs Kompanien Kaiserlicher vor Hohen-Vietz, das am Tage vorher, den Protesten des Schloßherrn Rochus von Vitzewitz zum Trotz, von den von Stettin und Garz her heranziehenden Schweden besetzt worden war. Oberst Maradas, der die Kaiserlichen führte, forderte die Übergabe des Schlosses. Als diese verweigert wurde, legten die Kaiserlichen, die aus je zwei Kompanien der Regimenter Butler, Lichtenstein und Maradas zusammengesetzt waren, die Leitern an, stürmten das Schloß, brannten es bis auf die nackten Mauern aus und ließen die schwedische Besatzung über die Klinge springen.
Einen Augenblick stand Rochus von Vitzewitz in Gefahr, das Schicksal der Besatzung zu teilen; seine beiden halberwachsenen Söhne aber, sie mochten siebzehn und sechzehn Jahre zählen, warfen sich dazwischen und retteten ihn durch ihre Geistesgegenwart. Oberst Maradas, an den jungen Leuten Gefallen findend, bot ihnen an, im Kaiserlichen Heere Dienst zu nehmen, ein Anerbieten, das von seiten des jüngeren, Matthias, ohne langes Säumen, auch ohne Widerspruch des Vaters angenommen wurde. Es waren nicht Zeiten, um über erfahrene Unbill, wie sie der Lauf des Krieges für Freund und Feind gleichmäßig mit sich brachte, lange zu grübeln. Matthias trat als Cornet in das Regiment Lichtenstein ein, Anselm aber, der ältere, erklärte, bei dem Vater ausharren und demselben bei Wiederaufbau des Schlosses zur Seite stehen zu wollen.
Dieser Wiederaufbau jedoch verzögerte sich. Als er endlich nach dem Abzug der feindlichen, nunmehr Süddeutschland zum Schauplatz ihrer Kämpfe wählenden Heere beginnen sollte, hatten sich unter den fortwährenden Opfern des Krieges die Verhältnisse derart verschlechtert, daß es an den nötigen Mitteln zu einem Schloßbau gebrach. Rochus entschied sich also, von der Hohen-Vietzer-Höhe, von der aus die Seinen dreihundert Jahre und länger ins Land geblickt hatten, herabzusteigen und zu Füßen derselben, am Nordrande des sich hier hinziehenden alten Wendendorfes, ein einfaches Herrenhaus herzurichten. Dies war 1634.
Anselm ging ihm dabei in allen Stücken zur Hand, und schon Sonntag Exaudi, elf Monate nach Beginn des Baues, konnte die neue Heimstätte der Vitzewitze bezogen werden.
Es war ein Fachwerkhaus, lang, niedrig, mit hohem Dach. In dem Balken aber, der über der Türe hinlief, war ein Spruch eingeschnitten:
Dies ist der Vitzewitzen Haus,
Aus dem alten zog es aus;
Gottes Segen komm herein,
Wird es wohl geschützet sein.
Und fast schien es, als ob der Spruch sich erfüllen und inmitten aller Kriegstrübsal, die über dem Lande lag, an dieser neugegründeten Stätte ein neues Glück erblühen solle. Von Matthias, der aus dem Regiment Lichtenstein in das Regiment Tiefenbach übergetreten, bei Nördlingen verwundet und ein halbes Jahr später, erst zwanzig Jahre alt, zum kaiserlichen Hauptmann aufgestiegen war, trafen Nachrichten ein, die des alten Rochus Herz, trotzdem es den Schweden zuneigte, mit Stolz und Freude erfüllten. Anselm, ohne darum nachgesucht zu haben, sah sich an den Hof gezogen und trat in dieselbe Leibtrabantengarde, in der schon seit hundert Jahren alle Vitzewitze ihrem Herrn, dem Kurfürsten, gedient hatten; was aber vor allem zu Dank und Hoffnung stimmte, das waren zwei gesegnete Fruchtjahre, die der Himmel der Hohen-Vietzer Feldmark schenkte, wahre Prachternten, aus deren Erträgen nunmehr die Mittel zur Aufführung eines stattlichen, rechtwinklig an das eigentliche Wohnhaus sich anlehnenden Anbaues entnommen werden konnten. Dieser Anbau, eine einzige mit Emporen, Wappen und Hirschgeweihen geschmückte Halle, richtete das Gemüt des alten Rochus, der eine hohe Vorstellung von den Repräsentationspflichten seines Hauses hatte, wieder auf und gemahnte ihn an alte gastliche Zeiten. Als er das erstemal den Nachbaradel in diesem »Bankettsaal«, wie er die Halle gern nennen hörte, bewirtete, hielt er eine Ansprache an die Versammelten, die der Überzeugung Ausdruck gab, daß das Haus Vitzewitz auch wieder »bergan« ziehen und nicht immer »geduckt unterm Winde« stehen werde. All Ding, so etwa schloß er, habe seine Zeit, auch Krieg und Kriegesnot, und der Tag werde kommen, wo seine lieben Freunde und Nachbaren wieder auf der Höhe bei ihm zu Gaste sein und frei ostwärts mit ihm blicken würden.
Alles stimmte ein. Aber wenn jemals unprophetische Worte gesprochen wurden, so waren es diese. Der Krieg kam wieder, mit ihm Hunger und Pest, und zerstörte entweder den Wohlstand der Dörfer oder diese selbst. Ganze Gemarkungen wandelten sich in eine Wüste, und die Hälfte der Hohen-Vietzer Hofestellen stand leer, weil ihre Insassen verflogen oder verstorben waren. Inmitten dieses Elendes, ehe noch der Schimmer besserer Zeiten heraufdämmerte, schloß Rochus die müden Augen, und sie trugen ihn bergan in die Gruft unterm Altar und stellten den kupfernen Sarg, mit Beschlägen und Wappentafeln und mit aufgelötetem silbernen Kruzifix, in die lange Reihe der ihm vorangegangenen Ahnen. Nichts fehlte; denn der Zeiten Not hatte dem Vater die Ehren des Begräbnisses nicht kürzen sollen. So wollte es der älteste Sohn; der jüngere, mit seinem Regiment an der Fränkischen Saale stehend, hatte der Bestattung nicht beiwohnen können.
Anselm war nun Herr auf Hohen-Vietz.
Es war nicht frohen Herzens, daß er das erste Korn in den nur schlecht gepflügten Boden warf; aber siehe da, die Saat ging auf, ohne daß Freund oder Feind – denn zwischen beiden war längst kein Unterschied mehr – die jungen Halme zerstampft hätte; der Krieg, so schien es, hatte sich ausgebrannt wie ein Feuer, das keine Nahrung mehr findet, und ehe das Jahrzehnt schloß, ging die Mär von Mund zu Mund, die Mär, daß Friede sei.
Und es war Friede. Was niemand mehr mit Augen zu sehen gehofft hatte, es war da. Und als abermals zwei Jahre ins Land gezogen waren, ohne daß Schwede oder Kaiserlicher im Lebusischen gelagert und geplündert hätte, und jeder, selbst der Ungläubigste, seiner Zweifel sich entschlagen mußte, da traf ein Brief im Hohen-Vietzer Herrenhause ein, der führte die Aufschrift: »Dem wohledlen, gestrengen und festen Anselm von Vitzewitz, erbsessen auf Hohen-Vietz im Lande Lebus.« Der Brief selbst aber lautete: »Mein insonders vielgeliebter Bruder! Von heut ab in zween Wochen, so Gott seinen Segen zu meinem Plane gibt, bin ich bei Dir in Hohen-Vietz. Ich erwarte nur noch die Permission aus Wien, die mir Kayserliche Majestät nicht refüsieren wird. Vielleicht, daß uns tempora futura wieder zusammenführen, wie uns die Tage der Kindheit und adolescentia zusammen sahen. Wir Lutherischen – trotzdem sie zu Münster und Osnabrügge den Religionsfrieden mit vollen Backen proklamieret haben – sind wenig gelitten im Kayserlichen Heere, und kein Tag vergeht ohne Andeutung, daß man uns nicht mehr braucht. Ich höre, daß Unser gnädigster Herr Kurfürst, dem ich nie säumig gewesen, als meinen Lehns- und Landesherren zu konsiderieren, eine brandenburgische Armee wirbt, derowegen er aus schwedischem und Kayserlichem Heer Offiziers und Generals im Beträchtlichen herübernimmt. Es sollte mir eine rechte Freude sein, so die Reihe auch an mich käme; denn daß ich es sage, es zieht mich wieder heimb in mein liebes Land Lebus. Unsere Vettern und Nachbarn, die Burgsdorffs, die post mortem Schwarzenbergii das A und das O bei Hofe sind, werden doch etwas thun wollen für eine alte Kriegsgurgel, die den Dienst kennt wie den Catechismum Lutheri. Interim bene vale. Der ich bin Dein Bruder Matthias von Vitzewitz, Kayserlicher Oberst.«
Und Matthias kam wirklich und hielt die angegebene Zeit. Ein Fest sollte seine Anwesenheit feiern. In dem großen Anbau waren drei Tische gedeckt; zwei standen unten und liefen, der Länge des Saales nach, nebeneinander her, der dritte Tisch aber stand quer auf einer mit Wappen und Bannern geschmückten Empore, zu der drei Stufen hinanführten. Die ganze Freundschaft aus Barnim und Lebus war geladen; die Brüder saßen einander gegenüber; neben ihnen, an der Quertafel: Adam und Beteke Pfuel von Jahnsfelde, Peter Ihlow von Ringenwalde, Balthasar Wulffen von Tempelberg, Hans und Nikolaus Barfus von Hohen- und Nieder-Predikow, dazu Tamme Strantz, Achim von Kracht, zwei Schapelows, zwei Beerfeldes und fünfe von Burgsdorff. Sie waren alle, schon um Glaubens willen, mehr schwedisch als kaiserlich, besonders Peter Ihlow, der – ein Neffe Feldmarschall Ihlows – einen Groll gegen den Wiener Hof hatte, ihn anklagend, seinen Oheim in Schloß Eger meuchlings gemordet zu haben. Er wiederholte auch heute seine Anklage, wobei es dahingestellt bleiben mag, ob er die Gegenwart des Gastes momentan vergaß oder sie vergessen wollte.
Matthias von Vitzewitz, als er seinen Kriegsherrn, den Kaiser, in so herausfordernder Weise schmähen hörte, erhob sich und rief:
»Peter Ihlow, hütet Eure Zunge. Ich bin kaiserlicher Offizier.«
»Du bist es«, rief jetzt Anselm, aus dem der Wein, aber noch mehr das protestantische Herz sprach, über den Tisch hinüber: »du bist es; aber besser wäre es, du wärest es nie gewesen.«
»Besser oder nicht, ich bin es. Des Kaisers Ehre ist meine Ehre.«
»Ein Glück, daß du die Ehre satt hast. Die Fremden sind wenig gelitten im kaiserlichen Heere.«
Matthias, der sich bis dahin mühsam bezwungen hatte, verlor alle Herrschaft über sich, als er sich, durch Vorhaltung seiner eigenen Briefworte, in so wenig großmütiger Weise besiegt und gefangen sah. Die Augen traten ihm aus der Stirn, und sein Kinn auf den Knauf des Degens stützend, schrie er: »Wer das sagt, der lügt.«
»Wer es leugnet, der lügt.«
In diesem Augenblicke zogen beide. Die Zunächstsitzenden sprangen auf, aber ehe noch ein Dazwischenspringen möglich war, hatte des jüngeren Bruders Degen die Brust des älteren durchdrungen. Anselm war tödlich getroffen.
Matthias, außer sich über das Geschehene, wollte sich dem Kurfürsten stellen; nur widerwillig gab er den Vorstellungen derer nach, die auf Flucht drangen. In seine Garnisonstadt Böhmisch-Grätz zurückgekehrt, machte er nach Wien hin Meldung von dem Vorgefallenen; dabei hatte es sein Bewenden. Ihm zu zeigen, wie wenig die Kriegskanzelei den Vorfall beanstande, der ja in Verteidigung kaiserlicher Ehre seine erste Veranlassung hatte, ließ man ihn zum General aufsteigen und gab ihm ein Kommando in Ungarn. Aber diese Gnadenbezeugungen, dankbar, wie er sie entgegennahm, gaben ihm doch die Ruhe nicht wieder, nach der er dürstete, und von Peterwardein aus, wo er im Feldlager lag, schrieb er an den Kurfürsten und rief seine Gnade an, »um dessentwillen, der aller Menschen Heil und Gnade sei«.
Der Kurfürst schwankte; als aber durch die eidlichen Aussagen von Peter Ihlow, Beteke Pfuel und Ehrenreich von Burgsdorff erwiesen war, daß beide Brüder zu gleicher Zeit gezogen hätten, kam es zu einem Generalpardon, »gleichweis als ob die Geschichte nie geschehen wäre«, und Matthias kehrte nach Hohen-Vietz zurück, das er mit dem Tage, an dem Maradas das Schloß gestürmt hatte, nur einmal, in jener unheilvollen Festesstunde, wiedergesehen hatte.
Er kam und brachte, wie die Hohen-Vietzer noch lange erzählten, »eine Tonne Goldes mit sich«; denn Dotationen und Landerwerbungen, wie sie damals herkömmlich waren, hatten ihn reich gemacht. Der Kurfürst empfing ihn in ausgezeichneter Weise und setzte ihn unter Innehaltung herkömmlicher Formen in den Vollbesitz des verfallenen Gutes ein. Unmittelbar darauf schritt der Neubelehnte zur Aufführung eines schloßartigen, mit breiter Treppe und hohen Stuckzimmern reich ausgestatteten Renaissanceneubaues, der, mit dem ärmlichen Fachwerkhaus parallel laufend, einen hufeisenförmigen Gebäudekomplex herstellte, in dem die »Banketthalle«, der mehrgenannte Saalanbau des alten Rochus, die verbindende Linie war. Diesen Saalanbau selbst aber, eingedenk dessen, was hier geschah, schuf Matthias von Vitzewitz in eine Kapelle um. Über dem Altar stiftete er ein Bild, dessen Inhalt der Erzählung vom verlorenen Sohn entnommen war; daneben hing er die Klinge auf, mit der er den Bruder erstochen hatte. Er betrat die Kapelle nie anders als in der Dämmerstunde; er liebte nicht, daß man es wußte oder gar davon sprach, aber wer auf dem anstoßenden Fliesenflur des alten Fachwerkhauses zu tun hatte oder müßig lauschte, der hörte seine lauten Gebete.
Seine Buße währte sein Leben lang, und sein Leben kam zu hohen Jahren. Noch spät hatte er sich vermählt. Im Herbste desselben Jahres, das seinen Herrn den Kurfürsten hinscheiden sah, schied auch er aus dieser Zeitlichkeit, und die Hohen-Vietzer, an ihrer Spitze der achtzehnjährige Sohn des Hauses, trugen ihn bis zur alten Hügelkirche hinauf und setzten ihn in die Gruft neben den Kupfersarg des Vaters derart, daß Anselm zur Rechten, Matthias aber zur Linken stand.
Er war in der Zuversicht gestorben, daß Gott seine Buße angenommen habe; auch die, die nach ihm kamen, waren dieses Glaubens voll. Aber dieser Glaube, wie festen Lebensgrund er ihnen gab, konnte ihnen doch den Frohsinn des Lebens nicht wiedergeben. Sie blickten ernst um sich her. Und dieser Zug begann sich fortzuerben. Der Familiencharakter, der in alten Zeiten ein joviales Aufbrausen gewesen war, wich einem Grübeln und Brüten, und ihr Hang zu Festen und Gelagen schlug in einen Hang zur Selbstpein und Askese um. Auch sahen sie sich durch manchen Vorgang, durch Spuk und Wirklichkeit in diesem Hange genährt und gefestigt. In dem zur Kapelle umgeschaffenen Saalanbau, der, verstaubend und verfallend, längst wieder den Kapellencharakter abgestreift hatte und zu einem Vorratsraum für die kleinen Leute des Hauses geworden war, ging der alte Matthias um wie zu Lebzeiten und kniete vor dem Altar, den er gestiftet. Niemand im Hause zweifelte daran. Aber wenn auch ein einzelner den Spuk verneint und, sei es aus Glauben oder Unglauben, die Erscheinung als ein abergläubisch Gebilde verworfen hätte, so hätten doch andere Zeichen zu ihm gesprochen. Seit anderthalb hundert Jahren stand das Geschlecht auf zwei Augen; es sah darin einen Finger Gottes; zwei Brüder sollten nicht wieder in Waffen gegeneinanderstehen.
Die Dorfbewohner, wie kaum versichert zu werden braucht, hegten dies alles wie einen Schatz, und in den Spinnstuben wurde nichts eifriger verhandelt als die Frage, ob der alte Matthias gesehen worden sei oder nicht. Es war eine Art Ehrensache, ihn gesehen zu haben. Man scherzte über ihn und fürchtete sich. Die Bauern selbst waren nicht anders wie ihre Mägde. Auf dem Höhenzuge, dicht neben der Kirche, stand eine alte Buche, die teilte sich halbmannshoch über der Wurzel und wuchs in zwei Stämmen nach rechts und links. Das paßte den Hohen-Vietzern, und die Sage ging, daß beide Brüder, als sie noch Kinder waren, diesen Baum gemeinschaftlich gepflanzt hätten. Als aber Anselm von der Hand des jüngern gefallen sei, da habe sich der Stamm geteilt. Und noch andere wußten, daß Matthias, wenn er unten in der Kapelle gebetet, die große Nußbaumallee bis zur Kirche hinaufsteige und den Buchenstamm da, wo er sich teilt, zu umfassen und zusammenzupressen suche. Aber umsonst. Er sitze dann zu Füßen des Baumes und klage laut.
Aber wenn sich das nach dem Spukhaften und Schauerlichen drängende romantische Bedürfnis in diesen trüben Bildern mit Vorliebe aussprach, so drängte doch auch ein anderer Zug in den Herzen der Hohen-Vietzer ebenso entschieden auf endliche Versöhnung hin, und einen Reimspruch kannte jung und alt, der dieser Hoffnung auf Versöhnung Ausdruck gab. Auch im Herrenhause kannten sie ihn sehr wohl, und der Reimspruch lautete:
Und eine Prinzessin kommt ins Haus,
Da löscht ein Feuer den Blutfleck aus,
Der auseinander getane Stamm
Wird wieder eins, wächst wieder zusamm',
Und wieder von seinem alten Sitz
Blickt in den Morgen Haus Vitzewitz.
Drittes Kapitel
Weihnachtsmorgen
An Lewins Seele waren inzwischen unruhige Träume vorübergegangen. Die Fahrt im Ostwind hatte ihn fiebrig gemacht, und erst gegen Morgen verfiel er in einen festen Schlaf. Eine Stunde später begann es bereits im Hause lebendig zu werden; auf dem langen Korridor, an dessen Nordostecke Lewins Zimmer gelegen war, hallten Schritte auf und ab, schwere Holzkörbe wurden vor die Feuerstellen gesetzt und große Scheite von außen her in den Ofen geschoben. Bald darauf öffnete sich die Tür, und der alte Diener, der am Abend zuvor seinen jungen Herrn empfangen hatte, trat ein, einen Blaker in der Hand. Hektor blieb liegen, reckte sich auf dem Rehfell und wedelte nur, als ob er rapportieren wolle: Alles in Ordnung. Jeetze setzte das Licht, dessen Flamme er bis dahin mit seiner Rechten sorglich gehütet hatte, hinter einen Schirm und begann alles, was an Garderobestücken umherlag, über seinen linken Arm zu packen. Er selbst war noch im Morgenkostüm; zu den Samthosen und Gamaschen, ohne die er nicht wohl zu denken war, trug er einen Arbeitsrock von doppeltem Zwillich. Als er alles beisammen hatte, trat er, leise wie er gekommen war, seinen Rückzug an, dabei nach Art alter Leute unverständliche Worte vor sich hermurmelnd. An dem zustimmenden Nicken seines Kopfes aber ließ sich erkennen, daß er zufrieden und guter Laune war.
Die Türe blieb halb offen, und das erwachende Leben des Hauses drang in immer mahnenderen, aber auch in immer anheimelnderen Klängen in das wieder still gewordene Zimmer. Die großen Scheite Fichtenholz sprangen mit lautem Krach auseinander, von Zeit zu Zeit zischte das Wasser, das aus den naßgewordenen Stücken in kleinen Rinnen ins Feuer lief, und von der Korridornische her hörte man den sichern und regelrechten Strich, mit dem Jeetzes Bürste der Hacheln und Härchen, die nicht loslassen wollten, Herr zu werden suchte.
Alles das war hörbar genug, nur Lewin hörte es nicht. Endlich beschloß Hektor, der Ungeduld Jeetzes und seiner eigenen ein Ende zu machen, richtete sich auf, legte beide Vorderpfoten aufs Deckbett und fuhr mit seiner Zunge über die Stirn des Schlafenden hin, ohne weitere Sorge, ob seine Liebkosungen willkommen seien oder nicht. Lewin wachte auf; die erste Verwirrung wich einem heiteren Lachen. »Kusch dich, Hektor«, damit sprang er aus dem Bett. Der Morgenschlaf hatte ihn frisch gemacht; in wenig Minuten war er angekleidet, ein Vorteil halb soldatischer Erziehung. Er durchschritt ein paarmal das Zimmer, betrachtete lächelnd einen mit vier Nadeln an die Tischdecke festgesteckten Bogen Papier, auf dem in großen Buchstaben stand: »Willkommen in Hohen-Vietz«, ließ seine Augen über ein paar Silhouettenbilder gleiten, die er von Jugend auf kannte und doch immer wieder mit derselben Freudigkeit begrüßte, und trat dann an eines der zugefrorenen Eckfenster. Sein Hauch taute die Eisblumen fort, ein Fleckchen, nicht größer wie eine Glaslinse, wurde frei, und sein erster Blick fiel jetzt auf die eben aufgehende Weihnachtssonne, deren roter Ball hinter dem Turmknopf der Hohen-Vietzer Kirche stand. Zwischen ihm und dieser Kirche erhoben sich die Bäume des hügelansteigenden Parkes, phantastisch bereift, auf einzelnen ein paar Raben, die in die Sonne sahen und mit Gekreisch den Tag begrüßten.
Lewin freute sich noch des Bildes, als es an die Türe klopfte.
»Nur herein!«
Eine schlanke Mädchengestalt trat ein, und mit herzlichem Kuß schlossen sich die Geschwister in die Arme. Daß es Geschwister waren, zeigte der erste Blick: gleiche Figur und Haltung, dieselben ovalen Köpfe, vor allem dieselben Augen, aus denen Phantasie, Klugheit und Treue sprachen.
»Wie freue ich mich, dich wieder hier zu haben. Du bleibst doch über das Fest? Und wie gut du aussiehst, Lewin! Sie sagen, wir ähnelten uns; es wird mich noch eitel machen.«
Die Schwester, die bis dahin wie musternd vor dem Bruder gestanden hatte, legte jetzt ihren Arm in den seinen und fuhr dann, während beide auf der breiten Strohmatte des Zimmers auf- und abpromenierten, in ihrem Geplauder fort.
»Du glaubst nicht, Lewin, wie öde Tage wir jetzt haben. Seit einer Woche flog uns nichts wie Schneeflocken ins Haus.«
»Aber du hast doch den Papa...«
»Ja und nein. Ich hab' ihn und hab' ihn nicht; jedenfalls ist er nicht mehr, wie er war. Seine kleinen Aufmerksamkeiten bleiben aus; er hat kein Ohr mehr für mich, und wenn er es hat, so zwingt er sich und lächelt. Und an dem allen sind die Zeitungen schuld, die ich freilich auch nicht missen möchte. Kaum daß Hoppenmarieken in den Flur tritt und das Postpaket aus ihrem Kattuntuch wickelt, so ist es mit seiner Ruhe hin. Er geht an mir vorbei, ohne mich zu sehen. Briefe werden geschrieben; die Pferde kommen kaum noch aus dem Geschirr; zu Wagen und zu Schlitten geht es hierhin und dorthin. Oft sind wir tagelang allein. Ein Glück, daß ich Tante Schorlemmer habe, ich ängstigte mich sonst zu Tode.«
»Tante Schorlemmer! So findet alles seine Zeit.«
»Oh, sie braucht nicht erst ihre Zeit zu finden, sie hat immer ihre Zeit, das weiß niemand besser als du und ich. Aber freilich, eines ist meiner guten Schorlemmer nicht gegeben, einen öden Tag minder öde zu machen. Möchtest du, eingeschneit, einen Winter lang mit ihr und ihren Sprüchen am Spinnrad sitzen?«
»Nicht um die Welt. Aber wo bleibt der Pastor? Und wo bleibt Marie? Ist denn alles zerstoben und verflogen?«
»Nein, nein, sie sind da, und sie kommen auch und sind die alten noch; lieb und gut wie immer. Aber unsere Hohen-Vietzer Tage sind so lang und am längsten, wenn im Kalender die kürzesten stehen. Marie kommt übrigens heute abend; sie hat eben anfragen lassen.«
»Und wie geht es unserm Liebling?«
»In den drei Monaten, daß du nicht hier warst, ist sie voll herangewachsen. Sie ist wie ein Märchen. Wenn morgen eine goldene Kutsche bei Kniehases vorgefahren käme, um sie aus dem Schulzenhause mit zwei schleppentragenden Pagen abzuholen, ich würde mich nicht wundern. Und doch ängstigt sie mich. Aber je mehr ich mich um sie sorge, desto mehr liebe ich sie.«
Soweit waren die Geschwister in ihren Plaudereien gekommen, als Jeetze – nunmehr in voller Livree – in der Türe erschien, um seinen jungen Herrschaften anzukündigen, daß es Zeit sei.
»Wo ist Papa?«
»Er baut auf. Krist und ich haben zutragen müssen.«
»Und Tante Schorlemmer?«
»Ist im Flur. Die Singekinder sind eben gekommen.«
Lewin und Renate nickten einander zu und traten dann heiteren Gesichts und leichten Ganges, ein jeder stolz auf den andern, in den Korridor hinaus. In demselben Augenblick, wo sie an dem Treppenkopf angelangt waren, klang es weihnachtlich von hellen Kinderstimmen zu ihnen herauf. Und doch war es kein eigentliches Weihnachtslied. Es war das alte »Nun danket alle Gott«, das den märkischen Kehlen am geläufigsten ist und am freiesten aus ihrer Seele kommt. »Wie schön«, sagte Lewin und horchte, bis die erste Strophe zu Ende war.
Als die Geschwister im Niedersteigen den untersten Treppenabsatz erreicht hatten, hielten sie abermals und überblickten nun das Bild zu ihren Füßen. Die gewölbte Flurhalle, groß und geräumig, trotz der Eichenschränke, die umherstanden, war mit Menschen, jungen und alten, gefüllt; einige Mütterchen hockten auf der Treppe, deren unterste Stufen bis weit in den Flur hinein vorsprangen. Links, nach der Park- und Gartentür zu, standen die Kinder, einige sonntäglich geputzt, die anderen notdürftig gekleidet, hinter ihnen die Armen des Dorfes, auch Sieche und Krüppel; nach rechts hin aber hatte alles, was zum Hause gehörte, seine Aufstellung genommen: der Jäger, der Inspektor, der Maier, Krist und Jeetze, dazu die Mägde, der Mehrzahl nach jung und hübsch und alle gekleidet in die malerische Tracht dieser Gegenden, den roten Friesrock, das schwarzseidene Kopftuch und den geblümten Manchester-Spenzer. In Front dieser bunten Mädchengruppe gewahrte man eine ältliche Dame über fünfzig, graugekleidet mit weißem Tuch und kleiner Tüllhaube, die Hände gefaltet, den Kopf vorgebeugt, wie um dem Gesange der Kinder mit mehr Andacht folgen zu können. Es war Tante Schorlemmer. Nur als die Geschwister auf dem Treppenabsatz erschienen, unterbrach sie ihre Haltung und erwiderte Lewins Gruß mit einem freundlichen Nicken.
Nun war auch der zweite Vers gesungen, und die Weihnachtsbescherung an die Armen und Kinder des Dorfes, wie sie in diesem Hause seit alten Zeiten Sitte war, nahm ihren Anfang. Niemand drängte vor; jeder wußte, daß ihm das Seine werden würde. Die Kranken erhielten eine Suppe, die Krüppel ein Almosen, alle einen Festkuchen, an die Kinder aber traten die Mägde heran und schütteten ihnen Äpfel und Nüsse in die mitgebrachten Säcke und Taschen.
Das Gabenspenden war kaum zu Ende, als die große, vom Flur aus in die Halle führende Flügeltüre von innen her sich öffnete und ein heller Lichtschein in den bis dahin nur halb erleuchteten Flur drang. Damit war das Zeichen gegeben, daß nun dem Hause selber beschert werden solle. Der alte Vitzewitz trat zwischen Türe und Weihnachtsbaum, und Lewins ansichtig werdend, der am Arm der Schwester dem Festzug voraufschritt, rief er ihm zu: »Willkommen, Lewin, in Hohen-Vietz.« Vater und Sohn begrüßten sich herzlich; dann setzten die Geschwister ihren Umgang um die Tafel fort, während draußen im Flur die Kinder wieder anstimmten:
Lob, Ehr' und Preis sei Gott
Dem Vater und dem Sohne,
Und auch dem Heil'gen Geist
Im hohen Himmelsthrone.
Der Zug löste sich nun auf, und jeder trat an seinen Platz und seine Geschenke. Alles gefiel und erfreute, die Schals, die Westen, die seidenen Tücher. Da lagerte kein Unmut, keine Enttäuschung auf den Stirnen; jeder wußte, daß schwere Zeiten waren, und daß der viel heimgesuchte Herr von Hohen-Vietz sich mancher Entbehrung unterziehen mußte, um die gute Sitte des Hauses auch in bösen Tagen aufrechtzuerhalten.
Zu beiden Seiten des Kamins, über dessen breiter Marmorkonsole das überlebensgroße Bild des alten Matthias aufragte, waren auf kleinen Tischen die Gaben ausgebreitet, die der Vater für Lewin und Renaten gewählt hatte. Lieblingswünsche hatten ihre Erfüllung gefunden, sonst waren sie nicht reichlich. An Lewins Platz lag eine gezogene Doppelbüchse, Suhler Arbeit, sauber, leicht, fest, eine Freude für den Kenner.
»Das ist für dich, Lewin. Wir leben in wunderbaren Tagen. Und nun komm und laß uns plaudern.«
Beide traten in das nebenan gelegene Zimmer, während in der Halle die Weihnachtslichter niederbrannten.
Viertes Kapitel
Berndt von Vitzewitz
Der Vater Lewins war Berndt von Vitzewitz, ein hoher Fünfziger. Mit dreizehn Jahren bei den zu Landsberg garnisonierenden Knobelsdorff-Dragonern eingetreten, hatte er, nach beinahe dreißigjährigem Dienst, das Kommando des berühmten Regiments eben übernommen, als ihn im Frühjahr 1795 der Abschluß des Basler Friedens veranlaßte, seinen Abschied zu fordern. Voller Abscheu gegen die Pariser Schreckensmänner sah er in dem »Paktieren mit den Regiciden« ebenso eine Gefahr wie eine Erniedrigung Preußens. Er zog sich verstimmt nach Hohen-Vietz zurück. Vielleicht war es ein Ausdruck seiner Verstimmung, daß er es, wenigstens im geselligen Verkehr, vorzog, seinen militärischen Rang ignoriert und sich lediglich als Herr von Vitzewitz angesprochen zu sehen. Das Gut selbst war ihm schon sieben Jahre früher zugefallen, unmittelbar nach seiner Vermählung mit Madeleine von Dumoulin, der ältesten Tochter des Generallieutenants von Dumoulin, der bei Zorndorf, als jüngster Offizier in der Schwadron des Rittmeisters von Wakenitz, Wunder der Tapferkeit verrichtet und nach zweimaligem Durchbrechen der russischen Karrees den Pour le mérite auf dem Schlachtfelde empfangen hatte.
Madeleine von Dumoulin, groß, schlank, blond, eine typische Schönheit, wie so oft die Töchter des altfranzösischen Adels, war der Abgott ihres Gemahls. Und doch sah sie zu ihm hinauf; ohne Prätensionen, fast ohne Laune beugte sie sich vor der Überlegenheit seines Charakters. Die Geburt eines Sohnes, noch in der Garnisonstadt des Regiments, schuf ein gesteigertes Glück, das aus beider Augen noch lebhafter sprach, als ihnen, bald nach ihrer Übernahme von Hohen-Vietz, auch eine Tochter geboren wurde. Es war im Mai 1795, ein Frühlingsregen sprühte, und das Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen, ein Regenbogen, stand verheißungsvoll über dem alten Hause. Aber die Verheißung, wenn sie dem Kinde gelten mochte, galt nicht dem Vater. Ein Allerschmerzlichstes blieb auch ihm, wie so vielen seiner Ahnen, unerspart. Es traf ihn anders, aber nicht minder schwer.
Der Tag von Jena hatte über das Schicksal Preußens entschieden; elf Tage später hielten bereits angemeldete französische Offiziere vor dem Herrenhause in Hohen-Vietz, zu deren Bewillkommnung, um nicht Anstoß zu geben, auch die kaum von einem hitzigen Fieber wiederhergestellte, noch die Blässe der Krankheit zeigende Dame vom Hause erschienen war. In der Halle war gedeckt. Frau von Vitzewitz blieb und schien ihren Zweck, ein leidliches Einvernehmen zwischen Wirt und Gästen herzustellen, erreichen zu sollen, als sich, während schon der Nachtisch aufgetragen wurde, ein ihr gegenübersitzender Kapitän von der spanischen Grenze, olivenfarbig, mit dünnem Spitzbart, erhob und in unziemlichster Huldigung Worte lallte, die der schönen Frau das Blut in die Wangen trieben. Berndt von Vitzewitz fuhr auf den Elenden ein, andere Offiziere, dazwischen springend, trennten die miteinander Ringenden, und Partei ergreifend für den beleidigten Gemahl, steckten sie draußen im Park den Platz ab, wo der Handel auf der Stelle ausgemacht werden sollte. Berndt, ein Meister auf den Degen, verwundete seinen Gegner schwer am Kopf, und die Franzosen, in der ihnen eigenen ritterlichen Gesinnung, beglückwünschten ihn, ohne die geringste Verstimmung zu zeigen, zu seinem Triumph. Aber es war ein kurzer Sieg, zum mindesten ein teuer erkaufter. Die heftigen, von solchen Vorgängen unzertrennlichen Erregungen warfen die schöne Frau aufs Krankenbett zurück, am dritten Tag war sie aufgegeben, am neunten trugen sie sie die alte Nußbaumallee hinauf, bis an die Hohen-Vietzer Kirche, und senkten sie unter Innehaltung aller von ihr gegebenen Bestimmungen ein. Nicht in die Gruft, sondern in »Gottes märkische Erde«, wie sie so oft gebeten hatte. Die Glocken klangen den ganzen Tag ins Land, und als der Frühling kam, lag ein Stein auf der Grabesstelle, ohne Namen, ohne Datum, nur tief eingegraben: »Hier ruht mein Glück.«
Berndts Charakter hatte sich unter diesen Schlägen aus dem Ernsten völlig ins Finstere gewandelt. Die Lage des zerbröckelten, nahezu aus der Reihe der Staaten gestrichenen Vaterlandes war nicht dazu angetan, ihn aufzurichten. Sein eigner Besitz entwertet, die Ernten geraubt, das Gehöft von Räuberhänden halb niedergebrannt – so verfiel er auf Jahr und Tag in brütenden Trübsinn und lebte erst wieder auf, als Sorge und Mißgeschick, die beinahe unausgesetzt auf ihn eindrangen, einen großen Haß in ihm gezeitigt hatten. Er wurde rührig, regsam, er hatte Ziele, er lebte wieder.
Der Haß, dem er dieses dankte, richtete sich gegen alles, was von jenseits des Rheines kam, aber doch war ein Unterschied in dem, was er gegen den Machthaber und gegen die französische Nation empfand. Für diese letztere, deren Mut, Begeisterung und Opferfähigkeit er so oft gepriesen, so oft vorbildlich hingestellt hatte, hatte er, wie fast alle Märker, im tiefsten Herzen eine nicht zu ertötende Vorliebe, und aller Haß, den er dieser Liebe zum Trotz stark und ehrlich zur Schau trug, war viel mehr Absicht und Kalkül als unmittelbare Empfindung, emporgewachsen aus der unablässigen, mit Geflissentlichkeit gehegten Betrachtung, daß – um ihn selber sprechen zu lassen – »das undankbarste aller Völker einen guten König geschlachtet habe, um sich vor den Triumphwagen eines freiheitsmörderischen Tyrannen zu spannen«. Ganz anders sein Haß gegen den Bonaparte selbst. Ungemacht und ungekünstelt sprang er wie ein heißer Quell aus seinem Herzen. Schon der Name widerte ihn an. Er war kein Franzos', er war Italiener, Korse, aufgewachsen an jener einzigen Stelle in Europa, wo noch die Blutrache Sitte und Gesetz; und selbst die Größe, die er ihm zugestehen mußte, war ihm staunens-, aber nicht bewundernswert, weil sie alles himmlischen Lichtes entbehrte. Er sah in ihm einen Dämon, nichts weiter; eine Geißel, einen Würger, einen aus Westen kommenden Dschingiskhan. Als Mitte November bekannt wurde, daß der Kaiser Küstrin passieren werde, um bis an die Weichsel zu gehen, führte Berndt seine beiden halberwachsenen Kinder – Renate zählte elf, Lewin eben sechzehn Jahre – nach der alten Oderfestung und nahm Stand an dem Müncheberger Tore, um ihnen den zu zeigen, »den Gott gezeichnet habe«. Und als dieser nun unter dem gewölbten Portal hin in die stille Stadt einritt und das gelbe Wachsgesicht wie ein unheimlicher Lichtpunkt zwischen dem Bug des Pferdes und dem tief in die Stirn gerückten Hute sichtbar wurde, da schob er die Kinder in die vorderste Reihe und rief ihnen vernehmlich zu: »Seht scharf hin, das ist der Böseste auf Erden.«
Aber wer zu hassen versteht, so es nur der rechte Haß ist, der weiß auch zu lieben, und die leidenschaftliche Zuneigung, die Berndt so viele Jahre lang gegen die zu früh Heimgegangene als sein höchstes irdisches Glück im Herzen getragen hatte, er übertrug sie jetzt auf die Kinder, die als die Ebenbilder der Mutter heranwuchsen. Schlank aufgeschossen, blond und durchsichtig, wichen sie in jedem Zuge von der äußeren Erscheinung des Vaters ab, zu dessen gedrungener Gestalt sich dunkelster Teint und ein schwarzes, kurzgeschnittenes, mit nur wenig Grau erst untermischtes Haar gesellte. Und wie verschieden die Erscheinung, so verschieden auch waren die Charaktere. Leichtbeweglich und leichtgläubig, immer geneigt, zu bewundern und zu verzeihen, hatten die Kinder das heitere Licht der Seele, wo der Vater das düstere Feuer hatte. Demütig und trostreich, angelegt um zu beglücken und glücklich zu sein, leuchtete ihren Wegen die alles verklärende Phantasie. Der Vater freute sich dessen. Er träumte von einer Wandlung, die mit ihnen über das Haus kommen werde.
Berndt von Vitzewitz, wie alle, die ihr Herz an etwas setzen, machte wenig davon; er hatte das Schamgefühl der Liebe. Aber ebensowenig gefiel er sich darin, eine rauhe Außenseite herauszukehren. Weil er Autorität hatte, durfte er darauf verzichten, sie jeden Augenblick geltend zu machen. Er liebte es, im Gespräch den Unterschied der Jahre zu überspringen und bespöttelte jene Väter und Mütter, die, aus der Not eine Tugend machend, ihre Gefühls- und Gedankenwelt in zwei Rubriken, in eine für die »Intimen« und in eine andere für die Kinder bestimmte Hälfte, zu teilen pflegen. Er war offen, entgegenkommend gegen Lewin, reich an Aufmerksamkeiten gegen Renate. Nur in den letzten Wochen, wie die Schwester dem Bruder bereits geklagt hatte, war eine Änderung eingetreten; er mied jede Begegnung, sprach wenig und saß halbe Nächte lang, wenn ihn nicht Besuche in die Umgegend führten, an seinem Schreibtisch oder durchschritt im Selbstgespräch das einfensterige Kabinett, das sein Arbeitszimmer bildete.
Das Arbeitszimmer war ebenso tief wie schmal, so daß die gelben, von Tabak- und Lampenrauch längst grau gewordenen Wände, bei dem wenigen Licht, das einfiel, noch dunkler erschienen, als sie waren. Von Luxus keine Spur. Nur für Bequemlichkeit war gesorgt, für jenes Alles-zur-Hand-Haben geistig beschäftigter Männer, denen nichts unerträglicher ist, als erst holen, suchen oder gar warten zu müssen. Die beiden Türen des Kabinetts, von denen die eine nach der Halle, die andere nach dem Damenzimmer führte, lagen dem Fenster zu, wodurch zwei breite Wandflächen zur Aufstellung eines Schreibtisches und eines Ledersofas, beide von beträchtlicher Länge, gewonnen waren. Ein dazwischenstehender gartenstuhlartiger Holzschemel würde die Kommunikation vollständig geschlossen haben, wenn nicht die Tischplatte eine entsprechende Einbuchtung gehabt hätte. Über dem Schreibtisch hing ein schönes Frauenporträt, Brustbild, nachgedunkelt, über dem Sofa ein schmaler, länglicher Spiegel, dessen völlig verblaktes Glas über seine Nutzlosigkeit an dieser Stelle keinen Zweifel ließ. Ein Schlüsselbrett, dazu zwei, drei Hirschgeweihe, mit allerhand Mützen und Hüten daran, vollendeten die Einrichtung. In den Ecken standen Stöcke umher, eine Entenflinte und ein Kavalleriedegen, während an den Paneelen der Fensternische mehrere Spezialkarten von Rußland, mit Oblaten und Nägelchen, je nachdem es sich am bequemsten gemacht hatte, befestigt waren. Zahllose rote Punkte und Linien zeigten deutlich, daß mit dem Zeitungsblatt in der Hand zwischen Smolensk und Moskau bereits viel hin- und hergereist worden war.
Dies war das Zimmer, in das, wie am Schlusse des vorigen Kapitels erzählt, Vater und Sohn eintraten. Beide nahmen auf dem Sofa Platz, gegenüber dem Frauenporträt, das jetzt auf sie niedersah. Berndt, der in seinem gewöhnlichen Hauskostüm war: weite Beinkleider von schottischem Stoff, dunkler Samtrock, dazu ein rotseidenes Tuch leicht um den Hals geschlungen, streckte den rechten Fuß auf ein hohes, tabouretartiges Doppelkissen. Lewin, aus Respekt und Gewöhnung, saß gerade aufrecht neben ihm.
»Nun, was gibt es, Lewin, was bringst du?«
»Vielleicht eine Neuigkeit. Morgen werden unsere Blätter das Bulletin bringen, das die Vernichtung des Heeres zugesteht. Ladalinskis hatten den französischen Text; Kathinka las uns die Hauptstellen vor. Es hat mich erschüttert.«
»Auch mich, aber noch mehr hat es mich erhoben.«
»So kennst du schon den Inhalt? Und ich komme wieder zu spät.«
»Tante Amelie empfing den Zeitungsausschnitt schon gestern; du kennst ihre alten Beziehungen. Graf Drosselstein, der gestern bei ihr war, erbot sich, mir persönlich die Nachricht zu bringen. Wir haben wohl eine Stunde geplaudert. Und glaube mir, das Bulletin sagt nicht die Hälfte. Wir haben Briefe aus Minsk und Bialystock; sie sind total vernichtet.«
»Welch ein Gericht!«
»Ja, Lewin, du sprichst das Wort. Die große Hand, die beim Gastmahl des Belsazar war, hat wieder ihre Zeichen geschrieben und diesmal keine Rätselzeichen. Jeder kann sie lesen: ›Gezählt, gewogen und hinweggetan.‹ Ein Gottesgericht hat ihn verworfen. Und doch fürchte ich, Lewin, wir haben Neunmalweise am Ruder, die dem zornigen Gott in den Arm fallen wollen. Sie dürfen es nicht. Wagen sie es, so sind sie verloren, sie und wir. – Wie ist die Stimmung?«
»Gut. Es ist mir, als wäre eine Wandlung über die Gemüter gekommen. Das ganze Fühlen ist ein höheres; wo noch Niedrigkeit der Gesinnung ist, da wagt sie sich nicht hervor. Was fehlt, ist eins: ein leitender Wille, ein entschlußkräftiges Wort.«
»Das Wort muß gesprochen werden, so oder so. Wenn die Menschen stumm sind, so schreien es die Steine. Gott will es, daß wir seine Zeichen verstehen. Lewin, wir alle sind hier entschlossen. Wir alle stehen hier des Wortes gewärtig; wird es nicht gesprochen, so folgen wir dem lauten Wort, das in uns klingt. Es begräbt sich leicht im Schnee. Nur kein feiges Mitleid. Jetzt oder nie. Nicht viele werden den Njemen überschreiten, über die Oder darf keiner.«
Lewin schwieg eine Weile; er mied es, dem Blick des Vaters zu begegnen. Dann sprach er halb vor sich hin: »Wir sind die Verbündeten des Kaisers. Wir wollen das Bündnis lösen, Gott gebe es, aber –«
»So mißbilligst du, was wir vorhaben?«
»Ich kann nicht anders. Das, was du vorhast, und was Tausende der Besten wollen, es ist gegen meine Natur. Ich habe kein Herz für das, was sie jetzt mit Stolz und Bewunderung die spanische Kriegsführung nennen. Alles, was von hintenher sein Opfer faßt, ist mir verhaßt. Ich bin für offenen Kampf, bei hellem Sonnenschein und schmetternden Trompeten. Wie oft habe ich in Entzücken geweint, wenn ich auf der Fußbank neben Mama saß und sie von ihrem Vater erzählte, wie er, kaum achtzehnjährig, in die russischen Vierecke einbrach und wie dann Rittmeister von Wakenitz vor der Schwadron ihn küßte und ihm zurief: ›Junker von Dumoulin, lassen Sie uns die Degen tauschen.‹ Ja, ich will Krieg führen, aber deutsch, nicht spanisch, auch nicht slawisch. Du weißt, Papa, ich bin meiner Mutter Sohn.«
»Das bist du, und ein Glück, daß du es bist. Über deiner Mutter Kindheit haben helle Sterne gestanden, und ich bitte Gott, daß der Segen ihres Hauses über dir und über Renaten sei.«
Lewin sah wieder vor sich hin. Berndt von Vitzewitz aber fuhr fort: »Ich weiß, was eine Natur zu bedeuten hat; alles An- und Eingeborene, das nicht gegen die Gebote Gottes streitet, ist mir heilig; gehe deinen Weg, Lewin, ich zwinge dich in nichts. Aber ich, in stillen Nächten habe ich mir's geschworen, ich will den meinen gehen!«
Eine kurze Pause folgte, während welcher Berndt in dem schmalen Zimmer auf- und niederschritt. Dann, ohne des Schweigens zu achten, in dem Lewin verharrte, sprach er weiter: »Ihr in den Städten – und du bist ein Stadtkind geworden, Lewin –, ihr wißt es nicht, ihr habt es nicht recht erlebt. Unter den Augen der Machthaber nahm die Unterdrückung Maß und das Ungesetzliche gesetzliche Formen an. Sie rühmen sich dessen sogar und glauben es beinahe selbst, daß sie unsere Ketten gebrochen haben. Aber wir auf dem Lande, wir wissen es besser, und ich sage dir, Lewin, die rote Hand, die Feuer an die Scheunen legte, die die Goldringe von den Fingern unserer Toten zog, sie ist unvergessen hier herum, und eine rötere Hand wird ihr Antwort geben.«
Lewin wollte dem Vater antworten; aber dieser, die Heftigkeit seiner Rede plötzlich umstimmend, fuhr mit ersichtlicher Bewegung fort: »Du warst noch ein Knabe, als der böse Feind ins Land kam; der Glanz seiner Taten ging vor ihm her. Was er damals im Übermut seines Glückes unsere Königin zu fragen sich erdreistete: ›Wie mochten Sie's nur wagen, den Kampf gegen mich aufzunehmen?‹, diese Frage ist seitdem von tausend Schwachen und Elenden im Lande selber nachgesprochen worden, als ob sie das A und das O aller Weisheit wäre. Und in dieser Vorstellung unserer Ohnmacht bist du herangewachsen, du und Renate. Ihr habt nichts gesehen als unsere Kleinheit, und ihr habt nichts gehört als die Größe unseres Siegers. Aber, Lewin, es war einst anders, und wir Alten, die wir noch das Auge des Großen Königs gesehen haben, wir schmecken bitter den Kelch der Niedrigkeit, der jetzt täglich an unseren Lippen ist.«
»Und ich bin es sicher«, fiel jetzt Lewin ein, »er wird von uns genommen werden. Wir werden einen frohen, einen heiligen Krieg haben. Aber zunächst sind wir unseres Feindes Freund, wir haben mit und neben ihm in Waffen gestanden; er rechnet auf uns, er schleppt sich unserer Türe zu, hoffnungsvoll wie der Schwelle seines eigenen Hauses; das Licht, das er schimmern sieht, bedeutet ihm Rettung, Leben, und an der Schwelle eben dieses Hauses faßt ihn unsere Hand und würgt den Wehrlosen.«
In diesem Augenblick begannen die Glocken zu klingen, die von dem alten Hohen-Vietzer Turm her zur Kirche riefen. Sie klangen laut und voll in dem klaren Wetter. Berndt horchte auf; dann mit der Hand nach Osten deutend, von wo die Klänge herüberhallten, fuhr er seinerseits fort: »Ich weiß, daß geschrieben steht: ›die Rache ist mein‹, und in menschlicher Gebrechlichkeit, das weiß der, der in die Herzen sieht, bin ich allezeit seinem Wort gefolgt. Ich fürchte nicht, daß ich lästere, wenn ich ausspreche: Es gibt auch eine heilige Rache. So war es, als Simson die Tempelpfosten faßte und sich und seine Feinde unter Trümmern begrub. Vielleicht, daß auch unsere Rache nichts anderes wird als ein gemeinschaftliches Grab. Sei's drum; ich habe abgeschlossen; ich setze mein Leben daran, und, Gott sei Dank, ich darf es. Diese Hand, wenn ich sie aufhebe, so erhebe ich sie nicht, um persönliche Unbill zu rächen, nein, ich erhebe sie gegen den bösen Feind aller Menschheit, und weil ich ihn selber nicht treffen kann, so zerbreche ich seine Waffe, wo ich sie finde. Der große Schuldige reißt viel Unschuldige mit in sein Verhängnis; wir können nicht sichten und sondern. Das Netz ist ausgespannt, und je mehr sich darin verfangen, desto besser. Wir sprechen weiter davon, Lewin. Jetzt ist Kirchzeit. Laß uns Gottes Wort nicht versäumen. Wir bedürfen seiner.«
So trennten sie sich, als die Glocken zum zweitenmal ihr Geläut begannen.
Fünftes Kapitel
In der Kirche
Das Summen der Glocken war noch in der Luft, als Berndt von Vitzewitz, Renaten am Arm, aus einem in den Schnee gefegten Fußsteig in die große Nußbaumallee einbog, die, leise ansteigend, von der Einfahrt des Herrenhauses her in gerader Linie zur Hügelkirche hinaufführte. Dem voraufschreitenden Paare folgten Lewin und Tante Schorlemmer. Alle waren winterlich gekleidet; die Hände der Damen steckten in schneeweißen Grönlandsmuffen; nur Lewin, alles Pelzwerk verschmähend, trug einen hellgrauen Mantel mit weitem Überfallkragen.
Die mehrgenannte Hügelkirche, der sie zuschritten, war ein alter Feldsteinbau aus der ersten christlichen Zeit, aus den Kolonisationstagen der Zisterzienser her; dafür sprachen die sauber behauenen Steine, die Chornische und vor allem die kleinen hochgelegenen Rundbogenfenster, die dieser Kirche, wie allen vorgotischen Gotteshäusern der Mark, den Charakter einer Burg gaben. Wenig hatten die Jahrhunderte daran geändert. Einige Fenster waren verbreitert, ein paar Seiteneingänge für den Geistlichen und die Gutsherrschaft hergerichtet worden; sonst, mit Ausnahme des Turmes und eines neuen Gruftanbaues der nördlichen Langwand, stand alles, wie es zu den Mönchszeiten gestanden hatte.
War nun aber das Äußere der Kirche so gut wie unverändert geblieben, so hatte das Innere derselben alle Wandlungen eines halben Jahrtausends durchgemacht. Von den Tagen an, wo die Askanier hier ihre regelmäßig wiederkehrenden Fehden mit den Pommerherzögen ausfochten, bis auf die Tage herab, wo der Große König an ebendieser Stelle, bei Zorndorf und Kunersdorf, seine blutigsten Schlachten schlug, war an der Hohen-Vietzer Kirche kein Jahrhundert vorübergegangen, das ihr nicht in ihrer inneren Erscheinung Abbruch oder Vorschub geleistet, ihr nicht das eine oder andere gegeben oder genommen hätte.
Ein gleiches, was hier eingeschaltet werden mag, gilt von der Mehrzahl aller alten märkischen Dorfkirchen, die dadurch ihren Reiz und ihre Eigentümlichkeit empfangen. Besonders im Gegensatz zu den weltlichen oder Profan-Bauten unseres Landes. Überblickt man diese, so nimmt man alsbald wahr, daß die eine Gruppe zwar die Jahre, aber keine Geschichte, die andere Gruppe zwar die Geschichte, aber keine Jahre hat. Burg Soltwedel ist uralt, aber schweigt. Schloß Sanssouci spricht, aber ist jung wie ein Parvenü. Nur unsere Dorfkirchen stellen sich uns vielfach als die Träger unserer ganzen Geschichte dar, und die Berührung der Jahrhunderte untereinander zur Erscheinung bringend, besitzen und äußern sie den Zauber historischer Kontinuität.