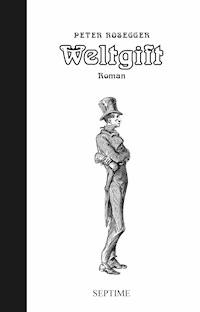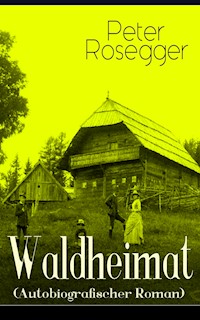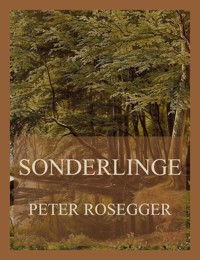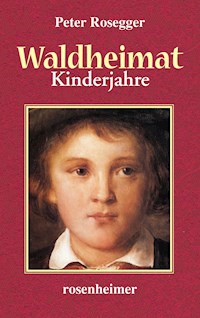
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Kindeszeit und Kindesheim. Es ist das alte Lied vom Paradies. Es ist eine wunderbare Eigenschaft unserer Seele, dass wir vergangenes Ungemach unschwer zu vergessen pflegen, während das längst verblühte Schöne und Angenehme der Erinnerung treu bleibt. 'Waldheimat' nenne ich mein Buch, weil mir dieser Begriff am besten die Zustände und Geschehnisse zu begründen und zu erklären scheint, von denen hier die Rede sein wird. Die Dinge möge man auf meine Person beziehen oder auch nicht. Die Erzählungen wollen zu jener Gattung von Wahrheit gehören, welche allgemein ist und durch den Mund des Poeten bedeutsamer wird."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2003
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: Franz v. Defregger: »Porträt eines Buben« (Ausschnitt)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54673-0 (epub)
Worum geht es im Buch?
Peter Rosegger
Waldheimat – Kinderjahre
„Kindeszeit und Kindesheim. Es ist das alte Lied vom Paradies. Es ist eine wunderbare Eigenschaft unserer Seele, dass wir vergangenes Ungemach unschwer zu vergessen pflegen, während das längst verblühte Schöne und Angenehme der Erinnerung treu bleibt. ’Waldheimat‘ nenne ich mein Buch, weil mir dieser Begriff am besten die Zustände und Geschehnisse zu begründen und zu erklären scheint, von denen hier die Rede sein wird. Die Dinge möge man auf meine Person beziehen oder auch nicht. Die Erzählungen wollen zu jener Gattung von Wahrheit gehören, welche allgemein ist und durch den Mund des Poeten bedeutsamer wird.“
Inhalt
Vorwort
Als Großvater freien ging
Vom Urgroßvater, der auf der Tanne saß
Meine Aja
Was bei den Sternen war
Ums Vaterwort
Allerlei Spielzeug
Wie der Meisen-Sepp gestorben ist
Auf der Wacht
Wie ich dem lieben Herrgott mein Sonntagsjöppel schenkte
Wie das Zicklein starb
Dreihundertvierundsechzig und eine Nacht
Geschichten vom lieben Mond
Auf bösen Wegen
Am Tage, da die Ahne fort war
Als ich Bettelbub gewesen
Weg nach Maria Zell
Als ich der Müller war
Als ich zur Drachenbinderin ritt
Als ich im Walde beim Käthele war
Als dem kleinen Maxel des Haus niederbrannte
Als die hellen Nächte waren
Als ich das erste Mal auf dem Dampfwagen saß
Als ich mir die Welt am Himmel baute
Als ich den Kaiser Josef suchte
Als der Kaiser die Kaiserin nahm
Wie der Hartl an einem Tage die Sonne zwei Mal aufgehen sah
Beim lieben Vieh
Wie wir die Gürtelsprenge haben gehalten
Mitten unter Sündern
Als ich die erste Schlacht gesehen
Als ich zum Pfluge kam
Vorwort
Kindeszeit und Kindesheim!
Es ist das alte Lied vom Paradiese. Es gibt Gemüter, denen dieses Paradies nimmer verloren ist, und wäre auch längst die Stirne gefurcht vor Sorgen, das Haar gebleicht vor Alter; in denen das Reich Gottes fortwährt und in der Erinnerung noch reiner und herrlicher ersteht, als es in der Wirklichkeit je sein konnte; aber Kinder sind Poeten und – umgekehrt. Es ist eine wunderbare Eigenschaft unserer Seele – eine Spur der Göttlichkeit –, dass wir in der Regel vergangenes Ungemach unschwer zu vergessen pflegen, während das längst verblühte Schöne und Angenehme der Erinnerungen treu bleibt und also abgesondert von den Schlacken der Alltäglichkeit eine ideale, unvergängliche Welt in uns aufbaut.
Wir nennen jene Menschen zwar Träumer, in denen die Vergangenheit eine größere Rolle spielt als die Gegenwart, ja, als die Pläne und Hoffnungen für die Zukunft. Die Vergangenheit ist abgeschlossen und fertig, sie steht uns als ein Ganzes gegenüber. Sie ist ein Traum, und doch sage ich, sie ist das reellste Gut, weil es unwandelbar ist und nicht verloren sein kann, so lange die Seele lebt.
Wenn ich in diesem Buche von Kindes- und Jugendtagen des Waldbauernbuben erzähle, so möge man die Dinge auf meine Person beziehen oder auch nicht. Die Erzählungen dieses Buches wollen zu jener Gattung von Wahrheit gehören, welche allgemein ist und die durch den Mund des Poeten bedeutsamer wird. Grundlage meiner Schrift sind die Verhältnisse, die in jener Gegend bestanden und zum kleinen Teile noch bestehen, und ferner die Zufälle und Ereignisse, die in mein eigenes Leben oder in das meiner Verwandten hereinspielten. Schon mancher Kopf ist darüber geschüttelt worden, wieso ich in meiner Bauernhütte all die verschiedenen Zustände und Sitten und die vielen wunderlichen Kerle kennen gelernt hätte und ob denn alles so bei der Hand gewesen oder von allen Seiten herbeigekommen wäre, um sich von mir beschreiben zu lassen? Die Frage ist sehr gerechtfertigt, denn in einer entlegenen Waldbauernhütte kann ein blöder Junge nicht viel Volksstudien gemacht haben. Als ich zu einem Schneidermeister in die Lehre kam, da erst eröffnete sich mir die Bauernwelt. Die Bauernhandwerker, als der Schuster, der Schneider, der Weber, der Fassbinder usw., sind in vielen Alpengegenden eine Art von Nomadenvolk. Sie haben wohl irgendeine bestimmte Wohnung, entweder im eigenen Häuschen oder in der gemieteten Stube eines Bauernhofes, wo ihre Familie lebt, wo sie ihre Habseligkeiten bergen und wo sie ihre Sonn- und Feiertage zubringen; am Montagsmorgen aber nehmen sie ihr Werkzeug auf den Rücken oder in die Seitentasche und gehen auf die Ster, d. h. sie gehen auf Arbeit aus und heimen sich im Bauernhause, wohin sie bestellt sind, für so lange ein, bis sie die bestimmte Arbeit, den Hausbedarf, verfertigt haben. Dann wandern sie wieder zu einem anderen Hofe. Der Handwerker wird in seinem Sterhause wie zur Familie gehörig betrachtet und ist in wenigen Tagen eingeweiht in die Verhältnisse, Eigenarten und Geheimnisse des Hauses.
Ich habe im Laufe meiner vier Schneiderjahre in siebenundsechzig verschiedenen Häusern gearbeitet, und zwar in den oberen Gegenden des Mürztals und im so genannten Jackelland. Das war meine Hochschule, in der ich das Bauerntum im Großen und Einzelnen kennen lernte. Und so habe ich hier den »Kindesjahren« die »Lehrjahre« beigefügt, in denen ich von den Erfahrungen in meinem Handwerkerleben erzähle. Gehört ja doch auch dieses ganz und gar meiner Waldheimat an.
»Waldheimat« nenne ich mein Buch, weil mir dieser Begriff am besten die Zustände und Geschehnisse zu begründen und zu erklären scheint, von denen hier die Rede sein wird. Es ist ja ein wunderliches Seelenleben, welches sich in dem Schatten der Tannenwälder, in den tauigen Wiesentälern und auf den stillen Hochmatten entwickelt. Was war ich für ein Schwärmer für Gott und seinen Himmel, für alles Geheimnisvolle und Unbegreifliche! Und wie bin ich so weltdurstig gewesen, dass, da ich doch nicht hinaus konnte in die große, ich mir eine eigene kleine Welt schuf. Sie ist auch darnach geworden. Der Ernst ward zum Spiel und das Spiel zum Leben, und an jedem Ereignisse, das geschah, und an jedem Menschen, den ich kannte, hing ein Stück meines kindischen Herzens. Als endlich noch die Jahre dazukamen, in denen der heiße Funke beginnt zu glimmen, wurde die Unruhe noch größer. – Es wird anderen auch so ergehen. – Lange tat ich, wie es der Brauch war, bis ich plötzlich aus dem Kreise sprang. Jauchzend flog ich in die Welt, voll jener Sehnsucht, die mich heute wieder zurückzieht in den Wald.
– – ’s ist lange vorbei. Das Nest unter den Fichten ist verwüstet worden von dem Geier des bösen Geschickes. Fremde Bewohner waren in dasselbe gezogen und hatten ihre Not darin gelitten. Es war, als hätte die Drangsal auf immer währende Zeiten Besitz ergriffen von dem Waldhause.
Möge der alte Bau auf der Bergeshöhe endlich zerfallen. Mögen die Auen, auf denen der Waldbauernbub die Schafe geweidet, die Felder, über welche er den Pflug geleitet – die Gründe all’, die durchdrungen sind von dem Schweiße des Vaters und der Träne der Mutter – mögen sie in wenigen Jahren überwoben sein mit dem grünen, heiligen Schleier des Waldes. Der liebe, lachende Frieden wird sein, Eichhörnchen, Rehe und Hirsche werden wohnen in der Waldheimat; Finken und Amseln, Spatzen und Lerchen und allerlei fröhliche Vögel werden das Gewipfel beleben.
Und so wird es nach mir dort sein, wie es lange vor mir gewesen ist.
Der Verfasser
Als Großvater freien ging
Beim Kreuzwirt auf der Höh’ saßen sie um den großen Tisch herum: Fuhrleute von oben und unten, Gewerbsleute von Pöllau und Vorau, Holzarbeiter vom Rabenwald und Masenberg, Grenzwächter von der ungarischen Markung.
Mein armer Großvater, der Waldbauer von Alpel, war auch unter ihnen. Er war damals eigentlich noch lange nicht mein Großvater, und ihm war sie noch voll und rund, die Welt, die später jedes Mal ein Loch bekam, so oft das schlimme, tollwitzige Enkelein nicht bei ihm war. So geht’s auf der Welt, man meint in jungen Jahren, man hätte es fertig mit allem und ahnt nicht, welche Herzensgewalten noch in der Zukunft schlummern.
Und dass ich denn erzähle. Mein Großvater – Natz –, Natz, wie er eigentlich hieß … nein, da ich einmal da bin, so will ich ihn doch lieber Großvater heißen schon in seiner Jugendzeit – mein Großvater also ging damals gerade »im Heiraten um«. Immer war er auf dem Viehhandel aus, oder im Mostkaufen, oder im Wallfahrten, oder in diesem und jenem – und keinem Menschen sagte er’s, warum er eigentlich wanderte. Der hübschen Mägdlein und jungen Witwen gab es genug im Lande; mancher Bauer sagte, er gebe auch eine gute Aussteuer mit, bevor man noch wusste, dass er eine heiratsfähige Tochter habe. Aber mein Großvater war einer von denen, die nach etwas anderem gucken. Er hatte den Glauben, für jeden Mann gebe es nur ein Weib auf der Welt, und es käme für den Heiratslustigen darauf an, dasselbe aus allen anderen lächelnden und winkenden Weibern herauszufinden. Er hat nach jahrelanger Suche schließlich die Rechte und Einzige gefunden, aber nicht in der weiten Welt draußen, sondern ganz nahe – zehn Minuten seitab von seinem Vaterhause. Dort war sie eines Sonntags im langen Heidebeerkraut herumgegangen, um für ihre Mutter frische Beeren zu sammeln. Das Lockenköpfchen und vom Busen ein erklecklicher Teil ragte hervor, alles andere stak im Kraut.
Mein Großvater lugte ihr durch das Gezweige des Dickichts zu, sprach sie aber nicht an. Und als sie fort war, schlich auch er davon und dachte: Jetzt geh’ ich morgen noch einmal in die Pöllauergegend hinab, und wenn mir keine Gescheite (hier so viel als Passende) unterkommt, so lass ich’s gut sein und nimm die da.
So war er noch einmal in der Pöllauergegend gewesen. Und dort hatte er richtig eine aufgetrieben, die reicher und feiner war als das Mädel im Heidekraut; aber gar zu gerngebig. Das freute ihn wohl für den Augenblick, doch ließ er’s dabei bewenden; eine Häusliche wollte er haben, und er lenkte seine Schritte heimwärts – der Sparsameren zu.
Und da war’s unterwegs, dass er beim Kreuzwirt auf der Höh’ einkehrte. Er saß anfangs abseits beim Ofenbanktischchen, trank ein Glas Apfelmost und biss ein Stück schwarzes Brot dazu. Seine Gedanken hatte er – wie alle Freiersleute – nicht beisammen; seine Ohren nahmen wohl teil an dem lebhaften Gespräche der gemischten Gesellschaft, die um den großen Tisch saß und Wein trank. Die Grenzwächter hatten draußen in der Holzhauerhütte schwer verpönten ungarischen Tabak gefunden und wollten demnach den Eigner desselben mit sich fort zum Gerichte führen. Da kamen jedoch andere Männer des Waldes herbei, und mit gehobenen Knütteln stellten sie den Grenzwächtern die Wahl, was ihnen lieber wäre: Prügel oder zehn Maß beim Kreuzwirt, denn mit dem Schergengeschäft wär’s diesmal nichts. Wollten die Überreiter, wie man die Grenzer nannte, sofort zu ihren Gewehren greifen; diese waren aber jählings in den Händen der Holzhauer – sonach wählten sie von den beiden verfügbaren Dingen die zehn Maß Wein beim Kreuzwirt. Nun saßen die Grenzwächter lustig unter den lustigen Zechern, hielten Bruderschaft mit den Waldleuten und Fuhrmännern und stopften schließlich ihre Pfeifen mit jenem Tabak, den sie in der Holzhauerhütte in Beschlag genommen hatten.
Zum Kartenspielen kam’s, und viel Silbergeld kollerte auf dem Tisch herum. Einer der Holzhauer, ein schielendes, weißhaariges Männlein, war nicht glücklich; sein bocklederner Beutel, der manchen gewichtigen, schrillenden Fall auf den Tisch getan hatte, der immer tiefer umgestülpt werden musste, bis die dürren, gierigen Finger auf sein silbernes Eingeweide kamen – der Beutel gab endlich nichts mehr herfür. Da zog das Männchen seine Taschenuhr hervor: »Wer kauft mir das Knödel ab?« Die Uhr ging im Kreis herum; es war ein tüchtiges Zeug mit drei schweren Silbergehäusen und einer Schildkrötenschale am Rücken, welche ringsum mit Silbernieten besetzt war. Ein Spindelwerk ferner, mit einem gewaltigen Zifferblatt, auf welchem der Messingzeiger just die dritte Nachmittagsstunde anzeigte.
Dreißig Gulden verlangte der Mann für die Uhr; man lachte ihm hell ins Gesicht, der Eigentümer aber behauptete: »Was wollt ihr wetten? Ehe der Zeiger auf halb vier steht, ist die Uhr verkauft!« Darauf lachten sie noch unbändiger.
Mein Großvater, der hatte von seiner Ofenbank aus die Sache so mit angesehen. Diese verkäufliche Uhr mit dem Schildkrötengehäuse, sie machte ihm die Seele heiß. So eine Uhr war längst seine Passion gewesen; und wenn er nun als Bräutigam eine könnte im Hosenbusen tragen, oder wenn er sie gar der Braut zur Morgengabe spenden möchte! Eine Uhr! Eine Sackuhr! Eine silberne Sackuhr mit Schildkrötengehäuse! –
So weit kam’s, dass mein Großvater aufstand, zum großen Tisch hinging und das Wort sprach: »Geh, lass mich das Zeug anschauen!«
»He, du bist ja der Bauer von Alpel!«, rief der alte Holzhauer, »na, du kannst leicht ausrucken, und dir darf ich’s unter vierzig Gulden gar nicht geben!«
Mein Großvater hatte aber nicht viel im Sack; darum sagte er: »Steine haben wir dies Jahr mehr im Alpel als Geld.«
»Was willst denn, Bauer, hast nicht groß Haus und Grund?«
»Im Haus steht der Tisch zum Essen, aber auf dem Grund wächst lauter Heidekraut«, entgegnete mein Großvater.
»Und Korn und Hafer!« rief einer drein.
»Wohl, wohl, ein wenig Hafer«, sagte mein Großvater.
»Hafer tut’s auch«, rief der Weißkopf, »weißt, Bauer, wenn du einverstanden bist, ich lass dir die Uhr billig.«
»Damit bin ich schon einverstanden«, antwortete mein Ahn.
»Gut«, und damit riss ihm der Holzhauer die Uhr wieder aus der Hand, wendete sie um, dass das Schildkrötengehäuse nach oben lag, »siehst du die Silbernieten da am Rand herum?«
»Sind nicht übel«, entgegnete mein Großvater.
»Übel oder nicht«, rief der schielende Weißkopf, »nach diesen Nieten zahlst mir die Uhr. – Für die erste Niete gibst mir ein Haferkorn, für die zweite gibst mir zwei Haferkörner, für die dritte vier, für die vierte acht, und so verdoppelst mir den Hafer bis zur letzten Niete, und die Uhr gehört dein mitsamt der Silberkette und dem Frauentaler, der dran hängt.«
»Gilt schon!«, lachte mein Großvater, bei sich bedenkend, dass er für eine solche Uhr eine Hand voll Hafer doch leicht geben könne.
Der Kreuzwirt hatte im selben Augenblick meinen Großvater noch heimlich in die Seite gestoßen, der aber hielt das für lustige Beistimmung und schlug seine Rechte in die des Alten. »Es gilt, und alle Männer, die beim Tisch sitzen, sind Zeugen!«
Er hatte aber keinen Hafer bei sich.
Tat nichts. Sofort brachte der Kreuzwirt ein Schäffel herbei, um durch Zählen der Körner, wie mein Ahn meinte, die Rechnung zu bestimmen.
Sie setzten sich um den Hafer zusammen, mein Großvater, vom frischen Apfelmost im Kopfe erwärmt, lachte in seinen jungen Bart; des Gewinnes gewiss, freute er sich schon auf die großen Augen, die das Heidebeermägdlein zur gewichtigen Uhr machen werde.
Zuerst wurden die Nieten gezählt, die um das Schildkrötenblatt herumliefen; es waren deren gerade siebzig. Dann kam’s an die Haferkörner; mein Großvater sonderte sie mit den Fingern, der Holzhauer zählte nach, und die andern überwachten das Geschäft.
Erste Niete: ein Korn; – zweite Niete: zwei Körner; – dritte Niete: vier Körner; – vierte: acht Körner; – fünfte: sechzehn; – sechste: zweiunddreißig; – siebente: vierundsechzig; – achte: hundertachtundzwanzig; – neunte: zweihundertsechsundfünfzig; – zehnte Niete: fünfhundertzwölf Körner. – »Wirtin, den kleinen Schöpflöffel her!« – Das ist gerade ein gestrichener Schöpflöffel voll.
Mein Großvater schob die Körner mit der Hand hin: »Macht’s weiter, ich seh’s schon, es wir schier ein Metzen herauskommen.«
Und die anderen zählten: Elfte Niete: zwei Schöpflöffel voll Hafer; – zwölfte Niete: vier Löffel voll; – dreizehnte acht Löffel; – vierzehnte: sechzehn Löffel voll. Das macht eine Maß. – Fünfzehnte Niete: zwei Maß; – sechzehnte: vier Maß. – Das ist ein Maßl (Schäffel). – Siebzehnte Niete: zwei Maßl; –achtzehnte: vier Maßl; – neunzehnte: acht Maßl; – zwanzigste Niete: sechzehn Maßl, oder ein Wecht. – (Steirischer Malzen.)
Jetzt tat mein Großvater einen hellen Schrei. Die andern zählten fort, und bei der dreißigsten Niete kostete die Uhr über tausend Wecht Hafer. Das war mehr als die Jahresernte der ganzen Gemeinde Alpel.
»Jetzt hab’ ich mein Haus und Grund verspielt«, knurrte der Freier.
»Sollen wir noch weiter zählen?«, fragten die Männer.
»Wie ihr wollt«, antwortete mein Großvater mit rollenden Augen.
Bei der dreiundvierzigsten Niete hatten sie eine Million Wecht Hafer. Bei der fünfzigsten rief mein Großvater, die Hände zusammenschlagend, aus: »O du himmlischer Herrgott, jetzt hab’ ich deinen ganzen Hafer vertan, den du seit der Schöpfung der Welt hast wachsen lassen!«
»Sollen wir weiter zählen?«, fragten die Männer.
»Nicht nötig«, antwortete das weißköpfige Männlein gemessen, »das Übrige schenk’ ich ihm.«
Mein Großvater – er erbarmt mich heute noch – war blass bis in den Mund hinein. Er hatte es in seiner Kindheit schon gehört, die Weltkugel mit allem, was auf ihr, drehe sich im Kreise; jetzt fühlte er’s deutlich, dass es so war – ihm schwindelte. – Da geht er ins Heiraten aus und vertut sein ganzes Gütel. – »Alle Rösser auf Erden«, rief er, »fressen nicht so viel Hafer als die lumpigen paar Nieten da in der Uhr!«
»Steck’ sie ein, Bauer, sie gehört ja dein«, sagte der alte Waldmann, »und zahl’ den Zettel aus.«
»Ihr Leut’«, stotterte mein Großvater, »ihr habt mich übertöppelt« (überlistet).
»Du bist auch nicht auf den Kopf gefallen«, entgegnete man ihm, »du kannst zählen, wie jeder andere – und die ehrenwerten Zeugen!«
»Ja, ja, die ehrenwerten Zeugen«, rief mein Ahn, »lauter Leut’, die geschwärzten Tabak rauchen!«
»Sei still, Bauer!« flüsterte ihm der Kreuzwirt zu, »umliegend (ringsum) ist der Wald! Wenn sie dich angehen, ich kann dir nicht helfen.«
Der alte Weißkopf schielte in den wurmstichigen Tisch hinein; er mochte merken, dass für ihn hier eigentlich doch nichts Rechtes herauskam, er sagte daher zu meinem Großvater: »Weißt du, Bauer, du könntest jetzt wohlfeil zu einem Körndl (Korn, Getreide) kommen. Ich will Hafer verkaufen. Gib mir dreißig Gulden für den ganzen.«
Abgemacht war’s. Leichten Herzens legte mein Großvater dreißig Gulden auf den Spieltisch und eilte davon. Im freien Wald sah er auf die Uhr; der Zeiger stand auf halb vier.
Mein Ahn kehrte heim, warb um das Heidebeermädchen und verehrte ihm die Uhr zum Brautgeschenk. »Aber«, sagte er, »mein Schatz, das nehm’ ich mir aus, du musst mir für die erste Silberniete da einen Kuss geben und bei jeder weiteren Niete die Küsse verdoppeln!«
Das arglose Mädchen ging drauf ein. –
Die Leutchen sind über achtzig Jahre alt, sind meine Großeltern geworden, doch starben sie lange bevor die Uhr abgeküsst war. Und wir Nachkommen werden kaum jemals im Stande sein, diese Schuld der Großmutter vollends wettzumachen.
Vom Urgroßvater, der auf der Tanne saß
An die Felder meines Vaters grenzte der Ebenwald, der sich über Höhen weithin gegen Mitternacht erstreckte und dort mit den Hochwaldungen des Heugrabens und der Wölzer-Alpen zusammenhing. Zu meiner Kindeszeit ragte über die Fichtenund Föhrenwipfel dieses Waldes das Gerippe einer Tanne empor, auf welcher der Sage nach vor mehreren Hundert Jahren, als der Türke im Lande war, der Halbmond prangte und unter welcher viel Christenblut geflossen sein soll.
Mich überkam immer ein Schauern, wenn ich von den Feldern und Heiden aus dieses Tannengerippe sah; es ragte so hoch über den Wald und streckte seine langen, kahlen, wild verworrenen Äste so wüst gespensterhaft aus, dass es ein unheimlicher Anblick war. Nur an einem einzigen Aste wucherten noch einige dunkelgrüne Nadelballen, und über diese ragte ein scharfkantiger Strunk, auf dem einst der Wipfel saß. Den Wipfel musste der Sturm oder ein Blitzstrahl geknickt haben – die ältesten Leute der Gegend erinnerten sich nicht, ihn auf dem Baume gesehen zu haben.
Von der Ferne, wenn ich auf dem Stoppelfelde die Rinder oder die Schafe weidete, sah ich die Tanne gern an; sie stand in der Sonne rötlich beleuchtet über dem frischgrünen Waldessaume und war so klar und rein in die Bläue des Himmels hineingezeichnet. Dagegen stand sie an bewölkten Tagen, oder wenn ein Gewitter heranzog, gar starr und dunkel da; und wenn im Walde weit und breit alle Äste fächelten und sich die Wipfel tief neigten vor dem Sturme, so stand sie still, ohne Regung und Bewegung.
Wenn sich aber ein Rind in den Wald verlief und ich, es zu suchen, an der Tanne vorüber musste, so schlich ich gar angstvoll dahin und gedachte an den Halbmond, an das Christenblut und an andere entsetzliche Geschichten, die man von diesem Baume erzählte. Ich wunderte mich aber auch über die Riesigkeit des Stammes, der auf der einen Seite kahl und von vielen Spalten durchfurcht, auf der anderen aber mit rauen, zersprungenen Rinden bedeckt war. Der unterste Teil des Stammes war so dick, dass ihn drei Männer nicht hätten zu umspannen vermocht. Die ungeheuren Wurzeln, welche zum Teile kahl dalagen, waren ebenso ineinander verschlungen und verknöchert wie das Geäste oben.
Man nannte den Baum die Türkentanne oder auch die graue Tanne. Von einem starrsinnigen oder übermütigen Menschen sagte man in der Gegend: »Der tut, wie wenn er die Türkentanne als Hutsträußl hätt’!« Und heute, da der Baum schon längst zusammengebrochen und vermodert ist, sagt man immer noch das Sprüchlein.
In der Kornernte, wenn die Leute meines Vaters, und er voran, der Reihe nach am wogenden Getreide standen und die »Wellen« herausschnitten, musste ich auf bestimmte Plätze die Garben zusammentragen, wo sie dann zu je zehn in »Deckeln« zum Trocknen aufgeschöbert wurden. Mir war das nach dem steten Viehhüten ein angenehmes Geschäft, umso mehr, als mir der Altknecht oft zurief: »Trag’ nur, Bub’, und sei fleißig; die Garbenträger werden reich!« Ich war sehr behändig und lief mit den Garben aus allen Kräften; aber da sagte wieder mein Vater: »Bub’, du laufst ja wie närrisch! Du trittst Halme in den Boden, und du beutelst die Körner aus. Lass dir Zeit!«
Als es aber gegen Abend und in die Dämmerung hineinging und als sich die Leute immer weiter und weiter in das Feld hineingeschnitten hatten, sodass ich mit meinen Garben weit zurückblieb, begann ich unruhig zu werden. Besonders kam es mir vor, als fingen sich die Äste der Türkentanne, die in unsicheren Umrissen in den Abendhimmel hinein stand, zu regen an. Ich redete mir zwar ein, es sei nicht so, und wollte nicht hinsehen – konnte es aber doch nicht ganz lassen.
Endlich, als die Dunkelheit für das Kornschneiden zu groß wurde, wischten die Leute ihre Sicheln ab und kamen zu mir herüber und halfen mir unter lustigem Sang und Scherz die Garben zusammentragen. Als wir damit fertig waren, gingen die Knechte und Mägde davon, um in Haus und Hof noch die abendlichen Verrichtungen zu tun; ich und mein Vater aber blieben zurück auf dem Kornfelde. Wir schöberten die Garben auf, wobei der Vater diese halmaufwärts aneinander lehnte und ich sie zusammenhalten musste, bis er aus einer letzten Garbe den Deckel bog und ihn auf den Schober stülpte.
Dieses Schöbern war mir in meiner Kindheit die liebste Arbeit; ich betrachtete dabei die »Romstraße« am Himmel, die hinschießenden Sternschnuppen und die Johanniswürmchen, die wie Funken um uns herumtanzten, dass ich meinte, die Garben müssten zu brennen anfangen. Dann horchte ich wieder auf das Zirpen der Grillen, und ich fühlte den milden Tau, der gleich nach Sonnenuntergang die Halme und Gräser und gar auch ein wenig mein Jöpplein befeuchtete. Ich sprach über all’ das mit meinem Vater, der mir in seiner ruhigen, gemütlichen Weise Auskunft gab und über alles seine Meinung sagte, wozu er jedoch oft bemerkte, dass ich mich darauf nicht verlassen dürfe, weil er es nicht gewiss wisse.
So kurz und ernst mein Vater des Tages in der Arbeit gegen mich war, so heiter, liebevoll und gemütlich war er in solchen Abendstunden. Vor allem half er mir immer meine kleine Jacke anziehen und wand mir seine Schürze, die er in der Feldarbeit gern trug, um den Hals, dass mir nicht kühl wurde. Wenn ich ihn mahnte, dass auch er sich den Rock zuknöpfen möge, sagte er stets: »Kind, mir ist warm genug.« Ich hatte es oft bemerkt, wie er nach dem langen, schwierigen Tagewerk erschöpft war, wie er sich dann für Augenblicke auf eine Garbe niederließ und die Stirne trocknete. Er war durch eine langwierige Krankheit ein arg mitgenommener Mann; er wollte aber nie etwas davon merken lassen. Er dachte nicht an sich, er dachte an unsere Mutter, an uns Kinder und an den durch mannigfaltige Unglücksfälle herabgekommenen Bauernhof, den er uns retten wollte.
Wir sprachen beim Schöbern oft von unserem Hofe, wie er zu meines Großvaters Zeiten gar reich und angesehen gewesen war und wie er wieder reich und angesehen werden könne, wenn wir Kinder, einst erwachsen, eifrig und fleißig in der Arbeit wären und wenn wir Glück hätten.
In solchen Stunden beim Kornschöbern, das oft spät in die Nacht hinein währte, sprach mein Vater mit mir auch gern von dem lieben Gott. Er war vollständig ungeschult und kannte keine Buchstaben; so musste denn ich ihm stets erzählen, was ich da und dort in Büchern von dem lieben Gott damals schon gelesen hatte. Besonders wusste ich dem Vater manches zu erzählen von der Geburt des Herrn Jesus, wie er in der Krippe eines Stalles lag, wie ihn die Hirten besuchten und ihn mit Lämmern, Böcken und anderen Dingen beschenkten, wie er dann groß wurde und Wunder wirkte und wie ihn endlich die Juden peinigten und ans Kreuz schlugen. Gern erzählte ich auch von der Schöpfung der Welt, von den Patriarchen und Propheten und von den Zeiten des Heidentums. Dann sprach ich auch aus, was ich gelesen von dem Jüngsten Tage, von dem Weltgerichte und von den ewigen Freuden, die der liebe Gott für alle armen, kummervollen Menschen in seinem Himmel bereitet hat.
Ich erzählte das alles in unserer Redeweise, dass es der Vater verstand, und er war dadurch oft sehr ergriffen.
Ein anderes Mal erzählte wieder mein Vater. Er wusste wunderbare Dinge aus den Zeiten der Ureltern, wie diese gelebt, was sie erfahren und was sich in diesen Gegenden einst für Sachen zugetragen, die sich in den heutigen Tagen nicht mehr ereignen.
»Hast du noch nie darüber nachgedacht«, sagte mein Vater einmal, »warum die Sterne am Himmel stehen?«
»Ich habe noch nie darüber nachgedacht«, antwortete ich.
»Wir denken nicht daran«, sprach mein Vater weiter, »weil wir das schon so gewöhnt sind.«
»Es wird wohl endlich eine Zeit kommen, Vater«, sagte ich einmal, »in welcher kein Stern mehr am Himmel steht; in jeder Nacht fallen so viele herab.«
»Die da herabfallen, mein Kind«, versetzte der Vater, »das sind keine rechten Sterne, wie sie der Herrgott zum Leuchten erschaffen hat; – das sind Menschensterne. Stirbt auf der Erde ein Mensch, so lischt am Himmel ein Stern aus. Wir nennen die Auslöschenden: Sternschnuppen; – siehst du, dort hinter der grauen Tanne ist just wieder eine niedergegangen.«
Ich schwieg nach diesen Worten eine Weile, endlich aber fragte ich: »Warum heißen sie jenen wilden Baum dort die graue Tanne, Vater?«
Mein Vater bog eben einen Deckel ab, und als er diesen aufgestülpt hatte, sagte er: »Du weißt, dass man ihn auch die Türkentanne nennt. Die graue Tanne heißen sie ihn, weil sein Geäste und sein Moos grau ist und weil auf diesem Baume dein Urgroßvater die ersten grauen Haare bekommen hat. – Wir haben hier noch sechs Deckeln aufzusetzen, und ich will dir indes eine Geschichte erzählen, die sehr merkwürdig ist.«
»Es ist schon länger als achtzig Jahre«, begann mein Vater, »seitdem dein Urgroßvater meine Großmutter geheiratet hat. Er war sehr reich und schön, und er hätte die Tochter des angesehensten Bauers zum Weib bekommen. Er nahm aber ein armes Mädchen aus der Waldhütten herab, das gar gut und sittsam war. Von heute in zwei Tagen ist der Vorabend des Festes Mariä Himmelfahrt; das ist der Jahrestag, an welchem dein Urgroßvater zur Werbung in die Waldhütten ging. Es mag wohl auch im Kornschneiden gewesen sein; er machte frühzeitig Feierabend, weil durch den Ebenwald hinein und bis zur Waldhütten hinauf ein weiter Weg ist. Er brachte viel Bewegung mit in die kleine Wohnung. Der alte Waldhütter, der für die Köhler und Holzleute die Schuhe flickte, ihnen zuzeiten die Sägen und die Beile schärfte und nebenbei Fangschlingen für Raubtiere machte – weil es zur selben Zeit in der Gegend noch viele Wölfe gab –, der Waldhütter nun ließ seine Arbeit aus der Hand fallen und sagte zu deinem Urgroßvater: ›Aber, Josef, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du mein Lenerl zum Weib haben willst, das wär’ ja gar aus der Weis’!‹ Dein Urgroßvater sagte: ›Ja, deswegen bin ich heraufgegangen den weiten Weg, und wenn mich das Lenerl mag und es ist sein und Euer redlicher Will’, dass wir zusammen in den heiligen Ehestand treten, so machen wir’s heut’ richtig, und wir gehen morgen zum Richter und zum Pfarrer, und ich lass dem Lenerl mein Haus und Hof verschreiben, wie’s Recht und Sitte ist.‹ – Und das Mädchen hatte deinen Urgroßvater lieb, und es sagte, es wolle seine Hausfrau werden. Dann verzehrten sie zusammen ein kleines Mahl, und endlich, als es schon zu dunkeln begann, brach der Bräutigam auf zum Heimweg.
Er ging über die kleine Wiese, die vor der Waldhütten lag, auf der aber jetzt schon die großen Bäume stehen, und er ging über das Geschläge und abwärts durch den Wald, und er war gar freudigen Gemütes. Er achtete nicht darauf, dass es bereits finster geworden war, und er achtete nicht auf das Wetterleuchten, das zur Abendzeit nach einem schwülen Sommertag nichts Ungewöhnliches ist. Auf eines aber wurde er aufmerksam, er hörte von den gegenüberliegenden Waldungen ein heulendes Gebelle. Er dachte an Wölfe, die nicht selten in größeren Rudeln die Wälder durchzogen; er fasste seinen Knotenstock fester und nahm einen schnelleren Schritt. Dann hörte er wieder nichts als zeitweilig das Kreischen eines Nachtvogels, und sah nichts als die dunklen Stämme, zwischen welche der Fußsteig führte und durch welche von Zeit zu Zeit das Leuchten zuckte. Plötzlich vernahm er wieder das Heulen, aber nun viel näher als das erste Mal. Er fing zu laufen an. Er lief, was er konnte; er hörte keinen Vogel mehr, er hörte nur immer das entsetzliche Heulen, das ihm auf dem Fuße folgte. Als er hierauf einmal umsah, bemerkte er hinter sich durch das Geäst funkelnde Lichter. Schon hörte er das Schnaufen und Lechzen der Raubtiere, die ihn verfolgen, schon denkt er bei sich; ’s mag sein, dass morgen keine Verlobung ist! – Da kommt er heraus zur Türkentanne. Kein anderes Entkommen mehr möglich – rasch fasst er den Gedanken, und durch einen kühnen Sprung schwingt er sich auf den untersten Ast des Baumes. Die Bestien sind schon da; einen Augenblick stehen sie bewegungslos und lauern; sie gewahren ihn auf dem Baum, sie schnaufen und mehrere setzen die Pfoten an die raue Rinde des Stammes. Dein Urgroßvater klettert weiter hinauf und setzt sich auf einen dicken Ast. Nun ist er wohl sicher. Unten heulen sie und scharren an der Rinde; – es sind ihrer viele, ein ganzes Rudel. Zur Sommerszeit war es doch selten geschehen, dass Wölfe einen Menschen anfielen; sie mussten gereizt oder von irgendeiner anderen Beute verjagt worden sein. Dein Urgroßvater saß lange auf dem Ast; er hoffte, die Tiere würden davonziehen und sich zerstreuen. Aber sie umringten die Tanne und schnüffelten und heulten. Es war längst schon finstere Nacht; gegen Mittag und Morgen hin leuchteten alle Sterne, gegen Abend hin aber war es grau, und durch dieses Grau schossen dann und wann Blitzscheine. Sonst war es still, und es regte sich im Walde kein Ästchen.
Dein Urgroßvater wusste nun wohl, dass er die ganze Nacht in dieser Lage würde zubringen müssen; er besann sich aber doch, ob er nicht Lärm machen und um Hilfe rufen sollte. Er tat es, aber die Bestien ließen sich nicht verscheuchen; kein Mensch war in der Nähe, das Haus zu weit entfernt.
Damals hatte die Türkentanne unter dem abgerissenen Wipfelstrunk, wo heute die wenigen Reiserbüschel wachsen, noch eine dichte, vollständige Krone aus grünenden Nadeln. Da denkt sich dein Urgroßvater: ›Wenn ich denn schon einmal hier Nachtherberge nehmen soll, so klimme ich noch weiter hinauf unter die Krone.‹ Und er tat’s und ließ sich oben in einer Spalte nieder, da konnte er sich recht gut an die Äste lehnen.
Unten ist’s nach und nach ruhiger, aber das Wetterleuchten wird stärker, und an der Abendseite ist dann und wann ein fernes Donnern zu vernehmen. – ›Wenn ich einen tüchtigen Ast bräche und hinabstiege und einen wilden Lärm machte und gewaltig um mich schlüge, man meint’, ich müsst’ den Rabenäsern entkommen!‹, so denkt dein Urgroßvater – tut’s aber nicht; er weiß zu viele Geschichten, wie Wölfe trotz alledem Menschen zerrissen haben.
Das Donnern kommt näher, alle Sterne sind verloschen – ’s ist finster wie in einem Ofen; nur unten am Fuße des Baumes funkeln die Augensterne der Raubtiere. Wenn es blitzt, steht wieder der ganze Wald da. Nun beginnt es gar zu sieden und zu kochen im Gewölke wie in tausend brauenden Kesseln. ›Kommt ein fürchterliches Gewitter‹, denkt sich dein Urgroßvater und verbirgt sich unter die Krone, so gut er kann. Der Hut ist ihm hinabgefallen, und er hört es, wie die Bestien den Filz zerfetzen. Jetzt zuckt ein Strahl über den Himmel, es ist einen Augenblick hell, wie zur Mittagsstunde – dann bricht in den Wolken ein Schnalzen und Krachen und Knallen los, und weithin hallt es im Gewölke.
Jetzt ist es still, still in den Wolken, still auf der Erde – nur um einen gegenüberliegenden Wipfel flattert ein Nachtvogel. Aber bald erhebt sich der Sturm, es rauscht in den Bäumen, es tost durch die Äste, eiskalt ist der Wind. Dein Urgroßvater klammert sich fest an das Geäste. Jetzt flammt wieder ein Blitz, gelblich-grün erleuchtet ist der Wald; alle Wipfel neigen sich, biegen sich tief; die nächst stehenden Bäume schlagen, es ist, als fielen sie heran. Aber die Tanne steht starr und ragt hoch auf über dem Walde. Unten rennen die Raubtiere wild durcheinander und heulen. Plötzlich saust ein Körper durch die Äste wie ein Steinwurf. Da leuchtet es wieder – ein schneeweißer Ballen hüpft auf den Boden und kollert dahin. Dann dichte Nacht. Es braust, siedet, tost, krachend stürzen Wipfel. Ein Ungeheuer mit weit schlagenden Flügeln, im Augenblicke des Blitzes gespenstige Schatten werfend, naht in der Luft, stürzt der Tanne zu und birgt sich gerade über deinem Urgroßvater in die Krone. Ein Habicht war’s, Junge, ein Habicht, der auf der Tanne sein Nest gehabt.«
Mein Vater hatte bei dieser Erzählung keine Garbe angerührt; ich hatte den ruhigen, schlichten Mann bisher auch nie mit solcher Lebhaftigkeit sprechen gehört.
»Wie’s weiter gewesen?« fuhr er fort. »Ja, nun brach es erst los? Das war Donnerschlag auf Donnerschlag, und beim Leuchten war zu sehen, wie hundert und tausend Eiskörner auf den Wald niedersausten, an die Stämme prallten, auf den Boden flogen und wieder hoch emporsprangen. Sooft ein Hagelkorn an den Stamm der Tanne schlug, gab es im ganzen Baume eine hohlen Schall. Und über dem Heugraben gingen Blitze nieder, und auf den jenseitigen Wald gingen Blitze nieder; plötzlich war eine blendende Glut, ein heißer Luftdruck, ein Schmettern, und es loderte eine Fichte.
Und die Türkentanne stand da, und dein Urgroßvater saß unter der Krone im Astwerk.
Die brennende Fichte warf weithin ihren Schein, und nun war zu sehen, wie ein rötlicher Schleier lag über dem Walde, wie nach und nach das Gewebe der kreuzenden Eisstücke dünner und dünner wurde und wie viele Wipfel keine Äste, dafür aber weiße Streifen hatten, wie endlich der Sturm in einen mäßigen Wind überging und ein dichter Regen rieselte.
Die Donner wurden seltener und dumpfer und zogen sich gegen Mittag und Morgen; aber die Blitze leuchteten noch ununterbrochen.
Am Fuße des Baumes war kein Heulen und kein Augenfunkeln mehr. Die Raubtiere waren durch das wilde Wetter verscheucht worden. Stieg denn dein Urgroßvater wieder von Ast zu Ast bis zum Boden. Und er ging heraus durch den Wald über die Felder gegen das Haus.
Es war schon nach Mitternacht. Es war an demselben Morgen ein frischer Harzduft gewesen im Walde – die Bäume haben geblutet aus unzähligen Wunden. Und es war ein beschwerliches Gehen gewesen über die Eiskörner, und es war eine sehr kalte Luft.
Als der Bräutigam zum Hause kommt und kein Licht in der Stube sieht, wundert er sich, dass in einer solchen Nacht die Leute so ruhig schlafen können. Haben aber nicht geschlafen, waren zusammen gewesen in der Stube um ein Kerzenlicht. Sie hatten nur die Fenster verlehnt und verhüllt, weil der Hagel alle Scheiben eingeschlagen hatte.
›Bist in der Waldhütten blieben, Sepp?‹, sagte deine Ururgroßmutter. Dein Urgroßvater aber antwortete: ›Nein, Mutter, in der Waldhütten nicht.‹ –
Als sie darauf am Frauentag alle über die Verheerung und Zerstörung hin zur Kirche gingen, fanden sie im Walde unter dem herabgeschlagenen Reisig und Moos manchen toten Vogel und manch anderes Tier; unter einem geknickten Wipfel lag ein toter Wolf.
Dein Urgroßvater ist bei diesem Gange sehr ernst gewesen; da sagt auf einmal das Lenerl von der Waldhütten zu ihm: ›O, du himmlisch’ Mirakel! Sepp, dir wachst ja schon ein graues Haar!‹
Später hatte er alles erzählt, und nun nannten die Leute den Baum, auf dem er dieselbige Nacht hat zubringen müssen, die graue Tanne!«
Das ist die Geschichte, wie sie mir mein Vater eines Abends beim Kornschöbern erzählt hat und wie ich sie später aus meiner Erinnerung niedergeschrieben. – Als wir dann nach Hause gingen zur Abendsuppe und zur Nachtruhe, blickte ich noch mehrere Male hin auf den Baum, der hoch über dem Wald in den dunkeln Abendhimmel hinein stand.
Von dieser Zeit ab fürchtete ich mich nicht mehr, wenn ich an der grauen Tanne vorüberging. Und sie stand noch jahrelang da, zur Winters- und Sommerszeit in gleicher Gestalt – ein wild verworrenes Gerippe von Ästen, mit den wenigen dunkelgrünen Nadelballen auf der Krone und dem scharfkantigen Strunk über derselben.
Ich war schon erwachsen. Da war es in einer Herbstnacht, dass mich mein Vater aufweckte und sagte: »Wenn du die graue Tanne willst brennen sehen, so geh’ vor das Haus!«
Und als ich vor dem Hause stand, da sah ich über dem Walde eine hohe Flamme lodern und aus derselben qualmte finsterer Rauch in den Sternenhimmel auf. Wir hörten das Dröhnen der Flammen, und wir sahen das Niederstürzen einzelner Äste; dann gingen wir wieder zu Bette. Am Morgen stand über dem Wald ein schwarzer Strunk mit nur wenigen Armen – und hoch am Himmel kreiste ein Geier.
Wir wussten nicht, wie sich in der stillen, heiteren Nacht der Baum entzündete, und wir wissen es noch heute nicht. In der Gegend ist vieles über dieses Ereignis gesprochen worden, und man hat demselben Wunderliches und Bedeutsames zu Grunde gelegt. Noch einige Jahre starrte der schwarze Strunk gegen den Himmel, dann brach er nach und nach zusammen, und nun stand nichts mehr empor über dem Walde.
Auf dem Stocke und auf den letzten Resten des Baumes, die langsam in die Erde sinken und vermodern, wächst das Moos.
Meine Aja
Liebe Leserin mit deinen schönen Augen! Wenn es dich getroffen hätte, wenn du es gewesen wärest, die dazumal von einer armen Magd in der Strohkammer des Rüsenhofes zur Welt geboren war! Es hätte ja sein können, und wenn es wahr ist, dass wir auch in Zukunft mitunter auf die Welt kommen, so kann es noch fürder sein. Aber wünschen mag ich dir’s nicht.
Die kleine Jula gehörte zu jenen Kindern, die keinen Vater haben, weil es für sie sündhaft wäre, einen zu haben. Mutter hatte sie gerade so viel, als unerlässlich nötig ist, um geboren werden zu können. Eine Bauernknechtin hat mit harten Kräften zu tun, sich selbst zu atzen und zu bedecken, so sagte die Magd, kaum sie vom Bette aufgestanden war, zu ihrem Dienstherrn: »Mein Rüsenbauer! Baue dir drei Staffeln in den Himmel und nimm mir das Kleine ab!«
Dachte sich der Rüsenbauer: Das wäre nicht dumm. Drei Staffeln in den Himmel und nach etlichen Jahren eine brauchbare Halterdirn, und nachher eine eigene Knechtin, die im Haus das Unhandsamste verrichtet und nicht viel kostet. ’s täte sich. –
»Ja«, sagte er, »das Kleine nehm’ ich dir ab, aber nur der Staffeln in den Himmel wegen tue ich’s.«
Die Magd schluchzte wohl, als sie in einen andern Hof zog und sich von dem Kinde trennte; aber der Bauer tröstete sie: »Geh’ nur, geh’, mach’ kein Wasser an, schaust dir doch wieder um ein anderes.«
Die Knechtin ging und sah nicht mehr um und starb nach kurzer Zeit.
Die Jula wuchs heran und war eine brauchbare Halterdirn und wurde eine willige Magd, die im Haus das Unhandsamste mit Geduld verrichtete. In jedem ordentlichen Hof musste ein Hofnarr sein; will der Klügste sich dazu nicht hergeben, so muss der Einfältigste dran. Die Jula war die gläubige Einfalt, die alles für bare Münze nahm, was klingelte, die aufopferungswillige Güte, welche einmal eine ganze Nacht damit verbrachte und sich die Hände wund rieb, am Brunnen den Pechlappen des Schusters weiß zu waschen. Ihr Lohn dafür war das Spottgelächter des ganzen Hauses.
Den Sommer ihres neunzehnten Lebensjahres verbrachte sie mit Träumen. Es war sonst nicht ihre Art, tatlos dazustehen und in die leere Luft hineinzustarren, aber in diesem Sommer tat sie’s, und im Herbste drauf kam’s ans Tageslicht, warum. Es war wieder kein Vater da, aber die junge Mutter presste ihr Wunder umso stürmischer an die Brust, je eindringlicher man ihr riet, es in fremde Hände zu geben.
Zur selben Zeit traf sie ein Geschick, das ganz unbegründet dasteht, wie das Ereignis in einer stümperhaften Erzählung, aber wie eine schlechte Laune des Himmels. Zu mir ist nichts von sonst gekommen, als was die Jula später oft und oft erzählt hat.
Sie zog am Morgen mit ihrem Graskorbe hinaus auf die Wiese und mähte und rechte das Futter zu einer Schichte. Und als die Sonne aufgeht, bleibt sie ein wenig stehen, stützt sich auf den Rechen, schaut hin und denkt, wie doch die Sonne schön ist! – Wie sie sich wieder zu ihrer Arbeit wendet, sieht sie kein Futter mehr, keine Wiese, sieht den Rechen nicht, den sie in der Hand hält – und schreit auf: »Uh, Halbesel, was ist denn das?« ’s ist so ein Nebel vor. Sie reibt sich die Augen, da tanzen rote, grüne und gelbe Sonnen im Nebel herum und sie sieht ihren Rechen noch immer nicht. Jetzt tastet sie umher und findet den Korb nicht, da ruft sie nach den Leuten.
Dort vor dem Hause steht die Bäuerin, die hört’s, kommt etliche Schritte herbei und frägt, was denn das heut für ein albernes Geschrei wäre beim Futtermähen?
»Du, Bäuerin«, sagt die Jula, »ich weiß nicht, was das ist, ich sehe auf einmal nichts.«
»So wirst halt blind geworden sein«, meint die Bäuerin.
»Jesus Maria, doch das nicht!« schreit die Jula und reibt mit Angst und Macht an den Augen, »nein – ich sehe alles! Ich sehe ja alles!« Aber sie tastete herum und stolperte endlich über die Sense, dass sie sich blutig schnitt. Endlich kamen Leute herbei und führten sie und sagten, es hätte schier den Anschein, als wie wenn sie blind geworden wäre.
»Nein«, rief sie, »blind! Was ihr närrisch seid, wie kunnt ich denn blind werden? – Zu meinem Kind führet mich geschwind!«
Man führte sie in die Kammer. Sie tastete nach dem Knäblein, sie riss es von seinem Nestchen empor und vor ihr Auge, und jetzt tat sie den Schrei: »Blind! Stockblind!« und stürzte vor dem Bettchen aufs Knie.
Nun erst, als sie ihr eigenes Kind nicht mehr sehen konnte, wusste sie es, glaubte sie es.
Sie war blind. Und sie blieb von diesem Tage an blind, und sie lebte augenlos noch dreiundsechzig Jahre lang.
Gesagt musste was werden, und so sagten die Leute, es wäre schon im Blute gelegen, und schwache Augen hätte sie immer gehabt.
Anfangs mögen die Quacksalber und Kurpfuscher gekommen sein mit ihren Schmieren und Pflastern, Tropfen, Laxieren und allen jenen Übeln, die dem Kranken – nachdem ihm sein Leiden vom Himmel gesandt ist – vom Teufel spendiert werden. Dann mag, ohne dass an einen Arzt, an eine Augenheilanstalt gedacht wurde – das Bestreben zu helfen erlahmt sein, und man hatte der Armen gesagt: »Wenn’s der lieb’ Herrgott so haben will, so ist kein anderes Mittel, als wie geduldig leiden!«
Und zu diesem Mittel hat sich die Jula bequemt. Weniger Geduld hatten andere Leute, welche wohl sehen konnten, aber allzu schwarz sahen. Das waren die Vordersten der Gemeinde; diese taten dar, dass sie ohnehin schwer belastet seien, dass die Mutter der Jula nicht in ihrem Bereiche geboren, dass sie aus der Waldgemeinde Alpel gekommen war, und dass die Blinde nun in die Gemeinde Alpel zuständig sei. So wurde sie von ihrem Kinde hinweggeführt und in unsere Waldgemeinde eingelegt. Hier sollte sie als »Einlegerin« von Haus zu Haus wandern und in jedem eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Wochen behalten und verpflegt werden.
In mein Vaterhaus kam sie von einem Boten des Nachbars begleitet, die erste Zeit des Jahres zwei Mal, und wir hatten sie jedes Mal zwei Wochen lang zu behalten. Sie hatte einen Buckelkorb, in welchem sich ihre Habseligkeiten befanden und den sie sich nie vom Boten tragen ließ, sondern auch dann noch selbst schleppte, als sie schon gar alt und mühselig geworden war. Ferner besaß sie einen Handstock, der am Griffknorpel ein Riemlein hatte, den sie außer Haus immer und überall bei sich trug, den sie zur Nachtzeit neben ihrem Bett mit ängstlicher Sorgfalt aufbewahrte und der ihr wirklich mehr Gutes getan hat als je ein Mensch auf dieser Erde. Dann hatte sie in ihrem Mieder stecken einen Blechlöffel, bei dem die Verzinnung schon fast weggewetzt war und überall die schwarzen Stellen hervorschauten. Was man ihr vorsetzte, das aß sie nur mit diesem Löffel. Endlich besaß sie ein ledernes Geldtäschchen, in welchem sich stets – wenn irgendwo eine Not war – was vorfand. Denn in der ehrwürdigen Kirche zu Krieglach steht der steinerne Opferstock für die Armen, der über Kreuz und quer mit Eisen beschlagen ist, nicht umsonst. Etliche Mal des Jahres brachte der Richter vom Alpel aus diesem steinernen Behälter Geld mit in die Waldgemeinde und verteilte es dort unter die Armen. Die Jula wurde jedes Mal unruhig, wenn es hieß, der Richter komme. Zum öfteren Male freilich war es ganz vergeblich, wie sie sich auch um ihn herum zu schaffen machte. Er fragte wohl stets: »Na, Jula, wie geht’s? Halt alleweil fleißig? Brav, brav!« Nur gar selten, »zu allen heiligen Zeiten einmal«, wie die Bauern sagen, setzte der Richter noch bei: »Schau, du, ich hab’ was für dich, Jula. Da – lang’ her. So, heb’s gut auf!«
Da tat sie denn jedes Mal bitten: »Nur keine Sechser nit! Alles Kreuzer sind mir lieber. Recht vergelt’s Gott! Will schon fleißig beten.«
Mancher Bettelmann hat es erfahren, warum ihr die Kreuzer lieber waren als wie das »große Geld«. Ihr war ums Austeilen zu tun.
Beten sah man die Jula übrigens seltener, als man glaubt, dass ein Mensch, der so ganz auf den Himmel angewiesen ist, sollte. Im Gegenteil, wenn wir uns an Festtagen etwas eingehend mit dem Rosenkranz abgaben, hörte ich sie nicht selten ihren Knieschemel rücken und ein wenig dabei brummen. Einstweilen schien ihr die Erde wichtiger denn der Himmel. Konnte sie die Erde auch nicht sehen, so doch tasten. Und das tat sie denn getreulich, sie arbeitete. In jedem Hause, kaum sie eintrat, wusste sie sich nützlich zu machen, und war sie die Örtlichkeit einmal gewohnt, so waren ihre Verrichtungen von wirklichem Belange. Sie hackte Streu, sie wiegte die Kinder, ja sie molk sogar die Kühe. Und wenn es ihr gelang, ihre Arbeiten zur Zufriedenheit des Bauers und der Bäuerin zu machen, so wuchs ihr Eifer und ihre Freude, und sie vergaß, dass sie blind war.
Der Stern ihres Auges war grau, sie sah nichts als den blassen Schein des Tages.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com