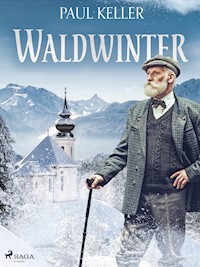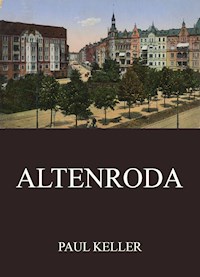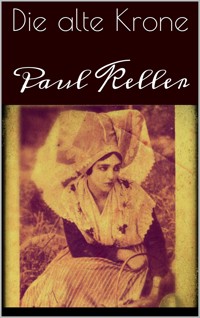1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Waldwinter gehört zu den stärksten Werken Paul Kellers. Ein junger Schriftsteller flieht das Leben der städtischen Gesellschaft und verliebt sich dabei zuerst in ein liebes Mädchen, das aber einen andern liebt, dann ernsthaft in ein Mädchen, das von seiner verstorbenen Mutter mit dem Hass auf die Ehe geimpft wurde. Gelingt es ihm, dieses extreme Hindernis zu überwinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Waldwinter
Roman aus den schlesischen Bergen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Paul Keller
Waldwinter
Roman aus den schlesischen Bergen
1. elektronische Auflage 2014
[email protected], Basel
Auf der Flucht nach der Stille
Ich lachte laut auf.
Mochten sie hundert Boten senden, sie würden mich nicht finden; mochten sie tausend Briefe hinter mir herschicken, sie würden mich nicht erreichen. Der elektrische Funke selbst würde mich nicht einholen.
»'S geht a bissel sachte – der Fuchs is gutt – aber der Weg is halt ziemlich miserabel.«
»Es geht großartig, Herr – Herr –«
»Herr Sternitzke Franze!«
»Richtig! Herr Sternitzke! Ich hatt's schon wieder vergessen. Es geht großartig, Herr Sternitzke!«
Und weiter ging die Flucht mit einer Geschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde. Von Minute zu Minute wuchs meine Sicherheit und damit meine Freude. Herr Sternitzke in meiner kleinen Droschke rauchte so ungeheuer, und die Räder rasselten so laut und schlugen so wahrnehmbar, daß ich die Empfindung hatte, ich säße in dem Wagen eines Eilzuges, der mich mit rasender Schnelligkeit von dannen beförderte.
»Es ist hübsch von Ihnen, Herr Sternitzke, daß Sie mich selber von der Bahn abgeholt haben. Ich dachte, Sie würden einen Knecht schicken.«
»Nee,« sagte Sternitzke, »'n Knecht schick' ich grundsätzlich nich; denn erstens sagte der Oberförster, ich soll alleene fahr'n, und zweetens scheut der Fuchs vor der Bahne, und drittens hab ich gar keen' Knecht nich!« »Aha! Das seh' ich ein! Da ist also der Herr Oberförster auch auf mein Wohl bedacht?«
Herr Sternitzke lächelte.
»Och nee,« sagte er, »das grade nich; a is halt schrecklich neugierig uff Sie. A kann sich gar nich denken, warum Sie jetzt – ich meine, 's geht doch uff'n Winter zu – warum Sie jetzt zu uns in die Sommerfrische woll'n.«
Ich mußte lachen.
»Das ist aber gar nicht hübsch vom Herrn Oberförster, daß er so neugierig ist.«
»Ah,« machte Sternitzke, »der! der hat noch viel andere Untugenden, der! Überhaupt, a Kujon is a!«
Und er lachte vor sich hin.
»Da stimmen Sie wohl nicht gut mit dem Oberförster, Herr Sternitzke?«
»O ja! A is ja mei bester Kunde! Keen Eenziger kneipt so viel wie der. Und das is doch wichtig für'n Gastwirt. Dann sind wir och Gevattersleute. Nee, nee, gutte Freinde sein wir. Aber Krach hab'n wir bald alle Tage!«
»So, so! Da freu' ich mich schon auf den Oberförster!«
»A studierter Oberförster is a nich. A hat sich bloß so ruffgearbeit' beim Herrn Baron. Na, und wegen Ihn' is a eben, wie gesagt, ganz schrecklich neugierig.«
»HHhHhä! Das kann ich mir denken!«
Wir fuhren weiter. Die Straße stieg bergan, und der Fuchs schlug ungefähr ein Tempo ein wie ein müdes Öchslein, wenn es abends vom Felde kommt. Nach einer Weile machte Sternitzke eine Vierteldrehung nach mir hin und sagte: »Das heißt – das muß ich ja sagen – ich wundere mich ja auch a bissel über Ihnen –« »Das glaube ich, Herr Sternitzke! Denken Sie mal, ich wundere mich beinahe selber über mich!«
Franz Sternitzke schüttelte den Kopf und sagte eine Weile gar nichts mehr. Seine Bemühungen, etwas aus mir herauszubekommen, waren gescheitert. Ehe wir die Anhöhe erreichten, schnaubte der Fuchs einigemal tief und schmerzlich auf, und dann blieb er zu einer kleinen Erholungspause stehen. Ich stieg aus.
»Wie alt ist denn Ihr Fuchs, Herr Sternitzke?« fragte ich.
Der Besitzer des edlen Rosses sah mich ob dieser indiskreten Frage verärgert an.
»A is sonst a sehr guttes Pferd!« sagte er.
»Oh, Herr Sternitzke, er ist ein Staatspferd! Es ist sehr hübsch von ihm, daß er ein wenig stehen geblieben ist. Sehen Sie doch bloß diese herrliche Aussicht hier!«
Sternitzke warf einen flüchtigen Blick in das prächtige Waldtal und nach der Berglehne hinüber, die in den Mattgoldfarben des Herbstes schimmerte, und vertiefte sich dann in die edlen Formen seines »guten Pferdes«. Plötzlich platzte er in unverfälschtem Schlesisch heraus: »Achtza is a!«
»Achtzehn Jahre erst? Oh, Herr Sternitzke, er ist jung, jawohl, blutjung! Unsere jüngste Balletteuse ist wenigstens achtundzwanzig.«
»Is das auch so ein Pferd?«
»Die Balletteuse? Nee, nee, nee, Herr Sternitzke, was denken Sie denn! Das ist 'ne junge Dame, die am Theater die kleinen Engel spielt.«
»Ach so,« nickte Herr Sternitzke verständnisvoll und rauchte sich eine von den Zigarren an, die ich ihm geschenkt hatte. Während er den Rauch immer abwechselnd durch die Zähne und durch die Nase stieß, genoß ich den entzückenden Ausblick ins Tal.
Es fiel mir ein, wie klein die Erde und wie groß die Sonne sei. Fern über den Wüsten Afrikas steht sie und hat Kraft genug, auch dieses schlesische Tal mit Licht und Glanz zu füllen. Und es ist nicht wahr, daß die Natur im Herbst eine lebensmüde, matte Matrone sei, die dem Tod geweiht ist; ein starkes, fruchtbares Weib ist sie, das zusammenbricht, indem es gebiert.
Herr Sternitzke schreckte mich aus meinen Betrachtungen. Er wackelte mit der Leine und sprach zum Fuchs in freundlich ermutigendem Tonfall: »Na, Aler, wull'n mer wieder?«
Nein, der Fuchs »wollte« offenbar noch nicht. Aber da ich in den Wagen stieg, brachte Herr Sternitzke mit vielem Zureden und einigem Peitschenwedeln das Gefährt wieder glücklich in Gang.
Ich lehnte mich zurück im Wagen und schloß die Augen. Dieser einfache Mann wunderte sich darüber, daß ein Großstädter zur Herbstzeit aufs Land ziehen könne. Ja, er wußte nicht, daß ich auf der Flucht war – auf der Flucht vor der Großstadt, vor ihrem anstrengenden, fürchterlichen Winter. Nein, ich wollte nicht dreimal in der Woche ins Theater gehen, ich wollte mich nicht immer und immer wieder ärgern über diesen und jenen Kerl, der mir die Laune verdarb, über diesen und jenen gemeinfalschen Ton, der mich aus der besten Stimmung zerrte. Ich wollte mir nicht tausend Lügen sagen lassen und nicht aus Höflichkeit tausendmal selber lügen. Ich wollte nicht tanzen müssen, wenn ich nach Einsamkeit dürstete, und nicht einsam durch menschengefüllte Straßen irren, wenn ich einen Freund suchte. Ich wollte keinem Weibe begegnen, das mich zum Schwiegersohn wünschte, und keine andere sehen, die ich vergeblich begehren würde. Ich wollte nicht Skat spielen, ich wollte auf der Eisbahn keinen Stuhlschlitten schieben, ich wollte keine Besuche machen, ich wollte meine Wirtin nicht jammern hören, ich wollte nicht halbe Nächte lang im Café sitzen, ich wollte – ja richtig: ich wollte keine Zeitungen lesen.
Ein Seufzer entrang sich meiner Brust.
»Sie sind wohl krank?« fragte Herr Sternitzke.
»Krank? Ich? Wieso?«
»Nu je, Sie sehn ziemlich miserabel aus. Und dann, weil Sie halt jetzt zu uns aufs Dorf komm'.«
»Na, richtig krank bin ich gerade nicht. Aber nervös bin ich.«
Sternitzke nickte teilnehmend.
»Nerviös! Ja, ja, ja, ja! Ich ooch!«
»Ach was? Sie sind auch nervös, Herr Sternitzke?«
»Sehr!«
Nach einem Weilchen wandte er sich halb um.
»Sind Sie verheiratet?«
»Verheiratet? Nein!«
Herr Sternitzke seufzte.
»Ich bin!«
Und er versank in tiefes Sinnen. Ich störte ihn nicht, dem Grunde seiner Nervosität nachzugrübeln. Eine Zeitung knisterte in meiner Tasche; ich warf sie an den Straßenrand. Politisches stand darin, ein Roman, den ein überreizter Mensch schrieb, Rezensionen, Festberichte – ah, mochte sie der Wind verjagen! Aber neben der Zeitung steckte ein Brief, den las ich. Es gibt selten etwas Gedrucktes, das man zweimal liest, aber viel Geschriebenes, das man zehnmal liest. Die Tinte ist wahrer als die Druckerschwärze.
»Sie nehmen's auf Ihre eigene Kappe, lieber Freund! Ich verhehle Ihnen nicht, daß man Sie mindestens für einen komischen Kauz halten wird. Jetzt, wo der Winter kommt! Sie haben keine Ahnung, wie furchtbar öde so ein verlassener Waldwinkel im Winter ist! Der Burgwirt schreibt zwar, er werde sich alle Mühe geben, für Ihr Leibliches zu sorgen. Und er wird das wirklich – natürlich seinen Kräften entsprechend. Aber langweilen werden Sie sich fürchterlich, und ich sehe Sie schon ›in die Öffentlichkeit flüchtend‹. Wie ein Vater, der seine Tochter ins Noviziat eines Klosters schickt, möchte ich Ihnen sagen ›Wenn du's nicht aushältst, geniere dich nicht, zurückzukommen‹. Im Ernst, ich weiß wirklich nicht, ob Sie das Zeug zum Romantiker haben. Sie sind doch ein lebensfroher Mensch. Sie haben Ihren Freundeskreis, Ihre guten Verbindungen in der Stadt. Kein Weib, keine Leidenschaft, kein Schicksalsschlag hat Ihnen das Herz vergiftet; was fliehen Sie? Doch das ist alles Ihre Sache. Sie haben gewünscht, einen Winter ›auf der Burg meiner Väter‹ zu verleben – bon! – verleben Sie einen Winter dort! Ich werde inzwischen die gewünschte Diskretion wahren und abwarten, wie sich die Geschichte des neuen Herrn meines Waldhofes entwickeln wird.«
»Ein ganz prächtiger Mann,« sagte ich halblaut.
Herr Sternitzke lächelte, obwohl ich ihn gar nicht gemeint hatte.
»Der Herr Baron kommt wohl sehr selten hierher?« fragte ich.
»Bale gar nich,« antwortete mein Kutscher, »'s is nischt los bei uns! Wenn ich so könnte, tät' ich in die große Stadt ziehn. Da würd' ich auch nicht so nerviös sein!«
Die Sehnsucht der Menschen geht immer aufs Wandern. Drüben im andern Lande, über den Grenzen, die sie nicht überschreiten können, vermuten die Menschen Glück und Heil. Das alte Märchen vom König und Bauer wiederholt sich alle Tage. »Wo du nicht bist, da wohnt das Glück.«
Wir hatten endlich die Anhöhe erreicht. Der Weg machte eine scharfe Biegung und stieg plötzlich ziemlich steil bergab. Ein neues Tal öffnete sich dem Blicke. Ein Gebirgsfluß durchströmte es seiner Länge nach, und an seinen Ufern lagen die Häuser von Steinwernersdorf. Ein Blick nur fiel über die vielen schrägen Dächer, dann suchte ich das eine Haus, das Haus im Walde, die »Burg«, die mir einen Winter lang Zuflucht, Obdach und Frieden gewähren sollte.
Drüben über dem Tale stieg ein Bergkegel empor, von unten bis oben mit Laubwald bestanden, und über die obersten Baumkronen ragte ein grauer Turm empor. Dort lag die Burg, in der ich wohnen wollte. Aus meiner Dorfjungenzeit her klingen noch immer ein paar Saiten in meiner Seele, die kein Sturm zerrissen und keine Hand zurückgeschraubt hat, weder die eigene, noch eine fremde. Jetzt klangen sie. Die kindliche Liebe zur Natur, die Lust, mit großen Augen in die Welt zu schauen, mit Augen, die nicht forschen wollen, sondern an Märchenwunder glauben, sie wurden rege in meinem Herzen. Es ist nicht zu viel, wenn ich sage: es war mir, als wenn ich nach Hause käme, nach langer Zeit nach Hause, mit der süßen, wehmütigen Freude des spät Heimkehrenden.
Und dahin für den Augenblick war alles, was den Großstadtmenschen auszeichnet: Selbstbeherrschung, Mäßigung, kritischer Blick; jedes spöttisch überlegene Wörtlein verstummte auf meinen Lippen, der Mann neben mir kam mir vor wie ein alter, lieber Bekannter, der mich zu den Ferien abgeholt hat und den ich auf dem Heimwege nach tausend Dingen aus der Heimat fragen muß.
So fragte ich denn, fragte ins Blaue darauf los, und Sternitzke gab auf alle Fragen Antwort.
Das dort mit dem Turme, das sei die Kirche, eine Filialkirche bloß, alle drei Sonntage mal sei Gottesdienst, und der Pfarrer trinke immer hinterher bei ihm Kaffee und esse jedesmal zwei Eier, flaumweich gekocht; er, Sternitzke, bereite sie selber; denn seine Frau passe nicht ordentlich auf. Und neben der Kirche, da sei eben gleich Franz Sternitzkes Gasthof »zum silbernen Löffel«, der einzige Gasthof am Orte, in dem die anständigen Leute verkehren. Vor dem Straßenwirtshaus müsse er mich warnen; denn erstens werde dort Aktienbier verschenkt, und nicht mal vom Faß, und zweitens verkehrten überhaupt dort bloß »Kröte und Flöte«. Dort hinter der Brücke am Waldrande das Haus sei die Oberförsterei. Die Brücke habe zwei Geländer, die habe der Oberförster auf eigene Kosten machen lassen; denn er sei schon einmal ins Wasser gefallen, als er spät aus dem »Silbernen Löffel« nach Hause ging. Hier machte Herr Sternitzke eine Lachpause von zwei Minuten und fuhr dann in seinem Anschauungsunterricht fort. In die hohe Pappel neben Henschelbauers Hause habe schon zweimal der Blitz geschlagen, einmal am 23. Juni 1886, nachmittags gegen 3 Uhr 30, und einmal am 17. August 1895, abends so nach zehn. Der Baum sei aber noch ganz gut. Darüber bezeigte ich meine Genugtuung, und Herr Sternitzke fuhr fort zu beschreiben:
Da rechts Bauer Böhm: 4 Kinder, 75 Morgen Acker, 3000 Taler Schulden.
Hinter ihm wohne Bauer Eistert: 2 Rinder, 83 Morgen Acker, 4000 Taler Schulden. Im Auszugshause die alte Eistert habe die Wassersucht und 6000 Taler Geld, rücke aber bei Lebzeiten nichts raus.
Auf der Berglehne in den kleinen Häusern Leinwandweber, arme Leute! Das letzte rechts sei das Haus vom alten Bäcker-Weber; dessen Sohn sei ein »sehr hohes Tier« geworden: Gymnasiallehrer! Der Alte kriege alle Jahre ein Heidengeld von seinem Sohne geschickt und lebe natürlich einen feinen Tag.
Dort im Hause mit dem Schieferdache wohne der Kaufmann Nehrlich. Gute Ware, aber schlechte Zigarren. Die seien im »Silbernen Löffel« besser. Drei zu 10, zwei zu 10 und zwei zu 15 seien zu haben. Der Oberförster gebe aber für die »gute Kiste« auch bloß 5 Pfennig pro Stück.
An der Wegkreuzung dort wohne der Schmied. Das sei ein berühmter Mann weit und breit. Er sei Pferdedoktor. Auch ein Zweirad habe er schon gebaut, aber das gehe sehr schwer. Und nächstens werde er einen lenkbaren Luftballon erfinden.
Ja richtig, die Schule! Der alte Lehrer seit jetzt krank, und es sei ein Vertreter da. Bei dem lernten die Kinder sehr viel, namentlich im Zeichnen. Skat spiele er aber unter der Kanone.
Dort in dem kleinen Häuschen wohne der »Büttner«. Der singe ersten Tenor im Gesangverein. Und er mache die Damenrollen, wenn Theater gespielt werde. Das müsse ich mir mal ansehen, das sei großartig! Ich würde wohl ersten Platz gehen, der koste 50 Pfennig. Und hinterher sei Tanz. Manchmal werde auch eine Gans ausgelost.
Die Büttnerin vertrage auch die Zeitungen im Dorfe, das »Wochenblatt« und das »Tageblatt«. Mir würde er das »Tageblatt« empfehlen, das »Wochenblatt« sei zu »labrig«. Das heißt, im »Tageblatt« ständ' ja meistens auch nicht viel Gescheites. Am schönsten sei die »Geschichte«. Die jetzige hieße: »Die Diamanten des Brasilianers.« Es sei schon die 46. Fortsetzung, aber er könne mir die alten Nummern geben.
Hier wurde mir etwas schwül, und ich unterbrach den Menschenfreund.
»Und der Burgwirt, was ist denn das für ein Mann?«
»Hm!« machte Herr Sternitzke und zuckte mit den Achseln, »mein Fall is a ja nich.«
»Hoho, hoho!«
»Das heißt – je, je – ich red' ihm ja gar nischt Schlechtes nach. Gar nich! A hat ja sogar 'n Oberkellner und is schwer reich, 's Bier is bloß so so im Winter; sonst is alles sehr passabel. Aber sehn Se – ich denke, er wird Ihn' zu fein sein. Soweit ich Sie kenne, sind Sie doch 'n ganz gemütlicher Herr. Na, und der Burgwirt – brummig, sag' ich Ihn' – macht keen Witz und nischt – und schrecklich stolz is a.«
»So! Na, ich werd' mich bemühen, mit ihm auszukommen.«
»Tun wird a Ihn' nischt! A is eben bloß zu stolz. A denkt, a is was Feineres als die Dorfleute, und runter ins Dorf kommt er bale gar nich.«
Wir bogen inzwischen in die Dorfstraße ein, und der Fuchs, der die Nähe seines Stalles witterte, setzte sich in schlanken Trab. Herr Sternitzke fragte, ob er mich auf den Schloßberg hinauffahren solle, es ginge allerdings sehr steil. Ich dankte ihm und stieg vor der Tür des »Silbernen Löffels« aus.
»Woll'n Sie mir nich bald mal die Ehre antun?« fragte Sternitzke und wies mit der Hand nach der Tür.
Ich trat ein. Die Wirtsstube war groß, freundlich und sauber, nebenan war das Honoratiorenstübchen. Dort hinein wurde ich geführt.
»Weib!« rief Sternitzke nach der Küche. »Weib, komm' mal raus!«
Auf diesen Ruf stürzten fünf kleine Kinder in die Gaststube, Buben und Mädchen.
»Sind das alle Ihre Kinder?« fragte ich, indem ich mit den Kleinen freundlich war.
Herr Sternitzke kratzte sich hinterm Ohr.
»Olles meine! Und außerdem sind noch drei Stück da, – 's kleenste reichlich 'n halbes Jahr und 's älteste neune.«
»Also jedes Jahr eins?«
»Ja! Immer im November oder Dezember! – Weib, komm doch mal raus!«
Es rührte sich nichts.
»Da will ich doch a mal sehn, ob die nich raus kommt!«
Herr Sternitzke ging sehr energisch nach der Küche, um nach einiger Zeit mit der lakonischen Botschaft zurückzukehren: »Sie kummt nich!«
»Na also, was ist Ihnen gefällig, Herr Doktor?« Diese Bezeichnung wurde in der Folgezeit für mich im Dorfe allgemein üblich.
»Ich bitte um eine Tasse Kaffee und zwei Eier – flaumweich!«
»Ah, wie der Herr Pfarrer! Gleich – gleich!«
Und er rannte wieder nach der Küche. Auch die Kinder verzogen sich. Ich war allein, kehrte in die Gaststube zurück und machte einen Spaziergang durch das große Gastzimmer, um die lahmgeschüttelten Glieder etwas gefüge zu machen. Neben der Küchentür blieb ich stehen. Dort hing eine ortspolizeiliche Bekanntmachung, die mich interessierte.
Während ich noch so las, hörte ich, wie drinnen in der Küche eine Tür ging und jemand eintrat. Die folgende Unterhaltung wurde in einem solchen »Flüstertone« geführt, daß ich alles verstehen konnte.
»Tag, Sternitzke!«
»Tag, Oberförster!«
»Na?«
»Was – na?«
»Na, is er da?«
»A is!«
»Ich sah deine Fuhre draußen stehn. Fährst 'n wohl noch auf 'n Berg?«
»Nee, looft lieber!«
»Hihi! Der Schlauberger! Was is er denn für einer, he?«
»Sehr feiner Mann – Doktor oder Professor oder so was.«
»Ja, ja, aber du weißt schon: was will er denn hier? Was is sozusagen seine Kommission hier?«
»Weeß ich nich! – Zwei Minuten sind rum!«
»Tu nur nich so dicke, Sternitzke! Mir kannst's schon sagen. 'n politischer Verbrecher is er wohl nich?«
»Nee!«
»Und so 'n Kriminalfall – Duell – Spieleraffäre – oder so was – wie?«
»Nöö! Zweieinhalb Minuten!«
»Na, zum Deibel, was is er denn da?«
»'N sehr netter Mann is er, trinkt Kaffee und ißt weiche Eier wie der Pfarrer und sagt, 's is gar nich hübsch vom Oberförster, daß er so neugierig ist.«
»Weißt du, Sternitzke, dich kann der Affe lausen; adje!«
»Adje! Drei Minuten sind rum!«
»Hör' mal, Sternitzke, übrigens habe ich ein Recht zu fragen; denn ich bin stellvertretender Amtsvorsteher, verstehst du?«
»Ja, aber wenn der Amtsvorsteher da is, hast du außer deinen Stiefelabsätzen gar nischt zu vertreten und auch nischt – halt – dreieinhalb Minuten – raus!«
»Sternitzke, es is geradezu frech von dir, mich so zu behandeln; – das – das is eine Infamie – jawohl, – ich – ich – hä, vielleicht weißt du selber nichts –«
»Ich? Hoho! Alles weiß ich! Alles hat a mir erzählt – seine ganzen Verhältnisse. Auguste, hast 'n Kaffee gebrüht?«
»Denkst wohl, ich kann hexen, du Schafskopp?«
Das klang nicht gerade lieblich.
»Bravo, Frau Sternitzke, bravo!« applaudierte der Oberförster. »Seine ganzen Verhältnisse! Blech! Da hätt' er viel zu erzählen! Na, übrigens ist mir ganz egal, was er ist, schert mich nich 'n Pfifferling, is mir ganz Wurst –« »Hm! Was will ich dir sagen, Oberförster! Uffpassen soll a auf dich, und 'm Baron Rapport machen –«
»Wa – as! Aufpassen? Auf mich? Rapport? Ein Spion, ein Schnüffler, ein Spürhund, ein Denunziant, pfui Deibel noch einmal –«
»Brüll doch nich so, Kerl, a hört's ja sonst!«
»Is mir ganz egal; wenn man mir so kommt, dann brüll ich, und wenn's die ganze Welt hört, und wenn's der Herr Baron selber hörten, da brüll ich, daß die Wände –«
»Aber es ist ja bloß Spaß, du Schöps! Ein riesig gemütliches Heft is a, keine Spur von Spion, nerviös is er, weiter nischt. Ah, nu is raus, nu hab ich mich doch verschnappt, man kann aber wirklich kee Geheimnis nich haben.«
»Ich werd dir schunn die Geheimnisse anstreichen!«
»Bravo, Frau Sternitzke, bravo! Was tut er erst so! Mir einen Aufpasser! Das fehlte ja gerade noch. Also nervös, je, je! Gehirnerweichung oder Verfolgungswahnsinn oder so was – nich, Sternitzke?«
»Weeß ich nich, aber vernünftiger wie du is er bestimmt! Alte, wenn du jetzt mit 'm Kaffee nich fertig wirst, kriechen die flaumweichen Eier hier erst aus.«
»Do brüh dir 'n doch salber, du Lops!«
Das war wieder echt schlesisch. Ein energischer Frauentritt, ein Zuklappen der Türe, ein tiefes Aufseufzen Sternitzkes, und dann war große Stille.
»A su is se!« seufzte Sternitzke.
»Ja, kann ich ihr auch gar nicht übel nehmen,« knurrte der Oberförster, »du beträgst dich ganz – wie soll ich sagen – ganz rabiat beträgst du dich!«
»Schneid lieber a paar Schnittel ab, Bernhard; sunst verhungert der Doktor vorher!« wimmerte Sternitzke. »Werd' mich hüten, wo ich so behandelt werde – eine Infamie ist's –«
»Schneid, Bernhard, schneid! Ich erzähl dir olles, olles erzähl ich dir. Wo hat 'n jetzt die Alte wieder 'n Kaffeesack hingehangen? Olles erzähl ich dir, Bernhard.«
»Wenn du was weißt –«
»Viel weeß ich, viel! Olles weeß ich! Schneidste, Bernhard?«
»Ja, ich schneide. Wie viel denn?«
»Viere! Aber nich zu dicke!«
Hier ging ich leise von der Küchentüre zurück nach dem Honoratiorenstübchen. Etwa fünf Minuten vergingen noch, dann erschien Sternitzke mit einem Tablett, brachte mir den Kaffee, die Eier und die Schnitten und sagte: »Meine Frau läßt sich empfehlen und entschuldigen.«
»Schon gut, Herr Sternitzke. Ich danke sehr!« Und ich langte zu.
Nach einem Weilchen knarrte die Tür, und der Oberförster trat ein.
»Guten Tag, ah!«
»Ah, guten Tag, Herr Oberförster, das ist aber hübsch, daß du zufällig gerade mal –« heuchelte Sternitzke.
»Ja, ich – ich – wollte bloß im Vorübergehen mal schnell – mein Name ist Gerstenberger!«
»Unser Herr Oberförster, der neue Herr Doktor, der auf die Burg zieht,« stellte Sternitzke vor.
»Ach, das freut mich, Herr Oberförster, ich soll Sie schön grüßen vom Herrn Baron; er hat mir sehr viel Liebes und Gutes von Ihnen erzählt.«
»Ja, ja, hat er, hat er? Ach, Sie erlauben wohl, Herr Professor?«
»Aber ich bitte sehr, Herr Oberförster!«
Und wir saßen zusammen, und Sternitzke brachte uns Bier »vom Faß«.
In die Romantik
Nun stieg ich hinauf. Die Abendsonne leuchtete mir.
Der Waldweg war nicht allzu breit, und die Buchenkronen so mächtig, daß sie sich über mir schlossen zu einem langen Bogengange.
Ich ging langsam. Es war nicht, um in Stimmung zu kommen, die war da, als das letzte Wort der harmlos-neugierigen Männer da unten an meinem Ohr kaum verklungen war.
So wie man durch einen Kirchengang langsam schreitet oder durch einen alten Korridor behutsam geht, so ging ich. Und ich wehrte meiner Phantasie nicht. Meine Seele kann sich wandeln; sie kann an einem Tage jung und alt sein. Immer, wenn ich Menschen sehe, ist sie alt; und immer, wenn die Bäume über mir rauschen, ist sie jung.
Ein Schauern überkam mich in dem Halbdunkel. Ich fühlte mich auf einmal allein – fern von allen – verlassen – O du süße, süße Kinderfurcht, dich möchte ich noch einmal genießen!
Ich schloß die Augen. Da wurden alte Traumbilder vor mir lebendig.
Frau Dolores kam, eine schöne, blonde Frau – Sie schaute mich an mit wehen Augen und fuhr mir mit weißer Hand prüfend durch die Haare.
Nein, auch ich war nicht – er! Da ging sie zur Quelle. Das Wasser rann, und ihre Tränen rannen.
Frau Dolores, was weinst du? Weinst du um Männertreue? Eben weil du weinst, kommt er nicht wieder. Glaube mir, Frau Dolores! Ich kenne die Menschen – ach, so unglückselig genau; ich bin ein kluges Weltkind von draußen. Weil du weinst, kommt er nicht wieder – arme Dolores! Wenn du lachtest, würde er vielleicht kommen. Im Gehölz klang Saitenton. Da saß er – Wolfram mit der Harfe.
Die Augen irrten ihm nach der Quelle zu Dolores. Seine schönsten Lieder sang er –
Verlorene Schönheit! Frau Dolores wird dich nicht hören, Wolfram. Wenn du sie lachen sehen willst, geh, – suche den andern! Singe ihm Heimatlieder, bis ihm das Herz springt vor Heimweh, und dann führe ihn zu ihr!
Da wirst du sie jubeln hören. – Und du schleiche dich fort in die Welt –
Aber der werbende Saitenton klingt weiter – Herr Wolfram ist nur ein Mensch –
Ein Knecht kommt vorbei. Er ist schön wie ein Held. Die Kühnheit wohnt auf seiner Stirn, der Trotz auf seinen Lippen, die Kraft in seinen Fäusten. Und in seinen Augen sind Gedanken.
Hüte dich Burgherr, der ist gefährlich!
Der Knecht schlägt mit seinen Fäusten gegen einen Stein. Die Hände bluten ihm, aber der Stein bleibt ganz. – Und aus tausend solchen Steinen ist die Burgmauer gebaut! – Unüberwindlich!
Da gräbt der Knecht verzweifelnd die blutenden Hände in die weichen Locken und stürmt hinunter ins Tal in seine elende Hütte –
Ich betrachte den Stein, an den er geschlagen hat. Jahrhunderte lang werden seine Wassertröpflein drüber rinnen, wenn es taut oder gewittert. Und dann wird der Stein mürbe sein und zerfallen.
Denk' an deine Urkinder, schöner Knecht, und werde froh! –
Ein Mönch kommt des Weges. Einen Rosenkranz hält er in der Hand, und die Perlen gleiten langsam, und die Lippen zucken dazu –
Jetzt weiß ich nicht, ist der von ehedem oder von heut – träume ich noch, oder bin ich schon wach –
Nach Frau Dolores schaue ich aus, nach Wolfram, nach dem Knechte –
Da stehe ich dicht vor der Burg.
Hoch ragt das in seinem Verfall noch stattliche Bauwerk vor mir auf.
Die Burgmauer umschließt noch den ganzen Hof; freilich zeigt ihr oberer Rand zahllose Lücken, und hin und wieder reicht eine von diesen Lücken bis auf die Sohle. Aber das Hauptgebäude scheint gut erhalten zu sein, und ebenso der hohe sechseckige Turm. Das Abendgold liegt auf den Fenstern, und die Butzenscheiben glänzen in ihrer bleiernen Umrahmung wie Riesenrubine in Altsilberfassung.
Das Hauptgebäude hat drei Stockwerke. Bis über das zweite hinauf rankt blau-grüner Efeu. Auch die kleine gotische Pforte in der Burgmauer ist ganz von Efeu umwuchert. Unten im tiefen Burggraben liegt rotes Laub, und zwischen den Holzstämmen, aus denen die Brücke gezimmert ist, wächst Moos.
Zögernd setze ich meinen Fuß darauf. Das Herz pocht mir plötzlich sehr laut. Die ungewohnte Romantik faßt mich an, und der Gedanke, da hineinzugehen zu fremden Leuten in das sonderbare Haus und dort Heimatrecht zu begehren, regt mich auf.
Wenn jetzt der Türmer bliese und ein langhaariger Diener käme, mich nach Wunsch und Begehr, Namen und Weg zu fragen, ich würde mich kaum wundern. Da geht die Pforte auf, und ein Mann erscheint. Er ist schwarz gekleidet, sein weißes Vorhemd und sein langer Rock sind tadellos, aber ganz altmodisch. Er mag ein Fünfziger sein oder Sechziger; ein grauer Bart fällt ihm auf die Brust herab, und auch seine halblangen Haare sind ergraut.
»Guten Abend,« sagt er ernstfreundlich. »Sie sind der Herr aus der Stadt, den wir erwarten?«
»Ja, mein Herr! Und Sie sind wohl der Gebieter dieser Burg, Herr Waldhofer? Da empfehle ich mich bald Ihrer Gunst und Gastfreundschaft.«
Er lächelte kaum merklich.
»Seien Sie willkommen,« sagte er und machte eine einladende Handbewegung. Ich trat in den geräumigen Hof. Herr Waldhofer ging mir so rasch voran, daß ich nicht viel Zeit hatte, mich umzusehen. Wir traten in einen dämmrigen Hausflur und bald darauf in ein geräumiges, niederes Zimmer.
Die ganze Einrichtung verriet die Gaststube; aber die schweren Tische und Stühle waren altdeutsch, und an den Wänden waren viele Geweihe angebracht und eine Anzahl ausgestopfter Vögel.
»Seien Sie nochmals willkommen, Herr Doktor!«
»Ich danke Ihnen, Herr Waldhofer!«
»Sie wünschen etwas zu essen?«
»Nein, ich danke; Herr Sternitzke hat mich von der Bahn abgeholt, und da hab' ich etwas bei ihm zu mir genommen.« »Jawohl! Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten?«
»Ich bitte darum!«
Er ging hinaus. Ich habe mich von Jugend auf eines ausgezeichneten Gehörs zu erfreuen gehabt. So kam es, daß ich eine melodische Frauenstimme in schmerzlichem Tonfall draußen sagen hörte: »Nichts? Oh, oh, meine schönen Rebhühner!«
Ei, das war schade! Mit geringer Dankbarkeit dachte ich an die von Herrn Sternitzke gekochten Eier und an die vom Oberförster geschnittenen, fürchterlich dicken Brotstullen zurück. Aber satt war ich, das stand bombenfest. Waldhofer kam zurück. Er stellte zwei Gläser auf den Tisch und goß ein. Dann hob er sein Glas und sagte: »Auf einen glücklichen Winter!«
Ich war überrascht von den Umgangsformen dieses Mannes. Es war kein Wunder, wenn er Franz Sternitzke als etwas übermäßig Feines vorkam.
Waldhofer setzte sich mir gegenüber. Er schaute mir aufmerksam ins Gesicht, ohne daß ich doch das lästige Gefühl hatte, gemustert zu werden.
»Ihre Sachen sind vorgestern hier angekommen,« sagte er; »ich habe sie in Ihren Zimmern bereits untergebracht.«
»Ich mache Ihnen viele Scherereien, nicht wahr?«
»Nein! Der Herr Baron hat für alles gesorgt, und ich habe mich lediglich an seine Anordnungen gehalten.«
»Der Herr Baron will mir sehr wohl, und ebenso die Frau Baronin.«
Waldhofer nickte und sah in sein Glas.
»Ich habe oben im zweiten Stock zwei Gastzimmer für meinen Sohn einrichten lassen, wenn er mal zu den Ferien kam. Sie sind bescheiden möbliert, aber doch so, wie wir's jetzt gewöhnt sind. Ich hätte sie Ihnen abgetreten; denn mein Sohn braucht sie nicht mehr. Aber Sie suchen ja wohl die Romantik.«
»Jawohl! Das heißt, ich bin mir über meine Stellung zur Romantik selber nicht recht klar.«
Waldhofer sah mir voll ins Gesicht.
»Die Menschen sind jetzt noch weit von ihr. Aber wenn sie noch weiter sein werden, kehren sie zu ihr zurück. Es geht alles im Kreise.«
Ich erschrak beinahe, als er das so sagte.
»Sie beschäftigen sich mit der Kunst, Herr Waldhofer?« fragte ich mit Respekt.
»Ein wenig. Der Winter ist lang hier oben.« Und er lenkte ab.
»Herr Sternitzke ist ein lustiger Mann, nicht wahr?«
»Ja, wie es scheint, eine naive, brave Haut – ebenso der Oberförster.«
»Ah, den kennen Sie auch schon? Das freut mich! Sie werden die beiden brauchen, wenn wir erst hier im Gebirge eingeschneit sind; dann ist es sehr einsam.«
Und er sprach vom Winter im Gebirge. Ich hatte bald heraus, daß mein Wirt ein gebildeter Mann sei, vielleicht noch etwas mehr. Mich nach dem Zwecke meines Herkommens zu fragen, fiel ihm offenbar gar nicht ein. Da hielt ich's für geboten, mich von selbst ihm gegenüber auszusprechen.
Ich sprach von meiner Großstadtflucht, von meiner Einsamkeitssehnsucht. Ich wisse sie mir selber nicht recht zu erklären; denn eine so recht trübe, herbe Erfahrung hätte ich gar nicht gemacht. Die Summe kleiner Unannehmlichkeiten sei es wohl, die mich zur Flucht getrieben, vielleicht sei es auch bloß Abwechselungssucht, daß ich aus dem Großstadtwinter in den Waldwinter floh.
»Im Grunde werden's die Liebe zur Natur und die Jugend sein,« sagte Waldhofer.
Da klopfte es an die Tür. Gleich darauf erschien ein Mädchen mit einer Lampe. Das milchhelle Licht bestrahlte das rotwangige, entzückend frische Gesicht einer vielleicht Achtzehnjährigen.
»Meine Tochter Ingeborg,« sagte Herr Waldhofer, »da unser Gast!«
Ich sprang auf und machte meine Verneigung. Das Mädchen stellte das Licht auf den Tisch. Etwas verwirrt, aber mit einem reizenden Augenaufblitzen, reichte es mir die Hand. »Guten Abend und schön willkommen auf dem Waldhofe! Gott, das ist aber weit bis zu uns?«
»Sehr weit, mein Fräulein! Aber ich wäre ganz gern auch noch von viel weiter hergekommen.« »Ja – a? Das freut mich! Es ist aber auch sehr hübsch auf dem Waldhofe, überhaupt im Sommer – den Winter mag ich gar nicht so gern leiden –«
»Nein, denn der sperrt unruhige Leute in die Stube,« sagte Waldhofer.
Das Kind lachte glücklich und fing gleich zutraulich an zu plaudern.
»Mein Vater sagt, ich war' ein wildes Ding – aber das bin ich schon lange nicht mehr. Ich war doch auch in der Pension, auch in der großen Stadt, Herr Doktor, ja! Damals mit Walter! Du, sieh doch mal, Vater, nicht wahr, er – er ist unserem Walter ähnlich?«
»Laß, Ingeborg, laß das!« »Nein, Sie – Sie sind aber wirklich dem Walter ähnlich, sehr sogar, der hat auch solche Augen gehabt, der hat –«
»Aber so laß doch sein, Ingeborg!«
Waldhofer ging nach dem Fenster hin. Ingeborgs Augen wurden traurig.
»Walter war mein einziger Bruder, Herr Doktor. Er war auch Doktor, ein junger Arzt, und da hat er sich an einem kranken Kinde angesteckt und ist gestorben. Mit 26 Jahren! Denken Sie mal!«
»O, mein gnädiges Fräulein, das tut mir leid, das tut mir herzlich leid!«
»Das ist doch keine Unterhaltung für den ersten Abend, Ingeborg,« sagte Waldhofer, blieb aber am Fenster stehen.
Ingeborg faßte sich rasch.
»Ich wollte Sie ja bloß ein bißchen aufklären, Herr Doktor, wenn Sie doch mal jetzt im Hause wohnen, nicht wahr? Außer Vater und mir sind nur noch die alten Baumannleute da. Der alte Baumann hackt im Winter Holz, und im Sommer bekommt er eine schwarze Jacke angezogen und muß den Oberkellner spielen. Ist das nicht lustig?«
»Sehr lustig!«
Während sie sämtliche Fenster schloß, plauderte sie immer munter weiter.
»Ja, im Winter kommen beinahe gar keine Gäste zu uns. Die Dorfleute gehen alle zum Sternitzke, weil der so hübsche Witze macht. – Aber im Sommer! Da ist manchmal der ganze Hof voll! Der alte Baumann und das Mädchen, das wir halten, rennen sich halbtot. Ich darf keinen Gast bedienen. Das leidet der Vater nicht. Und ich möchte doch so gern mal mit einem Dutzend Biergläser laufen und sagen: »Bitte, meine Herrschaften!«
»Ja, und dir dann ein Trinkgeld geben lassen.«
»O pfui, Papa, das wird keiner machen. Sie werden schon sehen, daß ich ein Fräulein bin. Der Herr hat's auch gleich gesehen und mir einen so tiefen Diener gemacht, als ich kam.«
»Aber Ingeborg!«
»Ich geh' schon Papa! Gute Nacht, Herr Doktor!«
Und sie war draußen. Aber sie guckte noch einmal zur Tür herein.
»Was furchtbar Schlimmes muß ich Ihnen noch sagen: Morgen zum zweiten Frühstück kriegen Sie gewärmte Rebhühner!«
Klapp war die Tür zu.
»Die wird's hier oben nicht verderben,« dachte ich.
»Sie ist ein Kind, das gern plaudert, Herr Doktor,« sagte Waldhofer wie zur Entschuldigung, »und ich bin so ein finsterer Mensch, der ein bißchen Frohsinn um sich braucht.«
»O, Herr Waldhofer, etwas Herzerfrischenderes hätte ich mir gar nicht wünschen können.«
Wir saßen noch ein Weilchen zusammen und plauderten.
Da sagte der Wirt: »Ist es Ihnen gefällig, jetzt nach Ihren Zimmern zu gehen?«
Wir gingen hinauf. Ich war schon durch viele Ruinen gewandert: in Österreich, in Thüringen, am Rhein, in Schlesien; aber nie hatte mich solch ein Schauer ergriffen wie jetzt, da ich die schmale Treppe hinaufstieg.
Die Wand am Treppenaufgang war mit alten Bildern behangen. Geharnischte Männer, Frauengesichter mit großen, runden Augen, dazwischen mal ein Herzog, ein Bischof, ein dickes Kindergesicht. Vor einem kleinen Bilde blieb ich stehen.
»Sebastian Brant?« fragte ich.
»Ja,« erwiderte Waldhofer; »ich besitze eine Handschrift des ›Narrenschiffes‹. Wenn Sie mal Einsicht nehmen wollen? – Bitte, hier ist Ihr Zimmer!«
Er öffnete eine schwere Tür. Wir traten in einen Saal. Die Lampe, die Waldhofer trug, reichte bei weitem nicht aus, den Raum genügend zu erleuchten. Zunächst bemerkte ich nichts als eine mächtige Tafel, um die eine Reihe riesiger Lehnstühle standen. Über der Tafel hing eine Art Kronleuchter, der aus einem einzigen riesigen Geweih gefertigt schien.
»Der alte Bankettsaal,« bemerkte Waldhofer. »Der Herr Baron hat ihn ausdrücklich zu Ihrem Wohn- und Arbeitszimmer bestimmt und die nötigen Mittel bewilligt, ihn instand zu setzen. Die Fenster schließen luftdicht, der Tisch, die Stühle und die Schränke sind gebrauchsfertig, und der Ofen ist erst gesetzt.«
Er zeigte mir einen riesigen altdeutschen Kachelofen.
»Er ist beinahe ein Kunstwerk, er sieht doch aus, als ob er zweihundert Jahre alt wäre. Sehen Sie mal dieses zerbröckelte Sims, diesen fürchterlichen Sprung, und da fehlen doch anscheinend zwei Kacheln, die Tür scheint sich auch kaum in den Angeln zu halten, dabei heizt er vortrefflich.«
Mir war plötzlich ganz beklommen.
»Ja, aber, aber die Kosten, die Kosten,« stammelte ich; »ich hab ja gar nicht daran gedacht, daß das alles so viel Umstände und entsetzliche Kosten machen wird.«
»Beruhigen Sie sich,« unterbrach mich Waldhofer,»der Baron ist reich, der kann für einen jungen Künstler schon mal was tun. Und er tut es ja auch für seine Burg. Sie sind Schriftsteller, nicht wahr?«
»Jawohl!«
»Ich habe gehört, daß manche von den Herren ein sehr großes Arbeitszimmer lieben, und manche ein recht kleines. Ich hab an beide Fälle gedacht. Hier« – er öffnete eine Tapetentür dicht neben dem Ofen – »Hab ich ein kleines Turmzimmer instand gesetzt, geheizt wird es vom Ofen mit.«
»Aber, Herr Waldhofer, Sie sind ja ein prächtiger Herr -«
Darauf gab er nicht acht.
»Dort drüben liegt Ihr Schlafzimmer – bitte, wenn es Ihnen gefällig ist –«
Wir traten in einen zweiten, mittelgroßen Raum. Ein großes Himmelbett gewahrte ich, einen alten Tisch, auf dem eine riesige irdene Waschschüssel und ein ebensolcher Krug stand, einen Schrank, ein paar Stühle und einen Diwan, mit einem grauen Felle überdeckt. In einer Ecke stand der Ofen, in demselben Stile gehalten wie der im Bankettsaal, nur kleiner.
Ganz überwältigt sank ich auf einen der Reisekörbe, die ich geschickt hatte, und sagte: »Also, das hier wäre die einzige Stilwidrigkeit in diesem romantischen Idyll: diese Körbe und ich.«
Waldhofer lächelte.
»Sie werden sich in den Stil hineinleben! – Wenn Sie heut noch auszupacken wünschen, darf ich Ihnen wohl den Baumann heraufschicken?«
»Ach ja, bitte, ich brauche doch so manches –« »Dann wünsche ich gute Nacht!«
Er ging. Ich sank wieder auf den Reisekorb und stützte den Kopf auf beide Hände. Ich starrte das riesige Himmelbett, das sich vor mir aufbaute, stumpfsinnig an, ohne einen bestimmten Gedanken. Ich hatte nur die Empfindung, daß ich mich in einer ganz ungeheuerlichen Situation befinde, in einer Situation, die ich mir selbst geschaffen und die nun doch anders auf mich wirkte, als ich gedacht hatte.
Die Tür in den Bankettsaal stand offen. Da war mir's, als ob mich ein Unbehagen von dort anfiele. Es war so finster da draußen; nur ein Stuhl ragte hoch auf in dem matten Lichtscheine, den meine Lampe hinauswarf. Ich ging hin und schloß die Tür.
Dann versuchte ich zu lächeln. Ich fürchtete mich wohl gar? Das wäre ja noch schöner! Ich trat an das Bett heran. Die Bettstelle wies alte, hübsche Holzschnitzereien auf, das Bettzeug aber war ganz modisch und, wie es schien, vorzüglich.
Ich würde wohl gut schlafen; ich war ja weit gereist. Da, ein langsamer, schlürfender Schritt draußen – ein leises Pusten und Schnauben – dann ein heimliches Klopfen – die Tür geht sacht auf – ein grauer Menschenkopf streckt sich herein –
»Womit kann ich dienen?«
Das war nun der echte Kellnerton.
»Ah, Sie sind wohl Herr Baumann?«
»Wenn Sie befehlen – ja! Ich bin Herr Baumann.«
»Sie werden so freundlich sein, mir den Korb auspacken zu helfen und diese Kiste öffnen.«
»Ganz wie der Herr befehlen!«
Und er schnitt eine rechtwinklige Kellnerverneigung und stürzte sich dann mit der Energie eines Athleten auf meine Kiste. Mittels eines Meißels und eines Hammers begann er sie zu öffnen. Dazu sprach er in einzelnen Absätzen:
»Wollen sich der Herr nur einen Augenblick gedulden – werde gleich so weit sein – wird alles prompt besorgt werden – können sich der Herr ganz darauf verlassen – werden sehr zufrieden sein – sehr schönes Wetter heute gewesen – Barometer seit vorgestern gestiegen – wart, du Beest, krach – so – bitte gehorsamst!«
Die Kiste war offen.
»Sie sind Oberkellner, nicht wahr, Herr Baumann?« fragte ich.
»Wenn der Herr befehlen, ja – das heißt nur im Sommer, wenn's dem Herrn weiter nichts verschlägt.«
Nein, es verschlüge mir nichts weiter, versicherte ich und begann mit Baumann auszupacken. Ich wies ihn an, die Sachen vorläufig in irgendeinen Schrank, auf dem Diwan, auf einem Stuhl oder draußen im Bankettsaal auf dem Tische zu plazieren, und er schob von einem Orte zum andern, als ob er hundert Gäste zu bedienen hätte.
»Sagen Sie mal, was führen Sie denn so alles?« fragte ich, um etwas mit ihm zu reden.
»Lager, Pilsener, Kulmbacher, Selter, diverse Limonaden, Rhein-, Ungar-, italienische, französische, spanische Weine, Wiener Würstchen, kalten Aufschnitt, Sol-Eier, Hammel-, Rinds-, Kalbs-, Schweinebraten – nicht zu fett – Kopfsalat –«
»Gut, gut, Herr Baumann; ich frage ja bloß mal so.«
»Ja, wenn der Herr etwas zu speisen wünschen; gebratene Rebhühner sind sehr zu empfehlen –«
»Danke, die bekomme ich morgen gewärmt.«
Herr Baumann machte ein erschrockenes Gesicht.
»Ge – gewärmt, sagen der Herr?« stotterte er.
»Gewärmt, sagte ich! – Ich esse Gewärmtes mit Leidenschaft.«
Baumann schüttelte ganz fassungslos den Kopf. Im übrigen war ich mit seiner Dienstfertigkeit sehr zufrieden und spendierte ihm, ehe ich ihn entließ, ein Markstück. Das ließ er, ohne es zu betrachten, mit einer geschickten Handbewegung in die Hosentasche gleiten, ergriff seinen Meißel und Hammer und machte eine Verbeugung von staunenswertem Umfang.
»Danke gehorsamst! Beehren mich der Herr wieder!« Und er war draußen.
Der alte Kerl in der Barchentjacke hatte mir mit seiner Kellnerhöflichkeit die ganze Romantik verpfuscht. Aber ich war ihm nicht einmal böse. Ich fühlte mich behaglicher jetzt. Dort auf dem Diwan lag mein Schlafrock, brüderlich vereint mit meiner Gitarre; neben dem irdenen Waschgeschirr lag mein elegantes Reise-Necessaire, und neben der mittelalterlichen Bettstelle standen meine dunkelroten Schlafschuhe.
Ich hatte die fröhliche Hoffnung, daß ich hier heimisch werden könne. Und in dieser Hoffnung ging ich schlafen. Es war dreiviertel 9!
Ich war weit auf der Bahn gefahren, und die Bahnfahrt strengt mich an; ich hatte zwei Stunden lang auf Sternitzkes Droschke gesessen, und das war auch nicht gerade erholend; ich lag in einem tadellosen Bette, also ist es gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich sage, daß ich, ein Großstadtmensch, schon gegen 11 Uhr einschlief.
Freilich war's ein unruhiger Schlaf.
Herr Baumann kam, machte eine riskant aussehende Verneigung, ergriff meine Gitarre und sang mir unter einer schauerlichen Begleitung seine Sommer-Speisekarte vor.
Franz Sternitzke kam auf seinem Fuchse angeritten, sprang ab, fühlte mir den Puls und meinte, ich sei schrecklich nervös und müsse zurück nach der Großstadt.
Dann änderte sich das Bild, verzerrte sich. Die Seele flog zurück –
Im Pferdelehnwagen saß ich; ich zankte mit meinem Verleger. Ich wollte ihm eben eine mächtige Brandrede halten, da – kam der Oberförster, wetzte ein riesiges Brotmesser, setzte es mir auf die Brust und sagte, ich wäre ein elender Spion und müsse augenblicklich sterben.
Ja, und der Wasserkrug! Der vermaulte sich gegen das Necessaire, und gerade wollte er es mit Wasser bespritzen, da kam der Ritter Balduin aus dem Bankettsaale, oh, ein fürchterlicher Mensch, er kämmte sich mit meinem Kamm die roten Haare – und dann bekam er einen Totenschädel – und band sich meine Bartbinde über den zahnlosen Mund – und gräßlich! – er zog meinen Schlafrock und meine Schuhe an, legte sich auf den Diwan und richtete die hohlen Totenaugen unverwandt auf mich –
Da sank auch die Decke des Himmelbettes auf mich herab – langsam – langsam – um mich zu ersticken – und das Gerippe lachte.
In Todesangst erwachte ich. Ein mattes, ungewisses Licht fiel durch die beiden Fenster. Von der einen Wand sah ein Menschenantlitz auf mich herab – der Spuk hielt an. Nach einer Weile erst war ich klar.
Ich richtete mich im Bette auf und besann mich.
Dann sprang ich aus dem Bette, riß mit einem Ruck den Schlafrock vom Diwan und zog ihn an. Auch die Schuhe suchte ich hervor. Dann öffnete ich das Fenster. Der Mond schien draußen und die goldenen Sterne. Zu meinen Füßen rauschte der Wald. Ein blauer Berg grüßte herüber, und unten im Tale, im Dämmerscheine, lagen Menschenhäuser.
Ich atmete tief auf. Ja, das waren beruhigende Eindrücke.
Nun konnte ich schlafen.
Neue Heimat
Als ich erwachte, war ich so freudig wie ein Kind am Christmorgen, wenn es sich der Einbescherung vom vorhergehenden Abend erinnert, der vielen Gaben, die er gebracht, und der Knecht-Ruprecht-Furcht, die glücklich überstanden ist. Es war erst einhalb acht Uhr. Trotzdem stand ich schon auf. Meine erste Betrachtung galt wieder dem riesigen Himmelbette, dem ich nun entronnen war. Mit äußerster Vorsicht befühlte ich die alten, grünseidenen Vorhänge.
Wer mochte sie zuerst gerafft haben? Vielleicht die schöne Frau mit dem harten, traurigen Gesichte, deren Bild an der Wand hing? Warum sah sie so traurig aus? Gab es auch damals schon Herzeleid – Witwenkummer – Muttersorgen – oder auch Ehen ohne Liebe?
O du alter Betthimmel, was für Gedanken mögen zu dir schon emporgestiegen sein! Wenn du ein bißchen Glück aufgespeichert hast, taue es auf mich hernieder. Den Kummer mögen die Würmer fressen, die in deinem Holze bohren!
Mit diesen Gedanken wandte ich mich dem Wasserkruge zu. Der dickbäuchige Geselle war so schwer, daß ich ihn nur mit beiden Händen regieren konnte. Es ist traurig, daß wir Neuen so schwach sind. Körperkraft ist eine der besten Gottesgaben. Das wissen alle die, die sie nicht haben.
Ich wusch mich und kleidete mich an; dann trat ich ans Fenster. Ein wunderbarer Herbstmorgen lag auf den Fluren. Mir ist es immer so gegangen: Wenn ich in einem fremden Hause morgens ans Fenster trat und die Sonne scheinen sah, da faßte mich eine so jugendstarke, wanderlustige Seligkeit, ein Drang hinaus auf die fremde, sonnige Flur, als ob da tausend nicht gekannte Wonnen harrten, die ich nun finden sollte.
Und dann, bei diesem Gesundheits- und Glücksgefühl waren auch immer die Gottes- und die Menschenliebe am stärksten in meinem Herzen.