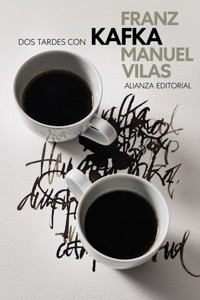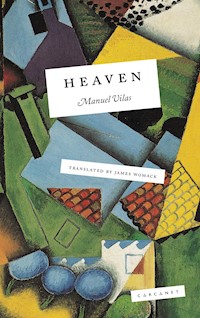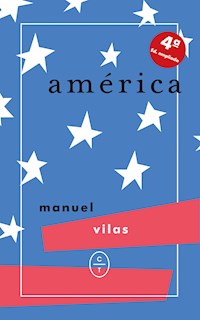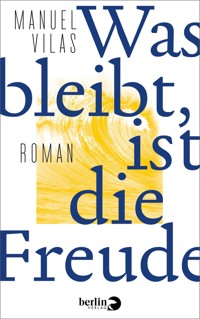
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man muss an das Glück glauben ... Diesmal ist Manuel Vilas auf Reisen: In Hotelzimmern und Flughäfen setzt er die Erinnerungssymphonie seines Erzählers fort. Und er bereichert sie mit einem neuen Motiv: der heiteren Freude. Auch dabei ist die Vergangenheit überall, wie der Wellenschlag am Strand: Sie ist in den Orangensaftpressen, in den Hemden, die nie weiß genug sind ... Vilas' literarische Kühnheit und seine Fähigkeit, das Intime ins Universelle zu projizieren, machen ihn zu einem der wichtigsten Autoren unserer Tage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem Spanischen von Astrid Roth
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert. Außerdem wurde diese Übersetzung gefördert durch die Accion Cultura Espanola.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Alegría bei Planeta, Madrid
© Manuel Vilas, 2019
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Stocksy/Gary Parker
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Llegué por el dolor a la alegría.
Supe por el dolor que el alma existe.
Por el dolor, allá en mi reino triste,
un misterioso sol amanecía.
José Hierro
1
All jenes, was wir liebten und verloren, was wir sehr liebten, was wir liebten, ohne zu wissen, dass es uns eines Tages genommen würde, all jenes, was uns, nachdem wir es verloren hatten, nicht zerstören konnte, auch wenn es mit außerordentlicher Kraft, brutal und beharrlich auf unseren Zusammenbruch hinzuwirken schien, verwandelt sich früher oder später in Freude.
Die menschliche Seele hätte nicht auf die Welt herabsteigen sollen.
Sie hätte oben bleiben sollen, in der himmlischen Unergründlichkeit, in den Sternen, im tiefen Raum. Sie hätte sich von der Zeit fernhalten sollen; der menschlichen Seele wäre es besser ergangen, wenn sie nicht menschlich wäre, weil die Seele unter der Sonne altert, sie schmilzt, sie verfällt und entzündet sich zu Millionen Fragen, die sich über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausbreiten, die nur eine Zeit bilden, und das ist die Lebenszeit eines jeden von uns, eine Zeit, in der die Liebe eine stete, unerfüllte Sehnsucht ist, die uns die Schönheit des Lebens vor Augen führt und dann verschwindet.
Sie verschwindet.
Sie überlässt uns einer gewaltigen, bitteren und heiklen Stille.
Millionen Fragen, die menschliche Wesen waren, bevor sie sich in Fragen verwandelten. Millionen Körper, Millionen Väter, Mütter, Söhne und Töchter.
Und wir bleiben allein und erschreckt zurück.
Die menschliche Seele sind wir, wir alle, die wir Liebe suchen, alle, die wir tagtäglich danach suchen, geliebt zu werden, die wir tagtäglich darauf hoffen, dass sich die Freude einstellt, auf was sonst sollten wir hoffen.
Wie sehr wünschen wir uns alle, dass das Leben eine Ordnung und einen Sinn hat, aber es gibt nur Zeit und flüchtige Abschiede und in diesen Abschieden lebt die überaus große Liebe, die ich gerade empfinde.
Das verwirrt mich, verstört mich.
Hier stehe ich, verlassen, und gleichzeitig spüre ich die Kraft der Freude, aber auch die unbestimmte Wut des Lebens in mir.
Wie alle menschlichen Wesen.
Weil wir alle gleich sind.
Und in dieser gierigen Freude liegt alle Erkenntnis, die wir über das Leben zusammenzutragen vermochten.
Anfang 2018 veröffentlichte ich einen Roman, einen Roman, der die Geschichte meines Lebens erzählt, dieses Buch verwandelte sich in einen Abgrund.
In diesem Buch lebte die Geschichte meiner Familie.
Bach und Wagner, mein Vater und meine Mutter.
Ich packte meine Familie in ein viel beachtetes Buch, und das ist das Schönste, was ich im Leben gemacht habe.
Bist du verrückt?, sagten viele zu mir.
Nein, es ist nur Liebe, antwortete ich. Nur Liebe und Notwendigkeit und Hoffnung. Wenn du über deine Familie schreibst, wird diese Familie wieder lebendig. Wenn ich über meinen Vater und meine Mutter schrieb und das, was wir waren, kam die Vergangenheit zurück und sie war groß und gut. Das war alles, das war es, was ich gemacht habe.
Ich befinde mich in diesem Moment in einem Hotel in Barcelona.
Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal mit Kugelschreiber und Notizbuch schreiben würde, wie ich es gerade mache. Der Computer steht vor mir, aber ich brauche ihn nicht mehr.
Ich habe in diesem Hotel dreimal das Zimmer gewechselt. Das erste gefiel mir nicht, weil es zu warm und der Ausblick schrecklich war. Als sie mir das zweite gaben, dachte ich, dass ich dort Ruhe finden könnte: diese Erleichterung, diese Notwendigkeit, zu entspannen, nicht länger in einem nervösen Durcheinander, einem Hin und Her gefangen zu sein.
Aber als ich eine Weile ausgestreckt auf dem Bett lag, wurde mir klar, dass ich nicht erfolgreich gewesen war. Das Zimmer ging auf die Diagonal raus, eine der Hauptverkehrsadern von Barcelona, und der Lärm, der von der Straße heraufdrang, war übermäßig. Aus dem übermäßigen wurde ein höllischer Lärm. Es war der Lärm der Unbekannten, Hunderter Männer und Frauen, die sich in ihren Autos oder auf ihren Motorrädern oder in Gespräche vertieft durch die Stadt bewegten. Der Lärm verwandelte sich nach und nach in einen Feind. Ich wurde nervös. Wie dumm von mir, dass ich beflügelt von dem ersten positiven Eindruck meinen Koffer ausgepackt hatte. Ich sah meinen Koffer, wie er dort offen auf dem Tisch lag. Ich überlegte, wie lange es dauern würde, alles wieder einzupacken.
Ich betrachte meine Sachen, als gehörten sie einem Geist ohne Körper. Meine schwarzen Pullover, meinen Computer, meinen Terminkalender, meinen Kulturbeutel. Sie sehen aus wie Sachen, die mein Vater benutzte, sie sehen aus, als gehörten sie meinem Vater und nicht mir.
Es war der 1. Juli in Barcelona. Ich spürte die Feuchtigkeit, die die ganze Stadt durchdrang. Ich könnte mich nicht an diese Feuchtigkeit gewöhnen, die mich auf eine demütigende Weise zum Schwitzen brachte. Mein Leben und die Hitze hatten sich irgendwann in meiner Vergangenheit verbrüdert. Wenn ich tot bin und nicht mehr schwitze, werde ich das Nichts erreichen. Das Nichts bedeutet, die spanische Hitze nicht mehr zu spüren, die immerwährende Hitze aller spanischen Städte: feuchte Hitze oder trockene Hitze, auf jeden Fall Hitze.
Die Hitze und das Leben sind ein und dasselbe für mich gewesen.
Ich bin fünfundfünfzig Jahre alt und in ein paar Tagen werde ich sechsundfünfzig. Ich glaube mir dieses Alter nicht. Wenn ich es mir glauben würde, wenn ich es in all seiner unerbittlichen Wahrheit akzeptieren würde, müsste ich an den Tod glauben. Man kann nicht leben, wenn der Tod die Gedanken beherrscht, auch wenn er uns wie nichts anderes so unbändig entströmt. Er ist dort, in deinem Herzen. Niemand hat seinen eigenen Tod lieben wollen, niemand möchte mit ihm sprechen, ich schon, ich will, weil er mir gehört.
Ich schaute mich im Spiegel an. Das Altern der Männer ist immer weniger offensichtlich, es versteckt sich. Die Gesellschaft zeigt sich beim Altern der Männer nachsichtig, anders als bei den Frauen, da ist sie unerbittlich.
Ich rief bei der Rezeption an und bat darum, ein weiteres Mal das Zimmer wechseln zu dürfen. Jemand kam, um mir zu helfen. Ich dachte daran, wie man sich da unten das Maul über mich zerreißen würde.
»Um diesen Spinner kümmerst du dich jetzt.«
»Nein, ich war letzte Woche schon bei einem; und der war noch viel schlimmer als der hier, weil er verheiratet war und von seiner Frau unterstützt wurde. Der hier ist wenigstens allein.«
Ich stellte mir dieses Gespräch vor, aber ich fühlte mich dabei keineswegs unwohl, sondern empfand fast Dankbarkeit, weil die Angestellten am Empfang an mich dachten und über mich lästerten. Alles ist Leben und alles dient dem Leben. In allem zeigt sich eine Huldigung des Lebens.
Ich kann diese Huldigung in allem, was einen Platz unter der Sonne hat, sehen.
Am nächsten Tag bat ich erneut darum, das Zimmer wechseln zu können. Und ich wurde Zeuge, dass das Leben Starrköpfe belohnt, diejenigen, die keine Ruhe geben, bis sie das Optimum herausgeholt haben. Beharrlichkeit kann wahnsinnig machen.
Sie gaben mir, vielleicht, weil sie mich satthatten, ein sensationelles Zimmer im fünfzehnten Stock, das oberste und wahrscheinlich beste des Hotels. Es war das perfekte Zimmer: groß, hell, das höchste des ganzen Gebäudes. In der Ferne konnte man das Meer sehen. Und außerdem gab es ein Fenster in der Dusche, aus dem man Barcelona aus einem anderen Blickwinkel sah.
Ich fühlte mich wie der Herr der Stadt.
Die Stadt lag mir zu Füßen.
Ich stellte die Klimaanlage an und alles war perfekt.
Dann erinnerte ich mich an meinen ersten Aufenthalt in Barcelona. 1980 war das. Meine damalige Freundin hatte hier Verwandte, bei denen wir wohnten; eine Tante von ihr zeigte uns die Stadt. Jene Beziehung hielt nicht. Und ich denke jetzt, achtunddreißig Jahre später, an sie. Eine vergessene Liebe, von der nur diese Erinnerung eines Mannes mit einem guten Gedächtnis bleibt. Was macht die Zeit aus uns? Trotzdem ist jener, der ich war, jener, der vor achtunddreißig Jahren mit seiner Freundin nach Barcelona kam, in meinen Körper, in mein Fleisch eingegraben.
Mein Zimmer im fünfzehnten Stock in diesem Hotel scheint ein heiliger Ort zu sein, ich bin derjenige, der ihm Geist einhaucht.
Langsam wird es Nacht.
Ab und zu schaue ich aus dem Fenster: Dort liegt Barcelona, voller blauer Farben, an diesem Sommerabend, mit seinen Hunderten Straßen und seinen Toten, die mit den Lebenden sprechen. Dieses endlose Gespräch, das die Menschen ab fünfzig mit ihren verstorbenen Liebsten führen.
Gleich habe ich ein Abendessen mit einem Leseclub, der meinen Roman gelesen hat, ein Buch, in dem ich von euch beiden rede: von dir, Mamá, von dir, Papá, weil ihr beide und eure beiden Geister alles sind, was ich habe, und ich habe ein Reich, vielleicht ist es ein unergründliches Reich, auf jeden Fall ein Reich der Schönheit.
Ihr habt euch in Schönheit verwandelt und ich habe diesem Wunder beigewohnt. Und ich bin dem Leben unendlich dankbar, weil ihr jetzt Schönheit und Freude seid.
2
Es macht mir sehr viel Freude (auch Angst), meinen Lesern zu begegnen. Ich denke dann immer, dass es sie enttäuschen wird, wenn sie sehen, wie ich aussehe. Und es täte mir so leid, sie zu enttäuschen. Es ist so traurig, einen anderen Menschen zu enttäuschen. Vielleicht entscheiden sich deshalb so viele Autoren, sich nicht zu zeigen. Nicht nur die Schriftsteller, jedwedes menschliche Wesen hat die Wahl, sich nicht zu zeigen, bevor es enttäuscht.
Ich betrete die Buchhandlung und eine Menge Leute kommen auf mich zu, um mich zu begrüßen. Unter ihnen ist eine besondere Person. Ich erkenne sie nicht sofort. Sie schaut mich an, als würden wir uns kennen, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Möglicherweise habe ich eine Ahnung. Ich habe immer Angst vor diesen Ahnungen, vor diesen gewaltigen Zufällen im Leben.
Und mit nur zwei Wörtern fällt bei mir der Groschen.
Ich hatte sie fünfunddreißig Jahre lang nicht gesehen. Ihre Schönheit ist für immer dahin. Wenn die Vergangenheit einen einholt, hat das immer verheerende Auswirkungen auf das Nervensystem. Und trotzdem bleibt sie in meiner Erinnerung makellos, ohne Beschädigung.
Ich spüre eine unsägliche Zärtlichkeit.
Ich versuche, in ihrem jetzigen Gesicht jenes zu finden, das in meinem Kopf ist. Und ich glaube, sie merkt es. Ich sage ihr, dass ich sie immer sehr bewundert habe. Das ist mir in den Sinn gekommen, ihr zu gestehen: dass ich sie bewundert habe. Ich denke, das war das bestmögliche Verb.
Sie sagt mir, dass der Roman sie zu Tränen gerührt habe und dass sie sich an meine Eltern erinnere, dass sie sie perfekt in dem Buch gespiegelt gesehen habe.
»So waren deine Eltern, so erinnere ich mich an sie«, hat sie zu mir gesagt.
Ich erinnere mich perfekt an ihre, weil ihre Eltern und meine befreundet waren, und ich erinnere mich an diese Freundschaft, ich erinnere mich an ihr Lachen, ich erinnere mich an ihre Abendessen in kleinen Gasthäusern, die Witze, die Begeisterung, die Freude.
Und von alldem sind sie und ich übrig geblieben.
Sie sagt mir, dass ich mich glücklich schätzen müsse, weil ich meine Eltern in dem Buch so gut getroffen hätte. Ich traue mich nicht, sie nach ihrer Familie in Barcelona zu fragen. Sie kommt mir zuvor und sagt, dass die Tante, bei der wir wohnten, bereits gestorben sei, aber sie sagt auch: »Wahrscheinlich erinnerst du dich gar nicht, das ist ja lange her und du wirst viele Leute kennengelernt haben, ich weiß nicht, ob und wie du mich in Erinnerung behalten hast.«
Auf dem Weg in mein Hotel denke ich an sie.
Ich habe sie noch nicht einmal gefragt, ob sie verheiratet ist oder Kinder hat. Ich glaube, dass ich Angst hatte, diese Frage zu stellen. Wie sollte man auch keine Angst vor dieser Frage haben. Ich habe mich anderen Leuten zugewandt und am Ende des Abendessens habe ich sie von Weitem gesehen und wollte mich nicht von ihr verabschieden. Als würde ich sie unversehrt in die Tiefe der Dunkelheit, aus der sie gekommen war, zurückschicken.
Sie schien nicht sie zu sein.
Wer war sie dann?
Ich betrete mein Zimmer im fünfzehnten Stock meines Hotels. Ich habe die Klimaanlage angelassen und das Zimmer ist ziemlich kalt, aber das ist sehr angenehm.
Sie geht mir nicht aus dem Kopf. Ich hätte ihr ein endgültiges Lebewohl sagen können, weil wir uns mit ziemlicher Sicherheit nicht wiedersehen werden. Wir fuhren zusammen Ski, 1978 und 1979. Sie hatte eine sehr moderne Skiausrüstung. Ich habe mich nicht getraut, ihr zu sagen, dass ich mich nach vierzig Jahren noch an die Marke ihrer Skier und ihrer Bindungen und ihrer Skischuhe erinnere. Es waren Rossignol ST 650, die Bindungen waren von Look Nevada und die Skischuhe von Nordica. Ich habe mich nicht getraut, ihr von dieser ganzen Fülle an Erinnerungen und Marken zu erzählen, wohinter sich die vielleicht stärkste und bedeutendste Erinnerung verbirgt, und das ist folgende: dass ich durch sie und ihre hiesige, bereits verstorbene Tante das erste Mal Barcelona gesehen habe. Ich habe sie nicht gefragt, in welchem Jahr sie gestorben ist.
Sie erlaubte uns nicht, im selben Zimmer zu schlafen: Sie schlief bei der Tante und ich schlief allein in einem anderen Zimmer.
Und jetzt, achtunddreißig Jahre später, glaube ich, dass diese Entscheidung sehr weise gewesen war. Dank ihr könnte ich diese Nacht vielleicht ruhig schlafen.
Und mit dem Gesicht von Paloma, als sie jung war – so hieß sie und so heißt sie immer noch –, versuche ich, die Augen zu schließen, versuche ich einzuschlafen.
Sie hatte einen dunklen Teint, schwarze, unschuldige Augen, braunes, glattes Haar und jeder mochte sie, weil sie nett war, sanft und gutherzig.
Wir hätten uns nicht trennen sollen. Wir hätten heiraten und zusammen alt werden sollen.
Ich hätte sie nicht kennenlernen sollen.
Ich hätte nicht geboren werden sollen, bei all dem Leid, das mir widerfährt.
Mitten in der Nacht stehe ich auf, ich kann nicht schlafen, es ist drei Uhr morgens, ich mache überall Licht an und betrachte den Raum und betrachte meine im Zimmer herumliegenden Sachen. Morgen fahre ich zurück nach Madrid und diese Wände werden einen anderen Gast aufnehmen und so weiter, bis das Gebäude aufgegeben wird, bis zu dem Moment, wo es anders genutzt, renoviert oder zerstört wird und alles, was ich gerade sage, in einem Wirbel für immer davongetragen wird.
3
Vivaldi, mein jüngerer Sohn, arbeitet bei einem Kurierdienst und fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt. Valdi, in Kurzform, heißt so zu Ehren des berühmten Komponisten der Vier Jahreszeiten, der ebenfalls rothaarig war.
Ich habe die Schallplatte der Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi ungefähr 1977 gekauft. Es war ein Sonderangebot, sie kostete hundertfünfundzwanzig Peseten. Ich war damals gerade vierzehn Jahre alt, aber diese Platte war für mich eine Offenbarung: Diese Musik gab mir ein Gefühl für die Unberechenbarkeit der Zeit, den Wandel, die Bewegung, die Veränderung und diese Erkenntnis tat mir weh, weil ich mich danach sehnte, dass sich nichts veränderte.
Valdi und ich leben in unterschiedlichen Städten. Ich lebe in Madrid und er seit Kurzem in Barcelona. Seitdem ich weiß, dass er für diese Firma namens Glovo arbeitet, sehe ich in einer Menge Madrider Straßen junge Männer und Frauen in seinem Alter. Früher habe ich sie nicht wahrgenommen, aber jetzt nehme ich sie wahr. Ich sehe sie, seitdem mein Sohn dazugehört.
Wenn ich einen der Jungs mit einem Fahrrad und der gelben Kiste von Glovo sehe, macht mein Herz einen Sprung und ich denke an Valdi.
Ich kann nicht anders, als auch all diese jungen Menschen zu lieben, die zwar nicht meine Kinder sind, aber die gleiche Arbeit machen wie er. Ich denke an ihre Väter und Mütter. Da ich ihnen nicht einfach so sagen kann, dass ich sie liebe, mache ich ein Foto von ihnen und schicke es über WhatsApp an Valdi. Ich weiß, dass er das mag. Er erklärt mir technische Details an den Fahrrädern seiner Kollegen in Madrid.
Tatsache ist auch, dass Valdi mir dann antwortet. Wenn ich mit ihm über andere Dinge reden will, antwortet er mir nicht. Seine Arbeit interessiert ihn, und das macht mich froh.
Ich denke, dass ich bei ihm sein sollte, um ihm zu helfen, in die Pedale treten, bei der Zustellung. Valdi hat nicht studieren wollen, er mochte einfach nicht. Er erzählt mir, was er bei dem Kurierdienst verdient. Er sagt mir, dass man es schaffen kann, damit sehr viel zu verdienen. Ich weiß, dass das unmöglich ist, aber es gefällt mir, ihn mit diesen Träumen zu sehen. Ich denke, dass es besser ist, dass er diesen Ehrgeiz hat, der mich an meinen erinnert, als ich in seinem Alter war.
Trotzdem bekümmert es mich, dass er diese Arbeit macht, es wäre mir lieber, er würde etwas anderes tun. Er scheint mir so verloren. Und trotzdem scheint mir dieses Verlorensein so schön, so groß, so anrührend.
Wie sehr liebe ich Valdi und wie wenig sehe ich ihn. Aber wenn wir telefonieren, bin ich glücklich. Er erzählt mir tausend Sachen und alle sind ein wenig verrückt.
Er muss auf Rechnung arbeiten. Er ist damit in der gleichen Situation wie ich, auch ich bin selbstständig. Diese Übereinstimmung finde ich großartig, vielleicht hat sie etwas zu bedeuten.
Bestimmt bedeutet das etwas, ich brauche es so sehr, dass die Dinge, die wir tun, einen Sinn haben.
Bach, mein Vater, arbeitete ebenfalls auf Rechnung. Und so haben wir drei über die Arbeit eine Verbindung oder über die Musik, weil selbstständig zu sein in der Arbeitswelt obdachlos zu sein bedeutet, das ist, wie von der Musik zu leben.
Wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich in Valdis Erinnerung immer jung, weil ich noch nicht zu den Alten gehöre. Wenn ich jetzt sterben würde, müsste er um mich weinen, und das will ich nicht. Niemand soll je um mich weinen. Aber wie sehr würde es mir gefallen, wenn ich in seinen Erinnerungen im Besitz meiner Kräfte wäre, wenn seine Erinnerungen an mich voller Schönheit, voller Licht wären.
Das Leben ist so groß, wie es grausam und hart ist.
Das Leben ist die Unmöglichkeit, das Leben zu kennen. Ich kenne meinen Sohn kaum noch und er kennt mich nicht. Wir streifen jeder für sich durch die Welt. Und so, wie diese gegenseitige Unkenntnis größer wird, verbrauchen sich unsere Leben mehr und mehr.
Nur indem wir die Schönheit unserer gegenwärtigen Unkenntnis und unserer zukünftigen Unkenntnis betrachten, retten wir uns vor der Tragödie, uns zu entfremden.
Das Leben eines Vaters und das Leben eines Sohnes sind voller Unkenntnis voneinander und nur die Liebe kann dies in die schönste Odyssee verwandeln.
Aber niemand weiß, was die Liebe ist, noch, wo ihre Grenzen liegen.
Wir werden niemals wissen, was leben heißt, weil es vielleicht nur atmen und in den Himmel schauen ist. Und das reicht uns nicht, es hat uns nie gereicht.
Dein armer Vater schleppt sich durch diese Welt, um eine Minute deines Lebens bettelnd, Valdi.
Vater sein, bedeutet, um Liebe zu betteln.
4
Eines Tages verstehst du, dass du niemals mit jemandem richtig zusammen gewesen bist, nicht einmal mit dir selbst. Und dieser Tag ist ein großer Tag. Das Leben eines alternden Menschen besteht darin, zu akzeptieren, dass er niemals mit jemandem zusammen gewesen ist noch mit jemandem zusammen sein wird, niemals kann er einem anderen seine Seele offenbaren, geschweige denn, dass der andere erkennt, was ihm offenbart wird, sie behütet, sie pflegt, sie schützt. Um jemanden zu lieben, musst du dir selbst entsagen. Wenige Menschen entsagen sich selbst. Im hohen Alter akzeptieren die Menschen die Einsamkeit, daran denke ich, während ich im AVE Richtung Madrid sitze.
Wir haben die Illusion der Gemeinsamkeit geschaffen. Indem wir die Familie erfanden, indem wir die Liebe erfanden, die Freundschaft, die bedingungslosen Bande, und diese Illusion funktioniert, bis im Alter ein neues Gefühl offenbar wird: das Gefühl, dass du allein sterben wirst, weil wir alle allein sterben werden. Die Meere, die Berge, die Sterne und die Bäume sind allein, so empfinde ich die Einsamkeit: als wunderbaren Ausdruck des Mysteriums hier, am Leben und auf der Welt zu sein.
Ich würde mich gerne tot sehen, um meinen eigenen Tod vom Leben aus zu berühren. Die Idee der Auferstehung, so abwegig, so angefochten, so niedergemacht, so verunglimpft, so verachtet, stellt sich mir als gelbe Kraft dar, die mich lockt. Die Auferstehung, an die der größte Autor der Moderne – Tolstoi, der Russe Leo Tolstoi – glaubte, ist Zuneigung zum Leben.
Wie sollte man auch nicht dem Leben zugeneigt sein, der Kontemplation der Liebe, der Kontemplation des Essens, der Kontemplation des Winters, des Sommers, des Frühlings, des Herbstes. Wie sollte man nicht dem Wind zugeneigt sein und dem Wesen des Windes.
Wir haben die uralten Geheimnisse vergessen.
Ich kann keinen Schritt in diesem Leben tun, ohne dass mich nicht das Gespenst meiner toten Eltern begleitet.
Nach der Veröffentlichung meines Romans sagte ich mir, dass ich sie nicht mehr anrufen werde, dass ich sie auf immer tot sein lassen werde, aber die Leute bestürmten mich, mit aller Rücksicht und in bester Absicht, mit Fragen über sie. Trotzdem wollte ich sie dorthin, wo sie herkamen, zurückschicken. Aber wo war dieser Ort?
Diese Frau, die neben mir im AVE sitzt, wird ebenfalls Vater und Mutter haben und ihrem Alter entsprechend – sie sieht aus wie etwas über sechzig – sind sie wahrscheinlich tot. Sie isst neben mir, sie isst ein kleines Sandwich so, dass es kaum auffällt. Aus dem Augenwinkel betrachte ich ihre roten Fingernägel auf dem Toastbrot; und die Kopfhörer, die mit ihrem Handy verbunden sind.
Vom AVE aus blickt man auf Vorstadthäuser, mehrstöckige, wenig attraktive Wohnblöcke. Dort leben Menschen und ich stelle mir ihr Leben vor. Es ist möglich, dass auch ich in einer dieser Wohnungen in einem Außenbezirk ende, in einer dieser einfachen Wohnungen mit Blick auf die Zuggleise.
Immer wieder stelle ich mir ein solches Ende vor: von allem und allen verlassen, einer totalen Anonymität ausgeliefert, in einer 40-Quadratmeter-Wohnung, in der es im Sommer vierzig Grad wird, von Staub und Schmutz mürbe, in einem schmutzigen Bett liegend. Und krank und mit dem Tod ringend und trotzdem ruhig. So sehe ich mich in der Zukunft.
Ich glaube, dass ich mit dieser Art von Gedanken versuche, dem Schicksal zu trotzen, ich versuche, vor nichts Angst zu haben. Weil, auch wenn es in diesen Wohnungen, die ich vom AVE aus sehe, nichts gibt, wonach ich streben oder mich sehnen würde, mit Sicherheit Menschen dort leben, Menschen, die atmen und sich verlieben. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass sich das Leben unter der Sonne abspielt, wenn es Tag ist, und unter dem Mond, wenn es dunkel ist. Niemand kann dir das nehmen: den Tag und die Nacht.
Ich schaue noch einmal auf die Frau, die mit mir im AVE fährt. Sie ist eingeschlafen, mit einem Brotkrümel am Mund, was sie nicht besonders gut aussehen lässt. Mit außerordentlicher Behutsamkeit mache ich den Krümel mit der Hand weg.
Jetzt ist sie perfekt.
5
Ich erinnere mich, dass wir im Sommer zum Baden an den Cinca fuhren, ein Fluss mit Wasser aus den Bergen, acht Kilometer von Barbastro entfernt. Einmal hatte ich eine Halluzination in diesem Fluss. Das muss 1974 oder 1975 gewesen sein. Ich schwamm, tauchte und berührte die Steine am Grund. Und ich entschied mich, auf eigene Faust Stellen in dem Fluss zu erforschen, an denen ich noch nie gewesen war. Ich trug Wasserschuhe und ging los, entfernte mich immer weiter von dort, wo meine Eltern und deren Freunde, ein anderes Paar mit einem kleinen Kind, waren.
Ich staunte über die Schuhe, weil sie für mein Kinderhirn wie ein Wunder waren, vor allem das erste Mal, als ich welche trug: Mit ihnen konnte man im Wasser gehen, diesen Schuhen machte das Wasser nichts aus. Vielleicht sollte ich endlich einmal sämtliche Wunder, derer ich in meinem Leben ansichtig geworden bin, genauestens auflisten, so trivial oder absurd oder albern sie auch scheinen mögen. Ich verliebte mich auf jeden Fall in diese Schuhe. Als ich sie geschenkt bekam, empfand ich eine außerordentliche Freude und wie gerne würde ich sie noch einmal spüren.
Ich sah, wie das Sonnenlicht auf das Wasser des Cinca knallte, es war wie eine Explosion, so etwas hatte ich noch nie gesehen. An einer seichten Stelle setzte ich meine Füße ins Wasser und betrachtete meine Schuhe und ging los. Bis ich an eine abgelegene, breite Stelle kam, wo der Fluss sich wie zu einem Schwimmbecken staute, eine Art Mauer, so etwas wie ein Wehr, hielt ihn zurück. Langsam ließ ich mich in dieses klare, stehende Wasser gleiten, das mich immer mehr umfing. Und langsam begann ich, dort zu schwimmen. Die Schönheit dieses zurückgehaltenen Wassers löste ein unauslöschliches Glücksgefühl bei mir aus.
Ihm wohnte eine tiefe Ruhe inne.
Heute ist der 19. Juli 2018 und ich werde sechsundfünfzig Jahre alt. Ich feiere meinen Geburtstag nicht. Dieser Tag ist mir unangenehm, weil ich ihn nicht mehr anders verstehen kann denn als Gipfel einer Demütigung, eines Vergessens, eines militärischen Scheiterns. Ich sah meinen Vater seinen Geburtstag verheimlichen und ich sah meine Mutter das Gleiche tun.
Sie schienen zeitlos zu sein.
Und jetzt mache ich das Gleiche. Vielleicht haben sie ihn nicht verheimlicht, sondern sich eher nicht daran erinnert. In meiner Familie wurde weder der Geburtstag meiner Mutter noch der Geburtstag meines Vaters je gefeiert.
Er wurde nicht nur nicht gefeiert, sondern es wurde noch nicht einmal die Existenz eines solchen Tages angenommen. Warum machten sie das? War das Teil ihres Wesens? Oder verzichteten sie auf jegliche Feier, um nur eines zu feiern?
So war es, weil es nur einen Geburtstag gab: meinen. Die Geschichte eines Menschen besteht darin, dass er seinen Geburtstag feiert bis zu dem Moment, wo sich dieser Tag verdunkelt und er zur Hölle fährt.
Mein Geburtstag gefällt mir nicht, weil meine Eltern tot sind. Sie waren diejenigen, die dieses Datum erfanden, und ohne sie ist dieses Datum Staub, Wind, nichts.
Sie waren diejenigen, die den Tag meiner Geburt zum wichtigsten Tag des Universums machten. Und da sie nicht mehr da sind, ist der Tag meiner Geburt zu einem finsteren, öden, traurigen Datum geworden, ein Unglück, ein Scherbenhaufen.
Ich erinnere mich an den Fluss, weil das an meinem Geburtstag war, als mein Geburtstag ein großer und schöner Tag war, weil mein Vater ihn groß machte. Er wusste, wie das ging. Seitdem er diese Welt verlassen hat, ist mein Geburtstag ein elendes und schlappes Spektakel. Saure Feuchtigkeit, unsagbare Enttäuschung, Schmerz und Schweigen, so ist mein Geburtstag heute, weil weder er noch sie hier sind, nur darum.
Trotzdem gehe ich mit Mo, meiner jetzigen Frau, und ein paar Freunden essen und plötzlich, beim Nachtisch, stelle ich überrascht fest, dass Mo eine Kerze gekauft und sie auf ein Kuchenstück gesteckt hat, und die Kerze brennt und sie gratulieren mir zum Geburtstag. Ich bin dankbar, dass sie an mich gedacht haben, und ich erinnere mich an meinen Vater. Ich habe das Gefühl, dass er derjenige gewesen ist, der diese Überraschung vorbereitet hat. Er hat das gemacht, damit ich nicht seinetwegen in Melancholie, Nostalgie versinke. Er hat das extra gemacht. Er hat mir aus dem geisterhaften Raum heraus, in dem er weiterlebt, etwas sagen wollen. Er hat mir Folgendes gesagt: Es gibt Menschen, die dich lieben.
Ich wünschte mir immer, niemand würde mich lieben, weil es unmöglich ist, dass die Liebe meines Vaters zurückkommt, weil es unmöglich ist, derjenige zu sein, der ich war, aber das Leben hat mir mit dem Kuchen, den Mo gekauft hat, eine kleine Feier geschenkt.
Ich liebe es, Valdi an meinem Geburtstag eine sehr spezielle WhatsApp zu schicken. Es ist eine Art Witz, nur zwischen uns beiden. Ich schreibe ihm Folgendes: »Denk daran, deinen Vater anzurufen, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren.« Es ist fast ein metaphysischer Witz. Als wäre ich nicht sein Vater. Als wäre ich ein Freund, der ihm einen Rat gibt. Und folglich wäre sein Vater jemand anderes als ich. Ich mache das auch an Feiertagen wie Weihnachten oder so. Ich mag es sehr, diesen Witz zu machen. Ich mache ihn quasi für mich selbst. Ich glaube, dass ich mich, wenn ich ihn mache, von meiner Rolle als Vater erhole. Alle Väter müssen sich von der Vaterschaft erholen, vielleicht, um endlich wieder nur Sohn zu sein. Ich mag es, mir vorzustellen, dass der Vater meines Sohnes nicht ich bin, sondern ein unbekanntes Wesen. Jemand, der ein Leben am Rande der Normalität führt. Jemand Geheimnisvolles, jemand, der ständig auf Reisen ist. Jemand ohne festen Wohnsitz, der aber trotz alledem einen Anruf zum Geburtstag verdient. Jemand, an dessen Gesicht ich mich kaum erinnern könnte. Jemand, der mir nicht wichtig ist, aber es verdient, beglückwünscht zu werden, nicht um seiner selbst willen, sondern weil es eine Pflicht ist, ihn zu beglückwünschen.
Als würde ich Valdi sagen, »du hast die Pflicht, deinen Vater zu beglückwünschen, obwohl du ihn nicht liebst oder obwohl du Angst vor ihm hast oder obwohl du es vergessen hast oder obwohl du siehst, wie er langsam verschwindet, oder obwohl du mehr von ihm erwartet hast oder obwohl er dich enttäuscht hat oder obwohl er letzten Endes unbedeutend war oder obwohl er dir wehgetan hat, oder obwohl er nicht wirklich gut klarkam«.
Ich sehe noch einmal diesen Schwimmer von vor vierzig Jahren, dort, an dieser ruhigen Stelle, und ich sehe, wie er in dieses Wasser hineingleitet, schwimmt. Und das bin ich, weil ich es geschafft habe, an diesen Punkt meiner Vergangenheit zu gelangen, an diesen 19. Juli, an diesen verloren gegangenen Tag, und ich schwimme an diesem Ort und ich nehme wahr, dass dieser Ort gefährlich ist, weil der Cinca seine Geheimnisse hat und manchmal Menschen mit sich fortnimmt.
Aber er möchte nicht, dass ich mit ihm gehe. Ich darf mich in seinem Schlund erfreuen, an seinen dunklen Strömungen, an seinen Steinen auf dem Grund, seinem wilden Atem.
Ich habe Flüsse immer geliebt.
Mo schläft jetzt. Sie ist eingeschlafen, weil es bereits der 20. Juli frühmorgens ist, sie hat die Melancholie des Kalenders besiegt. Sie hat an die Stelle, an der ich ein Denkmal für die Einsamkeit errichten wollte, eine Kerze gesetzt.
Mo ist die Abkürzung für Mozart, das hatte ich noch nicht gesagt, und sie ist meine zweite Frau.
Und sogar Bra, mein älterer Sohn, mein geliebter Johannes Brahms, hat mich angerufen, um mich zu beglückwünschen.
6
Mo und ich haben uns in den USA ineinander verliebt. Ich glaube, dass wir dort glücklich waren, und wir waren es auf sehr einfache Weise. Was wir am meisten liebten, war, von Hotel zu Hotel zu ziehen. Wir beide mögen Hotels. Andererseits hatten wir beide eine Scheidung hinter uns.
Ich war einundfünfzig Jahre alt, als ich ihr begegnete. Und zweiundfünfzig, als wir uns entschieden zusammenzuziehen. Ich machte eine eigene Buchführung. Ich rechnete. Sie ist zehn Jahre jünger als ich, dadurch ergab sich für mich ein ganz anderer zeitlicher Kontext als in meiner ersten Ehe. Wir waren uns in vielen Dingen ähnlich: Zum Beispiel waren wir beide unordentlich. Wir stapelten Kleidung und Bücher und Papiere. Wobei sie das Schreiben, das sie sucht, immer findet. Ich finde es nie.
Wie ist das möglich, frage ich mich.
Als wir uns kennenlernten, beichteten wir uns alles Mögliche; unter anderem alle Beziehungen, die wir gehabt hatten. Damals fanden wir das toll, erotisch, es turnte uns an. Jetzt, ein paar Jahre später, stehen uns diese damals gebeichteten Wahrheiten manchmal im Weg. Sie sind uns unangenehm. Und es ist schon interessant, dass das, was anfangs ein erotisches Spiel war, bei dem es darum ging, Eindruck zu schinden und um den anderen zu werben, einem später dann so zusetzt.
All das ist für mich wie ein Wunder der menschlichen Natur. Es ist Freude.
Wenn ich sie ärgern will, erinnere ich sie an irgendeinen ihrer Geliebten und sie macht dasselbe bei mir mit einer meinen Geliebten. Sodass wir beide am Ende den Schaden haben.
Im Supermarkt ist Mo sehr originell und impulsiv. Sie kauft immer sehr viel. Sie legt die Sachen in den Wagen. Und ich nehme sie wieder heraus, wenn sie nicht hinschaut. Wenn wir an der Kasse ankommen, bemerkt sie nicht, dass sie nicht da sind.
Manchmal sagt sie, sie glaube, wir hätten mehr Sachen in den Wagen gelegt. Ich sage ihr, dass das, was wir haben, eine sehr gute Wahl ist. Dann lächelt sie. Weil Mo eitel ist. Nur dass Mos Eitelkeit wie die Eitelkeit eines kleinen Mädchens ist.
Mo gibt überall Trinkgeld und sie gibt den Armen Geld. Sie ist davon überzeugt, dass es magisches Denken gibt und eine geheime Ordnung, die dazu führt, dass am Ende die Gerechtigkeit und das Gute siegen.
Sie steht morgens früher auf als ich. Weil ich immer schlecht schlafe. Und wenn sie aufsteht, stellt sie mir immer einen frisch gepressten Orangensaft in den Kühlschrank. Diesen Orangensaft, den sie mir in den Kühlschrank stellt, finde ich außerordentlich geheimnisvoll. Sehr oft betrachte ich ihn, als wäre er eine Offenbarung Gottes. Ich verstehe das nicht.
Was auch immer passiert, ob sie in Eile ist oder ganz plötzlich das Haus verlassen muss, sie lässt mir einen Orangensaft da. Wenn ich den Kühlschrank aufmache und den Saft sehe, überkommt mich manchmal auch ein schrecklicher Gedanke.
Ich denke Folgendes: dass ich nicht in der Lage bin, dasselbe zu tun.
An manchen Tagen messe ich, wie viel frisch gepressten Orangensaft sie mir dagelassen hat. Manchmal ist es ein riesengroßes Glas voll. Dann wieder ein normales Glas. Und ich denke darüber nach, wovon die Saftmenge, die sie mir in den Kühlschrank stellt, wohl abhängt.
Dieser Orangensaft ist ein Liebesbeweis, der mich rührt und mir meine Unfähigkeit, dasselbe zu tun, vor Augen führt.
Unverzüglich fange ich an, darüber nachzudenken, was ich im Gegenzug für sie mache. Zum Beispiel fahre ich sie immer wieder mit dem Auto irgendwohin, weil mir das gefällt. Sobald das Schuldgefühl schwächer wird, trinke ich den Orangensaft.
Während ich zu Ende trinke, denke ich darüber nach, ob sie irgendwohin gefahren werden möchte. Ich denke, wenn ich sie mit dem Auto fahre, dass ich vielleicht das Glück habe, dass sie dasselbe denkt wie ich, wenn ich jeden Morgen den Kühlschrank aufmache und darin ein Glas Orangensaft vorfinde.
Sie stellt den Orangensaft nicht an irgendeine Stelle in den Kühlschrank.
Sie stellt ihn mitten rein.
Was ich nicht glaube, ist, dass sie sich niemals klarmacht, warum manchmal mehr und manchmal weniger Saft da ist.
Sie weiß, dass ich Orangensaft liebe.
Mo macht ihn mit einer elektrischen Orangenpresse. Meine Mutter machte ihn mit einer alten manuellen Orangenpresse.
Ich betrachte die elektrische Orangenpresse.
Die Presse, die meine Mutter benutzte, kann ich nicht betrachten, weil die Zeit sie verschlungen hat. Weil die Liebe sie verschlungen hat.
Es ist so anstrengend für mich, bis ans Ende des Labyrinths zu kommen, immer bist du am Ende des Labyrinths. Immer du, voller Freude.
7
Wir sind nach Santander gefahren und haben uns in einem Hotel eingemietet, das Abba heißt und das vor zehn Jahren Hotel México hieß. Die Gebäude erfinden sich neu. Die Menschen ebenfalls. Auch ich bin, glaube ich, eine Neuerfindung.
Mo schläft weiter, während ich schreibe. Das Fenster des Zimmers ist offen. Es hat gerade geregnet und eine angenehme Frische zieht herein, die den ganzen Raum streichelt. Es ist eine große Sommernacht am Kantabrischen Meer, dieses Meer, das mich an meinen Erdkundeunterricht in der Grundschule erinnert. Man sagte uns, dass das Kantabrische Meer im Norden sei. Spanien war seine Meere. Ich hätte hier geboren sein können, denke ich. Ich bin heute durch die Stadt gelaufen und habe eine Menge Häuser gesehen, in denen ich mir vorgestellt habe, zu leben.
Allein zu leben.
In einer unmenschlichen Einsamkeit.
In einer Einsamkeit, die von der Vorstellung, die sich Menschen von der Einsamkeit machen, weit entfernt ist.
In einer Einsamkeit, die eine Form von Fülle, Gnade, Herrlichkeit, Macht, Herrschaft, Wut und Heiterkeit gleichzeitig ist.
Ich glaube, dass dies die Einsamkeit war, die ich vor vierzig Jahren empfand, als ich an diesem geheimen Ort am Fluss Cinca ins Wasser stieg, an jenem Tag, der unendlich weit weg ist von meinem Geburtstag.
»Wo bist du gewesen?«, fragte mein Vater mich später. »Wir haben solche Angst gehabt, wir haben dich die ganze Zeit gerufen, du hast uns einen solchen Schrecken eingejagt.«
Meine Mutter war geradezu bestürzt.
Eine unendliche Sorge stand ihnen ins Gesicht geschrieben.
»Und außerdem hast du Geburtstag«, sagte meine Mutter.
Auf einem Campingtisch waren einige Kartoffeltortillas. »Alles gut, er ist ja da«, sagte Ramiro, der Freund meiner Eltern. »Alles fertig«, sagte Pili, die Frau von Ramiro. Die beiden hatten den Campingtisch mitgebracht. Daran dachte ich in diesem Moment: dass der Campingtisch ihnen gehörte.
Ich erkannte, dass mein Vater niemals einen Campingtisch kaufen würde und ich auch nicht, weil wir nicht so waren, nicht, dass wir was Besseres waren, eher das Gegenteil, man könnte uns eher über diese Eigenschaft beschreiben: Leute, die nicht in der Lage waren, einen Campingtisch aufzubauen.
Ich lächelte, ich war mit dem Fluss zusammen gewesen. Ich bin nicht sehr weit im Leben gekommen, ich bin nicht reich noch ein besonderer Glückspilz und ich habe eine Tendenz, in einer Art und Weise zu leiden, die meinem Vater immer fremd war.
Ich habe viel darüber nachgedacht, welche Bereiche meiner Persönlichkeit mein Vater kannte und welche nicht. Was alles wusste mein Vater nicht von mir? Ist das nicht wider eine notwendige Ordnung, darüber nachzudenken, dass mein Vater starb, ohne genau zu wissen, wer ich, sein Sohn, war? Diese Ordnung bestimmt den Sinn des Lebens und die physikalischen Gesetze und die mathematische Logik.
Als ich an diesem geheimen Ort im Cinca schwamm, sah mein Vater mich die ganze Zeit nicht. Das war es, was ihn erschreckte. An diesem fernen Tag, meinem Geburtstag, war ich dreißig Minuten lang verloren, außerhalb seines Wahrnehmungsbereichs.
Ich betrachtete die Kartoffeltortilla.
Ramiro hatte Feuer gemacht und begann, Rippchen zu grillen. Damals wusste ich auch, dass mein Vater niemals Feuer machen noch Rippchen grillen noch sich einen Grill kaufen würde. Welch starken Bande es doch zwischen meinem Vater und mir gab und wie sie sich entwickelten. Welch riesige Bedeutung diese Bande hatten und haben. Wie außerordentlich berechnend und schrecklich, nicht aus dieser Welt zu scheiden und meine Gedanken und meinen Willen ständig zu verseuchen.
Mein Vater ist wie ein Alien.
Und ich lasse ihn dort sein, ich lasse es zu, dass er mich von innen aufisst.
Die Liebe ist Essen.
8
Seinerzeit (vor bereits vier Jahren) akzeptierte ich den Vorschlag von Mo, längere Zeiträume in den USA, in Iowa City, im Mittleren Westen, zu verbringen. Wir alle haben eine Seele, die zu einem berühmten Komponisten passt, und ich lag genau richtig, als ich sie Mozart nannte, weil er Freude war, aber auch Abgrund. Die Musik Mozarts war Unschuld und gleichzeitig eine Meute verliebter Schwerter. Sie war Freiheit und gleichzeitig Ahnungslosigkeit. Sie war Lobpreis und gleichzeitig Wahnsinn.
Ich hatte bereits mit Mo in den USA gelebt, war aber oft nach Madrid gereist, weil mir bewusst wurde, dass ich nicht ohne Spanien leben konnte. Ich dachte, es ginge, dass ich Spanien vergessen könnte, aber dem war nicht so. Es war fast wie ein Wunder: Mein Vater und meine Mutter wurden für mich zum Sinnbild für Spanien, sozusagen die beste Version Spaniens.
Und da meine Eltern tot waren, konnte ich außerhalb meines Landes leben. Und so begleitete ich sie. Anfangs war ich in die USA verliebt, ich fand alles aufregend, toll, und das lenkte mich von mir selbst ab. Das Land war pure Lebensfreude, und das begeisterte mich.
Nach der ersten Verliebtheit fühlte ich mich seltsam, wie ein Pilger ohne Glauben, ein Umherirrender. Trotz allem half mir diese Entfremdung, mich auf eine andere Weise an meine Vergangenheit zu erinnern, mit einem Gefühl von Fremdheit, das mich an den Rand einer neuen Angst brachte, in der sich mir beinahe übernatürliche Dinge offenbarten. Es war eine Angst voller Wissen. Es war Schmerz, aber ein Schmerz, der auf Bereiche des Lebens verwies, wo es gut war, zu sein.
Die letzten Jahre meines Lebens sind ausgesprochen seltsam, weil sich mir mit einer ungeheuren Kraft die Vergangenheit offenbart hat. Die Vergangenheit hat sich in eine Art unzugänglicher Gott verwandelt. Ich kann keinen Zugang zu meiner Vergangenheit finden. Das heißt, die Vergangenheit taucht vor meinen Augen wie ein Geisterschiff auf, das die Anker lichtet, das sich verabschiedet, das aber niemals ganz fort ist. Das ist etwa so, als würde ich Millionen von Vergangenheitsformen anderer Menschen betrachten, die sich in Luft auflösten.
Wenn ich lebe, eröffnet mir das eine Hoffnung auf ein Fortbestehen meiner Vergangenheit. Meine Vergangenheit macht mit und hält mich am Leben, weil ich ihr Wirt bin, wie in diesen Hollywoodfilmen, in denen es um teuflische Besessenheit geht.
Auch scheint da noch, starr und gelb, ausgestreckt und schlafend, eine Art göttliche Hand, die Hand eines gigantischen Wesens, zu sein: Das heißt, wenn ich an die Auslöschung meiner Vergangenheit denke, meines eigenen Lebens und der Leben der Männer und Frauen, die ich gekannt habe, fühle ich, weit davon entfernt, Dunkelheit und Angst zu verspüren, oder weit davon entfernt, nur Dunkelheit und Angst zu verspüren, auch das: die Gegenwart von Gelb, die Gegenwart eines Ozeans gelben Wassers, mit gelben Haien, Walen und Delfinen, die dort auf mich warten.
Das menschliche Gehirn hat Abgründe und du musst diese Abgründe mit deinem eigenen Blut versorgen. Als wärst du ein Landwirt, der den bizarrsten Boden der Welt bestellen muss, ein Bauer, der für die Ernte menschlichen Getreides verantwortlich ist.
Ich höre, wie es mich mahnt. »Schau dir diese Abgründe an, es sind die Abgründe der Gattung Mensch, die Nacht, in der sich Materie und Leben verlieben.«
Du kannst dir anschauen, wie einsam sich die Materie fühlte, und aus ihrer Verzweiflung entstand das Leben.
Setz dich in diese Abgründe und betrachte das, was sich lohnt, betrachtet zu werden, das ist das Leben. Der Dritte Weltkrieg wird nicht so sein, wie die Leute denken. Die gesamte Menschheit wird gegen den Müll kämpfen, der sich verselbstständigen und sich gegen uns richten wird. Wir produzieren Müll.
Geht an die Strände und die Meere und die Flüsse und seht, wie er immer mehr wird.
9
In den Sommern meiner Kindheit, in Barbastro, litt meine Mutter unter den Mücken in der Wohnung. Sie jagte sie so lange, bis keine mehr übrig war. Wenn ihr eine besonders zusetzte, nannte sie sie »das ekelhafte Viech«.
Mo und ich sind gerade in San José, ein Ort an der Küste von Almería, wir verbringen ein paar Urlaubstage am Meer. Es ist heiß. In der Küche unserer Wohnung befindet sich »ein ekelhaftes Viech«. Ich habe versucht, es zu vertreiben, und ich habe es so genannt, wie meine Mutter es nannte.
»Raus hier, du ekelhaftes Viech«, habe ich gesagt.
Es war nicht meine Stimme, es war ihre, ich habe sie wieder gehört: »Raus hier, du ekelhaftes Viech«, drang ihre Stimme aus meinem Körper.
Sie war es, da bin ich mir sicher.
Mein Herz hat einen Satz gemacht, weil meine Mutter zurückgekehrt ist, und es ist auch sie gewesen, nicht ich, die diese ekelhafte Mücke verfolgt hat.
Sie ertrug die Mücken im Sommer nicht und ich auch nicht.
Diese Liebe, die wir füreinander empfanden, wird niemals vergehen.
Ich habe den Abend damit verbracht, Mücken zu jagen.
Wir haben den Abend damit verbracht, Mücken zu jagen, sie und ich. Wir lachten. Wir nannten alle »ekelhafte Viecher«.
Meine Mutter dachte, dass die Mücken der Teufel seien, und ich auch. Ich denke genau wie sie.
Die Mücken sind der Teufel.
10
Ich bin niemals vollkommen glücklich gewesen, bei mir haben sich Schrecken und Begeisterung immer die Waage gehalten. Wenn Menschen manchmal behaupten, dass sie vollkommen glücklich sind, sind sie in der Regel nicht ehrlich. Dieses Aufgesetzte interessiert mich nicht mehr. Ich sehne mich nach Wahrheit und nach Schönheit. Schönheit und Wahrheit wie eine Ehe.
Es war keine schlimme Krankheit, niemand weiß ganz genau, was es war. Sie trat auf, als ich achtzehn war und im ersten Jahr studierte. Zum Studieren musste ich Barbastro verlassen und nach Saragossa ziehen. Ich lebte in einem Studentenwohnheim, daran habe ich wunderbare Erinnerungen. Dort hatte ich meine erste Krise.
Es passierte eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte.
Es war nicht nur, dass ich nicht schlafen konnte, wenn es nur das gewesen wäre. Ich war in einer unbekannten Angst gefangen, die mich innerlich auffraß.
Das psychische Leid kennt keinen Inhalt.
Es lässt sich nicht erzählen. Das physische Leid lässt sich benennen, aber das psychische nicht. Es ist der Biss eines unbekannten Wolfes in das Wohl deines Denkens, deiner Seele, deines Bewusstseins, deines Gleichgewichts.
Jemand beißt dir mitten in die Seele und du verstehst den Biss; das heißt, rational begreifst du diesen Biss, weil sich durch diesen blutgierigen Biss deine Wahrnehmung der Welt vergrößert; du siehst mehr Dinge; du siehst die Toten; du siehst die Tür zu einem Jenseits des Lebens; du siehst das Unsichtbare.
Jeder Mensch ist in der Lage, das Unsichtbare zu sehen. Man muss dafür nicht intelligent sein, sondern es braucht Herz und Mitgefühl. Und Barmherzigkeit. Vor allem Barmherzigkeit.
Es war im Sommer 1981. Ich konnte nicht schlafen und quälte mich und litt und ich hatte Angst, ich konnte nicht sprechen. Meine Mutter ging mit mir zum Hausarzt. Dieser Mann sah dem Regierungspräsidenten Adolfo Suárez ähnlich, auch wenn der damals bereits Ex-Präsident war. Die Leute vergessen immer mehr, wer Adolfo Suárez war; die jungen Menschen lesen bestenfalls in den Geschichtsbüchern über ihn; er war auch kein Politiker von internationalem Rang; aber er war derjenige, der im Großen und Ganzen die Demokratie in Spanien möglich machte, und er bestimmte die spanische Politik Ende der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre.
In jenen Jahren glaubte ganz Spanien an Adolfo Suárez, man identifizierte sich mit ihm. Ganz Spanien war Adolfo Suárez. Mein Vater war Adolfo Suárez. Der Arzt, zu dem ich ging, war Adolfo Suárez. Die Menschen auf der Straße waren Adolfo Suárez. Das Leben hieß Adolfo Suárez.
Wenn ich an diese Zeit denke, hatte sie für mich etwas Argloses. Die Arglosigkeit hieß Adolfo Suárez. Später, mit den Jahren, hassten ihn schließlich alle, weil es in Spanien unvermeidlich ist, dass man dich hasst, weil wir aus dem Hass kommen. Und man hasste ihn auf eine ekelerregende Weise. Auch wenn man Adolfo Suárez aus allen möglichen Gründen politisch ablehnen konnte, stellte der Hass, der ihm entgegenschlug, den Hassenden in ein schlechtes Licht und nicht den Verhassten.
Der Arzt, der Adolfo Suárez ähnelte, war überaus höflich und förmlich, und das gefiel meiner Mutter; sie fand, dass uns das aufwertete, und es kann sein, dass sie recht hatte. Er gab mir ein paar seltsame Pillen, die er aus einem dunklen Glas nahm. Es ist, als hätte ich sie gerade jetzt in der Hand.
Wenn ich versuche, zu erzählen, wo ich herkomme, gibt es immer Tiefen, Abgründe, in denen alles verschwindet. Ich habe dann keine Worte mehr. Diese Pillen waren Antidepressiva. Ich nahm ein paar, machte aber nicht damit weiter, weil ich mich sofort besser fühlte. Offensichtlich nicht wegen der Pillen, sondern weil die Angst weg war, das glaubte ich zumindest.
Nein, sie war nicht weg, sie hatte sich in etwas anderes verwandelt. Es war keine mentale Störung, es war keine Depression.
Es war eine Passion, es war eine Form von Passion.
Ich erinnere mich, dass ich ein wenig später in diesem Sommer – ich war gerade neunzehn Jahre alt geworden und stand am Abgrund – meinen Onkel Alberto Vidal auf der Straße sah, den Bruder meiner Mutter, den ich gerne Monteverdi nenne. Ich sah seine Essenz, ich sah, wozu er letztendlich bestimmt war, und das war so aufgrund meines instabilen Nervenkostüms. Damals wusste ich das nicht, für mich war alles nur Schmerz, aber der Schmerz war auch Wissen.
Was ich im Leben gesehen habe, hat mich schwer angegriffen, aber es hat sich gelohnt, es zu sehen, weil ich so intensiver gelebt habe und anständiger.
An jenem selben Sommerabend machte meine Mutter bei offenem Fenster für das Abendessen Würstchen und Pommes frites. Meine Mutter machte sehr besondere Pommes frites, sie konnte das sehr gut, ich liebte ihre Fritten. Trotzdem schaffte ich es nicht, auch nur eine einzige zu essen. Ich kriegte nichts herunter. Ich war vollkommen fertig.
Ein Engel war zu mir gekommen und er würde nicht mehr fortgehen.
Es war der Engel meines Seins, meiner verzweifelten Art und Weise, das Leben zu sehen, die Menschen zu sehen, mich selbst zu sehen.
Die Zeit verging sehr langsam. Für jemanden in einer depressiven Phase bleibt die Zeit stehen. Mir gefällt der Begriff »depressive Phase« nicht. Auf mich traf das nicht zu. Es hat viel Zeit vergehen müssen, bis ich verstand, dass es für niemanden eine eindeutige Diagnose gibt. Diagnosen sind eine grausame Erfindung der Menschen. Ich hatte ein Übermaß an Bewusstsein, das war alles. Ich sah zu viele Dinge. Und an jenem Abend, angesichts der Würstchen, stellte ich fest, dass ich mich nicht auf den Beinen halten konnte. Aber das fiel nicht weiter auf. Mein Vater bemerkte nicht einmal, dass etwas mit mir war. Er hatte genug mit sich zu tun.
Seins und meins, was dasselbe war, was schließlich zu unserem wurde.
Der Engel sagt mir, schau, wie sich die Leere über alle Dinge legt, schau deinen Onkel Monteverdi, schau die Würstchen, schau die Hitze des Sommers und schau dich selbst an, schau die Bäume, den Himmel, schau deine neunzehn Jahre, schau mich an und hab Angst vor mir.
Ich hatte Angst vor ihm, ja, fast vierzig Jahre lang hatte ich Angst vor ihm, und niemals erzählte ich von ihm, fast niemandem.
Ich erzählte nicht vom Engel der Melancholie, der in Wirklichkeit der Engel der Hellsichtigkeit war. Mein Vater und meine Mutter waren ebenfalls hellsichtig.
Ich gebe diesem Engel einen Namen: Er heißt Arnold Schönberg, nach dem Begründer des zeitgenössischen Lärms, dem Begründer der Zwölftonmusik.
Mein Leben ist Geschichte der Musik.
11
Bei den verschiedenen Bücherschauen, an denen ich teilgenommen habe, bin ich auf Menschen getroffen, die meine Eltern und meine Familie kannten. Für mich ist das ein übernatürliches Phänomen, es erstaunt mich, bewegt mich, weil es mir das Gefühl gibt, als würde alles willentlich passieren.
Es sind natürlich nicht viele Menschen.
Es ist, als wären sie versteckt gewesen.
In Málaga kam ein Rechtsanwalt im Ruhestand zu mir, der mir sagte, er sei mit dem Bruder meines Vaters, den ich in meinem Roman Rachmaninow oder kurz Rachma genannt habe, bei den Piaristen zur Schule gegangen.
Der Anwalt sagt mir seinen Namen, den ich sofort wieder vergesse. Er erzählt mir von seinem jetzigen Leben, was ich in Lichtgeschwindigkeit vergesse. Ich höre nichts von dem, was er mir über die Gegenwart sagt.
Ich schaue ihm einfach nur in die Augen und versuche, in ihnen die Vergangenheit zu sehen, jene, die er mit Rachma teilte.
Mich interessiert nur meine Familie.
»Er war ein sehr aufgeweckter, sehr fantasiebegabter, sehr sympathischer Kerl, wir waren sehr befreundet«, sagt der Anwalt zu mir.
Mich beschleichen Zweifel, ich denke, dass das, was er mir gerade sagt, eine falsche Erinnerung sein könnte.
Ich frage nach, will Details wissen. Ich prüfe sein Wissen über meinen Onkel Rachma.
Er lügt nicht, es stimmt.
Er hat bestanden.
Wir sehen uns an.
»Ich habe deinen Roman sehr genau gelesen, ich habe ihn zehnmal gelesen, mindestens zehnmal, weil er auch von mir erzählt«, sagt er.
»Dein Onkel war ein guter Kerl«, sagt er.
Wir sehen uns weiter an.
Es sind mehr als fünfzig Jahre vergangen, seit er Rachma das letzte Mal sah.
»Wir haben am Fluss geangelt, dein Onkel hat auch im Fluss gebadet, aber wir konnten nicht schwimmen, er musste sich Stellen suchen, die nicht so tief waren, keiner von uns konnte schwimmen«, sagt er.
»Wann war das?«, frage ich, weil ich ihn prüfe.
»Um 1941 oder so, Anfang der Vierzigerjahre, nach dem Krieg«, antwortet er und besteht.
»Wusstest du, dass Rachma tot ist?«, frage ich ihn.
»Ja, das weiß ich.«
»Ich lebe seit vielen Jahren in Málaga, ich erinnere mich nicht mehr, wie lange genau, ich bin im Ruhestand«, wiederholt er, »ich habe zwei Enkelkinder, aber ich sehe sie nur wenig. Das schmerzt mich sehr. Vor vier Jahren starb meine Frau. Ich lebe allein«, sagt er.
Als er mir sagt, dass er allein lebe, färbt sich sein Leben in ein attraktives und gleichzeitig gefährliches Gelb.
»Wusstest du, dass Rachma am Ende allein war?«, frage ich ihn. Weil ich in Rachma eine Art Anführer sehe, eine Art Vorbild, Legende, die ich mir manchmal erfinde, weil ich Rachma zu meinem Helden gemacht habe. Ich sah ihn derart wenig im Leben und die paar Mal, die ich ihn sah, bewunderte ich ihn so sehr. Und jetzt wird mir klar, dass ich ihn liebe, dass ich sein Andenken hochhalte, dass ich ihn immer liebte, auch wenn ich ihn nie sah. Er schien mir so anders als Bach zu sein. Sie waren Brüder und doch verschieden, und ich glaube, dass Valdi nach Rachma kommt. Ich glaube, dass Vivaldi Rachmaninow ist, ein Wunderkind im Rückblick auf die Geschichte der Musik und im biologischen Sinne im Hinblick auf die Geschichte meiner Familie.
»Ja, das weiß ich. Er hatte sich scheiden lassen, jemand hat es mir erzählt«, antwortet er.
»Wer hat dir das erzählt?«
Und er sagt den Namen eines Dritten, ein weiterer Unbekannter, jemand, der mit beiden befreundet und die Verbindung war oder der Bote.
»Was ist aus ihm geworden?«, fragt er.
»Er ist auch gestorben.«
»Dann bist nur noch du übrig.«
Er lächelt.
Eine Schlange von Menschen wartet darauf, dass ich ihnen meinen Roman signiere. Der achtzigjährige Rechtsanwalt, der in Málaga lebt, bemerkt die Schlange. Aber ich halte ihn zurück. Ich möchte, dass er mir etwas erzählt, mehr erzählt. Und er liest das in meinen Gedanken.
Ich möchte bei ihm einziehen, ich möchte immer weiter mit ihm plaudern, möchte, dass er mir alles erzählt.
»Es gibt nichts weiter zu erzählen. Und das Buch hast du auch schon signiert«, sagt er.
Und er geht. Er geht in seine Wohnung, in der Stadt Málaga.
Was wird er in der Wohnung machen?
Nicht viel, denke ich.
Ich sehe ihn unter einem Deckenventilator, wie er Kaffee trinkt und ein Toastbrot, einen Joghurt, eine Birne isst und auf sein Ende wartet.
Aber ich danke dir unendlich, dass du gekommen bist. Du hast mich glücklich gemacht, weil dein Glaube und deine Erinnerung und deine Einsamkeit schön sind.
Hoffentlich kommen deine Enkel dich öfter besuchen, hoffentlich, und ich sage das ihretwegen, nicht deinetwegen, weil du schon alles weißt.
12
Ich bereite mich gut auf den Tod vor, denke ich. Es ist mir unverständlich, mir ein Leben ohne mich vorzustellen, und gleichzeitig finde ich es faszinierend, an ein Leben ohne mich zu denken, es betört mich, verschönt mich und erhebt mich, begeistert mich und adelt mich. Es führt dazu, dass mir bewusst wird, dass ich nicht weiß, wer ich bin, noch, warum ich auf die Welt gekommen bin, noch, wozu. Ich bezweifle sogar, dass ich auf die Welt gekommen bin.
Vielleicht habe ich deshalb bei einer Bank eine Kreditkarte beantragt, die achtzig Euro im Jahr kostet, aber mir im Gegenzug sechshundert Punkte schenkt, die ich in Zugtickets eintauschen kann. Diese Idee des Tauschs macht mir gute Laune, weil ich mit diesen Punkten die Zugtickets für meine Söhne bezahlen kann, damit sie mich in Madrid besuchen kommen. Ich mag es, Zugtickets für sie zu kaufen.
Ich kaufe ihnen Tickets für den AVE, damit sie mich in Madrid besuchen kommen. Ich hole sie im Atocha-Bahnhof ab. Es ist eine Liturgie, es ist meine besondere Art und Weise, zur Messe zu gehen, eine Kirche zu besuchen. Der Bahnhof Atocha Renfe ist eine Kathedrale für mich, er ist wie Sankt Peter in Rom. Ich lehne mich an das Geländer im Ankunftsbereich, das eine Grenze zwischen denen bildet, die ankommen, und denen, die warten. Es ist ein Spektakel, die Leute ankommen zu sehen, zu sehen, wie sie sich umarmen und sich küssen. Während ich auf meine Söhne warte, schaue ich mir die anderen an.
Ich konzentriere mich darauf, zu beobachten, wie intensiv die Leute sich begrüßen. Davon, wie sie sich umarmen, küssen, anlächeln, schließe ich auf die Beziehungen.
Der Ankunftsbereich im Atocha-Bahnhof rührt mich. Man sieht hier die ganze Welt. Ich warte auf Bra, der sich etwa drei Minuten verspäten wird, und in diesen drei Minuten liegen drei Millionen Gefühle. Er verzögert sich, aber ich bin mir sicher, dass er kommt, weil ich gerade eine WhatsApp erhalten habe, in der er mir mitteilt, dass er aus dem Zug gestiegen ist. Und trotzdem kommt er noch nicht.
Dieses Warten ist die reine Vorfreude, ein besonderer Moment.
Ich verbringe mein Leben damit, im Internet meinen Kontostand zu überprüfen, aus Angst vor dem Tag, an dem ich vielleicht diese AVE-Zugtickets nicht mehr zahlen kann. Ich schaue mir die immer komplizierter werdenden Webseiten der beiden Banken, bei denen ich mein Geld habe, an. Die Kennwörter kann ich mir sehr gut merken, weil diese beiden Geheimwörter die Namen meiner Söhne sind: »Antonio Vivaldi« das eine und »Johannes Brahms« das andere. Wahrscheinlich haben sie keinen einzigen weiteren Kunden mit derart gewichtigen Kennwörtern. Auf diesen beiden Webseiten findet sich meine gesamte Identität. Wenn diese beiden Webseiten mich rausschmeißen, schmeißt mich die Welt auch raus.
Ich finde es entsetzlich, an der Schwelle zu meinen letzten Lebensjahren ohne Geld dazustehen.
Ich werde eine Wohnung brauchen, Pflege, um diese Welt auf würdige Weise zu verlassen.
Aus Respekt vor den anderen, nicht vor mir selbst. Damit sich niemals jemand meinetwegen schämen muss.
Der schlechte Tod ist ein Konstrukt unserer Kultur. »Er ist wie ein Hund verreckt«, sagt man. Als könnten die Hunde zwischen verschiedenen Todesarten unterscheiden. Freiheit ist in dieser Welt unmöglich, weil die anderen immer eine Meinung über dein Leben haben. Es wäre mir egal, im Dreck zu verrecken, umgeben von Abfällen und Elend, im Winter vor Kälte zu sterben oder im Sommer in der Sonne zu verbrennen, weil der Tod mich erleichtern würde.
Aber ich spare, um in Würde zu sterben, wie man so sagt, und damit sich niemand schämen muss, weil ich schlecht sterbe.
Der Tod ist nicht schlecht, wir haben ihn schlecht gemacht.