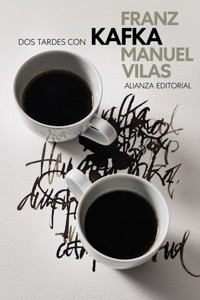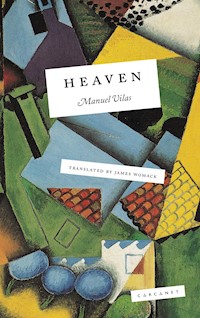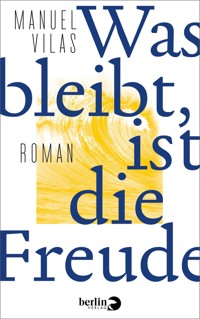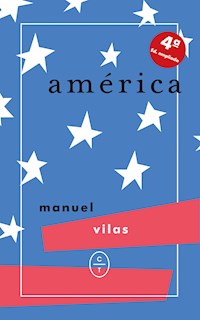17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Erzähler, der bis ins Herz der Wahrheit gelangt.« ›El País‹ »Wir sollten über unsere Familien schreiben, ohne jede Beschönigung, ohne dabei zu erfinden. Wir sollten nur von dem erzählen, was passiert ist, oder von dem wir glauben, dass es passiert sei.« Aus dieser Überzeugung heraus schrieb Manuel Vilas ein Buch über sich, seine Mutter, seine Kinder, vor allem aber über seinen Vater, den stets soignierten Handlungsreisenden, der vom sozialen Aufstieg träumte - und von Ferien in Ordesa ... Illusionslos und poetisch, in einer Sprache, die Realismus mit visionären Bildern verbindet, entsteht ein Lebensbild der letzten fünf Jahrzehnte Spaniens. Manuel Vilas, der als einer der großen Lyriker seiner Generation gefeiert wird, gelingt auch mit diesem kulturkritischen, feinfühligen ersten Roman ein wahrer Coup
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Die Veröffentlichung dieses Werks wurde vom Spanischen Ministerium für Kultur und Sport gefördert.
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Ordesa« bei Alfaguarra, Madrid© 2017 Manuel Vilas via Casanovas & Lynch Literary Agency, S. L., BarcelonaFür die deutschsprachige Ausgabe© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Micky Wiswedel / stocksy
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Epilog:
Das Krematorium
Bildnis
Geschichte Spaniens
Der Regen
Huesca, 1969
Cambrils
1980
Coca-Cola
Daniel
Papá
974310439
Zitate
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.Así yo distingo dicha de quebranto,los dos materiales que forman mi canto,y el canto de ustedes, que es el mismo canto,Y el canto de todos, que es mi propio canto.
Violeta Parra
1
Wenn man doch nur konkrete Zahlen statt ungenauer Worte hätte, um den menschlichen Schmerz zu beschreiben. Wenn wir doch nur wüssten, wie sehr wir gelitten haben, und wenn der Schmerz doch nur begreifbar und messbar wäre.
Eines Tages kommen wir alle an den Punkt, uns mit der Bedeutungslosigkeit unseres Daseins auseinanderzusetzen. Manch einer erträgt das, ich werde es niemals ertragen.
Ich ertrug es niemals.
Ich betrachtete Madrid, und das Unwirkliche seiner Straßen und seiner Häuser und seiner Bewohner schmerzte mich am ganzen Leib.
Ich bin ein Ecce-Homo gewesen.
Ich verstand das Leben nicht.
Die Gespräche mit anderen Menschen wurden langweilig, zäh, schädlich.
Es tat mir weh, mit anderen zu reden: Ich sah das Unnütze sämtlicher Gespräche, der vergangenen und der zukünftigen. Ich sah, dass die Gespräche, noch während sie stattfanden, vergessen wurden.
Der Fall vor dem Fall.
Die Eitelkeit der Gespräche, die Eitelkeit desjenigen, der spricht, die Eitelkeit desjenigen, der antwortet. Die Eitelkeiten im gegenseitigen Einverständnis, damit die Welt sich weiter dreht.
Ab da begann ich wieder an meinen Vater zu denken. Weil ich dachte, dass die Unterhaltungen mit meinem Vater die einzig lohnenden gewesen waren. Ich kam auf diese Unterhaltungen zurück in der Hoffnung, inmitten der allgemeinen Auflösung von allem einen Moment der Ruhe zu finden.
Mein Gehirn war wie versteinert, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich addierte die Zahlen auf den Nummernschildern der Autos, darüber wurde ich tieftraurig. Beim Reden in meiner Muttersprache machte ich Grammatikfehler. Ich schaffte es nicht, Sätze zu Ende zu bringen, verstummte, und mein Gesprächspartner sah mich mitleidig oder abfällig an, und dann beendete er meinen Satz.
Ich stotterte und wiederholte mich tausend Mal. Vielleicht lag in dieser affektiven Störung Schönheit. Ich stellte meinen Vater zur Rede. Ich musste immerzu an das Leben meines Vaters denken. Ich versuchte, in seinem Leben eine Erklärung für meins zu finden. Ich war mit einem Mal verängstigt, sah Gespenster.
Ich betrachtete mich im Spiegel, dabei sah ich nicht mein eigenes Altern, sondern das von jemandem, der bereits gelebt hatte. Ich sah das Altern meines Vaters. Ich konnte mich auf diese Weise perfekt an ihn erinnern. Ich musste mich nur selbst im Spiegel ansehen, und schon erschien er, als wäre es eine Liturgie, die ich nicht kannte, eine Schamanenzeremonie, als hätte sich die göttliche Ordnung verkehrt.
Ich empfand keinerlei Freude, keinerlei Glück, als ich meinen Vater im Spiegel sah, sondern der Schmerz wurde nur noch stärker, ich stieg weiter hinab, in die Eiseskälte zweier sprechender Kadaver.
Ich sehe, was man nicht sehen sollte, ich sehe den Tod in seinem ganzen Ausmaß und wie er in der Materie gründet, ich sehe die umfassende Bedeutungslosigkeit aller Dinge. Ich hatte Teresa von Ávila gelesen, dieser Frau waren ähnliche Dinge wie mir passiert. Sie beschrieb sie auf ihre Weise, ich auf meine.
Ich fing an zu schreiben, nur wenn ich schrieb, konnte ich all die düsteren Botschaften, die die menschlichen Körper, die Straßen, die Städte, die Politik, die Medien, unser Sein aussandten, übermitteln.
Das große Gespenst unseres Seins: ein der Natur entfremdetes Konstrukt. Das große Gespenst ist erfolgreich: Die Menschheit ist von ihrer Existenz überzeugt. Damit fangen meine Probleme an.
Im Jahr 2015 suchte eine Traurigkeit den Planeten heim und nistete sich wie ein Virus in den menschlichen Gesellschaften ein.
Ich ließ ein MRT meines Gehirns machen. Ich hatte einen Termin bei einem Neurologen, ein korpulenter, glatzköpfiger Mann mit gepflegten Fingernägeln, einer Krawatte unter dem weißen Arztkittel. Er untersuchte mich. Er sagte, dass nichts Seltsames in meinem Kopf zu sehen sei. Dass alles gut sei.
Und ich fing an, dieses Buch zu schreiben.
Ich dachte, dass mein Seelenzustand eine vage Erinnerung an etwas sei, das sich an einem Ort im Norden von Spanien ereignet hatte. In Ordesa, einem Ort inmitten der Berge, und die Erinnerung daran war gelb. Die Farbe Gelb besetzte den Namen Ordesa, und hinter Ordesa zeichnete sich die Figur meines Vaters im Sommer 1969 ab.
Ein Geisteszustand, der ein Ort ist. Ordesa. Und außerdem eine Farbe: Gelb.
Alles wurde gelb. Wenn die Dinge oder die Menschen gelb werden, heißt das, dass sie aufgelöst oder bitter sind.
Der Schmerz ist gelb, das will ich eigentlich sagen.
Ich schreibe diese Zeilen am 9. Mai 2015. Vor siebzig Jahren unterzeichnete Deutschland die bedingungslose Kapitulation. Wenige Tage später sollten die Fotos von Hitler durch die Fotos von Stalin ersetzt werden.
Auch die Geschichte ist ein Körper voller Reuegefühle. Ich bin zweiundfünfzig Jahre alt und die Geschichte meiner selbst.
Meine beiden Söhne betreten gerade die Wohnung, sie kommen vom Paddlespielen. Es ist bereits fürchterlich heiß. Die Beharrlichkeit der Hitze, wie sie fortwährend die Menschen, den Planeten überfällt.
Und wie sie für die Menschheit spürbar zunimmt. Es ist nicht nur der Klimawandel, es ist eine Art Mahnung der Geschichte, eine Form von Rache der alten Mythen an den neuen. Der Klimawandel ist nichts anderes als eine Neuauflage der Apokalypse. Wir lieben die Apokalypse. Wir tragen sie in den Genen.
Die Wohnung, in der ich lebe, ist schmutzig, voller Staub. Ich habe mehrere Male versucht zu putzen, aber es klappt nicht. Ich konnte noch nie putzen, nicht, dass es mich nicht interessiert hätte. Vielleicht ist es genetisch bedingt, eine aristokratische Ader. Aber das ist höchst unwahrscheinlich.
Ich lebe in der Avenida de Ranillas, in einer Stadt in Nordspanien, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß: Hier gibt es nichts als Staub, Hitze und Ameisen. Vor einiger Zeit hatte ich Ameisen in der Wohnung, ich habe sie mit dem Staubsauger getötet: Hunderte eingesaugte Ameisen, ich kam mir wie ein Massenmörder vor. Ich betrachte die Pfanne in der Küche. Das Fett in der Pfanne. Ich muss sie reinigen. Ich weiß nicht, was ich meinen Söhnen zu essen kochen soll. Die Banalität des Essens. Vom Fenster aus sehe ich eine katholische Kirche, die unerschütterlich das Licht der Sonne, ihr gottloses Feuer aufnimmt. Das Feuer der Sonne, das Gott direkt über die Erde schickt, als wäre es eine schwarze Kugel, schmutzig, abscheulich, wie Moder, Unrat. Seht ihr nicht den Unrat der Sonne?
Auf der Straße ist niemand. Da, wo ich wohne, gibt es keine Straßen, nur leere, staubige Bürgersteige voller toter Grashüpfer. Alle sind in den Ferien. Sie tummeln sich am Meer am Strand. Die toten Grashüpfer hatten auch Familie und Feiertage, Weihnachten und Geburtstage. Wir alle sind arme Wesen, im Tunnel der Existenz gefangen. Die Existenz ist eine moralische Kategorie. Existieren heißt, etwas tun zu müssen, irgendetwas tun zu müssen, was auch immer.
Wenn mir etwas im Leben klar geworden ist, dann, dass wir alle, wir Männer und Frauen, eine einzige Existenz sind. Diese eine Existenz wird eines Tages eine politische Stimme haben, und an diesem Tag werden wir einen Schritt weiter sein. Ich werde das nicht erleben. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht erleben werde, die ich aber jetzt sehe.
Ich habe immer Dinge gesehen.
Immer schon haben die Toten mit mir gesprochen.
Ich habe so viele Dinge gesehen, dass die Zukunft schon mit mir spricht, als wären wir Nachbarn oder sogar Freunde.
Von ihnen erzähle ich, den Gespenstern, den Toten, meinen toten Eltern, von der Liebe, die ich für sie empfand, davon, dass diese Liebe nicht endet.
Niemand weiß, was Liebe ist.
2
Nach meiner Scheidung (sie war vor einem Jahr, sie wird zwar offiziell und durch richterlichen Beschluss an einem konkreten Datum festgemacht, aber eigentlich ist sie eine unbestimmte Zeit, ein Prozess; auf jeden Fall geht es dabei um mehr als nur ein bedeutsames Datum: Es geht um das erste Mal, dass man daran denkt, das zweite Mal, die Häufung der Male, die man daran denkt, die Zunahme von Vorfällen voller Meinungsverschiedenheiten und Streit und Traurigkeit, die das stützen, was man denkt, und schließlich geht es um den Auszug aus der Wohnung, und dieser Auszug beschleunigt unter Umständen eine Vielzahl von Ereignissen, die zu einem Gerichtsentscheid führen, der aus juristischer Sicht das Ende zu bedeuten scheint; die juristische Sicht gibt Halt am Abgrund, sie ist wie eine Wissenschaft, insofern wir einer Wissenschaft bedürfen, die ordnet und versichert) wurde ich zu dem Mann, der ich bereits viele Jahre zuvor gewesen war, das heißt, ich musste einen Wischmopp und einen Besen kaufen und Putzmittel, viele Putzmittel.
Der Hausmeister des Mehrfamilienhauses stand in der Tür. Wir unterhielten uns ein wenig. Es ging um ein Fußballspiel. Auch ich denke an das Leben der anderen. Der Hausmeister sieht orientalisch aus, aber er stammt aus Ecuador. Er ist schon lange in Spanien, er erinnert sich nicht an Ecuador. Ich weiß, dass er mich eigentlich um meine Wohnung beneidet. So schlecht es einem auch im Leben gehen mag, es gibt immer jemanden, der einen beneidet. Das ist eine Art kosmischer Sarkasmus.
Mein Sohn half mir, die Wohnung zu putzen. Es hatte sich eine Menge Papierkram angehäuft, alles war voller Staub. Man kennt das, man nimmt ein Kuvert in die Hand und bemerkt auf den Fingerkuppen dieses unangenehme Gefühl von Staub, fast wie von Erde.
Es fanden sich vergilbte alte Liebesbriefe, jugendlich-unschuldige, zärtliche Briefe, die Briefe der Mutter meines Sohnes, die meine Frau gewesen war. Ich sagte zu meinem Sohn, er solle sie in die Kiste mit den Andenken legen. Wir legten auch die Fotos meines Vaters dort hinein, ebenso ein Portemonnaie meiner Mutter. Eine Art Friedhof der Erinnerung. Ich wollte und ich konnte den Blick nicht von diesen Dingen abwenden. Ich berührte sie voller Liebe und voller Schmerz.
Du weißt nicht, was du mit alldem machen sollst, oder?, fragte mich mein Sohn.
Es gibt auch noch anderes, Rechnungen und vielleicht Wichtiges wie Versicherungsunterlagen und Briefe von der Bank, sagte ich.
Die Banken verstopfen einem den Briefkasten mit frustrierenden Briefen. Jede Menge Kontoauszüge. Briefe von der Bank machen mich nervös. Sie sagen einem, wer man ist. Sie veranlassen einen, über die eigene Bedeutungslosigkeit in der Welt nachzudenken.
Ich sah mir die Kontoauszüge an.
Warum stellst du die Klimaanlage so hoch?, fragte er mich.
Die Hitze macht mir Angst, mein Vater hatte das auch. Erinnerst du dich an deinen Großvater?
Das ist eine unangenehme Frage, weil mein Sohn denkt, dass ich mit solchen Fragen versuche, Punkte bei ihm zu machen, um besser von ihm behandelt zu werden.
Mein Sohn ist lösungsorientiert und packt mit an. Er hat mir sehr geholfen, meine Wohnung in Ordnung zu bringen.
Plötzlich schien mir meine Wohnung nicht das Geld wert zu sein, das ich für sie bezahle. Ich vermute, diese Gewissheit sagt am meisten über die Reife des menschlichen Verstandes unter dem Joch des Kapitalismus aus. Aber dank des Kapitalismus habe ich eine Wohnung.
Ich dachte wie immer an den wirtschaftlichen Ruin. Das Leben eines Menschen ist im Wesentlichen der Versuch, sich nicht wirtschaftlich zu ruinieren. Egal, womit er sein Geld verdient, das wäre das große Scheitern. Wenn man seine Kinder nicht ernähren kann, verliert man in unserer Gesellschaft jede Existenzberechtigung.
Niemand weiß, ob ein Leben ohne die anderen möglich ist. Einzig und allein das Ansehen bei den anderen versichert einen der eigenen Existenz. Das Ansehen macht eine Stimmung offenbar, es ist der Gradmesser, wie man bewertet und beurteilt wird, und aus diesem Urteil ergibt sich die eigene Position in der Welt. Es ist ein Kampf zwischen einem Körper, dem eigenen, lebendigen Körper, und dem Wert des eigenen Körpers für die anderen. Wenn die Leute einen begehren, die eigene Anwesenheit begehren, wird es einem gut gehen.
Der Tod jedoch – dieser verrückte Psychopath – hebt durch den Verfall des Fleisches, der sich über den Tod hinaus fortsetzt, sämtliche gesellschaftlichen und moralischen Werte auf. Es wird viel über den politischen und moralischen Werteverfall gesprochen und sehr wenig über den körperlichen Verfall, der nach dem Tod eintritt: die Entzündung, die Explosion von ekelerregenden Gasen und die Verwandlung des Leichnams in Gestank.
Mein Vater sprach sehr wenig über seine Mutter. Er erinnerte sich lediglich daran, wie gut sie kochte. Meine Großmutter verließ Barbastro Ende der Sechzigerjahre und kehrte nie wieder zurück. Das muss 1969 gewesen sein. Ihre Tochter nahm sie mit.
Ich wurde in Barbastro geboren und wuchs dort auf. Als ich geboren wurde, lebten zehntausend Menschen in dem Städtchen. Jetzt sind es siebzehntausend. Allein das zeigt das Potenzial des Ortes hinsichtlich einer kosmischen und persönlichen Bestimmung.
In der Antike wurde dieser Wunsch, das Ungestaltete in Gestalt zu verwandeln, »Allegorie« genannt. Weil sich für fast alle Menschen die Vergangenheit wie eine Romanfigur verdichtet.
Ich erinnere mich an ein Foto meines Vaters aus den Fünfzigerjahren, auf dem er in seinem Seat 600 zu sehen ist. Man kann ihn kaum erkennen, aber er ist es. Es ist ein seltsames Foto, typisch für diese Zeit, mit wie neuen Straßen. Im Hintergrund stehen ein Renault Ondine und eine Gruppe Frauen von hinten, mit Handtaschen, Frauen, die inzwischen wohl tot oder sehr alt sind. Ich kann den Kopf meines Vaters in dem Seat 600 mit einem Kennzeichen aus Barcelona ausmachen. Er hat nie erzählt, dass sein erster Seat 600 ein Kennzeichen aus Barcelona hatte. Auf dem Foto ist es weder Sommer noch Winter. Gemäß der Kleidung der Frauen könnte es Ende September oder Anfang Mai sein.
Über den Verlust all der Dinge, die es einmal gab, ist fast alles gesagt. Erzählen möchte ich allerdings davon, wie fasziniert ich von diesem Auto war, von diesem Seat 600, der für Millionen Spanier Anlass zur Freude war, der Anlass zu gottloser und materieller Hoffnung war, der Anlass war, an die Zukunft der eigenen Autos zu glauben, der Anlass zum Reisen war, der Anlass war, andere Orte und andere Städte kennenzulernen, der Anlass war, über das Labyrinthische der Geografie und der Wege nachzudenken, der Anlass war, an Flüsse und Strände zu fahren, der Anlass war, sich in einer Kammer einzuschließen, die einen von der Welt trennte.
Das Kennzeichen weist auf Barcelona hin, die Nummer ist eine vergessene Zahl: 186 025. Etwas wird irgendwo von diesem Kennzeichen bleiben, und daran zu denken ist, wie zu glauben.
An Format sollte es uns niemals fehlen. Mein Vater machte für Spanien, was er konnte: Er fand Arbeit, arbeitete, gründete eine Familie und starb.
Es gibt wenige Alternativen dazu.
Die Familie ist eine Form bestätigten Glücks. Menschen, die sich entscheiden, alleine zu bleiben, sterben früher, so die Statistik. Niemand möchte früher sterben. Weil zu sterben nicht lustig ist, es hat auch etwas Altertümliches. Todessehnsucht ist ein Anachronismus. Und das haben wir erst kürzlich herausgefunden. Eine der neuesten Entdeckungen der westlichen Kultur ist: Es ist besser, nicht zu sterben.
Komme, was wolle, lieber nicht sterben, vor allem aus einem ganz einfachen Grund nicht: Es ist nicht erforderlich. Es ist nicht erforderlich zu sterben. Früher dachte man das, man dachte, es wäre erforderlich zu sterben.
Früher war das Leben weniger wert. Jetzt ist es mehr wert. Die heutigen Reichen, der materielle Überfluss führen dazu, dass das einstmalige Lumpenproletariat (jene, denen es vor Jahrzehnten egal war, ob sie lebten oder starben) das Leben liebt.
Die spanische Mittelschicht der Fünfziger- und Sechzigerjahre vererbte ihren Sprösslingen hochtrabende Ideen.
Ich weiß noch nicht einmal, in welchem Jahr meine Großmutter starb. Vielleicht war es 1992 oder 1993, oder 1999 oder 2001 oder 1996 oder 2000, so ungefähr. Meine Tante rief an, um uns über den Tod der Mutter meines Vaters zu informieren. Mein Vater sprach nicht mit seiner Schwester. Sie hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ich hörte die Nachricht ab. Sie sagte, sie würden sich zwar nicht gut verstehen, hätten aber dieselbe Mutter. Sie meinte: Weil sie dieselbe Mutter hätten, wäre das ein Grund, aufeinander zuzugehen. Ich hielt nachdenklich inne, als ich die Nachricht abgehört hatte; in die Wohnung meiner Eltern drang immer derart viel Licht, dass die Tatsachen ihre Konturen verloren, das Licht ist machtvoller als das menschliche Tun.
Mein Vater setzte sich in seinen Sessel. Einen gelben Sessel. Er würde nicht zu der Beerdigung fahren, das stand für ihn fest. Sie war in einer weit entfernten Stadt gestorben, an die fünfhundert Kilometer von Barbastro entfernt, an die fünfhundert Kilometer von dort entfernt, wo mein Vater in diesem Moment die Nachricht vom Tod seiner Mutter erhalten hatte. Er fuhr einfach nicht. Er hatte keine Lust zu fahren. So weit Auto zu fahren. Oder stundenlang in einem Bus zu sitzen. Und sich diesen Bus raussuchen zu müssen.
Dieser Umstand hatte einen Sturzbach anderer Umstände zur Folge. Ich will nicht bewerten, was passierte, sondern es erzählen oder es sagen oder es feiern. Die Moral der Umstände ist immer ein Konstrukt der Kultur. Die Umstände an sich sind unbestreitbar. Die Umstände sind, wie sie sind, ihre Interpretation ist politisch.
Mein Vater fuhr nicht zur Beerdigung meiner Großmutter. Welche Beziehung hatte er zu seiner Mutter? Er hatte gar keine Beziehung zu ihr. Natürlich hatten sie zu Anfang eine, klar, so um 1935 oder 1940, keine Ahnung, aber diese Beziehung löste sich nach und nach in Luft auf, verschwand. Ich finde, mein Vater hätte zu dieser Beerdigung fahren müssen. Nicht wegen seiner toten Mutter, sondern um seinetwegen und auch um meinetwegen. Indem er dieser Beerdigung fernblieb, blieb er dem Leben insgesamt fern.
Das Rätselhafte daran ist, dass mein Vater seine Mutter liebte. Er fuhr nicht zu ihrer Beerdigung, weil er unbewusst den toten Körper der Mutter ablehnte, während sein bewusstes Ich unüberwindbar träge war.
In meinem Kopf vermischen sich tausend Geschichten, die mit der Armut zu tun haben und damit, wie die Armut einen mit ihrem Traum vom Reichtum vergiftet. Oder wie die Armut einen lähmt, dazu führt, dass man keine Lust hat, ins Auto zu steigen und fünfhundert Kilometer zu fahren.
Der Kapitalismus ist in Spanien im Jahr 2008 zusammengebrochen, wir verloren uns, wir wussten nicht mehr, wonach wir streben sollten. Mit dem Einsetzen der wirtschaftlichen Rezession begann eine politische Komödie.
Fast waren wir auf die Toten neidisch.
Mein Vater wurde in einem Dieselofen verbrannt. Er hatte niemals einen Wunsch geäußert, was wir mit seinem Leichnam machen sollten. Wir beschränkten uns darauf, uns des Toten zu entledigen (des Körpers, dessen, was er gewesen war und von dem wir jetzt nicht mehr wussten, was er war), wie alle es machten. Wie man es mit mir machen wird. Wenn jemand stirbt, sind wir davon besessen, den Leichnam schnellstmöglich zu beseitigen. Den Körper auszulöschen. Aber warum diese Eile? Wegen der Verwesung? Nein, es gibt heute ja sehr gute Kühlschränke in den Leichenhäusern. Eine Leiche macht uns Angst. Die Zukunft macht uns Angst, uns macht das, in was wir uns verwandeln, Angst. Es erschüttert uns, an die Verbindung zu denken, die wir zu diesem Leichnam hatten. Es erschrecken uns die Gedanken an die Tage, die wir an der Seite des Leichnams verbracht haben, die Vielzahl von Dingen, die wir mit diesem Leichnam unternommen haben: ans Meer zu fahren, mit ihm zu Mittag zu essen, mit ihm zu reisen, mit ihm zu Abend zu essen oder sogar mit ihm zu schlafen.
Das einzige wirkliche Problem am Ende des Lebens der Menschen ist die Beseitigung des Leichnams. In Spanien gibt es zwei Möglichkeiten: die Erdbestattung oder die Feuerbestattung, also sich in Erde oder in Asche zu verwandeln.
Mein Vater wurde am 19. Dezember 2005 verbrannt. Heute bedaure ich das, es war wahrscheinlich eine vorschnelle Entscheidung. Dass wir ihn verbrannt haben, hatte andererseits mit dem Umstand zu tun, dass mein Vater nicht bei der Beerdigung seiner Mutter war, das heißt meiner Großmutter. Was ist wichtiger, auf meine Verwandtschaft hinzuweisen und »meine Großmutter« zu sagen oder auf die meines Vaters und »seine Mutter« zu sagen? Ich weiß nicht, für welche Perspektive ich mich entscheiden soll. Meine Großmutter oder seine Mutter, wie ich mich entscheide, sagt alles. Mein Vater war nicht bei der Beerdigung meiner Großmutter, und das hatte etwas damit zu tun, was wir mit dem Leichnam meines Vaters machten; es hatte etwas damit zu tun, dass wir uns entschieden, ihn verbrennen, einäschern zu lassen. Es hat nicht mit Liebe zu tun, sondern mit einem Sturzbach von Umständen. Umständen, die weitere Umstände auslösen: der Sturzbach des Lebens, Wasser, das beständig fließt, während wir wahnsinnig werden.
Mir wird in diesem Moment auch bewusst, dass in meinem Leben nichts Schlimmes passiert ist, und trotzdem trage ich tiefes Leid in mir. Der Schmerz hindert mich keineswegs daran, Freude zu empfinden; für mich ist Schmerz sowieso eher bewusstseinserweiternd. Leid ist erweitertes Bewusstsein, das zu allem, was gewesen ist und sein wird, vordringt. Es ist eine Art verborgener Freundlichkeit zu allen Dingen. Ein Wohlwollen hinsichtlich allem, was war. Und aus Freundlichkeit und Wohlwollen erwächst immer Anmut.
Es ist eine Art allgemeines Bewusstsein. Leiden ist eine ausgestreckte Hand. Es ist Freundlichkeit den anderen gegenüber. Wir lächeln, doch innerlich brechen wir zusammen. Wenn wir lieber lächeln, anstatt tot auf der Straße umzufallen, hat das mit Anmut, Sanftheit, Wohlwollen, Nächstenliebe, Respekt den anderen gegenüber zu tun.
Ich weiß noch nicht einmal, wie ich die Zeit strukturieren soll, wie sie definieren. Ich kehre zu diesem Nachmittag im Mai 2015 zurück, den ich in diesem Augenblick erlebe, und ich sehe auf meinem Bett verstreut eine Vielzahl Medikamente. Es ist alles dabei: Antibiotika, Antihistaminika, Anxiolytika, Antidepressiva.
Und dennoch feiere ich, am Leben zu sein, und ich werde es immer feiern. Der Tod meines Vaters wird in immer weitere Ferne rücken, oft habe ich bereits Schwierigkeiten, mich an ihn zu erinnern. Trotzdem macht mich das nicht traurig. Dass mein Vater der vollkommenen Auflösung entgegengeht, während ich, abgesehen von meinem Bruder, der Einzige bin, der sich an ihn erinnert, scheint mir von ausgesprochener Schönheit.
Meine Mutter starb vor einem Jahr. Als sie noch lebte, wollte ich manchmal über meinen Vater sprechen, aber sie wollte nicht. Auch mit meinem Bruder kann ich nicht groß über meinen Vater sprechen. Das ist kein Vorwurf, mitnichten. Ich verstehe, dass das unangenehm ist, und in gewisser Weise die Scham. Weil das Reden über einen Toten in einigen traditionellen Kulturen, oder zumindest in jener, mit der ich aufgewachsen bin, eine ausgesprochene Schamlosigkeit voraussetzt.
Also blieb ich alleine mit meinem Vater. Und ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt – ich weiß nicht, ob mein Bruder das macht –, der sich tagtäglich an ihn erinnert. Und sich tagtäglich seine gänzliche Auflösung vergegenwärtigt. Eigentlich erinnere ich mich nicht tagtäglich an ihn, er ist in mir, ich habe mich von mir selbst zurückgezogen, um ihm Unterschlupf zu gewähren.
Es ist, als hätte mein Vater nicht für mich am Leben sein wollen, ich will damit sagen, dass er mir sein Leben nicht offenbaren wollte, den Sinn seines Lebens: Kein Vater will für den eigenen Sohn ein Mensch sein. Meine gesamte Vergangenheit versank, als meine Mutter dasselbe wie mein Vater machte: Sie starb.
3
Meine Mutter starb im Schlaf. Sie war es leid, sich herumzuschleppen, sie konnte nicht mehr gehen. Ich habe nie wirklich gewusst, woran genau sie eigentlich litt. Meine Mutter war eine chaotische Erzählerin. Ich bin genauso. Von meiner Mutter erbte ich das erzählerische Chaos. Es entstammte keiner literarischen Tradition, weder einer klassischen noch einer avantgardistischen. Ein geistiger Verfall ausgelöst durch einen politischen Verfall.
In meiner Familie wurde nie genau erzählt, was los war. Daher meine Schwierigkeit, Dinge, die mir passieren, in Worte zu fassen. Meine Mutter hatte eine Vielzahl von Gebrechen, die sich überlagerten und in ihren Geschichten aufeinanderprallten. Sie hatte keine Möglichkeit, das, was ihr widerfuhr, zu ordnen. Ich habe es schließlich geschafft zu entschlüsseln, was mit ihr los war: Sie wollte in ihren Geschichten ihre Sorge zum Ausdruck bringen und sie wollte dem Erzählten einen Sinn abringen; sie interpretierte, und am Ende führte all das dazu, dass sie schwieg; sie vergaß Details, die sie mehrere Tage zuvor erzählt hatte, Details, von denen sie dachte, dass sie unvorteilhaft für sie seien.
Sie verdrehte Tatsachen. Sie hatte Angst vor den Tatsachen. Sie hatte Angst, dass die Wahrheit dessen, was sich ereignete, gegen ihre Interessen sein könnte. Aber sie wusste auch nicht, was, jenseits ihres Instinkts, ihre Interessen waren.
Meine Mutter ließ das aus, von dem sie dachte, dass es nicht vorteilhaft sei. Das habe ich bei meiner Art zu erzählen übernommen. Das heißt nicht, zu lügen. Es ist ganz einfach die Angst, sich zu irren, oder die Angst, in ein Fettnäpfchen zu treten, Panik vor dem überholten Urteil der anderen, weil man nicht das getan hat, was man gemäß einem unverständlichen Gesellschaftskodex hätte tun müssen. Weder meine Mutter noch ich haben wirklich verstanden, was von uns erwartet wird, was wir machen sollen. Andererseits vermochten weder ihre Ärzte noch die Geriater, ihr das chaotische Umherschweifen auszutreiben. Meine Mutter setzte der medizinischen Logik zu, trieb sie in die Enge. Die Fragen, die sie den Ärzten stellte, waren denkwürdig. Einmal gestand ihr ein Arzt, dass er den Unterschied zwischen einem bakteriellen und einem viralen Infekt eigentlich nicht wisse. Das geistige Chaos und die Sehnsucht meiner Mutter, gesund zu sein, führten dazu, dass ihre intuitiven und visionären Bemerkungen interessanter als die Erklärungen der Ärzte waren. Sie sah im menschlichen Körper so etwas wie eine böse, wilde Schlange. Sie glaubte an das Wilde der Blutzirkulation.
Sie liebte das Drama. Ihre Dramatik war ausgeprägter als die Geduld der Ärzte. Die Ärzte wussten nicht, was sie mit ihr machen sollten. Sie hatte ein schlimmes Bein. Sie bekam eine Prothese, das umliegende Gewebe entzündete sich. Sie hatte die Prothese zur selben Zeit bekommen wie der König von Spanien, Juan Carlos der Erste. Das kam im Fernsehen. Wir machten Witze darüber. Als sich ihr Bein entzündete, konnte man die Prothese nicht herausnehmen, weil meine Mutter wegen ihrer Herz-Kreislauf-Probleme nicht operiert werden konnte.
Ihre Krankheiten waren vielzählig. Sie zählte die Beschwerden auf, einige waren unglaublich originell.
Sie war allein. Sie war vollkommen alleine in ihrer Wohnung und zählte Krankheiten.
Asthma hatte sie auch. Und Angstzustände. Sie war ein Lehrbuch für sämtliche Krankheiten, die einen Namen trugen. Selbst ihr Lebensgefühl war zu einer leichten Krankheit geworden. Ihre Krankheiten waren nicht tödlich, es waren kleine, alltägliche Qualen. Sie litt einfach.
Sie wohnte zur Miete: vierundfünfzig Jahre in einer Mietwohnung. Als junge Frau rauchte sie viel. Sie muss bis um die sechzig geraucht haben. Ich weiß nicht genau, wann sie aufhörte.
Wenn ich den Zeitpunkt, wann sie aufhörte, bestimmen wollte, würde ich sagen, es muss etwa 1995 gewesen sein. Das heißt, damals wäre sie zweiundsechzig gewesen.
Sie rauchte modern, und außerdem unterschied sie sich von den älteren Frauen ihrer Zeit weil sie rauchte. Ich erinnere mich, dass meine Kindheit von Tabakmarken beherrscht wurde, die mir luxuriös und geheimnisvoll vorkamen.
Zum Beispiel die Tabakmarke Kent, die mich vor allem wegen der schönen weißen Packung faszinierte. Meine Mutter rauchte Winston und L&M. Mein Vater rauchte wenig, und wenn, dann Lark.
All diese Zigarettenschachteln auf den Tischen und Beistelltischchen stehen für mich für die Zeit, als meine Eltern jung waren. Damals ging es bei uns zu Hause fröhlich zu, weil meine Eltern jung waren und rauchten. Die jungen Eltern rauchten. Unglaublich, mit welcher Genauigkeit ich mich an diese Fröhlichkeit erinnere, diese Fröhlichkeit der Siebzigerjahre, zu Beginn der Siebzigerjahre: 1970, 1971, 1972 bis 1973.
Sie rauchten und ich betrachtete den Rauch, und so vergingen die Jahre.
Weder mein Vater noch meine Mutter rauchten je schwarzen Tabak.
Sie rauchten nicht einmal Ducados, gar keinen schwarzen Tabak. Daher meine Abneigung gegen die Marke Ducados, ich fand den Tabak lausig, widerlich. Meine Eltern rauchten den nicht. Ich verband mit schwarzem Tabak Schmutz und Armut. Auch wenn ich sah, dass es reiche Leute gab, die Ducados rauchten, verachtete ich schwarzen Tabak weiterhin oder hatte Angst vor ihm. Eher war es Angst. Angst gehört, zumindest bei Persönlichkeiten wie mir, zum Überlebenswillen. Je mehr Angst man hat, desto eher überlebt man. Ich habe immer Angst gehabt. Aber gleichsam hat die Angst mich nicht daran gehindert, dass ich mir Ärger einhandelte.
Ich bemerke einen gigantischen Spalt. Ich glaube, durch die Erinnerung an die Tabakmarken meiner Eltern komme ich einer unverhofften Fröhlichkeit im Leben meiner Eltern auf die Spur.
Ich will damit sagen, dass ich glaube, dass sie glücklicher waren, als ich es bin. Auch wenn sie vom Leben am Ende enttäuscht waren. Oder vielleicht einfach enttäuscht waren vom Verfall ihrer Körper.
Sie waren keine normalen Eltern. Sie waren originell für ihre Zeit. Ja, das denke ich. Sie waren originell, weil sie seltsame Dinge taten, sie waren nicht wie die anderen. Der Grund für ihre Schrulligkeit, oder warum mich als ihr Sohn diese Schrulligkeit berührt, hat wohl mit Liebe zu tun. Mein Vater wurde 1930 geboren. Meine Mutter – das ist eine Annahme, weil sie ihr Geburtsjahr änderte – 1932. Sie waren wahrscheinlich zwei Jahre auseinander, es können auch drei gewesen sein. Manchmal waren es auch sechs, weil meine Mutter ab und zu darauf bestand, dass sie 1936 geboren wurde, das schien ihr ein bedeutsames Jahr zu sein, sie hatte oft gehört, dass das aus welchen Gründen auch immer so gesagt wurde.
Eigentlich wurde sie 1932 geboren.
4
Meine Mutter entstammte einer Familie von Bauern, sie wuchs in einem winzigen Dorf in der Nähe von Barbastro auf. Mein Großvater väterlicherseits war Kaufmann, aber nach dem Bürgerkrieg wurde er als Roter, als republicano, angeklagt und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, die er wegen seines schlechten Gesundheitszustands allerdings ganz nicht absitzen musste. Er war sechs Jahre in einem Gefängnis in Salamanca. Ich weiß nicht sehr viel darüber, manchmal erzählte mein Vater mir, dass mein Großvater den Milizsoldaten nahegestanden habe. Er schien Freunde in der Frente Popular gehabt zu haben. Als die Nationalen in Barbastro einmarschierten, wurde er denunziert. Mein Vater wusste, wer ihn denunziert hatte. Der Kerl ist inzwischen tot. Mein Vater hegte keinerlei Hass. Aber er schwieg. Ich weiß nicht genau, was das für eine Art Schweigen war, ich glaube nicht, dass es politisch motiviert war, er verweigerte sich eher den Worten. Als hätte mein Großvater nicht reden wollen und als hätte es meinem Vater gut gepasst zu schweigen.
Ich werde sterben, ohne zu wissen, ob mein Vater und mein Großvater miteinander redeten. Es kann sein, dass sie niemals miteinander redeten. Sie umgab eine biblische Trägheit. Ich werde sterben, ohne zu wissen, ob mein Vater meinem Großvater jemals einen Kuss gab. Ich glaube, dass sie sich nicht, nein, ich glaube, dass sie sich niemals küssten. Sich einen Kuss zu geben bedeutet, die Trägheit zu überwinden. Die Trägheit meiner Vorfahren ist schön. Ich kenne weder meinen Großvater väterlicherseits noch mütterlicherseits. Es gibt noch nicht einmal Fotos von ihnen. Sie verließen die Welt, bevor ich zur Welt kam, und sie gingen, ohne ein Foto zu hinterlassen. Sie haben nicht ein einziges Porträt hinterlassen. Sodass ich nicht weiß, was ich auf dieser Welt mache. Weder sprach meine Mutter über ihren Vater noch mein Vater über seinen. Schweigen als eine Art Aufstand. Niemand verdient es, genannt zu werden, und so werden wir nicht aufhören, von diesem Niemand zu sprechen, wenn dieser Niemand stirbt.
5
Meine Eltern gingen, anders als die Eltern meiner Schulfreunde, nie in die Kirche; das befremdete mich sehr und war mir meinen Freunden gegenüber peinlich. Sie wussten nicht, wer Gott war. Sie waren keine Agnostiker oder Atheisten. Sie waren nichts. Sie dachten nicht an so etwas. Zu Hause war Religion kein Thema. Und jetzt, beim Niederschreiben dieser Erinnerung, fasziniert mich das. Vielleicht waren meine Eltern Außerirdische. Sie verfluchten nicht einmal Gott. Sein Name fiel einfach nicht. Sie lebten, als würde der katholische Glaube nicht existieren, und das war in höchstem Maße bemerkenswert für das Spanien, in dem sie lebten. Für meine Eltern war die Religion etwas Unsichtbares. Sie existierte nicht. Ihre Moral kannte kein Gut und Böse.
In jenem Spanien der Sechziger- und Siebzigerjahre hätten sie gut daran getan, in die Kirche zu gehen. In Spanien ist es den Messgängern immer sehr gut ergangen.
6
Da meine Mutter rauchte, fing ich auch an zu rauchen. Es wurde zu unser beider Zeitvertreib. Meine Mutter hat mich mit diesem Laster vertraut gemacht, sie wusste nicht, was sie tat. Was die Bedeutung von Dingen anging, lag sie immer falsch: Kleinsten Dingen schrieb sie große Wichtigkeit zu und um Wichtiges kümmerte sie sich nicht. Wir rauchten so lange, bis man uns sagte, dass wir innerlich verfaulen würden. Sie schickte mich Tabak kaufen. Ich kannte am Ende alle Tabakläden von Barbastro.
Die Toten rauchen nicht.
Einmal entdeckte ich in einer Kiste eine Kent-Zigarette, die an die dreißig Jahre alt war. Jemand hatte sie dort versteckt. Ich hätte sie in eine Urne packen sollen.
Ich suche nach irgendeiner Bedeutung für die Tatsache, dass nichts bleibt. Alle verlieren den Vater und die Mutter, das ist pure Biologie. Nur dass ich auch beobachte, wie die Vergangenheit sich auflöst und in eine endgültige Starre verfällt. Ich nehme einen Riss in Raum und Zeit wahr. Die Vergangenheit ist das Leben, das dem heiligen Gericht der Finsternis übergeben wurde. Die Vergangenheit verschwindet niemals, sie kann immer zurückkehren. Sie kommt zurück, sie kommt immer zurück. Die Vergangenheit ist voller Freude. Ein Wirbelsturm ist sie. Sie ist alles im Leben der Menschen. Die Vergangenheit ist auch Liebe. Wenn man von der Vergangenheit besessen ist, kann man die Gegenwart nicht genießen, aber die Gegenwart genießen, ohne dass das Gewicht der Vergangenheit mit ihrer Trostlosigkeit spürbar wäre, ist kein Genuss, sondern bedeutet Entfremdung. In der Vergangenheit gibt es keine Entfremdung.
7
Sie scheinen zu leben. Aber sie sind tot.
Ich muss an den Tag denken, an dem sie sich kennenlernten. Ein Samstagabend im Monat April 1958. Ich sehe den Abend ganz genau vor mir. Die Gegenwärtigkeit dieses Abends verdeckt eine andere, entferntere Gegenwärtigkeit.
Der Tod ist real und legal. Es ist legal zu sterben. Wird es einmal einen Staat geben, der den Tod zu etwas Illegalem erklärt? Dass der Tod gesetzlich legitimiert ist, beruhigt mich; zu sterben ist kein subversiver Akt; sogar der Selbstmord ist nicht mehr subversiv.
Aber was machen sie als noch Lebende, die beiden, meine Eltern, die sich dem legalen Tod entziehen? Sie sind eindeutig nicht ganz tot. Ich sehe sie sehr oft. Mein Vater kommt meistens, bevor ich ins Bett gehe, wenn ich mir die Zähne putze. Er stellt sich hinter mich und schaut auf die Marke meiner Zahnpasta, er betrachtet sie neugierig. Ich weiß, dass er mich nach der Marke fragen will, aber er darf es nicht.
Und gemeint ist hier nicht, dass ich mich an sie erinnere, dass sie in meiner Erinnerung leben. Es geht um den Raum, in dem sie sich aufhalten und wo die Geister weiterhin leiden. Es geht um den schlechten Tod und das gute Leben.
Da sind sie. Und irgendwie sind sie schreckliche Geister.
Als meine Eltern starben, wurde meine Erinnerung zu einem jähzornigen, ängstlichen und wütenden Gespenst. Wenn sich die eigene Vergangenheit vom Antlitz der Erde löscht, löscht sich das Universum und alles ist elend. Es gibt nichts Elenderes als die Bedeutungslosigkeit der Inexistenz. Die Vergangenheit abzuschaffen ist niederträchtig. Der Tod der eigenen Eltern ist niederträchtig. Die Wirklichkeit erklärt einem damit den Krieg.
Wenn ich als Kind (da ich noch keine Persönlichkeit entwickelt hatte oder aufgrund meiner Schüchternheit) darunter litt, dass ich nicht wusste, wo mein Platz unter den anderen, den Schulfreunden, war, dachte ich immer an meinen Vater und meine Mutter und vertraute darauf, dass sie eine Erklärung für meine soziale Unsichtbarkeit haben. Sie waren meine Beschützer und hüteten das Geheimnis des Grundes für meine Existenz, den ich nicht kannte.
Mit dem Tod meines Vaters begann das Chaos, weil derjenige, der wusste, wer ich bin, und letztendlich für mein Dasein und meine Existenz die Verantwortung übernehmen konnte, nicht mehr auf dieser Welt war. Vielleicht ist das eines der eigentümlichsten Dinge meines Lebens. Der einzige wahre Grund dafür, dass man auf der Welt ist, beruht auf dem Willen des Vaters und der Mutter. Du bist dieser Wille. Der fleischgewordene Wille.
Dieses biologische Prinzip des Willens hat keinen politischen Charakter. Deshalb interessiert es mich so, bewegt es mich so. Wenn es keinen politischen Charakter hat, bedeutet das, dass es der Wahrheit zugeschrieben werden kann. Die Natur ist eine grausame Form der Wahrheit. Die Politik ist die verhandelte Ordnung, das ist gut so, aber sie ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit sind dein Vater und deine Mutter.
Sie haben dich erfunden.
Du kommst aus dem Samen und dem Ei.
Ohne Samen und Ei gibt es nichts.
Dass die eigene Identität und die eigene Existenz einer politischen Ordnung unterliegen, konterkariert nicht das Prinzip des Willens, das der politischen Ordnung vorausgeht; dieses ist außerdem ein notwendiges Prinzip, während die politische Ordnung sehr gut sein kann und alles, was recht ist, aber sie ist nicht notwendig.
8
Ich bereute es, mich für die Einäscherung entschieden zu haben. Meine Mutter, mein Bruder und ich wollten alles vergessen. Den Leichnam loswerden. Wir zitterten vor Angst und taten so, als hätten wir die Situation unter Kontrolle, wir versuchten, über ein paar komische Details zu lachen, die uns vor den Schrecken schützten. Die Gräber wurden erfunden, damit sich die Erinnerung der Lebenden dorthin flüchten kann und weil die Knochenreste wichtig sind, auch wenn wir sie nie sehen: Es reicht, daran zu denken. Aber in Spanien werden die Toten in Nischen bestattet. Das Grab im Boden ist vornehm; die Nischen sind deprimierend, teuer und hässlich. Weil in Spanien alles hässlich und teuer für die untere Mittelschicht ist, die sich weiter unten als in der Mitte befindet. Wie finster und verlogen dieser zusammengezimmerte Stempel »untere Mittelschicht« ist.
Wir waren Unterschicht, nur war mein Vater immer sehr gut gekleidet. Er wusste, was sich gehört. Aber er war arm. Er sah lediglich nicht so aus. Er sah nicht so aus und widersetzte sich damit dem sozioökonomischen System Spaniens der Siebziger- und Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Man konnte deshalb nicht ins Gefängnis kommen, nur weil man Stil hatte, wo man eigentlich arm war. Man konnte nicht ins Gefängnis kommen, nur weil man trotz Armut vermied, sie zu zeigen.
Mein Vater war ein Künstler. Er hatte Stil.
Bevor er verbrannt wurde, wurde der Leichnam meines Vaters einige Stunden in der Leichenhalle aufgebahrt. Leute kamen, um sich von ihm zu verabschieden. Wenn ein Bestattungsunternehmen einen Toten aufbahrt, wird für dieses kleine Spektakel alles bis auf ein geschminktes Gesicht versteckt. Man sieht weder Hände noch Füße oder Schultern der Leiche. Die Lippen werden zugeklebt. Ich dachte darüber nach, ob die Lippen mit Kleber verschlossen werden. Man stelle sich vor, dass der Kleber nicht hält und sich plötzlich der Mund eines Leichnams öffnet. Jemand, den ich kannte, kam vorbei. Er war kein Freund meines Vaters, höchstens ein Bekannter. Ihm wurde bewusst, dass seine Anwesenheit unangemessen war. Er ging auf mich zu und sagte: »Wir waren ja gleich alt, ich wollte nur sehen, wie es aussieht, wenn nur noch mein Körper da ist.« Er meinte es ganz ernst. Er schaute noch einmal auf den Leichnam und ging dann.
Später erfuhr ich, dass dieser Mann zwei Monate später ebenfalls verstorben war. Ich erinnere mich an seine Gestik, sogar an seine Stimme. Ich erinnere mich, wie er das Gesicht meines toten Vaters durch den Glaskasten, in dem sich der Sarg befand, betrachtete und mit all seiner Vorstellungskraft versuchte, das Gesicht meines Vaters durch seines zu ersetzen, um zu ergründen, wie er selbst wohl tot aussähe.
Auch ich habe meinen toten Vater betrachtet. Der Beschützer, der Wächter, der Befehlshaber in meiner Kindheit verließ die Welt. Ich sah den Zerfall der Menschheit. Die Kadaverwerdung. Der Beginn der Bedeutungslosigkeit. Der Wahnsinn. Die Größe. Der Leichnam in seiner ganzen Rätselhaftigkeit.
9
Ruckartig erwachte ich aus einem sehr düsteren Traum. Ich hatte Angstlöser zum Einschlafen genommen. Damals nahm ich alarmierende Mengen und trank dabei. 2006 mischte ich sie zum ersten Mal ganz bewusst mit Alkohol. Ich stolperte gerade in eine Ehekrise, ich hatte eine Geliebte. Es war mehr als eine Affäre, es war besonders, so empfand ich es zumindest damals; vielleicht ging es nur mir so, die zweite Person müsste befragt werden, ob es auch für sie um Liebe ging. Lebenslust ist immer kompliziert: Sie beginnt mit überbordender Freude und endet in einem gewöhnlichen Schauspiel. Wir sind gewöhnlich, und wer sich das nicht eingesteht, ist noch gewöhnlicher. Sich diese Gewöhnlichkeit einzugestehen ist der erste Schritt, sich davon zu emanzipieren. Seitdem kombinierte ich während all meiner Ehekrisen Alkohol und Angstlöser. Wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt, setzt die Panik ein; dann nimmt man eben ordentlich Angstlöser.
Im Grunde sind Drogen der einzig ernst zu nehmende Feind des Kapitalismus.
Es war ein intensiver Traum, aus dem ich mit einem Gefühl von verbrauchtem oder erschöpftem Schrecken erwachte. Ich hatte von einem Schlafzimmer geträumt, von einem Schlafzimmer in einer Wohnung, die kurz zuvor noch meine gewesen war.
Ich hatte an diesem Tag einiges zu tun. Ich trank Kaffee, duschte. Ich bin mir immer unsicher, was ich zuerst machen soll: zuerst Kaffee trinken und dann duschen oder duschen und dann Kaffee trinken. Ich war nervös, aufgeregt. Ich musste einen Anzug anziehen und zu einem offiziellen Essen mit den Königen von Spanien. Die Idee, dem König von Spanien auf Droge die Hand zu schütteln, reizte mich, aber dafür fehlte mir revolutionärer Mut. Es war so viele Jahre her, dass ich einen Anzug getragen hatte, vielleicht seit meiner Hochzeit nicht mehr. Für Scheidungen braucht man ja keinen.
Da ich nicht weiß, wie man eine Krawatte bindet, hatte mein Bruder mir einen Knoten vorbereitet. Ich zog meinen dunkelblauen Anzug an. Er saß nicht schlecht. Mit dem weißen Hemd sah ich sogar gut aus. Ich hatte abgenommen; ich hatte meine Zeit mit dem Kampf gegen das Essen verbracht. Essen erfreut das Herz, aber Schlanksein ebenso. Dass es schon spät sei, dachte ich, dabei war das gar nicht so.
Also setzte ich mich auf einen Stuhl und dachte an das Leiden des Krawattenstoffs: Der Knoten war bereits einige Tage alt. Ich erinnerte mich an meinen Vater. Er wusste natürlich, wie man sich die Krawatte bindet. Er konnte das im Schlaf.
Ein Mann mit Krawatte sieht immer alt aus.
Ich fuhr zu dem königlichen Essen, ich fuhr mit meinem Auto. Vor einigen Tagen hatte ich dem Königshaus mein Kennzeichen durchgegeben.
Ich brauchte etwas, bis ich den Eingang auf der Plaza de Armas fand.
Ich wurde immer nervöser.
Dann, als mein Gehirn kurz davor war zu explodieren, hörte ich eine Stimme: »Ruhig, Kumpel, alles ist gut: Du gehst lediglich zu einem Essen, der Anzug steht dir gut. Deine Eltern sind tot. Du scheinst zu leben. Dein Auto ist nicht übel, und du siehst sogar jung aus. Was ist schon eine Mahlzeit mehr oder weniger in deinem Leben.«
Es tut mir immer gut, wenn ich diese Stimme höre. Es ist eine Stimme, die aus meinem Inneren kommt, aber sie scheint eine dritte Person zu sein. Die dritte Person in mir.
Ich fahre durch Madrid. Die Reifen meines Autos berühren die Stadt Madrid. Ich berühre den Krawattenknoten. Ich schau auf das GPS. Viel Verkehr. Das GPS ist nicht gut, es ist alt, ich habe die Daten nicht aktualisiert, weil das fünfzig Euro kostet. Die Leute in Madrid haben Geld, man merkt das.
10
Madrid ist nett.
Madrid ist in diesem Land alles gewesen, hier findet sich alles. Mein Vater fuhr häufiger nach Madrid. Alle Spanier aus der Provinz waren einmal in Madrid. Dann war Madrid grausam. Die Leute aus der Provinz hatten Angst vor der Größe Madrids.
Dabei war Madrid gar nicht so groß. Nicht so groß wie London oder Paris zum Beispiel. Vielleicht ändert sich das langsam. Von der »Provinz« zu sprechen hatte etwas Abfälliges. Und es war absurd. Dieses Madrid, das sich so aristokratisch über die Provinz erhob, war ursprünglich ein monarchistisches Konstrukt und später ein franquistisches, aber egal.
Alles ist egal, weil die Geschichte tot ist und weil die Leute gemerkt haben, dass das, was die Geschichte erzählt, nichts mit der Gegenwart zu tun hat, und die Leute wollen nicht mehr den gespenstischen Ballast vergangener Zeiten, erdichteter Zeiten.
Ein Wächter zeigt mir, wo ich parken soll. Dann gibt mir ein anderer Wächter eine andere Anweisung. Die Wächter sind elegant gekleidet. Die Wächter des Königspalastes von Madrid.
Eine riesige Treppe erhebt sich vor mir, rechts und links daneben stehen Wachsoldaten in Galauniform mit glänzenden, aber harmlos wirkenden Lanzen. Ich glaube nicht, dass ihre Lanzen in über hundert Jahren einmal geschärft wurden. Kastrierte Lanzen, Lanzen von lediglich historischem Wert, unbrauchbar, wenn es darum geht, einen Körper zu zerfetzen.
Ich gehe die Treppe hoch. Ich beobachte die Wachsoldaten, ich sehe ihnen in die Augen.
Es fühlt sich für mich an, als würden die Wachsoldaten meine Vergangenheit kennen, als wüssten sie, dass ich ein Hochstapler bin; als wüssten sie, dass es mir besser anstünde, mit ihnen in ihrer sonderbaren Verkleidung und eine Lanze haltend dort zu stehen. Was werden sie verdienen? Ich schätze 1450 Euro, mit Glück vielleicht 1629 Euro. Ich glaube nicht, dass es 1700 sind. Man redet nicht über sein Gehalt, dabei ist es das Einzige, wozu wir uns bekennen könnten. Wenn man das Gehalt von jemandem kennt, sieht man ihn nackt.
Die großen Fenster des königlichen Palastes verharren an Ort und Stelle, sie sehen die Dinge und filtern das Licht der Tage, die sich zu Jahrhunderten geballt haben.
Die Eingeladenen lächeln.
Madrid ist wie das Herz einer Bestie.
11
Die Monarchie ist faszinierend, aber diese Faszination schützt sie nicht vor Tadel. Dort standen Felipe VI. und seine Frau Doña Letizia, das spanische Königspaar, ohne dass jemand sie darum gebeten hätte, obwohl beide wissen, dass diese Bitte insofern nicht nötig ist, als die Geschichte eine Folge von schrecklichen politischen Machenschaften ist und es besser ist, nicht in diesen Abgrund zu blicken, weil die beiden, Felipe und Letizia, in dem Sinne eine glaubwürdige und solide Lösung sind, als dass alles, was sie ersetzen könnte, ungewiss, unsicher ist und in Verwüstung, Tod und Elend enden könnte. Sie wissen, dass der Dienst, den sie Spanien erweisen, an der Sache orientiert oder abbildbar ist, er lässt sich berechnen und bemessen, er ist Geld wert, sie sind international tätig, damit andere Staaten oder Firmen in Spanien investieren. Dank ihnen, ja. Es stimmt. Die internationalen Investoren vertrauen ihnen. Vertrauen ist Geld wert und bedeutet, dass Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauskommen.
Trotzdem werden sich die Leute verbünden, es gilt also, wachsam zu sein, weshalb auf dem Gesicht von Felipe VI. ein winziger Schatten liegt und weshalb seine Frau das Zischen einer Peitsche hört. Sie müssen vorsichtig sein. Sie gestaltet beständig diesen moralischen Raum, eine Art politischer Tempel für »das Untadelige«.
Sie sind Ehemann und Ehefrau, und deshalb empfinde ich ein gewisses Mitleid für sie. Es ist normal, Ehepaare zu bemitleiden, vor allem Ehepaare, die in die Jahre kommen, weil wir alle wissen, dass die Ehe die schrecklichste aller gesellschaftlichen Institutionen ist, da sie Opfer verlangt, Entsagung verlangt, Unterdrückung der Instinkte erfordert, Lüge über Lüge erfordert, und im Gegenzug verspricht sie sozialen Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand.
Doña Letizia geht einen Schritt weiter als ihr Ehemann und begibt sich in eine komfortablere historische Zone, näher zur Absolution hin. Sie denkt an diese aufklärerische Idee, sie denkt: »Niemand wird mir je etwas vorwerfen können.« Sie schweigen. Ich beobachte ihr Schweigen, das manchmal von zustimmenden Einsilbern unterbrochen wird.
Jemand hat ihr gesagt: »Wähle immer das Ja.«
Das spanische Königspaar hat zu einem offiziellen Mittagessen geladen anlässlich der Verleihung des Premio Cervantes an einen hochbetagten Schriftsteller namens Juan Goytisolo, ein Genie mit brillanten Büchern, den besten Büchern seiner Generation, Büchern, die auf Spanisch geschrieben wurden. Es handelt sich folglich um einen spanischen Autor. Es leuchtet nicht wirklich ein, an seine Nationalität zu erinnern. Da Spanien ein Land ist, das eher zu einem Nein tendiert, haben sie Doña Letizia gesagt, dass sie, wenn sie kann, immer Ja sagen soll.
Es ist der 23. April 2015, ein Frühlingsmorgen in Madrid, mit einer Außentemperatur von sechzehn Grad. Die Gäste stehen in Grüppchen zusammen und unterhalten sich mit einer gewissen Gewogenheit. Die Gespräche sind höflich und entspannt. Aber sie werden auch mit Bedacht geführt. Alle Gäste wissen, dass sie Teil einer einvernehmlichen Struktur sind, ein Familienfoto, eine soziologische Realität, die »spanische Kultur, Abteilung Literatur, 2015« heißen könnte.
Ein Foto, über das die Zeit dann die unvermeidliche Kavallerie des Todes hinwegschickt. Ich denke in diesem Moment an mich selbst, an den Mann mit der Krawatte, deren Knoten ein anderer Mann gebunden hat. Das hört sich wie der Beiname eines Höflings aus einem Ritterroman an: der Mann, dessen Krawattenknoten ein anderer Mann gebunden hat.
Ich habe keine besonderen Probleme, mich in welchen Gruppen auch immer zurechtzufinden, ich ziehe sogar von einer zur anderen und grüße berühmte Autoren mit zuvorkommender Herzlichkeit. Ich fühle mich in meinem Anzug schick. Trotzdem herrscht im tiefsten Inneren meiner Seele die Angst.
Ich habe Angst. Mir machen die Macht und der Staat Angst, mir macht der König Angst.
Im Grunde haben alle Angst. Selbst diejenigen, von denen man annimmt, sie hätten nichts zu befürchten, wie Ihre Majestäten die Könige von Spanien, vielleicht haben auch sie manchmal Angst. Bei anderen Gästen, bei altgedienten Gästen, ist die Angst vielleicht durch Gewohnheit und Routine verdrängt worden.
Diese altgedienten Gäste scheinen in ihrem Element zu sein. Es gibt eine offensichtliche Veränderung: Juan Carlos I. regiert nicht mehr, sondern sein Sohn. Aber darüber hinaus ist das Protokoll identisch.
Ich verwandele mich innerlich in eine dritte Person, und ich gebe mir diesen Beinamen: der Mann mit der falschen Krawatte.
Ich sehe mich als dritte Person.
Das Gespenst tritt auf den Plan. Ich bin das Gespenst.
Der Mann mit der falschen Krawatte ist neu hier, es ist sein erstes Essen mit dem Königspaar.
Ende der Leseprobe