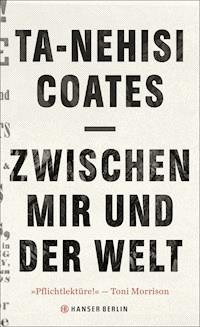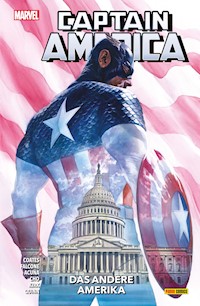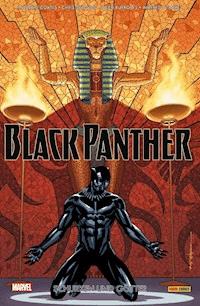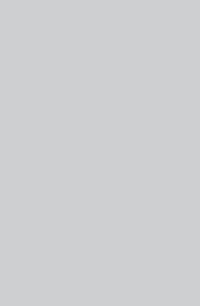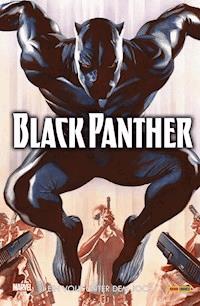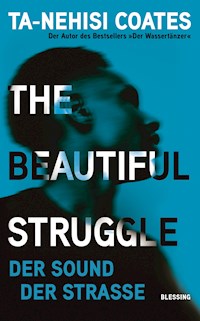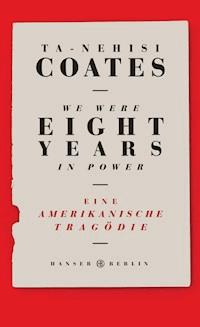
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
George Floyds Tod erschüttert die USA und löst Proteste gegen rassistische Polizeigewalt aus. Ta-Nehisi Coates, "die Stimme des schwarzen Amerika" (Tobias Rüther, F.A.S.), über die Ära Obama und Donald Trump.
Mit Barack Obama sollte die amerikanische Gesellschaft ihren jahrhundertealten Rassismus überwinden. Am Ende seiner Amtszeit zerschlugen sich die Reste dieser Hoffnung mit der Machtübernahme Donald Trumps, den Ta-Nehisi Coates als "Amerikas ersten weißen Präsidenten" bezeichnet: ein Mann, dessen politische Existenz in der Abgrenzung zu Obama besteht. Coates zeichnet ein bestechend kluges und leidenschaftliches Porträt der Obama-Ära und ihres Vermächtnisses – ein essenzielles Werk zum Verständnis der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der USA, von einem Autor, dessen eigene Geschichte jener acht Jahre von einem Arbeitsamt in Harlem bis ins Oval Office führte, wo er den Präsidenten interviewte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der erste schwarze Präsident der USA: Für viele Afroamerikaner war mit Barack Obama die Hoffnung auf das Ende der weißen Vorherrschaft verbunden, die das Land seit seiner Gründung prägt. Die Reste dieser Hoffnung zerschlugen sich mit der Machtübernahme Donald Trumps, den Ta-Nehisi Coates als »Amerikas ersten weißen Präsidenten« bezeichnet: ein Mann, dessen politische Existenz in der Abgrenzung zu Obama besteht. Coates’ neues Buch ist ein bestechend intelligentes, unverstellt persönliches und leidenschaftliches Porträt der Obama-Ära und ihres historischen Vermächtnisses – ein essenzielles Werk zum Verständnis der amerikanischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, geschrieben von einem Mann, dessen eigene Geschichte jener acht Jahre in einem Arbeitsamt in Harlem begann und im Oval Office endete, wo er den Präsidenten interviewte.
Hanser Berlin E-Book
TA-NEHISI COATES
WE WERE EIGHT YEARS IN POWER
EINE AMERIKANISCHE TRAGÖDIE
Aus dem Englischen von Britt Somann-Jung
Hanser Berlin
Für Kenyatta, Tom, Nikola und Amelie,
die mit mir in die Tiefe gegangen sind
und mich wieder ans Ufer geleitet haben
We don’t just shine, we illuminate the whole show.
Jay-Z
INHALT
Einleitung: We were eight years in power
1.
Notizen aus dem ersten Jahr
»So haben wir gegen den weißen Mann verloren«
2.
Notizen aus dem zweiten Jahr
American Girl
3.
Notizen aus dem dritten Jahr
Warum befassen sich so wenige Schwarze mit dem Bürgerkrieg?
4.
Notizen aus dem vierten Jahr
Das Vermächtnis von Malcolm X
5.
Notizen aus dem fünften Jahr
Angst vor einem schwarzen Präsidenten
6.
Notizen aus dem sechsten Jahr
Plädoyer für Reparationen
7.
Notizen aus dem siebten Jahr
Die schwarze Familie im Zeitalter der Masseninhaftierung
8.
Notizen aus dem achten Jahr
Mein Präsident war schwarz
Epilog: Der erste weiße Präsident
Danksagung
Nachweise
EINLEITUNG
WE WERE EIGHT YEARS IN POWER
1895, ZWEI JAHRZEHNTE nachdem sein Bundesstaat den Weg von der egalitären Erneuerung der Reconstruction-Ära hin zu einer unterdrückerischen Politik der »Wiedergutmachung« gegangen war, wandte sich der Kongressabgeordnete Thomas Miller aus South Carolina an die verfassunggebende Versammlung des Staates:
Wir waren acht Jahre an der Macht. Wir haben Schulen gebaut, Wohltätigkeitseinrichtungen gegründet, das Strafvollzugssystem errichtet und unterhalten, für die Bildung von Taubstummen gesorgt, die Fähren wieder in Betrieb genommen. Kurzum, wir haben den Staat wiederaufgebaut und den Weg zu neuer Blüte bereitet.
Mit Beginn der 1890er Jahre war das vorherrschende Bild der Reconstruction das einer durch und durch korrupten Ära der »Negerherrschaft«. Es hieß, South Carolina laufe Gefahr, »afrikanisiert« zu werden und in Barbarei und Unrecht zu versinken. Miller hoffte, dass er, indem er die schwarzen Regierungsleistungen herausstellte und auf überzeugende Weise von schwarzer Rechtschaffenheit berichtete, die zweifellos unvoreingenommenen Einwohner South Carolinas davon überzeugen könnte, die Bürgerrechte der Afroamerikaner unangetastet zu lassen. Sein Plädoyer fand kein Gehör. Die Verfassung von 1895 verlangte schließlich sowohl einen Nachweis über die Lese- und Schreibfähigkeit als auch Grundbesitz als Voraussetzung für die Wahlberechtigung. Als sich diese Maßnahmen als unzureichend erwiesen, um die white supremacy – die weiße Vorherrschaft – zu sichern, wurden schwarze Bürger erschossen, gefoltert, verprügelt und verstümmelt.
Im Zuge seiner Bewertung von Millers Einspruch und der Versammlung von 1895 machte W. E. B. Du Bois eine ernüchternde Beobachtung. Aus Du Bois’ Perspektive ging es der verfassunggebenden Versammlung von 1895 nicht um moralische Reform oder den Versuch, den Staat von der Korruption zu befreien. Dies war nur der Deckmantel für das wahre Ziel der Versammlung – eine weiße Willkürherrschaft wieder einzusetzen. Das Problem war nicht, dass South Carolinas Regierung während der Reconstruction-Ära von einer nie dagewesenen Bestechlichkeit verzehrt worden wäre. In Wahrheit war genau das Gegenteil der Fall. Die Erfolge, die Miller herausstellte, die tatsächliche Bilanz der Reconstruction in South Carolina, untergruben die weiße Vorherrschaft. Um sie wiederherzustellen, wurde die Bilanz verdreht, verhöhnt und verzerrt, bis sie den Vorurteilen des weißen South Carolina besser entsprach. »Wenn es etwas gab, das South Carolina mehr fürchtete als eine schlechte Negerregierung«, schrieb Du Bois, »dann war es eine gute Negerregierung.«
Die Furcht hatte einen Vorläufer. Gegen Ende des Bürgerkriegs, nachdem sie Zeuge der Effektivität der »farbigen Truppen« der Union geworden waren, zogen die in hilflosen Aktionismus verfallenden Konföderierten Staaten in Erwägung, Schwarze für ihre Armee zu rekrutieren. Doch im 19. Jahrhundert war das Bild des Soldaten eng mit Vorstellungen von Männlichkeit und Staatsbürgerschaft verknüpft. Wie konnte eine Armee, die gebildet worden war, um die Sklaverei mit allen damit einhergehenden Annahmen über schwarze Minderwertigkeit zu verteidigen, eine Kehrtwende machen und erklären, dass Schwarze es wert seien, in die Ränge der Konföderierten aufgenommen zu werden? Und tatsächlich konnte sie es nicht. »Der Tag, an dem wir sie zu Soldaten machen, ist der Anfang vom Ende unserer Revolution«, bemerkte Howell Cobb, Politiker aus Georgia. »Und wenn sich Sklaven als gute Soldaten erweisen, dann ist unsere ganze Theorie der Sklaverei falsch.« Für die weiße Vorherrschaft gab es hier nichts zu gewinnen. Wenn Schwarze sich als die Feiglinge herausstellten, die sie jener »ganzen Theorie der Sklaverei« zufolge waren, dann würde die tatsächliche Schlacht auf dem Feld verloren gehen. Sollten sie hingegen effektiv kämpfen – und damit den Nachweis einer »guten Negerregierung« erbringen –, dann konnte der grundlegendere Krieg nicht gewonnen werden.
Den roten Faden dieses Buches bilden acht Artikel, die ich in den acht Jahren der ersten schwarzen Präsidentschaft geschrieben habe – einer Zeit guter Negerregierung. Obama wurde inmitten umfassender Panik gewählt und ging aus seinen acht Jahren als guter Sachwalter und umsichtiger Baumeister hervor. Auf der Basis eines konservativen Modells errichtete er das Gerüst einer staatlichen Gesundheitsversorgung. Er verhinderte den ökonomischen Kollaps und unterließ es, jene zu verfolgen, die für diesen Kollaps die Hauptverantwortung trugen. Er beendete die staatlich sanktionierte Folter, führte jedoch den seit Generationen währenden Krieg im Nahen Osten fort. Seine Familie – die charmante und schöne Ehefrau, die wunderbaren Töchter, die Hunde – schien einem Brooks Brothers-Katalog entsprungen zu sein. Er war kein Revolutionär. Er vermied große Skandale, Korruption und Bestechlichkeit. Er war über die Maßen bedächtig, sah sich als Hüter des heiligen Erbes seines Landes, und wenn ihn die Sünden seines Landes störten, so hielt er dieses Land letztlich doch für eine Kraft, die Gutes in der Welt bewirken konnte. Kurzum, Obama, seine Familie und seine Regierung waren die beste Werbung dafür, mit welcher Leichtigkeit schwarze Menschen vollständig in den nicht bedrohlichen Mainstream amerikanischer Kultur, Politik und Mythen integriert werden konnten.
Und das war schon immer ein Problem.
Eine Richtung afroamerikanischen Denkens geht davon aus, dass gewaltbereites schwarzes Draufgängertum – der schwarze Gangster, der schwarze Aufrührer – der ultimative Schrecken des weißen Amerikas ist. Vielleicht stimmt das auf einer sehr individuellen Ebene. Auf kollektiver Ebene aber fürchtet dieses Land nichts so sehr wie schwarze Respektabilität – gute Negerregierung. Es applaudiert, ja feiert die Idee guter Negerregierung, solange sie abstrakt und ungefährlich ist – in der Cosby Show zum Beispiel. Doch wenn sich abzeichnet, dass eine gute Negerregierung echten Schwarzen Macht über echte Weiße verleihen könnte, kommt Angst auf; dann wird über Affirmative Action geklagt und die Herkunft des Präsidenten angezweifelt. Der Grund dafür ist, dass die amerikanischen Mythen in ihrem Kern nie farblos waren. Sie können nicht aus der »ganzen Theorie der Sklaverei« herausgelöst werden, die behauptet, dass eine gesamte Klasse von Menschen die Leibeigenschaft im Blut hat. Diese Klasse der Leibeigenen bereitete das Fundament, auf dem all die Mythen und Vorstellungen errichtet wurden. Und auch wenn wir uns eine nahtlose schwarze Integration in den amerikanischen Mythos theoretisch vorstellen können, erinnert sich der weiße Teil dieses Landes an den Mythos so, wie er ersonnen wurde.
Ich glaube, die alte Furcht vor guter Negerregierung vermag zu erklären, was als eine schockierende Wende erscheint – die Wahl Donald Trumps. Manche Stimmen behaupten, dass die erste schwarze Präsidentschaft vor allem »symbolisch« gewesen sei, was eine Abwertung ist, die die Macht von Symbolen gehörig unterschätzt. Symbole repräsentieren die Wirklichkeit nicht nur, sie können auch Werkzeuge für ihre Veränderung sein. Die symbolische Kraft der Präsidentschaft Barack Obamas – dass Weißsein nicht mehr ausreichte, um den Einzug der Leibeigenen ins Schloss zu verhindern – griff die am tiefsten verwurzelten Ideen weißer Überlegenheit und Vorherrschaft an und sorgte unter ihren Anhängern und Begünstigten für Angst. Es war diese Angst, die den Symbolen, die Donald Trump einsetzte – den Symbolen des Rassismus –, genug Macht verlieh, um ihn zum Präsidenten zu machen und somit in eine Position zu hieven, in der er der Welt schaden kann.
Eine gängige These in diesem Land, eine, für die Schwarze nicht unempfänglich sind, besagt, dass den Schwarzen, wenn sie sich auf eine Art und Weise verhalten, die den Werten der Mittelschicht entspricht, wenn sie höflich, gebildet und rechtschaffen sind, alle Früchte Amerikas zur Verfügung stehen. In ihrer vulgärsten Form verneint diese Theorie individueller guter Negerregierung, dass Rassismus und weiße Vorherrschaft bedeutende Kräfte im amerikanischen Leben darstellen. In ihrer differenzierteren und seriöseren Form verkauft sie sich als gleichwertiges Komplement zum Antirassismus. Doch ein zentrales Argument dieses Buches lautet, dass gute Negerregierung – auf individueller und politischer Ebene – häufig genau die weiße Vorherrschaft verstärkt, die sie zu bekämpfen sucht. Genau das ist Thomas Miller und seinen Kollegen 1895 passiert. Es ist den Schwarzen in ganz South Carolina während der Wiedergutmachung passiert. Es ist den Schwarzen in Chicagos South Side passiert, als zwischen den Weltkriegen der New Deal eingeführt wurde. Und es passiert meiner Meinung nach genau jetzt mit dem Erbe des ersten schwarzen Präsidenten.
Jeder der Essays in diesem Buch greift einen Aspekt der laufenden Diskussion über den Nutzen und die Lage guter Negerregierung auf, wie sie sich in meinem Kopf vollzieht. Die Essays zeigen mich in einer Bewegung, in einem Prozess des Nachdenkens, der sich auch beim Schreiben dieser Einleitung fortsetzt. Ich bezweifle beispielsweise nicht, dass Anzug und Krawatte beeinflussen, wie manche Menschen auf andere reagieren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob im Fehlen von Anzug und Krawatte das eigentliche Problem liegt. (Was gute Negerregierung angeht, war Barack Obama der Beste, den wir je hatten. Doch als er aus dem Amt schied, glaubte eine Mehrheit in der Oppositionspartei nicht einmal, dass er Bürger dieses Landes war.) Jedem dieser Essays ist eine Art erweiterter Blogeintrag vorangestellt, der einzufangen versucht, warum ich den Text schrieb und an welchem Punkt meines Lebens ich mich dabei befand. Zusammengenommen bilden sie eine locker geknüpfte Autobiographie, von der ich hoffe, dass sie die Essays selbst bereichert. Am Ende des Buches steht ein Epilog, der das Post-Obama-Zeitalter zu bewerten sucht, in dem wir uns jetzt befinden.
Ich wollte, dass diese Artikel – alle acht erschienen ursprünglich im Atlantic – in einem einzigen Band versammelt werden. Aber ich verspürte auch den Drang, etwas Neues aus ihnen zu machen. Dieses Buch hat seine spezifische Form, weil ich die Herausforderung genossen habe, es auf diese Weise zu gestalten. Wenn sich den Leserinnen und Lesern nur die Hälfte meiner Freude daran vermittelt, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt.
WE WERE EIGHT YEARS IN POWER
1.
NOTIZEN AUS DEM
ERSTEN JAHR
WIE ALLES SCHREIBEN nahm diese Geschichte ihren Anfang im Scheitern. Es war im Februar 2007. Ich saß in einem Amtsgebäude an der 125. Straße, nicht weit von dem jamaikanischen Fleischpastetenladen und der Backfischbude entfernt, die ich in jenen Tagen offenkundigen Scheiterns so häufig aufsuchte, dass es schon nicht mehr gesund war. Ich war 31 Jahre alt. Ich lebte in Harlem mit meiner Partnerin Kenyatta und unserem Sohn Samori, die nach afrikanischen Antikolonialisten aus aufeinanderfolgenden Jahrhunderten benannt waren. Die Namen ließen auf einen Haushalt schließen, der sich dem panafrikanischen Traum verschrieben hatte, der Idee, dass die Schwarzen hier und heute mit den Schwarzen dort und damals in einem gewaltigen dramatischen Kampf verbunden waren. Diese Idee war der grundlegende Subtext unseres Lebens. Es ging gar nicht anders. Der sichtbare Text war der von Überlebenskünstlern.
Ich hatte gerade zum dritten Mal in sieben Jahren meinen Job verloren und war in jenes Amtsgebäude gekommen, um mir einen Kurzvortrag über Arbeit, Verantwortung und die Notwendigkeit, ohne Stütze auszukommen, anzuhören. Die Stütze war klein und zeitlich befristet, der Weg zu ihr demütigend. Wie irgendjemand daran Gefallen finden oder sich daran gewöhnen können sollte, entzog sich meinem Vorstellungsvermögen. Aber der Geist der Sozialreform war stark und suchte die Arbeitsämter allerorten heim. Im dortigen Klassenzimmer, inmitten einer Gruppe vermeintlicher Loser und Nichtstuer, erhielt ich meine Lektion über die große Sünde der Faulheit. Immerhin fühlte sich das Setting richtig an: Meine unvergesslichsten Misserfolge und Niederlagen hatten sich in den Klassenzimmern meiner Jugend ereignet, in denen ich auf ewig ein »Verhaltensproblem« hatte, auf ewig der »Besserung« bedürftig war, auf ewig daran scheiterte, »mein Potenzial auszuschöpfen«. Damals hatte ich mich gefragt, ob etwas mit mir nicht stimmte, ob ich an irgendeinem Gehirnschaden litt, der mich dazu trieb, beim Ausmalen über die Linien zu kritzeln. Mein ganzes Leben lang fühlte ich mich als Versager – aus der Middle School herausgestolpert, aus der Highschool geflogen, das College abgebrochen. Doch jetzt hatte ich das Gefühl zu ertrinken, und mir war bewusst, dass ich nicht allein ertrinken würde.
Kenyatta und ich waren seit neun Jahren zusammen, und während dieser Zeit war ich nie in der Lage gewesen, kontinuierlich ein nennenswertes Einkommen beizusteuern. Ich war Autor und empfand mich als Teil einer Tradition, die bis zu einer Zeit zurückreichte, als es für schwarze Menschen ein Ausweis von Rebellion war, lesen und schreiben zu können. Absurderweise glaubte ich das immer noch. Deshalb erfüllte mich die Arbeit des Schreibens mit einem Gefühl »tieferen Sinns«. Aber mit »tieferem Sinn« konnte ich die Miete nicht bezahlen. Mit »tieferem Sinn« konnte ich keine Lebensmittel kaufen. Mit »tieferem Sinn« überzog ich meine Konten. Mit »tieferem Sinn« leerte ich meine Kreditkarten und rief das Finanzamt auf den Plan. Ich schmiedete wilde und unrealistische Pläne. Vielleicht sollte ich Koch lernen. Vielleicht sollte ich als Barkeeper arbeiten. Ich dachte darüber nach, Taxi zu fahren. Kenyatta hatte eine näher liegende Lösung: »Ich glaube, du solltest mehr Zeit aufs Schreiben verwenden.«
In diesem Moment, als ich in jenem Klassenzimmer mein Pflichtprogramm absolvierte, konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich konnte mir gar nichts vorstellen. So wie bei fast jeder anderen Lektion, die man mir in einem Klassenzimmer erteilte, kann ich mich an nichts von dem erinnern, was dort gesagt wurde. Und so wie bei all den anderen tief vergrabenen Traumata, die ich in Klassenzimmern angesammelt hatte, ließ ich den Schmerz über mein Versagen nicht zu. Stattdessen fiel ich in die alten Gewohnheiten und die Logik der Straße zurück, wo es häufig nötig war, Demütigungen zu leugnen und Schmerz in Wut zu verwandeln. Also nahm ich das Leid dieser Zeit wie einen Inkassobescheid entgegen und versteckte es in der obersten Schublade meines Geistes, entschlossen, mich darum zu kümmern, wenn ich die Mittel hätte zu bezahlen. Ich glaube, mittlerweile habe ich die meisten dieser alten Rechnungen beglichen. Aber der Schmerz und der Nachhall des Scheiterns halten sich, noch lange nachdem die Schublade geleert ist.
Aus irgendeinem Grund kann ich mich an alles erinnern, was ich mir nicht zu fühlen erlaubte, als ich an jenem Tag das Arbeitsamt verließ und durch die Straßen von Harlem lief, genau wie ich mich an alles erinnern kann, was ich mir in meiner Jugend nicht zu fühlen gestattete, als ich gefangen war zwischen den Schulen und der Straße. Und ich weiß, dass es da draußen schwarze Jungen und schwarze Mädchen gibt, die in einem Bermudadreieck des Geistes verloren sind oder in der Flaute Amerikas festhängen; nichts fühlend und nichts vergessend, halten sie sich über Wasser oder gehen unter. Das Wertvollste, was ich damals besaß und heute noch besitze: meine Neugier. Selbst im Klassenzimmer wusste ich immer, dass sie mir die nicht nehmen können. Meine Neugier war es, die mich über Wasser hielt und schließlich heraushob.
Wie jeder Mythos über selbst erarbeiteten Erfolg birgt auch dieser einen Funken Wahrheit. Aber zur Wahrheit gehört vor allem, dass der Wind um mich herum auffrischte, sich drehte und mein kleines Boot zurück in die Zivilisation blies. Meine Neugier hatte sich schon lange auf die Fragen rassischer Trennlinien gerichtet, ein Phänomen, das in den Nullerjahren in eigentümlichem Wandel begriffen schien. Die Energien des Landes hatten sich nach dem 11. September verlagert. Während der Bush-Jahre drehten sich die entscheidenden Fragen von Recht und Gerechtigkeit um Spionage und Folter. Die alte Bürgerrechtlergeneration zog sich allmählich zurück, und sogar unter schwarzen Aktivisten herrschte eine allgemeine Ermüdung angesichts des Feuerwehrmann-Modells von Führung, wie Jesse Jackson und Al Sharpton es repräsentierten. Die Choreographie neigte dazu, sich zu wiederholen. Irgendetwas Empörendes ereignete sich. Ein Protestmarsch wurde abgehalten. Vorhersehbare Standpunkte und Plattitüden wurden ausgetauscht. Und das ursprüngliche Vergehen geriet in Vergessenheit. Der Anlass der Empörung war meistens gravierend und sehr real – die Erschießung von Sean Bell durch die New Yorker Polizei zum Beispiel. Aber die Tatsache, dass daraus keine substanziellen Aktionen folgten und dass die Taktik sich innerhalb von gut vierzig Jahren nicht verändert zu haben schien, gab vielen von uns das Gefühl, dass wir Zeugen weniger einer politischen Bewegung als einer kathartischen Darbietung waren. Währenddessen war außerhalb der aktivistischen Community eine andere Idee im Aufwind: die Vorstellung, dass wir die »Ablenkung« des Rassismus irgendwie »hinter uns lassen« müssten. Bücher beklagten das Ausspielen der sogenannten »Rassenkarte«, Artikel plädierten dafür, die Gefährdungen der schwarzen Communities nicht länger mit Rasse zu erklären. Wie aufrichtig oder unredlich sich dies auch ausdrückte, es herrschte ein spürbarer Hunger nach etwas Neuem.
Zur gleichen Zeit, als ich mir in einem Arbeitsamt in Harlem meine Misserfolge vor Augen führte, warf Barack Obama im Kampf um die Präsidentschaft seinen Hut in den Ring.
Ich hatte noch nie einen schwarzen Mann wie Barack Obama gesehen. Er sprach zu den Weißen in einer neuen Sprache – als würde er ihnen tatsächlich vertrauen und an sie glauben. Es war nicht meine Sprache. Es war nicht einmal eine Sprache, die mich besonders interessierte, außer um zu verstehen, wie er sie gelernt und welche Wirkung sie auf seine Zuhörer hatte. Interessanter schien mir, dass er diese Sprache irgendwie mit der Sprache der Chicagoer South Side ausbalanciert hatte. Er sprach von sich selbst unmissverständlich als schwarzem Mann. Er hatte eine schwarze Frau geheiratet. Man vergisst leicht, wie schockierend das in Anbetracht der damals verbreiteten Auffassung war, dass zwischen Erfolg und Assimilation ein direkter Zusammenhang bestand. Der gängigen Erzählung zufolge heirateten erfolgreiche schwarze Männer weiße Frauen und traten in jenes unfruchtbare Niemandsland ein, das nicht schwarz war, aber auch niemals weiß sein konnte. Schwarzsein war für diese Männer nichts, in dem man verwurzelt sein konnte, sondern etwas, dem man zu entgehen und zu entfliehen suchte. Barack Obama fand einen dritten Weg – ein Mittel, seine Sympathie für das weiße Amerika auszudrücken, ohne sich ihm anzubiedern. Weiße ließen sich von ihm verzaubern – am allermeisten jene in den Nachrichten-Redaktionen. Diese Tatsache veränderte mein Leben. Sie erzeugte den Wechsel des Windes, ohne den meine Neugier bloß meine eigene geblieben wäre.
Meine These ist, dass Barack Obama direkt verantwortlich für den Aufstieg einer Reihe schwarzer Autoren und Journalisten ist, die während seiner beiden Amtszeiten bekannt wurden. Diese Autoren waren talentiert – aber Talent ist nichts ohne ein Feld, auf dem es sich zeigen kann. Obamas Präsenz eröffnete den Autoren ein neues Feld, und was als Neugier auf den Mann selbst begann, weitete sich schließlich zu einer Neugier auf die Community, in der er sich so bewusst verortete, und auf die alten, unruhig schlummernden Fragen zur amerikanischen Identität, die er wachgerufen hatte. Ich war einer dieser Autoren. Und auch wenn ich es damals nicht wahrnahm, als ich trübselig vom Arbeitsamt nach Hause trottete, raus aus dem Klassenzimmer und zurück über die 125. Straße, frischte der Wind überall um mich herum auf.
SCHON WÄHREND MEINER letzten Anstellung hatte ich mich für Bill Cosby interessiert, der auch den Ruf nach etwas Neuem zu hören schien. Damals tingelte er durch die Innenstädte des Landes, fest entschlossen, seine Leute davon abzubringen, »die Schuld beim weißen Mann zu suchen«. Die Tour durch die Vortragssäle schien spontan begonnen zu haben, ausgelöst von der Reaktion auf Cosbys berüchtigte Rührkuchenrede. 2004 war Cosby ans Rednerpult einer Veranstaltung getreten, die vom NAACP Legal Defense and Educational Fund finanziert wurde, offiziell um des fünfzigsten Jahrestags der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Sache Brown v. Board of Education zu gedenken, durch die die Rassentrennung an den Schulen aufgehoben worden war. Der Legal Defense Fund der NAACP hatte sich einen Namen gemacht, weil er die Gerichte anrief, das Land für die vielfältige Art und Weise, auf die Jim Crow schwarze Leben geplündert hatte, zur Rechenschaft zu ziehen. Aber als Cosby auf die Bühne trat, war er entschlossen, nicht die Plünderer, sondern die Geplünderten zur Rechenschaft zu ziehen. Er wetterte gegen »die Leute, die sich wirtschaftlich unten und in der unteren Mitte befinden«, weil sie ihren Teil des Bürgerrechtsdeals nicht erfüllten. Er attackierte schwarze Jugendliche dafür, von »500-Dollar-Sneakers« besessen zu sein. Er verhöhnte schwarze Eltern, weil sie ihren Kindern Namen wie »Shaniqua und Mohammed« gaben. Er schäumte vor Wut über die laxe Moral schwarzer Frauen.
Ich nahm Anstoß an dieser Charakterisierung und schrieb in der Village Voice darüber – ein weiterer Job, den ich verlieren würde –, kurz nachdem er die Rede gehalten hatte. Aber wie sich herausstellte, stimmte ein Teil der »sich wirtschaftlich unten und in der unteren Mitte befindenden« Leute Cosby tatsächlich zu. Das weiß ich, weil ich mir angesehen habe, wie Cosby ihnen die Botschaft direkt überbrachte. Er nannte diese Veranstaltungen »Weckrufe«. In der Regel versammelte Cosby lokale Amtsinhaber auf der Bühne – Schulleiter, Richter, Bewährungshelfer, Direktoren von Community Colleges. Dazu lud er diverse »gefährdete Jugendliche« ein. Die Beamten gaben dann ihre eigene Version der Rührkuchenrede zum Besten. Das Publikum applaudierte wie wild. Der Geist der Veranstaltung war irgendwo zwischen Uncle Ruckus (die Comicfigur, die behauptet, als Kind weiß gewesen zu sein) und dem Motivationsredner Les Brown zu Hause. Da war Selbstgeißelung. Da war Erweckung. Aber vor allem war da Nostalgie – eine Sehnsucht nach der unkomplizierten Zeit, als alle schwarzen Männer hart arbeiteten, alle schwarzen Frauen tugendhaft waren und alle schwarzen Eltern kollektiv den Kindern die Leviten lasen. Mittlerweile weiß ich, dass alle Menschen sich nach einer edlen, unbefleckten Vergangenheit sehnen, dass so sicher, wie der schwarze Nationalist von einem erhabenen Afrika vor der Korruption durch die Weißen träumt, Thomas Jefferson von einem idyllischen Britannien vor den Normannen träumte und wir alle von einer anderen Zeit träumen, als die Dinge noch einfach waren. Mittlerweile weiß ich, dass diese Sehnsucht ein Rückzug aus der komplizierten Gegenwart in den Mythos ist. Ich weiß, dass diejenigen, die sich in Märchen flüchten, die Zuflucht in dem verrückten Streben nach vergangener Größe suchen oder in einem Bild von Größe, die es nie gegeben hat, letztlich eine Tragödie erwartet.
Cosbys Weckrufe bekamen auch viel Applaus von weißen Experten. Das war weder überraschend noch interessant – die Weckrufe verlangten dem weißen Gewissen nichts ab, also war auch nichts Schockierendes daran, wenn Weiße ihm zujubelten. Was mich aber faszinierte, war diese Strömung schwarzer Nostalgie, die Sehnsucht nach einer edlen Vergangenheit, denn die schwarze Vergangenheit schien mir kein brauchbarer Quell für Nostalgie zu sein; alles, was ich dort sah, waren Rassentrennung und Sklaverei. Meine Faszination erstreckte sich auch auf Cosby selbst. Er war kein Konservativer in unserem binären Verständnis von Wahlpolitik. Da Cosby meist mit dem umgänglichen Dr. Huxtable verschmolz, den er in der Cosby Show spielte, verdeckte die bürgerliche Fassade seiner berühmtesten Rolle sein Selbstverständnis als race man. Er hatte die Anti-Apartheid-Bewegung unterstützt, für afroamerikanische Colleges und Universitäten gespendet, schwarzen Führungsfiguren wie Jesse Jackson und Organisationen wie TransAfrica geholfen. Er schien einen schwarzen Konservativismus wiederzubeleben, der in der amerikanischen Politik von links und rechts keine echte Heimat zu haben schien, aber tief in der schwarzen Community verwurzelt war.
Mir war, als hätte ich eine Geschichte über all das zu erzählen – eine große Geschichte. Cosby schien mir emblematisch für eine Richtung schwarzen Denkens, der ich nicht zustimmte, aber die ich besser verstehen wollte. Ich wollte das in einer Mischung aus Porträt, Kommentar und persönlichen Erinnerungen herausarbeiten. Der daraus resultierende Essay – »So haben wir gegen den weißen Mann verloren« – scheitert letztlich an diesem Versuch, aber die Aufmerksamkeit, die er erregte, und die Beziehung zum Atlantic, die damit begann, markierten die erste Phase meines Lebens, in der ich gefestigt genug war, um weitere Versuche zu unternehmen und mir somit den Traum zu erfüllen, den gleichen Weg zu beschreiten wie meine Helden, wie James Baldwin oder Zora Neale Hurston. So wie sie versuchte ich mit diesem Text auf meine eigene Weise schwarze Menschen zum Leben zu erwecken, die mehr waren als Comicfiguren, mehr als Foto-Negative oder Schatten.
Die Tradition schwarzen Schreibens ist zwangsläufig düster, zwangsläufig resistent. Sie war das Haus, in dem ich wohnen wollte, und wenn man meinen Einzug datieren möchte, liegt man mit dem Tag der Veröffentlichung dieses Artikels wahrscheinlich nicht falsch. Ich nenne ihn einen »Versuch«, weil ich ein Gefühl zu Papier bringen wollte, etwas Traumartiges und schwer Fassbares, das in meinem Kopf existierte und dort zu großen Teilen auch eingeschlossen blieb. Und auch anderen Herausforderungen, die der Text barg, wurde ich nicht gerecht.
Ich weiß nicht, ob Cosbys Weckrufe die Flut an Vergewaltigungsvorwürfen verdecken sollten, der er schon damals ausgesetzt war. Ich wusste von den Vorwürfen. Andere Journalisten hatten darüber berichtet. Ich wusste auch, dass sie mehr Aufmerksamkeit verdienten als die eine Zeile, die ihnen in meinem Essay letztlich zukam. Ich hatte noch nie eine Geschichte wie »So haben wir gegen den weißen Mann verloren« geschrieben. Ich hatte noch nie für ein so bedeutendes landesweites Publikationsorgan geschrieben. Ich musste mich mit meinen lauernden Versagensängsten auseinandersetzen. Lieber eine klare Geschichte schreiben, überlegte ich mir, als eine komplizierte, wenn ich mich dann mit Redakteuren auseinandersetzen muss, die ich noch nicht kenne. Aber die komplizierte Geschichte wäre wahrer gewesen – sie hätte möglicherweise mehr zu erklären vermocht als die einfache Geschichte, für die ich mich entschied. So kam es, dass ich selbst dem zum Opfer fiel, was ich als bestimmende Kraft hinter Bill Cosbys Handeln beschrieb: der Vereinfachung.
Und es gab noch mehr, was ungesagt blieb. So wie immer, wenn man berichtet und recherchiert, wenn man die verschiedenen Wahrnehmungen, alles, was man sieht, hört und fühlt, in eine einigermaßen zusammenhängende Wortfolge zu bringen versucht. Das war stets die größte Herausforderung in den Jahren, in denen ich für den Atlantic schrieb, Jahren, die mich vom Arbeitsamt schließlich ins Oval Office führen sollten, um Zeuge von Geschichte zu werden. Für jeden Text in diesem Buch gilt, dass es eine Geschichte gibt, die ich erzählt habe, und viele weitere, die ich nicht erzählt habe, ob das nun gut war oder schlecht. Im Falle Bill Cosbys war es sicher schlecht. Das war meine Schande. Das war mein Versagen. Das war der Anfang meiner Geschichte.
»SO HABEN WIR GEGEN DEN WEISSEN MANN VERLOREN«
DIE KÜHNHEIT VON BILL COSBYS SCHWARZEM KONSERVATIVISMUS
LETZTEN SOMMER WURDE ICH Zeuge, wie Bill Cosby in der Detroiter St. Paul Church of God in Christ seinen inneren Malcolm X heraufbeschwor. Es war ein heißer Juliabend. Cosby sprach vor einem Publikum aus schwarzen Männern, die Enyce-T-Shirts oder Polohemden oder Blazer und Krawatte trugen. Manche waren mit ihren Söhnen gekommen. Manche saßen im Rollstuhl. Die Kirche war brechend voll, hinter den hölzernen Bänken wurden Reihen mit Klappstühlen aufgestellt, um den Andrang aufzufangen. Aber auch die Stühle reichten nicht aus, und die Nachzügler platzierten sich entlang der Seitenwände oder draußen in der kleinen Empfangshalle, wo sie ein paar Fetzen von Cosbys Rede aufzuschnappen hofften. Vorne lief Cosby mit einem kabellosen Mikro hin und her und wechselte zwischen vorbereiteten Ausführungen und komischen Stegreifbemerkungen. In einer Reihe hinter ihm saßen einige ältere schwarze Herren, die Gemeindeältesten, nickten und grunzten kehlige Zustimmung. Der Rest der Kirche war im Call-and-Response-Modus und durchsetzte Cosbys Pointen mit Gelächter, Applaus und Zwischenrufen wie: »Teach, black man! Teach!«
Er fing mit der Geschichte eines schwarzen Mädchens an, das zur Klassenbesten seiner alten Highschool aufstieg, obwohl es vom Vater verlassen worden war. »Sie hielt die Rede vor dem Abschlussjahrgang, und ihre Rede begann so«, sagte Cosby. »Ich war fünf Jahre alt. Es war Samstag und ich stand am Fenster und wartete auf ihn. Sie hat nie gesagt, was ihr half, die Wende zu schaffen. Ihre Mutter, ihre Großmutter oder ihre Urgroßmutter erwähnte sie nie.«
»Hört ihr mich?«, sagte Cosby mit verzerrter, wie zur Faust geballter Miene. »Männer? Männer? Männer! Wo seid ihr, Männer?«
Publikum: »Wir sind hier!«
Cosby war mit dem Ziel nach Detroit gekommen, die schwarzen Männer der Stadt am Kragen zu packen und die Starre aus ihnen herauszuschütteln, die sie – wie schwarze Männer im ganzen Land – als unterdurchschnittlich gebildet, überdurchschnittlich inhaftiert und unterrepräsentiert in den Reihen aktiver Väter dastehen lässt. Es waren keine Frauen im Publikum. Reporter waren nicht zugelassen, aus Angst, ihre Anwesenheit könnte jene Väter verschrecken, die mit ihren Unterhaltszahlungen im Rückstand waren. Aber ich war da und profitierte von Rasse, Geschlecht und dem Versprechen, keinen der angeblich scheuen Teilnehmer zu interviewen.
»Männer, wenn ihr gewinnen wollt, dann können wir gewinnen«, sagte Cosby. »Wir sind keine bedauernswerte Rasse. Wir sind eine strahlende Rasse, die mit den Besten mithalten kann. Aber wir leben in einer neuen Zeit, in der die Leute pathologisches Verhalten normal finden. (…) Als sie damals in unsere Viertel kamen, haben wir die Kinder im Keller versteckt, zum Gewehr gegriffen und gesagt: By any means necessary. Mit allen notwendigen Mitteln.«
»Über den Hass dieser Leute will ich gar nicht reden«, fuhr er fort. »Ich spreche von einer Zeit, in der wir unsere Frauen und unsere Kinder beschützten. Jetzt haben wir Menschen in Rollstühlen, die gelähmt sind. Ein kleines Mädchen in Camden, dem beim Seilspringen durch den Mund geschossen wurde. Die Großmutter hat’s durchs Fenster gesehen. Und die Leute warten darauf, dass Jesus kommt, obwohl Jesus doch schon in ihnen ist.«
Cosby trug seine übliche Uniform – dunkle Sonnenbrille, Slipper, einen Jogginganzug mit dem Emblem einer Hochschule. An diesem Abend war es die University of Massachusetts, an der er dreißig Jahre zuvor seinen Doktor in Erziehungswissenschaften gemacht hatte. Er predigte aus dem Buch schwarzer Eigenverantwortung, eine Heilsbotschaft, die er in den vergangenen vier Jahren bei Veranstaltungen im ganzen Land – angekündigt als »Weckrufe« – verbreitet hat. »Mein Problem«, erzählte Cosby dem Publikum, »ist, dass ich es leid bin, gegen Weiße zu verlieren. Wenn ich sage, Weiße sind mir egal, dann meine ich, lass sie reden. Was können sie schon zu mir sagen, was schlimmer wäre als das, was ihr Großvater gesagt hat?«
Von Birmingham bis Cleveland und Baltimore, in Kirchen und Colleges, hat Cosby Tausenden schwarzer Amerikaner erzählt, dass Rassismus zwar allgegenwärtig sei, aber keine Ausrede dafür, sich nicht anzustrengen. Cosby zufolge sind die wirksamsten Mittel gegen Rassismus nicht Versammlungen, Demonstrationen und Appelle, sondern starke Familien und Gemeinden. Anstatt einer abstrakten Idee von Gleichheit anzuhängen, sollten Schwarze ihre Kultur reinigen, sich ihrer persönlichen Verantwortung stellen und die Traditionen wiederbeleben, die sie in der Vergangenheit stark gemacht hatten. Hinter Cosbys Standpauken über Werte und Verantwortung steht eine Vision, die sich grundlegend von Martin Luther Kings sanftem, alle Menschen einschließenden Traum unterscheidet: Es ist ein Amerika der konkurrierenden Kräfte, mit einem schwarzen Amerika, das sich nicht länger damit zufriedengibt, die schwächste Kraft zu sein.
Das ist starker Tobak, vor allem aus dem Mund eines Mannes, an den sich das weiße Amerika als Sitcom-Star und freundliches Werbegesicht von E. F. Hutton, Kodak und Jell-O Pudding Pops erinnert. Und gerade jetzt wirkt Cosbys rassisch fundierter Kreuzzug besonders schrill. In dem Maße, in dem sich schwarze Politik professionalisiert hat, weicht das Reden über Rasse überall dem Reden über Standards und Ergebnisse. Newarks junger Bürgermeister Cory Booker mit seiner Ivy-League-Ausbildung bewarb sich mit dem Versprechen der Kompetenz und der Kriminalitätsbekämpfung um das Amt, genau wie Washingtons Bürgermeister Adrian Fenty. Wir erleben einen Augenblick, in dem sich die Nation für ihre Fortschritte in der Rassenfrage beglückwünscht und ein schwarzer Präsidentschaftskandidat die Verwirklichung von Kings Traum verkörpert. Barack Obama hat den Bemühungen der Clinton-Kampagne getrotzt, ihn in die Schublade des »schwarzen« Kandidaten zu stecken, und inszeniert sich stattdessen als das Symbol einer Gesellschaft, die die denkfaulen Einteilungen in Rassen hinter sich gelassen hat.
Das schwarze Amerika scheint die Euphorie jedoch nicht ganz zu teilen. Die Bürgerrechtsgeneration verlässt die amerikanische Bühne, eingehüllt nicht in den Nebel der Nostalgie, sondern in eine düstere Wolke der Beunruhigung angesichts des anhaltenden Rassismus, der vermeintlichen Schwäche der nachfolgenden Generation und der scheinbaren Gleichgültigkeit großer Teile des Landes gegenüber dem Schicksal des schwarzen Amerikas. In diesem Klima zeigt Cosbys Heilsbotschaft von Disziplin, moralischer Reform und Eigenverantwortung einen Ausweg auf – die Verheißung, dass man Amerika nicht von seiner Erbsünde heilen muss, um Erfolg zu haben. Der Rassismus mag nicht ausgerottet sein, aber man kann ihn schlagen.
Hat Dr. Huxtable, Vorstand eines der beliebtesten Fernsehhaushalte der Nation, die Wahrheit erkannt: dass der Traum der Integration niemals das Streben nach Selbstachtung verdrängen sollte, dass Schwarze sich mehr Gedanken darüber machen sollten, wie sie sich selbst beurteilen, als darüber, ob sie von Weißen aufgrund ihres Charakters beurteilt werden? Oder hat er den Verstand verloren?
Von dem Moment an, als er – in der Rolle des Oxford-Absolventen Alexander Scott in der NBC-Abenteuerserie Tennisschläger und Kanonen – ins populäre Bewusstsein drang, stand Cosby für die Idee eines Amerikas, das die Frage der Rasse hinter sich ließ. Die Serie, die 1965 anlief, war die erste wöchentliche Show mit einem Afroamerikaner in der Hauptrolle, aber Rassenbeziehungen spielten darin kaum eine Rolle. Auch in Cosbys Auftritten als immens populärer Stand-up-Comedian kam das Thema kaum vor. »Ich grübele nicht groß darüber nach, wie ich eine soziale Botschaft in meine Show schmuggeln könnte«, sagte Cosby 1969 dem Playboy – und dass er »keine Zeit« habe, »herumzusitzen und mir den Kopf zu zerbrechen, ob die Schwarzen dieser Welt es meinetwegen schaffen werden. Ich muss mich um meinen Gig kümmern.« Seine künstlerische und kommerzielle Krönung – die Cosby Show, die von 1984 bis 1992 lief – war scheinbar ein Monument jener zurückhaltenden Sensibilität.
Tatsächlich war schwarze Identität niemals ausgeklammert, weder in der Cosby Show noch bei Bill Cosby selbst. In die Handlungsstränge wurden schwarze Musiker wie Stevie Wonder oder Dizzy Gillespie eingebaut. Im Haus der Huxtables hingen Bilder schwarzer Künstler wie Annie Lee, schwarze Theaterveteranen wie Roscoe Lee Browne und Moses Gunn waren Teil der Besetzung. Für die Arbeit hinter den Kulissen engagierte Cosby den Harvard-Psychiater Alvin Poussaint, der sicherstellen sollte, dass die Serie keine Stereotypen verbreitete und Schwarze würdevoll darstellte. Poussaint griff Cosbys Bildungsfixierung auf und veranlasste die Drehbuchautoren, schwarze Schulen und Colleges einzubauen. »Wenn im Drehbuch Oberlin, Texas Tech oder Yale stand, kreisten wir die Stellen ein und sagten, sie sollen stattdessen ein schwarzes College nehmen«, erzählte mir Poussaint letztes Jahr in einem Telefoninterview. »Ich weiß noch, am nächsten Tag fragten dann die Weißen bei der Arbeit, was Morehouse für ein College sei.« 1985 verärgerte Cosby den Sender NBC, weil er ein Anti-Apartheid-Poster an der Zimmertür des Huxtable-Sohns platzierte. Der Sender wollte sich aus der Debatte heraushalten. »Bei Archie Bunker mag es verschiedene Ansichten zur Apartheid geben«, wurde Cosby im Toronto Star zitiert, »aber die Huxtables können nur auf einer Seite stehen. Das Poster bleibt an der Tür. Und ich habe der NBC gesagt, wenn sie es abnehmen wollen oder versuchen, es aus der Show herauszuschneiden, dann gibt es keine Show.« Das Poster blieb.
Abseits der Bühne trug Cosbys Philanthropie ihm hohes Ansehen innerhalb der Bürgerrechtsszene ein, vor allem, als seine Frau und er 1988 dem Spelman College zwanzig Millionen Dollar spendeten – die größte private Spende, die ein schwarzes College je erhalten hatte. »Zwei Millionen wären fantastisch gewesen; zwanzig Millionen waren der pure Irrsinn, um es in der Sprache der Hip-Hop-Generation auszudrücken«, sagt Johnnetta Cole, damals Präsidentin von Spelman. Als Cosbys Sohn 1997 willkürlich erschossen wurde, während er auf einem Freeway in Los Angeles einen kaputten Reifen wechselte, trat die Kategorie Rasse erneut in den Vordergrund. Cosbys Frau schrieb einen Kommentar für USA Today, in dem sie den Tod ihres Sohnes weißem Rassismus anlastete. »Alle Afroamerikaner sind in diesem Land jederzeit gefährdet, ungeachtet ihrer Bildung und ihrer wirtschaftlichen Situation, einfach aufgrund ihrer Hautfarbe«, schrieb sie. »Wir alle wissen doch, dass Heilung und Entwicklung nur möglich sind, wenn man der Wahrheit ins Auge sieht. Wann endlich sieht Amerika seinen historischen und gegenwärtigen rassischen Realitäten ins Auge, so dass es zu dem Land werden kann, das es zu sein vorgibt?«
Der Kommentar verursachte einen kleinen Aufruhr, aber die meisten Weißen nahmen ihn kaum wahr. Für sie blieb Cosby Amerikas Dad. Aber wer den Cosbys nahestand, war von dem Kommentar nicht überrascht. Cosby war ausdrücklich ein race man, der wie viele seiner Generation den Eindruck gewonnen hatte, das schwarze Amerika sei vom Weg abgekommen. Die Krise der abwesenden Väter, die Zunahme der Verbrechen, die Schwarze an Schwarzen verübten, und die wachsende Popularität von Hip-Hop ließen Cosby zu der Überzeugung gelangen, die schwarze Community würde nach den Errungenschaften der sechziger Jahre nun kulturellen Selbstmord begehen.
Sein Zorn und seine Frustration platzten 2004 während einer NAACP-Preisverleihung in Washington ins öffentliche Bewusstsein. Anlass der Gala war der fünfzigste Jahrestag der Gerichtsentscheidung Brown v. Board of Education, der in eine Zeit fiel, als die Schatten der Sterblichkeit und der Bedeutungslosigkeit sich über die Bürgerrechtsgeneration legten. Innerhalb der nächsten zwei Jahre würden Rosa Parks und Coretta Scott King, die Matriarchinnen der Bewegung, sterben. Die Mitgliederzahlen der NAACP schrumpften; wenige Monate später würde ihr Präsident Kweisi Mfume zurücktreten (später wurde bekannt, dass die NAACP eine Untersuchung wegen sexueller Belästigung und Vetternwirtschaft gegen ihn eingeleitet hatte – Anschuldigungen, die er zurückwies). Andere Führungsfiguren glitten in die Selbstparodie ab: Al Sharpton würde bald darauf eine Reality-Show moderieren und ein Jahr später Werbung für eine räuberische Kreditbank machen; kurz zuvor hatten Jesse Jackson und er MGM noch aufgefordert, sich für den erfolgreichen Film Barbershop zu entschuldigen.
Cosby war einer der letzten Geehrten, die an jenem Abend das Podium betraten. Er begann mit der Bemerkung, dass junge Schwarze die Türen ignorierten, die die Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung für sie geöffnet hatten, und stattdessen einen Schritt zurück machten. »Niemand schämt sich mehr dafür, schwanger zu sein und keinen Mann zu haben«, sagte er dem Publikum. »Es ist keine Schande mehr, wenn ein junger Mann sich davor drückt, dem unehelichen Kind ein Vater zu sein.«
Jubel brandete auf, und Cosby machte weiter. Vielleicht hatte er das Gefühl, die Leute auf seiner Seite zu haben, und preschte deshalb vor. »Die Leute, die sich wirtschaftlich unten und in der unteren Mitte befinden, erfüllen ihren Teil des Deals nicht«, verkündete er dem Publikum.
Cosby verunglimpfte Aktivisten, die dem Strafjustizsystem Rassismus vorwarfen. »Da sind Leute unterwegs, die Coca-Cola klauen. Leute, denen wegen eines Stücks Rührkuchen in den Hinterkopf geschossen wird«, sagte Cosby. »Dann rennen wir alle auf die Straße und sind empört: Die Cops hätten ihn nicht erschießen sollen. Aber was zum Teufel hatte er mit dem Rührkuchen vor? Ich habe mal genauso verzweifelt ein Stück Rührkuchen gewollt. Da war der Kuchen, und da war ich und hatte kein Geld. Und etwas, das sich Erziehung nennt, sagte mir: Wenn du dabei erwischt wirst, machst du deiner Mutter Schande.«
Dann griff er die afroamerikanischen Namensgepflogenheiten und den Bekleidungsstil junger Schwarzer an. »Meine Damen und Herren, hören Sie sich diese Leute an, dann wissen Sie, was falsch läuft. (…) Woher in Afrika soll das sein? Wir sind keine Afrikaner. Diese Leute sind keine Afrikaner. Sie wissen einen Dreck über Afrika – aber sie heißen Shaniqua, Shaligua, Mohammed und sonst wie und sitzen allesamt im Gefängnis.« Etwa zu diesem Zeitpunkt verließen die Ersten den Zuschauerraum und versammelten sich in der Lobby. Es gab immer noch Jubel, aber einige Gäste liefen umher und fragten sich, was passiert war. Manche glaubten, Cosby sei senil geworden. Das vorherrschende Gefühl war Schock.
Nach diesem Ereignis, das als Pound Cake speech – Rührkuchenrede – bekannt wurde und einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, wurde Cosby von verschiedenen Gruppierungen des schwarzen Establishments attackiert. Der Dramatiker August Wilson kommentierte: »Ein Milliardär, der Armen ihre Armut vorwirft. Bill Cosby ist ein Clown. Was soll man da erwarten?« Einer der Moderatoren der Gala, Ted Shaw, leitender Anwalt des NAACP Legal Defense and Educational Fund, nannte Cosbys Bemerkungen »eine brutale Verunglimpfung insbesondere mittelloser Schwarzer«. Nachdem er Cosby einen »Afristokraten im Winter« genannt hatte, veröffentlichte Michael Eric Dyson, Professor an der Georgetown University, ein Buch mit dem Titel Is Bill Cosby Right? Or Has the Black Middle Class Lost Its Mind? (Hat Bill Cosby recht? Oder hat die schwarze Mittelschicht den Verstand verloren?), in dem er Einspruch gegen Cosbys düstere Diagnose erhob und dessen Wandlung vom Mainstream-Komiker zum Sozialkritiker und Moralapostel herabwürdigte. »Cosby profitierte vom Kampf der Bürgerrechtsbewegung«, schrieb Dyson, »aber er verweigert ihm vehement einen Platz an seinem künstlerischen Tisch.«
In den Barbershops, Kirchen und bei den Grillpartys der schwarzen Gemeinden, wo eine bestimmte Form des Konservativismus immer noch dominant ist, kam Cosbys Rhetorik dagegen gut an. Außenseiter mögen in Cosbys Sprache und Tonfall eine Standpauke vernommen haben. Aber weite Teile des schwarzen Amerikas hörten darin die Möglichkeit, ihre Communities zu verändern, ohne vom Gewissen und der Aufmerksamkeitsspanne der politischen Entscheidungsträger abhängig zu sein, denen ihre Interessen möglicherweise gleichgültig waren. Als Cosby dann mit seiner Rührkuchenrede durchs Land tourte, verfasste ich einen Artikel, in dem ich ihm elitäres Denken vorwarf. Mein Vater, ein ehemaliger Black Panther, las den Artikel und rügte mich dafür – für ihn barg Cosbys Auftritt eine Botschaft schwarzer Ermächtigung. Und aus dem gleichen Grund verfängt Cosbys Argumentation beim schwarzen Mainstream.
Die Kluft zwischen Cosby und Kritikern wie Dyson spiegelt nicht nur die Kluft zwischen den konservativen und liberalen Denktraditionen des Landes, sondern auch die historische intellektuelle Spaltung innerhalb des schwarzen Amerikas. Cosbys offensichtlichster Vorläufer ist Booker T. Washington. An der Wende zum 20. Jahrhundert verband Washington eine Verteidigung des weißen Südens mit dem Ruf nach schwarzer Eigenverantwortung und wurde zum prominentesten schwarzen Führer seiner Zeit. Er argumentierte, dass man den weißen Südstaatlern Zeit geben müsse, um sich an die Emanzipation zu gewöhnen; in der Zwischenzeit sollten die Schwarzen ihre gesellschaftliche Position verbessern, aber nicht, indem sie wählten oder für Ämter kandidierten, sondern indem sie das Land bewirtschafteten und selbst Landbesitzer würden.
Auf der anderen Seite stand W. E. B. Du Bois, das integrationistische Vorbild für die Dysons unserer Zeit, der in Washington einen Apologeten des weißen Rassismus sah; dessen Bereitschaft, das schwarze Wahlrecht zu opfern, hielt Du Bois für Ketzerei. Die eine Hälfte von Washingtons Gedankengebäude fiel der Geschichte selbst zum Opfer: Sein berühmter Kompromiss von Atlanta – in dem er die Rassentrennung als vorläufiges Mittel akzeptierte, um Frieden mit den Südstaatlern zu schließen – wurde mit Lynchmorden, Landraub und rassischem Terror beantwortet. Doch die andere Hälfte – sein Plädoyer für schwarze Eigenverantwortung – hatte Bestand.
Nach Washingtons Tod 1915 fand die schwarze konservative Tradition, die er begründet hatte, ihr dauerhaftes und natürliches Zuhause in der aufstrebenden Ideologie des schwarzen Nationalismus. Marcus Garvey, der Schutzheilige der Bewegung, stellte den Kompromiss von Atlanta auf den Kopf; implizit akzeptierte auch er die Rassentrennung, allerdings nicht als Friedensangebot an die Weißen, sondern als Ausweis schwarzer Überlegenheit. Die schwarzen Nationalisten schmähten die Integrationisten Du Bois’scher Prägung als Marionetten oder Verräter, die sich nicht schämten, Leute um Hilfe anzubetteln, die ihnen mit Hass begegneten.
Garvey vertrat die Ansicht, dass die Schwarzen sich des weißen Respekts nicht als würdig erwiesen hatten. »Die größten Stolpersteine beim Fortschritt der Rasse hat sich die Rasse stets selbst in den Weg gelegt«, schrieb Garvey. »Der zerstörerische Sand, der ins Getriebe des Negerfortschritts geworfen wird, stammt nicht von einem Außenseiter, sondern von ebenjenem Burschen in unserer Mitte, der der Erste sein sollte, das Rad des Fortschritts zu schmieren, statt es zu behindern.« Jahrzehnte später sollte dieser Gedanke auch bei Malcolm X anklingen, der bemängelte, dass die Schwarzen ihr Schicksal nicht selbst in die Hand nähmen. »Der weiße Mann ist zu intelligent, um zuzulassen, dass jemand anders die Kontrolle über die wirtschaftlichen Belange seiner Gemeinschaft übernimmt«, sagte Malcolm. »Aber ihr lasst jedermann herein und erlaubt ihm, die Kontrolle über die wirtschaftlichen Belange eurer Gemeinschaft zu übernehmen, ihr lasst ihn das Wohnungswesen, die Bildung, die Jobs, die Unternehmen kontrollieren, alles unter dem Vorwand, dass ihr euch integrieren wollt. Nein, ihr habt den Verstand verloren.«
Schwarze Konservative wie Malcolm X oder Louis Farrakhan, der Führer der Nation of Islam, haben sich gelegentlich mit schwarzen Liberalen verbündet. Doch im Allgemeinen halten sie an einigen Kernüberzeugungen fest, die Garvey fast ein Jahrhundert zuvor umrissen hat: einer grundlegenden Skepsis gegenüber (weißen) Regierungen als vermittelnden Kraft beim »Negerproblem«, einem unerschütterlichen Glauben an einen vereinten Willen des schwarzen Volkes und einer Fixierung auf eine vermeintlich glorreiche Vergangenheit.
Von diesen Überzeugungen ist auch Come On People beseelt, das Manifest, das Cosby und Poussaint im vergangenen Herbst veröffentlichten. Auch wenn es staatliche Programme nicht gänzlich ablehnt, tritt das Buch doch überwiegend für Lösungen von innerhalb der Community ein, um die trostlose Bevölkerungsstatistik des schwarzen Amerikas zu kurieren. »Sobald wir unsere Position bestimmt haben«, schreiben sie, »können wir auf unserem Weg von Opfern zu Siegern voranschreiten, so wie wir es immer getan haben.« Come On People ist durchdrungen von schwarzem Stolz (»keine Bevölkerungsgruppe hat einen solchen Einfluss auf die Kultur der gesamten Welt gehabt wie die Afroamerikaner, und dieser Einfluss war größtenteils gut«) und stärker noch von der Idee des großen Niedergangs – genauer gesagt der Theorie, dass die Schwarzen nach Jim Crow den Bezug zu ihren kulturellen Traditionen verloren haben, die es ihnen ermöglichten, Jahrhunderte der Unterdrückung zu überstehen.
»Bei allem Leid brachte die Rassentrennung auch etwas Gutes«, schreiben Cosby und Poussaint. »Sie zwang uns zum Beispiel, uns um uns selbst zu kümmern. Als Restaurants, Wäschereien, Hotels, Theater, Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäfte segregiert waren, eröffneten und führten die Schwarzen ihre eigenen Geschäfte. Schwarze Lebensversicherungsanstalten und Banken florierten, genau wie schwarze Bestattungsinstitute. (…) Solche Erfolge sorgten für Arbeit und schwarzen Wohlstand. Sie verliehen der schwarzen Bevölkerung zudem das befriedigende Gefühl einer eng verflochtenen Gemeinschaft.« Obwohl die Autoren sich bemühen, sich von der Nation of Islam zu distanzieren, zitieren sie doch voller Anerkennung einen ihrer Prediger, der bei einem Weckruf im kalifornischen Compton sprach: »Heute war ich in Koreatown und habe mich mit den koreanischen Kaufleuten getroffen«, sagte der Prediger der Menge. »Ich liebe sie. Wisst ihr warum? Wie heißt der Ort, in dem sie leben? Koreatown. Danach fuhr ich nach Chinatown. Wie heißt der Ort? Chinatown. Wo ist euer Ort?«
Die Idee des großen Niedergangs und die begleitende Theorie, dass die Rassentrennung auch etwas »Gutes« befördert habe, gehören zum festen Inventar dessen, was der Juraprofessor Christopher Alan Bracey von der Washington University in seinem Buch Saviours or Sellouts die »organische« schwarze konservative Tradition nennt: Konservative, die harte Arbeit und moralische Besserung Protesten und Eingriffen von staatlicher Seite vorziehen, aber aufgrund ihrer Nähe zu den Black Nationalists der Heritage Foundation oder Rush Limbaugh ein Gräuel sind. Wenn Politstrategen davon sprechen, dass die Republikaner eine Riesenchance vertun, die schwarze Community zu gewinnen, dann ist es dieser überwiegend männliche Block, an den sie denken – den älteren Frisör, den ergrauten Football-Trainer, den pensionierten Vietnam-Veteranen, den betrunkenen Onkel beim Familientreffen. Er wählt demokratisch, nicht aus Liebe zum Abtreibungsrecht oder zu progressiver Besteuerung, sondern weil er spürt – weil er weiß –, dass die Wählerbasis der Republikanischen Partei Menschen sind, die ihn hassen. Und das ist das Publikum, das zu Cosby strömt: kulturell konservative schwarze Amerikaner, die davon überzeugt sind, dass die Integration und bis zu einem gewissen Grad der ganze liberale Traum sie ihrer natürlichen Abwehrkräfte beraubt haben.
»Es gibt Dinge, die haben wir nicht kommen sehen«, erzählte mir Cosby letztes Jahr, als wir uns in Manhattan zum Lunch trafen. »Den Klan zum Beispiel konnte man sehen, aber weil diese Dinge nicht auf einem Pferd daherkommen, weil es kein weißes Laken gibt und die Täter nicht weiß sind, haben wir die Dinge im Licht von Familie und Vergebung betrachtet. (…) Wir haben nicht auf die Schulabbrecherrate geachtet. Wir haben nicht auf die Väter geachtet, auf die Selbstachtung unserer Jungs.«
Angesichts des Zustandes, in dem das schwarze Amerika sich befindet, lässt sich über diese Analyse schwerlich streiten. 13 Prozent der Bevölkerung sind schwarz, aber schwarze Männer machen 49 Prozent der amerikanischen Mordopfer aus und 41 Prozent der Inhaftierten. Die Geburtenrate unter schwarzen Teenagern beträgt 63 auf 1000, doppelt so hoch wie bei Weißen. 2005 verfügten schwarze Familien über das niedrigste mittlere Einkommen aller ethnischen Gruppen, die bei der Volkszählung erfasst wurden, und ihr mittleres Einkommen betrug nur 61 Prozent des Einkommens von Weißen.
Am beunruhigendsten ist eine unlängst veröffentlichte Studie der Pew Charitable Trusts, die zu dem Ergebnis kam, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in den 1960er Jahren in die Mittelschicht hineingeborene Schwarze in die Armut oder Beinahe-Armut abglitten, mit 45 Prozent dreimal so hoch war wie bei Weißen – was nahelegt, dass die Fortschritte selbst der erfolgreichsten Gruppen des schwarzen Amerikas bestenfalls unsicher bleiben. Einer anderen, im vergangenen November veröffentlichten Pew-Studie zufolge waren Schwarze »seit 1983 nicht mehr so wenig optimistisch bezüglich schwarzer Aufstiegsmöglichkeiten«.
Der Aufschwung der organischen konservativen schwarzen Tradition ist auch eine Reaktion darauf, dass Amerika sich zunehmend aus seinem zweiten Versuch einer Reconstruction zurückzuziehen scheint. Schwarze haben verfolgt, wie Gerichte Affirmative Action schwächten, das wohl stärkste Symbol staatlich geförderter Inklusion. Sie wurden Zeugen eines verlogenen Kriegs gegen die Drogen, der sich angesichts der Opfer ausnimmt wie ein Krieg gegen Schwarze. Sie haben sich zum Spielball von Präsidentschaftskampagnen werden sehen: Ronald Reagans (mit seiner Beschwörung der »Rechte von Bundesstaaten« in Mississippi 1980), George Bushs (Willie Horton), Bill Clintons (seine Distanzierung von Sister Souljah) und George W. Bushs (John McCains angebliches uneheliches schwarzes Kind). Sie haben die Bemühungen um ein Ende der Rassentrennung in Schulen und im Wohnungswesen scheitern sehen. Sie haben die Schrecken von Katrina erlebt. Das Ergebnis all dessen ist ein breites Misstrauen gegenüber der Regierung als Garant schwarzen Fortschritts.
Im Mai 2004, nur einen Tag vor Cosbys Rührkuchenrede, besuchte die New York Times Louisville, Kentucky, einst der Nullpunkt im Kampf für eine Integration der Schulen. Aber die Times stellte fest, dass sich die Positionen vertauscht hatten und dass schwarze Eltern sich stärker für Bildungsfortschritte als für ein ausgewogenes Verhältnis der Schülergruppen interessierten. »Integration? Was hat die uns schon gebracht?«, fragte ein Elternteil. »Sie haben unsere Kinder in die Falle gelockt, damit sie scheitern.«
Als Reaktion auf dieses vermeintliche Versagen richten viele schwarze Aktivisten ihre Bemühungen nun nach innen. Geoffrey Canadas ambitioniertes Harlem Children’s Zone-Projekt spornt schwarze Schüler an, ihre Lerngewohnheiten zu verändern und ihr häusliches Leben zu verbessern. In Städten wie Baltimore und New York bilden sich Community-Gruppen, die aus schwarzen Männern aktive Väter machen wollen. Das Liacouras Center in Philadelphia war im vergangenen Oktober mit Tausenden schwarzer Männer gefüllt, die sich verpflichteten, in ihren Vierteln Streife zu laufen und gegen die steigende Mordrate anzukämpfen. Als Cosby in die St. Paul Church in Detroit kam, erhob sich ein örtlicher Richter und forderte Cosby und andere schwarze Prominente auf, die gemeinsame Sache mit mehr Geld zu unterstützen. »Ich bin nicht hierhergekommen, um einen Scheck auszustellen«, entgegnete Cosby. »Ich stelle auch in Houston, Detroit oder Philadelphia keine Schecks aus. Lasst die Sportler in Ruhe. Ihr kennt ja nur Oprah Winfrey und Michael Jackson. Vergesst den Scheck. (…) So haben wir gegen den weißen Mann verloren. Der Richter meinte, Bill Cosby würde einen Scheck ausstellen, aber bis es so weit ist (…)«
Statt auf Almosen oder Hilfe von außen zu warten, sollten benachteiligte Schwarze Cosby zufolge damit anfangen, ihre eigene Kultur von schädlichen Einflüssen zu befreien, wie zum Beispiel dem Gangsta Rap, einem seiner bevorzugten Angriffsziele. »Was denken sich die Plattenproduzenten dabei, wenn sie am laufenden Band Gangsta Rap mit asozialen, frauenfeindlichen Botschaften ausspucken?«, fragen Cosby und Poussaint in ihrem Buch. »Glauben sie, dass schwarze Jugendliche nicht ausleben werden, was ihnen eingebläut wurde, seit sie alt genug sind, um hinzuhören?« Cosbys Reden über Kultur spiegeln – und verstärken – eine wachsende Strömung der öffentlichen schwarzen Meinung: Die Pew-Umfrage vom vergangenen November stellte fest, dass 71 Prozent der afroamerikanischen Bevölkerung Rap für einen schlechten Einfluss hielten.
Der schwarze Konservativismus, den Cosby heraufbeschwört, ist auch in der Präsidentschaftskampagne Barack Obamas zutage getreten. Zu Beginn spekulierten manche Kommentatoren, dass Obamas cosbyeske Appelle an die Eigenverantwortung ihn schwarze Stimmen kosten würden. Doch sollten ihm seine Ermahnungen, dass schwarze Kids von der PlayStation loskommen und schwarze Väter ihre Aufgabe erfüllen müssen, geschadet haben, so hat es sich nicht in den Umfragen niedergeschlagen. Tatsächlich ist diese Form der Rhetorik eine Art doppelt codiertes Spiel, denn sie erlaubt es Obama und Cosby, sowohl kulturell konservative Schwarze zu bedienen als auch jene Weißen, die das schwarze Amerika für eine Bastion der Dekadenz halten. (Eigentümlicherweise reagiert Cosby verhalten bis gereizt, wenn die Sprache auf Obama kommt. Als Larry King ihn fragte, ob er Obama unterstütze, blaffte er: »Stellen Sie Weißen diese Frage? (…) Ich wüsste zu gern, warum ausgerechnet dieser Kerl immer so hervorgehoben wird. Wie viele Amerikaner in den Medien nehmen ihn wirklich ernst, oder sehen sie in ihm nur ein braunes Vorzeige-Baby?« Das Gespräch endete damit, dass Cosby Bewunderung für Dennis Kucinich äußerte. Monate später ließ er mich abblitzen, als ich um seine Einschätzung der Kandidatur Obamas bat.)
Dass sich die Aufmerksamkeit von weißem Rassismus auf die schwarze Kultur verlagert hat, ist nicht so neu, wie einige Kommentatoren glauben. Als ich an jenem Juliabend in der St. Paul Church stand und Cosby zuhörte, erinnerte ich mich an das letzte Mal, als die Welt da draußen sich so anfühlte: im Sommer 1994, nachdem Louis Farrakhan den Millionen-Mann-Marsch in Washington angekündigt hatte. Auch Farrakhan tourte durchs Land und veranstaltete Men only-Meetings (allerdings in größerem Stil). Ich hatte ihn zu Hause in Baltimore gesehen, als ich in den Semesterferien von der Howard University heimgefahren war. Der Marsch selbst wurde zu einem kathartischen Erlebnis. Ich marschierte mit vier oder fünf anderen schwarzen Männern, und überall unterwegs standen schwarze Frauen auf Veranden oder am Straßenrand und schrien, klatschten, jubelten. Farrakhans Ansichten über Juden schienen uns größtenteils am Thema vorbeizugehen; was verfing, war die Gelegenheit, uns unserer Menschlichkeit und Männlichkeit zu vergewissern, indem wir die Mall entlangmarschierten und uns nicht benahmen, als kämen wir gerade aus St. Quentin. Wir lebten im Schatten der Crack-Ära der Achtziger. So viele von uns hatten im Gefängnis gesessen oder waren auf dem Weg dorthin. So viele von uns waren Väter nur in biologischer Hinsicht. Wir glaubten uns abgestempelt und klammerten uns an den Marsch als öffentliches Statement: Es war an der Zeit, erwachsen zu werden.
Schwarze Konservative haben seit der Wende zum 20. Jahrhundert aus diesem Brunnen verlorener schwarzer Würde geschöpft. Zum einen haben die klassischen schwarzen Nationalisten immer wieder das goldene Zeitalter eines schwarzen Afrikas aufgerufen, in dem sich mächtige Reiche erstreckten und jeder ein König war. Zum anderen haben populistische schwarze Konservative wie Cosby auf das schwarze Amerika vor 1968 verwiesen, als die schwarze Bevölkerung im Kampf vereint war: Männer waren Männer und ein Mädchen, das schwanger wurde und nicht heiratete, wurde schnell auf Opas Farm geschickt.
Was beide Visionen verbindet, ist der Eindruck, dass die schwarze Kultur in ihrer gegenwärtigen Form verfälscht und pathologisch ist. Was sie ebenfalls teilen, ist eine Verwurzelung im Mythos. Schwarze Menschen in den USA sind nicht die Nachfahren von Königen. Wir sind – und ich sage das mit großem Stolz – die Nachkommen von Sklaven. Wenn sich unser Kampf durch Erhabenheit auszeichnet, dann nicht, weil er in Märchen gründet, sondern in jener bescheidenen Herkunft und dem langen Weg, den wir seither zurückgelegt haben. Das Gleiche gilt für Träume von einer getrennten, aber edlen Vergangenheit, separate but noble. Die konservative Analyse Cosbys und großer Teile des schwarzen Amerikas nivelliert die Geschichte und glättet die Falten, die das schwarze Amerika seit Anbeginn charakterisiert haben.
Tatsächlich verwendete der Black Brain Trust vor einem Jahrhundert die gleichen Phrasen wie Cosby heute. Man war besorgt, dass die Sklaverei die schwarze Familie in ihrem Wesen zerstört habe, und schien von den gleichen Themen besessen – Kriminalität, ungezügelte Sexualität und allgemeiner moralischer Verfall –, die Cosby als Entwicklungen der jüngsten Zeit ausmacht. »Abgesehen von einer politischen Agenda richten sich die frühen Bemühungen der schwarzen Mittelschicht, auf die Rassentrennung zu reagieren, auf soziale Reformen«, sagt Khalil G. Muhammad, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität von Indiana. »Die National Association of Colored Women, Du Bois in seiner Studie The Philadelphia Negro, sie alle einte die Besorgnis, dass die Afroamerikaner sich der Welt nicht von ihrer besten Seite zeigten. Der Eindruck war, dass sie Verbrechen begingen und ihre Sexualität im Zaum halten müssten.« William Jelani Cobb, Professor für amerikanische Geschichte am Spelman College, fügt hinzu: »Dieselben Leute, die für soziale Reformen eintraten, machten andere schlecht, weil sie nicht Klavier spielten. Sie sahen sich oft als widerwillige Betreuer der weniger Gebildeten.«
Vor allem ein Argument Cosbys – dass viel von dem, was junge schwarze Männer heimsucht, seinen Ursprung in der schwarzen Kultur nach dem Ende der Rassentrennung habe – lässt sich nicht mit der Geschichte in Einklang bringen. Schon in den 1930er Jahren waren Soziologen besorgt, dass schwarze Männer gegenüber schwarzen Frauen ins Hintertreffen gerieten. In seiner klassischen Studie aus dem Jahr 1939, The Negro Family in the United States, argumentierte E. Franklin Frazier, dass die Urbanisierung die Fähigkeit der Männer untergrabe, für ihre Familien zu sorgen. 1965 – auf der Höhe der Bürgerrechtsbewegung – griff Daniel Patrick Moynihans Maßstäbe setzender Bericht »The Negro Family: The Case for National Action« dasselbe Thema auf.
Bisweilen scheint Cosby die Parallelen zwischen seinen Argumenten und denen, die in der vermeintlich ruhmreichen Vergangenheit vorgebracht wurden, bewusst nicht sehen zu wollen. Man denke nur an seine Probleme mit Rap. Wie kann ein bekennender Jazz-Fan sich nicht bewusst sein, dass die Musik seiner Jugend einst für ähnliche Klagen gesorgt hat? »Der erschöpfte Schauermann, der Gepäckträger, das Hausmädchen und der arme Liftboy, denen nach Entspannung verlangt und die im Jazz ein Tonikum für müde Nerven und Muskeln zu finden hoffen«, schrieb der Hobbyhistoriker J. A. Rogers, »sind nur zu sehr geeignet, auf den Bootlegger, den Spieler und den Halbweltler zu stoßen, die auf der Suche nach Opfern und auf der Flucht vor den Augen der Polizei unterwegs sind.«
Abgesehen von der zweifelhaften Idee, dass die schwarze Kultur einst ein Quell der Tugend war, bleibt immer noch der Vorwurf bestehen, dass die Kultur das Problem ist. Aber um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, muss man schon auf ziemlich tönernen Füßen stehen. Und das Hip-Hop-Argument ist besonders wacklig. Ronald Ferguson, ein Sozialwissenschaftler der Harvard University, hat gezeigt, dass die zunehmende Popularität von Hip-Hop zu Beginn der 1990er Jahre damit einherging, dass schwarze Jugendliche weniger Zeit mit Lesen verbrachten. Aber Gangsta Rap kann auch mit anderen Phänomenen in Beziehung gesetzt werden – viele davon positiv. In den neunziger Jahren, als die Popularität des Gangsta Rap geradezu explodierte, sanken die Schwangerschaftsrate unter schwarzen Teenagern und die Mordrate unter jungen schwarzen Männern. Sollen wir Dr. Dre jetzt einen Orden für seinen Bürgersinn verleihen?
»Ich weiß nicht, wie Kultur zu messen und ihre Auswirkungen zu überprüfen wären, und ich bezweifle, dass irgendjemand es weiß«, sagt Harry Holzer, Wirtschaftswissenschaftler der Georgetown University. »Es gibt das liberale Narrativ, dass begrenzte Möglichkeiten und Hürden zu Problemen bei der Arbeitsbeschaffung und zu kriminellem Verhalten führen, aber es gibt auch ein anderes Narrativ, das von Normen, Verhaltensweisen und Gegenkultur handelt. Letzteres lässt sich statistisch nicht beweisen, was nicht bedeutet, dass es nicht dennoch zutreffen könnte.« Holzer glaubt, dass beide Argumente etwas Wahres enthalten und dass das eine das andere nicht ausschließt. In Ordnung. Doch es sei darauf hingewiesen, dass die Beweislast für eine strukturelle Ungleichheit erdrückend ist. 2001 schickte ein Rechercheur weiße und schwarze Bewerber auf Jobsuche in Milwaukee, wobei er ihnen nach dem Zufallsprinzip Vorstrafen zuteilte. Das Ergebnis war, dass ein weißer Mann mit Vorstrafen in etwa die gleichen Chancen auf eine Stelle hat wie ein schwarzer Mann ohne Vorstrafen. Drei Jahre später kamen Rechercheure in New York zu den gleichen Ergebnissen, unter wesentlich strikteren Bedingungen.
Die vorherrschende Meinung ist, dass solche Studien Balsam für die Seele schwarzer Menschen sind und es ihnen erlauben, sich weiter in Selbstmitleid zu ergehen. Tatsächlich trifft das Gegenteil zu – die liberale Erkenntnis, dass Schwarze nach Jahrhunderten des Kampfes immer noch Opfer allgegenwärtiger Diskriminierung sind, ist der ultimative kollektive Dämpfer. Es bedeutet, dass Afroamerikaner akzeptieren müssen, dass ihre Kinder immer »weniger als« sein werden, jedenfalls bis zu einem ungewissen Zeitpunkt in der Zukunft, an dem der weiße Rassismus auf wundersame Weise abklingt. Das ist weder die Art von Zukunft, die schwarze Menschen dringend herbeisehnen, noch ist sie ein besonders motivierendes Gesprächsthema.