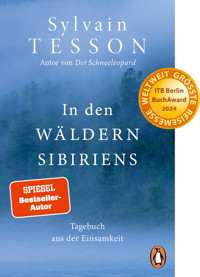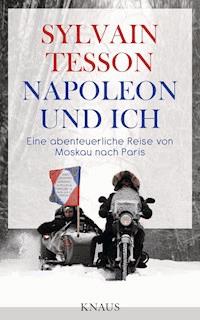19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ich war aufgebrochen, um mich in der körperlichen Anstrengung aufzulösen. Die weiße Querung wurde für mich zur absoluten Reise, zu einem Schweben in einer Idee von Landschaft.»Sylvain Tesson Vier Jahre lang, von 2017 bis 2020, unternimmt Sylvain Tesson in Begleitung des Bergführers Daniel du Lac jeden März eine kräftezehrende Skitour, um die gesamte Alpenkette von Menton in Frankreich aus über die Gipfel bis nach Triest in Italien zu queren. Gemeinsam bewältigen sie eine weitgehend unbegangene Strecke, deren Verlauf bisher nirgendwo verzeichnet ist, legen 1600 Kilometer in Schnee und Eis zurück, überwinden unter größten Anstrengungen 60.000 Höhenmeter. Jeder Tag birgt eine körperliche Grenzerfahrung, ist ein Angehen gegen die Kälte und die Müdigkeit, aber er ist auch Quell einer befreienden inneren Erfahrung inmitten der Alpen, deren wilde, winterliche Einheit und Kraft kaum jemand erfassen kann. «Ein schwindelerregendes Eintauchen in die geheime Schönheit verschneiter Gipfel. Eine poetische wie spirituelle Reise, die ganz der Schönheit gewidmet ist.»Augustin Trapenard, La Grande Librairie «Ein Buch, das dazu bestimmt ist, Ihren Blick zu reinigen!»Télématin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sylvain Tesson
Weiß
Über dieses Buch
«Ich war aufgebrochen, um mich in der körperlichen Anstrengung aufzulösen. Die weiße Querung wurde für mich zur absoluten Reise, zu einem Schweben in einer Idee von Landschaft.»Sylvain Tesson
Vier Jahre lang, von 2017 bis 2020, unternimmt Sylvain Tesson in Begleitung des Bergführers Daniel du Lac jeden März eine kräftezehrende Skitour, um die gesamte Alpenkette von Menton in Frankreich aus über die Gipfel bis nach Triest in Italien zu queren. Gemeinsam bewältigen sie eine weitgehend unbegangene Strecke, deren Verlauf bisher nirgendwo verzeichnet ist, legen 1600 Kilometer in Schnee und Eis zurück, überwinden unter größten Anstrengungen 60000 Höhenmeter.
Jeder Tag birgt eine körperliche Grenzerfahrung, ist ein Angehen gegen die Kälte und die Müdigkeit, aber er ist auch Quell einer befreienden inneren Erfahrung inmitten der Alpen, deren wilde, winterliche Einheit und Kraft kaum jemand erfassen kann.
Vita
Sylvain Tesson, geboren 1972 in Paris, ist Schriftsteller, Geograf und ein leidenschaftlicher Reisender. An eine erste Expedition nach Island schlossen sich weitere an: mit dem Fahrrad um die Welt, zu Fuß durch den Himalaya und zu Pferd durch die Steppe Zentralasiens. Für seine Reisebeschreibungen und Essays wurde Sylvain Tesson mit dem Prix Goncourt de la nouvelle und zuletzt mit dem Prix Renaudot für «Der Schneeleopard» ausgezeichnet.
Nicola Denis wurde mit einer Arbeit zur Übersetzungsgeschichte promoviert. Im niedersächsischen Celle geboren, lebt sie seit über zwanzig Jahren im Westen Frankreichs. Dort übersetzt sie neben Klassikern wie Alexandre Dumas oder Honoré de Balzac französische Gegenwartsautoren wie Sylvain Tesson, Olivier Guez, Philippe Lançon oder Éric Vuillard. 2021 erhielt sie für ihr übersetzerisches Gesamtwerk den Prix lémanique de la traduction. Im August 2022 erschien bei Klett-Cotta ihr literarisches Debüt Die Tanten.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «Blanc» bei Éditions Gallimard, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Blanc» Copyright © 2022 by Éditions Gallimard
Redaktion Bärbel Brands
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Conny Hepting/plainpicture
ISBN 978-3-644-01766-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motti
Karte
Vorwort Was tun?
2018, erstes Jahr Die Freiheit
Der erste Tag, 8. März
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Der fünfte Tag
Der sechste Tag
Der siebte Tag
Der achte Tag
Der neunte Tag
Der zehnte Tag
Der elfte Tag
Der zwölfte Tag
Der dreizehnte Tag
Der vierzehnte Tag
Der fünfzehnte Tag
Der sechzehnte Tag
Der siebzehnte Tag
Der achtzehnte Tag
Der neunzehnte Tag
Der zwanzigste Tag
Der einundzwanzigste Tag
Der zweiundzwanzigste Tag
2019, zweites Jahr Die Zeit
Der dreiundzwanzigste Tag, 18. März
Der vierundzwanzigste Tag
Der fünfundzwanzigste Tag
Der sechsundzwanzigste Tag
Der siebenundzwanzigste Tag
Der achtundzwanzigste Tag
Der neunundzwanzigste Tag
Der dreißigste Tag
Der einunddreißigste Tag
Der zweiunddreißigste Tag
Der dreiunddreißigste Tag
Der vierunddreißigste Tag
Der fünfunddreißigste Tag
Der sechsunddreißigste Tag
Der siebenunddreißigste Tag
2020, drittes Jahr Die Schönheit
Der achtunddreißigste Tag, 27. Februar
Der neununddreißigste Tag
Der vierzigste Tag
Der einundvierzigste Tag
Der zweiundvierzigste Tag
Der dreiundvierzigste Tag
Der vierundvierzigste und fünfundvierzigste Tag
Der sechsundvierzigste Tag
Der siebenundvierzigste Tag
Der achtundvierzigste Tag
Der neunundvierzigste Tag
Der fünfzigste Tag
Der einundfünfzigste Tag
Der zweiundfünfzigste Tag
2021, viertes Jahr Das Vergessen
Der dreiundfünfzigste Tag, 8. März
Der vierundfünfzigste Tag
Der fünfundfünfzigste Tag
Der sechsundfünfzigste Tag
Der siebenundfünfzigste Tag
Der achtundfünfzigste Tag
Der neunundfünfzigste Tag
Der sechzigste Tag
Der einundsechzigste Tag
Der zweiundsechzigste Tag
Vom dreiundsechzigsten bis zum siebenundsechzigsten Tag
Der achtundsechzigste Tag
Vom neunundsechzigsten bis zum einundsiebzigsten Tag
Vom zweiundsiebzigsten bis zum fünfundsiebzigsten Tag
Der sechsundsiebzigste Tag
Der siebenundsiebzigste Tag
Der achtundsiebzigste Tag
Der neunundsiebzigste Tag
Der achtzigste Tag
Der einundachtzigste Tag
Der zweiundachtzigste und dreiundachtzigste Tag
Der vierundachtzigste Tag
Der letzte Tag
Abschied vom Weiß
Zitathinweise
Für AJG, blond, weiß, blau
«Das Hochgebirg’ ein Hochgefühl.»
Lord Byron, Ritter Harold’s Pilgerfahrt
«Weiß also bedeutet Freud, Behagen, Wonn, und bedeutets nicht mit Unrecht, sondern mit vollem Recht und Würden.»
Rabelais, Gargantua und Pantagruel
«Die unendliche Vielfalt der Landschaften bewies uns ständig, dass wir noch nicht alle Formen des Glücks, der Versunkenheit oder der Traurigkeit erfahren hatten, die sie umfassen konnten.»
André Gide, Die Früchte der Erde
VorwortWas tun?
Es hatte geschneit. Wir ahnten es, noch bevor wir aus dem Fenster sahen. Der Himmel war verschwunden, die Welt war weiß. Ich hatte die Nacht neben einem Holzofen in einer Hütte verbracht. Mein Freund, der Bergführer Daniel du Lac de Fugères, lag neben einem Stapel Seilen.
Ich hatte Lust, aufzustehen und in die Stille vorzudringen. Das Weiß birgt seine Geheimnisse. Der Schnee diktiert der Erde die Gedanken des Himmels. Der Nebel aber mit seiner leichenhaften Färbung wirkt abschreckend auf jegliche Erkundungslust. Im Morgengrauen mag niemand eine Leichenhalle betreten. Dabei bräuchte man nur den ersten Schleier zu heben.
«Du Lac», sagte ich. «Warum versinken wir nicht einfach im Weiß? Da gibt es doch sicher etwas für uns zu finden.»
«Was tun?», hatte Lenin auf seinem Totenbett gefragt. Die Russen mochten diese Frage. Später sollten sie sich eine andere stellen: «Was haben wir getan?»
Die Geschichte hat es uns bewiesen: Die Zukunft ist niemals rosig. Die Geografie hingegen hält ihre Versprechen. Von ihr lernen wir, dass das Leben in der Bewegung besteht. Du Lac sagte: «Lass uns die Alpen auf Skiern überqueren!»
Seine Idee war folgende: Wir würden im Winter am Mittelmeer aufbrechen, dort, wo sich das Gebirge hinter Palmen verliert. Wir würden der Krümmung der Bergkette Richtung Nord-Ost bis nach Triest folgen, jener unmöglichen Stadt an der Adria, wo der Konvention zufolge die Alpen enden. Unterwegs würden wir uns möglichst nah an den Hauptkamm halten. Wir würden in Berghütten und Schutzräumen übernachten. Ein Ritt, nur auf Skiern, zwischen zwei Meeren. Nichts als Schnee! Wir würden Hunderte von Kilometern zu bewältigen haben, Meter um Meter. Das klang nach Sklavenarbeit. In Wirklichkeit war es ein Geschenk des Himmels: Glück ist, sich in etwas verbeißen zu können.
Beim Bergsteigen löst sich unvermittelt die Zeit auf, der Raum wird weit und der Geist tief ins Innere gedrängt. Der Glanz des Schnees hebt das Bewusstsein auf. Allein das Vorankommen zählt. Die Anstrengung löscht alles – Erinnerung und Reue, Wünsche und Schuldgefühle.
Doch was würde es mir nützen, diese Bergkette über Monate zu überqueren, was hätte ich davon, mir solche Strapazen anzutun? An jenem Morgen wusste ich es noch nicht: Es ging nicht darum, ein Bergmassiv zu überwinden, sondern mit einer Substanz zu verschmelzen. Vielleicht würde mein lang gehegter Traum in Erfüllung gehen, und ich könnte das Reisen zum Gebet werden lassen.
Ein Jahr später, an einem Märzmorgen, standen wir, beide mit einem Paar Skiern in der Hand, am Strand von Menton in der Nähe der italienischen Grenze. Von du Lac hatte ich einen Ausspruch von Paul Morand gelernt: «Anderswo ist ein schöneres Wort als morgen.»
Wir hatten die Frage «Was tun?» beantwortet, denn wir wussten, wohin wir wollten.
2018, erstes JahrDie Freiheit
Der erste Tag, 8. März[*]
Von Menton über den Col du Berceau nach Olivetta. 13 Kilometer und 1300 Höhenmeter.
Hinter uns lag Menton mit seinen gelben, an blumigen Abhängen gestaffelten Häusern. Wir kosteten das Wasser mit den Fingern. Ich leckte an meinem Zeigefinger, denn das Meer ist das Salz der Erde, als du Lac murmelte: «Lass uns gehen, wir sind nicht von hier.» Auch ich kannte Sätze, die zum Aufbruch passten. Von Rimbaud: «Ich werde mir ein Pferd kaufen und fortziehen.» Von Montaigne: «Man sollte stets gestiefelt sein und bereit zum Aufbruch.» Von Madame Despentes: «Aufstehen und abhauen.» Von Gide: «Eine der großen Regeln der Kunst: nicht verweilen.» Und der schönste, von Christus im Matthäus-Evangelium: «Komm und folge mir nach.»
Du Lac hatte seine Prinzipien: nie jemanden um etwas bitten, nie lange irgendwo bleiben, die Poesie in der Flüchtigkeit finden. «Gehen wir! Es gibt noch so viel zu sehen», einer seiner Lieblingssätze.
Unser Abenteuer sollte sich über vier Winter erstrecken, drei bis vier Wochen pro Jahr auf Skiern. Um gegen eine weltumspannende Lungenentzündung anzukämpfen, sollten die Regierungen die Gesellschaft bald unter Hausarrest stellen. Die «Bewegungsfreiheit» würde ein Politikum werden. Und «Aufstehen und abhauen» würde nicht mehr so einfach sein. In Frankreich wären wir eines Tages dazu angehalten, eine selbst ausgefüllte Genehmigung vorzuzeigen, um die Veilchen auf der gegenüberliegenden Böschung pflücken zu dürfen.
Die Treppen von Menton wurden zu einem Weg, der zu einer Piste, die zu einer Spur wurde. Die Feldsteine knirschten eine Musik, die ich kannte: die des Wanderns in der Garrigue. Der Kalkstein roch nach Licht. Die Seekiefern wichen ihren Verwandten, den Aleppokiefern, die an den Kampf (gegen den Abhang) gewöhnt sind. Wie viele Pässe würde es bis zur Adria geben? War es überhaupt möglich, sie alle zu bestreiten?
Nach 1300 Metern Aufstieg erreichten wir den Col du Berceau. Auf der anderen Seite, im Norden: Italien. Der Waldweg war weiß. Fünf Stunden zuvor hatten wir uns vom Meer verabschiedet und stießen bereits auf den ersten Schnee. In diesem Jahr war er bis in die tieferen Lagen gefallen. Wir sahen Spuren des italienischen Eichhörnchens. Vom Meer aufzusteigen ins Gebirge, symbolisierte die vor Milliarden von Jahren begonnene amphibische Anstrengung der Arten.
Dornen, Ruinen und Trockenmauern beim Abstieg zum Dorf Olivetta – diese kehligen Wörter sangen die Litanei der Welt von gestern, als allein die Bauern über dieses Gebiet herrschten. Wir übernachteten in einem Gasthaus, wo du Lac ein Fläschchen Grappa leerte. Ich trank keinen Alkohol mehr. Wehmütig sah ich meinem Kameraden zu und erzählte ihm von der russischen Art, sich auf den Schlaf einzustimmen:
Nach dem ersten Glas: brauchst du kein Wiegenlied!
Nach dem zweiten: brauchst du keine Bettdecke!
Nach dem dritten: brauchst du kein Bett!
Er legte sich mit seinen Visionen nieder, und ich, nüchtern, schlief allein. Das Meer, der Schnee, das Eichhörnchen: ein guter Tag.
Der zweite Tag
Von Olivetta über den Col de Brouis zum Col de Turini. 21 Kilometer und 1800 Höhenmeter.
Nachdem wir zu Fuß den Col de Brouis erklommen hatten, stiegen wir noch 700 Meter durch ein kleines Tal aus Kalk- und Gipsgestein auf. Sobald wir auf 1600 Metern mit dem ersten Schnee in Berührung kamen, schnallten wir unsere Skier an. Das war unsere Segnungszeremonie, ohne Prälaten, ohne Liturgie, ohne alles. Allein das Klacken der einrastenden Bindungen. Das Meer war immer noch zu sehen, schwarz, dort unten in seinem Loch.
Künftig gehörten wir dem Gebirge an. Der Schnee wäre alles: Verlobte, Leichentuch, Verheißung, sexuelle Reinheit und kosmische Kraft, Matrix der Vergebung und der Waschungen, von der wir uns nicht mehr würden trennen wollen.
Unser Ziel war die Militärpiste des Mercantour, ein ehemaliger Grenzweg. Wir mussten über Hänge warmen Schnees waten, die mit Weiden und Lärchen gespickt waren. «Der reinste Klebstoff!», sagte du Lac. Und die Bäume wie Staubwedel. Wir verrenkten uns, um unter den Ästen hindurchzukriechen. Dann erreichten wir den Kamm. Der Winter 2018 war schneereich gewesen. So viel Neuschnee war selten! Er quoll über die Felsvorsprünge. Das Gebirge? Glich einem Werk von Zuckerbäckern. Die Lawinen hatten Skiläufer mitgerissen. Täglich war im Radio zu hören: verschüttete Touristen! Verwandte und Freunde hatten mich gewarnt: «Fahr nicht! Dieses Jahr ist verhext. Du Lac ist verrückt!» Merkwürdig, die Zeichen der Zuneigung dieser Freunde, die einem am liebsten Handschellen anlegen würden …
Wir folgten der weißen Piste auf 2000 Metern Höhe. Kasernen und kleine Festungen wechselten einander ab wie Rastplätze. Wir betrachteten die schwarzen Ruinen inmitten des Märchenwaldes. Dieser Grat war einmal eine Schusslinie gewesen. Mitte des 18. Jahrhunderts und während der Revolution war dort leidenschaftlich getötet worden. Bonaparte hatte sich seine Sporen hier in Authion verdient. 1930 war befestigt, 1945 nachgebessert worden. In diesen Tannenwäldern für Schneeköniginnen hatten die Schlachten dazu gedient, die Grenzen einer Nation festzulegen, deren unbescholtene Bürger heute keine Grenzen mochten.
Im Jahr 2018 nahmen engagierte Bewohner des Mercantour und der Vallée de la Tinée Emigranten aus dem Sahel und aus Nahost auf. Hannibals Elefanten, Handelsreisende und italienische Schmuggler, die Flüchtlinge des 21. und der Wolf des 20. Jahrhunderts, alle kannten sie diese Passage. Jeder Schutzwall hat seine Schwachstellen. Patrouillierende Ordnungskräfte kontrollierten Schlepper und Wanderer. Am Tag zuvor waren wir im Wald Polizisten und Legionären begegnet. Zwischen zwei Patrouillen kümmerten sich die Mitglieder der Hilfsorganisationen um einzelne Männer und ganze Familien, die aus Syrien, Libyen, Afghanistan, aus dem Irak oder aus Mali gekommen waren. Die Unglücklichen hatten die Wüste und das Meer überquert, bis zum letzten Fallgatter. Hier, im Département Alpes-Maritimes, wurden sie mit offenen Armen empfangen. Diese Migranten migrierten nicht. Sie flohen für immer vor dem Heiligen Krieg. Allein die christlichen Ufer boten ihnen Zuflucht.
Du Lac und ich waren keine Kinder des Exils. Wir fanden am Abend eine offene Tür. Auf Skiern verfolgten wir einen Kindertraum: endloses Schuleschwänzen. Es gefiel uns, über unüberwindliche Stellen an unzugängliche Orte zu gelangen. Dieses Gymkhana war unser Spiel, und eine Grenze zu Fuß zu übertreten eine Übung, bei der wir die weißen Gipfel mit einem «ciao bella» begrüßten. Wir hatten Rückendeckung. Irgendwo wartete jemand auf uns – die Definition von Reichtum.
Um acht Uhr abends klopften wir im Lampenschein an die Tür eines Hotels am Col de Turini.
Am folgenden Morgen brachen wir wieder auf, nachdem wir die Erschöpfung des Vortags fortgewischt hatten. Die Nacht: eine Strafmilderung.
Der dritte Tag
Vom Col de Turini über die Pointe des Trois Communes und den Pas du Diable bis zum unbewirtschafteten Refuge des Merveilles. 12 Kilometer und 1000 Höhenmeter.
Heute morgen zeichneten die Kämme der Pointe des Trois Communes über den weißen Waldrändern ihre Sinuskurven zwischen Himmel und Erde: unten rosafarbener Lack, oben blaue Pastellfarbe. Den Wald (ein Mikado aus Kristall) verließen wir nach 300 Metern Aufstieg. Wir folgten einem Grat, nicht zu nah an der Kante, damit der Schneeüberhang nicht abbrach, aber auch nicht zu weit darunter, um keine Lawine auszulösen. Kurzum, mit Samtpfoten auf Fabergé-Eiern. An der Spitze dieser schmalen Klinge: das Mercantour.
Gegen Mittag kam Wind auf, Eisregen prasselte auf die Welt ein. Wochenlang würde ich mich jenem Wechsel von Anmut und Qual aussetzen. Immer wenn die Welt mir ihre Schönheit offenbarte, würde ich dieses Glück mit einer Ohrfeige bezahlen müssen!
Als ich mich nachmittags um vier an einem 45° steilen Abhang auf den Harscheisen meiner Skier zu halten und meinen Fausthandschuh fester zu ziehen versuchte, fiel mein Stock 100 Meter bergab zwischen die Felsen. Meine Alpenüberquerung auf Skiern begann mit einem Anfängerfehler. Skiwandern ist etwas für Vierbeiner. Auf drei Beinen kraxelte ich bis zu einer flachen Stelle, während du Lac, ohne ein Wort des Vorwurfs, in einem Korridor abstieg und auf der Suche nach dem Stock den Felsriegel umfuhr. Gedemütigt harrte ich aus. Die halbe Stunde wurde mir lang. Von den Böen gepeitscht, stand ich reglos da und malte mir aus, dass er nie wiederauftauchen würde. Plötzlich, der Wind brachte es inzwischen auf 80 Stundenkilometer, sah ich ihn, mit meinem Stock bewaffnet und weiten Schrittes, über die andere Seite herankommen. Ein paar Gämsen auf den Felsvorsprüngen des Pas du Diable beäugten diese Komödie. Unterhalb des Passes war ich wieder mit du Lac vereint.
Seit fünfzehn Jahren schon streiften wir zusammen durchs Gebirge. Wir hatten uns nach seiner Rückkehr aus Mali kennengelernt, wo ihm die Erstbesteigung einer Route des Schwierigkeitsgrades 8 in den Sandsteinwänden der «Hand der Fatima» gelungen war. Er hatte mir von Bergsteigern erzählt, die geglaubt hatten, als Erste auf einer dieser Felsnadeln angekommen zu sein, und dort auf Keramikscherben gestoßen waren: Demnach hatten es auch urzeitliche Afrikaner hinaufgeschafft! Mir gefielen seine eigensinnigen, nie abgedroschenen Geschichten. Du Lac vertrug viel Wodka, ich schlief damals nur wenig. Wir waren zusammen auf Gebäude geklettert. Wir hatten an Balkonen gebaumelt. Und uns immer gut verstanden.
Als Weltcupsieger im Klettern, internationaler Champion, Bergführer und Pionier extremer Kletterrouten prädestinierte ihn nichts dafür, sich mit mir anzuseilen. Doch wir teilten die Begeisterung fürs Klettern als bestes Mittel gegen die Langeweile. Man klettert, entflieht, und es zählt nicht, was nach der Rückkehr geschieht. Pierre Mazeaud – der erste Franzose auf dem Everest – hatte mit seinem gesellschaftspolitischen Programm eine Richtschnur für unser Leben formuliert: «Ich bin zu den Gaullisten übergelaufen und habe die Anarchie auf das Klettern verlegt.»
Klettern war eine Liturgie gelöster Gesten und fester Knoten. Auf den Granit- oder Kalkplatten dankten wir dem (noch immer nicht gestorbenen) Gott Pan. Schön ist alles im Tode noch, was auch erscheinet, hatte Priam auf den Festungsmauern von Troja verkündet. Göttlich ist alles, was leer ist, ergänzten wir. Das Gebirge war unsere Kirche. Unsere allabendliche Erschöpfung nach dem Klettern der Beweis für unseren Glauben. Konnte das Gefühl, am Rande eines Abgrunds lebendig zu sein, nicht den Namen Gott tragen?
Das Klettern ermöglicht es dem eiligen Menschen, Zeit zu gewinnen. Auf 300 Metern durchlebt er das ganze Spektrum der Gefühle – Freude, Angst, Hoffnung, Fülle. Alles im Zeitraffer!
Wir fühlten uns zu Hause an diesen Wänden, an denen wir nichts zu suchen hatten. Ich folgte du Lac überallhin. Ich sicherte ihn auf schwierigen Abschnitten, er half mir hinauf, wenn ich nicht weiterkam. Wir waren schnell, und diese Schnelligkeit schärfte unsere Sinne. Wir genossen es, uns an den Steilwänden abzuarbeiten und, sobald es dunkel wurde, unsere Schlafsäcke in eine Grotte zu legen, um dort den Wein zu trinken, den wir mit nach oben geschafft hatten. Das Feuer knisterte, Schatten tanzten, wir rauchten Zigarren – harmlose kleine Feste, mit denen wir die Tausendfüßler aufschreckten. Die Milchsäure ließ unsere Unterarme anschwellen. Und unter dem Gewölbe entfaltete du Lac die Energie seiner Fröhlichkeit. Aus seiner Tasche lugten Flaschen und Bücher. Seine Freundschaft war grenzenlos, sein Rücken stark. Es gab nichts Besseres als diese paläolithischen Höhlen nach Tagen in den Gärten der Lüfte. Nichts Besseres als jene Sternennächte, in denen wir unsere Gedanken auf der Glut räucherten. Manchmal lasen wir einander Gedichte vor. Und wer weiß, ob die Felsschichten der Grotten nicht unsere Gesänge speicherten?
Wir hatten Hunderte von Nächten in salzverkrusteten Quarz- oder Kalkhöhlen geschlafen. Im Jemen, über dem Arabischen Meer, hatten wir eine 500 Meter lange Route erschlossen und dabei mit der Taschenlampe Skorpione aufgescheucht. Auf der Baffininsel waren wir Tag und Nacht unter den Strahlen einer nie ersterbenden Sonne geklettert und auf dem Gipfel der Grands Charmoz in ein Gewitter geraten. Auf dem Pic de Bure hatten wir befürchtet, uns den Schädel zu spalten, und auf den Grandes Jorasses fürstlich genächtigt auf Vorsprüngen, die gerade mal so breit wie ein Nachttisch waren. Ob im Ahaggar, auf dem Mont Blanc, im Verdon oder an den Felswänden in Italien und Spanien – wir redeten uns ein, dass unser Heil in der Flucht liege. Und wir bereiteten den nächsten Streifzug vor, sobald unsere Schwüre, nie wieder damit anzufangen, vergessen waren. Wir brachen immer aufs Neue auf. Die Bewegung ist eine Lösung für alles.
Hinter dem Pas du Diable ließ der Wind nach. Wir liefen noch zwei Kilometer mit unseren Skiern über die glatt gestrichene Crème bis zum Refuge des Merveilles. Im März war die Hütte unbewirtschaftet. Wir schaufelten einen Weg bis zur Tür und schlüpften durch die Schneise in den Raum, der abendlichen Besuchern wie uns zur Verfügung stand. Den Ofen anzünden, die Temperatur auf 10 °C bringen, Suppe kochen: aufregende Tätigkeiten, die auch unter dem Begriff «Überleben» firmieren.
Sich nach einem teuflischen Tag ins Trockene betten: ein Wunder.
Der vierte Tag
Vom Refuge des Merveilles über drei Pässe bis zur Madone de Fenestre. 12 Kilometer und 1000 Höhenmeter.
Um acht Stunden lang über eine Landschaft zu schleifen, braucht es innere Ressourcen. Man rezitiert Gedichte, erinnert sich bestimmter Gesichter oder singt. In geografischen Gegenden, die wie mit dem Hobel bearbeitet erscheinen (Steppen, karge Hochebenen), hatte ich mir so schon über die Langeweile hinweggeholfen.
Eine unsere Beschäftigungen bestand darin, die Höhen wie eine Zeitleiste hinaufzuwandern und sie mit geschichtlichen Daten zu assoziieren. Wir bastelten uns eine eigene Chronologie. Die bunte Zusammenstellung der Ereignisse machte den Mangel an Genauigkeit wett. Wenn wir auf 800 Metern starteten, entrichteten wir einen Gruß an Karl den Großen. Auf 1100 Metern setzten sich, hoch zu Ross, die Ritter der Tafelrunde zu uns. Auf 1500 Metern waren wir in der Neuen Welt angelangt, auf 1700 herrschte Ludwig XV. Ihm folgte Napoleon auf 1800 Metern, und danach kamen, dicht beieinander, Victor Hugos Exil, die Belle Époque, der Tod Apollinaires, der armenische Völkermord, die Aéropostale, der Jom-Kippur-Krieg sowie die Befreiung von Palmyra. Jenseits von 2018 wären wir dann im Bereich der Science-Fiction. Außerdem würden wir unweigerlich auf einen Pass stoßen, über den es wieder abzusteigen gälte: Die Menschheitsgeschichte ist kein endloser Lauf zum Gipfel. Irgendwann geht es, in der Geschichte wie im Gebirge, für alle wieder bergab. Das Refuge des Merveilles befand sich auf 2110 Metern Höhe. Jenseits von Stanley Kubrick.
Bis zur Madone de la Fenestre, einem hochgelegenen Weiler, der von einem einsamen Hüttenwirt gehütet wurde, waren drei Pässe zu überqueren. Unsere letzten hundert Meter hatten es in sich. Sobald ein Abhang eine Neigung von über 40° aufwies, mussten wir messerscharfe Harscheisen aus Aluminium an den Skiern befestigen, die sich im Schnee festkrallten. Es war, wie über Porzellan zu kratzen. Du Lac eroberte die Steilhänge in Zickzacklinien, indem er sie in kurzen und schnellen Kehren erklomm. Mit seinen Stöcken vollführte er heuschreckenartige Choreografien. Er war ein Meister der Spitzkehren. «Die Begeisterung des Bekehrten!», brüllte ich ihm hinterher. Ich folgte seiner Spur. Die Steilhänge lösten Panik in mir aus. An Felswänden empfand ich nie auch nur den geringsten Schwindel. Doch in den vereisten Draperien legte sich die Perspektive in Falten: Die Vorstellung abzurutschen ist schlimmer als die abzustürzen.
Dann erreichten wir den Pass, mussten die Skier abschnallen, die Harscheisen einpacken, die Stöcke richtig einstellen, die Seehundfelle abziehen und falten, sodass sie in den Rucksäcken warm blieben, dann die Skier für die Abfahrt fixieren und die Jacken abdichten: meine Handgriffe für die kommenden Wochen. Ich hoffte, sie würden zu Reflexen werden. Du Lac nannte diese Betätigungen «Übergänge». So wechselten wir zwischen Kehren und Übergängen. Ein modernes Lebensprogramm. Unsere Handgriffe erforderten eine gewisse Kontrolliertheit. Ich verhedderte mich in mir selbst. Mit meiner chaotischen Schlampigkeit hielt ich du Lac auf. Er hatte immer alles zur Hand, was er brauchte. Sich zu organisieren ist eine Kunst. Mir blieben noch hundert Tage, um sie zu vervollkommnen.
Vom Pas de Colomb aus öffnete sich die Vallée de la Tinée. Dort war ich drei Jahre zuvor elendig humpelnd eingetroffen. Damals versuchte ich gerade, mich von einem Unfall zu erholen, der mich etwas Wertvolleres als das Leben gekostet hatte: meinen Lebensmut! Die Rückeroberung meiner selbst hatte ich «Die schwarzen Wege» genannt und dafür drei Monate lang vom Mercantour bis zum Cotentin dornige Pfade beschritten. Die Kräfte waren zurückgekehrt, und in La Hague, oben auf den Steilfelsen, hatte ich all meine Traurigkeit ins Meer geworfen: «Vorbei, der Tod!»
Dieses Mal brach ich ins Weiß auf. Und vertraute auf das Substanzielle dieser Farbe – auf dass sie mich mit Freude erfüllte. Der Aufenthalt in Schneelandschaften ist ein Aderlass der Seele. Man atmet das Weiß, zieht ins Licht. Die Welt explodiert. Man saugt den Raum in sich auf. Und dann erhellt sich das Sein durch die Klärung des Blicks.
Unterhalb des Passes war die Madone de Fenestre in ihrer romanischen Gestalt zu entdecken: eine Kapelle inmitten einer kleinen Ansammlung von Häusern. Vor dem Abstieg deutete du Lac mit einem präzisen Fingerzeig auf eine ungewisse Stelle: «Und morgen sind wir dort drüben.»
Unter dem Schnee zieht sich die Welt zurück. Es bleiben nur wenige chinesische Pinselstriche. Durch den weißen Traum waren Spitzen, Wände, Kämme und Vorsprünge der Berge auf ihre expressiven Linien reduziert. Der Schnee hebt hervor, was er berührt, er ist Schönheit. Rein offenbart er, was genügt. Magisch füllt er die Leere nach einem unsichtbaren Prinzip, löscht die Unvollkommenheit, bewahrt das Hervorspringende. Die Weiße entschuldigt alles Nutzlose – indem sie es verbirgt.
Ich war losgezogen, um mich in den Strapazen zwischen den angedeuteten Formen zu vergessen. Die weiße Durchquerung sollte für mich die Reise schlechthin werden: das Schweben in einer Vorstellung von Landschaft.
Wochenlang würden du Lac und ich durch einen Nicht-Ort im Herzen der Ruhe gleiten. Ebenso gut hätte ich auf einem Segelboot den Ozean befahren können. Ich hätte in blauen Ängsten geschmort. Tage der Flaute hätten mir ein ähnliches Gefühl der Entstofflichung vermittelt. Doch ich hätte das Ruder in der Hand halten müssen, und ich saß nicht gern still. Ich bevorzugte die Disziplin des Skiwanderns: sich lange und ausdauernd abmühen, gelegentlich vorwärtsgleiten, gelegentlich stürzen.
Der fünfte Tag
Von La Madone de Fenestre über den Pas des Ladres nach Boréon. 8 Kilometer und 500 Höhenmeter.