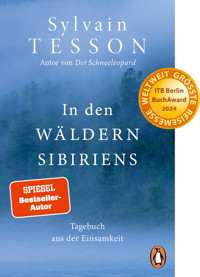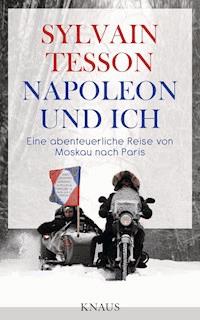9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gemeinsam mit dem Fotografen Vincent Munier reist der Abenteurer und Schriftsteller Sylvain Tesson nach Tibet, um sich auf die Suche nach einem der seltensten Tiere dieser Erde zu begeben - dem Schneeleoparden. Ob sie dem Tier begegnen werden? Ungewiss. Auf über 5000 Metern, fernab vom Lärm der Zivilisation, hinterfragt Tesson eine Welt, in der kaum noch Raum bleibt für das Ungebändigte und die Schönheit der Natur. Eine meditative Reise in die weiße Stille des Himalaya, eine Lektüre gegen die Hektik unseres Alltags und die Zerstörung der Welt. Entstanden ist ein aufrüttelndes, preisgekröntes, kraftvolles Werk, dessen Sog man sich nicht entziehen kann. «Der Schneeleopard» war das erfolgreichste französischsprachige Buch des Jahres 2019.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Sylvain Tesson
Der Schneeleopard
Über dieses Buch
«Es gibt ein Tier in Tibet, dem ich seit sechs Jahren nachstelle», sagte Munier. «Es lebt auf der Hochebene. Man muss eine lange Annäherung in Kauf nehmen, wenn man es zu sehen bekommen will. Ich fahre diesen Winter wieder hin, komm doch mit.»
«Welches meinst du?»
«Den Schneeleoparden.»
«Ich dachte, der sei ausgestorben.»
«Er tut nur so.»
Gemeinsam mit dem Fotografen Vincent Munier reist der Abenteurer und Schriftsteller Sylvain Tesson nach Tibet, um sich auf die Suche nach einem der seltensten Tiere dieser Erde zu begeben – dem Schneeleoparden. Ob sie dem Tier begegnen werden? Ungewiss. Auf über 5000 Metern, fernab vom Lärm der Zivilisation, hinterfragt Tesson eine Welt, in der kaum noch Raum bleibt für das Ungebändigte und die Schönheit der Natur. Eine meditative Reise in die weiße Stille des Himalaya, eine Lektüre gegen die Hektik unseres Alltags und die Zerstörung der Welt. Entstanden ist ein aufrüttelndes, preisgekröntes, kraftvolles Werk, dessen Sog man sich nicht entziehen kann. «Der Schneeleopard» war das erfolgreichste französischsprachige Buch des Jahres 2019.
Eine Reise in die weiße Stille der Bergwelt Tibets, eine Suche nach dem, was bedroht ist und nicht verschwinden darf.
Vita
Sylvain Tesson, geboren 1972 in Paris, ist Schriftsteller und ein großer Reisender. Er fuhr mit dem Fahrrad um die Welt und unternahm monatelange Expeditionen – durch den Himalaya, zu Fuß von Sibirien nach Indien und immer wieder nach Zentralasien. Für seine Reisebeschreibungen und Essays wurde er mit d em Prix Goncourt de la nouvelle und zuletzt mit dem Prix Renaudot für «Der Schneeleopard» ausgezeichnet.
Nicola Denis hat über die Geschichte der Übersetzung ihre Doktorarbeit geschrieben. In Celle geboren, lebt sie seit über zwanzig Jahren im Westen Frankreichs. Dort übersetzt sie neben Klassikern wie Alexandre Dumas oder Honoré de Balzac französische Gegenwartsautoren: Sylvain Tesson, Olivier Guez, Philippe Lançon und Éric Vuillard.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «La panthère des neiges» bei Éditions Gallimard, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«La panthère des neiges» Copyright © 2019 by Éditions Gallimard, Paris
Redaktion Barbara Hoffmeister
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Vincent Munier
Copyright © Marie Amiguet, für die Abbildung auf Seite 2
Copyright © Vincent Munier, für die Fotografie auf Seite 135
ISBN 978-3-644-00855-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Karten
Vorwort
Erster Teil Die Annäherung
Das Motiv
Das Zentrum
Der Kreis
Der Yak
Der Wolf
Die Schönheit
Die Mittelmäßigkeit
Das Leben
Die Anwesenheit
Die Einfachheit
Die Ordnung
Zweiter Teil Der Vorplatz
Die Entwicklung der Lebensräume
Das Einmalige und das Vielfältige
Instinkt und Vernunft
Erde und Fleisch
Dritter Teil Die Erscheinung
Nichts als die Tiere
Die Liebe auf den Abhängen
Die Liebe im Wald
Eine Katze in der Schlucht
Die Künste und die Tiere
Die erste Erscheinung
Sich in die Raumzeit legen
Worte für die Welt
Der Pakt der Entsagung
Die Kinder des Tals
Die zweite Erscheinung
Der Anteil der Tiere
Das Yakopfer
Die Angst vor der Dunkelheit
Die dritte Erscheinung
Im Einverständnis mit der Welt
Die letzte Erscheinung
Die ewige Wiederkunft der ewigen Wiederkunft
Die geteilte Quelle
In der Ursuppe
Vielleicht zurückkehren!
Der Trost der Wildnis
Die erdabgewandte Seite
Bildband-Hinweis
Zitathinweise
Für die Mutter eines Löwenjungen
«Die Weibchen sind insgesamt mutloser als die Männchen, abgesehen vom Bär und vom Leoparden; bei diesen hält man die Weibchen für mutiger.»
Aristoteles
Historia animalium
Vorwort
Wir hatten uns an einem Ostersonntag kennengelernt, bei der Vorführung seines Films über den Äthiopischen Wolf. Er sprach über die Ungreifbarkeit der Tiere und über die oberste Tugend: die Geduld. Er berichtete von seinem Leben als Tierfotograf und beschrieb, was auf der Lauer alles zu beachten sei. Eine ungewisse, subtile Kunst, bei der es sich in der Natur zu tarnen galt, um auf ein Tier zu warten, dessen Kommen mehr als ungewiss war. Die Wahrscheinlichkeit, unverrichteter Dinge zurückzukehren, war hoch. Diese Bereitschaft zur Ungewissheit erschien mir äußerst nobel – und genau deshalb antimodern.
Würde ich, ein leidenschaftlicher Läufer und Redner, mich wirklich stundenlang still verhalten können?
Zwischen Brennnesseln versteckt, gehorchte ich Munier: kein Geräusch, keine Bewegung. Atmen durfte ich – das einzige Zugeständnis. In der Stadt hatte ich es mir angewöhnt, zu allem meine Meinung zu sagen. Das Schwierigste war es also, den Mund zu halten. Zigarren waren verboten. «Rauchen können wir später, auf einer Böschung am Ufer. Bei Nacht und Nebel!», hatte Munier gesagt. Die Aussicht, an der Mosel eine Havanna zu schmauchen, machte die Position des liegenden Spähers erträglich.
In den Hainbuchen tönten die Vögel in der Abendluft. Das Leben schäumte über. Und doch vermochten die Vögel dem Geist des Ortes nichts anzuhaben. Als Teil dieser Welt störten sie deren Ordnung nicht. Pure Schönheit. Hundert Meter entfernt der Fluss. Über ihm Geschwader fleischfressender Libellen. Am westlichen Ufer ging der Baumfalke auf Raubzug. Stolzer Flug, präzise, tödlich – wie ein Stuka.
Doch keine Zeit für Ablenkung: Aus dem Bau kamen zwei ausgewachsene Tiere.
Bis in die Abendstunden eine Mischung aus Anmut, Komik und Autorität. Gaben die beiden Dachse ein Signal? Auf einmal tauchten vier Köpfe auf, Schatten huschten aus den Gängen. Das Spielen in der Dämmerung nahm seinen Lauf. Wir hatten uns in zehn Meter Entfernung postiert, die Tiere bemerkten uns nicht. Die jungen Dachse balgten miteinander, spielten auf dem Erdwall, kullerten in den Graben, bissen einander in den Nacken und bekamen von einem Erwachsenen, der in diesem Abendzirkus für Disziplin sorgte, eine Schelle verpasst. Der schwarze mit den drei elfenbeinfarbenen Zügeln im Pelz verschwand unter dem Laub, bevor er ein Stückchen weiter wieder hervorkam. Die Tiere übten für ihre Streifzüge über die Felder und an den Ufern. Es war ihr Aufwärmtraining für die Nacht.
Manchmal näherte sich einer der Dachse und zeigte sein längliches Profil, war dann, nach einer raschen Kopfbewegung, von vorn zu sehen. Die dunklen Streifen, in denen die Augen saßen, bildeten zwei traurige Rinnsale. Als er noch weiter herankam, konnten wir die kraftvollen, nach innen gewölbten Pfoten des Sohlengängers sehen. Die Krallen hinterließen im Boden Frankreichs diese kleinen Bärenabdrücke, die ein in seinem Urteil eher ungeübter Menschenschlag als «Schädlingsspuren» einordnete.
Zum ersten Mal verhielt ich mich in Erwartung einer Begegnung derartig ruhig. Ich erkannte mich selbst nicht wieder! Bisher hatte ich mich zwischen der Republik Sacha und dem Département Seine-et-Oise bewegt und dabei drei Grundsätzen gehorcht:
Da das Unerwartete sich nie von selbst einstellt, muss man ihm nachjagen.
Die Bewegung fördert die Inspiration.
Die Langeweile rennt weniger schnell als ein eiliger Mensch.
Kurz, ich redete mir ein, dass zwischen der Distanz und der Bedeutsamkeit der Ereignisse ein Zusammenhang bestehe. Stillstand kam mir vor wie eine Generalprobe für den Tod. Aus Respekt vor meiner Mutter, die in ihrer Gruft am Seine-Ufer ruht, trieb ich mich rastlos herum – samstags in den Bergen, sonntags am Meer –, ohne darauf zu achten, was rings um mich geschah. Wie konnte es sein, dass man eines Tages, nach Tausenden von Reisekilometern, mit dem Kinn im Gras am Rand eines Grabens lag?
Neben mir fotografierte Vincent Munier die Dachse. Seine Muskeln verschmolzen unter der Tarnkleidung mit der Vegetation, sein Profil jedoch war im schwachen Licht noch zu erkennen. Ein scharfkantiges Gesicht, wie zum Befehlen bestimmt, eine Nase, die bei Asiaten für Belustigung sorgte, ein markantes Kinn und ein sanfter Blick. Ein gutmütiger Riese.
Er hatte mir von seiner Kindheit erzählt, von seinem Vater, mit dem er sich unter einer Fichte versteckte, um dem Erwachen des Königs beizuwohnen: dem Auerhuhn; der Vater lehrte den Sohn, was die Stille versprach; der Sohn entdeckte den Reiz von Nächten auf gefrorenem Boden; der Vater erklärte, dass ein plötzlich auftauchendes Tier die schönste Belohnung sei, die das Leben für die Liebe zum Leben bereithalte; der Sohn begann, sich allein auf die Lauer zu legen, entschlüsselte die geheimnisvolle Organisation der Welt, lernte, das Auffliegen eines Ziegenmelkers einzufangen; der Vater entdeckte die kunstvollen Fotografien des Sohnes. Der vierzigjährige Munier, der hier neben mir lag, war in jener Nacht in den Vogesen auf die Welt gekommen. Inzwischen war er der bedeutendste Tierfotograf seiner Zeit. Seine makellosen Bilder von Wölfen, Bären und Kranichen wurden in New York verkauft.
«Tesson, komm, wir beobachten Dachse im Wald», hatte er zu mir gesagt, und ich hatte eingewilligt, schließlich schlägt man die Einladung eines Künstlers in sein Atelier nicht aus. Er wusste nicht, dass tesson oder taisson auf Altfranzösisch Dachs (blaireau) bedeutet. Der Ausdruck überlebt heute noch im westfranzösischen und im picardischen Dialekt. Tesson geht auf eine Verballhornung des ursprünglich griechischen Wortes táxis zurück, von dem die Begriffe Taxonomie und Taxidermie abstammen, Letzteres die Kunst der Tierpräparation – bekanntlich häutet der Mensch gerne, was er gerade benannt hat. Auf französischen Militärkarten waren sogenannte tessonières eingetragen, Flurnamen, in denen die Erinnerung an Brandopfer weiterlebte. Der Dachs war auf dem Land verhasst, er wurde rücksichtslos ausgerottet. Man warf ihm vor, den Boden umzuwühlen und die Hecken zu durchbrechen. Er wurde ausgeräuchert und getötet. Verdiente er die Unerbittlichkeit der Menschen? Der Dachs war ein wortkarges Wesen, ein Tier der Nacht und der Einsamkeit. Er sehnte sich nach einem Leben im Verborgenen, herrschte über die Dunkelheit, mochte keine Besuche. Er wusste, dass der Frieden verteidigt werden wollte. Bei Einbruch der Dämmerung kam er aus seinem Bau und kehrte erst im Morgengrauen wieder zurück. Wie hätte der Mensch die Existenz eines Totems der Diskretion dulden können, das die Distanz zur Tugend und die Stille zur Ehrensache erhob? Auf zoologischen Schautafeln wurde der Dachs als «monogam und sesshaft» beschrieben. In etymologischer Hinsicht mochte ich mit ihm verbunden sein, seinem Wesen hatte ich mich nicht angepasst.
Es wurde dunkel, die Tiere schwärmten ins Dickicht aus, es raschelte. Munier musste meine Freude bemerkt haben. Für mich war dies einer der schönsten Abende meines Lebens. Ich war einer Truppe vollkommen selbstbestimmter Geschöpfe begegnet. Sie wenigstens wehrten sich nicht mit aller Kraft gegen ihre Natur. Über die Uferböschung kehrten wir auf die Straße zurück. Die Zigarren in meiner Tasche waren inzwischen zerbröselt.
«Es gibt ein Tier in Tibet, dem ich seit sechs Jahren nachstelle», sagte Munier. «Es lebt auf der Hochebene. Man muss eine lange Annäherung in Kauf nehmen, wenn man es zu sehen bekommen will. Ich fahre diesen Winter wieder hin, komm doch mit.»
«Welches meinst du?»
«Den Schneeleoparden.»
«Ich dachte, der sei ausgestorben.»
«Er tut nur so.»
Erster TeilDie Annäherung
Das Motiv
Wie bei Tiroler Skilehrern findet das Liebesleben des Schneeleoparden in weißer Landschaft statt. Im Februar wird er brünstig. Er ist in Pelz gekleidet und lebt im Kristall. Die Männchen kämpfen, die Weibchen sind willig, die Pärchen rufen einander. Munier hatte mich vorgewarnt: Wenn wir eine Chance haben wollten, ihn zu sehen, müssten wir ihn im Winter suchen, in vier- bis fünftausend Meter Höhe. Ich würde die Widrigkeiten des Winters mit den Freuden der Erscheinung kompensieren müssen. Auch Bernadette Soubirous hatte in der Grotte von Lourdes diese Technik angewandt. Die kleine Hirtin wird mit Sicherheit kalte Knie gehabt, aber für das Schauspiel einer Jungfrau im Strahlenkranz keine Mühe gescheut haben.
«Leopard», ein Name klingend wie Geschmeide. Doch nichts garantierte uns, dass wir tatsächlich einen Leoparden sehen würden. Die Lauer ist ein Wagnis: Sobald man den Tieren folgt, droht alles zu scheitern. Es gibt Menschen, die sich damit arrangieren und gerne warten. Dafür braucht es einen philosophischen Geist, der zur Hoffnung neigt. Leider war ich anders veranlagt. Ich wollte das Tier unbedingt sehen, auch wenn ich meine Ungeduld Munier gegenüber anstandshalber verschwieg.
Schneeleoparden wurden überall gewildert. Ein Grund mehr, die Reise anzutreten. Wir würden einem schutzlosen Wesen zu Hilfe eilen.
Munier hatte mir Fotografien von seinen bisherigen Reisen gezeigt. In dem Tier vereinten sich Stärke und Anmut. Lichtreflexe elektrisierten sein Fell, seine Beine liefen zu breiten Untertassen aus, der überdimensionale Schwanz diente als Pendel. Er hatte sich angepasst, um unbewohnbare Regionen bevölkern und Steilfelsen erklimmen zu können. Der Geist der Berge, der zu Besuch auf die Erde kommt, ein uralter Bewohner, den die menschliche Tollheit in die Randgebiete abgedrängt hatte.
Ich brachte jemanden mit dem Tier in Verbindung, eine Frau, die mich nie mehr irgendwohin begleiten würde: Mädchen der Wälder, Königin der Quellen, eine Freundin der Tiere. Ich hatte sie geliebt und hatte sie verloren. In meiner kindischen, unsinnigen Vorstellung verknüpfte ich die Erinnerung an sie mit einem unerreichbaren Tier. Ein banales Symptom: Sobald uns ein Mensch fehlt, nimmt die ganze Welt seine Gestalt an. Falls ich dem Tier begegnen sollte, würde ich ihr später sagen können, dass ich sie an einem Wintertag in der weißen Ebene getroffen hatte. Das war magisches Denken. Ich hatte Angst, lächerlich zu wirken. Vorerst verlor ich zu meinen Freunden kein Wort darüber. War in Gedanken allerdings ständig bei ihr.
Es war Anfang Februar. Um mein Gepäck zu erleichtern, beging ich den Fehler, meine gesamte Hochgebirgsrüstung anzulegen. So stieg ich in meiner Treckingjacke und meinen chinesischen Armeestiefeln der Marke «Langer Marsch» in der Pariser Banlieue in die Bahn zum Flughafen. Den Waggon besetzten schöne fulfuldische Ritter mit traurigen Gesichtern und ein Walache mit Akkordeon, der Brahms bearbeitete, doch ich zog sämtliche Blicke auf mich. Die Exotik hatte sich verschoben.
Das Flugzeug startete. Definition des Fortschritts (und der Trostlosigkeit): in zehn Stunden zurücklegen, was Marco Polo in vier Jahren durchmessen hatte. Als echter Mann von Welt stellte uns Munier einander in den Lüften vor. Ich begrüßte die beiden Freunde, mit denen ich einen Monat verbringen sollte: die gelenkige Marie, Muniers Verlobte, Tierfilmerin mit einer Leidenschaft für das Leben in der Wildnis und schnelle Sportarten, sowie Leo mit den weitsichtigen Augen, einer wirren Frisur und gedanklichem Tiefgang – ein Wortkarger also. Marie hatte einen Film über Wölfe, einen anderen über Luchse gedreht, beides Tiere auf Bewährung. Nun ein weiterer Film über ihre beiden Lieben: über die Leoparden und Vincent Munier. Zwei Jahre zuvor hatte Leo seine Doktorarbeit in Philosophie unterbrochen, um Muniers Adjutant zu werden. In Tibet brauchte Munier einen Laufburschen für die Einrichtung der Lauer, das Justieren seiner Ausrüstung und für die langen Abende. Da ich wegen meiner angeschlagenen Wirbelsäule nichts tragen durfte und weder ein kompetenter Fotograf noch ein erfahrener Spurenleser war, fragte ich mich, wie ich mich nützlich machen könnte. Mir oblag es, niemandem im Weg zu stehen und bloß nicht zu niesen, falls der Leopard sich zeigen sollte. Tibet wurde mir auf einem Plateau serviert. Zusammen mit einem großartigen Künstler, einer menschlichen Wölfin mit Lapislazuli-Augen und einem besonnenen Philosophen machte ich mich auf die Suche nach einem unsichtbaren Tier.
«Wir sind also die Viererbande», sagte ich, als das Flugzeug in China aufsetzte.
Wenigstens für die Kalauer wäre ich zuständig.
Das Zentrum
Wir waren im äußersten Osten Tibets in der Verwaltungsprovinz Qinghai gelandet. Die Stadt Yushu mit ihren grauen Fassaden lag auf rund 3700 Höhenmetern. Sie war 2010 von einem Erdbeben zerstört worden.
In nicht einmal zehn Jahren hatten die Chinesen mit monströser Entschlossenheit die Trümmer aufgeschüttet und fast alles wiederaufgebaut. Schnurgerade reihten sich die Straßenlaternen aneinander und erleuchteten ein vollkommen ebenmäßiges Betonraster. Geräuschlos rollten die Autos über die Schachbrettlinien. Die Kasernenstadt nahm die hereinbrechende weltweite Dauerbaustelle vorweg.
Wir brauchten drei Tage, um Osttibet mit dem Auto zu durchqueren. Unser Ziel war der Süden des Kunlun-Gebirges am Rande des Changthang-Plateaus. Munier kannte die wildreichen Steppen dort.
«Wir nehmen die Verbindungsstraße von Golmud nach Lhasa», hatte er im Flugzeug zu mir gesagt, «so erreichen wir Budongqan, ein Dorf an der Eisenbahnstrecke.»
«Und danach?»
«Danach fahren wir weiter nach Westen, an den Fuß des Kunlun-Gebirges, bis zum ‹Yak-Tal›.»
«Heißt das wirklich so?»
«Für mich ja.»
Ich machte mir Notizen in meine kleinen schwarzen Hefte. Ich musste Munier versprechen, in meinem Buch nicht die richtigen Ortsnamen zu verwenden. Diese Orte bargen ihre Geheimnisse. Wenn wir sie preisgäben, würden die Jäger sie plündern. Wir gewöhnten uns an, die Orte mit Namen einer poetischen, individuellen Geographie zu versehen, ausgefallen genug, um die Spuren zu verwischen, aber auch so bildreich, dass sie genau Auskunft geben konnten: Tal der Wölfe, See des Dào, Höhle des Mufflons. Ab jetzt sollte Tibet in mir als Karte der Erinnerungen verzeichnet sein, weniger präzise als die Atlanten, träumerischer, um die Zuflucht der Tiere zu erhalten.
Wir fuhren nach Nordwesten, durch Provinzen mit hoch aufragenden Bergmassiven. Ein Gebirgspass nach dem anderen – von den Herden abgeschälte Buckel in 5000 Höhenmetern. Der Winter malte vereinzelte weiße Tupfer über glatte, windgepeitschte Flächen. Spärlicher Firnschnee zog sich über die Aufschlüsse.
Wahrscheinlich musterten uns Raubtieraugen von den Bergkämmen, doch im Auto betrachtet man nur das eigene Bild in der Scheibe. Ich sah keinen Wolf, und es war ausgesprochen windig.
Die Luft roch nach Metall, ihre Härte lud zu gar nichts ein. Weder zum Herumstreifen noch zur Rückkehr.
Die chinesische Regierung hatte ihren alten Plan von der Kontrolle Tibets verwirklicht. Beijing befasste sich nicht mehr mit der Verfolgung der Mönche. Es gab effizientere Mittel als den Zwang, um ein Gebiet zu kontrollieren: Entwicklungshilfe und Raumplanung. Kaum sorgt der Zentralstaat für Komfort, erlischt die Rebellion. Und wenn es einen Bauernaufstand gibt, empören sich die Behörden: «Was? Eine Erhebung? Wo wir doch Schulen bauen?» Hundert Jahre zuvor hatte Lenin diese Methode mit seiner «Elektrifizierung des ganzen Landes» erprobt. Beijing wandte die Strategie seit den 1980er Jahren an. Der Wortschwall der Revolution hatte der Logistik Platz gemacht. Das Ziel war vergleichbar: der Zugriff aus dem Reich der Mitte.
Auf funkelnagelneuen Brücken führte die Straße über Wasserläufe. Telefonantennen krönten die Gipfel.